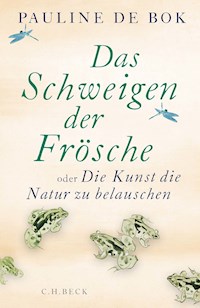
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Tiere und Pflanzen zu sehen und ihre vielen Stimmen zu hören, erfordert eine besondere Aufmerksamkeit. Die Schriftstellerin Pauline de Bok berichtet einfühlsam von 18 Monaten in der Natur, in denen sie Vögel, Insekten, Säugetiere und Amphibien beobachtet, im Wechsel der Jahreszeiten, aber auch in einem längerfristigen Wandel. Der Tümpel neben ihrem Haus trocknet aus, die Frösche verschwinden, andere Arten wandern ein. Ihr glänzend geschriebenes Buch kreist um die große Frage unserer Zeit, wie das Menschentier einen verträglichen Platz in der Natur finden kann. Meist wird die Natur von einem unsichtbaren Beobachter «von außen» gesehen, gefilmt, beschrieben. Pauline de Bok setzt dagegen auf teilnehmende Beobachtung, als Tier unter Tieren. In «ihrem» Biotop in Mecklenburg, wo sie seit zwanzig Jahren in einem ehemaligen Kuhstall lebt, beobachtet sie Geburt, Paarung, Sterben und Tod, Fressen und Gefressenwerden vieler Tiere, belauscht Hirsche, Spatzen, Ringelnattern und Kraniche. Ihre große Kunst besteht darin, sich dabei selbst als aktiven Teil dieses Biotops zu sehen, in dem sie einheimische Pflanzen schützt, einen kleinen Ersatztümpel für Schwalben und Insekten anlegt, Waschbären fängt und sich als Gärtnerin, Sammlerin und Jägerin in die Nahrungskette einreiht. Ihr Buch ist eine wunderbar lesbare Schule der Wahrnehmung, des Sehens, Hörens, Riechens und Registrierens anderer Lebewesen, die uns den Spiegel vorhalten als der Spezies, die dabei ist, das eigene Biotop zu zerstören.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
PAULINE DE BOK
Das Schweigen der Frösche
oder Die Kunst, die Natur zu belauschen
Aufzeichnungen aus einem Biotop im Wandel
Aus dem Niederländischen von Gerd Busse
C.H.Beck
Zum Buch
Meist wird die Natur von einem unsichtbaren Beobachter «von außen» gesehen, gefilmt, beschrieben. Pauline de Bok setzt dagegen auf teilnehmende Beobachtung, als Tier unter Tieren. In «ihrem» Biotop in Mecklenburg, wo sie seit zwanzig Jahren in einem ehemaligen Kuhstall lebt, beobachtet sie Geburt, Paarung, Sterben und Tod, Fressen und Gefressen-werden vieler Tiere, belauscht Hirsche, Spatzen, Ringelnattern und Kraniche. Ihre große Kunst besteht darin, sich dabei selbst als aktiven Teil dieses Biotops zu sehen, in dem sie einheimische Pflanzen schützt, einen kleinen Ersatztümpel für Schwalben und Insekten anlegt, Waschbären fängt und sich als Gärtnerin, Sammlerin und Jägerin in die Nahrungskette einreiht. Ihr Buch ist eine wunderbar lesbare Schule der Wahrnehmung, des Sehens, Hörens, Riechens und Registrierens anderer Lebewesen, die uns den Spiegel vorhalten als der Spezies, die dabei ist, das eigene Biotop zu zerstören.
Über die Autorin
Pauline de Bok lebt als freie Schriftstellerin in Amsterdam und Mecklenburg. Als Übersetzerin von «Tschick» ist sie die niederländische Stimme von Wolfgang Herrndorf. Für ihren Roman «Blankow oder Das Verlangen nach Heimat» (2009) wurde sie mit dem Annalise-Wagner-Preis ausgezeichnet. Bei C.H.Beck erschien von ihr bereits das vielbeachtete Buch «Beute. Mein Jahr auf der Jagd» (2018).
Inhalt
Der Frühling zögert
1. Der Tümpel ist trocken, als wäre kein Winter gewesen
2. Tieren lauschen, sie locken und loswerden
3. Die Landschaft vermaist, die Kraniche profitieren
4. Der Ölkäfer, das Schicksal des Damspießers und die Osterhasen
5. Zwanzig Frühlinge und meine große kleine Eiche
Die Natur explodiert
6. «Trinkt, Trinkt!», rufe ich allem zu, was lebt
7. Experiment Tümpelgrube
Den Sommer feiern
8. Ein Geständnis an den Laubfrosch
Die Lebenskraft schwindet
9. Storch und Mäuse stellen meine Tierliebe auf die Probe
10. Das Prinzip Schrumpfsprengung
11. Wie ich von einem Waschbären überlistet wurde
Spätherbst
12. Ist es der Buchdrucker, der den Wald verdirbt?
13. Die Kamerafalle, die digitale Falle und die Lebendfalle
Wo bleibt der Winter?
14. Der Wildschweinkopf knistert im Ofen
15. Der Tümpelgeist kehrt zurück
Der lange leere Frühling
16. Das Virus
17. Von Sommerzeitschnee, dem Pfeilstorch und Icarus
18. Mein Grüner-Daumen-Gemüsegarten war ein Hirngespinst
Hochsommer
19. Das Würmergezücht in der Wanne
Herbstjubel
20. Du bist ein kleines Wunder
Der Frühling zögert
1.
Der Tümpel ist trocken, als wäre kein Winter gewesen
Es gibt hier Stellen, wo ich nie hinkomme. Weil ich festen Boden unter den Füßen brauche. Weil ich kein Fell oder Federn habe und Wasser nicht einfach von mir abschütteln kann. Es durchnässt mir die Kleidung, bis sie mir an der Haut klebt, und läuft mir in die Stiefel. Weil ich nicht schnell laufen, gut klettern oder auffliegen kann, wenn Gefahr droht.
Ich habe mir ein Heim geschaffen, um es warm, trocken und sicher zu haben. Trotzdem möchte ich manchmal wie die anderen Tiere sein, mich mit dem begnügen, was da ist, draußen zu Hause sein. Ich habe mich umgeben mit Hilfsmitteln, mit Prothesen, habe mir viele kluge Tricks ausgedacht – na ja, nicht ich, aber meine Art, ich bin ein Rädchen in einer geölten Maschine und nenne mich frei.
Ich habe noch nie ein Schlammbad genommen, mich niemals an einem kühlen Morgen im Sommer, wenn der Boden warm ist, in einem dünnflüssigen Brei aus lehmiger Erde gewälzt. Ich fürchte mich vor scharfen Steinen oder Stacheln, vor Blutegeln und Tieren, die versuchen, in mich einzudringen. Ich bin kein Wildschwein, das sich im Schlamm suhlt, um die Parasiten loszuwerden, die in seinem Fell herumkrabbeln, dem manchmal all das Leben, das auf ihm mitlebt, zu viel wird. Wenn es dann träge aus dem Bad steigt, legt es sich in seinem triefenden Schlammkleid in die Sonne, bis die Haut unter seinem Fell brennt. Es steht auf, drückt seinen plumpen Leib kräftig gegen einen Baum und fängt an, sich an der Rinde zu reiben, gegen und mit dem Strich seiner Haare, so lange, bis der Panzer aus getrockneter Erde zerbröckelt und mit den Tierchen und allem aus seinem Fell fällt. Es muss herrlich sein, seinen Körper an so einem Stamm abzubürsten, ich vertrage nicht mal ein raues Handtuch, sogar damit reibe ich mir die Haut schon rot.
Ich habe keine Ahnung, wie es sein würde, wenn ich dicht behaart wäre, ich kann mir mich selbst nicht ohne nackte Haut vorstellen, ich bin meine nackte Haut, ungeschützt, kein wildes Tier. Was, wenn der Schlamm mich verschlingen wollte und ich nicht die Kraft hätte aufzustehen? Moor, Morast, das weiß jeder, saugt sich an deinen Füßen fest, zerrt an deinem Körper, verschluckt dich. Blubb blubb, weg ist man, erstickt im Schlamm.
Die ganze Fahrt von Amsterdam hierher war ich unruhig, ich wollte unbedingt noch bei Tageslicht ankommen, wollte wissen, in welchem Zustand ich das Land und das Grundstück vorfinden würde – und den Tümpel, vor allem den Tümpel.
Die Tage bis Mitte März zählend, hatte ich täglich nach dem Wetter in Mecklenburg geschaut, das beschäftigte mich mehr als das Wetter zu Hause, auch wenn ich wusste, wie eng beides zusammenhing. Das niederländische Seeklima unterscheidet sich nur wenig vom Klima hier in der norddeutschen Tiefebene, die Ostsee ist keine hundert Kilometer Luftlinie entfernt, die Nordsee etwa dreihundert.
Die Mecklenburger Jahre haben eine Wetterfanatikerin aus mir gemacht. Obwohl ich längst weiß, dass das Wetter dort einfach etwas später oder etwas früher kommt als in den Niederlanden und bei Ostwind etwas länger anhält. Und wenn alles wieder einmal anders ist als vorhergesagt, behaupten wir hier zwischen den Seen der Endmoränenlandschaft gern, dass das durch unser Mikroklima kommt. Damit immer alles stimmt.
Aber das ist nicht so, nicht mehr, nichts scheint mehr zu stimmen. Die Extreme werden extremer, die Bandbreite ändert sich schneller und schneller. Wir fühlen uns überrumpelt, verlieren die Kontrolle. Wir haben immer geglaubt, das Klima würde sich so langsam ändern, dass wir es kaum bemerken, dass es Statistiken bleiben, Grafiken, dass wir genug Zeit hätten, uns anzupassen, Generation um Generation, dass es von selbst gehen würde.
Es war der Tümpel, der mich alarmierte, der Weidentümpel gleich hinter unserem Kuhstall. Ich hatte ihm nie viel Aufmerksamkeit geschenkt, es war eine der Stellen, wo ich selten hinkam, eigentlich nur, wenn eine dicke Eisschicht darauf lag, ging ich mal darüber hinweg. Sobald es zu tauen begann und das Schneewasser von den Äckern floss, füllte sich der Tümpel. Ab und zu, wenn der Sommer heiß und trocken gewesen war, blieb nur an der tiefsten Stelle eine schlammige Pfütze übrig. Irgendwann hatten wir mal vorgehabt, den Tümpel vertiefen zu lassen, ihn schöner zu machen, aber das war nur so eine Idee gewesen. Er war gut so, wie er war. Er war nicht für uns da, sondern um seiner selbst willen. Und für die Tiere und alles, was dort wuchs.
Aber diesmal war die Frage, ob überhaupt Wasser in dem Tümpel stand, im März, Gott bewahre.
Ich warf einen Blick auf den Tacho, der auf hundert zurückgefallen war, und trat aufs Gaspedal. Mir kam ein Foto in den Sinn, gut ein Jahr war das her, unsere Freunde vom Prenzlauer Berg – die ich Mitte der Achtzigerjahre in der DDR kennengelernt hatte und die während des Sommers meistens im Bauernhaus auf unserem gemeinsamen Vorwerk wohnen – hatten es kurz nach Neujahr gemailt. Darauf war ein kleiner Holzzaun zu sehen, komischerweise im Wasser. Es dauerte einen Moment, bis ich es kapiert hatte: Es war unser eigener Zaun vor dem kleinen Kartoffelacker. Der Tümpel war über die Ufer getreten, das hatte ich noch nie erlebt.
Nicht lange danach konnte ich es mit eigenen Augen sehen, es war Mitte Februar, und es hatte leicht geschneit, die gefrorenen Wasserspiegel lagen weiß gepudert in der Landschaft. Der Tümpel hatte unseren Garten zum Kuhstall hin zur Hälfte unter Wasser gesetzt, bis zu der kleinen Eiche, keine zehn Meter von unserer Gartentür entfernt. Die dünnen Stämme der Sauerkirschbäumchen ragten schwarz aus der Eisfläche empor.
Der Winter war spät gekommen, und er war streng gewesen, bis tief in den März hinein hatte ich mit Boom lange Touren gemacht, wir waren quer über die Seen gelaufen, durch die hart gefrorenen Sumpfgebiete gestreunt, hatten die Landschaft von Stellen aus entdeckt, an denen wir nie zuvor gewesen waren. Und ich war nur allzu gern bereit gewesen, dieses Wetter, diese winterliche Landschaft, als den neuen Status quo zu akzeptieren.
Im Spätsommer hatte ich voller Vertrauen den neuen, aus Weidenzweigen geflochtenen Entenkorb in den Tümpel gestellt. Zum ersten Mal ging ich einfach so hinein, sogar ohne Stiefel. Die Sommermonate waren heiß und trocken gewesen, der Tümpel war nahezu ausgetrocknet. Nach dem Winter würde er wie immer wieder mit Wasser gefüllt sein, und dann hätte ich im Frühjahr junge Enten, Küken. Ich schlug vier Eisenrohre in den Boden, jeweils zwei schräg zueinander, steckte dicke Bambusstöcke hinein, so dass sie sich überkreuzten, und befestigte dazwischen den Entenkorb, mit der Öffnung nach Nordosten, zur windabgewandten Seite. Ich hatte Glück, das war genau die Richtung der Gartentür, so dass ich das junge Leben gut würde beobachten können. In den Korb legte ich schon mal ein kleines Nest aus Heu.
Die Südwestseite war durch einen hohen Wall schön abgeschirmt. Die Enten würden Monate Zeit haben, sich an den Nistplatz zu gewöhnen. Jetzt brauchte man nur noch auf den Herbst mit seinem Regen zu warten, auf den Winter mit seinem Schnee und das schmelzende Eis im Frühjahr. Ich sah den Korb schon zwischen den Stöcken über dem Wasser schweben, hörte die Enten schnattern. Der Korb und das Wasser würden ihre Brut gegen Raubvögel, Krähen und Elstern schützen, und gegen Marder, Füchse, Waschbären und Marderhunde. Auch wenn ich mir bei den Waschbären nicht sicher war. Aber wer sich auch daran zu schaffen machte, ich würde es ganz aus der Nähe beobachten können, mit meinem Fernglas, vom Haus aus.
Doch der Herbstregen blieb aus, und der Winter war seltsam mild und trocken. Mir begann zu dämmern, dass der Tümpel mir erzählt, wie es um mein Biotop steht. Denn er ist der Quell. Aus dem Wasser entspringt alles, was lebt.
Neben mir auf dem rechten Fahrstreifen krochen die Lastwagen wie eine erschöpfte Kamelkarawane dahin, und wir in unseren Pkws schoben uns wie Esel etwas schneller an ihnen vorbei. Anhalten, anfahren, eine Rettungsgasse bilden, bremsen, in den Spiegel schauen, links hinter mir hatte sich eine Lücke gebildet, gleich ausnutzen und einscheren, gut so, auf der etwas schnelleren Fahrspur, nein, doch nicht schneller. Die anderen belauern, mir ein Leben mit ihnen vorstellen, auf das Lenkrad trommeln, rechnen, wie viele Kilometer, wie viele Stunden, wie viele Staus. Das Radio meldete eine verlängerte Fahrtzeit von einer guten Dreiviertelstunde, ein Unfall war gerade passiert, also ein Stau, der anwuchs. Bremsen, Stopp.
Vor mir stiegen einzelne Fahrer aus, um die Gliedmaßen zu strecken. In meinem Kopf rechnete es schon wieder. Die Sonne ging dort drüben um Viertel nach sechs unter, dann war es um halb acht dunkel. Das würde ich nicht schaffen.
Es wäre, als würde ich durch die tiefe Nacht fahren, wie im Winter, wenn alle Menschen in den vorbeiziehenden Dörfern schon schlafen. Ich würde mich schnell im kalten Haus verschanzen. Der Wunsch, mit einer Taschenlampe das Grundstück zu inspizieren, würde verschwinden, sobald ich im Innern wäre. Die Ungeduld der Städterin, das schnelle Halbwissen, es passt nicht zum Leben dort. Morgen würde ich einen Rundgang machen und sehen, wie die Lage ist.
Ich stellte das Radio aus und suchte einen Podcast.
Gruh-gruh, ich öffne die Augen. Schmale Streifen Sonnenlicht scheinen durch die Bretter auf die Bettdecke. Die Kraniche! Ich bin da, in meinem Kuhstall. Sofort stehe ich neben dem Bett, um die Tür im Spitzgiebel aufzuschwingen, quietschend und knarrend leistet sie Widerstand, noch gerade sehe ich die Vögel groß am Horizont, bevor sie mit trägen Flügelschlägen trompetend davonschweben, um sich am nächsten Hang wieder niederzulassen.
Die Welt ist weiß bereift, fröstelnd krieche ich wieder unter die Bettdecke. Auf dem Heuboden kann ich die Spatzen rascheln hören, sie zwitschern und scharren in der Dachrinne. Mit dem Leben um mich herum fühle ich mich gleich wieder zu Hause, und meine Augenlider werden schwer. Der Raureif beginnt sich aufzulösen, der Acker mit dem Winterweizen färbt sich in frischem Grün. Ein leises Verlangen nach Frühling prickelt durch meine Adern. In der Wärme meines Bettes träume ich noch ein wenig vor mich hin.
Nach meiner Ankunft gestern hatte ich meine Nase doch noch gleich an die Gartentür gedrückt, doch so sehr ich auch in Richtung des Tümpels starrte, ich konnte nicht sehen, dass sich der Mond im Wasser spiegelte. Aber das hatte nichts zu bedeuten, sagte ich mir, in der Mitte des Tümpels würde es bestimmt nass und sumpfig sein.
Noch halb dösend sehe ich vor mir, wie ich gleich mit den Füßen vorsichtig die Oberfläche abtaste, bei jedem Schritt werden meine Sohlen etwas tiefer einsinken, meine Füße, meine Knöchel, ich werde die Saugkraft des Tümpelgeistes spüren, ein Stiefel wird im Matsch stecken bleiben, während ich mit dem Fuß bereits zum nächsten Schritt ansetze und ihn gerade noch in den Schaft zurückgleiten lassen kann – oder auch nicht. Dann wird er in dem sumpfigen Boden schwer aufsetzen, ich werde wieder ins Wanken kommen und mit den Armen fuchteln, bis ich umkippe. Der Länge nach im Schlamm, mit dem Gesicht im Modder. Ich werde eine Schwimmbewegung machen, mit den Händen das Wasser spüren, ich werde zappeln, schallend lachen wie eine Närrin und nicht einmal über die plötzlichen Laute erschrecken, die in der Stille aus mir hervorbrechen. Ich werde mich auf den Rücken drehen, den Kopf hin und her bewegen, die Haare wie einen Pelz im Schlamm reiben, ich werde zwischen den noch kahlen Ästen der Silberweide hindurch in den Himmel schauen, wo die Wolken vorbeiziehen. Und für einen Moment werde ich glauben, dass alles gut wird.
Abrupt schlage ich die Bettdecke zurück, jetzt gibt es keinen Aufschub mehr.
Ich wate durch das Dickicht aus wilden Brombeeren, bahne mir meinen Weg durch einen Streifen durstiger Seggen und betrete den innersten Kreis des Tümpels, der von einem Wall aus Findlingen und Erde begrenzt wird. Verdorrte Weidenblätter knistern unter meinen Gummistiefeln, als wäre es noch Herbst.
Ich fühle nichts Weiches, nichts Schlickiges, sehe nicht einmal irgendwo Fäulnis, rieche nichts. Der Tümpel ist trocken, knochentrocken, als hätte es überhaupt keinen Winter gegeben. Ich stehe an der tiefsten Stelle, drehe mich einmal um meine eigene Achse und noch einmal, taste mit den Füßen den Boden ab. Wie eine dicke, wattierte Jacke ist er mit Wülsten bedeckt, hier und da gibt es ein Loch, die Trittsiegel von Wildschweinen, vermute ich. Ich sehe keine Tiere in dem Tümpel, kein Leben.
Erschüttert sehe ich mich um. Vom Wall aus schießt ein Grünspecht laut lachend an mir vorbei, in der Ruine der Getreidescheune gegenüber dem Kuhstall hackt sich der große Buntspecht trommelnd eine Nisthöhle.
Als ich beim Komposthaufen neben dem Wall einen Feldstein zur Seite rolle, wird ein dichter kleiner Wurzelteppich mit starken schwarzgrünen Spitzen sichtbar. Die Brennnesseln sprießen schon, plattgedrückt, im Dunkeln, trotz der Bedrängnis. Ich lege den Stein zurück, er wird sie noch eine Weile vor dem Nachtfrost schützen. Im Vorbeigehen stecke ich mit vorsichtigen Handgriffen ein paar fransige Ausläufer der Brombeerhecke zurück, von Rehen und Damhirschen abgenagt.
Es hat Jahre gedauert, bis die Sträucher, die ich gepflanzt hatte, Wurzeln schlugen, bis die Wurzeln in der Tiefe genügend Nahrung und Wasser fanden, um sich gegen das andere Grün zu behaupten. Aber dann schossen kräftige junge Ranken aus dem Boden, im letzten Sommer sah ich Hunderte rote Brombeeren reifen, der Gelierzucker stand schon im Vorratsschrank bereit. Doch bevor sie sich schwarz färbten und voll im Saft standen, kam der Herbst, und nun hängen sie vertrocknet an den dunkelgrünen Zweigen. Weder den Fliegen noch den Wespen schmecken sie, auch nicht den Vögeln.
An dem hohen Ahorn und den ertrunkenen Sauerkirschbäumchen vorbei, am flachen Ufer, steige ich wieder in den Tümpel. Neben dem Entenkorb setze ich mich auf das dürre Laub. Ich starre über die heranrückenden wilden Brombeeren zur Gartentür, als würde ich zu mir selbst zurückschauen, während ich durch das Glas den Tümpel, die Felder, den Waldrand und den weiten Westen in mich aufnehme.
Meine Hand streicht über eine Wulst neben mir. Ich stecke meine Finger darunter, es ist ein nicht einmal zehn Zentimeter dickes Stück, ich ziehe daran, und es löst sich sofort ab. Trockenes Laub und moorige Erde liegen in meiner Hand, nahezu gewichtslos.
Ich denke an die Küken, die hier hatten schwimmen sollen. Ich denke an all das Essbare, das im Tümpel gelebt haben würde, an all die Wassertiere, die ich nicht einmal mit bloßem Auge sehen, geschweige denn ihren Namen kennen würde, an die herumwimmelnden Mikroben, Larven, Würmer, an die Schwärme von Mücken und Gnitzen, die über dem Wasser tanzen, die Frösche und Kröten im Schlamm, ich denke an die Salamander und Schlangen, an die Vögel und die kleinen Räuber, die Mäuse, die Maulwürfe und Igel.
Die Kälte beißt mir in den Hintern. Meine Hände wühlen noch ein wenig herum, suchen nach Leben, nach etwas, das kriecht, scharrt, davonfliegt, egal was, irgendetwas, das sich bewegt, doch der Tümpel ist ausgestorben, tot. Hinter mir ragt der Wall meterhoch über mir empor, ganz klein bin ich jetzt, und ich weiß, dass ich etwas verloren habe.
Wenn jemals wieder Wasser in den Tümpel kommt, werde ich darin mit meiner nackten Haut ganz untertauchen, nehme ich mir vor. Ich sage dem Tümpelgeist, dass er uns nicht im Stich lassen darf.
2.
Tieren lauschen, sie locken und loswerden
Jetzt, wo der Tümpel ausgetrocknet ist, wird sicher auch keine Pfütze auf der kleinen Wiese im Süden stehen, so wie normalerweise im Frühling, denke ich, während ich zur Rinne zwischen dem Findlingswall und der großen Silberweide gehe. Im Frühjahr ist es jedes Mal ein Genuss, die verfaulenden Blätter herauszuschöpfen, das Bett zu vertiefen und zuzusehen, wie aus der Pfütze ein kleiner Bach in den Tümpel zu fließen beginnt.
Nicht so in diesem Jahr, es gibt kein Wasser, das fließen könnte. Aber ich sehe auch kein Gras. Stattdessen liegt die Wiese voll mit Klumpen, so weit der Schatten der Bäume an der Totholzhecke reicht. Wildschweine. Die ganze Südecke haben sie nach Engerlingen und anderen fetten Larven oder Raupen abgesucht, denn sie brauchen tierisches Eiweiß. Natürlich suchen sie es hier, der Lehm ist feuchter und somit weniger hart als auf den Äckern und Heuwiesen. Und daher auch reicher an kleinen Tieren.
Dann werden sie wohl auch auf der Ostwiese gewesen sein. Als ich dorthin gehe, sehe ich in der Ferne hinter unserem Grundstück den Froschteich aufscheinen: Da steht zum Glück noch Wasser. Auch die Ostwiese ist ein Klumpenfeld, ich muss an die junge Bache denken, die ich hier einmal mit ihren Frischlingen beobachtet habe, an einem Sommerabend, noch bevor die Dämmerung einsetzte. Fröhlich schleuderte sie die Grassoden in die Luft: Schaut mal, so macht man das. Es war wie in einem Zeichentrickfilm. Jetzt sehe ich nur das Ergebnis dieses fröhlichen Wühlens, es hat etwas von einem Riesenpuzzle, dessen Teile überall verstreut sind.
Der Obstgarten! Plötzlich ist es vorbei mit meiner ruhigen Grundstücksbegehung, ich stolpere fast über meine Füße, als ich die Seitenfront des Bauernhofs passiere. Ich will nicht sehen, was sich überdeutlich vor mir auftut. Mein eigenes «Nein!» gellt mir in den Ohren. Überall haben die Schweine gehaust, der Boden ist übersät mit moosigen Klumpen, mit Kuhlen, mit großen und kleinen Trittsiegeln. An manchen Stellen ist die Erde dunkel, sie müssen heute Nacht noch dagewesen sein, während ich auf dem Heuboden schlief, die älteren Wühlstellen sind grauer. An den Rändern, wo es waldig ist, sind die Schneeglöckchen herausgewühlt worden, sie liegen mit ihren nackten, feinbewurzelten Zwiebeln zwischen den verdorrten Blättern.
In den letzten Jahren hat sich das Moos zwischen dem Gras immer weiter ausgedehnt, auch grün, auch schön, dachten wir Hofbewohner. Wie praktisch, müssen die Wildschweine gedacht haben: den hungrigen Rüssel kurz unter eine vertrocknete Schicht stupsen, sie hochwerfen, und schon wimmelt es nur so von Köstlichkeiten. Das ist Wühlen light, so lernen die Frischlinge es auf spielerische Weise. Und unterdessen machen sich die Bachen an die tieferen Wühlarbeiten.
Da stehe ich nun als Jägerin. Unser gesamtes Grundstück gilt als «befriedetes», das heißt eingehegtes Gebiet. Auch wenn wir keinen Zaun haben, bleibt es doch Menschengebiet, in dem nicht gejagt werden darf. Halte ich mich nicht daran und werde erwischt oder angeschwärzt, bin ich meinen Jagdschein los.
Aufs Geratewohl schiebe ich mit der Stiefelspitze ein paar Klumpen zurück, kurz darauf stehe ich vornübergebeugt da, um mit beiden Händen die schlimmsten Löcher zu stopfen und den Boden festzutreten. Immer schneller, ich muss zusehen, dass ich die aufgerissene grüne Matte wieder glatt bekomme, bevor es regnet und warm wird und die Wachstumsperiode anbricht. Ich muss die gröbsten Schäden beheben, bevor meine Freunde zu Ostern aus Berlin kommen. Der Obstgarten ist ihr Werk, ihr Paradies.
Ich vergesse die Zeit, mein Rücken fängt an zu brennen und zu stechen. In der Stadt habe ich zu wenig auf meinen Körper geachtet, ich sitze am Schreibtisch und werde steif. Mühsam biege ich mit den Händen in der Seite meinen Rücken wieder gerade. Wie es alte Leute tun.
Man kann kaum erkennen, was ich wieder in Ordnung gebracht habe. Es ist sinnlos, zu viel Arbeit für mich allein. Nur noch eine einzige Kuhle, und die noch, und die – und ich bin schon wieder am Schuften. Bis zur nächsten Attacke. Wenn ich jetzt nicht aufhöre, habe ich einen Hexenschuss, und das kann ich mir hier, allein lebend, nicht erlauben. Mit einem Mal fällt mir ein, dass ich heute Morgen vergessen habe, den Ofen anzumachen. Ich muss sofort ins Haus, um am Abend nicht in der Kälte zu sitzen. Du bist noch nicht wirklich angekommen, schimpfe ich innerlich.
Zur Hölle mit dem Höckerboden, ich kann es mir auch einfacher machen: häufig auf dem Grundstück herumtigern, um überall meine Duftmarken zu hinterlassen, abends oder nachts draußen noch kurz Lärm schlagen, die Ruhe der Wildschweine stören, wer weiß, vielleicht vertreibe ich sie. Zumindest für eine Weile, denn schon bald werden sie sich wieder an Menschen auf dem Grundstück gewöhnt haben, sie werden weiterhin kommen, solange es was zu holen gibt.
Drinnen lege ich meine Hände auf den Lehm des Ofens: Durch die paar Scheite gestern Abend ist er schon nicht mehr eiskalt. Ich werfe eine halbe Schubkarre voll Holz hinein sowie Zeitungspapier und ein Streichholz, schließe die Tür und höre, wie der Sauerstoff durch den offenen Rost ins Innere gesogen wird.
Als das Holz knackt und knistert, lasse ich den Frühling herein. Ich öffne ein Stallfenster für die Rauchschwalben, jedes Jahr Anfang April kommen die ersten Kundschafter, eine oder zwei Wochen später folgt der Rest. In den ersten Jahren ist es mir schon mal passiert, dass das Stallfenster geschlossen blieb, wenn ich nicht da war. Ein Sommer ohne Schwalben hat etwas Karges, Unfruchtbares. Jetzt, wo der Tümpel ausgetrocknet ist, wäre es noch trauriger.
Die Regentonnen müssen nach draußen, zwei alte Ölfässer. Als ich das erste ergreife, drückt sich mein Daumen durch das rostige Eisen, und ich halte den abgerissenen Rand in Händen. Die Tonne war im letzten Sommer schon spröde. Jetzt reicht es, die Romantik ist dahin. Robust, industriell, schön wär’s, auf dem Schrottplatz wussten sie seinerzeit nicht mal, was überhaupt drin gewesen war. Sie hatten die Fässer mit Verdünner ausgespült, den Inhalt auf dem Boden gekippt, und ich hatte sie unter das Regenrohr gestellt und mit dem Wasser den Gemüsegarten gegossen.
Höchste Zeit, richtige Regentonnen zu kaufen. Aber unter all den Online-Angeboten ist nicht eine, die mir gefällt. Die Holztonnen aus Fassdauben mit zwei Eisenbändern darum herum sind inzwischen nicht nur sündhaft teuer, sondern wirken auch so rustikal, dass es schon wehtut. Die aus Kunststein sind klein und allzu kitschig, nur die aus Kunststoff sind unauffällig, bezahlbar und groß genug. Aber ich möchte eigentlich kein Plastik.
Daran hätte ich vorher denken sollen, jetzt ist keine Zeit mehr, lange hin und her zu überlegen. Der Kuhstall hat ein riesiges Dach, gut fünfhundert Quadratmeter, von dem bei einem kräftigen Schauer ordentlich Wasser herunterkommt. Das kann ich bei der jetzigen Trockenheit nicht einfach achtlos durch die Regenrohre im Boden versickern lassen.
Mit einem Rollmaßband nehme ich die maximalen Maße auf und schreibe Regentonnen auf meine Einkaufsliste. Bevor es regnet, werden sie dort stehen, gelobe ich mir, aber für die nächsten sechzehn Tage deutet im Wetterbericht nichts darauf hin.
Zurück zu den Schwalben: Sie können jetzt in den Stall, aber wie sorge ich dafür, dass sie auch dableiben? Irgendwo auf dem Grundstück müssen sie feuchte Lehmkugeln für ihre Nester holen können. Ich muss ihnen dabei helfen. Vielleicht kann ich eine flache Kuhle graben und dafür sorgen, dass Wasser darin stehen bleibt.
Plötzlich sehe ich das Riesenloch vor mir, das wir vor zwanzig Jahren im Sommer von einem großen Bagger hatten graben lassen. In ihm war eine sieben Kubikmeter große Klärgrube aus Beton eingelassen worden, und über lange, perforierte Rohre sollte das Abwasser in der Südwiese versickern. Die Frage war, ob das bei unserem schweren Boden nicht zu langsam gehen würde. Ich wagte das zu bezweifeln, aber als ich vor dem abgrundtiefen Loch stand und an den speckigen Wänden aus Lehm und Klei nach unten sah, brauchte mir keiner mehr etwas zu erklären. Wir haben keine Ahnung, was für eine Welt sich unter der ersten dünnen Erdschicht verbirgt, wir haben keine Ahnung, worauf wir leben.
Die Sickergeschwindigkeit musste gemessen werden, dazu sollten wir selbst ein Loch von einem halben Kubikmeter Größe ausheben und mit Wasser füllen. Innerhalb von vierundzwanzig Stunden musste das Wasser versickert sein. Das war es nicht, aber es kam niemand, der es kontrollierte, also beließen wir es dabei. Ich erinnere mich vor allem daran, wie Boom beim Graben fluchend und zeternd seinen Spaten in den harten Boden rammte.
Wenn das Wasser so langsam versickert, überlege ich, mit meinen Gedanken wieder bei den Schwalben, reicht es vielleicht, wenn ich eine flache Grube aushebe, sie mit einer zusätzlichen Schicht aus reinem Lehm auskleide und sie hin und wieder aus der Regentonne oder notfalls aus dem Wasserhahn auffülle. Aber dann muss ich schon morgen mit dem Graben anfangen, der Boden wird von Tag zu Tag härter, und die erste Kundschafterin kann jeden Moment eintreffen.
Ich gebe zwaluwen und leem in den Computer ein, finde aber nicht, wonach ich suche, danach «Schwalben» und «Lehm». Auf der Seite des NABU erscheinen zu meiner Überraschung Fotos von selbst angelegten Lehmpfützen, mindestens anderthalb Meter im Durchmesser, mit offenen Einflugschneisen und ohne Gebüsch in der Nähe, in denen Feinde auf der Lauer liegen können. Stell dir mal vor, meine Lehmpfütze als Präsentierteller für jagende Katzen!
Die Naturschützer empfehlen Teichfolie als undurchlässigen Boden. Plastik? Noch mehr Plastik?, seufze ich. Offenbar glaubt NABU, dass der Zweck die Mittel heiligt. Ich zögere: Es würde die Pfütze natürlich garantiert wasserdicht machen. Schnell verkrieche ich mich hinter dem breiten Rücken des NABU und schreibe Teichfolie auf meine Liste.
Draußen sehe ich mir an, wo die Lehmpfütze entstehen soll: irgendwo zwischen dem Stall und der Ruine der Getreidescheune, an der tiefsten Stelle. Das ist hinter der Klärgrube. Ich stelle mich auf den Betondeckel und schaue mich um: Hier würde die Pfütze genügend Raum haben, sich auszudehnen, die Schwalbennester wären in der Nähe, und aus der Küche könnte ich alles unbeobachtet im Blick behalten. Hier soll sie hin.
Auf dem Acker läuft ein Rehbock vorbei, sein neues Geweih noch im Bast, er sieht und riecht mich nicht, ich stehe reglos da wie ein Standbild, und der Wind kommt von seiner Seite, samtig golden glänzen seine Stangen im Abendlicht. Die Dämmerung wird gleich einsetzen, gut eine halbe Stunde früher als in Amsterdam. Als ich ins Haus gehe, fliegen die ersten Fledermäuse vorbei. Auch bei ihnen setzt wieder ein neuer Zyklus ein, auch für sie dreht sich jetzt alles ums Fressen, Jagen und das Säugen der Jungen.
Viel Essbares wird noch nicht herumfliegen, denke ich, Insekten habe ich bisher nicht gesehen. Aber was heißt das schon, wie kann ich das wissen, eine Fledermaus spürt sie unendlich viel schneller auf als ich mit meinen menschlichen Sinnen.
Im Haus fühlt es sich schon etwas angenehmer an, morgen wird die Kälte daraus vertrieben sein. Auf der Bank am Ofen räkele ich mich mit dem Rücken am warmen Lehm. Ich sitze eine Weile da und starre vor mich hin, durch das Stallfenster kommt das letzte Licht herein, es ist ganz still. Ob diese Stille in mir steckt oder von außen kommt, weiß ich nicht, jetzt ist sie überall. Eine solche Stille habe ich lange nicht mehr gehört.
Dann springt der Kühlschrank an, etwas trippelt – eine Maus. Kssst!, zische ich unwillkürlich, das Tier rennt durch den Raum und verschwindet eilends hinter dem Herd. Eine ganze Weile war es uns gelungen, Mäuse vom Haus fernzuhalten. Boom hatte die Ritzen zwischen Wand und Boden mit Mörtel zugeschmiert. Aber jetzt sind in den Küchenschränken die Plastikverschlüsse der Gläser und Flaschen angenagt, zum Dank haben die hungrigen Gäste Kötel und Pfützen zurückgelassen.
Der Boden neben dem Schornstein ist mit blauen Schnipseln übersät. Meine Yogamatte? Sie hat ein Loch, so groß wie ein Apfel. Wirklich geschmeckt haben wird sie der Maus nicht, und für den Nestbau war sie offenbar auch nicht geeignet. Mein Auge fällt auf ein neues Loch im Boden, gerade groß genug für eine Maus. Sternförmig darum herum sieht man Nagestreifen. Das Tier wollte augenscheinlich vom Haus aus in den Kriechkeller. Ich decke das Loch mit einem Backstein ab. Wie die Mäuse hereingekommen sind, muss ich noch feststellen.
Als ich versuche, in die Stille zurückzufinden, kommt eine Mücke und sirrt um meinen Kopf herum. Es fängt schon an, schön warm zu werden, nicht wahr?, sage ich zu ihr. Und ich denke: Ich werde dich nicht totschlagen, ich überlasse dich den Fledermäusen oder in Kürze den Schwalben. Grimmig sirrt sie weiter.
Au! Ich schlage mir mit der rechten Hand auf den linken Handrücken. Biest! Plattgedrückt liegt die Mückendame in einem Tropfen Blut zwischen den blauen Adern. Es war höhere Gewalt, murmele ich. Sie war zu weit gegangen.
Es ist lächerlich, auf das Totschlagen einer Mücke zu verzichten, denke ich. Wie viele Mücken würde ich in einem Jahr ins Jenseits befördern, weil ich nicht gestochen werden will? Keine Ahnung, aber wahrscheinlich nicht mehr als die, die in einem einzigen Insektenballen im Kropf einer Schwalbe stecken, wenn sie ihre Jungen füttert, das sind ungefähr zweihundert, habe ich mal gelesen.
Manchmal, so weiß ich, ist es verblüffend nützlich, nach Mengen und Maßen zu suchen, auch schockierend, weil ich oft keine Ahnung von Verhältnissen habe oder sie aus Faulheit aus den Augen verliere. Mich von einer Mücke stechen zu lassen, weil ich sie der Fledermaus gönne, wie komme ich bloß darauf? Bei meinen Versuchen, Gutes zu tun, sind meine Taten oft erbärmlich deplatziert. Widersprüchliche Geschöpfe sind wir.
Als ich die Lampe auf dem kleinen Beistelltisch ausschalten will, liegt dort eine Motte. Strahlend weiß hebt sie sich von dem glatten, dunklen Holz ab. Sie hat mit ihren langen, durchscheinenden Flügeln etwas Körperloses. Der Tod ist weiß. Die Motte liegt auf einem Flügel. Ich gehe in die Hocke und puste sie sanft an. Ihre Vorderbeine, dünn wie Nähgarn, beginnen sich zu bewegen, tasten ebenso wie ihre langen, zarten Fühler in der Luft herum. Jetzt bewegt sie auch ihre mittleren und hinteren Beine im Versuch, sich aufzurichten, ihr Hinterleib windet sich. Ich halte den Atem an. Sie findet nirgends Halt.
Dann aber ballt sie all ihre Bewegungen in einem einzigen Moment zusammen und fällt um. Auf ihren anderen Flügel. Noch ungestümer bewegt sie sich, zappelt. Sie will davonfliegen, leben. Auf ihrem Kopf sehe ich ihr kleines, schwarzes Auge.
Ich schalte die Lampe aus.
Um Viertel vor sechs erwache ich aus einem tiefen Schlaf. An der Innenseite des Giebelpfostens schiebt sich ein Baumläufer nach oben. Von so nahe habe ich noch nie einen gesehen. Sein Federkleid ist wie ein rohes Stück Baumrinde, auf dem Balken ist er fast so perfekt getarnt wie auf einem Baum. Er tickt gegen das Holz und stochert mit seinem langen, gebogenen Schnabel in der weichen Außenschicht des Balkens herum. Wie eine Maus kriecht er hinauf, allerdings bewegt er sich auch seitwärts, da er es gewohnt ist, Bäume zu umrunden, und weg ist er, um die Ecke nach draußen. Einen Moment lang höre ich noch sein leises Ticken.
Ich muss wieder eingenickt sein, denn ich werde noch einmal wach, jetzt vom Schrei zweier Kraniche. Als dieser abebbt, höre ich ein ganz leises, dunkles Gurren, dann ein fett rollendes R, das anschwillt, bis ein ekstatisches Geschrei den Kehlen der beiden entfährt, worauf sie kollernd erneut in Stille verfallen. Ich öffne die Augen. Sie stehen dort auf dem Hügelrücken, der eine Vogel breitet seine großen Flügel aus, Hals und Kopf in die Höhe gereckt, der andere springt ihm auf den Rücken und reibt seine Kloake gegen die seiner Lebensgefährtin. Sie schwankt, und er landet vor ihr auf dem Boden. Als beide wieder auf ihren staksigen Beinen stehen, tanzen sie umeinander herum, machen kleine Luftsprünge, strecken ihre Hälse senkrecht zum Himmel, Kopf und Schnabel in einer Linie, hin zu ihrem Kranichgott, und schreien ihr Entzücken heraus.
Es ist wunderbar, aber ich muss auch über sie lachen, Prahlhänse sind sie.
Unwillkürlich gehe ich davon aus, dass es unsere sind, die, die ihr Nest im Tümpel auf dem Acker haben. Wenn es stimmt, dass es unsere sind, sollten es dann dieselben sein wie im letzten Jahr? Und balzen Kraniche überhaupt an dem Ort, an dem sie auch brüten? Ich weiß es nicht, aber ich gehe gern davon aus, dass ich meinen Platz hier mit alten Bekannten teile.
Die Motte kommt mir in den Sinn, und mir wird bewusst, dass ich keinen Moment daran gedacht habe, ihren Todeskampf zu beenden, oder, anders gesagt, ihr Leiden zu verkürzen, ihr den Gnadenstoß zu geben. Und ich würde es noch immer nicht tun. Es wäre ein Akt der Gewalt, während ich nicht einmal weiß, ob sie Schmerzen hat. Ist es schlimm, wenn das Leben langsam aus ihr entweicht und sie sich noch dagegen wehrt?
Als ich nach unten komme, ist sie tot. Ich lasse sie liegen, sie muss nicht verschwinden. Wäre ich jetzt noch in Amsterdam, würde sie hier auch einfach so liegen.
Mit einem Spaten steche ich im Gras den Umriss der Lehmpfütze ab. Es ist noch schlimmer, als ich gedacht hatte, kaum fünf Zentimeter tief dringt das Blatt in den Boden ein. Ich hole einen anderen Spaten aus dem Arbeitsschuppen, den mit den Fußstützen auf dem oberen Rand, so kann ich Kraft auf ihn ausüben, ohne meine Schuhsohlen durchzutreten. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Dann springe ich so lange mit beiden Füßen auf die Spatenkante, bis ich mit meinem ganzen Gewicht das Blatt in den Lehm treibe. Oft schaukele ich auf dem Spaten hin und her. Es ist ein gutes Training, aber es geht nicht voran. Immer wieder stoße ich auf einen Feldstein.
Weil die Erde so hart ist, sind die Soden, die ich aussteche, schön fest. Darüber würde ich mich zu anderen Zeiten freuen, denke ich, während ich keuchend über dem Spaten hänge. Aber warum eigentlich jetzt nicht? Ich drehe mich um und schaue zu der umgewühlten Südwiese hinüber.
Im nächsten Moment bin ich auch schon dort, ebne das Klumpenfeld ein und fülle die restlichen Löcher mit den Soden auf. Als ich müde bin vom Bücken, trete ich sie fest, Schritt für Schritt, vor und zurück, nach links und nach rechts, die Knie leicht gebeugt, es bereitet mir immer mehr Vergnügen, als würde ich die Wiese glatt tanzen. Dann muss ich wieder zur Lehmpfütze, um weitere Soden auszustechen, zurück zu den Kraftakten und der Akrobatik, dem Schuften und dem Schaukeln auf dem Spaten. Aber es macht mir nichts aus, der Mensch verweichlicht, wenn er sich nicht hin und wieder abrackert.
Schau an, da kommt aus einer Sode ein kleiner glänzender, cognacfarbener Wurm gekrochen, einen Millimeter dick, zwei Zentimeter lang. Er lebt im Lehm, ich sehe jetzt die winzigen Kanäle, die er quer durch die Sode gegraben hat. Dieses kleine, weiche Geschöpf ohne Skelett und ohne Panzer hat weniger Mühe mit dem steinharten Lehm als ich mit meinem stählernen Spatenblatt.
Ich lege den Spaten beiseite. Pause. Das Würmchen hat Vorrang vor der Lehmpfütze. Alles, was in der Erde kreucht und fleucht, geht in diesem Frühjahr vor, jedenfalls solange es keine Regenwürmer, Ameisen oder Asseln sind oder irgendwelche anderen Erdbewohner, die ich schon kenne. Ich habe dem Leben unter der Erde nie viel Aufmerksamkeit geschenkt. Regenwürmer stehen für einen guten Boden, das wusste ich schon als Kind, doch sehr viel weiter bin ich nicht gekommen. Aber wenn ich tiefer in meinen Lebensraum vordringen will, wissen möchte, wie es darum bestellt ist, wenn ich der Trockenheit und Verödung die Stirn bieten will, sind die Bodentiere und die Insekten in der Luft wichtige Informanten.
Ich bröckele den Lehm von der Sode, aus der der Wurm zum Vorschein kommt, packe im Haus meine neuen Becherlupen aus – Kinderspielzeuge aus Plastik – und stecke den kleinen Wurm in den Topf mit dem schrägen Spiegel, damit ich ihn auch von unten betrachten kann.
Was ist ein Wurm? Ein Regenwurm ist ein Wurm, und auch die Spulwürmer, die wir als Kinder in unserem Kot hatten, sich windende Fädchen, die einem zuerst eine Weile Jucken am Poloch bescherten. Das fiel dann irgendwann der Mutter auf, weil man sich ständig durch die Kleidung hindurch kratzte, und die gesamte Familie wurde in den nächsten Tagen rigoros entwurmt.
Mein Cognacwürmchen hat Segmente, es handelt sich also, wie beim Regenwurm, um einen Ringwurm, doch die gibt es in Tausenden und Abertausenden von Arten. In dem kleinen Spiegel sehe ich, dass mein Wurm Beine hat, die einem echten Wurm fehlen würden. Der kriecht wie ein Regenwurm mit seinen Segmenten vorwärts, streckt sich und zieht sich wieder zusammen, eigentlich ziemlich umständlich. Ich tippe «Wurm mit Beinen» in den Computer, und auf dem Bildschirm erscheinen Hundert- und sogar Tausendfüßler, die mich kurz erschaudern lassen, aber mein Würmchen hat nur zwei mal drei Füße an der Vorderseite und einen Wulst unter dem Hinterleib. Nachschieber heißt das, lese ich. Da ist er, ich habe ihn gefunden: ein Drahtwurm – auch wenn es sich streng genommen nicht um einen Wurm handelt.
Er lebt bis zu fünf Jahre im Boden, ehe er zum Schnellkäfer wird. Er ist somit eine Larve, ein Insekt. Als Ei existiert er nicht einmal einen Monat, als Käfer hat er nur eine Lebensdauer vom Frühling bis zum Sommer. Und all die Jahre dazwischen bleibt er im Untergrund in der dichten, festen Erde und kriecht durch seine kleinen, engen Gänge. Ich beneide ihn nicht. Außerdem ärgern sich auch noch alle über ihn, denn er frisst die Wurzeln der Gewächse und kann mit seiner Gefräßigkeit eine ganze Ernte vernichten. Ich versuche mir vorzustellen, wie viele Drahtwürmer unter der Erde stecken müssen, um das hinzukriegen. Es muss von ihnen wimmeln.
Der Drahtwurm bringt mich auf die anderen Wimmeltiere, die im Boden leben. Regenwürmer, ich schaue kurz nach: Pro Quadratmeter sind es durchschnittlich zweihundert, Engerlinge dreihundert. Es sind grobe Schätzungen, aber ich muss irgendwo anfangen, um mir ein Bild machen zu können. Zusammengenommen geht es um Tausende von Tieren auf dem einen Quadratmeter. Dass überhaupt noch Platz für Erde übrigbleibt, denke ich unsinnigerweise.
Du kannst dich zwar jetzt auf die Drahtwürmer und das ganze Leben im Boden stürzen, dir Sorgen um die Schwalben und den Regen machen, aber du wolltest doch gleich nach deiner Ankunft die Waschbärfalle aufstellen, jetzt, wo es noch geht! Es ist die Jägerin in mir, die sich meldet. Und sie hat recht. Offenbar versuche ich, dem auszuweichen, obwohl jetzt die beste Zeit des Jahres ist: Die Waschbären sind gerade aus ihrer Winterruhe erwacht, haben Hunger und greifen nach allem, was sie scharrend, kletternd und schwimmend zu fassen bekommen können.
Von Mitte April an werfen die Weibchen ihre Jungen. Wenn ich also vorher noch ein Weibchen fange und töte, gibt es demnächst vier bis sieben Bären weniger, die hier Eier wegholen, Küken und Vögel auffressen, Frösche, Blindschleichen, junge Igel und Hasen. Natürliche Feinde haben sie nicht. Zumindest sagen das alle, aber in Wirklichkeit haben sie die schon: Ich bin einer davon. Und ich habe nur noch eine gute Woche, dann ist das Fangen von Waschbären bis zum Herbst tabu. Mutterlos krepierende Junge will ich nicht auf dem Gewissen haben. Mehr noch, es ist strafbar, und ich würde – zu Recht – auch damit meinen Jagdschein riskieren.
Also hebe ich die Waschbärfalle in die Schubkarre und bringe sie in den Obstgarten zu der Stelle, an der ich im vergangenen Herbst meinen ersten Waschbären gefangen habe. Ich spieße eine Backpflaume auf den Haken, der an der Rückwand der Falle befestigt ist, schmiere Nutella darauf und stelle die Falle scharf. Jetzt nur noch die Wildkamera an einen Baum binden und sie auf die Falle richten.
Als ich zurücklaufe, höre ich am Bauernhof etwas zwischen den dürren Blättern und Narzissen rascheln. Stille. Ich recke meinen Hals und sehe ein Häuflein Ringelnattern in der Sonne liegen, sie sind noch klein. Jedes Jahr aufs Neue kommen sie bei den ersten warmen Sonnenstrahlen aus ihren dunklen Höhlen und feuchten Grotten geglitten, um sich zu wärmen. Als ich weitergehe, höre ich sie davonrascheln. Ich habe ihnen ihr Sonnenbad verdorben, aber sie kommen sicher bald zurück und haben mich auf eine Idee gebracht.
Kurze Zeit später sitze ich mit geschlossenen Augen an der warmen Fachwerkwand im Gemüsegarten, das Gesicht der Sonne zugewandt. Ich atme tief ein, aber in meinem Kopf rattert es weiter: Ich muss mit dem Gemüsegarten anfangen, die verdorrten Pflanzen wegschaffen, Kompost unter die Erde mischen und darf auch das Rhabarberbeet nicht vergessen, ich muss im Haus Setzlinge ziehen, Sirup um einen Baumstamm schmieren, um die Wintereule anzulocken, damit ich sie betrachten kann, ich habe noch einen alten Topf Zuckerrübensirup herumstehen. Ich muss die Johannisbeer- und Himbeersträucher und die Traubenreben zurückschneiden, dazu bin ich vor dem Winter nicht mehr gekommen. Den Vögeln muss ich neben der Eiche ein Wasserbad hinstellen, für die Schlangen und Blindschleichen muss ich einen Bruthaufen anlegen, ich muss Kaulquappen, Eier, Larven und Puppen suchen, Insektenfallen aufstellen. Und ich darf nichts vergessen, wenn ich zum Einkaufszentrum in die Stadt fahre.
Spüre die Sonne auf deinem Gesicht! Spürst du die Sonne? Allein das schon, die Wärme, das Summen einer frühen Biene, etwas, das pfeifend und surrend vorüberfliegt – ich muss nicht einmal mehr die Augen öffnen, es reicht, dass ich sie höre, es sind die Höckerschwäne. Jetzt mal langsam, ich bin erst einen Tag hier.
Neben mir, auf einem Feldstein an der Wand, liegen zwei Weinbergschnecken, ihre Gehäuse berühren sich, aber ihre Sohlen kleben noch nicht aneinander. Ich beobachte ihre ersten Avancen, das wird noch mindestens einen Tag dauern. Gut sichtbar und ungeschützt liegen sie da, eine leichte Beute für andere Tiere, alle ebenso hungrig zu Beginn des Frühlings.
Ich hoffe auf eine gute Weinbergschneckensaison, im letzten Jahr habe ich Rezepte gesammelt, Escargots de Bourgogne vom eigenen Hof. Warum sollte ich wohl Escargots aus der Dose essen oder in einem Restaurant und nicht die von hier, frisch gesammelt wie noch warme Hühnereier. Weil ich nicht wissen will, was ich esse? Oh, du willst es schon? Na dann.
Vor ein paar Jahren waren sie nahezu verschwunden, es war die Zeit der braunen Spanischen Nacktschnecken. Ich hatte schon nicht mehr geglaubt, dass ich die jemals wieder loswerden würde. Im Gemüsegarten pflanzte ich nur noch feste Kräuter und anderes Zeug von der Liste «Was Schnecken nicht mögen». Das Schlimmste war, dass ich sie selbst hergebracht hatte. Die Töpfe mit Thymian aus dem Gartencenter waren voll mit kleinen glasigen Eiern, aus denen, wie ich später entdeckte, Spanische Schnecken wuchsen. So verbreiten wir Menschen wie Blinde alles Mögliche über den Erdball und haben keine Ahnung, was wir da machen.
Ich rückte den Nacktschnecken mit der Gartenschere zu Leibe, schnitt sie durch und legte sie für ihre Artgenossen auf einen Haufen, die sich wie hungrige Kannibalen darüber hermachten. Die Gartenschere garantiert einen schnellen Tod, dennoch gruselt es den meisten Menschen davor. Sie wollen das Durchschneiden nicht spüren, den weißlichen Schmodder nicht sehen, der aus dem Schneckenleib quillt.
Die Gemüsegärtner in meiner Umgebung, die keine Tiere auf dem Gewissen haben wollten, warfen sie in einen Eimer und brachten sie in den Wald. Vielleicht nett für die Exoten selbst, aber sicher nicht für die anderen Schneckenarten, die dort leben. Auch die Weinbergschnecken ziehen bei der spanischen Invasion den Kürzeren.
Im vorigen Sommer waren die braunen Nacktschnecken auf unerklärliche Weise verschwunden, und es tauchten wieder mehr Weinbergschnecken auf. Ich holte das Grundrezept für Escargots schon hervor, zögerte dann aber doch. Man muss sie erst eine Woche ohne Nahrung und Wasser einsperren, dann verlieren sie ihre Abfallstoffe. Ich wollte sie schon bedauern, als mir klar wurde, dass sie in eine Trockenstarre fallen: Sie verschließen ihr Gehäuse mit einer Kalkschicht und warten auf feuchtere Zeiten. So überleben sie auch den Winter, aber dann heißt sie Kältestarre. Sie leiden nicht darunter, Schnecken sind Kaltblüter. Wie es ist, ein kaltblütiges Geschöpf zu sein, und wann es leidet oder nicht, davon kann ich mir mit meinem warmen Blut kein Bild machen.
Nach einer Woche wirft man die erstarrten Weinbergschnecken in kochendes Wasser. Dann sind sie auf der Stelle tot, so dass sie ihr Fleisch für uns nicht mehr mit ihrem Schleim verderben können, und leiden nicht.
Ich begann, die Schnecken zu zählen, doch als der Sommer voranschritt und es trockener und trockener wurde, verschwanden sie zusehends im Boden und schlossen ihre Kalkhaustür. Das Rezept verschwand wieder in der Mappe.
Neuer Frühling, neue Chancen, denke ich nun und träume davon, dass ich mir in diesem Frühjahr endlich Escargots in geschmolzener Butter mit Knoblauch und grünen Kräutern zubereiten werde. Die beiden auf dem Feldstein dürfen also vorläufig in ihrem Tun fortfahren, lass sie sich nur schön fortpflanzen, dann habe ich bald eine reiche Ernte. Ich brauche sie nicht, um zu überleben, ich habe keinen knurrenden Magen oder leide an Eiweißmangel. Ich kann mir den Luxus leisten, mich bei jedem Tier, das ich essen möchte, zu fragen: Gibt es genug davon?
Ich muss die Waschbärfalle kontrollieren, geht mir morgens beim Aufwachen plötzlich durch den Kopf. Wenn sie scharfgestellt ist, hat das absoluten Vorrang. Die Stalltür quietscht, ich hatte vergessen, sie vorsichtig zu öffnen, sofort bleibe ich stocksteif stehen. Zwei Rehe, die als Silhouetten im Gegenlicht grasen, drehen mir ihre Köpfe zu. Rasch verschwinden sie hinter den Kastanienbäumen, das eine mit einem dicken Bauch, das andere jungfräulich schmal.
Die Falle steht nach wie vor offen, und die Pflaume hängt noch drin. Die Wildkamera zeigt eine Aufnahme von einer graugetigerten Katze, und heute Nacht um 3 Uhr 41 ist ein Waschbär vorbeigekommen. Da hat wenig gefehlt, jetzt muss er nur noch in die Falle tappen. Ich werde noch ein wenig Nutella auf die Pflaume schmieren, der Geruch wird ihm hoffentlich den letzten Rest seines Verstandes rauben.
Bevor ich wieder ins Haus gehe, hänge ich vor dem breiten Fenster im Innenhof einen Fettknödel auf, damit ich schon beim Frühstück die Meisen beobachten kann. Oder einen Kleiber. Die Spatzen und Mäuse werden kommen und die Krümel vom Boden einsammeln. Und wenn der Buntspecht erst einmal die Kugel anfliegt und darauf einhackt, ist sie innerhalb eines Tages verputzt. Dann hänge ich eine neue auf.
Man darf Vögel nicht füttern, wenn es draußen genügend Nahrung gibt, habe ich gelernt, aber die gibt es so früh in dieser Jahreszeit noch nicht. Doch auch wenn es sie gäbe, ich füttere dennoch, ich kann von dem An- und Abfliegen, den Tricks und Kniffen, den Streitigkeiten und dem nur allzu erkennbaren Verhalten gar nicht genug bekommen, ich verlustiere mich in den langen Stunden und Tagen im Haus an der Fettknödelgesellschaft vor meinen Augen. Und übrigens, mit dem Zufüttern im Herbst, Winter und Frühling rette ich mehr Vögel, als davon sterben.
Ich will ein bisschen Leben um mich herum, nennen wir es Gesellschaft.
3.
Die Landschaft vermaist, die Kraniche profitieren
Ich streune wieder über das Gelände auf der Suche nach Eiern, Larven, Puppen, nach Würmern, Fröschen, Mäusen und Schlangen, und stehe schon bald wieder im Tümpel, halte Ausschau nach etwas, das lebt, egal was, doch alles bleibt ausgetrocknet und still. Das fahle Licht fällt durch die kahlen Äste auf mich herab – was mache ich auch in dieser trübseligen Kuhle. Alle Lust fließt aus mir heraus. Wäre er doch nur das, was er immer war, ein Quell des Lebens, der sich selbst genügt. Jetzt ist er nur noch sein eigener, blasser Schatten.
Es gab Tage, an denen ich es hatte kommen sehen, schon im Spätsommer, Tage, an denen ich den Entenkorb nicht als ein Zeichen der Hoffnung sah, sondern als einen Beweis meiner Blindheit für das, was wir Menschen auf uns herabgerufen hatten. Sei nicht so pessimistisch, hielt ich mir dann vor, ein bisschen Vertrauen in die Wettergötter und in die Widerstandsfähigkeit der Natur! Trotzdem dachte ich manchmal schon zaghaft daran einzugreifen. Ich könnte ein Rohr vom Regenrohr zum Tümpel legen, um das Wasser direkt dort einzuleiten. Um überhaupt Wasser in die Tonne zu bekommen, muss ich im Regenrohr, so wie an der Ostseite, knapp oberhalb der Tonne eine seitliche Klappe anbringen lassen: Diese Klappe bleibt offen, bis die Tonne voll ist, danach schließe ich sie wieder, und das Wasser fließt durch das Fallrohr auf den Boden. Das bräuchte ich dann nur noch mit einem weiteren Rohr zu verlängern, und ich müsste einen schmalen Graben ausheben.
Ich schreite die Entfernung von der Mitte des Tümpels bis zum Regenrohr ab: siebenundvierzig Schritte, meine Schrittlänge beträgt durchschnittlich achtzig Zentimeter, das sind also etwa vierzig Meter. Mit einem Spaten habe ich da keine Chance, ein so langer Graben durch Lehmboden ist eher etwas für junge Muskeln. Mehr noch: Es muss ein Bagger zum Einsatz kommen, denn der Boden zwischen dem Kuhstall und dem Tümpel ist voll mit riesigen Findlingen, die nach dem Legen der Fundamente für das Vorwerk zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts übriggeblieben sind.
Ich weiß noch immer nicht, ob so ein Rohr etwas nützt. Das bisschen Regenwasser, spotteten die Männer aus der Umgebung, wenn ich es zur Sprache brachte. Während ich geneigt bin zu denken, dass auch Kleinvieh Mist macht. Wenn man als Mensch noch etwas übrig behalten möchte, das man anstreben kann, geht es nicht anders. Grübelnd folge ich dem Pfad auf dem Wall, als mein Auge auf ein Büschel dicker, spröder Haare fällt, hellgrau mit ein wenig Dunkel und Schwarz dazwischen. Ein Dachs! Der ist also auch wieder auf den Beinen, das heitert mich auf. Ich sammle das Büschel ein und lege es auf die Ablage meiner Vitrine mit Tierfunden neben die Igelhaut. So dicht beieinander, das geht nur, weil sie tot sind, der Dachs mit seinen kräftigen Kiefern ist nämlich, abgesehen vom Uhu, das einzige Tier, das eine zusammengerollte Stachelkugel aufbekommt, wenn es Lust auf Igel hat. Dann hole ich die Wildkamera aus dem Obstgarten und hänge sie an den Tümpel, vielleicht sucht das Wild dort ja nachts im Windschutz Deckung.
Ein Auto fährt auf den Hof, es ist der Mann vom Zeltverleih. Er kommt, um die Südwiese für unser Sommerfest auszumessen. Früher hat er in Sibirien Rohrleitungen verlegt, erzählte er mir mal. Wenn er mit dem Messen fertig ist, könnte ich ihn ja um Rat fragen. Ich zögere, sehe mich selbst da stehen: Immer wieder eine allerletzte Frage stellen, noch etwas anderes wissen wollen. Aber dann denke ich: na und? Die meisten Menschen geben gern Ratschläge.
«Nein», sagt der Zeltmann, «würde ich nicht machen, so ein Rohr, das bisschen Regenwasser vom Dach wird dir wirklich nichts nützen, im Gegenteil, dadurch verschlämmt der Boden nur noch weiter. Ausbaggern das Ganze, das ist das Einzige, was hilft, und all den Schlamm auf die Uferböschung.»
Er erklärt mir, was es mit Erdschichten und unterirdischen Wasserläufen auf sich hat, dass der Acker auf den Findlingswall drückt und sich das Erdreich noch weiter verdichtet. Ich nicke, meine Gedanken sind schon bei Tileman Stella, dem Wissenschaftler und Kartographen, der Ende des sechzehnten Jahrhunderts die Grenzfehde zwischen dem Herzog von Mecklenburg und den Markgrafen von Brandenburg untersucht hat, deren Tiefpunkt der Streit um das Wasser war. Ich stieß darauf, als ich an einem Buch über ein Nachbardorf arbeitete.
Seinerzeit hatte es mich gewundert, wie heimtückisch das Wasser hier sein kann, bis hin zu schweren Überschwemmungen. Ich dachte, dass vor allem wir Niederländer damit zu kämpfen hätten. Scherzend nannten Boom und ich unseren Mecklenburger Kuhstall unseren terp, einen Zufluchtsort für den Fall, dass die Randstad Holland jemals im Wasser versinken sollte, Warft auf Deutsch, Wurt auf Norddeutsch. Manche unserer deutschen Freunde kannten das Wort nicht mal. Ein reiner Scherz ist es inzwischen nicht mehr, die Eiskappen am Nord- und Südpol schmelzen immer schneller ab, niemand weiß, welche Kräfte das freisetzen wird.
Die Ruine der Getreidescheune habe ich noch nicht inspiziert. Jetzt, wo der Tümpel ausgetrocknet und ausgestorben ist, bleibt nur sie noch als selten betretene Welt übrig. Ich behandle sie schonend und bin nicht oft dort. Nichts tun ist das Beste, summt es in meinem Kopf, als ich hingehe.
In der Ruine stehen bereits kräftige Eschen, ein Kastanienbaum, knorrige Holunderbüsche und andere Sträucher, dazwischen klaffen Hohlräume. Manchmal kippe ich eine Schubkarrenladung Schutt oder werfe einen vollen Staubsaugerbeutel hinein. Der Schlingknöterich rankt sich jedes Jahr höher und dichter an den alten, halb verrotteten Balken empor und greift zum Himmel, alles Mögliche wächst und wuchert dort. Brütende Vögel, verwilderte Katzen, die hier ihr Nest haben, ein Rehbock, der Schutz sucht, die Ruine ist voller Leben. Sie ist Natur geworden.
Als ich hinten herumgehe, verstummt der Singsang in meinem Kopf. Es scheint, als habe jemand in meiner Abwesenheit die Wildnis aufgeräumt. Ich kann tiefer ins Ruineninnere hineinsehen als sonst zu Beginn des Frühjahrs und kann mir diese abgeschiedene Welt kaum noch ins Gedächtnis rufen. Rechts von mir habe ich freie Sicht auf den Hühnerauslauf der Nachbarn, bisher konnte ich die Hennen mit ihrem zufriedenen oder alarmierten Gegacker nur hören.
Dass die Welt der Getreideruine weniger geheimnisvoll, weniger in sich gekehrt ist, liegt nicht an uns, sondern daran, dass die Natur unter der Trockenheit stöhnt, sogar die Bäume, die tief im Boden wurzeln: Der Grundwasserspiegel sinkt von Jahr zu Jahr.
Nachmittags höre ich von unserem Brennholzlieferanten, der viele Hektar Wald besitzt, dass ein dramatisches Jahr hinter ihm liegt. Von den tausend neuen Bäumen, die er im letzten Jahr angepflanzt hat, sind mehr als die Hälfte eingegangen. Auch kämpft er gegen das berüchtigte Eschentriebsterben, das, so wollen es Untergangsszenarien, das Ende der Esche in unserer Landschaft bedeutet. Mit dem Buchdrucker, einem Borkenkäfer, hat der Waldbauer dagegen wenig Probleme: Der Käfer hat es vor allem auf die gemeine Fichte abgesehen, und die hat er in seinen Wäldern kaum.





























