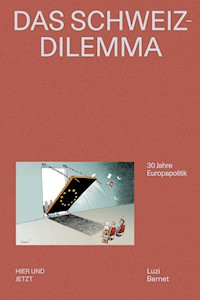
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hier und Jetzt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
1992 lehnten Volk und Stände den Vertrag über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ab. Einige Monate zuvor hatte die Schweiz ein EU-Beitrittsgesuch in Brüssel deponiert, ziemlich unauffällig. Luzi Bernet war damals als junger Auslandskorrespondent vor Ort mit dabei. Von diesem Moment ausgehend spannt er den weiten Bogen über die Entwicklung der Schweizer Europapolitik der letzten dreissig Jahre bis hin zum Abbruch der Verhandlungen über das Rahmenabkommen. Der Autor legt keine trockene Abhandlung zur Zeitgeschichte vor, sondern eine profunde, leicht lesbare Entwicklungsgeschichte der Irrungen und Wirrungen der Schweizer Europapolitik der letzten drei Jahrzehnte. Hin- und hergerissen steckt das Land seit Jahren im Dilemma zwischen Annäherung und Blockade. Am Ende plädiert Luzi Bernet für einen entspannteren Europadiskurs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Schweiz-Dilemma30 Jahre Europapolitik
Luzi Bernet
Die Schweiz und Europa Karikaturen von Patrick Chappatte
Einleitung
Der EWR
Die Zeitenwende von 1989
Die Verhandlungen
Die Geschichte einer Überforderung
Die Urschweiz erwacht
Die Wirtschaft kommt zu spät
Der «dimanche noir» und die Folgen des EWR-Neins
Die Bilateralen
Die Wundheilung
Die Geburtsstunde der Guillotineklausel
Auftakt zu den Verhandlungen
Personenfreizügigkeit, Äpfel und Birnen
Die flankierenden Massnahmen und die Geburt der Europakoalition
Vom ersten zum zweiten Paket
Tanz ums Bankgeheimnis
Reisen ohne Barrieren – das Kunststück «Schengen»
Der Bilateralismus: Jahre des stillen Glücks
Das Rahmenabkommen
Eine Schweizer Idee
Brüssel übernimmt
Schwung – und Meinungsumschwung
Zuwanderungsinitiative: der Anfang vom Ende?
Und dann kam der Brexit
«Reset» und mehr: Wiederbelebungsversuche
Das Drama um rote Linien, der Zerfall der Europakoalition und das Treffen im «Savoy»
26. Mai 2021: wie es zum Abbruch kam
Offenes Feld oder grosse Leere? Die Reaktionen
Das Abkommen, das niemand wollte
Epilog: Europa bleibt
Chronologie
Anhang
Die Schweiz und Europa Karikaturen von Patrick Chappatte
7. Dezember 1992: Die Deutschschweizer Mehrheit lehnt den Beitritt zum EWR ab.
© Chappatte in L’Hebdo
25. Mai 2000: Das Volk nimmt die bilateralen Verträge an.
© Chappatte in Die Weltwoche
2. Juni 2002: Die bilateralen Verträge treten in Kraft.
© Chappatte in NZZ am Sonntag
27. September 2005: 54,6 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer stimmen «Schengen» zu.
© Chappatte in Le Temps
8. Februar 2011: Die Schweiz und Europa.
© Chappatte in Le Temps
22. Dezember 2011: Die Banken und der Steuerbetrug.
© Chappatte in Le Temps
22. Mai 2012: Ein Land im Schutz der Krise.
© Chappatte in Le Temps
2. Oktober 2012: Brüssel setzt der bilateralen Annäherung ein Ende.
© Chappatte in Le Temps
13. April 2013: Das Ende des Bankgeheimnisses.
© Chappatte in Le Temps
16. Februar 2014: Der Stadt-Land-Graben: nach der Annahme der «Masseneinwanderungsinitiative».
© Chappatte in NZZ am Sonntag
8. März 2014: Das Erasmus-Programm wird nach der Annahme der «Masseneinwanderungsinitiative» unterbrochen.
© Chappatte in Le Temps
28. Juni 2016: Europa, die Briten und die Schweizer.
© Chappatte in Le Temps
27. Mai 2021: Aus für das Rahmenabkommen.
© Chappatte in Le Temps
Einleitung
Es war eine seltsame Szenerie an jenem späten Maitag im Jahr 1992 an der Rue de la Loi, mitten im Brüsseler Europaviertel. Einer von uns Korrespondenten hatte erfahren, dass der damalige Vertreter der Schweiz bei den Europäischen Gemeinschaften (EG), Botschafter Benedikt von Tscharner, das Schweizer EG-Beitrittsgesuch offiziell übergeben würde. Eine Feier war nicht geplant, das Geschäft war wohl zu heikel, low profile war angesagt, die Medienvertreter wurden nicht informiert. Dennoch machte die Information die Runde, und so kam es, dass sich eine kleine Gruppe Schweizer Korrespondenten vor dem Gebäude des Ministerrats einfand, um dem «historischen Akt» beizuwohnen. Einer von uns, mein Freund Jörg Thalmann, Korrespondent der Basler Zeitung, hatte in seinem Fundus noch ein paar Schweizer Devotionalien gefunden und brachte einige Schweizer Fähnchen und anderen patriotischen Krimskrams mit. Nach wenigen Minuten war der Spuk vorbei, von Tscharner hatte dem amtierenden Präsidenten des Ministerrats, dem Portugiesen João de Deus Pinheiro, den unauffälligen Brief formlos übergeben und machte sich zusammen mit dem ihn begleitenden Praktikanten Roberto Balzaretti, dem späteren Staatssekretär, wieder auf den Weg zurück in sein Büro. Wer immer uns damals überhaupt gesehen haben mag, wird sich gewundert haben über dieses eigenartige helvetische Grüppchen mitten im tosenden Brüsseler Strassenverkehr.
So prosaisch sah also die Realität unserer Europapolitik – immerhin das vielleicht wichtigste Thema der Schweizer Politik – damals aus. Der Tag war grau, erinnere ich mich, obwohl ich leider kein Tagebuch geführt habe, Nieselregen in Brüssel.
Ich war mit meiner Freundin und späteren Frau gerade erst in der europäischen Hauptstadt angekommen und richtete mich als Korrespondent für einen kleinen Pool schweizerischer Regionalzeitungen ein. Wir waren mit der Vorstellung nach Brüssel gereist, an Grossem teilzuhaben. Und danach sah es auch aus: Kurz vorher war der Eiserne Vorhang gefallen, die Mauer, die Berlin trennte, war niedergerissen worden; die Sowjetunion zerfiel; die Europäischen Gemeinschaften ihrerseits waren mit dem Vertrag von Maastricht daran, zur Europäischen Union (EU) inklusive Wirtschafts- und Währungsunion zusammenzuwachsen und einen grossen Integrationsschritt zu tun; und das Binnenmarktprogramm des damaligen Kommissionspräsidenten Jacques Delors versprach die Schaffung eines riesigen Wirtschaftsraums, in dem Personen, Güter, Dienstleistungen und Kapital frei und ohne Grenzen zirkulieren konnten.
Da war viel Aufbruch – nach Jahren des Kalten Kriegs, der Stagnation, der Eurosklerose und ja, auch der Langeweile. Brüssel, heute Inbegriff des bleiernen Bürokratismus, war in diesen Jahren der Ort, wo «es» passierte, wo wichtige Entscheidungen getroffen und Weichen gestellt wurden. Für einen jungen Journalisten wie mich ein Eldorado. Auf meiner Heimredaktion, der Zürichsee-Zeitung, welche die Bildung meines Zeitungspools angeregt hatte, war man der Meinung, dass es in diesen Zeiten angezeigt war, mit einem eigenen Mann vor Ort zu sein, um die Leserinnen und Leser aus erster Hand über die europäischen Umwälzungen und deren Relevanz für die Schweiz zu unterrichten. So vital war die schweizerische Medienszene damals noch.
Doch da war dieser seltsam graue Tag im Mai 1992, der Nieselregen. Damals fiel mir das nicht auf, im Rückblick aber scheint er gleichsam symbolisch gewesen zu sein. Jedenfalls passt der erinnerte Regen ganz gut zur Schweizer Europapolitik. Denn nach dem Aufbruch kam immer wieder die Ernüchterung, oder, je nach Sichtweise, die Rückkehr zu den Realitäten:
–Noch im Jahr meiner Ankunft in Brüssel wurde aus dem Grau sogar ein vermeintliches Schwarz. Als am 6. Dezember 1992 der Vertrag über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) von Volk und Ständen abgelehnt wurde, sprach Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz in Bern von einem «dimanche noir» für die Schweiz. Und EU-Kommissar Frans Andriessen gab uns im Brüsseler Medienzentrum zu verstehen, dass die EG nie und nimmer zu bilateralen Verhandlungen bereit sein werde.
–24 Jahre nach der Übergabe des Beitrittsgesuchs folgte 2016 dessen sang- und klangloser Rückzug – oder «die Ermordung einer Leiche», wie es der Westschweizer Publizist und frühere Co-Präsident der Neuen Europäischen Bewegung, François Cherix, derb formulierte.1
–Dreissig Jahre später, 2022, liegt ein weiteres europapolitisches Grossprojekt der Schweiz in Trümmern, das institutionelle Rahmenabkommen mit der EU. Wieder viel grau, wieder wenig Aufbruch.
Gleichwohl: Auch wenn grosse Ambitionen scheiterten, die Schweiz hat in all den Jahren im Verhältnis zur EU viele Erfolge erzielt. Mit zwei bilateralen Vertragspaketen hat sie sich weitgehenden Zugang zum europäischen Binnenmarkt verschafft, mit der Teilnahme am Abkommen von Schengen geht sie in Sachen Integration sogar weiter als einige Mitgliedstaaten der EU. Und noch bemerkenswerter: Alle diese Schritte sind direktdemokratisch legitimiert. Der Schweizer Souverän hat auch in politisch hochsensiblen Fragen wie der Personenfreizügigkeit immer wieder Ja gesagt zur Kooperation mit der EU – trotz des Trommelfeuers von rechts. Das ist durchaus einzigartig in Europa.
Die Schweiz ist gegenüber der EU nicht mehr dort, wo sie 1992 stand. Ja, vielleicht werden die rund zwanzig Jahre seit Inkrafttreten der bilateralen Verträge im Rückblick dereinst als die beste Zeit im Verhältnis der Schweiz zur EU in die Geschichte eingehen: Der Wirtschaft ermöglichten die Abkommen die Teilhabe an wesentlichen Teilen des Binnenmarkts, uns allen einige wichtige Annehmlichkeiten beim barrierefreien Reisen und Leben in Europa – und dies paradoxerweise, ohne dass wir der EU politisch ein wesentliches Stück näher gekommen wären.
Eine Konstante der letzten dreissig Jahre war die lautstarke innen- beziehungsweise parteipolitische Begleitmusik. Immer, wenn es um Europa ging, flogen die Fetzen. Viele Zeitgenossen erinnern sich noch lebhaft an den Showdown im Bundesbriefarchiv in Schwyz während des Abstimmungskampfs zum Beitritt zum EWR, als der bärtige Volksmusiker Sity Domini in Anwesenheit der Bundesräte Koller und Ogi und vor laufenden Kameras behauptete, eine EWR-Mitgliedschaft bedeute Krieg und das Schweizer Volk käme zu massivem Schaden. «Es war eine unheimliche Stimmung», schrieb Arnold Koller später über diesen von Treichlern und allerlei Volksbrauchtum begleiteten Auftritt, den man als Start- und Ausgangspunkt für alle folgenden Europakampagnen bezeichnen darf.2 Immer wurde mit grobem Geschütz und hoher Aggressivität argumentiert, das nüchterne Abwägen von Vor- und Nachteilen trat in den Hintergrund.
Die Folge: Hüben und drüben wurden junge Leute in jenem Jahr politisiert. Viele davon sitzen heute in Parlamenten und Regierungen, andere machen sich in neuen Bewegungen für oder gegen die EU stark (und einige haben sich resigniert zurückgezogen). Die EWR-Debatte prägte die Schweiz wie kein zweites Thema nach dem Krieg. Es wurden Gräben aufgerissen (auch zwischen den Landesteilen), Familien gerieten sich in die Haare, Freundschaften zerbrachen. Die Parteienlandschaft der Schweiz wurde mit dem steilen Aufstieg der Schweizerischen Volkspartei (SVP) umgepflügt. Kulminationspunkt war die Wahl Christoph Blochers in den Bundesrat im Jahr 2003.
Mit der Zeit gesellte sich zu dieser Politisierung allerdings eine eigenartige Ritualisierung der Europapolitik. Es gibt im politischen Diskurs unseres Landes mittlerweile wenig, was voraussehbarer ist als ein Schlagabtausch über das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU. Selbst engagierten Beobachterinnen und Beobachtern fällt es schwer, beim Kampf der Schlagworte ein Gähnen zu unterdrücken. Alles scheint gesagt, es stellt sich der Eindruck ein, es werde um des Streits (also: um der parteipolitischen Profilierung) willen gestritten und nicht der Sache wegen. Dieser dialogue des sourds schreckt inzwischen ausserhalb der politischen Blase viele ab. Dreissig Jahre Europapolitik – sie bieten nicht nur viel Anschauungsmaterial über den Prozess der Selbstvergewisserung einer Nation. Sie sind auch ein Lehrstück über den Zwang zur Wiederholung in der Politik, ja: über die beinahe neurotische Nabelschau eines Kleinstaats. Derweil geht die Jugend wegen des Klimawandels auf die Strasse. Oder sammelt Unterschriften für eine Altersvorsorge, die den nachfolgenden Generationen eine Perspektive geben soll.
Das tut der Relevanz des Themas keinen Abbruch. Die Europadebatte steht an einem toten Punkt. Zwar blitzen die Neunziger immer wieder auf – etwa, wenn Exponentinnen und Exponenten der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz (SP), die massgeblich am Aus des Rahmenabkommens beteiligt war, den EU-Beitritt wieder aufs Tapet bringen möchten.
Doch es sind neue Ideen gefragt. Ein Beitritt ist derzeit unvorstellbar, aber auch die jahrelange, erfolgreiche bilaterale Methode scheint an ihr Lebensende gelangt zu sein. Die EU ihrerseits muss nach dem Austritt Grossbritanniens Vorstellungen darüber entwickeln, wie sie künftig mit weniger integrationswilligen europäischen Drittstaaten umgehen will. Bisher hat sie sich diesbezüglich recht dogmatisch verhalten – nicht zuletzt, um ihren Binnenmarkt, den innersten Kern der europäischen Integration, zu schützen. Denn dieser hat allen Anfeindungen und Krisen getrotzt. Und davon gab es in den letzten Jahren genug. Aber auch das gehört zum Neuanfang: die Erkenntnis, dass die EU nicht verschwindet, was viele ihrer Schweizer Gegner hofften und hoffen. Sie bleibt bestehen; als womöglich etwas weniger verführerische Braut wie zu Beginn der 1990er-Jahre, aber als eine Realität, an der kein Weg vorbeiführt.
Das Dilemma, das Herbert Lüthy schon 1961 in seinem glänzenden Essay über die «Schweiz als Antithese» auf den Punkt gebracht hat, begleitet die Schweiz nach wie vor: «Wir diskutieren besorgt die Haltung, die wir gegenüber der wirtschaftlichen Integration Europas einnehmen sollen […]; und während wir darüber diskutieren, als ob es sich um eine Sache handelte, die wir nehmen oder zurückweisen können, vollzieht sich diese Integration Tag für Tag unmerklich und unaufhaltsam, und sie lässt sich nicht dadurch rückgängig machen, dass wir uns weigern, an ihrer Organisation teilzunehmen. Es scheint, dass wir mit uns selbst uneinig sind und dass unser Wille, im wirtschaftlichen Wettlauf mitzugehen, uns ständig in Widerspruch zu unserem politischen Willen bringt, das zu bleiben, was wir sind – oder vielmehr, was wir waren.»3
Es ist eine gute Zeit für eine Rückschau – selbst wenn manche Politikerinnen und Politiker jetzt, nach dem Debakel um das Rahmenabkommen, forsch meinen, es gelte, nach vorn zu schauen. Das vorliegende Buch lädt zum Innehalten ein. Es will die letzten dreissig Jahre schweizerischer Europapolitik in groben Zügen nachzeichnen, als ein Stück lebendige und spannende Zeitgeschichte. Während bisherige Darstellungen vor allem Vorgänge der Diplomatie und der Aussenwirtschaftspolitik darlegten, sollen hier auch die mit der EU-Frage verbundenen innenpolitischen Entwicklungen und Verwerfungen beleuchtet werden, etwa der Familienstreit im bürgerlichen Lager oder die Bildung beziehungsweise der Zerfall der EU-freundlichen Koalition von Mitte-Links.
Wo stehe ich? Gewiss, ich bin nicht mehr der junge, erwartungsfrohe Europakorrespondent in Brüssel. Sondern ein gestandener Politbeobachter, den das Europathema nicht mehr losliess und der es – manchmal näher, manchmal distanzierter – stets verfolgte. Ich bin, das sei auch transparent gemacht, leidenschaftlich gern Europäer und frage mich manchmal, warum um alles in der Welt wir zwar die italienische Küche und Kultur verehren, die Kathedralen Frankreichs bestaunen und uns in den Weiten Skandinaviens erholen, uns gleichzeitig aber so schwertun mit der politischen Gestalt unseres Kontinents, die ja doch eine ganz andere – demokratischere, freiheitlichere – ist als die jenige unserer Eltern und Grosseltern. Stünde man auf dem Mond und würde mit dem Fernglas Europa suchen, würde man Jakob Kellenberger, dem ehemaligen Chefunterhändler in den Verhandlungen der Schweiz mit der EU zu den bilateralen Verträgen, vielleicht zustimmen: «Begründungspflichtig für ein Land in der Lage der Schweiz ist nicht der EU-Beitritt, sondern seine Ablehnung.»4
Ja, dieses Buch ist aus einer europafreundlichen Perspektive geschrieben. Aber es wird versucht, fair zu sein und den unterschiedlichen Sichtweisen Rechnung zu tragen – in der etwas verwegenen Hoffnung, dass nun, da wir am Anfang eines neuen Kapitels stehen, ein vernünftiger Dialog über die Stellung der Schweiz in Europa zustande kommen kann.
Übrigens: Es kann auch ganz wunderbares Wetter sein in Brüssel, dieser unterschätzten Hauptstadt Europas.
DER EWR
Die Zeitenwende von 1989
«Wo warst Du damals eigentlich?», wurde ich gefragt. Es war eine Tischrunde vor noch nicht allzu langer Zeit. Wir tauschten Erinnerungen an jene Herbsttage 1989 aus, als sich in Berlin Historisches zutrug und die Mauer fiel. Ich habe präzise Erinnerungen an 9/11 und an alle anderen Daten der jüngeren Geschichte, auch daran, was ich dann gerade machte und wo ich war. Aber 1989? Irgendwie im Nebel. Dabei war ich damals schon längst erwachsen und am Ende meines Studiums angelangt.
Allmählich dämmerte es mir. Ich war im Militärdienst. Ein Blick ins Dienstbüchlein schuf Klarheit: In jenen Novembertagen war ich im Wiederholungskurs. Die Übung «Dreizack» brachte 24 000 von uns Wehrmännern ins Rheintal. Genau genommen war es die zweite Auflage von «Dreizack», denn bereits 1986 hatte ein solches Grossmanöver Zehntausende Soldaten in Bewegung gesetzt. In der Ostschweiz wurde unter anderem die Zusammenarbeit zwischen zivilen und militärischen Stellen bei der Krisenbewältigung geübt. Hintergrund war die «Nordostbedrohung», wie man damals sagte, also die Möglichkeit eines Angriffs der Mitgliedstaaten des Warschauer Pakts.
Man muss sich das einmal vor Augen führen. Das Manöver endete am 23. November 1989. Also exakt zwei Wochen nach dem Fall der Berliner Mauer. Und drei Tage vor der Abstimmung über die Abschaffung der Armee, die sich wie eine Schockwelle über die Schweiz legte. Mehr als 35 Prozent der Stimmberechtigten votierten damals für die Abschaffung der Armee, sogar zwei Kantone stimmten zu. Niemand hatte ein solches Resultat erwartet, schliesslich schien die Armee unverrückbar zur Grundausstattung der Eidgenossenschaft zu gehören.
Allein die Datenkonstellation zeigt, wie rasch alles ging und wie der europäische Aufbruch jener Jahre die Schweiz aus dem Tritt brachte. Alte Gewissheiten brachen zusammen. Nicht einmal das Innerste, die Armee, der grosse und nach dem Zweiten Weltkrieg nie hinterfragte Integrationsmotor der vielgestaltigen Schweiz, blieb davon verschont.
1989 war der Anfang einer Phase hoher Ereignisdichte. Paukenschlag folgte auf Paukenschlag. Der «Fichenskandal», der die teilweise willkürliche Überwachung von Hunderttausenden Personen und Organisationen während des Kalten Kriegs aufzeigte, sorgte ebenso für Schlagzeilen wie später die Enthüllungen über die P-26 beziehungsweise P-27, jener paramilitärischen beziehungsweise nachrichtendienstlichen Organisationen, die im Geheimen für den Fall einer sowjetischen Besetzung der Schweiz gebildet worden waren.
Polemiken um den Auftritt der Schweiz an der Weltausstellung in Sevilla (mit dem Slogan «La Suisse n’existe pas!» als aufwühlendem Motto) oder um den Boykott der Kulturschaffenden aus Anlass der für 1991 geplanten Feiern zum 700-Jahr-Jubiläum der Eidgenossenschaft offenbarten das Bild einer verunsicherten Nation. Was sich in Berlin oder am Grenzübergang Klingenbach/ Sopron abspielte, nachdem der österreichische Aussenminister Alois Mock und sein ungarischer Amtskollege Gyula Horn mit einer Drahtschere den Eisernen Vorhang durchschnitten hatten – das ging auch die Schweiz etwas an. Vor diesem Hintergrund sind die Debatten über die EWR-Mitgliedschaft einzuordnen.
Plötzlich stand das grosse Ganze zur Disposition, nämlich die Rolle der Schweiz in einer sich wandelnden Welt. Das erklärt auch, warum die Frage der europäischen Integration mit derartiger Vehemenz diskutiert wurde. Höchst unterschiedliche Interpretationen der Schweiz trafen nun aufeinander: hier ein Land der Gewissheiten und Traditionen, denen man gerade in unsicheren Zeiten Sorge tragen wollte, dort ein Land des Aufbruchs, das sich am Zeitgeist orientieren sollte.
Doch die Verbindung zwischen den grossen Weltereignissen und der Schweizer Europapolitik war durchaus konkret. «Es gibt […] Verbindungen vom grossen west-östlichen Gezeitenstrom über den EWR-Wirbel zum Kentern des Schweizer Bootes!», schrieb Dieter Freiburghaus in seiner Studie über sechzig Jahre Schweizer Europapolitik. Ein paar Stichworte dazu: Die Rahmenbedingungen des EWR-Projekts veränderten sich mit den dramatischen weltpolitischen Entwicklungen rasch. Die EG beschleunigte die Integration nach Jahren des Stillstands mit dem Maastrichter Vertrag, und die Staaten der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), lange Jahre die natürlichen Partner der Schweiz, versuchten angesichts der Unsicherheiten, unter das Dach der EU zu kommen. Vor dem und im Verhandlungsprozess stellten sie die Weichen in Richtung EG-Beitritt. Der EWR, so noch einmal Freiburghaus, «transformierte sich […] von einer eigenständigen neuen Form der ökonomischen Integration in Westeuropa zu einem ‹Trainingslager› für den Beitritt»5 – eine alte Streitfrage, die jüngst mit der Veröffentlichung vertraulicher Sitzungsprotokolle des Bundesrates von 1991 durch die Forschungsstelle Dodis neue Nahrung erhalten hat.6 Doch der Reihe nach.
Zunächst schien es, als könnte die Schweiz in jenen Jahren europapolitisch in gewohnter Weise Schritt für Schritt vorgehen. Nicht weniger als 16 Jahre (sic!) hatte Bern mit der EG über ein Versicherungsabkommen verhandelt, 1989 war es in Kraft getreten.
Mit dieser Erfahrung und einer über Jahre gepflegten, stark wirtschaftspolitisch geprägten Sicht auf Europa legte die Schweizer Diplomatie im August 1988 dem Bundesrat einen Integrationsbericht vor. Darin hiess es, es gelte für die Schweiz, «wettbewerbsfähig zu bleiben und damit beitrittsfähig zu sein, um den Zwang zur Mitgliedschaft zu vermeiden».
Die Formulierung ging auf Staatssekretär Franz Blankart zurück, der die Kurzformel geprägt hatte: «Beitrittsfähig sein, um nicht beitreten zu müssen.» Diese Aussage konnte durchaus zweideutig interpretiert werden, denn sie implizierte, dass man überhaupt beitreten kann. Doch wie Bundesrat Arnold Koller später schrieb, «signalisierte das Kürzel […]: Wir wollen unabhängig bleiben, und dafür müssen wir wettbewerbsfähig sein».7
Im Sommer, noch vor dem Fall der Berliner Mauer, war das die wohl vorherrschende Sicht im Bundeshaus. Es schienen alle Optionen offen zu stehen. Und wer weiss: Vielleicht hätte sich unter dieser Prämisse sogar ein kluger und passender Ansatz gefunden, ein window of opportunity sozusagen, um spätere, unter Druck und allzu rasch getroffene Entscheide besser vorbereiten zu können. Es hätte aber schon sehr viel Kraft gebraucht, sich gegen den Zeitgeist zu stemmen.
Denn die Integration in Europa lief in jenen Jahren auf Hochtouren und nahm keine Rücksicht auf das gemächliche Tempo der direktdemokratischen eidgenössischen Politik.
Schon 1985 schlug der damalige EG-Kommissionspräsident Jacques Delors einen ersten Pflock ein, als er sich anschickte, den europäischen Binnenmarkt zu «verwirklichen», wie man damals sagte. Der Binnenmarkt wurde zwar schon 1957 in den Römischen Verträgen erwähnt, der Gründungsakte der EU. Aber er blieb weitgehend ein Papiertiger, bis Jacques Delors’ Kommission 1985 das «Weissbuch» veröffentlichte, das präzise Massnahmen vorsah, welche zu dessen Umsetzung notwendig waren. Das «Weissbuch» enthielt zudem einen Zeitplan und ein magisches Datum: Schon am 31. Dezember 1992 sollte der Binnenmarkt vollendet sein. «Ist es vermessen, den Beschluss anzukündigen und dann auch durchzuführen, bis 1992 alle innergemeinschaftlichen Grenzen aufzuheben?», fragte Delors anlässlich seiner Antrittsrede im Januar 1985 vor dem Europäischen Parlament in Strassburg. Das war der erste Weckruf.
Er löste in der Schweizer Wirtschaft Hoffnungen, aber auch Unsicherheit und Angst aus – berechtigterweise. Denn die Formulierung «wettbewerbsfähig bleiben» aus dem Integrationsbericht von 1988 war ziemlich euphemistisch.
Tatsache war, dass die Schweiz damals wirtschaftlich ein zweigeteiltes Land war. Ihre Exportindustrie war zweifellos hoch kompetitiv und international ausgerichtet. Ihre Binnenwirtschaft hingegen agierte träge, wurde von der Politik protegiert und war in Kartellen organisiert. Die Schweiz war keineswegs die wettbewerbsfreudige, liberale Nation, als die sie sich gerne sah. «Es gab das Zementkartell, das Optikerkartell, das Bierkartell, 16 Bankenkartelle und zahllose weitere», brachte es der Ökonom und frühere Gewerkschaftssekretär Beat Kappeler einmal auf den Punkt.8 Kappeler war in der Zeit um 1990 im Rahmen der Kartellkommission im Übrigen mitbeteiligt daran, dass diese Kartelle später eines nach dem anderen fielen.
Da war also die Einsicht, dass in der Schweiz einiges zu tun war. Und da war die EG, die sich mit Siebenmeilenstiefeln daranmachte, den grossen europäischen Markt zu realisieren.
Bemerkenswert: Für einen kurzen Moment gab es zwischen der Schweiz und Brüssel so etwas wie eine Parallelität der Interessen; beide erblickten das Rezept der Zukunft darin, die Wirtschaft von regulatorischen Hindernissen zu befreien. Es gab in der Geschichte der Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU nur ganz selten einen vergleichbaren Moment der Übereinstimmung.
Mit Delors’ ambitionierten Plänen wurde die EG zu einer verlockenden Braut, die in der Schweiz allmählich das gesteigerte Interesse gewisser Wirtschaftskreise auf sich zog. Spät erkannten sie, dass sich da etwas zusammenbraute, was für sie ganz unmittelbar von Wert sein könnte. Plötzlich mussten sich auch die Chefs von kleineren und mittleren Betrieben mit der Brüsseler Gemeinschaft befassen. Die grossen, exportorientierten Konzerne verfügten schon länger über entsprechende Fachleute und aussenwirtschaftliches Know-how.
Aufmerksamkeit erregte Delors’ Projekt aber auch anderswo in Europa und in Milieus, die der EG sonst nie viel abgewinnen konnten. Zu einer glühenden Anhängerin des Binnenmarkts wurde zum Beispiel die britische Premierministerin Margaret Thatcher, später eine Ikone aller Europagegner. Im April 1988 versammelte sie die Crème de la Crème der britischen Wirtschaft im Lancaster House in London, um den Firmenchefs den Binnenmarkt schmackhaft zu machen. Sie sollten sich einmal vorstellen, sagte sie zu den Wirtschaftskapitänen, was das bedeute: ein «einziger Markt ohne Grenzen – sichtbare oder unsichtbare –, der Ihnen direkten und ungehinderten Zugang zur Kaufkraft von mehr als 300 Millionen der reichsten und wohlhabendsten Menschen der Welt gibt». Es war die wahrscheinlich europafreundlichste Rede, welche die konservative Politikerin je gehalten hatte. Nach den Zöllen würden nun auch die anderen Handelshemmnisse zwischen den Staaten der EG beseitigt: unterschiedliche Industriestandards, komplizierte Einfuhrgenehmigungen, beschränkte öffentliche Ausschreibungen. «Wir haben eine Chance, wieder Anführer der Welt zu werden», so Thatcher damals.9 Für den Binnenmarkt war sie bereit, manche Kröte zu schlucken: Mehrheitsentscheidungen im Ministerrat etwa oder mehr Mitsprache für das Europäische Parlament. Erst später, in ihren Memoiren, hat sie sich von ihrer damaligen Euphorie teilweise distanziert.
Jedenfalls standen die Europäischen Gemeinschaften auf dem Zenit ihrer Popularität in Wirtschaftskreisen. Und angesichts der neuen Dynamik wurde klar, dass sich aus eigenen Kräften würde anstrengen müssen, wer nicht Teil der Organisation sein wollte. In der Geschichte der Schweizer Europapolitik taucht dieser Topos übrigens immer wieder auf: im Schweizer «Weissbuch» etwa, das 1995 eine aufgeregte Debatte über wirtschaftspolitische Reformen in der Schweiz anstiess. Oder in der freisinnigen Forderung nach einer «Fitnesskur» nach dem Abbruch der Verhandlungen über das Rahmenabkommen. Ein Abseitsstehen der Schweiz ohne eigene Anpassungsleistung ist jedenfalls nicht zu haben. Das ist ein wichtiger Befund. Denn er erklärt auch, warum es von linker Seite immer viel Skepsis gegenüber der europäischen Integration gab und gibt. Für viele Linke war und ist sie ein neoliberales Projekt. Darauf wird später ausführlicher einzugehen sein.
Die Verhandlungen
Dann ging plötzlich alles ganz rasch. Vier Jahre nach seiner Antrittsrede in Strassburg doppelte Jacques Delors im Europäischen Parlament nach. Im Januar 1989 lancierte er dort eine Initiative «zur Gründung eines Europäischen Wirtschaftsraumes» zwischen den damals zwölf EG- und sieben EFTA-Staaten. Dabei sei eine «neue Form der Assoziation zu suchen, die in institutioneller Hinsicht stärker strukturiert sein sollte, mit gemeinsamen Entscheidungs- und Verwaltungsorganen». Es war der Start zum EWR-Drama.
Europapolitische Alternativen, wie sie noch im erwähnten Integrationsbericht von 1988 diskutiert wurden – die Rede war darin von einer Assoziation mit der EG, einer Zollunion EG–EFTA und, interessanterweise, einem Rahmenabkommen –, standen bald nicht mehr zur Debatte. Ein «radikaler Kurswechsel» der schweizerischen Europapolitik, der noch ein Jahr zuvor in besagtem Bericht als «unnötig» erachtet wurde, stand bevor. Fortan ging es nur noch um den EWR (und auch um den Vollbeitritt zur EG).
«Die EFTA-Länder schnappten nach diesem Köder wie ausgehungerte Forellen», beschrieb Jörg Thalmann, der Brüsseler Korrespondent der Basler Zeitung, in seinen unveröffentlichten Memoiren die Reaktion auf Delors’ Rede.10 Schon am 20. März 1989 fand in Brüssel eine informelle Ministerkonferenz zwischen der EG, den EG-Mitgliedstaaten und den EFTA-Staaten statt. Es wurde beschlossen, unverzüglich informelle Gespräche aufzunehmen. Nach Sondierungs- und sogenannten exploratorischen Gesprächen begann die erste formelle Verhandlungsrunde im Juli 1990.
Doch wer verhandelte da eigentlich mit wem? EG-seitig war es einigermassen klar: Die Kompetenz lag bei der Brüsseler Kommission – soweit es sich um Handelsfragen drehte. Ging es allerdings um die Regelung institutioneller Fragen, dann schaltete sich auch der Europäische Gerichtshof (EuGH) ein. EFTA-seitig war es wesentlich komplizierter, weil sie keine supranationale Organisation mit Aussenhandelskompetenz war. Die EFTA war 1960 in Stockholm gegründet worden, um ein Gegengewicht zu den Europäischen Gemeinschaften zu bilden.11
In der alten Welt verhandelten die EFTA-Staaten je einzeln mit Brüssel. Nunmehr verlangte die EG, die EFTA-Staaten müssten mit einer Stimme sprechen – was diese vor grosse Herausforderungen stellte. Besonders für die Schweiz war das eine Knacknuss. Es zwang sie zu zweifachen Konzessionen in den EWR-Verhandlungen: zuerst innerhalb der EFTA, dann gegenüber der EG.
Es war eine schwierige Anfangskonstellation, mit ungleichen und nicht allzu gefestigten Verhandlungspartnern und mit EFTA-Staaten, die schon früh auf die Beitrittsoption setzten und deshalb zu einem weitgehenden Entgegenkommen bereit waren. So war es erstaunlich, «dass ein EWR-Vertrag überhaupt zustande kam», wie es Dieter Freiburghaus später treffend formulierte.12
Worum ging es? Der neu zu schaffende gemeinsame Wirtschaftsraum sollte durch die Einführung der sogenannten vier Freiheiten (Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr) auf der Basis des relevanten EG-Rechtsbestandes («acquis communautaire») errichtet werden – mit Ausnahmen (z. B. für die Fischerei und die Landwirtschaft) und Übergangsfristen. Institutionelle Fragen kamen dazu und stellten vor allem aus Schweizer Sicht das grösste Hindernis dar: die Ausgestaltung der Überwachung, die Gerichtsbarkeit, die Frage der Mitentscheidung beim künftig relevanten EWR-Folgerecht.
Und tatsächlich: Die Konflikte zeichneten sich schon bald ab. Bereits im Januar 1990, also noch vor der offiziellen Eröffnung der Verhandlungen, machte Jacques Delors einen gewichtigen Rückzieher, indem er seine spektakuläre Zusage «gemeinsamer Entscheidungs- und Verwaltungsorgane» relativierte. Eine «gewisse Durchlässigkeit» zwischen der EG und der EFTA müsse natürlich gewährleistet sein, sagte der Franzose im Europäischen Parlament, aber es sei nicht denkbar, «bis zu einer Mitentscheidung zu gehen, die sich letztendlich nur aus einem Beitritt ergeben kann».
Es war der erste Dämpfer in einem Verhandlungsmarathon, welcher die Schweiz mancher Illusionen beraubte. Jedenfalls wich der anfängliche Zauber ziemlich rasch der Ernüchterung. Selbst der europhile Schweizer Aussenminister René Felber ärgerte sich über die EG: «Wir sind uns nicht gewohnt an Leute, die jedes Jahr die Sprache wechseln: Man hat uns im Januar 1989 gemeinsame Institutionen angeboten und ein Recht auf Mitentscheidung», liess er sich in der Freiburger Zeitung La Liberté zitieren.13 Die Überraschung, das sei hier angefügt, war allerdings etwas gespielt. Man wusste in Bern durchaus schon früh, dass die Gemeinschaft grössten Wert auf ihre Entscheidungsautonomie legte.14
Delors stand im Übrigen nicht allein da mit seiner Äusserung. Anlässlich eines Besuchs in Bern am 20. September 1990 befand auch die britische Premierministerin Margaret Thatcher, Nichtmitgliedstaaten der EG könnten nicht an den Entscheidungen der Gemeinschaft mitwirken. Bei ihrem Besuch gab Thatcher «unmissverständlich» (NZZ) zu verstehen, dass sie einen Beitritt der Schweiz als Vollmitglied der EG sehr begrüssen würde. Vielleicht, weil sie als Britin ein besonderes Gespür dafür hatte, dass der EWR souveränitätspolitisch problematisch sein würde?
Die Gespräche gestalteten sich hart und zäh, allerdings weniger mit Blick auf die materiellen Fragen. Selbst wenn die Liste der Ausnahmewünsche zu Beginn noch lang war, war man sich relativ rasch einig darin, dass der EWR grundsätzlich auf dem EG-Recht beruhen sollte. Meinungsunterschiede gab es hingegen bei der Frage der Übernahme und Weiterentwicklung des «acquis», der Überwachung des Abkommens und der Institutionen – aus heutiger Sicht sind dies vertraute Töne. Die EG wünschte sich ein Zweipfeilersystem, die EFTA möglichst gemeinsame, für beide Seiten zuständige Organe. Auf Drängen der Schweiz etablierte die EFTA in den Verhandlungen ein Junktim zwischen materiellen Fortschritten und der Lösung der institutionellen Fragen.
Sie stand damit allerdings je länger, je mehr im Abseits. Ein Beispiel: Irgendwann kamen die Gespräche unvermeidlich zu der Frage, was geschehen sollte, wenn ein EFTA-Staat einen für den EWR relevanten EG-Beschluss nicht nachvollziehen konnte oder wollte. Im Jargon sprach man von der Möglichkeit eines opting-out. Galt der Nichtnachvollzug dann für die EFTA als Ganze oder für jedes einzelne Land? Alle EG- und EFTA-Staaten waren für ersteres, nur die Schweiz beharrte wochenlang auf einem individuellen opting-out. In Brüssel fasste man diesen Positionsbezug als klassischen Fall von Rosinenpickerei auf, auf den es aus EG-Sicht nur eine Antwort geben konnte: keine Kompromisse. «You can have your opting-out. Just now!», soll der impulsive italienische Aussenminister Gianni De Michelis den Bundesräten Felber und Delamuraz entgegengeschleudert und dabei Richtung Türe gewiesen haben, als diese in einer Ministerrunde einmal mehr auf dem individuellen opting-out beharrten.15
Selbst den EFTA-Partnern gegenüber, denen ein rascher Abschluss wichtiger war als die Erörterung kniffliger staats- und völkerrechtlicher Überlegungen, war die schweizerische Position schwer vermittelbar. «Der Bundesrat verfing sich immer mehr in der institutionellen Frage», fand auch Bundesrat Arnold Koller, der bei allen institutionellen Mängeln stets an den EWR-Vertrag geglaubt hatte. «Darob gerieten die positiven Verhandlungsergebnisse (Ausnahmen der Landwirtschaft und der Steuerharmonisierung, Vetorecht, Mitwirkung beim decision shaping, Kündigungsrecht, Vereinbarkeit mit der Neutralität, keine Übertragung von Hoheitsrechten an die EG) immer mehr in den Hintergrund.»16
Hatte Koller recht? Wäre die Geschichte anders ausgegangen, hätte man sich nicht derart in diese institutionellen Fragen verbissen und sich stattdessen mehr mit dem materiellen Gehalt des EWR auseinandergesetzt?
Rückblickend ist das schwierig zu beurteilen. Möglicherweise gewichtet man diese Fragen in der Schweiz tatsächlich zu hoch. Sie waren und sind den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern schwer zu vermitteln, weil sie hoch komplex sind und die Details letztlich kaum jemanden ausser Juristinnen und Politiker interessieren. Andererseits bieten sie bis in unsere Tage argumentative Leerstellen, die sich in der direkten Demokratie bestens instrumentalisieren lassen – von beiden Seiten. Wird etwa die Frage der Mitbestimmung nicht überzeugend gelöst, ist vonseiten der EU-Befürworter rasch das Argument der «Satellisierung» zur Hand. Nur wer Vollmitglied in der EU sei, könne mitbestimmen, nur so sei die Satellisierung zu vermeiden und ein Souveränitätsverzicht überhaupt zu rechtfertigen. Umgekehrt meinen die EU-Gegner, Satellisierung sei unbedingt zu vermeiden, weswegen man sich von der EU unbedingt fernhalten müsse. Die Diskussion um «fremde Richter» bewegt sich in ähnlichen Kategorien.
Wie auch immer: Mitte 1991 drohten die EWR-Verhandlungen zu scheitern. Im September 1991 sprach sich Alt-Nationalbankpräsident Fritz Leutwyler öffentlich für deren Abbruch aus, und Bundespräsident Flavio Cotti erklärte am Europatag im Rahmen der 700-Jahr-Feierlichkeiten vor rund tausend Gästen aus ganz Europa, der EWR verliere in letzter Zeit an Attraktivität – «was prompt zu einem Krach im Bundesrat führte», so Arnold Koller.17
Trotzdem schleppte man sich noch über die Ziellinie, dank massiver Konzessionen der EFTA-Staaten. Die EG setzte ihr Zweipfeilersystem durch und erteilte gemeinsamen Organen erfolgreich eine Absage. Und dem gemeinsamen EWR-Gerichtshof – ursprünglich eine conditio sine qua non der Schweiz – zog nach Abschluss der Verhandlungen der EuGH den Stecker, indem er befand, ein solches Gericht sei mit den Römischen Verträgen nicht vereinbar. So setzte sich am Ende auch hier das Zweipfeilermodell der EG durch. Und die EFTA musste einen eigenen Gerichtshof schaffen. Im Falle der Verweigerung der Übernahme eines EG-Rechtsaktes durch die EFTA hatte man die vorläufige Ausserkraftsetzung einzelner Abkommensteile zu gewärtigen.
Rechtzeitig zur Unterzeichnung des EWR-Abkommens am 2. Mai 1992 in Porto war schliesslich auch das Transitabkommen EG–Schweiz unter Dach. Darin verpflichtete sich die Schweiz zum Bau der Neuen Eisenbahn-Alpentransversalen (NEAT) und musste im Gegenzug (wenige) Konzessionen beim höchstzulässigen Lastwagengewicht machen.





























