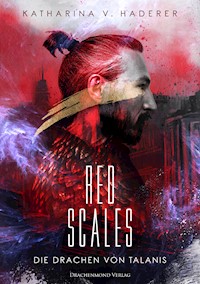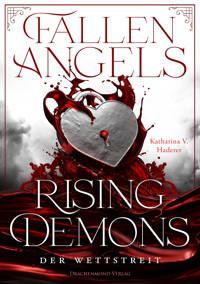9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Black Alchemy
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Mythen und Magie, Action und Abenteuer: der Auftakt zu einem packenden High-Fantasy-Epos von einer neuen weiblichen Stimme. Als Sergent Erik Zejn degradiert und von der Hauptstadt ins Vorland versetzt wird, rechnet er mit Ereignislosigkeit und Langeweile. Doch dann erheben sich die Toten aus den Gräbern und greifen die Lebenden an. Zejn steht vor der größten Herausforderung seines Lebens: Er muss herausfinden, wie er die Toten für immer zurück unter die Erde schicken kann. Die Einzige, die mehr über die unheimlichen Vorgänge zu wissen scheint, ist die Kräuterhexe Mirage. Doch Zejn ist sich sicher, dass man ihr nicht trauen kann. In Wahrheit ist Mirage Alchemistin und versucht alles, um die Bedrohung aufzuhalten. Nur deshalb ist sie immer in der Nähe, wenn die Toten erwachen. Schnell beginnt die Bevölkerung zu glauben, dass sie für die Angriffe verantwortlich ist und wendet sich gegen sie. Wenn Mirage sich selbst retten will, muss sie ihre Unschuld beweisen und die Toten für immer zurück unter die Erde bringen. Weder Zejn noch Mirage ahnen, dass die Toten nicht ihre einzigen Feinde sind. Alle Bände der »Black Alchemy«-Reihe: Das Schwert der Totengöttin Der Garten der schwarzen Lilien Der Herrscher des Waldes
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 421
Ähnliche
Katharina V. Haderer
Das Schwert der Totengöttin
Roman
Knaur e-books
Über dieses Buch
Als Sergent Erik Zejn degradiert und von der Hauptstadt ins Vorland versetzt wird, rechnet er mit Ereignislosigkeit und Langeweile. Doch dann erheben sich die Toten aus ihren Gräbern und greifen die Lebenden an.
Die Einzige, die mehr über die unheimlichen Vorgänge zu wissen scheint, ist die Alchemistin Mirage. Zejn ist sich sicher, dass sie für die Angriffe verantwortlich ist, und setzt alles daran, sie auf den Scheiterhaufen zu bringen.
Um ihr Leben zu retten, muss Mirage ihre Unschuld beweisen und die Toten für immer zurück unter die Erde bringen.
Doch weder Zejn noch Mirage ahnen, dass die Toten nicht ihre einzigen Feinde sind.
Inhaltsübersicht
Dieses Buch widme ich allen Frauen und Mädels –
den Gamerinnen und DSA-Geeks,
den Witcher- und Game-of-Thrones-Fans der ersten Stunde,
den Liebhaberinnen und Autorinnen dunkler, blutiger Geschichten,
den Werwolf-Spielleiterinnen und Whiskey-Trinkerinnen,
den LARPerinnen und Bogenschützinnen,
den Lagerfeuerliebenden und Abenteurerinnen.
Und, Männer: Falls ihr so eine noch nicht zu Hause habt, solltet ihr euch schleunigst eine besorgen.
I
ZEJN
1
Etwas fehlte.
Es dauerte eine Weile, bis Sergent Erik Zejn merkte, was er vermisste – im Allgemeinen war es einfacher, Dinge zu finden, die da waren statt verschwunden.
Prüfend sog er die Landluft ein. Der Geruch nach Baumharz, feuchter Erde und Ziegendung wirkte fremd in seiner Nase.
Wo blieben der Unrat, den die Menschen aus den Fenstern zu kippen pflegten, der Urin an den Straßenecken, der Opiumrauch, die pestgebeutelten Bettler und parfümierten Schnösel? Aus dem Hügelgewirr der Vorlande war auch das Meer bloß eine Ahnung am Horizont, seine salzigen Winde und der vertraute Gestank pechbestrichener Schiffsplanken kaum mehr als eine Erinnerung.
Das Fehlen all jener Gerüche machte dem Sergent erneut bewusst, mit welch trügerischer Absicht man ihn nach Svonnheim versetzt hatte.
»Nett hier, nicht?«, flötete der Gardist, der ihn im Dorf herumführte. »Ruhig, idyllisch. In Svonnheim passiert recht wenig.«
Zejn maß seinen Stellvertreter mit einem Seitenblick. Seit sich Untergrundorganisationen zu einer Gilde zusammengeschlossen hatten, blühte in der Hauptstadt die Kriminalität. Jeder verfügbare Soldat sollte in Tradea eingesetzt werden – gerade Männer mit Zejns Fähigkeiten. Stattdessen hatte man ihn ins Vorland versetzt, auf einen Posten, auf dem der vorige Sergent an Altersschwäche verstorben war. Altersschwäche! Bei Soldaten passierte das nur den Besten oder Schlechtesten, und Zejn konnte sich nicht vorstellen, dass Sergent Besson zur ersten Sorte gehört hatte.
Sein Begleiter wies auf eine windschiefe Hütte, über deren Tor ein Schild hing, auf das eine Möhre gemalt war. »… die Gelbe Rübe, die hiesige Schenke. Gutes Bier. Den Wein kann man vergessen. Aber wer ein bisschen Unterhaltung benötigt … Die dicke Inge macht’s dir für ’nen Kopper.« Der Gardist – sein Name war Barthell – lachte mit dicken Pausbacken. Er war jünger als Zejn selbst, er schätzte ihn auf vielleicht Ende zwanzig. Irgendwann mochte er mal gut ausgesehen haben, doch der Müßiggang hatte ihm einen Wohlstandsbauch beschert. Zejn störte es ungemein, dass Barthells Bart getrimmt gehörte und die Tunika befleckt und zerknittert war. In seinen Gürtel waren zusätzliche Löcher geschnitten worden, damit Barthell ihn schließen konnte.
So etwas war Zejn noch nie untergekommen. Ein Soldat repräsentierte nicht bloß die Garde, der er diente, sondern auch sein Königshaus. Daher pflegte Zejn seinen Bart regelmäßig zu stutzen, die Wangen zu rasieren und sein blondes Haar zu kürzen. Ordentliche Kleidung stand für Verlässlichkeit und Disziplin. Und Zejn schloss aus Barthells Auftreten, dass es ihm an beidem mangelte.
»Stammen Sie aus Tradea, Sergent?« Barthell sprach den Gardetitel Serschoh aus, was verriet, dass seine Familie der alten Landessprache mächtig war.
Zejn schüttelte den Kopf.
»Woher dann?«
»Weinberg.«
»Wo liegt das?«
»Im Osten.«
»Und wie sind Sie nach Tradea gekommen?«
»Durch die Garde.«
Barthell wartete auf weitere Ausführungen, während sie im Dorf eine Runde zogen. Ihre Stiefel stanzten Spuren in den feuchten Boden. Als keine Erläuterung folgte, blies der Jüngere die Backen auf und wies auf einen Vorplatz, der durchaus als ausgetrampelte Verbreiterung des Gehwegs durchgehen konnte.
»Hier sehen Sie den Marktplatz. Am Tag des Travis kommen die Leute aus der Gegend zusammen, um hier Waren auszutauschen.«
»Heute ist der Tag des Travis.«
»Sag ich ja.«
Zejn rümpfte die Nase angesichts der Handvoll Menschen, die zwischen den Hütten umherstreunten. Selbst des Nachts war in einer Hintergasse Tradeas mehr los als hier. Der Nebelschleier, der von den angrenzenden Wäldern ins Dorf kroch, dämpfte die Geräusche. Auf dem Land war es so verdammt still, dass Zejns Herzschlag ihn aus dem Schlaf weckte.
»Bethe bringt ihr Wintergemüse, momentan gibt es hauptsächlich Rüben und Kohl. Der mit dem Hund ist der Jäger, lebt etwas außerhalb. Nimmt mich gelegentlich mit auf die Wildschweinjagd, ist eine wahre Freude. Jagen Sie, Sergent? Sie sollten uns begleiten! Dort drüben steht Hervis, einmal im Monat verkauft er Stoffe, Fibeln, manchmal auch Felle … die Frauen reißen sich darum. Da muss man als Mann aufpassen, oder sie stopfen deinen hart erarbeiteten Sold in Hervis’ Taschen.« Barthell drehte sich zu ihm. »Kommt Ihre Frau nach, Sergent?«
»Ich bin nicht verheiratet.«
»Nicht? Sie sind doch ein schmucker Kerl, Chief.« Er gurrte den alt-tradeadischen Titel, als wäre er eine Taube, die ihn vom Dach herab komplimentierte.
Zejn warf ihm einen skeptischen Blick zu. »Wird das ein Antrag, Barthell?«
Die Backen des Stellvertreters färbten sich rot. Irritiert räusperte er sich. »N-nun …«
Ein Aufschrei ließ Zejn herumfahren. Die Häupter der Anwesenden ruckten herum und suchten nach der Ursache. Der Fleischer beugte sich erschrocken unter seinen hängenden Würsten hindurch.
Vor seinem Stand krümmte sich ein Mann. Den Arm an die Brust gewinkelt, wimmerte er vor Schmerzen. Einige Dörfler setzten dazu an, ihm zu Hilfe zu eilen. Als sich der Fleischer zu ihm bücken wollte, wurde seine Aufmerksamkeit von einer weiteren Gestalt beansprucht, und er fuhr zurück. Jemand wisperte, und das Flüstern wurde hinter vorgehaltenen Händen weitergetragen. Plötzlich wandten sich die Dorfbewohner ab oder duckten sich hinter ihren Buden. Niemand fuhr fort, dem Verletzten zu helfen. Der stieß die Knie in die feuchte Erde und umklammerte seinen Arm.
»Was ist hier los?«, rief Zejn. Er trat heran, packte den Mann an der Schulter und riss ihn in die Höhe.
Der Verwundete schnappte nach Luft. Unkontrollierte Laute entrangen sich seiner Kehle. Zitternd streckte er dem Sergent den Arm entgegen.
»Was, bei Hollers Höllen …?« Er wich zurück.
Vor Zejns Augen löste sich der Mantelärmel des Verletzten auf. Die Haut darunter warf Blasen, offenbarte rohes Fleisch, gelbes Fett und die Sehnen am Handrücken. Der Geruch ätzte in Zejns Nase. Rasch barg er die Nase hinter seinem Handschuh.
»… die Hexe!«, stieß der Verletzte aus. Tränen quollen die Wangen hinab, Rotz sammelte sich an seiner Oberlippe. Als die Haut verschmorte, zischte es. Schaumige Reste tropften zu Boden. Mit glasigen Augen wies er auf jemanden, der sich rasch entfernte – Ledermantel, Kapuze, ein Fuchsfell über den Schultern, dessen Schwanz wie ein Glockenklöppel über den Rücken wippte.
»Hey!« Zejn schoss vor, eine Hand am Schwertgriff. Er packte die Gestalt und riss sie herum.
Dunkle Augen, dunkle Haut und ebenso dunkles Haar, das kraus aus der Kapuze wallte. Narben furchten ihre rechte Wange, und als die Frau den Mund verzog, schimmerten die Wundmale, als steckten Glasstücke darin.
»Lassen Sie mich los!«, forderte sie.
Er nickte in Richtung des Verletzten. »Was ist passiert?«
»Er hat in meine Tasche gefasst. Das hätte er unterlassen sollen.« Sie barg das Leder unter ihrem Arm. An ihrem Gürtel baumelten ein toter Hase und mehrere Fangschlingen.
Zejn schluckte. Ein metallischer Geschmack legte sich auf seine Zunge, üblicherweise ein Anzeichen dafür, dass Magie im Spiel war.
… die Hexe!
»Sind Sie lizenzierte Magierin?«
Sie zog die Augenbrauen zusammen. Ihr Mund öffnete sich, die Zähne blitzten weiß. »Lassen Sie mich los!«, forderte sie ein weiteres Mal. Als er nicht reagierte, entzog sie sich ihm mit einem Ruck. Er erwischte gerade noch ihre Hand. Unter dem Handschuh spürte er ihre Finger. Zwei davon fühlten sich seltsam hart an – Metall?
»Schon gut!«, rief jemand hinter ihnen.
Zejn wandte sich an den Fleischer. Auf seiner Tafel lagen ein Fasan und ein Hase, der vermutlich von der Fremden stammte.
»Der da«, wies der Fleischermeister auf den Dieb, »hätte es besser wissen müssen, als seine Klaufinger in die Tasche der Waldhexe zu stecken. Sie tut niemandem etwas.«
»Sie tut niemandem etwas? Haben Sie Augen im …?« Der Widerstand in seiner Hand schwand, und als er sich umdrehte, hielt er nur noch einen Handschuh fest.
»Hey!«, schnappte Zejn erneut. »Bleiben Sie stehen!« Er setzte ihr hinterher, doch plötzlich tauchte Barthell vor ihm auf. Die Männer prallten gegeneinander. Sein Stellvertreter stürzte und grub die Hände in den Schlick.
»Barthell!«, schnauzte Zejn.
»Lassen Sie sie«, ächzte der Gardist. Er verzog das Gesicht, Hintern und Schulter dreckverschmiert. Mühselig rappelte er sich hoch. »Die Leute hier machen das untereinander aus … Haben sie immer getan und werden sie immer. Die DeBois kommt bloß ins Dorf, um Tauschhandel zu betreiben, oder wenn jemand ihre Hilfe braucht. Sie hilft Kindern auf die Welt, betreut die Kranken. Wer glaubt, sie bestehlen zu können, hat es nicht anders verdient.«
Zejn stieß ein Schnauben aus. »Wo kommen wir hin, wenn jeder Selbstjustiz ausübt! Ist der Mann ein Dieb, wird er bestraft! Von uns! Und wird jemand verletzt – noch dazu bei Verdacht auf unlizenzierte Magie –, stellen wir ihn ebenfalls vor Gericht!«
Barthell versuchte, den Lehm von seinem Rock zu streichen. »Sie ist Trankbrauerin, ein Kräuterweib. Sollte sie tatsächlich zaubern können, ist sie ein Segen für die Menschen. Die haben sonst niemanden. Tradea schert sich nicht um uns.«
Zejn spürte, wie eine Ader an seiner Schläfe hervortrat. Die Flügel seiner langen, leicht gekrümmten Nase blähten sich. »Wie bitte? Habe ich richtig gehört? Sie wissen von unrechtmäßig ausgeübter Magie – und haben es nicht für wichtig befunden, diese zu melden?«
Barthells Gesicht fiel in sich zusammen. »A-aber der alte Chief …«
»Es interessiert mich nicht, was Ihr alter Chief getan, gesagt oder übersehen hat. Jetzt bin ich hier! Die ruhigen Zeiten sind vorbei, Barthell – nun müssen Sie sich Ihren Sold verdienen!«
Die Mundwinkel des stellvertretenden Sergents sackten herab.
»Sie ist ohnehin weg!«, rief der Fleischer. »Lassen Sie es gut sein.«
Zejn trat zu dem Verletzten und zog ihn mit einem Ruck in die Höhe.
»W-was tun Sie?«, jammerte der.
»Was denken Sie denn? Sie haben geklaut und wurden dabei erwischt. Dafür verlieren Sie nach tradeadischem Recht Ihre Hand.«
Zitternd hob der Dieb den Arm. Die Wunden stanken, seine Finger standen ab wie verknotete Zweige. »W-was wollen Sie mir noch nehmen, das ich nicht bereits verloren habe?«
Grob stieß Zejn ihn voran. »Seien Sie froh, wenn ich Ihnen die verletzte Hand abschlage und nicht die heile.«
MIRAGE
2
Mirage DeBois drückte die Tür zu ihrer Kate auf. Lichtstrahlen kämpften sich durch spinnwebenverhangene Ritzen, streiften Kräuter und Rispen, die zum Trocknen von den Dachbalken hingen. Wärme leckte ihre Wangen und begrüßte sie in ihrem Heim.
Vorsichtig zog Mirage die Tasche von der Schulter und stellte sie auf dem Steintisch ab, der einen Teil ihrer Hütte ausfüllte. Von außen gewöhnlich, offenbarte die Tasche ihre wahre Natur erst im Inneren. Die Schuppenhaut eines Nackenbeißers, die sorgsam eingenäht worden war, verhinderte, dass giftige oder ätzende Substanzen aussickerten. Eine Eigenschaft, die Mirage im Fall des ungeschickten Diebs die Haut gerettet hatte – im wahrsten Sinne des Wortes.
Sie eilte zu den Regalen, die an die Hüttenwände gezimmert waren, fuhr mit der Hand über die Gefäße, manche davon bauchig und dick wie Kürbisse, andere kaum länger als ihre Finger. Dicht reihten sich Tiegel, Fläschchen und Amphoren aus Glas, Ton oder Tierhäuten aneinander. In einem Glasballon fand Mirage Laudines Tränen, hievte den Behälter zum Steintisch und schob ihn über die Arbeitsfläche, sodass die glasklare Flüssigkeit darin schwappte.
Sie musste schleunigst die Kafritsbeeren in ihrer Tasche neutralisieren. Je nach Zusammensetzung konnte man daraus ein Gift herstellen, das bereits über so manche Giftspindel in fremde Getränke gelaufen war, oder eine aggressive Säure, wie sie Mirage bei sich getragen hatte. Alles, was sich in ihrer Tasche befunden hatte – Kräuter, Alchemika, ihre neuen Handschuhe –, war der Säure zum Opfer gefallen. Sie hätte dem Gauner den vergifteten Beutel über den Kopf gestülpt, hätte sich ihr der unbekannte Gardist nicht in den Weg gestellt. Auch er würde die Sitten des Vorlands auf brutale Weise lernen.
Mirage öffnete die Tür und sämtliche Fensterläden. Wind fuhr durch die getrockneten Kräuterrispen und vermischte deren Geruch mit dem harzigen Duft des Nadelwäldchens, in dem sie hauste. Die meisten Menschen rund um Svonnheim lebten vom Forst und seinen Früchten. Mirage ebenfalls – sie erntete seine Heilmittel und Gifte, nährte sich von seinen Wildtieren und wärmte sich an seinem Brennholz. Zum Winteranbruch arbeiteten im Vorland unzählige Holzknechte, die das Meilen entfernte Tradea – oder Traité, wie es die ursprünglichen Einheimischen nannten – mit Feuerholz belieferten. Mit der Arbeit der Stabschläger wuchs zugleich der Bedarf an Mirages Künsten, denn das finstere Tal mit den jahrhundertealten Bäumen forderte regelmäßig seinen Tribut wie ein alter Gott.
Mirage flickte Wunden, flößte Medizin ein – oder Rauschmittel, falls nichts anderes mehr half. Sie wusste, dass sie mit ihrer besonderen Profession ein Risiko einging. Eine lächerliche Paste mochte ausreichen, die Dörfler glauben zu lassen, jene Frau, die im Wald lebte, hätte ein magisches Wunder vollbracht. Hier in den südlichen Königreichen stand die Anwendung von Magie allein jenen zu, die eine Lizenz besaßen. Daher hatte sich Mirage mit der Garnison in Svonnheim arrangieren müssen.
Mit einem Stab stieß sie die Dachluke über dem Tisch auf, damit die giftigen Dämpfe entweichen konnten. Licht fiel auf die Steinplatte und machte Verfärbungen, Brandflecken und Kratzspuren zahlreicher Experimente sichtbar. Mirage trug einen Wassereimer zum Bach, der sich an der Kate vorbeischlängelte, und befüllte ihn. Zurück in der Hütte, schlüpfte sie aus ihrem Mantel und zwängte sich in einen ledernen Überwurf. Ein Arbeitstuch schützte Nase und Mund, ein Eisengestell mit Beryll-Gläsern ihre Augen. Handschuhe vollendeten ihre Vorbereitungen. Wer in der Welt der Alchemie einen winzigen Fehler beging, musste schmerzlich dafür zahlen.
Vorsichtig zog sie den Taschendeckel auf. Schaumreste verklebten die Innenseite, gespickt mit Lavendel und Tausendgut.
Sie hob die Tasche in einen zweiten Eimer und begann, mit einem Schöpflöffel Wasser hinzuzufügen, um die Kafritsäure zu verdünnen. Schließlich entkorkte sie Laudines Tränen und leitete die Neutralisation ein. Sie zwang sich zur Umsicht – Gewohnheit war der erste Schritt zu Fehlern. Manchmal reizte sie das Spiel mit der Gefahr. Es gab zwei Arten von Alchemisten: Jene, die das Risiko nicht verstanden, und jene, die es suchten. Sie gehörte zu Letzteren.
Mit zwei Metallstiften, die sie in die Flüssigkeit tunkte, testete sie, inwieweit sie sich dem gewünschten Ergebnis näherte. Je nach Säuregrad oxidierte ihre Oberfläche in unterschiedlichen Farben. Als nach weiterem Hinzufügen von Laudines Tränen keinerlei Reaktion erfolgte, trug Mirage den Eimer nach draußen und leerte den Inhalt in die Wiese. Die Tasche klatschte auf den Boden, Wasser und Schaumreste schwappten davon und mit ihnen die Kräuter, die sie gesammelt hatte, sowie die Scherben einiger Alchemika und Tiegel. Als sie die Taschenöffnung auseinanderzupfte, fand sie die kürzlich hergestellten Rauchkugeln. Äußerlich wirkten sie unbeschadet, doch den Kontakt mit der Säure hatten sie gewiss nicht überstanden. Entnervt warf sie die Kapseln von sich. All die Arbeit umsonst!
Einen Moment lang stand Mirage verbittert da, die Hände zu Fäusten verkrampft, ehe sie die Blechkugeln seufzend aus dem Nadellaub klaubte. Die Vorlande schenkten einem nichts, daher sollte sie dem Vorland ebenfalls nichts schenken.
Sie hackte Holz, kehrte mit einem Armvoll in die Hütte zurück und warf ein Scheit ins Glutnest der Feuerstelle. Müde kam sie auf dem nebenstehenden Stuhl zur Ruhe und streifte die Arbeitshandschuhe ab. Zum Vorschein kamen zwei metallene Aufsätze an ihrem rechten Ring- und kleinen Finger, die ihre Kunden üblicherweise für exzentrischen Schmuck hielten. Tatsächlich ersetzten sie die dort fehlenden Fingerglieder. Sie rieb sich die klammen Hände.
Ein neuer Sergent. Nachdem Sergent Besson zu allem Unglück auf der dicken Inge krepiert war, hatte es sich nur um eine Frage der Zeit gehandelt, bis Ersatz geschickt würde. Mirage hatte gehofft, dass sie einen der heimischen Gardisten in seinen Rang erheben würden. Stattdessen schickten sie irgendeinen Soldaten aus Tradea, der tatsächlich glaubte, die Garde besäße in Svonnheim etwas anderes als eine dekorative Funktion.
Mirage knackte mit den Fingerknöcheln. Prinzipiell konnte sie sich mit allen Menschen arrangieren. Bei Sergent Besson hatte ein Potenzmittelchen gereicht, um ihn von Mirages Nutzen zu überzeugen. Der neu hinzugekommene Wichtigtuer besaß mit Sicherheit ebenfalls Schwächen, die sich zu ihren Gunsten nutzen ließen.
Ihr Magen knurrte. Sie erhob sich und löste den Hasen vom Gürtel. Nach dem Unfall mit der Kafritsäure traute sie dem Braten nicht. Einige Fangschlingen lagen noch aus. Besser, sie sah sich nach frischem Wildbret um. Falls alle Stricke rissen, blieben immer noch Rüben.
Der spätherbstliche Wald empfing sie mit einem feuchten Kuss. Nebelschleier hatten sich in die Mulden gelegt und krochen wie müßige Geister durch Farn und Gestrüpp. Saftige Moospolster krönten die Felsen. Bald würden auch sie von Frost und Schnee überzogen werden. Die Waldesruhe wurde einzig vom gelegentlichen Rascheln oder dem Klageschrei der Nebelkrähen durchbrochen, die über die Felder zogen und auf den Schirmen der Kiefern rasteten. Ihr Krächzen verfolgte Mirage, während sie die Fallen absuchte.
Die Schlingen im Haselwäldchen lagen leer, daher machte sie sich auf den Weg zu den Murmeltiergründen im Norden. Eigentlich fing sie die Nager wegen ihres Fetts, das sich zu allerlei Hausmitteln verarbeiten ließ. Ihr Fleisch war zwar mäßig schmackhaft, aber wer hatte schon die Qual der Wahl?
Die Murmeltiergründe lagen auf der Anhöhe eines kahl geschlagenen Hügels, aus dem die Trümmer einer einstigen Wehranlage ragten. Die Dorfbewohner mieden die Ruinen ebenso wie die Wälle dahinter, in denen sich alte Grabanlagen befanden. Einzig zur Sonnenwende versammelten sich die Bewohner aus der Gegend, um mit Lichtern zwischen den Grabhügeln umherzuwandern und sich Nifs Mildtätigkeit durch Opfergaben zu erbitten.
Mirage mühte sich den schmalen Trampelpfad empor. Ein durchdringender Pfiff verriet ihr, dass sie von einem Murmeltier entdeckt worden war. Ein Schemen duckte sich in einem Loch. Das Murmeltierrudel stellte üblicherweise eine Wache auf, welche die anderen vor Gefahr warnte, weswegen Mirage sie nur selten lebend zu Gesicht bekam.
Wie das verfaulte Zahnwerk eines Riesen ragten die brüchigen Ecken und Kanten der Wehranlage aus dem Hügelkamm. Mirage betrat die Ruine durch den einstigen Haupteingang, dessen Bogen kaum noch als solcher zu erkennen war. Die beiden Skulpturen, die den Eingang flankierten, waren derart von Wind und Wetter zerfressen, dass Mirage bloß noch stumpfe Fratzen entgegenglotzten.
Nördlich der Wehranlage wölbten sich die Grabhügel wie Nurovas Busen. Südlich stieg der Rauch Tradeas auf, Geisterhände, die in den Himmel reichten. Das dahinter gelegene Meer blitzte auf wie blanker Stahl.
Die erste Murmeltierfalle fand Mirage leer vor, genauso die zweite. Krähen hockten auf den Bruchstücken der Wehranlage. Ihre schillernden Häupter ruckten herum, als hätten sie etwas vernommen. Zeitgleich katapultierten sie sich in die Höhe und segelten in einiger Entfernung neben dem alten Aussichtsturm herab.
Neugierig reckte Mirage den Kopf. Sie hatte in der Nähe des Turms eine Schlinge angebracht. Das aufgeregte Kreisen der Aasfresser verriet ihr, dass sie Beute erspäht hatten.
Sie eilte zwischen den Mauerresten hindurch, die einst einen Gang gebildet haben mochten, und überwand ein eingefallenes Fensterstück. Die Krähenschar war hinter einem Durchgang zu Boden gekommen, direkt vor dem Turmzugang, dessen Holzdach vor langer Zeit vermodert und von der Anhöhe gerutscht war.
Die Raben pickten mit ihren hakenförmigen Schnäbeln auf etwas ein. Fellflaum wurde vom Wind davongetragen.
Mirages Schritttempo verlangsamte sich. Sie legte die Stirn in Falten. Die Narben an ihrer Wange juckten. Sie war sich ziemlich sicher, so nah am Turm keine Schlinge ausgelegt zu haben. Und sie glaubte auch nicht, dass …
Ihr nächster Tritt ließ eines der Tiere aufschrecken. Wie auf Kommando folgten die restlichen und verteilten sich. Zurück ließen sie einen blutigen Stiefel.
Scharf entwich Mirage der Atem. Als sie näher eilte, entblätterte sich hinter dem Mauerstück ein Leib, der zu dem Schuhwerk gehörte. Verdreht lag er auf der blanken Erde, eingepackt in dicke Winterkleidung. Die Krähen hatten begonnen, Löcher in das Leder zu picken. Das innere Fell lag im Gras verteilt wie Wölkchen. Noch im Tod krallte sich eine von Schnäbeln zerfurchte Hand um einen Bogen – aus dem gekippten Köcher an ihrem Rücken ragten zahlreiche Pfeile mit braun-weiß gestreifter Befiederung hervor.
Vorsichtig trat Mirage zum Turmeingang heran und lauschte. Der Spätherbst flüsterte, und die Krähen zankten, sonst blieb es still. Sie blickte den Schacht empor: Ein Loch klaffte dort, wo sich das Dach einst befunden hatte.
Lautlos ging sie neben dem Toten in die Knie und zog ihn an der Schulter herum. Die Tote, korrigierte sie sich. Schlank, fast ausgemergelt. Schwanengleich bog sich ein Hals aus der Fellkapuze, die Lippen blau gefroren, ein Auge angepickt, das andere, geschlossene Lid zartviolett verfärbt. Die Totenstarre war abgeklungen. Das hieß, sie lag schon eine ganze Weile hier.
Mirage betrachtete die gebogenen Augenbrauen, die schmale Nase, die hohen Wangenknochen. Die junge Frau kam ihr bekannt vor. Vorsichtig zupfte sie die Verschlüsse des Mantels auf und zog ihn von der linken Schulter, löste den Kittel aus dem Hosenbund und inspizierte den Rücken der Leiche. Ihre Hand strich über eine lang gezogene Narbe – der Beweis, dass sie einander bereits einmal begegnet waren. Mirage erkannte ihre Arbeit wieder – die Wundnaht stammte von ihr.
Nur wenige Menschen fanden in den Wäldern ihr Zuhause. Es war ein raues und einsames Leben, das bloß Ausgestoßene wählten.
Wo genau das Mädchen gehaust hatte, wusste Mirage nicht. Aber sie erinnerte sich, wie sie eines Tages verletzt bei ihrer Hütte aufgetaucht war. Mirage hatte die Wunde gereinigt und genäht, genau jene unregelmäßige Narbe, über die sie nun fuhr. Gesprochen hatte die junge Frau kein Wort. Ein erlegtes Reh hatte sie ihr vor die Tür gelegt und war ebenso stumm verschwunden, wie sie gekommen war.
Mirage wälzte die Frau zurück auf den Rücken. Dabei kippte ihr Kopf aus der Kapuze. Ein brauner Zopf ringelte sich zu Boden wie eine Schlange. Interessiert schnellte Mirages Zunge über die Unterlippe, als sie die spitz zulaufenden Ohren berührte. Die ausnehmende Schlankheit der Toten, die überlangen Gliedmaßen und Finger … die Frau musste von Elfen abstammen. Vermutlich lag die Verwandtschaft einige Generationen zurück, schließlich wiesen weder die Haut- noch ihre Haarfarbe auf die Nachtelfen Ravennas hin. Dennoch haftete ihrer Erscheinung etwas Fragiles an. Aus welchem Grund war die Frau hier draußen gestorben, in aller Einsamkeit?
Als Mirage sie aus dem Mantel löste, fand sie die Ursache für den frühen Tod. Blut tränkte die Innenseite des Kleidungsstücks, verkrustete das Hemd. Eine oberflächliche Untersuchung enthüllte eine Stichwunde, vermutlich von einem Messer oder Speer. Die Waffe musste die Lunge getroffen haben.
Eine Krähe zog Mirages Aufmerksamkeit auf sich. Mutig hüpfte sie näher, riss den Schnabel auf und krächzte.
»Für dich bleibt genug übrig«, brummte sie und begann die Taschen der Toten zu durchsuchen. Sie trug kaum etwas bei sich.
Etwas raschelte unter ihren Fingern. Mirage zog einen zerknitterten Zettel hervor.
»Panumae im Zwielicht«, stieß sie aus und entrollte das Papierstück. Der Streifen war kaum länger als ihr Daumen und spärlich beschrieben. Obwohl sie die verschlüsselte Schrift nicht lesen konnte, verriet ihr das Schriftstück, wieso sich die Frau in die Wälder zurückgezogen hatte – und warum sie so abrupt ihren Tod gefunden hatte.
Die Tote war eine Glyphenjägerin.
3
Wie die meisten Großstädte besaß auch Tradea ein Glyphennetz, das die Diebesgilde zur verdeckten Kommunikation nutzte. Kriminelle Aufträge wurden von Glyphenläufern entgegengenommen, die verborgene Verstecke damit bestückten. Sogenannte Glyphenjäger suchten die Geheimfächer ab und führten anschließend die Instruktionen aus. Hatten sie die Aufgabe erledigt, hinterließen sie eine Nachricht für den Läufer, der wiederum die Belohnung vom Auftraggeber organisierte und einen Anteil behielt.
Glyphenjäger gab es für jeden Bedarf – Schmuggler, Rauschgifthändler, Fassadenkletterer, Räuber, Schläger oder sogar Attentäter. Mirage hatte das Glyphennetz gelegentlich genutzt, um Kontakt zum Schwarzmarkt herzustellen. Tradea pflegte ein fanatisches Recht, was die Nutzung gewisser Alchemika betraf, die daher bloß über illegale Wege zu bekommen waren.
Irgendwo in der Nähe musste sich ein Glyphenversteck befinden. Nur, was hatte der Auftraggeber von der Jägerin erwartet? In den Vorlanden gab es niemanden, den es sich zu bestehlen lohnte; niemanden, der genügend Einfluss besaß, damit sich ein Auftragsmord rentierte. Was hatte die Glyphenjägerin also gesucht? Und wichtiger: Wer hatte ihrem Auftrag ein jähes Ende bereitet?
Mirage leckte sich über die Lippen. Möglicherweise sollte sie einfach dem neuen Sergent eine Nachricht über den Leichenfundort zukommen lassen. Sollte er sich doch mit den Toten herumschlagen.
Die Krähe zupfte an der Hose der Leiche. Mirage verscheuchte sie mit einem Wink und wurde dadurch auf ein Lochmuster aufmerksam, welches das Leder halbkreisförmig maserte. Sie rutschte zu den Füßen der Toten, löste ihren Stiefel und krempelte das Hosenbein auf.
Ein Biss.
Mirage blinzelte.
Das war an und für sich nichts Ungewöhnliches. Es gab durchaus Wildhunde, die durch die Hügel streunten. Manchmal verirrten sich auch Bären oder Wölfe in die Gegend. Aber dieser Biss … die runde Form, die stumpfen Abdrücke: Mirage waren derlei Wunden erst einmal begegnet. Ein Bauer waren im Tollwutwahn auf seine eigene Frau losgegangen – mit keinen anderen Waffen als jenen, die ihm die Götter bei seiner Geburt verliehen hatten.
Das hier war der Abdruck eines Menschengebisses.
Mirage zog alarmiert die Hand zurück. »Was zum …?«, stieß sie aus.
Nachdenklich besah sie sich den Rest der Leiche. Die Beinwunde schien älter zu sein als die Stichwunde in der Brust, denn in den Ritzen der Schuhsohle hatte sich Blut gesammelt. Die Tote musste mit der Wunde noch eine Weile gelaufen sein.
Hatte der Mörder die Glyphenjägerin bis zum Turm verfolgt? Oder war sie ihm erst hier begegnet?
Langsam erhob sich Mirage und ließ den Blick schweifen. Hatte die Elfin eine Blutspur hinterlassen, könnten bloß die feinen Sinne eines Hunds ihr folgen. Mirage musste etwas tun. Hatte sich eine Krankheit von Tieren auf Menschen übertragen, mussten die Verseuchten gefunden, hingerichtet und verbrannt werden.
Sicherheitshalber entfernte sich Mirage einen Schritt. Möglicherweise konnten ihr die Priesterinnen der Nurova-Seelstatt helfen, die sich um die Vieh- und Landwirtschaft der Gegend bemühten. Doch die Garde von Svonnheim … Die Soldaten waren faule Säcke, die niemals eine richtige Ausbildung unter Sergent Besson erhalten hatten. Sie würden den Biss als Tierspur abtun und die Sache ruhen lassen. Mit den Konsequenzen durften sich dann später Mirage und die Priesterinnen herumschlagen.
Sie brauchte Beweise. Die Stirn in Falten gelegt, blickte sie zum grauen Himmel auf. Sie musste sich beeilen, wenn sie herausfinden wollte, wie die Jägerin zu Tode gekommen war, bevor der Regen alle Spuren verwischte.
Als sie die Hütte erreichte, begann es zu nieseln. Mirage fluchte und hoffte inständig, dass das Unwetter an der Ruine vorbeizog. Mit einem ungeduldigen Tritt beförderte sie das Fell von der Bodenluke, die mit einem Vorhängeschloss gesichert war. Den Schlüssel dazu trug sie stets bei sich.
Quietschend öffnete sich die Falltür. Der Geruch von Moder und Pilzen stieg auf und legte sich wie Tau auf Mirages Gesicht. Sie griff tief in die Dunkelheit und zog die Kiste mit verarbeiteten Alchemika hervor. Hier lagerten jene magischen Stoffe, die zu wertvoll – oder zu gesetzeswidrig – waren, um sie frei in der Hütte stehen zu lassen.
Sie klappte den Holzkasten auf. Sein Mechanismus öffnete eine Anzahl an Treppen und Lädchen, in denen sich Phiolen reihten, gefüllt mit bunten Flüssigkeiten und Pülverchen, von hastiger Hand beschriftet. Mirage zerrte die Kiste ans Tageslicht, damit sie die Schrift lesen konnte. Endlich drehte sie die richtige Phiole zwischen den Fingern – Wolfsnase. Sie steckte es in die Manteltasche. Aus den Untiefen des Kastens zog sie zwei Rauchkugeln und packte sie in die feuchte Tragetasche. Ein Messer, Kreide, Seil und eine Laterne vervollständigten ihre Ausrüstung. So trat sie die Rückkehr zur Mordstätte an.
Die Krähen hatten sich auf dem Leichnam versammelt und waren diesmal weitaus weniger gewillt, ihn zu verlassen. In einiger Entfernung setzte sich Mirage auf ein Mauerstück, kramte das Alchemikum aus der Tasche und entkorkte es. Als ihr der moschuslastige Geruch in die Nase stieg, stieß sie ein angeekeltes Ächzen aus. Die nächste Zeit würde sie mit dem widerwärtigen Geschmack und Gestank von Wolfstalg verbringen müssen, was ungefähr so angenehm war wie ein Maul voller Kuhdung.
Widerstrebend rang sie sich durch und kippte das Fläschchen mit einem Schluck hinunter. Ein Husten brach aus ihr hervor, ihr Magen rebellierte. Sie atmete tief ein und aus, klopfte sich auf die Brust. Es dauerte, bis der Brechreiz abflachte. Mirage horchte auf ihren Körper und starrte hinüber zu der grotesken Szenerie sich zankender Vögel, die mit Hautfetzen im Schnabel über die Wiese sprangen. Ihre Atemzüge wurden tiefer, hechelnder – zumindest klang es in ihren Ohren so. Zitternd öffnete sie den Mund, schluckte die kalte Luft mit einem Happs. Als zöge ein Nieselregen auf, legte sich ein Schleier vor ihre Augen, bis alles zu einem Farbnebel verwischte – das Graugrün der Wiese, der dunkle Turm, die rangelnden blauschwarzen Flecken auf einem Bündel aus Braun. Doch je weniger ihre Augen preisgaben, desto mehr verriet ihr ihr Geruchssinn. Das feuchte Leder, die einsetzende Verwesung, der Geruch gestockten Bluts. Wasserschwangere Wiesen, Murmeltierdung, Flechten, die an Mauerstücken hafteten.
Geräuschvoll sog Mirage den Atem ein. Metallisch legte sich der Blutgeschmack auf ihre Zunge, lockte sie. Langsam erhob sie sich, trat auf die Krähen zu, ließ sich von dem Verwesungsgeruch leiten, einen Schritt weiter und noch einen. Die Raben protestierten. Der Zug ihrer Flügelschläge streifte ihr Gesicht. Mirage blinzelte, kurz aus dem Blutdurst gerissen, den die tierischen Sinne mit sich brachten – versuchte sich darauf zu konzentrieren, warum sie hergekommen war, inmitten dieses Farbennebels.
Der Blutgeruch konzentrierte sich rund um die Leiche und führte in zwei verschiedene Richtungen von ihr fort.
Mirage zupfte einen der Duftpfade heraus und tastete sich daran entlang, ein Schleier, der sie zum Turmeingang lotste. Ihre Stiefel scharrten über Schutt, als sie in das Dunkel trat. Sie hörte sich röcheln, eine Frau mit den Sinnen eines Hunds. Der Blutduft war eine diesige Spur, der sie folgte, bis sie gegen die Mauer stieß. Sie ertastete hervorstehende Steinblöcke, die einmal die hölzerne Treppenkonstruktion gehalten haben mochten. Die Treppe war längst zerfallen, doch die Mauerstücke konnten sicherlich weiterhin ein Menschengewicht tragen. Ihre eingeschränkte Sicht würde den Aufstieg jedoch drastisch erschweren. Daher griff Mirage in ihre Tasche und suchte nach der Kreide. Damit markierte sie die Stelle, an der die Duftspur emporführte.
Sie verließ den Turm und sah sich weiter um – mit ihrem Geruchssinn, nicht den getrübten Augen. Ihre Nasenflügel bebten, die Zunge schnellte über ihre Lippen, als sie die Blutspur witterte. Sie bewegte sich wie ein Raubtier zur Toten und anschließend fort von ihr, marschierte in die entgegengesetzte Richtung. Der Geruch zerstob, vermutlich war die junge Frau gerannt. Mirage verfolgte ihrer Spur durch das Labyrinth aus Steinen und begann, den Hügel zur Nordwestseite hinabzusteigen.
4
Der in der Luft schwebende Blutgeruch, das Fuchsfell unter ihrem Kinn – beides erweckte in Mirage wölfische Jagdlust. Sie ging schneller, folgte dem Geruch wie im Rausch. Doch mit der Zeit mischte sich ein ungewöhnlicher Beigeschmack in die metallische Süße. Angewidert schüttelte Mirage das Haupt wie ein Wolf, nach dem das Alchemikum benannt worden war.
Irgendwas stimmte nicht. Sie vermochte die Note nicht augenblicklich zu entziffern – schwebte ein Hauch von Verwesung darin mit? Nein. Krankheit.
Die Spur roch falsch. War die Tote bereits erkrankt gewesen, als ihr Mörder sie zur Strecke gebracht hatte? Unwahrscheinlich – Mirage hätte den Geruch an ihrem Leichnam wahrgenommen. Etwas anderes musste ihn verströmen.
Mirage rümpfte die Nase und folgte der bizarren Duftspur hinab in die Talsenke. Je tiefer sie stieg, desto bedrückter fühlte sie sich. Spielte die eigenartige Stimmung der Grabhügel mit ihren Sinnen? In den alten Anlagen war schon lange niemand mehr bestattet worden. Üppig hatte das Gras sein Territorium zurückerobert. Obwohl die Menschen ihn nicht rodeten, hatte sich der Wald nie wieder auf die Kuppen gewagt, als ahnte er, dass hier Nif herrschte, die Göttin der Nachwelt. Flechten und Moose bedeckten die Geröllhalde gleich Samtdecken, betteten die Toten zur ewigen Ruhe. Der Wind kitzelte die Halme, die wie trockenes Haar dazwischen hervorstanden.
Manche Hügel waren hoch wie Häuser, Erdwulste, die Zugänge längst verfallen. Die größten unter ihnen lagen im Zentrum – und genau dorthin führte der Blutduft Mirage.
Ihre Nasenflügel bebten. Ihre Stiefel schmatzten über die feuchte Erde. Sie blinzelte, umgeben vom strahlenden Grün der Nifengründe, dem auch der anbrechende Winter nichts anhaben konnte. So blieb sie stehen und witterte.
Blut. Und Krankheit. Wie eine Seuche, die sich ins Fleisch der Lebenden gefressen hatte.
Nervös schnellte ihre Zunge hervor. Etwas zupfte an ihren Gedanken, ein Jucken machte sich in ihrem Kopf breit – als hätte sie etwas Wichtiges vergessen. Eine Erinnerung kauerte dicht unter der Oberfläche. Die Wolfssinne zerrten an ihrer Konzentration. Je stärker Mirage zu kratzen versuchte, desto tiefer wanderte die Erinnerung ab wie ein lästiger Span.
Ihre Beine trugen sie voran, hin zum höchsten der Massengräber. Unruhe rieselte über ihren Rücken, brachte ihre Haut zum Prickeln. Ihre Narben ziepten.
Der Geruch von frisch aufgewühlter Erde zog ihre Aufmerksamkeit auf sich. Mirages Herz galoppierte, das Blut pumpte in ihren Ohren. Sie näherte sich dem Zugang, der wie eine offene Wunde in den Hügel geschlagen worden war. Eine Weile stand sie davor, schnüffelte nach der Blutspur, die hineinführte. Dann duckte sie sich hinein.
Wie das Haar alter Damen streiften sie die feinen Wurzelfäden. Es war still – eine andere Stille als jene, die in den Wäldern herrschte, wo immer etwas knisterte, raschelte oder ein Vogel in der Ferne rief. Die Ruhe in dem Grabhügel verdiente bloß einen Namen: Totenstille.
Der Erdwall verschluckte alle Laute. Die Luft war stickig. Als sie durch Mirages Lunge rauschte, war es, als trüge sie das Alter mit sich – ein abgestandener Geschmack. Erde rieselte auf sie herab. Mirage hustete, eilte weiter, ganz entgegen dem Wolfsinstinkt, der sie drängte, diesem Ort zu entfliehen.
Sie streifte die Wände. Im Restlicht erkannte Mirage Stoffbündel, die wie menschengroße Schmetterlingspuppen in Nischen gebettet worden waren. Sie griff danach und durchstieß das Gewebe wie Spinnweben. Es zerbröckelte unter ihrer Berührung und blieb als staubiger Rest an den Fingerspitzen haften. Darunter erfühlte sie Gebein. Kühl ruhten die Überreste auf ihrem Totenbett.
Mirage barg einen Augenblick lang die Nase in der Armbeuge und schüttelte das Haupt, um die Empfindungen abzuschütteln. Staub und Verwesung. Würmer, die sich durchs Erdreich wanden. Die erstickende Enge. Sie zwang sich voran. Fast hatte sie das Gefühl, als würde es wärmer werden. Wer hatte die Glyphenjägerin entsandt, einen Zugang zu dem alten Grabhügel zu schürfen? Und wer hatte sie hier unten gefunden und attackiert?
Die Intensität des Blutgeruchs verriet Mirage: Sie näherte sich dem Ort des Geschehens. Der Abstand zwischen den Nischen verbreiterte sich. Das Licht von außerhalb war lediglich eine Ahnung. Vor ihr lauerte Dunkelheit. Der Drang, umzukehren und diesen Ort zurückzulassen, schnürte ihr den Hals zu.
Mirage tastete sich voran, umgeben von nichts als erdrückender Stille, Tod und Erde.
Sie roch es, bevor sie es sah. Brennendes Fett. Eine Lampe, die vermutlich von ihrer Vorgängerin abgestellt worden war und einen milchigen Lichtpunkt verbreitete.
Die Kammer war ebenfalls mit Nischen ausgekleidet. In ihrer Mitte thronte ein Altar. Mirage näherte sich und blickte mit trüben Augen darauf hinab. Wischspuren durchzogen den Staub. Was auch immer sich an dieser Stelle befunden hatte, war nun verschwunden.
Mit jedem Schritt verstärkte sich der Blutgeruch. Im Licht der Öllampe erkannte Mirage Schleif- und Scharrspuren am Fußboden. Hatte man die Glyphenjägerin an diesem Ort überfallen? Möglicherweise konkurrierende Glyphenjäger?
Sie reckte den Kopf, ihre Nasenflügel zuckten.
Nein. Hätten sich hier weitere Menschen aufgehalten – Mirage hätte es mit ihren Wolfssinnen bemerkt. Niemand außer dem Elfenabkömmling und ihr hatte die Grabkammer betreten.
Ein Klappern ließ sie herumfahren. Etwas bröckelte von der Decke. Mirage führte das Geräusch darauf zurück und wollte weitergehen, als eine Bewegung ihre Aufmerksamkeit fesselte.
Im Stoffbündel einer Nische regte sich etwas. Es kratzte und wisperte, als es gegen den alten Stoff stieß und dort eine Beule verursachte, die zu einem Loch wurde. Was war das? Ein Nagetier? Ein Maulwurf?
Mirage fasste nach der halb umgekippten Öllampe und reckte sie vor sich, das Licht blendete, sie kniff die Augen zusammen. Das Loch weitete sich, und etwas Weißes kroch hervor. Mirage hielt den Atem an. Ein bleicher Wurm arbeitete sich aus dem Gewebe, dick wie ein Finger. Ein zweiter folgte.
Die Lampe zitterte in ihrer Hand. Sie wusste die verschwommenen Eindrücke nicht zu verarbeiten. Der Geruch von Krankheit kroch ihren Rachen entlang. Sie schmeckte Rauch.
Da riss der Stoff, der die Totenreste einhüllte. Das waren keine Würmer. Fünf beinerne Finger, zusammengesetzt aus winzigen Knöchelchen, spießten aus dem Totenbett. Elle und Arm arbeiteten sich hervor. Das Bündel erzitterte, die Seile, die es zusammengehalten hatten, lösten sich. Aus den Spinnweben krochen blanke Knochen, fügten sich zum Gerippe eines Menschen, das einst von Fleisch aufrecht gehalten worden war. Knackend zog es einen zweiten Arm nach, zwei Beine, einen klappernden Schädel.
Mirage war in Grauen gefangen, schaffte es nicht, den Mund zu schließen. Das durfte nicht sein!
Das Skelett zog einen Knochen aus seiner Ruhestatt, reckte ihn wie eine Waffe. Das dicke Ende ratterte über seinen beinernen Brustkorb, als es damit ausholte.
Fupp-fupp-fupp – drei dumpfe Schläge gegen den Altar, und alles um Mirage erwachte zum Leben. Es knackte und knirschte, Gewebe zerriss, Seile, die Tücher gehalten hatten, fielen zu Boden. Elfenbeinfarben schälten sich die Überreste aus den Gräbern.
Die Toten wankten als Schemen vor undeutlichem Grund. Die Magie, die sie zurück in die Welt der Lebenden trieb, legte sich als fauler Geschmack in Mirages Mund. Sie würgte, und ihr Rücken brannte, als würde sie von einer Kohlehand berührt. Der falsche Geruch, der Seuchengestank – er schien von überall gleichzeitig zu kommen.
Flieh!, schrie endlich etwas in ihr.
Mirage stieß ihre Hand in die Tasche, packte eine der beiden Rauchkugeln und schleuderte sie auf den Altar. Die Trennwand zwischen den Kugelhälften riss beim Aufprall, die Flüssigkeiten vermischten sich und zerfetzten das Gefäß. Eine Rauchwolke platzte hervor wie die Sporen eines Bovists.
Das Rasseln und Ticken setzte sich fort. Als Mirage einen Schritt zurücksetzte, tauchte ein Knochenschädel aus der Wolke auf, Augenhöhlen und Nase bloß schwarze Löcher, in denen der Staub von Jahrzehnten kreiste. Der gebogene Unterkiefer lachte ihr entgegen.
Seine improvisierte Waffe fuhr aus der Rauchwolke auf Mirage nieder. Mit einem dumpfen Aufschrei taumelte sie zurück. Der Knochen zischte an ihr vorbei. Das Skelett holte ein weiteres Mal aus.
Mirage trat die Flucht an. Ihre Umgebung verwischte im Lauf. Sie stieß gegen Wände, hastete vorwärts, folgte dem Geruch der Frischluft. Um sie herum erwachte die Erde zum Leben, erfüllt von klackernden Geräuschen. Etwas packte sie und schlang sich um ihre Arme. Ein Scharren ertönte. Knöcherne Finger tasteten nach ihr, bohrten sich in ihre Kleidung und versuchten, sie in die Nischen zu zerren. Mirages Kehle entrang sich ein wölfisches Wehklagen. Der Knochenprügel traf sie im Rücken. Sie stürzte, gehalten von zahlreichen Knochenhänden, die von den Totenbetten reichten. In ihren Ohren klingelte es, als sie im Staub landete. Bevor sie sich fassen konnte, ging das Gebein ein weiteres Mal auf sie nieder. Knöchelchen rissen Spuren in ihre Kleidung. Vor ihren Augen flimmerte es. Sie spürte, wie sich ihre Haut unter dem gierigen Tasten spaltete, wie der Prügel dumpf auf sie niederschlug – und als sie das Bewusstsein verlor, dämmerte ihr: Nif hatte entschieden, das sollte ihr Ende sein.
ZEJN
5
»Ist das nicht ein wenig übertrieben, Sergent?«
Zejn blickte von seinem Tisch auf, die Schreibfeder in der Hand. »Was wollen Sie damit sagen, Sergent-Stellvertreter?«
Unruhig trat Barthell von einem Fuß auf den anderen. »Nun, wir haben hier bloß eine Handvoll Gardisten stationiert. Die Zugänge zu Svonnheim bewachen zu lassen, um nach der Hexe Ausschau zu halten, erscheint mir ein wenig … unverhältnismäßig.«
Zejns Augenbraue schob sich in die Höhe. Sein Schweigen verriet mehr als tausend Worte.
Barthell wandte den Blick ab.
Zejn beschrieb den Folianten, der von seinem Vorgänger bloß spärlich befüllt worden war. Hier ein Bericht über eine Schlägerei, dort eine knappe Erklärung darüber, warum ein Tölpel aus der benachbarten Ortschaft aufgeknüpft worden war. Zwischen manchen Einträgen lagen Monate, zwischen anderen wiederum Jahre. Unter Erik Zejn würde sich das ändern. Justiz musste vor allem eines sein: nachvollziehbar. Ordnung hatte ihren Preis.
Während Zejn detailliert festhielt, wie und unter welchen Umständen dem Taschendieb die Hand mit dem Rechtsschwert abgetrennt worden war, gab er Barthell mit einem Wink zu verstehen, dass er sich ebenfalls nützlich machen sollte. »Erstellen Sie ein Flugblatt.«
»Ein Flugblatt?«
»Über die Flucht der Hexe. Wie nannten Sie diese noch mal? DeBois?«
Zögerlich nickte Barthell.
»Es wird Zeit, dass wir sie in Gewahrsam nehmen. Sie wissen, wo sie lebt?«
Langsam zog Barthell die Schultern an.
»Was soll das nun heißen? Wissen Sie es oder nicht?«
Der zottelige Kopf kippte hin und her, die Augen angstvoll aufgerissen. Entnervt setzte Zejn die Feder ab, Tinte befleckte das Pergament. Ärgerlich. »Sie behaupten, die Leute hier hielten sie für eine Heilerin. Das heißt, sie müssen sie kontaktieren können. Wie gelingt ihnen das?«
Barthell blies die bärtigen Backen auf. »Da müssen Sie den Dorfschulzen fragen.«
Zejns Augenbrauen ruckten weiter in die Höhe. »Den Schulzen?«
»Die Menschen gehen zu ihm, und er geht zu ihr. So ist die natürliche Reihenfolge.«
Grummelnd wandte sich Zejn zurück an den Folianten. Die Feder kratzte lautstark über die Oberfläche. Die Tinte schimmerte im Kerzenlicht. Er kniff die Augen zusammen; hasste es, im Dunkeln zu schreiben.
»Sergent …«, begann Barthell.
»Was?«
»Sie machen sich nicht unbedingt Freunde, wenn Sie sich auf die Jagd nach der Heilerin begeben.«
»Sehe ich aus, als wollte ich mir hier Freunde machen?«
»Nein. Nein, das tun Sie nicht, Sir, aber …« Barthell schluckte, der Adamsapfel zuckte unter dem nachlässig gestutzten Bart. »Vielleicht sollten Sie es in Erwägung ziehen, Sir.«
Zejn blickte auf.
Barthell starrte ihn angstvoll an. »I-ich weiß nicht, warum man Sie hierhergeschickt hat, Sergent. Aber es ist klar, dass Sie für diesen Posten deutlich überqualifiziert sind. Vor allem in Anbetracht der Tatsache …« Sein Blick zuckte zu den Schwalbenabzeichen, die auf der Schulter von Zejns Uniform angebracht waren. Eine Bronzeschwalbe stand für einen Anwärter in Ausbildung, eine Silberschwalbe für den Rang eines einfachen Gardisten. Zwei Schwalben kennzeichneten den Rang des Sergents, der eine zehn Mann starke Einheit befehligte. Doch das war es nicht, worauf Barthell sich bezog. Er verwies auf den abgedunkelten, vogelförmigen Fleck, der das Fehlen eines Rangs auf der sonst ausgeblichenen Uniform markierte.
Drei silberne Schwalben, Wappentier des Königshauses – sie standen für den Rang des Hauptmanns, auch Lieutenant genannt, oder, eine davon aus Bronze geschmiedet, für seinen Stellvertreter, den Lieutenant-Stellvertreter.
Zejn war ein Dienstgrad entrissen worden. Man hatte ihn herabgesetzt – degradiert – und nach Svonnheim versetzt. Nicht man. Jemand. Allein der Gedanke daran weckte in ihm Übelkeit.
Er schluckte sie herunter und musterte seinen Stellvertreter. »Sie sind ja doch nicht so dumm, wie ich dachte.«
Barthell nahm die Beleidigung mit einem Seufzen hin. »Ich mag nicht der klügste Hahn im Stall sein, aber ich verstehe, wie die Dinge laufen, Sir. Und wer in der tradeadischen Garde einmal in Ungnade gefallen ist, steigt nicht wieder so schnell in ihren Rängen. Sie werden wohl eine Zeit lang in Svonnheim festsitzen, Sergent. Sie sollten sich überlegen, wie Sie sich hier einrichten.«
Zejn maß ihn mit einem strengen Blick.
Barthell rückte sich zurecht und schlug die Stiefel aneinander. »Vor allem, weil es hier nicht viele gibt, die Ihnen bei einer Verletzung helfen können, Sir.«
»Was wollen Sie damit sagen?«
Barthells rechter Mundwinkel hob sich. »Es könnte sein, dass Sie just die Hilfe jener brauchen, die Sie jagen, Sergent.«
6
Während Barthell die Flugblätter in üblich schludriger Manier kritzelte, grübelte Zejn über dem Folianten vor sich hin. Er konnte die Waldhexe nicht ziehen lassen. Nicht, wenn sie im Verdacht stand, unlizenziert Magie zu betreiben. Nicht, nachdem sie einem Mann eine schwere Körperverletzung beigebracht hatte.
Seine Hand fuhr hoch zu seiner Schulter. Barthell mochte nicht so dumm sein, wie er wirkte, doch ein entscheidendes Detail war ihm entgangen – nicht bloß sein Rangabzeichen fehlte, auch an seinem Ärmel prangte ein dunkler Fleck. Hier war ein weiteres Zeichen angenäht gewesen. Ein Zeichen, das ihn genau zu dem lizenzierte, was er an der Waldhexe anprangerte: die Ausübung von Magie.
Es war nichts, das die Leute hier zu wissen brauchten. Seine Gabe war simpel und fand ausschließlich im Kampf Anwendung.
Er empfand sein magisches Talent mehr als passive Kraft, auch wenn er zu beiderlei Einsatz ausgebildet worden war. Und sollte er hier tatsächlich in einen Kampf geraten, war es besser, seine Gegner wussten nichts von dem entscheidenden Vorteil, den Sergent Zejn besaß.
Seine Gabe war sein Trumpf, das war ihm immer bewusst gewesen. Sie war einer der Gründe, warum er so früh zum Sergent und hernach zum Lieutenant aufgestiegen war. Er hatte sie nie als selbstverständlich angesehen. Allein die Unterstützung der Garde hatte das Unvorstellbare vollbringen können: einem Jungen aus bescheidenen Verhältnissen Zugang zu seinen magischen Fähigkeiten zu gewähren.
Seiner Mutter und dem Militär hatte er alles zu verdanken. Und er hatte versagt. Hatte sein Potenzial falsch genutzt, war in den Rängen aufgestiegen und wieder gefallen. Seine Mutter wusste nichts davon, schrieb ihm immer noch regelmäßig Briefe – nun, nicht sie selbst, da sie diese Fähigkeit nicht besaß, doch sie bat den Dorfschulzen, Zejn einige liebevolle Worte zukommen zu lassen. Zejn hatte ihr verschwiegen, was Svonnheim bedeutete. Sie glaubte daran, dass er glücklich war. Liiert. Reich an Reputation.
Er ließ sie in dem Glauben. Sollte sie damit ins Grab gehen. Die Verbitterung musste einzig er mit sich tragen.
»Sir?«, unterbrach Barthell seinen Gedankengang.
Zejn blickte von seinen Unterlagen auf. Sein Kollege hielt ihm ein Pergament vor die Nase, auf dem sich sein Stellvertreter künstlerisch verewigt hatte. »Was meinen Sie?«
»Barthell«, stieß Zejn hervor. »Sie sind ein Vollidiot!«
Enttäuschung zog an den Mundwinkeln des Gardisten. Er besah sein vermeintliches Meisterwerk. »Ich dachte nur, es wäre eine gute Idee, sie zu malen … wegen der Narben und so. Von wegen Wiedererkennung.«
Zejn verdrehte die Augen und grapschte ihm das Bildnis aus der Hand. »Sie haben ungefähr genauso viel Zeichentalent wie die Muhme des Monarchen.«
Der Gardist blickte ihn verwundert an. »Sie haben die Gemälde der Seconde Maman gesehen?« Ein Grinsen schlich sich auf seine Lippen. »Wusste ich’s doch, dass Sie ein hohes Tier waren! Was haben Sie angestellt, dass man Sie hierherversetzt hat?«
»Das geht Sie nun wirklich nichts an, Barthell.«
Statt beleidigt das Gesicht zu verziehen, betrachtete der Stellvertreter eingehend sein vermeintliches Meisterwerk. »Ich finde nicht, dass es so schlecht geworden ist, Sir.«
Zejn seufzte. Eines musste man dem Kerl lassen, er ließ sich auch durch die gröbsten Beleidigungen nicht aus der Ruhe bringen.
»Barthell! Barthell, mon amour!« Eine rotblonde Frau kam herangelaufen, das stattliche Dekolleté tanzte, ein besticktes Tuch bedeckte die feisten Schultern.
»Das ist die dicke Inge«, flüsterte Barthell Zejn zu. Er breitete die Arme aus und trat ihr entgegen. »Inge, ma chère – was gibt’s? Wie kann ich dich beglücken?«
Die dicke Inge wirkte weniger wie eine Frau, die beglückt werden wollte, als vielmehr getröstet.
»Der Mair-Hof zu Dorfesruh«, atmete sie schwer. »Marcel und Adriane und die Kinder haben ihren Hof verlassen! Sie sagen, man habe sie gewarnt! U-hu …«
Inge stützte sich schluchzend auf Barthell. Der Gardist hatte reichlich Mühe, die stattliche Frau auf den Beinen zu halten, ließ sich allerdings nicht davon abhalten, herzhaft zuzugreifen.
»Ja?«
»Wiedergänger!«, stieß die dicke Inge hervor. »Die Familie behauptet, man habe sie vor lebenden Toten gewarnt!«
Barthells Mund stand offen, dann platzte ein Lachen daraus hervor. »Und an diese Ammenmärchen glaubst du, ma chère?«
Inge blinzelte verzweifelt, doch bevor Barthell sie weiter necken konnte, ging Zejn dazwischen. »Wo ist die Familie?«
Verwirrt blickte sich die Frau um, als würde ihr erst bewusst, dass Zejn danebenstand. »W-wie?«
»Die Bauernfamilie. Wo hält sie sich auf?«
»I-in der Gelben Rübe, Sergent.«
Zejn nickte Barthell zu. »Los geht’s.«
»Sir«, murmelte Barthell. »Sie können doch nicht wirklich glauben, dass …«
»Wenn ich eines in meiner Laufbahn gelernt habe, Barthell, dann, dass Menschen zwar abergläubisch sind – aber ihr Aberglauben in der Regel tatsächlich existierende Probleme verdeckt. Folgen Sie mir.« Damit stapfte er in Richtung Schenke los.
Vor der Gelben Rübe standen zwei Kühe und ein Esel angeleint. Zejn vermutete, dass sie der Familie Mair gehörten, und trat ohne Umschweife ein.
Nur wenige Tische waren besetzt, die Schank leer. Es roch nach abgestandenem Bier und Essigwein. Die Fensterläden waren gegen die Kälte geschlossen, Fensterglas konnte sich hier kaum jemand leisten, weswegen die Szenerie hauptsächlich von vereinzelten Kerzen und einer Feuerstelle erleuchtet wurde. Die meisten Anwesenden hatten sich um einen Ecktisch versammelt. Der Mann, den Zejn als Wirt ausmachte, beugte sich mit speckiger Schürze über die Tafel und sprach leise auf ein Ehepaar ein, das sich an den Händen hielt. In der Ecke hockten zwei Kinder und spielten mit den Falten des Mutterrocks.
»Familie Mair?« Zejn trat an den Tisch heran.
Die Anwesenden zuckten herum. Misstrauische Blicke begegneten ihm. Er erwiderte sie.
»Vulgo Mair ist der Name unseres Hofs«, berichtigte die Frau. Sie lehnte sich zurück, legte die Hand auf ihren hochschwangeren Leib. »Wir sind die Familie Roux.« Braune Locken spähten unter einem Kopftuch hervor.
Zejn grüßte sie mit einem Nicken. »Man hat uns berichtet, dass Sie von Ihrem Hof geflohen sind. Was genau ist passiert?«
Das Ehepaar rückte zusammen. Die Kinder suchten nach der Nähe ihrer Eltern, kuschelten sich heran.
»Man hat uns gewarnt«, erwiderte die Frau unsicher. »Vor den Toten.«
»Den Toten?«
»Die Toten aus den Grabhügeln. Sie haben ihre Ruhestätte verlassen. Unser Hof liegt in der Nähe, zwischen dem Wald und Dorfesruh.«
»Dorfesruh?«
Sie nickte, die Augen blank wie ein Reh. »Der See nordöstlich von hier.«