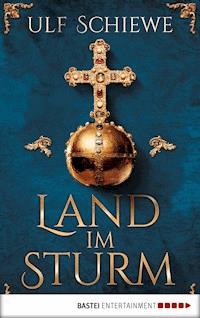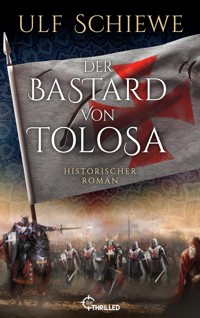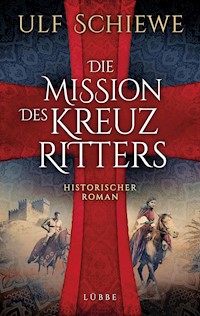9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Normannensaga
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Die Normandie im 11. Jahrhundert: Der berüchtigte Robert Guiscard von Hauteville, genannt das Schlitzohr, ist auf der Flucht nach Süditalien, wo seine Brüder sich als Kriegsherren einen Namen gemacht haben. Unter Roberts Gefährten befindet sich der 17-jährige Gilbert, dessen Herkunft im Dunkeln liegt und der bei den Hautevilles als Schweinehirt aufgewachsen ist. Seine Treue und Waghalsigkeit lassen ihn schnell zu Roberts engstem Vertrauten werden. Sie beginnen als Raubritter, für die nichts als Gold zählt, und sind doch dabei, ein Reich zu schaffen, das in Europa seinesgleichen suchen wird. Gewinner des HOMER-Literaturpreises 2014!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 510
Ähnliche
Ulf Schiewe
Das Schwert des Normannen
Roman
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Die Flucht
In der Nacht fielen Bewaffnete über unser Dorf her, sprangen von den Pferden und warfen Brände auf die strohgedeckten Hütten.
Manches, was dann geschah, sehe ich noch in allzu schrecklicher Deutlichkeit vor mir, vieles dagegen nur schemenhaft, denn ich war nicht mehr als ein Dreikäsehoch von vielleicht fünf Jahren. Ich muss bei meiner Mutter gelegen haben. Die Wärme ihres weichen Leibes und ihr schwacher Geruch von Milchbrei und Herdfeuer sind mir als Letztes in Erinnerung geblieben. Und natürlich, wie sie starb.
Beim ersten Gebrüll war sie hochgefahren und hatte gelauscht. Doch bevor sie mich an sich reißen und flüchten konnte, wurde die Tür eingetreten. Zwei Kerle drängten lärmend unter dem niedrigen Türbalken ins Innere der Hütte. Vor dem flackernden Feuerschein draußen wirkten ihre dunklen Gestalten wie Dämonen aus dem Höllenreich. Lange Schwertklingen blitzten in den Fäusten, suchten nach Gegnern. Dann bemerkten sie die schlanke Form meiner Mutter, die sich zitternd erhoben hatte, während ich mich an ihren Hemdzipfel klammerte.
Sie tauschten einen grinsenden Blick aus, bevor sie meine Mutter packten und in die Knie zwangen. Mit einem Ruck rissen sie ihr das dünne Leinenhemd vom Leib und starrten gierig auf ihre nackten Brüste. Mich kegelte ein Fußtritt zwischen die Töpfe und Pfannen an der Kochstelle.
Rücklings warfen sie meine Mutter auf das Lager, einer hielt sie fest, während der andere sich entblößte und auf sie stürzte. Sie kreischte wie besessen, suchte sich ihnen zu entwinden. Doch die Männer lachten nur über ihre vergebliche Mühe. Noch immer habe ich den nackten Hintern des Kerls vor Augen, der als Erster in sie eindrang, und bekomme Gänsehaut bei der Erinnerung an ihre spitzen Schreie. Es dauerte nicht lange, da war der andere an der Reihe. Noch einmal versuchte sie, sich zu wehren. Da wurden die Kerle wütend und schlugen auf sie ein, bis ihr Widerstand erlahmte und ich sie nur noch ächzen und wimmern hörte.
Schlimmer noch war die plötzliche Stille, die dann folgte, so unerträglich, dass ich mich mit einem Schrei gegen den Mann warf, der noch auf ihr lag, und ihm ein Küchenmesser ins Bein rammte. Gewiss nicht tief, dazu fehlte mir die Kraft, doch genug, dass er brüllend nach mir trat, von meiner Mutter abließ und sein Schwert vom Boden hob. Fast träge holte er aus und hätte mich mit einem Hieb in Stücke gehauen, wären da nicht zwei eiserne Fäuste gewesen, die mich von hinten packten und außer Reichweite rissen.
»Nicht den Jungen, ihr Schwachköpfe«, hörte ich eine tiefe Stimme. »Wegen dem sind wir doch nicht hier. Und hört auf, euch wie Säue zu benehmen.«
Ich strampelte wie wild und schrie nach meiner Mutter. Die beiden Schänder zogen beschämt ihre Beinkleider hoch. Sie selbst lag mit stierem Blick auf dem zerwühlten Lager und rührte sich nicht mehr.
»Verdammte Scheiße«, hörte ich meinen Retter bei dem Anblick murmeln, bevor er sie anherrschte. »Durchsucht alles nach Brauchbarem. Und dann raus hier.«
Er klemmte sich meinen kleinen Körper unter den Arm und zwängte sich durch die niedrige Tür. Einen letzten Blick auf die gebrochene Gestalt meiner Mutter konnte ich noch erhaschen, dann war sie für immer aus meinem Leben verschwunden.
Mein Schreien und Treten führte nur dazu, dass ich kurzerhand am Arm über den Erdboden aus der Hütte geschleift wurde. Draußen war der Anblick kaum besser. Brennende Dächer, vom Wind zu lodernder Brunst gefächelt, warfen ihren roten Schein auf ein paar Leichen, die auf dem Dorfplatz lagen. Hühner und Gänse stoben panisch davon, während die Krieger das Vieh zusammentrieben. Zwei heulende Mädchen, fast Kinder noch, wurden an Händen und Füßen gefesselt und wie Mehlsäcke auf einen der Gäule geworfen. Die übrigen Dörfler standen halbnackt und zitternd im kalten Nachtwind und schauten fassungslos zu, wie ihr Dorf niederbrannte.
Der Mann, der mich aus der Hütte gezerrt hatte, hob mich hoch und starrte mir ins tränennasse Gesicht. Ein Hüne von einem Kerl, wenn auch noch jung. Schlank war er und doch muskulös mit massigen Schultern, gutaussehend auf eine kantige Art, mit tiefliegenden Augen und blonden Strähnen, die sein Gesicht umwehten. Ich hasste ihn und versuchte, ihm ins Gesicht zu spucken.
»Nun gib endlich Ruhe, du kleiner Strolch«, lachte er, wobei seine Zähne im Feuerschein blitzten. »Sonst lass ich dich binden wie die Mägde da drüben.«
Er setzte mich vorsichtig auf die Füße, hielt mich aber fest am Nacken, während er Befehl zum Aufbruch gab. Später sollte ich mich noch oft an diese erste Begegnung mit Robert de Hauteville erinnern, den man das Schlitzohr nannte, Robert Guiscard.
Von dem langen Ritt ist mir wenig im Gedächtnis geblieben, außer dass Robert mich zu sich aufs Pferd setzte, dass die Nachtluft bitterkalt war und dass ich die meiste Zeit still vor mich hin weinte. Irgendwann musste ich eingenickt sein, denn meine nächste Erinnerung ist die an eine große Frau, die mich, fest an ihren üppigen Busen gedrückt, frühmorgens ins Haus trug, in Decken hüllte und an den warmen Herd setzte. Dabei schimpfte sie ausgiebig über die Herzlosigkeit ihres Männervolkes.
Sie hieß Fressenda, war Roberts Mutter und ein ansehnliches Weib von gutem Normannenblut, breiten Hüften und Haaren so gelb wie reifes Korn. Eine Frau, die zupacken konnte, wie ich bald erfahren sollte, die mit Verstand und einer scharfen Zunge gesegnet war, unter der sich selbst Roberts Vater duckte, wenn sie ihn damit geißelte. Ihrem Tancred de Hauteville, nun schon Mitte fünfzig, war sie ein gutes Weib. Um ihn und die zwölf Söhne kümmerte sie sich ebenso hingebungsvoll wie um die Knechte und Mägde der Burg und um die Bauern aus dem Dorf. Sie hatte ein Herz groß genug für alle, selbst für mich fand sich noch ein Plätzchen darin.
»Wie heißt du?«, fragte sie mich.
Noch voller Furcht und Hass, wollte ich ihr nicht einmal ins Gesicht sehen, geschweige denn antworten. Sie machte sich nichts daraus, flößte mir heiße Milch mit Honig ein und rieb mir die Füße warm. Dabei redete sie unablässig und schalt mich sanft, als wäre ich ein dummer kleiner Junge, der aus Unvernunft in den Dorfteich gefallen war.
»Brynjarr«, murmelte ich nach einer Weile widerwillig.
»Was?«
»Brynjarr.«
»Heißt du so?«
Ich nickte finster und wischte mir die Nase.
»Mag ich nicht«, sagte sie. »Das kriegt ja keiner über die Lippen. Bestimmt so ein Piratenname.«
Piraten waren für sie alle Seefahrer aus dem Norden, die mit ihren Schiffen an die Küste kamen, um Handel zu treiben, und nicht selten, um zu plündern. Dabei vergaß sie gern, dass sie selbst von solchen Leuten abstammte.
Sie überlegte einen Augenblick. »Wir hatten einen Knecht hier, weißt du. Ein guter Kerl. Der ist vor einer Weile gestorben. Und der hieß Gilbert. Ich werde dich nach ihm benennen. Das passt besser zu dir. Bist du eigentlich getauft?«
Ich sah sie nur mit großen Augen an.
»Ach, und selbst wenn …«, meinte sie und zuckte mit den Schultern. »Dann taufen wir dich eben noch mal.«
Und so wurde aus mir Gilbert. Obwohl ich meinen richtigen Namen all die Jahre nicht vergessen habe, denn er ist das Einzige, das mich noch mit meiner Kindheit und meiner Mutter verbindet. Doch Gilbert ist ein rechter Normannenname, und ich bin nicht unzufrieden damit.
Es sollten zwölf Jahre werden, die ich auf dem Besitz der Hautevilles verbrachte. Fressenda ließ mich mit der Zeit meinen Hass vergessen und wurde so etwas wie eine zweite Mutter. Nicht, dass ich verwöhnt wurde. Die Ländereien der Hautevilles waren nicht besonders ausgedehnt und das Leben wenig üppig. Zu viele Mäuler mussten gestopft werden. Anfänglich durfte ich die Gänse hüten, später die Schweine. Daher mein Spitzname, Gilbert Porchon, der Schweinehirt.
Die Schweine wären mir fast zum Verhängnis geworden, als ich mich zum ersten Mal in den Koben wagte. Ich wollte gerade eines der neugeborenen Ferkel auf den Arm nehmen, als mich die Sau anfiel, von den Beinen riss und sich wütend in mich verbiss. Fressenda packte mich am Kragen und zerrte mich außer Reichweite, bevor das Tier mich umbringen konnte. Die Narbe auf meiner Wange ist bis heute sichtbar.
Fressenda duldete keine Müßiggänger. Da war ich keine Ausnahme. Doch mein Vorrecht gegenüber den Knechten war, dass ich von ihr wie ein Sohn behandelt wurde und mit den Herrschaften am gleichen Tisch essen durfte. Manchmal steckte sie mir heimlich ein Stück Wurst zu und nannte mich ihren hübschen Piratenbub. Und vor dem Osterfest der Christen, wenn sie allen Männern der Familie der Reihe nach die Haare schnitt, durfte auch ich nicht fehlen.
Nach einer Weile gewöhnte ich mich an mein neues Leben und verlor selbst vor Robert meine Angst. Er hatte oft ein gutes Wort für mich, nahm mich sogar gelegentlich auf einen Ausritt mit. Gewiss nicht aus Reue, denn das hätte nicht seinem Wesen entsprochen. Aber die Männer, die meine Mutter umgebracht hatten, sah ich nie wieder.
Burg und Dorf von Hauteville lagen auf einem sanften Hügel, der das flache Land nach allen Seiten hin überblickte. Es gab viel Wald in der Gegend, und da das Roden eine ziemliche Schinderei ist, waren die Ackerflächen begrenzt. Von den Hütten des Dorfes umgeben, ragte ein klobiger, düsterer Turm in die Höhe. Er war das einzige Gemäuer aus Stein. Der Rest, ein großes Herrenhaus, Stallungen, Schmiede und Backhaus, war aus Holzstämmen gefügt und das Ganze von Graben und Palisaden umgeben. Keine Befestigung, die einem entschlossenen Angriff standgehalten hätte.
Doch die Stärke der Sippe war nicht die Burg, sondern ihre Männer. An Tancreds Seite standen kampferfahrene Söhne, blonde Riesen, mit denen nicht gut Kirschen essen war. Da war Serlo, der Besonnene und mit dreißig der Älteste. Nach ihm Williame, eine Urgewalt mit dem Kreuz eines Ochsen. Dann Drogo, Onfroi und Godefroi. Diese fünf waren Muriellas Brut, so hatte Tancreds erste Frau geheißen. Von ihr stammte auch eine Tochter, die ich nie zu Gesicht bekam, denn sie war mit einem Edelmann im fernen Rouen verheiratet. Für sie hatte Tancred mit Mühe eine Mitgift zusammengekratzt. Den Söhnen dagegen konnte er nichts geben, um eine Familie zu gründen.
Nach Muriellas Tod hatte Tancred wieder geheiratet und hätte es mit Fressenda nicht besser treffen können. Mit seinen zwanzig Jahren war Robert, mein Entführer, ihr Ältester, gefolgt von Mauger, Guillerm, Aubrey, Tancred, Humbert und Roger. Letztere waren in etwa meinem Alter. Dazu ein Töchterchen, das noch in den Windeln lag.
Natürlich gab es oft Reibereien zwischen den Stiefbrüdern, aber Fressenda machte keinen Unterschied zwischen ihnen. Es waren alles ihre Kinder. Auch ich gehörte jetzt dazu. Obwohl sie mich geraubt hatten, waren die Hautevilles bald meine Familie geworden, auch wenn die Jüngeren der Brüder mich oft hänselten und mich porchon riefen, um mich zu ärgern. Nur Roger tat das nicht. Wahrscheinlich habe ich ihn deshalb mein Lebtag lang geliebt.
Die beiden jungen Mädchen, die sie mit mir verschleppt hatten, mussten in der Küche arbeiten. Eine von ihnen wurde schwanger und bald darauf an einen Bauern verkuppelt. Die andere lief eines Tages fort. Die Männer ritten aus, um sie zu fangen. Was dabei aus ihr geworden ist, weiß ich nicht. Jedenfalls wurde sie nicht mehr erwähnt.
Seit unser Normannenherzog Williame seine Macht festigen konnte, sind Kleinkriege, Blutfehden und Raubzüge im Land seltener geworden. Damals, in jenen unruhigen Zeiten, waren solche Dinge jedoch nichts Ungewöhnliches. Und die Brüder Hauteville schienen oft ihre Finger in blutigen Geschäften zu haben, denn für Geld liehen sie ihr Schwert an jeden, der zahlen konnte. Fressenda behagte dies nicht, aber was sie heimbrachten, half, den Kochtopf zu füllen, wenn die Ernten schlecht waren.
Trotz seiner Jugend wurde Robert auch von den älteren Stiefbrüdern mit einer gewissen Achtung behandelt, denn er hatte seit jeher einen schlauen Kopf, daher sein Spitzname Guiscard. Warum er ausgerechnet mich geraubt hatte, darüber wurde lange Zeit nicht gesprochen. Bis zu jenem langen Winterabend, ich war inzwischen zehn Jahre alt, Roger neun. Draußen lag Schnee, die Mägde hatten die Tafel abgeräumt, und alles scharte sich um das große Feuer an der Rückwand der Halle. Die älteren Brüder tranken Bier und würfelten. Fressenda war in eine Decke gehüllt und wärmte ihre Füße an einem erhitzten Stein. Auch Tancred hatte sich ein Schaffell um die Schultern gelegt. Wir Knaben brieten Äpfel am Feuer.
»Erzähl von früher, Vater«, bettelte Roger.
»Nicht schon wieder«, stöhnten die Älteren.
»Doch, Vater, bitte.«
Wenn Tancred etwas gut konnte, dann war es Geschichten erzählen. Je nach Bedarf konnte seine Stimme schmeicheln oder donnern. Und überhaupt, seine ganze Erscheinung gab den Sagen und Legenden ihren besonderen Zauber, denn die weiße Löwenmähne um das wettergegerbte Gesicht ließ ihn wie Göttervater Thor persönlich erscheinen. Seine knallblauen Augen blinzelten verschmitzt, wenn es lustig wurde. Und das war nicht selten.
»Also gut, Jungs.« Er räusperte sich und warf den Hühnerknochen ins Feuer, an dem er genagt hatte. »Dann will ich euch heute erzählen, wie wir Normannen ins Land kamen.«
In Erwartung rückten wir enger zusammen.
»Ihr wisst, dass unsere Vorfahren aus dem hohen Norden kamen, aus dem Land der Fjorde und schneebedeckten Berge. Manche auch von den Inseln weit draußen im Meer, die man Orkneys nennt. Auf schnellen Drachenschiffen sind sie die Flüsse hinaufgefahren, haben gekämpft und Beute gemacht. Gold, Bernstein und Silber brachten sie heim zu ihren Weibern. Weder vor Sturm noch Schlachtgetümmel fürchteten sie sich, denn die Freuden Walhalls warteten auf die Tapferen, und einen rechten Kerl konnte man an der Zahl der Silberringe erkennen, die seine Arme schmückten.«
»Seeräuber«, murrte Fressenda. Für Walhall und die alten Götter hatte sie wenig übrig.
Doch wir achteten nicht auf sie. Auch wenn wir diese Geschichten schon hundert Mal gehört hatten, wir konnten nie genug davon bekommen.
»Einer dieser Männer hieß Hrolf«, fuhr Tancred fort. »Sie nannten ihn den Geher, Ganger Hrolf. Er hieß so, weil er so groß war, dass ihn kein Pferd tragen konnte. Die Franken nannten ihn später Rollo, das kam ihnen leichter über die Lippen. Er war ein gewaltiger Krieger, der ein Gefolge von Teufelskerlen um sich sammelte und mit ihnen das weite Meer befuhr. Sie fielen in ein Land namens Frisia ein und erkämpften sich Beute, Sklaven und hübsche Weiber.«
Hierauf ließ Fressenda ein verächtliches Grunzen vernehmen. Doch Tancred schien es nicht zu stören.
»Im nächsten Jahr segelten sie zu den Küsten des Westens, wo die Angeln und Sachsen leben. Auch hier erging es ihnen ähnlich, so dass sie bei ihrer Heimkehr als Helden gefeiert wurden. Immer mehr Männer schlossen sich Rollo an.«
Tancred nahm einen Schluck Bier und rülpste genüsslich.
»Schließlich kamen sie an unsere Küsten und begannen, die Seine heraufzurudern, dort wo sie ins Meer fließt. Rollo gefiel, was er sah. Fruchtbares Land mit Flüssen voller Fisch und Wäldern reich an Wild. Auf den Feldern gedieh der Weizen, Schafe und Rinder standen auf saftigen Wiesen. Rollo beschloss, sein Wanderleben aufzugeben und sich hier niederzulassen. Er und seine Gefährten unterwarfen das Volk und errichteten Befestigungen. Das konnte den Franken, denen das Land gehörte, nicht gefallen, und sie führten Krieg gegen Rollo. Charles der Einfältige war damals König. Obwohl er Rollo einmal sogar besiegte, konnte er ihn und seine Nordmänner doch nicht vertreiben, und am Ende schloss er einen Pakt mit ihnen. Sie durften das Land behalten, wenn sie es gegen andere Seeräuber verteidigten. Und dafür sollten sie ihm Gefolgschaft schwören. Zur Bekräftigung nahm Rollo Gisela, des Königs Tochter, zur Frau und ließ sich taufen. Danach sollte er als Zeichen seiner Huldigung, wie es bei den Franken üblich war, den Fuß des Königs küssen.«
Mit einem schelmischen Augenzwinkern hielt Tancred inne und steckte seine Nase in den Bierkrug. Kichernd stießen wir uns an, denn wir wussten schon, was nun kam. Nach einem kräftigen Schluck wischte er sich über die Lippen und nahm den Faden wieder auf.
»Nun, dem König den Fuß zu küssen, Herrgott noch mal, das war Rollo bei aller Liebe nun doch zu viel. Er befahl also einem seiner Männer, es für ihn zu tun. Auch dem widerstrebte dies. Doch Rollo bestand darauf. Da bückte sich der Kerl, packte des Königs Fuß und riss diesen so hoch an seine Lippen, dass der König rücklings in den Dreck stürzte.«
Bei diesen Worten johlten und kreischten wir immer vor Vergnügen, ganz gleich, wie oft wir die Geschichte schon gehört hatten. Roger sprang auf und machte gackernd beide nach, den Kerl, der den Fuß hochriss, und den König, der in den Dreck fiel. Jetzt lachte auch Fressenda und rief ihren Jüngsten zu sich, um ihn zu küssen und liebevoll über die glühenden Wangen zu streicheln.
»Und was lernen wir daraus, Männer?«, fragte Tancred.
»Ein Normanne beugt sich vor niemandem«, brüllten wir alle im Chor.
»So ist es«, lachte Tancred.
Natürlich wollten wir mehr hören, und es folgten einige der vielen Familienlegenden über den nordischen Krieger Hiallt, Tancreds Urgroßvater, der nach Rollos Tod ins Land gekommen war und Williame Langschwert, dessen Sohn, als Gefolgsmann diente. Ihm hatte Hiallt eines Tages bei der Jagd das Leben gerettet und dafür das Lehen erhalten, auf dem die Familie lebte. Hialtus Vila hatte er sein Dorf nach dem eigenen Namen benannt. Daraus wurde mit der Zeit Hauteville, je mehr die Normannen das Fränkische annahmen.
Ich beneidete die Hautevilles um ihre glorreichen Vorfahren. Und so rief ich plötzlich, als Tancred schon gähnte: »Und ich? Bin ich auch ein Nordmann oder ein Däne?«
Als alle mich anstarrten, wurde ich rot vor Verlegenheit.
»Du?«, sagte Humbert verächtlich. »Du bist ein Schweinehirt. Die kommen nicht aus dem Norden.«
»Selber Schweinehirt«, zischte ich und boxte ihm in die Rippen.
»Da hast du unrecht, Humbert, mein Sohn«, erwiderte Tancred. »Er ist als Geisel zu uns gekommen. Und Gilbert ist auch nicht sein richtiger Name.«
Die Jungen staunten. »Als Geisel?«
»Robert!«, brüllte Tancred. »Komm her und erzähl dem Jungen endlich, woher er stammt.«
»Vergiss es, Vater«, kam Roberts Antwort, der immer noch mit den Älteren würfelte. »Was sollen wir darüber reden. Der Mann ist längst tot.«
Robert kannte meinen Vater? Ich saß da wie versteinert. Meine großen Augen schienen Tancred zu dauern, denn er beugte sich vor und strich mir über den zerzausten Haarschopf.
»Er war ein Seefahrer, dein Vater, der mehrere Langschiffe mit Kriegern besaß. Die Seeräuberei zahlt sich heutzutage nicht mehr aus, aber manchmal kommen sie noch. Sein Lager am Strand wurde überfallen, und er musste ein Schiff zurücklassen, auf dem du und deine Mutter euch befandet. Du warst noch sehr klein. Ihr wurdet in jenes Dorf verschleppt, das sich Saint Croix nach dem Kreuz des Christengottes nennt, in der Hoffnung, dein Vater würde kommen und Lösegeld bieten. Davon hatte Robert gehört und beschlossen, dich selbst zu entführen. Er hat dann in den Häfen lange herumgefragt und nach deinem Vater gesucht. Ein wenig Lösegeld wäre uns allen gut bekommen, mein Junge, aber vergebens. Wir haben nie mehr von dem Mann gehört.«
Ich war überwältigt und konnte lange nichts sagen.
»Wie war sein Name?«, hauchte ich schließlich.
»Sven Langhaar soll er geheißen haben.«
»Bestimmt hat Robert sich getäuscht, und Gilbert ist doch nur ein Schweinehirt«, krähte Humbert.
»Vielleicht«, nickte Tancred. Dann zwinkerte er mir zu. »Vielleicht ist er aber auch ein Dänenprinz.«
Ein Dänenprinz. Mein Herz schlug heftig. Er hätte mich nicht glücklicher machen können. In der Nacht konnte ich kaum schlafen. Ich sah mich als Krieger unter rauhen Gesellen auf dem Schiff meines Vaters ins Abenteuer segeln. Brynjarr Svensson, der unerschrockene Sohn des berüchtigten Seefahrers und Kriegsherrn Sven Langhaar. Starker Wein für einen Zehnjährigen. Selbst Humbert behandelte mich von nun an mit mehr Respekt.
Zwei Wochen später wurde Hauteville überfallen.
Diesmal waren es Onfroi und Godefroi, die etwas ausgefressen hatten. Wie die Furien kamen sie durch den Schnee galoppiert, verfolgt von einer Bande bewaffneter Reiter, und nur im letzten Augenblick konnten sie sich in die Burg retten. Doch schon begannen die Verfolger, das Dorf zu plündern. Sie trieben Vieh zusammen und fingen die Pferde auf der Weide ein. Dann flogen Brandpfeile auf die holzgetäfelten Dächer.
»Ruht euch nicht aus«, knurrte Serlo den beiden noch atemlosen Brüdern zu. »Wir müssen sie sofort angreifen.«
Er warf sich in seinen Kettenpanzer und griff nach Schild und Speer. Drei Waffenknechte taten es ihm gleich.
Fressenda, mit wirrem Haar bis auf die Hüften, befahl den Knechten, auf die Dächer zu klettern, um das Feuer zu löschen. Die Frauen bildeten eine Kette, und Eimer mit Brunnenwasser wurden hinaufgehievt.
Auch Robert und Mauger wappneten sich hastig. Selbst Tancred ließ es sich nicht nehmen, eigenhändig den Besitz zu verteidigen. So stürmten sie aus dem Tor und warfen sich gegen ihre Feinde.
Es kam zu einem kurzen, aber heftigen Gefecht, bei dem trotz der Übermacht der Gegner die unbändige Wildheit und Entschlossenheit der Hautevilles rasch die Oberhand gewannen. Drei der Angreifer mussten ihr Leben lassen, bevor die Übrigen sich auf ihren Gäulen davonmachten. Leider war auch Tancred unter den Toten. Ein Pfeil hatte ihm die Kehle durchbohrt.
Lange trauerte ich um ihn.
Sven Langhaar.
Der Name sollte mir ein Lebtag lang im Kopf herumspuken. Prinz oder Schweinehirt, wer war ich wirklich? Wahrscheinlich nur der Sohn eines Kauffahrers, dem die Frau entlaufen war.
Und doch befeuerten Tancreds Worte meinen Geist und ließen mich nicht zur Ruhe kommen. Seinen Söhnen muss es ähnlich gegangen sein mit diesen Geschichten von großen Taten, von Kampf und Ehre, Wagemut und Eroberung. Tancred war einer, der von den alten Zeiten träumte, als entschlossene Männer sich noch Reiche schufen. Ganz gleich, wie sehr Fressenda versuchte, seinen Einfluss auszugleichen, alle zwölf waren von diesem Fieber angesteckt, Großes zu vollbringen.
Bei den Hautevilles gab es außer Burg und dem bisschen Land kaum etwas zu erben. Anstatt das wenige aufzuteilen, hatte man beschlossen, dass Serlo, der Älteste, alles übernehmen sollte. Die anderen würden sich bei einem großzügigen Herrn verdingen oder ihr Glück in der Fremde suchen müssen.
Williame und Drogo waren die Ersten, die Fressendas warmes Nest verließen. Das war schon kurz nach meiner Ankunft in Hauteville gewesen. Ihnen war zu Ohren gekommen, dass normannische Söldner im fernen Süden gern gesehen waren. Ein gewisser Normanne namens Richard Drengot sei für seine Kriegsdienste zum Grafen von Aversa aufgestiegen, so hieß es, und könne gute Männer gebrauchen. Wo dieses Aversa wohl lag, war keinem geläufig. In Italia hieß es. Angeblich sollte es dort warm sein, besser als das oft feuchtklamme Wetter in unseren Landen. Also waren die beiden in den Süden aufgebrochen. Wie es ihnen wohl ergangen sein mochte, fragte sich oft die Familie, doch Kunde kam lange Zeit keine.
Nach Tancreds Tod war Fressenda nicht mehr dieselbe. Sie schien oft abwesend, saß still da und starrte vor sich hin. An anderen Tagen machte sie uns verrückt mit endlosem Gerede und ihren Sorgen um Williame und Drogo. Sie vermisste sie, auch wenn es nicht ihre eigenen Söhne waren.
Sieben Jahre waren vergangen, da erreichten eines Tages fremde Krieger die Burg. Sie waren gut gewappnet und braun gebrannt, mit von der Sonne gebleichten Haaren. Einen erkannten wir. Der war damals mit Williame und Drogo geritten und hatte uns viel zu erzählen.
Er komme, um Grüße zu überbringen und Männer anzuwerben. Es sei den Brüdern gut ergangen. Bei den Fürsten der Lombarden hätten sie sich lange Zeit als Söldnerführer verdingt und mal auf dieser, mal auf jener Seite gekämpft. Sogar gegen die Sarazenen in einem Land, das sich Sicilia nannte. Inzwischen aber hätten sich die meisten Normannen in Italia zusammengeschlossen und Williame zu ihrem Anführer gewählt. Williame Bras-de-Fer nannten sie ihn jetzt. Nun, einen Arm wie Eisen hatte er schon immer gehabt. Und doch, wir waren alle erstaunt über das, was der Mann zu berichten hatte. Für einen Kerl, der den Tod nicht fürchtete, gebe es im Mezzogiorno, wie er den reichen Süden nannte, unzählige Städte zu plündern und Land zu erobern, von den hübschen Weibern gar nicht zu reden. Zum Beweis hatte er wertvolle Geschenke mitgebracht.
Dieser Mezzogiorno schien das gelobte Land zu sein. Besonders in Roberts Augen glitzerte es begehrlich, und er wollte alles bis ins Kleinste wissen. Der geht als Nächster, dachte ich bei mir. Doch es war zuerst Onfroi, der zwei Jahre später seinen Brüdern folgte.
Robert dagegen hatte etwas anderes gefunden, von dem er sich eine goldene Zukunft versprach. Er war als Reiterführer in den Dienst des mächtigen Seigneur de Creully getreten, Hamon Le-Dentu, so genannt, weil ihm wegen eines Schwerthiebs ein Teil der Lippen fehlte und dadurch die Zähne sichtbar waren. Diesem Baron hatte Robert sich durch Mut und Klugheit unentbehrlich gemacht. Außerdem war da noch eine Liebesgeschichte mit Hamons einziger Tochter, die Robert zu ehelichen hoffte.
Doch es sollte anders kommen.
Seit mehr als zehn Jahren hatte Unruhe in der Normandie geherrscht und offene Revolte gegen den jungen Herzog Williame den Bastard. Heute ist er König von England, aber damals missgönnten seine Vettern ihm den Herzogtitel, denn er war unehelicher Herkunft. Besonders im Bessin und im Contentin, wo die Hautevilles lebten, hatten die Aufrührer viele Anhänger. Die dortigen Barone hingen noch den alten Zeiten nach. Den Christenglauben und das Lehnswesen der Franken hatten sie eher halbherzig angenommen. Sie fühlten sich als freie Männer, die ihre Führer selbst erwählten. Sich einem halben Kind und noch dazu einem Bastard zu unterwerfen ging ihnen gegen den Strich. Auch Hamon Le-Dentu gehörte zu den Rädelsführern, und Robert Guiscard stand treu an seiner Seite.
Nach einem Mordversuch, dem der jetzt neunzehnjährige Herzog nur mit knapper Not entkam, waren die Fronten vollends verhärtet. Die Aufrührer fürchteten Williames Rache und begannen, ein gewaltiges Heer aufzustellen. Viel stand auf dem Spiel. Ein Sieg konnte Großes auch für Robert bedeuten.
Herzog Williame hatte ebenfalls gerüstet, doch es war ihm nicht gelungen, mehr als eine kleine Schar zusammenzukratzen. Sein Untergang schien besiegelt, als sein Lehnsherr, der Frankenkönig Henri, an der Spitze eines Heeres ihm zu Hilfe eilte.
Es war im August des Jahres 1047, einem ungewöhnlich heißen Sommer. Ich war gerade siebzehn Jahre alt geworden. Wochenlang hatte es nicht geregnet. Die Felder waren abgeerntet, der Boden hart und ausgetrocknet. In der Nähe von Caen sollte es zur entscheidenden Schlacht kommen. Das ganze Land schien den Atem anzuhalten. Wir warteten auf erlösenden Regen und auf Kunde von den Kämpfen.
An einem schwülen Nachmittag näherte sich ein Trupp von Kriegern, sechs Reiter und über zwei Dutzend Mann zu Fuß, die ihre Schilde auf dem Rücken trugen. Ich erkannte Robert und öffnete das Tor. Abgekämpft und aus mehreren Wunden blutend, ließ er sich aus dem Sattel gleiten. Den anderen Männern schien es nicht besser zu gehen. Viele trugen notdürftige Verbände.
»Was ist geschehen?«, fragte ich.
»Das siehst du doch«, herrschte er mich an. »Sie haben uns den Arsch versohlt.«
Fressenda und die anderen kamen aus dem Haus gelaufen.
»Robert«, rief sie und schlug entsetzt die Hand vor den Mund. »Du bist verwundet?«
Er legte den Arm um sie und humpelte an ihrer Seite in die Halle. »Halb so schlimm, Mutter. Mit Nadel und Zwirn bin ich bald wie neu. Kümmert euch um meine Männer. Da sind welche, die haben’s nötiger als ich.«
Roger und ich halfen, ihn aus Kettenpanzer und Lederwams zu schälen. Robert hatte recht. Die Wunden an seinem Leib waren nur oberflächlich. Die an seiner Seele tiefer. Während sie ihn nähten und verbanden, goss er zwei Karaffen Wein in sich hinein, ohne ein Wort zu sagen.
»Nun rede schon«, brummte Serlo, seit langem das Oberhaupt der Familie.
»Wir waren so nah dran, verflucht«, ließ Robert endlich hören. »Hatten keine Mühe, durch ihre Linien zu stoßen, drangen sogar bis zum König Henri vor. Dem brach der Gaul unter dem Hintern zusammen, und mein Herr hätte ihn fast getötet. Das wäre der sichere Sieg gewesen.«
»Und was ging schief?«
»Dieser Verräter ist uns in den Rücken gefallen.«
»Wer?«
»Ralf de Tesson.«
»Hatte der nicht geschworen, Williame eigenhändig umzubringen?«
»Der Hundsfott hat es sich anders überlegt. Griff unsere Flanke mit hundertfünfzig Reitern an. Im Durcheinander wurde ich von Hamon getrennt, worauf des Königs Männer über ihn herfielen. Ich musste zusehen, wie sie ihn erschlugen. Der Feind gewann die Überhand, unsere Reihen brachen auseinander. Dann kopflose Flucht. An der Orne holten sie uns ein. Ihr könnt euch das Gemetzel nicht vorstellen. Das Mühlwehr ist von Leichen so verstopft, dass sich das Wasser staut.«
»Wie seid ihr entkommen?«
»Wir konnten uns im Wald verstecken.«
Nach seinem Bericht herrschte lange Stille, während Serlo sich den Bart strich und nachdachte.
»Du kannst hier nicht bleiben«, sagte er. »Williames Rache wird euch alle verfolgen. Bis zum letzten Mann. Die Burgen der Rädelsführer werden sie schleifen und ihren Besitz unter sich verteilen. Du warst Hamons rechte Hand und bist bekannt, vergiss das nicht. Sie werden kommen, Robert, und wenn sie dich finden, werden sie dich foltern und vierteilen.«
Fressenda stöhnte auf, als würde sie selbst gefoltert. Sie trat rasch an Roberts Seite und schlang die Arme um sein Haupt. »Er muss sich verstecken«, rief sie.
Serlo schüttelte den Kopf. »Soll er ein Leben lang vor Williames Häschern weglaufen?«
»Was schlägst du vor?«, fragte Robert, der sich sanft aus der Umarmung seiner Mutter befreite.
»Geh nach Italia. Bei unseren Brüdern bist du sicher.«
Zum ersten Mal, seit er heimgekehrt war, gönnte Robert sich ein dünnes Lächeln.
»In den Mezzogiorno, meinst du?«
»Du hast keine Wahl. Am besten gleich morgen bei Tagesanbruch.«
Robert nickte. Er brütete eine Weile vor sich hin.
»Meine Männer werden sicher mitkommen«, sagte er mit einem Seufzer. »Die sind jetzt genauso gesetzlos wie ich.«
»Ich gebe euch Wegzehrung mit. Und an Ausrüstung, was wir entbehren können.«
»Danke, Bruder.«
Mezzogiorno. Da war es wieder, das Zauberwort. Ich weiß nicht genau, was ich mir darunter vorstellte, aber es packte mich plötzlich eine unbeschreibliche Sehnsucht nach diesem Land.
»Ich komme mit!«, rief ich wild entschlossen. »Du kannst auf mich zählen, Robert.«
»Du?«, lachte er. »Was soll ich mit einem Schweinehirten?«
An seinem Lächeln sah ich, dass er mich nur necken wollte.
»Zusammen mit Roger habe ich reiten und kämpfen gelernt, das weißt du so gut wie ich.«
»Aber Waffen hast du keine.«
»Irgendwas wird sich schon finden«, beharrte ich.
Auf keinen Fall wollte ich mich jetzt abweisen lassen, nachdem der Gedanke in mir gerade so richtig Wurzeln geschlagen hatte.
»Na gut. Du kannst dich um die Pferde kümmern.«
»Danke, Robert.« Ich konnte mein Glück kaum fassen.
»Ich will auch dabei sein«, ließ Roger sich vernehmen.
Fressenda wurde rot im Gesicht und sah aus, als wollte sie ihm eine Maulschelle verpassen. »Auf keinen Fall«, schrie sie. »Du bist viel zu jung.«
»Mutter! Ich bin fast so alt wie Gilbert.«
»Nein, nein, nein! Ich will kein Wort davon hören.«
»Mutter hat recht, Roger«, ließ Serlo sich vernehmen. »Und das ist das letzte Wort, hast du mich verstanden?«
Serlo konnte sehr bedrohlich wirken, wenn ihm der Sinn danach stand. Roger funkelte seinen Halbbruder zornig an. Dann lief er aus der Halle und schlug die Tür hinter sich zu, dass es bis ins Gebälk krachte. Er war so wütend, dass er sich nicht einmal von mir verabschieden wollte.
Dafür hatte ich jemand anderen zu verabschieden.
Denn in diesem heißen Sommer hatte mich der Blitz getroffen, le coup de foudre, wie man sagt. Sie hieß Gerlaine und war die Tochter des Schmiedemeisters. Nach der ersten Begeisterung über die bevorstehende Reise ernüchterte mich der Gedanke, sie verlassen zu müssen.
Ich rannte ins Dorf, um mit ihr zu reden. Ihre Mutter war vor wenigen Jahren verstorben, sie hatte keine Geschwister, und ihr Vater war ein griesgrämiger Graubart, der es nicht gern sah, wenn sie sich mit mir traf. Aber an diesem Abend war er nicht zu Hause, und so schlichen wir uns aus dem Dorf und auf die Felder. Am Waldrand setzten wir uns ins Gras und blickten in den Sonnenuntergang.
Ich hatte erwartet, dass sie über unseren Abschied Tränen vergießen würde, aber sie starrte nur versonnen über die abendliche Landschaft und sagte nichts. Bei Gerlaine wusste man nie, woran man war. Ich konnte nicht einmal sagen, ob sie mich wirklich liebte, obwohl sie an meinen Küssen Gefallen hatte und mich manchmal auf eine so seltsame Weise ansah, dass mir die Knie schwach wurden.
»Robert, dein Herr«, meinte sie nach einer Weile, »der wird es weit bringen.«
»Wie kommst du darauf?«
»Man spürt eine Kraft in ihm.« Sie hatte manchmal diesen Blick, als befände sie sich in einer anderen Welt und sähe Dinge, die sonst niemand wahrnehmen konnte. »Und er ist rastlos wie ein hungriger Wolf.«
Ich wusste, was sie meinte. Alle Brüder waren beeindruckende Männer, kraftvoll, lärmend, manchmal streitsüchtig. Aber Robert war noch anders. Er hatte etwas an sich, das Menschen in seinen Bann zog. Von ihm bemerkt zu werden oder gar ein Lob, dafür war man bereit, fast alles zu tun. Dann wieder gab es Momente, da fürchtete man sich vor ihm, denn sein Zorn konnte schrecklich sein. Und auch mit der anderen Bemerkung hatte sie recht. Er schien nie zufrieden, ein ewig Suchender.
»Bist du nicht traurig, dass ich fortgehe?«
Mit einem Ruck drehte sie den Kopf zu mir herum und starrte mich an, aus Augen so graugrün wie Morgennebel über den Feldern. Ihr Blick konnte einem durch Mark und Bein gehen.
»Nimm mich mit, Gilbert.«
»Aber das geht nicht …«, stammelte ich wie vor den Kopf geschlagen.
»Wolltest du mich nicht heiraten?«
Mit siebzehn und im Überschwang der Gefühle, da redet man so manches unbedachte Wort. Verlegen kaute ich auf der Unterlippe, während sie mich spöttisch musterte.
»Keine Sorge. Heiraten musst du mich nicht. Nur mitnehmen sollst du mich. Ich bin es leid hier. Was gibt’s denn schon in diesem Dorf? Irgendwann verkuppelt mein Vater mich mit einem dummen Bauern, der mir zehn Kinder macht. Entweder sterbe ich im Kindbett oder vor lauter Langeweile, während du deinen Spaß hast.« Sie ließ ihren Blick wieder in die Ferne schweifen. »Wie heißt das Land? Mezzogiorno? Was bedeutet das?«
»Mittag. Da, wo am Mittag die Sonne steht.«
Ich konnte nicht glauben, dass sie es ernst meinte. Ein junges Mädchen unter diesen rauhen Kriegern? Ein ungeheuerlicher Gedanke. Ich hatte mir die Kerle angesehen. Einige von denen machten einen ziemlich wüsten Eindruck.
»Gerlaine, du bist vollkommen verrückt.«
»Dann frag ich ihn eben selbst«, war ihre Antwort.
»Er wird es nicht erlauben.«
»Wir werden sehen.«
Als sie sich am nächsten Tag im Morgengrauen herausfordernd vor Robert aufstellte und rundheraus verlangte, sie mitzunehmen, starrte er sie erstaunt an. Dann ließ er seinen Blick an ihr von oben bis unten wandern. An seinem Gesichtsausdruck konnte man erraten, was in ihm vorging. Ein hübsches Mädchen war sie allemal. Und doch schien sie nicht besonders verwöhnt zu sein. Sie hatte gute Schultern, einen geraden Rücken, und ihre Füße steckten in soliden Bundschuhen. Sie trug einfache, etwas verschlissene Männerkleider und hatte einen Ranzen auf dem Rücken, das dunkle Haar unter einem Tuch versteckt.
»Kannst du kochen?«, fragte er.
Sie nickte. »Ebenso gut wie nähen und flicken.«
»Und dein Vater?«
»Der kommt erst in drei Tagen zurück. Bis dahin sind wir weit weg von hier.«
Sie blickte ihn ruhigen Auges an und ganz ohne Furcht. Ich glaube, Robert bewunderte ihren Schneid. Jedenfalls warf er mir einen belustigten Blick zu.
»Du bist verantwortlich für sie, Gilbert. Nicht, dass sie unterwegs schlappmacht.«
Dann lachte er schallend.
Wenig später brachen wir auf.
Das große Abenteuer hatte begonnen.
Der Wolf der Abruzzen
Noch vor dem Abmarsch hatte Robert uns seine Bedingungen klargemacht. Von jedem Einzelnen verlange er uneingeschränkte Treue und Gehorsam. Und ohne seinen ausdrücklichen Befehl dulde er weder Diebstahl noch Plünderei. Schließlich hätten wir anderes zu tun, als uns unterwegs mit wütenden Landbesitzern und Kastellanen herumzuschlagen. Dabei ließ er keinen Zweifel aufkommen, dass jeder Verstoß hart geahndet würde.
»Wem das nicht passt, der soll besser hierbleiben«, sagte er. »Überlegt es euch gut, denn später gibt es kein Zurück.«
Die Männer kannten ihn und wussten, dass er es ernst meinte, doch keiner von ihnen murrte. Besonders nicht unter dem strengen Blick eines rothaarigen Kerls mit gewaltigen Muskeln, der sich Rainulf nannte und wohl Roberts rechte Hand war. Das halbe Ohr hatte der Mann im Kampf verloren, schon sein Auftreten schüchterte ein, obwohl er wenig redete.
»Sold kann ich keinen zahlen«, fuhr Robert fort, »und die Verpflegung ist knapp bemessen. Doch im Süden wird es reiche Beute geben, das verspreche ich. Bis dahin müssen wir den Gürtel enger schnallen. Je schneller wir ankommen, desto besser. Erwartet also keine gemütliche Reise. Wir werden marschieren, bis wir umfallen.«
Und tatsächlich trieb er uns zu unbarmherzigen Gewaltmärschen an. Dabei verlangte er nicht mehr, als er selbst zu leisten bereit war. Wie alle in der Truppe gingen er und die fünf anderen Ritter zu Fuß. Pferde und Maultiere dienten einzig dazu, Gepäck und Waffen zu tragen, damit wir tagsüber schneller und länger marschieren konnten. Einzig meiner Gerlaine erlaubte er gelegentlich zu reiten, aber nur bis ihre Füße abgehärtet waren.
Die ersten Tage waren eine Qual. Zum Glück blieb uns das sommerliche Wetter treu, denn die meisten hatten abends kaum noch Kraft, ihre einfachen Zeltplanen aufzustellen, und so mancher schlief schon vor dem Abendessen ein. Nicht, dass man viel verpasste, denn Kochen war zu viel verlangt, und außer dem harten, mitgebrachten Brot und ein wenig Käse gab es nichts.
Was brachte diese Männer dazu, Robert zu folgen? Einem gesetzlosen Flüchtling, der mit zweiunddreißig Jahren noch nichts vorzuweisen hatte und der uns jetzt diesen Höllenmarsch in eine unsichere Zukunft abverlangte, ohne Aussicht auf Sold, nur mit einem vagen Versprechen auf Beute. Überhaupt, warum die Eile?
Aber so war dieser Robert Guiscard. Hart mit sich selbst und anderen, immer mit einem Ziel vor Augen und erfüllt von ungeduldigem Tatendrang. Zuversichtlich und des Weges sicher marschierte er voran. Ein Blick aus seinen stahlgrauen Augen genügte meist, um jeden Zweifler verstummen zu lassen. Es war schwer zu erklären, aber ihm traute man alles zu. Wer mochte da zurückbleiben oder seinen Spott ertragen?
Mit mir und Gerlaine und zwei Bauernburschen aus dem Dorf als Maultiertreiber waren wir ein bunt zusammengewürfelter Haufen von etwa fünfunddreißig, mehr schlecht als recht bewaffnet. Einige trugen noch Verbände, hätten sich aber lieber die Zunge abgebissen, als über Schmerzen zu klagen. Robert und die Ritter waren die Einzigen, die gut gerüstet waren und Kettenpanzer besaßen. Ich dagegen nannte nur ein langes Messer mein Eigen, das ich täglich schärfte und mit einem öligen Lappen säuberte, damit kein Rost ansetzte.
Es waren auch ein paar Raufbolde darunter, denen man ungern im Dunkeln begegnet wäre. Ihr Sprachrohr war ein vierschrötiger Muskelprotz namens Osbert, der seine flinken Augen überall zu haben schien.
»Halt mir bloß diesen Kerl vom Leib«, sagte Gerlaine schon am ersten Tag, als ahnte sie etwas.
»Wieso? Er tut dir doch nichts.«
Sie sagte nichts weiter, bat mich nur, ihr einen Stock zu schneiden, auf den sie am Wegrand zeigte. Die Astknoten sollte ich lediglich abrunden, und am Ende meiner Schnitzerei war dabei mehr eine Waffe herausgekommen als ein Wanderstab. Diesen Knüppel behielt sie von nun an immer bei sich. Und auch ich hielt ein vorsichtiges Auge auf Osbert, denn ihre Ahnungen hatte ich schon zu schätzen gelernt.
Der Erste, mit dem ich mich anfreundete, war ein sehniger Graubart, den sie Le-Vieux Reynard nannten, obwohl er nicht zu ermüden schien und sich flinker bewegte als so mancher Junge. Vielleicht war er auch gar nicht so alt, sondern nur früh ergraut. Jedenfalls war er schon zweimal im Mezzogiorno gewesen und kannte den Weg.
»Wir werden der Rhone folgen und das große Gebirge umgehen«, meinte er. »Das ist zwar länger, aber man kommt schneller voran.«
»Wie ist es da im Süden?«, wollte ich wissen.
»Du wirst es bald selbst herausfinden«, grinste er.
»Nun sag schon.«
Er lächelte in sich hinein. »Einige haben dort ihr Glück gemacht. Nur, einfach ist es nicht. Mir jedenfalls ist es nicht gelungen.«
»Und warum bist du dann wieder mitgekommen?«
»Weil ich ein verdammter Narr bin«, lachte er. Dabei fiel mir die Zahnlücke im rechten Oberkiefer auf, angeblich die Erinnerung an eine besoffene Prügelei. Der Kerl habe mit einem Hammer zugeschlagen, meinte Reynard, es dann aber doch bereut.
»Warum? Hat er sich entschuldigt?«
»Dazu ist er nicht mehr gekommen«, grinste er und machte eine unmissverständliche Handbewegung.
Auf dem langen Marsch waren mir die Männer unserer kleinen Gemeinschaft vertrauter geworden. Die Reiter unter uns kamen aus Familien mit Land und Namen, und doch standen auch die anderen ihnen in nichts nach. So jedenfalls sah es Robert. Schließlich waren wir jetzt alle gesetzlose Flüchtlinge und aufeinander angewiesen. Außerdem, was habe einen freien Normannen Rang oder Stellung zu kümmern, sagte er. Der Mann allein zähle. Eine Einstellung, die von allen geschätzt wurde.
Den rothaarigen Rainulf habe ich schon erwähnt. Fäuste wie Bärentatzen hatte der Mann und ein Fass von Brustkorb. Es brauchte einiges, um ihn aus der Ruhe zu bringen, und wenn er sprach, ließ er nur Kluges hören, so dass ihm selten einer widersprach. Rainulf war Robert treu ergeben und ließ nichts auf ihn kommen. Und die Truppe hatte er fest im Griff.
Der zweite Unterführer war Fulko. Der trug den besten Panzer von allen und war ein begnadeter Reiter, der jeden störrischen Gaul allein mit der Stimme zu zähmen wusste. Auch unter den Männern suchte er immer nach Ausgleich. Und doch hatte er schon oft seine Tapferkeit bewiesen, wie man hörte.
Als verlässlichen Kameraden hatte ich auch Herman kennengelernt, einen erfahrenen Speerkämpfer mit einem verbeulten Schild. Das Stück hatte schon so manche Schlacht überlebt. Er konnte sich nicht von dem alten Ding trennen und besserte ihn immer wieder aus. »Schild und Speer und die Gefährten, das sind die einzigen Dinge, die zwischen dir und dem Tod stehen, Junge. Merk dir das«, pflegte er zu sagen.
Ich gelobte, es nicht zu vergessen. Überhaupt sollten diese Männer zu meinen Lehrmeistern in den nächsten Jahren werden. Und bessere hätte ich mir kaum wünschen können, zumindest was das Kriegshandwerk betraf. In anderen Dingen waren sie außer Rainulf nicht immer die Klügsten.
Da war zum Beispiel Thore, der mit dem Bogen sogar ein Eichhörnchen vom Ast schießen konnte. Seine Pfeile fertigte er selbst an, mit allergrößter Sorgfalt. Er war ein fröhlicher, gutaussehender Geselle, dem nichts die Laune zu verderben schien. Er gab viel auf sein Äußeres, besonders auf sein Haar, das ihm in strohblonden Flechten den Rücken hinabhing. Und in den Bart geflochten, trug er winzige Silberringe. Wenn sich jemand über seine Eitelkeit lustig machte, grinste er nur und meinte, sie seien doch nur neidisch, weil einem wie ihm die Weiber nachliefen. Es stimmte sogar, wie ich herausfinden sollte. Wenn auch nicht immer die allerhübschesten.
Besonders beeindruckend war Rollo, ein Hüne von Kerl mit Schenkeln wie Baumstämme. Vielleicht hieß er so, weil er an den Rollo aus Tancreds Erzählungen erinnerte, den Urvater der Normandie. Seine Waffen waren ein Kriegshammer, der in seinem Gürtel steckte, und ein mächtiges Schwert, das er auf dem Rücken trug. Er war ein gutmütiger Mensch, bis man ihn reizte, wobei sein riesiger Körper durch schiere Kraft wettmachte, was ihm an Schlauheit fehlte. Er konnte Unmengen saufen. Sein größtes Laster aber war das Würfelspiel, bei dem er leider wenig Geschicklichkeit zeigte, so dass er meistens abgebrannt war.
Nicht zu vergessen mein neuer Freund Reynard Le-Vieux, der sich aus irgendeinem Grund in den Kopf gesetzt hatte, mich wie einen Sohn zu behandeln. Vielleicht weil er selbst vor vielen Jahren und unter tragischen Umständen seine Familie verloren hatte. Mehr als eine Andeutung darüber war aber nicht aus ihm herauszukriegen. Jedes Mal, wenn ich ihn danach fragte, bekam ich nur ein schmerzliches Lächeln zu sehen. Dann verlor sich für gewöhnlich sein Blick in der Ferne.
Mit der Zeit fiel uns der Marsch leichter. Die Blasen an den Füßen wichen frischer Hornhaut, die Waden wurden kräftiger, der Atem reichte bald schon wieder zum Grölen zotiger Lieder.
Abends, nachdem wir das Lager aufgeschlagen hatten, zerrieben wir Korn zu Mehl und buken Fladenbrot auf eisernen Blechen. Gerlaine rührte mit Gemüse, Speck und Kräutern eine dicke Suppe an, die wir heißhungrig hinunterschlangen. Einer blies auf dem Dudelsack. Gesättigt lauschten wir seinen Weisen, sangen oder erzählten uns Geschichten, bis die Feuer niedergebrannt waren. Dann krochen wir unter die Zeltplanen und schliefen bis zum Morgengrauen.
Gerlaine ließ sich von den Männern nicht einschüchtern. Auf dumme Sprüche wusste sie schlagfertige Antworten und hatte die Lacher meist auf ihrer Seite. Ansonsten verhielt sie sich still und vermied, ihre Weiblichkeit zur Schau zu stellen. Dennoch war sie unmerklich der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, auch wenn die Männer so taten, als würden sie über sie hinwegsehen. Kein Wunder, denn mit ihren dunklen, fast schwarzen Haaren, graugrünen Augen und dem kecken Näschen war sie eine Augenweide. Selbst die rauhe Männerkleidung konnte nicht ganz verbergen, was darunter steckte.
Dass sie ihr Nachtlager ausgerechnet mit einem Pferdeknecht teilte, das gefiel nicht jedem. Besonders dieser Osbert ließ seinen beißenden Spott an mir aus, wenn Robert nicht in der Nähe war.
»He, porchon. Wie ist sie so, dein kleines Luder?«, zischte er mir gelegentlich zur Belustigung seiner Kumpane zu. »Willst du sie nicht mit uns teilen? Die hat dich bestimmt schon satt und braucht was Handfesteres.« Dabei stießen sie sich grinsend mit den Ellbogen an und machten zotige Gesten.
»Nehmt euch vor diesem Kerl in Acht«, raunte mir der alte Reynard zu. »Ich kenne ihn nur zu gut.«
Gerlaine stellte sich taub, packte nur ihren Knüppel fester und marschierte mit finsterer Miene daher. Als er ihr jedoch wieder einmal aufreizend den Weg versperrte und sie mit anzüglichen Bemerkungen reizte, blieb sie stehen und starrte ihm kalt ins Gesicht.
»Das Lachen wird dir bald vergehen, Osbert. Ein früher Tod ist dir gewiss.«
Osbert lachte, aber es klang gezwungen. Offenbar hatten ihre Worte ihn doch getroffen. Jedenfalls hielt er sich für eine Weile zurück.
Eigentlich hätte ich statt Gerlaine dem Kerl das Maul stopfen sollen, und ich schämte mich, dass mir der Mut dazu gefehlt hatte. Dabei hatten die anderen gar keinen Grund, mich zu beneiden, denn trotz eifrigen Bemühens gelang es mir nicht, die keusche Festung zu nehmen. Nachts, wenn wir unbeobachtet waren, küssten und liebkosten wir uns wie früher, aber mehr ließ sie nicht zu. Ich hätte sie eben heiraten sollen, neckte sie mich. Doch dafür sei es nun zu spät. Dabei schlief sie unbekümmert an meiner Seite, ja sie verlangte sogar, dass ich Wache hielt, wenn sie ihre Notdurft verrichtete oder sich an einem Bächlein wusch. Ihr Vertrauen ehrte mich, doch Nacht für Nacht ihr warmer Leib neben mir, den ich selbst durch die dickste Kleidung nur allzu betörend wahrnahm, das trieb mich oft zu stummer Verzweiflung. Als Verführer war ich wohl nicht der Geschickteste.
Je weiter wir nach Süden kamen, desto mehr lichteten sich die dunklen Wälder, die Landschaft wurde von Feldern und Wiesen bedeckt, die sich auf sanften Hügeln endlos aneinanderreihten. Wir wanderten nun auf Pilgerstraßen, die nach Rom führten, wie man uns versicherte. Die meisten Leute hielten sich jedoch fern von uns, Bauern trieben ihr Viehzeug in Sicherheit, und Mütter rissen ihre Kinder an die Brust, wenn wir vorbeimarschierten. Eine Bande abgerissener Krieger war kein Anblick, der Vertrauen erweckte.
Und schließlich geschah das Unvermeidliche.
Es war an einem Nachmittag. Wir lagerten in einem kleinen Seitental der Rhone, an einem Bach, der von den Höhen floss. Robert war mit ein paar Männern in ein nahe gelegenes Dorf geritten, um unsere Vorräte aufzufrischen. Ich war mit Feuermachen beschäftigt und hatte nicht bemerkt, dass Gerlaine weiter das Tal hinauf zum Kräutersammeln gegangen war.
Plötzlich hörte ich sie irgendwo bachaufwärts schreien.
So schnell ich konnte, rannte ich den Hang hinauf. Weit konnte sie nicht sein, denn ich hatte sie deutlich genug gehört.
Und dann sah ich sie, halb im Gesträuch versteckt. Osbert hatte sie zu Boden geworfen und zerrte an ihren Kleidern. Sie selbst lag seltsam unbeweglich da, ein Bein ganz nackt. Der Anblick weckte mit einem Schlag tief vergrabene, schreckliche Erinnerungen in mir.
Später erfuhr ich, dass sie ihn sich eine Weile mit dem Knüppel vom Leib gehalten hatte. Sogar einen deftigen Hieb auf den Kopf hatte sie ihm verpasst. Aber darüber war er nur noch wütender und begieriger geworden, sie zu besteigen. Den Stock hatte er ihr entrissen und sie mit einem gezielten Fausthieb vorübergehend der Sinne beraubt. Für mich aber sah es aus, als läge sie tot im Gras. Wie meine Mutter vor so vielen Jahren. Der Anblick raubte mir jede Beherrschung, und eine Flut puren Wahnsinns überkam mich.
Osbert, in seiner Gier, hatte mein Nahen nicht bemerkt. Er war zu beschäftigt, seinem Opfer die Beinkleider herunterzureißen. Ohne zu wissen, was ich tat, hatte ich plötzlich mein Messer in der Hand. Ich bekam ihn an den Haaren zu fassen, riss seinen Kopf zurück. Doch bevor ich ihm die Kehle aufschlitzen konnte, hörte ich Gerlaine stöhnen, die sich wieder zu beleben schien.
Mein kurzes Zögern genügte Osbert, sich aus meinem Griff zu winden und aufzuspringen. Den Lederpanzer hatte er im Lager gelassen. Die Tunika war am Kragen eingerissen, Blut rann ihm von der Stirn, wo Gerlaine ihn mit dem Knüppel erwischt hatte, und mit seinem roten, noch halbsteifen Glied, das ihm aus der Hose hing, sah er ziemlich lächerlich aus. Doch der Eindruck änderte sich rasch, als er sein Schwert zog und sich mir drohend näherte.
»Kommst mir gerade recht, Bürschchen«, grinste er. »Bist du erst erledigt, schmeckt mir die Hure umso süßer.«
Blitzschnell holte er aus. Ich konnte gerade rechtzeitig außer Reichweite springen. Aus den Augenwinkeln bemerkte ich, wie Gerlaine, immer noch halbnackt, ihren Stock gepackt hatte, um mir beizustehen.
»Halt dich raus, Gerlaine«, rief ich ihr zu. »Lauf weg!«
Aber sie wollte nicht weichen. Ihre Augen waren weit aufgerissen, die Zähne entblößt wie bei einem Raubtier.
»Wir bringen das Schwein um oder sterben zusammen, das ist mir gleich«, schrie sie und hob den Knüppel höher.
Osbert trat nun seinerseits ein paar vorsichtige Schritte zurück. »Na komm, mein Täubchen«, lachte er. »Versuch es nur.«
Die Sache schien ihm Spaß zu machen. Er war sich seiner Überlegenheit gewiss. Mit Recht, denn Gerlaine war nur ein Mädchen. Und ich wohl groß genug für mein Alter, aber Osbert war stark wie ein Ochse und überraschend schnell auf den Beinen, ein erfahrener Kämpfer mit einem langen Schwert in der Faust. Was konnte ich mit meinem armseligen Messer gegen ihn ausrichten?
»Lauf, Gerlaine!«, rief ich noch einmal. »Hol Hilfe.«
»Hol Hilfe, Gerlaine«, ahmte Osbert mich johlend vor Vergnügen nach und stopfte sich seinen Schwanz wieder in die Hose. Deshalb achtete ich einen Augenblick lang nicht auf ihn, sondern sah besorgt zu Gerlaine hinüber. Das wusste Osbert zu nutzen. So plötzlich stürmte er auf mich zu, dass ich keine Gelegenheit hatte, mich wegzudrehen.
Nur der trügerische Boden rettete mich, denn Osbert strauchelte, sein Schwert verfehlte mich, und ehe ich michs versah, steckte mein Messer tief in seinem Leib. Er erstarrte und glotzte mich an wie blöd. So standen wir einen Wimpernschlag lang Auge in Auge, so dicht, dass ich seinen Atem riechen konnte, bis mir einfiel, was sie mir beigebracht hatten. Ich stieß das Messer noch einmal unter sein Brustbein, um sein Herz zu durchbohren, und drehte die Klinge halb um, damit sie sich nicht festsaugen konnte.
Das Schwert entglitt ihm, er gab ein Ächzen von sich, und das Kinn sackte herunter. Speichel tropfte ihm von der Unterlippe. Dann erzitterte er und fiel rücklings mit ausgebreiteten Armen ins Gras. Dort blieb er still und mit offenen Augen liegen.
Ich hielt das blutige Messer in der Hand und war wie vom Donner gerührt. Bei den Göttern, ich hatte einen Mann getötet.
Gerlaine dagegen blieb erstaunlich ruhig. Sie wischte die Tränen von den Wangen, beugte sich über Osbert und spuckte ihm ins Gesicht. Damit nicht genug, trat sie ihm ein paarmal mit Wucht in die Seite. Als er sich nicht regte, machte sie ein befriedigtes Gesicht und richtete ihre Kleidung.
»Saubere Arbeit, mein Junge«, hörte ich jemanden hinter mir sagen. Wie benommen drehte ich mich um.
Da stand Le-Vieux Reynard, der alles gesehen hatte, begleitet von einem halben Dutzend Männer, die unser Geschrei herbeigelockt hatte. Auch Robert näherte sich. Er warf mir einen wütenden Blick zu.
»Das war ein verdammt guter Mann in der Schlachtreihe«, sagte er mit vor Ärger zusammengepressten Lippen. »Musstest du ihn umbringen?«
»Der Kerl hat nichts Besseres verdient«, erwiderte Reynard. »Außerdem … der Junge hatte nur ein Messer.«
»Trotzdem ärgerlich«, knurrte Robert.
»Ich will seine Waffen«, hörte ich mich zu meinem eigenen Erstaunen sagen, weit mutiger, als ich mich fühlte. Aber irgendwie war mir jetzt alles gleich.
Robert starrte mich ungläubig an.
»Du willst was?«
»Ich habe ihn im Zweikampf getötet. Also gebühren mir seine Waffen.«
Ein geringschätziges Lachen war die Antwort. »Du weißt doch gar nicht, wie man damit umgeht.«
»So ist es Brauch, Guiscard«, warf einer der Männer ein, und die anderen nickten. »Es war ein ehrlicher Kampf. Und Gilbert ist der Sieger.«
Jetzt trat der mächtige Rainulf vor, das halbe Gesicht von rotem Bart bedeckt, der Rest von Sommersprossen. Er musterte mich aufmerksam.
»Gib dem Jungen wenigstens das Schwert«, grollte sein Bass. »Nachher sehen wir, zu was er taugt.«
Robert zuckte mit den Schultern. »Also gut. Du bist zwar nur ein Hänfling, aber ab jetzt darfst du Osberts Schwert tragen. Sieh zu, dass du es nicht verlierst.« Er drehte sich zu den anderen um. »Und dass mir keiner mehr das Mädchen anrührt.« Damit ließ er uns stehen.
Reynard und ein paar andere halfen, dem Leichnam alles an Wert abzunehmen. Dabei reichte er mir Osberts Schwert und Gürtel sowie seine Stiefel. Dann begruben wir ihn im weichen Grund neben dem Bach. Mit Kreuz oder Gebeten nahmen wir es nicht so genau. Osbert hätte ohnehin keinen Pfifferling darauf gegeben. Und ich schon gar nicht.
»Der hat Glück gehabt, dass er mit dem Schwert in der Hand gestorben ist«, sagte Reynard, der den alten Göttern nachhing. »Nun darf er sich an den Feuern von Walhall wärmen.«
Er befingerte das Amulett, das er am Hals trug. Eine kleine Schnitzerei aus einem Walrosszahn, die Thors Hammer darstellte. Gerlaine blickte finster auf den frisch aufgeworfenen Erdhügel. Dann machte sie das Zeichen gegen den bösen Blick und wandte sich ab.
Osberts Schwert war eine außergewöhnlich gute Arbeit aus bestem Stahl. Dass ein solcher Kerl eine so schöne Waffe besessen hatte, wunderte mich. Er musste sie in der Schlacht an der Orne einem toten Ritter abgenommen haben. Als wir zurück im Lager waren, merkte ich, dass mir alle mit neuem Respekt begegneten. Und mit dem Besitz dieses wertvollen Schwertes fühlte ich mich selbst zum Mann und Krieger geworden. Na ja, so halbwegs jedenfalls.
Am Abend folgte Robert mir bis zum Bach, wo ich Wasser holen wollte. Das Mondlicht fiel über sein kantiges Gesicht, und ich sah, dass er mir zulächelte.
»Bin froh, dass es dich nicht erwischt hat, Gilbert«, meinte er. »Du hättest mir gefehlt.« Bevor ich mich von meiner Überraschung erholen konnte, raufte er mir grob durch die Haare, schlug mir kurz auf die Schulter und war wieder im Dunkeln verschwunden.
So sehr mich diese Worte freuten, die wüsten Bilder des Erlebten konnten sie in dieser Nacht nicht vertreiben. Bei der Erinnerung an Osberts Blut durchfuhren mich Schauer. Wie leicht es gewesen war, einen Mann zu töten. Und was für ein verdammtes Glück ich selbst dabei gehabt hatte.
Auch Gerlaine zitterte am ganzen Leib, als sie alles im Geist noch einmal durchlebte. Weinend klammerte sie sich an mich. Dennoch spürte ich eine tiefe Befriedigung, fast eine Befreiung, als hätte ich nach all den Jahren endlich Rache genommen für das, was sie meiner Mutter angetan hatten.
Gerlaines Kopf ruhte auf meiner Brust, und der warme Duft, der ihren Haaren entströmte, hatte etwas Anheimelndes. Ich wiegte sie in meinen Armen, bis sie eingeschlafen war.
Wir marschierten weiter in Richtung Süden, vermieden aber die größeren Ortschaften. Gewaltige Berge türmten sich nun zu beiden Seiten des Weges auf, mit dichtbewaldeten Hängen und schroffen Felsgipfeln, die am Abend noch lange in der untergehenden Sonne leuchteten. Ich konnte mich kaum sattsehen, denn Berge wie diese waren ein völlig ungewohnter Anblick. Auch rochen die Wiesen nicht wie daheim nach nassem Gras und modriger Erde, sondern verströmten einen Duft von Wildblumen und Kräutern.
Robert besprach sich oft mit Reynard, der den Weg kannte und kein einziges Mal zögerte, wenn wir an eine Kreuzung kamen. Ohne ihn hätten wir uns in diesen wilden Tälern verloren.
Obwohl er das Plündern verboten hatte, war Robert nicht gewillt, unnütze Zeit auf der Jagd zu vergeuden, nicht in diesen unbekannten Bergwäldern. Es kam ebenfalls nicht in Frage, sein letztes Silber für Nahrung auszugeben. Widerstrebend ließ er es also zu, dass wir unser Essen stahlen. Das war meist recht einfach, denn wenn fünf oder sechs von uns schwerbewaffnet auf einem einsamen Hof auftauchten, rückten die Bauersleute bereitwillig, wenn auch vor Angst zitternd, Korn, Bohnen, Hühner und Zicklein heraus. Was sich einige von uns sonst noch nahmen, will ich lieber gar nicht erwähnen.
Einmal wäre es mir dabei fast an den Kragen gegangen.
Sie hatten Reynard und mich zu einer Hütte geschickt, die in einiger Entfernung in einem Seitental dicht am Waldrand lag. Die war so klein und unscheinbar, dass wir sie nicht weiter beachtet hätten, wäre nicht eine kleine Herde Schafe in der Nähe gewesen. Kein Mensch zu sehen, nicht einmal ein Hund. Eine gute Gelegenheit also. Während die Truppe eine Rast einlegte, wollten wir uns ein paar Hammel holen.
Einer der Krieger, vielleicht war ihm langweilig, schloss sich uns an, Ivain hieß er. Kein besonders großer Kerl, fast schmächtig, aber sehnig und zäh, mit mausgrauem Haar, das ihm tief in die Stirn fiel und sein halbes Gesicht bedeckte. Wahrscheinlich, um die hässliche Brandnarbe zu verbergen, die seine linke Gesichtshälfte verunzierte. Angeblich war er als Jugendlicher beinahe im Feuer umgekommen, als man sein Dorf überfallen und angezündet hatte. Ein Schicksal nicht unähnlich dem meinen. Deshalb mochte ich ihn wohl, obwohl er mich wenig beachtete und nicht viel sprach.
Die Hütte schien verlassen, als wir uns näherten. Also packten wir uns ein paar Schafe und schlachteten sie auf der Stelle. Während wir mit dem Ausweiden beschäftigt waren, stürmte plötzlich wild schreiend ein halbes Dutzend Kerle aus dem Wald und auf uns zu, allen voran ein gefährlich aussehender Ritter zu Pferde, besonders mit dem langen Schwert, das er schwang.
Ich vergaß vor Schreck, meine Waffe zu ziehen. Auch für Reynard, der Schild und Speer zurückgelassen hatte, war der Angriff so überraschend gekommen, dass er nicht viel mehr als eine Warnung brüllen konnte, schon war der Ritter heran. Da ich dem Kerl genau im Weg stand, hätte es mich zweifellos als Ersten erwischt, wäre es mir nicht eben noch gelungen, zur Seite zu springen. Immerhin spürte ich den Luftzug der Klinge, die mich nur einen Fingerbreit verfehlte.
Auch Reynard konnte ausweichen. Und nun hatten wir endlich unsere Schwerter in den Fäusten. Während der Reiter sein Ross wendete, kamen die Bauern mit Stöcken und Heugabeln auf uns zugerannt, um uns in die Mitte zu nehmen. Zwischen ihnen und dem Ritter sah ich mein letztes Stündlein gekommen.
Wer jedoch die Ruhe bewahrte, war Ivain. Der hatte nicht einmal sein Schwert gezogen, hielt nur eine unscheinbare Wurfaxt in der Hand. Als der Reiter erneut heranstürmte, holte Ivain kurz aus und schleuderte die Axt. Mit einem trockenen Knacken, als bräche ein Ast, fuhr sie dem Mann in die Stirn. Der breitete die Arme aus und fiel rücklings auf die Kruppe seines Gauls. Das Pferd scheute, wendete und rannte davon, wobei der Leichnam ins Gras rutschte und liegen blieb.
Hastig drehte ich mich um, um dem Angriff der Bauern oder Schäfer, was immer sie waren, zu begegnen. Aber die waren abrupt stehen geblieben und starrten mit Schrecken auf den Leib ihres toten Herrn. Es schien ihnen die Lust am Kämpfen genommen zu haben, denn nach einigen wütenden Blicken und gereckten Fäusten machten sie sich aus dem Staub.
Auch wir beeilten uns, die noch blutigen Schafsleiber über die Schulter zu werfen, und kehrten, nachdem Ivain seine Axt geholt hatte, zu den anderen zurück.
Mir hämmerte noch lange das Herz in der Brust. Und das nicht vor Anstrengung. Es war nun schon der zweite Totschlag auf dieser Reise, in den ich verwickelt war. Ich schielte zu Ivain hinüber, der gleichmütig neben uns herstapfte, und bemerkte, dass er noch eine zweite Wurfaxt im Gürtel trug.
»Was für eine Waffe ist das?«, fragte ich ihn.
»Francisca.