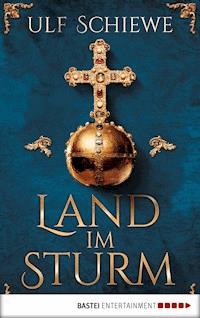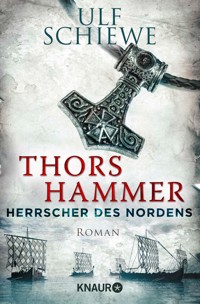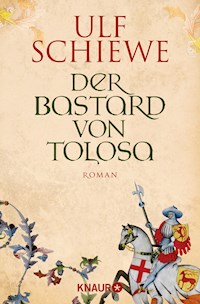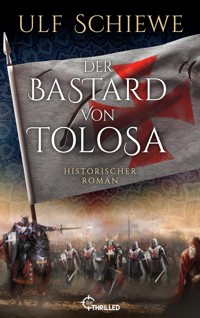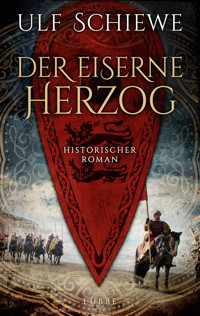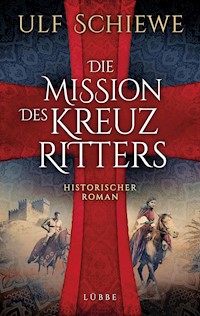9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Juni 1914. Es ist die Woche, die alles entscheidet. Die Woche, in der sich drei junge Serben auf den Weg nach Sarajevo machen. Dort soll Franz Ferdinand, Thronfolger Österreich-Ungarns, einem Militärmanöver beiwohnen - und sterben. Gavrilo Princip und seine Gefährten haben sich seit Monaten auf diesen Tag vorbereitet. Doch dem Geheimdienst sind Gerüchte zu Ohren gekommen, und Major Rudolf Markovic tut alles, um den Thronfolger zu retten und eine diplomatische Katastrophe zu vermeiden ...
Ulf Schiewe lässt uns diese entscheidende Woche der europäischen Geschichte hautnah miterleben - packend und extrem spannend.Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 583
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Juni 1914. Es ist die Woche, die alles entscheidet. Die Woche, in dersich drei junge Serben auf den Weg nach Sarajevo machen. Dort soll Franz Ferdinand, Thronfolger Österreich-Ungarns, einem Militärmanöver beiwohnen – und sterben. Gavrilo Princip und seine Gefährten haben sich seit Monaten auf diesen Tag vorbereitet. Doch dem Geheimdienst sind Gerüchte zu Ohren gekommen, und Major Rudolf Markovic tut alles, um den Thronfolger zu retten und eine diplomatische Katastrophe zu vermeiden … Ulf Schiewe lässt uns diese entscheidende Woche der europäischen Geschichte hautnah miterleben – packend und extrem spannend.
Über den Autor
Ulf Schiewe wurde 1947 im Weserbergland geboren und wuchs in Münster auf. Er arbeitete lange als Software-Entwickler und Marketingmanager in führenden Positionen bei internationalen Unternehmen und lebte über zwanzig Jahre im Ausland, unter anderem in der französischen Schweiz, in Paris, Brasilien, Belgien und Schweden. Schon als Kind war Ulf Schiewe ein begeisterter Leser, zum Schreiben fand er mit Ende 50.
Historischer Thriller
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Dr. Stefanie Heinen
Karte: Dr. Helmut Pesch, Köln
Titelillustration: © Johannes Wiebel | punchdesign; © akg-images/Erich Lessing
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-7796-5
www.luebbe.de
www.lesejury.de
PROLOG
Um ihn herum die Menge der Schaulustigen. Alles blickt erwartungsvoll in die gleiche Richtung. Er drängt sich vor, nähert sich dem Rinnstein, dort, wo man der heranfahrenden Fahrzeugkolonne am nächsten ist. In der Hosentasche die Pistole. Er spürt sie am Oberschenkel. Sie beult die Tasche ein wenig aus. Ob es auffällt? Jemand könnte erraten, was er bei sich trägt.
Vorsichtshalber schiebt er die Hand in die Tasche, legt sie über das kühle Metall. Die Waffe ist nicht schwer, wiegt an die sechshundert Gramm. Sie ist handlich, die Kanten sind rund, kein Hammer, der sich in der Kleidung verhaken könnte. Ein Leichtes, sie schnell zu ziehen, gleich, in wenigen Augenblicken, wenn der Motorwagen, auf den er wartet, um die Ecke kommt.
Noch vor Wochen hatte er von Waffen keine Ahnung, hat nie eine in der Hand gehalten. Aber inzwischen weiß er alles über diese Pistole. Ein gewisser Mister Browning aus Amerika hat sie entworfen, und eine belgische Firma hat sie angefertigt. Nun steckt sie in seiner Tasche, eine Browning der Fabrique Nationale, bereit, benutzt zu werden.
Man hat ihm alles beigebracht. Wie man sie entsichert, wie nah man an sein Ziel herantritt. Es ist gar nicht so leicht, mit einer Pistole zu treffen. Er hat gelernt, sie mit ausgestreckten Armen und beiden Händen zu halten, zu zielen und zu feuern. Es ist eine halbautomatische Pistole, die mit dem Rückstoß die nächste Patrone in die Kammer schiebt. Mindestens ein Dutzend Mal hat er sie auseinandergenommen, den Lauf gereinigt, die Teile mit einem öligen Tuch abgewischt, sie wieder zusammengesetzt, den Abzug geprüft, das Magazin mit Patronen gefüllt. Sechs Schuss. Sechs Kugeln. Eine davon genügt, um seinen Auftrag zu erfüllen. Vorausgesetzt, er trifft beim ersten Schuss. Oder dem zweiten. Für einen dritten wird er sicher kaum Gelegenheit haben.
Jede Nacht hat er in den letzten Tagen davon geträumt. Er hat sich an die Waffe gewöhnt. Sie liegt gut in der Hand. Als gehöre sie da hinein. Mit dem Daumen lässt sie sich leicht entsichern. Der Widerstand des Abzugs ist ihm vertraut, bis zum Punkt, an dem sich der Schlagbolzen löst, auf die Zündkapsel der Patrone trifft, und die Explosion die Kugel durch den Lauf jagt. Er hat sich vorbereitet, körperlich und geistig. Die Browning ist zum Zentrum seiner Existenz geworden. Alles konzentriert sich auf sie, jetzt, wo es darum geht, den Schuss abzufeuern, der die Welt verändern wird. Seine Aufmerksamkeit, sein beschleunigter Puls, sein Atem, sein ganzes Wesen dienen nur diesem Zweck.
Er hört Motorengeräusche. Der Wagen, auf den er wartet, biegt um die Ecke, kommt ihm entgegen. Da ist die Uniform, der Federbusch auf dem Kopf seiner Zielperson, die breite mit Orden behängte Brust, das leutselige Lächeln, die Hand, die der Menge zuwinkt.
Wie von selbst kommt die Waffe aus der Hosentasche. Er entsichert noch in der gleichen Bewegung, tritt zwei Schritte vor, hebt beide Arme, die rechte Hand hält die Pistole, die linke stabilisiert den rechten Arm. Das Ziel ist ganz nah. Jetzt!
Er zieht den Abzug durch.
Mit scharfem Knall löst sich der Schuss. Fast explosionsartig atmet er aus. So konzentriert war er, dass er zu atmen vergessen hat. Schweiß steht ihm auf der Stirn. Er versucht, sich zu entspannen.
»Und?«, fragt er, ohne sich umzudrehen.
»Nicht schlecht«, hört er Pavle hinter sich sagen. Gavrilos Herz schlägt ihm bis zum Hals. Nicht schlecht also. Aber gut genug?
Wer dieser Pavle ist, weiß er nicht, nur dass der Mann Mitglied der Schwarzen Hand ist, des serbischen Geheimbunds. Er redet nicht viel, trägt meist eine grimmige Miene zur Schau, lächelt fast nie. Aber ein Komitatschi und Freischärler soll er gewesen sein. Er ist hier, um ihnen das Schießen beizubringen. In einem Wald, ganz in der Nähe der Stadt. Wahrscheinlich heißt der Mann gar nicht Pavle. Und mehr als ihre Vornamen kennt er auch nicht. Besser so.
Gavrilo ist noch ganz in seiner Fantasie gefangen. Er atmet tief durch. Der Pappkamerad, den zwei serbische Soldaten an einer Leine entlanggezogen haben, um einen fahrenden Wagen nachzuahmen, kommt zum Stehen.
Major Vojislav Tankosić, der gekommen ist, um ihre Fortschritte zu überprüfen, tritt näher und sieht sich das Einschussloch an. »Nicht genau im Zentrum, aber immerhin. Für ein bewegliches Ziel ganz gut. Noch ein paarmal üben, dann hast du es raus.«
Gavrilo Princip, neunzehn Jahre alt, wechselt die rauchende Pistole von der einen in die andere Hand und betrachtet seine Rechte. Vom vielen Schießen hat er Schmauchspuren an den Fingern. Den Tankosić, inzwischen Major der serbischen Armee, kennt er von früher, als Tankosić bei den Tschetniks war und eine Freischärlergruppe gegen die Türken angeführt hat. Gavrilo wollte bei ihm anheuern. Aber Tankosić wies ihn ab. Er sei zu jung und zu schmächtig, um bei den Tschetniks zu kämpfen, hat es damals geheißen.
Nun ja, mit einem Meter sechzig ist er klein geraten. Und schwächlich war er auch schon immer. Für das, was sie jetzt vorhaben, bin ich dem Major wohl nicht zu jung, denkt Gavrilo. Und auch nicht zu schmächtig. Schließlich genügt es, eine oder zwei Kugeln ins Ziel zu bringen. Dafür zählt nicht, wie groß und stark man ist, es zählen nur Mut und Entschlossenheit.
»Wann geht es endlich los, Herr Major?«, fragt er.
»Nicht so laut«, raunt Tankosić und dreht den beiden Soldaten, die in einiger Entfernung stehen, vorsichtshalber den Rücken zu. »Ihr könnt es wohl nicht abwarten, was?«
Gavrilo sieht zu den beiden anderen jungen Männern, die mit ihm die Schießübungen absolvieren. Seine Freunde Trifko und Nedeljko, beide ebenfalls neunzehn Jahre alt. Und auch Danilo Ilić, den sie aus Sarajevo kennen, ist gekommen, um zu sehen, wie sie mit den Waffen zurechtkommen. Danilo gehört ebenfalls zur Schwarzen Hand, hat angeblich sogar eine Vertrauensstellung in der Organisation, obwohl er selbst erst dreiundzwanzig ist. Er hat die ganze Sache eingefädelt. Alle vier sind fest entschlossen, den Plan durchzuführen, um endlich etwas Großartiges für ihr Vaterland zu leisten. Für die serbische Sache.
»Ich glaube, wir sind so weit, Herr Major«, sagt Gavrilo leise.
Tankosić nickt. »Bald, mein Junge. Der Thronerbe wird in Sarajevo für den 28. Juni erwartet. Einige Tage vorher wird Pavle euch über die Grenze schmuggeln. Bis dahin müsst ihr euch gedulden.«
Der Mann, der sich Pavle nennt, nickt. Dann ruft er den beiden Soldaten zu, eine neue Zielscheibe anzubringen und wieder an den Ausgangspunkt zu ziehen. Er zeigt Gavrilo ein weiteres Mal, wie die Waffe zu halten ist. Und wie man trotz Rückstoß auch den zweiten Schuss ins Ziel bringt. »Jetzt noch mal«, sagt er. »Zwei Schüsse dicht hintereinander. Und diesmal mitten ins Herz, wenn ich bitten darf.«
MONTAG, 22. JUNI 1914
Neue Freie Presse
Wien, Samstag, den 20. Juni 1914
Durazzo ist gerettet. Die Befehlshaber der österreichisch-ungarischen und der italienischen Kriegsschiffe sind ermächtigt, die Kanonen in Tätigkeit zu setzen, wenn die Aufständischen in die Stadt dringen sollten und für den Hof, für die Gesandtschaften oder für die fremden Kolonien eine unmittelbare Gefahr bestünde. Das ist zureichend, um den rebellischen Bauern einen unzerbrechlichen Riegel vorzuschieben und den Weg nach Durazzo zu versperren. Der Befehl an die Kommandanten war die Antwort auf den Notschrei des Fürsten, der von den Mächten wiederholt militärische Hilfe verlangt hat und durch so viele bange Tage ohne jede Unterstützung und ohne jedes Zeichen wirksamer Sympathie geblieben ist. Der Auftrag, die Stadt gegen die Barbaren zu schützen, hätte sehr leicht zu spät eintreffen können.
Belgrad, 7:32 Uhr, im Park der Festung
Sie treffen sich an der Türbe, dem Grabmal des Damad Ali Pascha, eines Großwesirs des Osmanischen Reichs, gefallen 1716 im Kampf gegen das österreichische Heer unter der Führung von Prinz Eugen und hier beigesetzt. Das Monument liegt im Parkbereich der Festung von Belgrad, hoch über dem Zusammenfluss der Save und der Donau. Ein geschichtsträchtiger Ort für dieses Treffen.
Der Himmel ist bedeckt, und ein leichter Dunst steigt vom Ufer empor. Die beiden Männer sind in Zivil, sehen nicht anders aus als die üblichen Flanierer im Park, obwohl außer ihnen kaum jemand zugegen ist. Dazu ist es zu früh am Morgen. Nur ein alter Mann humpelt an ihnen vorbei. Er geht am Stock, zieht ein Bein nach. Vielleicht ein kriegsversehrter Veteran.
Oberst Dragutin Dimitrijević lässt sich auf einer nahen Bank nieder. Er ist siebenunddreißig Jahre alt und Chef des serbischen Militärgeheimdienstes. Sein Gesprächspartner sieht sich um, um sich zu vergewissern, dass niemand sie beobachtet. Es ist Vojislav Tankosić, zweiunddreißig Jahre alt, Major der serbischen Armee und ehemaliger Tschetnik im Kampf gegen die Osmanen.
Tankosić ist nervös. Er weiß, dass die Österreicher Spitzel in Belgrad unterhalten. Auch die eigene serbische Regierung soll nichts von dem wissen, was sie hier zu besprechen haben. Sein misstrauischer Blick liegt auf dem Rücken des humpelnden Alten, der sich langsam entfernt.
»Nun setz dich schon, und steh nicht so rum«, brummt Dimitrijević. »Hier kann uns niemand belauschen. Also beruhige dich.«
Beide Männer tragen Schnauzbärte im Gesicht, mit gewachsten, hochgezwirbelten Enden, wie es Mode ist. Aber damit endet jede Ähnlichkeit. Dimitrijević ist ein Bär von einem Kerl. Nicht besonders groß, aber mit ausladenden Schultern, einem Brustkasten wie ein Fass, kräftigen Oberarmen und einem breiten Schädel, auf dem nur noch spärlich Haare wachsen. Seit Studententagen hängt ihm der Spitzname Apis an – der geheiligte Stier von Memphis in der altägyptischen Mythologie.
Vojislav Tankosić dagegen ist hochgewachsen und äußerst schlank. Seine Wangen sind so hohl, dass man denken könnte, er hätte seit Wochen nichts Vernünftiges zu essen bekommen. Davon abgesehen ist er ein gut aussehender Mann mit dichtem schwarzen Haar, einer, dem auf der Straße die Frauen nachschauen.
Beide sind Mitglieder des berüchtigten nationalistisch-serbischen Geheimbundes, der Schwarzen Hand. Tankosić gehört zur Führungsebene. Dimitrijević ist mehr als das, er ist Mitbegründer und Anführer der Vereinigung. Mit ihm ist nicht zu spaßen, wie Tankosić weiß. Der Mann ist kaltblütig berechnend und ohne Skrupel. Vor elf Jahren waren sie beide an der Ermordung des serbischen Königs Aleksandar Obrenović beteiligt, der wegen seiner österreich-freundlichen Haltung unbeliebt gewesen war. Die Verschwörer waren nachts in den Palast eingedrungen, hatten den König und seine Frau mit unzähligen Kugeln erschossen, die Leichen mit Säbeln fast zerstückelt und anschließend aus dem Fenster geworfen. Nein, mit Dimitrijević ist nicht zu spaßen.
»In Albanien geht’s ziemlich rund«, sagt Tankosić. »Hast du gelesen, was über Durazzo in den Zeitungen steht?«
»Wozu brauche ich Zeitungen? Ich bin Leiter des Geheimdienstes. Ich bin schneller und besser informiert als jeder Schreiberling.«
»Natürlich. Will nur sagen, dass die Österreicher und Italiener jetzt Kriegsschiffe in Stellung gebracht haben. Die schießen die moslemischen Rebellen zusammen.«
Dimitrijević zuckt mit den Schultern. »Hab doch gleich gesagt, dass nichts wird mit diesem Bauernaufstand. Die Alliierten lassen ihren deutschen Fürsten nicht fallen. Aber selbst wenn sie diesen Aufstand niederschlagen, ist die Lage für uns Serben nicht besser geworden.« Er gähnt und reibt sich übers Gesicht, als wäre er noch nicht ganz wach. »Aber das soll uns nicht weiter kümmern. Wie geht es deinen Jungs?«
»Sie sind aufgeregt. Verständlich, unter den Umständen. Ist der Besuch des Thronfolgers immer noch sicher für den Achtundzwanzigsten?«
»Ja. Daran hat sich nichts geändert.« Dimitrijević starrt lange auf seine Fingernägel. »Hör zu«, sagt er schließlich. »Ich weiß, du hast die Burschen rekrutiert. Aber ich habe jetzt doch Zweifel bekommen. Ich denke, wir sollten die Sache abblasen.«
»Bist du verrückt? Es ist eine einmalige Gelegenheit. Die dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Ein solcher Schlag wird die k. und k. Monarchie erschüttern, vielleicht sogar stürzen.«
»Ich weiß. Aber deine Kerle sind blauäugige dumme Jungs. Schüler, verdammt noch mal!«
»Du kennst doch Danilo Ilić. Der ist mit ihnen befreundet und kennt sie gut. Er bürgt für sie. Außerdem wird er die drei in Sarajevo führen, damit nichts schiefgeht.«
Dimitrijević nickt. »Nichts gegen Ilić. Der ist verlässlich. Aber die drei Jüngelchen, die das erledigen sollen … Wie heißen die noch mal?«
»Gavrilo Princip, Nedeljko Čabrinović und Trifko Grabež. Alle drei bosnische Serben, wie du weißt. Die hassen die Österreicher.«
»Das mag sein. Aber sie sind unerfahren. Die werden alles vermasseln. Daran wird auch Ilić nichts ändern. Außerdem kennen sie dich. Wenn man sie schnappt, werden sie dich als Ersten verraten. Ist dir das nicht klar?«
»Ich gebe ihnen Zyanidkapseln mit. Sie sind bereit zu sterben.«
»Bist du sicher?«
Tankosić nickt. »Alle drei. Sie wissen, dass sie keine Chance haben davonzukommen. Und keiner von ihnen will lebend gefasst werden. Es ist ein Todeskommando. Sie wissen das.«
»Ich frage dich noch einmal: Bist du dir da sicher?«
»Ich schwör’s! Ich hab es hundertmal mit ihnen durchgesprochen, hab ihnen die Kapseln gezeigt und erklärt, was sie tun müssen. Ich weiß, sie sind jung, aber sie sind glühende Patrioten und begierig, ihr Leben für die Sache zu geben. Für das serbische Volk. In ihnen lebt der Geist von Märtyrern.«
Dimitrijević schüttelt den Kopf und seufzt. »Im Kaffeehaus ist glühender Patriotismus nicht schwer, Vojislav. Im Gefecht sieht es dann anders aus. Da scheißen die Herren Pennäler sich in die Hose. Du warst selbst im Krieg. Du weißt, wie es ist. Wer will schon sterben?«
»Mach dir keine Sorgen, Dragutin. Ich lege meine Hand für die drei ins Feuer. Besonders für Gavrilo Princip. Der ist ihr Anführer, die anderen beiden tun, was er sagt. Alle drei haben sich schon an verschiedenen Protesten beteiligt. Den Princip haben sie in Sarajevo deswegen von der Schule geworfen. Vor zwei Jahren hat er sich bei den Tschetniks gemeldet, wollte unbedingt gegen die Osmanen kämpfen. Ich sage dir, der ist wild darauf, etwas zu unternehmen. Und so entschlossen, dass es zum Fürchten ist.«
»Wie alt ist der Knabe?«
»Neunzehn. Genau wie die anderen beiden.«
»Neunzehn?« Dimitrijević verdreht ungläubig die Augen. »Ich fasse es nicht. Die sind doch noch gar nicht stubenrein.«
»Die Jüngsten sind oft die Tapfersten. Du weißt das.«
»Ja, weil sie keine Ahnung von der Welt haben.«
»Herrgott noch mal, Apis! Die müssen doch nur mit der Pistole abdrücken und vielleicht ’ne Bombe werfen. Was soll daran so schwer sein?«
Dimitrijević blickt auf den Boden und schweigt.
»Da ist noch was, das du wissen solltest«, fährt Tankosić fort. »Ilić meint, Gavrilo ist lungenkrank und weiß, dass er nicht lange zu leben hat.«
»Ach, und deshalb ist es ihm egal, dass er dabei draufgeht?«
»Er will nicht abtreten, bevor er etwas Großes für Serbien getan hat.«
»Mmh.« Dimitrijević kratzt sich nachdenklich das Kinn. »Und die anderen beiden?«
»Die sind ebenso entschlossen. Čabrinović wurde in der Kindheit regelmäßig von seinem Vater verprügelt. Der Alte ist Feuer und Flamme für Österreich. Čabrinović will es ihm heimzahlen.«
Dimitrijević zischt verächtlich durch die Zähne. »Dumme Bengel! Ich wurde auch verprügelt und bin deshalb kein Märtyrer geworden.« Er schweigt eine Weile und überlegt. »Wenn wir mehr Zeit hätten, ihnen einen richtig guten Waffendrill zu verpassen …«
»Wir haben häufig geübt. Gavrilo hat sich als besonders guter Schütze erwiesen. Er ist körperlich nicht der Kräftigste, aber mit der Pistole kann er umgehen. Und Čabrinović soll eine Bombe werfen.«
»Und der Dritte?«
»Pistole. Zur Sicherheit an anderer Stelle entlang der Straße.«
»Die Route ist bekannt?«
Tankosić nickt. »Route und Protokoll wurden in allen Einzelheiten veröffentlicht.«
»Die machen es uns leicht.« Dimitrijević schüttelt den Kopf über die Dummheit der österreichischen Behörden. »Üb auf jeden Fall noch ein paarmal mit ihnen, bevor du sie in den Tunnel schickst.«
Damit meint er die geheime Untergrundorganisation von Vertrauensleuten der Schwarzen Hand, mittels der das Bündnis Männer und Waffen nach Kroatien, Bosnien oder Montenegro schmuggelt. Und mit deren Hilfe sie in die umgekehrte Richtung Männer in Sicherheit bringt, die von der Polizei verfolgt werden.
Tankosić spürt plötzlich Dimitrijević’ kalte Augen auf sich ruhen. »Eines muss dir klar sein, mein lieber Vojislav: Du bist mein Freund, und ich kenne deine feste Gesinnung. Aber unter der Folter redet so mancher. Geht die Sache schief und die Jungs werden geschnappt, dann werden wir alles abstreiten und keinen am Leben lassen, der direkt damit zu tun hatte. Wir können nicht zulassen, dass der Bund in Gefahr gerät, solltest du deine Aufgabe vermasseln. Haben wir uns verstanden?«
Tankosić muss schlucken, bevor er antworten kann. »Es wird alles so verlaufen, wie wir uns das wünschen, Apis. Ich verspreche es.«
Sarajevo, 8:02 Uhr, in einer Pension nahe der Altstadt
Durch einen Spalt zwischen den schweren Brokatvorhängen dringt grelle Morgensonne und zwickt Major Rudolf Markovic in die Nase. Er öffnet erst eines, dann das andere Auge. Sein Kopf schmerzt vom Champagner der vergangenen Nacht, und die Zunge fühlt sich pelzig an. Das sind die ersten Wahrnehmungen.
Zu seiner Verwunderung liegt eine weibliche Hand auf seiner Brust. Und auf dem Oberschenkel ein nacktes Bein. Dabei gehören die Gliedmaßen nicht zur gleichen Person. Er kann sich überhaupt nicht erinnern, wem zum Teufel sie gehören. Vom Nachttisch her hört er seinen Wecker ticken. Ein Blick darauf lässt ihn erschrecken, als ihm dumpf klar wird, dass er verschlafen hat. Er muss vergessen haben, das Ding zu stellen.
»Verdammte Scheiße!« Er schiebt die fremde Hand von seiner Brust. »Huber!«, brüllt er. »Beweg deinen Arsch her! Aber dalli!«
Er lässt den Kopf aufs Kissen sinken und versucht, sich zu erinnern, wie viel er gestern getrunken hat. So wie sein Schädel brummt, kann es nicht nur der Champagner gewesen sein. Ich muss mal wieder mit dem Slibowitz übertrieben haben, denkt er zerknirscht. Damit machen sie uns am Ende fertig, diese Bosnier. Mit ihrem verfluchten Slibowitz.
Die nackte Frau, der die Hand gehört, stöhnt schlaftrunken und dreht ihm den hübschen Hintern zu. Die zweite lässt ihr Bein, wo es ist, und drängt sich noch enger an ihn. Ihr Gesicht mit den geschlossenen Augen kommt ihm bekannt vor. Etwas regt sich in ihm. Er ist versucht, die süße Bekanntschaft zu erneuern. Aber da ist der Wecker, der vorwurfsvoll tickt. Auf einmal dämmert es ihm: Die beiden sind Tänzerinnen des einzigen Kabaretts der Stadt, das diesen Namen verdient. Er hat sie nach der Vorstellung aufgegabelt und mit nach Hause genommen. Die Blonde ist aus Wien, wie sie behauptet, die andere aus der ungarischen Provinz. Jedenfalls ihrem Akzent nach zu schließen.
»Huber!«, brüllt er noch mal. »Wo zum Teufel steckst du?«
Die vollbusige Blonde setzt sich auf und blinzelt ihn an. »Was schreist du denn so, Schatzi?«
»Nix Schatzi! Zeit, dass wir alle aus den Federn kommen.«
Er setzt sich auf und reibt sich die stoppeligen Wangen. Die alte Wirtin der Pension, in der er logiert, drückt, was Damenbesuche angeht, beide Augen zu. Schließlich verdient sie sich durch stundenweises Vermieten ihrer Zimmer selbst gern etwas dazu. Meist an liebeshungrige Leutnants der österreichisch-ungarischen Armee. Also lässt sie ihm alle Freiheiten, solange er es nicht übertreibt oder sie wegen Kuppelei anzeigt.
Alois Huber, der sein Zimmer nebenan hat, steckt den Kopf durch die Tür. »Sie wünschen, Herr Major?«
»Warum, zum Teufel, hast du mich nicht früher geweckt? Ich muss in weniger als dreißig Minuten im Hauptquartier sein. Hast du wenigstens die andere Uniform ausgebürstet und die Stiefel gewienert?«
»Hab ich. Soll ich Sie rasieren, Herr Major?«
»Mach ich selber.« Markovic springt splitternackt aus dem Bett. Und bereut es gleich, als ihm bei der heftigen Bewegung der Schmerz durchs Hirn zuckt. Verdammte Sauferei! Aber dann reißt er sich zusammen. »Ihr beiden Hübschen macht euch jetzt aus dem Staub«, sagt er. »Danke für den schönen Abend. War mir eine Ehre.«
Die Mädchen studieren aufmerksam seine Nacktheit. Wie Katzen, die Fliegen fangen. Aber das stört ihn nicht weiter. Ist schließlich nicht das erste Mal, dass Frauenaugen ihn wohlgefällig betrachten. Er gibt jeder einen Kuss auf die Wange, dann tritt er zur Kommode mit dem Waschbecken und dem Spiegel. Markovic ist ein gut aussehender Mittdreißiger mit dunklem Haar und einem Grübchen im Kinn. Seine Augen sind heute Morgen etwas glasig und gerötet. Ansonsten sieht man ihm den Kater nicht an. Er schäumt den Rasierpinsel ein.
Huber, der junge Offiziersdiener, lungert derweil im Zimmer herum, den Blick fest auf die beiden nackten Frauen gerichtet. Seine Gegenwart hindert sie nicht daran, sich beim Anziehen ungeniert Zeit zu lassen. Im Gegenteil. Es scheint ihnen Spaß zu machen, dass der Bursche mit offenem Mund dasteht und die Augen nicht von ihren Brüsten lassen kann.
»Hör auf, die Weiber anzustarren!«, schnauzt Markovic. »Hol mir lieber die Uniform.«
»Zu Befehl!«, murmelt Huber widerstrebend und verlässt mit rotem Kopf und einem sehnsüchtigen Blick das Zimmer. Die Mädchen kichern.
Markovic wischt die letzten Schaumspuren von den Wangen und kämmt sich das militärisch kurz geschnittene Haar. Er kleidet sich hastig an, bindet sich die Uhr ums Handgelenk und wirft einen nervösen Blick darauf. Es ist eine jener noch seltenen, eigens für Flieger gefertigten Armbanduhren, eine Santos von Cartier, Geschenk seines Vaters, auf das er sehr stolz ist. Wesentlich praktischer als die üblichen Westentaschenuhren, besonders für einen Militär.
Noch zwanzig Minuten. Das dürfte reichen. Trotzdem Zeit, sich auf den Weg zu machen. Ein letzter kritischer Blick in den Spiegel. Markovic ist wie immer glatt rasiert, in perfektem Uniformschick und blank polierten Reitstiefeln. Auch wenn er sich in seiner Freizeit gern ausschweifenden Vergnügungen hingibt – schließlich ist er Junggeselle –, vieles beim Militär nicht so tierisch ernst nimmt und auch seinem Burschen einiges durchgehen lässt, so hört bei drei Dingen der Spaß auf: Das sind seine Ehre als Offizier, die Sorgfalt, mit der er die beruflichen Pflichten erfüllt, und nicht zuletzt seine militärische Garderobe. Nie würde er es sich erlauben, anders als in tadelloser Uniform in der Öffentlichkeit zu erscheinen. Das ist ihm seit der Kadettenschule eingebläut worden. Und er hält sich daran.
Ungeduldig dreht er sich zu den beiden Hübschen um, die es mit dem Anziehen nicht besonders eilig haben. Eine ist noch im Unterrock und sucht nach ihren Schuhen. Die Blonde zwängt sich gerade in ihr eng geschnittenes Kleid vom Vorabend und hat Mühe, den üppigen Busen unterzubringen.
»Ich muss jetzt los«, sagt er. »Ich kann nicht auf euch warten. Seid bitte leise, wenn ihr geht. Die Alte unten macht mir sonst Scherereien.«
»Versprochen, Schatzi«, sagt die Blonde und wirft ihm eine Kusshand zu. »War schön mit dir. Lass dich mal wieder sehen.«
»Sicher doch«, murmelt er abwesend und ruft noch mal seinen Burschen ins Zimmer. »Du kümmerst dich bitte um die Damen.«
Huber nickt eifrig. Er weiß, was erwartet wird. Er soll darauf achten, dass die Mädchen möglichst bald und diskret das Haus verlassen und vor allem nichts aus Markovic’ Zimmer mitgehen lassen. Nicht, dass es dort besonders Wertvolles gibt. Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Huber lässt sich auf einem Stuhl nieder und grinst der Ungarin zu, die nun endlich ihre Schuhe gefunden hat.
Markovic schüttelt den Kopf und verlässt das Appartement. Er steigt die Treppe hinunter, am Frühstückszimmer vorbei, und tritt vor die Tür der Pension. Auf der Straße bleibt er kurz stehen, um erst mal tief durchzuatmen, denn die frische Morgenluft wirkt wie Balsam auf die Kopfschmerzen. Sein Blick wandert zum schlanken Minarett der nahen Gazi-Husrev-Beg-Moschee, das sich blendend weiß vor dem strahlend blauen Himmel abhebt. Die Luft ist mild, die Berge ringsum leuchten in sattem Sommergrün. Es verspricht ein schöner Tag zu werden. Markovic sieht noch einmal auf die Uhr und macht sich auf den Weg.
Die Pension, in der er logiert, liegt etwas nördlich vom alten Basar. Es ist ungewöhnlich für einen k. u. k. Offizier, im moslemischen Teil der Stadt zu wohnen, aber Markovic findet es hier interessanter als in den neuen, modernen Vierteln westlich der Altstadt, wo seit der österreichischen Besetzung im Jahre 1878 viele Wohn- und Amtsbauten entstanden sind, Schulen, Kasernen und Offizierskasinos. Von der Pension bis zum Hauptquartier der Militärverwaltung im Konak, dem einstigen türkischen Gouverneurspalast auf der südlichen Seite des Flusses, ist es nicht weit. Auch ein Grund, warum Markovic die Pension gewählt hat, denn als Chef des Militärgeheimdienstes von Bosnien-Herzegowina belegt er im Konak eine kleine Flucht von Räumen.
Sein Weg führt mitten durch die Baščaršija, den türkischen Basar der Altstadt. Er liebt es, über den Basar zu wandern. In den schmalen Gassen herrscht wie immer das Treiben eines geschäftigen Wochentages, das unablässige Stimmengewirr vieler Menschen, übertönt von den Rufen der Händler, die ihre Waren anpreisen. Hier gibt es immer etwas Interessantes zu sehen, auch wenn im Augenblick die Zeit drängt.
In einem Bereich des Basars werden Obst und Gemüse angeboten, in einem anderen Fleisch und Flussfische. Da sind die Gassen der Brokatsticker, der Gerber und der Goldschmiede. Aus winzigen Werkstätten klingt das Hämmern der Kesselflicker und Schuhmacher. Menschen jeglichen Standes, jeglicher Herkunft und Religion wandern an den offenen Läden vorbei, meist klapprige Buden aus Holz mit Verschlägen, die sich zur Gasse hin öffnen und so vollgestopft sind mit Waren, dass man meinen könnte, sie würden unter der Last zusammenbrechen. Alles gibt es hier zu kaufen, das Nötige und das Unnötige, das Edle und das Profane. Gebrauchte Kleidung oder neue, aus feinem Tuch. Bestickte Kissen, Seidentücher, Ketten aus Glasperlen, Bernstein- und Silberschmuck, Rosenkränze, Koran oder Bibel. Händler schmeicheln und umgarnen Kunden, die das Angebot kritisch betasten und beäugen und lautstark um den besten Preis feilschen. Darunter Frauen bei ihren täglichen Einkäufen, nicht selten nach osmanischer Tradition gekleidet, weite Pluderhosen, darüber die Feredza, ein unförmiges Gewand, das jegliche Körperform verbirgt, und um dem Kopf ein langes Tuch, das nicht viel mehr als Augen und Nasenspitze erkennen lässt.
Markovic schiebt sich an einem Bauern vorbei, der ein Pferd hinter sich herzieht, macht einer Christin in kurzer Weste Platz, ebenso einem ehrwürdigen Popen mit langem Bart, der nicht auf den Weg achtet, weil er sich angeregt mit einem Mönch unterhält. Ein kleiner Junge steht allein in der Menge und schreit zum Erbarmen, bis die Mutter auftaucht und ihn auf den Arm nimmt. Es herrscht ein Gedränge und Geschiebe zwischen den Buden, schnell kommt man nicht voran. Den vielen Garküchen entströmt schon jetzt am Morgen ein Geruch von Knoblauch und gegrilltem Hammelfleisch, ein Geruch, der in Markovic’ verkatertem Magen ein Gefühl von Übelkeit hervorruft. Vor einem Kaffeehaus ist ein heftiger Streit zwischen zwei Männern entbrannt. Ein dritter versucht, sie auseinanderzuhalten. Zum Glück sind zwei Beamte der städtischen Polizei zur Stelle, leicht zu erkennen an ihrer blauen Uniform mit dem roten Fez.
In einer Nische, neben einem Händler für Geschirr und Tongefäße, hockt ein alter Muslim auf einem abgewetzten Teppich. Sein Bart ist weiß, das braune Gesicht voller Runzeln, auf dem Kopf sitzt ein speckiger Turban. Neben dem Mann steht eine Schubkarre, in der sich Wasserschlauch und Zuckerdose, ein Säckchen mit Kaffeebohnen, eine alte Handmühle und ein Stapel winziger, einfachster Steinguttassen befindet. Auf dem Kohlebecken vor ihm summt eine rußgeschwärzte Kupferkanne und verbreitet einen herrlichen Duft nach türkischem Kaffee. Markovic bleibt stehen. Für einen Kaffee muss Zeit sein, beschließt er. Besonders nach durchzechter Nacht. Soll Potiorek verdammt noch mal warten.
Der Alte schaut auf und schenkt ihm ein zahnloses Grinsen. »Guten Morgen, Efendi«, sagt er in schauderhaftem Deutsch. »Ein Tässchen Mokka? Wie immer?«
Markovic nickt und kramt in der Hosentasche nach einer Münze. Natürlich gibt es auf dem Basar richtige Kaffeehäuser, in denen man auf bequemen Kissen verweilen kann, aber Markovic hat es heute eilig. Außerdem mag er den Alten. Vielleicht, weil er arm ist und sich hier ein paar Kronen verdient, um zu überleben. Und sein Kaffee ist nicht schlechter als anderswo.
Der Alte lässt die Münze verschwinden, nimmt einen Topflappen, um sich nicht zu verbrennen, greift mit seiner großen, schwieligen Rechten, die von lebenslanger harter Arbeit zeugt, zur Kanne, nimmt mit der Linken eine saubere Tasse vom Stapel und gießt schwungvoll ein. Dann reicht er Markovic lächelnd und mit einer salbungsvollen, fast unterwürfigen Bewegung das dampfende Tässchen, ganz so, als handele es sich um etwas wundervoll Kostbares. Und das ist es auch. Markovic nimmt den ersten vorsichtigen Schluck von dem süßen Gebräu und fühlt sich gleich besser.
»Hvala! Danke!«, sagt er und zwinkert dem Alten zu.
Der lacht und erwidert etwas Unverständliches auf Bosnisch.
Die Sprache ist immer noch die größte Barriere, denkt Markovic. Auch für seine Arbeit. Bosnisch und Serbisch sind praktisch identisch. Vielleicht sollte er sich endlich mal dranmachen, die Sprache zu lernen. Obwohl nicht wenige Bosnier inzwischen Deutsch sprechen. Schließlich ist es Amtssprache in Bosnien und Herzegowina.
Markovic ist bereits seit drei Jahren auf diesem Posten in Sarajevo und hat sich immer noch nicht ganz an die erstaunliche Mischung aus West und Ost gewöhnt, an diese Stadt, in der christliche Kirchenglocken neben dem Ruf des Muezzins erklingen, wo man Rabbiner im Gespräch mit bärtigen orthodoxen Priestern antrifft. Ein ungewöhnliches Nebeneinander europäischer Moderne und türkischer Tradition. Sarajevo ist eine Stadt der Gegensätze und der Widersprüche.
Zwei Soldaten in österreichischen Uniformen grüßen ihn im Vorbeigehen. Die müssen heute Ausgang haben. Überhaupt ist wegen der anstehenden Manöver viel Militär in der Stadt. Das lenkt Markovic’ Gedanken unweigerlich auf den Besuch des Thronfolgers und die damit verbundenen Risiken. Denn so friedfertig der Basar sich gibt – in Sarajevo ist nicht alles eitel Sonnenschein. Besonders die bosnischen Serben sorgen für Unruhe. Von den Muslimen seit Jahrhunderten klein gehalten, sehen sie auch in Österreich nur den Unterdrücker. Ständig gibt es Aufruhr in der Stadt, Protestmärsche und Prügeleien mit der Polizei. Attentatsversuche gegen österreichische Amtsträger hat es auch schon gegeben. Serbien selbst mischt hier kräftig mit, das weiß er aus seiner Geheimdiensttätigkeit. Die Stadt ist voller Dunkelmänner und Spitzel. Darunter nicht zuletzt auch Markovic’ eigene Spione.
Ein Blick auf die Uhr, dann trinkt er aus und gibt seine Tasse zurück. Ein paar Schritte weiter biegt er in die Franz-Josef-Straße ein, die zum Appel-Kai und der Miljacka führt, dem Fluss, der Sarajevo in zwei lange Hälften teilt. An der Ecke, beim Feinkostladen Schiller, bleibt er stehen, um ein Pferdefuhrwerk vorbeizulassen, dann überquert er die Straße und betritt die Lateinerbrücke, die den Fluss überspannt. Wenig später erreicht er den Konak, einen dreistöckigen Bau neutürkischer Architektur mit hohen Fenstern und einer breiten Treppe, die zum Eingangsportal führt. Hier gehen österreichische Beamte und Offiziere ein und aus. Einige grüßen ihn. Leichtfüßig eilt er die Treppe hinauf und verschwindet im Innern des Gebäudes.
Sarajevo, 8:34 Uhr, im Konak
Die Versammlung findet in einem düsteren eichengetäfelten Raum statt. An der Wand das unvermeidliche Porträt des alten Kaisers, inklusive Ordensbrust und Backenbart. Offensichtlich ist Markovic der Letzte, der den Raum betritt. Am Kopfende des langen, spiegelblank polierten Konferenztisches sitzt Landesherr Oskar Potiorek in militärisch steifer Haltung und wirft ihm einen gereizten Blick zu. Sein Dienstgrad ist Feldzeugmeister, ursprünglich ein Generalsrang der Artillerie, im österreichisch-ungarischen Heer jedoch ein Rang der höchsten Führungsebene. Potiorek ist Befehlshaber der Balkanarmee, also ein äußerst wichtiger Mann.
»Schön, dass Sie uns doch noch beehren«, knurrt er ungehalten. »Vielleicht können wir dann ja endlich anfangen.«
»Tut mir leid«, erwidert Markovic und lässt sich auf einem freien Platz am hinteren Ende des Tisches nieder. Akten hat er nicht mitgebracht. Er weiß, worum es geht und was er dazu sagen wird. Er hält die Einladung des Thronfolgers und seiner Gemahlin nach Sarajevo für einen schweren Fehler. Aus Sicherheitsgründen. Und er hat vor, seine Bedenken noch einmal mit allem Nachdruck zu äußern. Selbst auf die Gefahr hin, dass er sich bei dem mächtigen Landeschef unbeliebt macht.
Potiorek ist mittelgroß und um die sechzig. Sein Haar ist grau meliert, streng gescheitelt und an den Seiten kurz geschoren. Die Oberlippe ziert ein Schnäuzer, und die etwas wabbeligen Wangen über dem steifen Militärkragen sind glatt rasiert. Eigentlich keine besonders einprägsame Erscheinung – bis er den Mund aufmacht. Die Stimme klingt blechern hart und etwas schnarrend, der Ton befehlsgewohnt, kaum Widerspruch duldend.
Vor Jahren wäre er um ein Haar zum Chef des Generalstabs der österreichisch-ungarischen Streitkräfte ernannt worden, wenn der Thronfolger ihn nicht zugunsten Franz Conrad von Hötzendorfs übergangen hätte. Eine peinliche Zurücksetzung, die Potiorek immer noch schmerzen muss. Dass diese beiden Offiziere seitdem bitter verfeindet sind, ist allgemein bekannt. Aber Landesherr der vor sechs Jahren formal annektierten Provinz Bosnien und Herzegowina ist sicher auch kein schlechter Posten.
Neben Potiorek sitzt sein Adjutant, Major Wiesinger. Ihm gegenüber räkelt sich ein Oberstleutnant der Infanterie, ein gewisser Baron von Scherwitz. Der trägt einen gewaltigen Schnauz- und Backenbart im Gesicht, ganz im Stil des Kaisers. Ebenso geladen sind der zivile Bürgermeister von Sarajevo, Fehim Efendi Čurčić, der Polizeichef der Stadt, Karl Mayerhoffer, und der Polizeikommissär der Landesregierung von Bosnien, Edmund Gede.
Mit Wiesinger hat Markovic des Öfteren zu tun. Auch Mayerhoffer und der schon ergraute Edmund Gede, der aus Graz stammt, sind ihm gut bekannt. Er schätzt sie als erfahrene Polizisten. Der Bürgermeister, ein beleibter, bosnischer Muslim, ist der Einzige, der keine Uniform trägt. Dafür hat er für gewöhnlich einen roten Fez auf dem Kopf, den er jetzt abgenommen hat. Mit ihm hat Markovic bisher wenig zu tun gehabt. Auch diesen von Scherwitz, einer der Kommandeure der anstehenden Manöver, kennt er nur flüchtig.
Potiorek räuspert sich, trinkt einen Schluck Wasser aus dem Glas, das vor ihm steht, und nimmt die schriftliche Aufstellung der Tagesordnung zur Hand, auf der auch die Namen der heute Anwesenden vermerkt sind. Er eröffnet die Konferenz mit einer knappen Nennung der Beteiligten. Markovic ist es peinlich, dass der Landeschef über den Namen des bosnischen Bürgermeisters stolpert, obwohl er dem Mann, wer weiß nicht wie oft schon begegnet sein muss.
Dann ergreift Major Wiesinger, der Adjutant, das Wort. Er streift kurz die geplanten Aktivitäten während des Manövers – auch Franz Conrad von Hötzendorf, der Chef des Generalstabs, wird selbstverständlich zugegen sein –, kommt dann aber ausführlich auf das Hauptthema des Tages zu sprechen, die einzelnen Programmpunkte, die den hohen Besuch betreffen. Die Beobachtung der Manöver durch den Erzherzog, die Abnahme der Ehrenkompanie, die Verteilung von Orden, den Besuch des Basars, den der Bürgermeister für die Herzogin organisiert hat, das geplante Diner mit lokalen Würdenträgern, die Wege per Motorwagen durch die Stadt, die das Paar nehmen wird, bis hin zum Empfang im Rathaus und den angesagten Reden. Alles genauestens festgelegt, was Uhrzeiten, Begleitpersonal und Honoratioren betrifft.
»Wir werden das alles natürlich bekannt geben, damit die Bevölkerung sich darauf einstellen kann«, schließt er.
»Sie wollen das in die Zeitung setzen?«, fragt Markovic entsetzt. Er richtet sich aus der lässigen Haltung auf, die er bisher eingenommen hat. »Dann weiß ja jeder Störer und Aufwiegler, wo er sich hinstellen muss.«
»Im Gegenteil«, erwidert Wiesinger pikiert. »Wir erwarten fröhliche Menschen, die dem Thronfolgerpaar begeistert zuwinken. Je bunter und lebendiger, umso besser. Wir werden zeigen, dass die Bosnier treu zur Monarchie stehen.«
»Und was ist mit Sicherheitsvorkehrungen?«, fragt Markovic. »Davon haben wir bis jetzt noch gar nichts gehört.«
Edmund Gede nickt heftig. »Ein äußerst wichtiger Punkt«, bemerkt er. Auch der Bürgermeister stimmt zu und macht ein besorgtes Gesicht.
Potiorek hingegen stören die Einwände. Was fällt den Leuten ein, meinen Plan infrage zu stellen?, scheint sein Gesichtsausdruck zu sagen. Und gleich macht er den Rädelsführer aus – Markovic. Er wirft ihm einen gereizten Blick zu. Wie kann er es wagen, die Anordnungen zu kritisieren! Potiorek richtet seine Aufmerksamkeit erneut auf die Liste, die vor ihm liegt.
»Sie sind doch dieser … äh … Markovic. Ist das richtig?«, fragt er bissig und starrt ihn mit einem dieser Blicke an, die Unteroffiziere zum Zittern bringen.
»Ganz recht, Herr Feldzeugmeister. Major Markovic, zu Diensten.«
Als wüsste der Kerl nicht genau, wer ich bin, denkt Markovic. Das sind die üblichen Mätzchen, um Leute einzuschüchtern. Dieser Potiorek ist als schwieriger Chef bekannt. Ein Schinder, der Untergebenen das Leben zur Hölle macht. Gerade den muss es ärgern, dass er keine Macht über ihn hat. Schließlich berichtet Markovic nicht an ihn, sondern direkt an das Evidenzbüro in Wien, das Hauptquartier des Geheimdienstes.
Potiorek starrt ihn ärgerlich an. Dann senkt sein Blick sich wieder auf die Liste. »Major Rudolf A. Markovic, Geheimdienst«, liest er vom Blatt ab. Das Wort Geheimdienst spricht er in einem Ton aus, als handele es sich um eine besonders widerwärtige Spezies. »Markovic«, fährt er fort. »Sind Sie etwa Bosnier oder gar Serbe?«
»Ich bin Österreicher. Wie Sie, Herr Feldzeugmeister. Genau genommen bin ich Wiener.«
»Soso. Und wofür steht das ›A‹, Herr Major?«
Markovic seufzt innerlich. Er kann sich denken, was jetzt kommt. »Es steht für Aaron, Herr Feldzeugmeister.«
»Aaron. Sie sind also Jude.«
»Ich nicht, aber meine Mutter.«
»Aha! Aber das vererbt sich mütterlicherseits, oder etwa nicht?« Potiorek lächelt plötzlich und zeigt dabei Haifischzähne. »Damit sind Sie Jude, mein Lieber.«
»Darf ich wissen, was das mit meiner Frage zu tun hat?«
»Nichts. Gar nichts. Ist nur interessant, wie ihr Juden inzwischen auch die Armee unterwandert.« Er grinst noch einmal. Diesmal hämisch. »Und sind Sie nicht Junggeselle?«
Markovic nickt.
»Mir sind da Dinge zu Ohren gekommen. Es heißt, Sie amüsieren sich gern. Nächtliche Ausschweifungen in gewissen Etablissements.«
In diesem Punkt hat Potiorek nicht unrecht. Gelegentlich trinkt Markovic zu viel. So wie letzte Nacht. Schuld daran sind die Langeweile des Soldatenlebens, besonders damals, als er noch in der Kavallerie war, und der leichte Zugang zu Alkohol in der Offiziersmesse. Und natürlich die Weiber. Aber was soll’s? Niemand ist ohne Schwächen. Auch der gute Potiorek nicht.
»Der Besuch gewisser Etablissements, wie Sie es nennen, gehört zu meinen Pflichten«, erwidert Markovic ungerührt. »Meine Kontakte und Informanten trifft man nicht in Amtsstuben.«
»Ah ja«, lässt Potiorek gedehnt hören. »Ich nehme an, Sie nennen das Milieurecherche.« Er lacht über seinen kleinen Scherz und sieht sich um, ob auch die anderen Anwesenden das lustig finden. Nur der Oberstleutnant grinst amüsiert. Potiorek wird wieder ernst und fügt mit einem giftigen Blick hinzu: »Wohl eher Recherche in Bordellen. Privatvergnügen auf Staatskosten.«
Eine ziemlich heftige Anschuldigung. Aber Markovic ist keiner, der sich leicht aus der Fassung bringen lässt. Er ist zwar Karriereoffizier, entstammt leider auch keiner adeligen Familie, was ein Nachteil ist, aber er ist Sohn einer reichen Unternehmerdynastie und somit nicht von dem mageren Offizierssold abhängig, den sie ihm zahlen. Sollen sie mich doch rausschmeißen, ist seine Devise. Aber das werden sie nicht tun. Dazu ist er ein zu guter Geheimdienstler.
»Nennen Sie es, wie Sie es wollen, Herr Feldzeugmeister«, antwortet er ruhig. »In einem haben Sie recht: Wir haben durchaus unsere Quellen im Milieu. Und natürlich anderswo auch. Sie wären erstaunt zu erfahren, was manche Herren ihren Liebchen anvertrauen. Besonders in gewissen Stunden. Sie kennen das ja aus meinen Wochenberichten. Obwohl wir unsere Quellen natürlich geheim halten. Aber es ist immer wieder erstaunlich, was einem da alles unterkommt. Also unterschätzen Sie uns nicht, Herr Feldzeugmeister.«
Markovic lächelt verbindlich. Das Schöne am Geheimdienst ist, dass einem niemand an den Karren pinkeln kann. Obwohl Markovic nicht direkt an den Landesherrn berichtet, so erhält dieser doch eine Durchschrift der regelmäßigen Analysen, die er nach Wien schickt. Deshalb weiß Potiorek sehr wohl, womit sich Markovic’ Abteilung beschäftigt. Schließlich beobachtet der Geheimdienst nicht nur externe Feinde der Monarchie, sondern hält auch ein Auge auf die eigenen Leute. Potiorek wird sich also denken können, dass sich einiges in Markovic’ Akten befinden könnte, das nicht unbedingt in den Wochenberichten erwähnt wird und nur sehr wenigen bekannt sein dürfte. Zum Beispiel, dass sich der Feldzeugmeister in Bosnien eine Geliebte hält, von der die Gemahlin in Wien nichts ahnt. Noch dazu eine bosnische Serbin, deren Bruder Geld mit Waffenschiebereien macht und undurchsichtige Verbindungen nach Belgrad unterhält.
Potiorek scheint verstanden zu haben. Er ist rot geworden, und seine Kiefer mahlen, aber er sagt nichts.
»Um auf meine Frage zurückzukommen«, fährt Markovic ungerührt fort, »meine Quellen berichten jetzt immer öfter von heimlichen Treffen unter Studenten. Unter denen gibt es ziemliche Krawallbrüder. Mir kommen beunruhigende Dinge zu Ohren.«
»Was für Dinge?«
»Es wird gegen die Monarchie gehetzt. Wir alle wissen, es gibt genug Hitzköpfe in diesem Land. Im Augenblick scheint sich etwas zusammenzubrauen.«
»Aha! Und haben Sie vielleicht Konkretes zu melden?«
»Leider nichts Genaues«, muss Markovic zugeben.
»Dann verschwenden Sie unsere Zeit nicht mit Vermutungen und substanzlosen Gerüchten!«, fährt Potiorek ihn scharf an.
Aber Markovic gibt sich noch nicht geschlagen. »Für Sie mögen sie vielleicht substanzlos erscheinen, aber für mich sind das Anzeichen, auf die man achten muss. Vor allem, wenn es um die Sicherheit des Thronfolgers geht. Eine der vordringlichsten Sorgen eines jeden Geheimdienstes, würde ich sagen. Gewiss auch für Sie, Herr Feldzeugmeister. Für uns alle.«
Potiorek runzelt ärgerlich die Stirn. »Natürlich ist es das. Aber für die Sicherheit ist bestens gesorgt. Wir haben genug Polizisten auf der Straße.«
»Mit Verlaub«, meldet sich Edmund Gede zu Wort. »Eben nicht. Dem kann ich so nicht zustimmen.« Er wendet sich an den Polizeichef der Stadt, der neben ihm sitzt. »Wie viel Mann haben Sie zur Verfügung?«
Unter Potioreks strengem Blick windet Mayerhoffer sich ein wenig, bevor er antwortet. Dann sagt er: »Achtzig Mann. Mehr hab ich nicht.«
Gede nickt grimmig. »Nehmen wir mal an, wir konzentrieren etwa die Hälfte auf strategisch wichtige Punkte und den Rest verteilen wir entlang der Route, dann wäre das angesichts der langen Strecke vom Bahnhof bis zum Rathaus bestenfalls ein Mann alle sechzig Meter. Das ist bei Weitem nicht genug, Herr Feldzeugmeister. Außerdem sind die Männer nicht gegen Attentate ausgebildet.«
»Was für Attentate?«, knurrt Potiorek. »Sarajevo ist sicher. Die Bevölkerung freut sich auf den Besuch. Es ist eine Ehre für diese Stadt. Nicht wahr, Herr Efendi … äh … Čurčić?«
Der Bürgermeister blickt unsicher zu Gede hinüber, bevor er antwortet. »Ich weiß nicht«, sagt er dann. Sein Deutsch ist gut, wenn auch stark akzentgefärbt. »Fragen der Sicherheit entziehen sich meiner Kompetenz. Aber natürlich, das Volk von Sarajevo freut sich auf den Besuch.«
»Auf den muslimischen Teil der Bevölkerung trifft das sicher zu«, sagt Markovic. »Sorgen machen mir die bosnischen Serben. Unter ihnen gibt es jede Menge Unzufriedene und Aufrührer. Es muss ja nicht gleich ein Attentatsversuch sein, aber es könnte gepöbelt werden, Steine könnten fliegen.«
»Die paar Polizisten sind einfach nicht genug«, wiederholt Gede mit Bestimmtheit. Mayerhoffer nickt. Er wirkt erleichtert, dass Gede und Markovic ihn unterstützen.
Potiorek runzelt die Stirn. »Dann bringen Sie meinetwegen Verstärkungen aus der Provinz.«
Gede schüttelt den Kopf. »Aus Tuzla höchstens. Oder Doboj. Aber auch dort sind wir dünn besetzt. Mehr als dreißig Mann kann ich nicht abziehen. Es liegt also auf der Hand. Mayerhoffer und ich sind nicht in der Lage, für die Sicherheit des hohen Besuchs zu garantieren. Das habe ich, wenn Sie sich erinnern, auch schon bei früheren Gelegenheiten zum Ausdruck gebracht.«
Einen Augenblick lang herrscht betretenes Schweigen, denn es ist deutlich, dass dem Landesherrn das Gesagte nicht gefällt. Alle warten auf seine Reaktion. Aber Markovic hat noch etwas hinzuzufügen:
»Vielleicht ist es Ihnen nicht aufgefallen, Herr Feldzeugmeister, aber die Fahrt durch die Stadt und die Festreden im Bürgersaal finden ausgerechnet am 28. Juni statt. Das ist ein ganz besonderes Datum für die Serben. Vidovdan, der Gedenktag zur Schlacht auf dem Amselfeld im Jahre 1389.«
»Na und?«
»Dieser Tag ist schlechthin das Symbol für die Befreiung des serbischen Volkes von Fremdherrschaft und Knechtschaft. Nicht gerade feinfühlig, dass der Thronfolger ausgerechnet an diesem Tag seinen Auftritt hat. Die bosnischen Serben könnten es als Beleidigung auffassen. Wie ist dieses Datum überhaupt zustande gekommen?«
Potiorek starrt ihn wütend an. »Jetzt nörgeln Sie auch noch an dem Datum herum! Ich selbst habe das Datum festgelegt, wenn Sie es genau wissen wollen. Schon vor vielen Monaten, verdammt noch mal! Und dieser Vidovdan, oder wie Sie es nennen, das ist doch dummes Zeug. Romantische Folklore, ohne Bedeutung. Eine Schlacht aus dem Mittelalter! Herr im Himmel! So was soll man ernst nehmen?«
»Ich denke, wir sollten es sehr wohl ernst nehmen. Es ist nicht das erste Mal, dass es Aufstände, ja, sogar Attentatsversuche in dieser Stadt gegeben hat. Vor vier Jahren sogar auf Ihren Vorgänger. Ich empfehle daher dringendst, die Straßen mit Militär zu säumen.«
»Sind Sie wahnsinnig? Wir sind doch keine Besatzungsarmee. Bosnien gehört zu Österreich-Ungarn. Wir bringen dem Land Fortschritt und Kultur. Das Volk freut sich auf den Besuch des Thronfolgers. Gerade deshalb habe ich darauf bestanden, dass die Herzogin ihn begleitet. Sie ist eine äußerst charmante Person und wird die Herzen der Leute im Sturm erobern. Also faseln Sie nicht von Militär in den Straßen. Das wäre genau die falsche Botschaft. Wir werden im Gegenteil Blumen streuen. Kinder werden Ständchen singen. Es ist ein friedlicher Besuch.« Er blickt noch einmal wütend in die Runde. »Und jetzt Schluss mit der Diskussion! Es wird gemacht, wie ich es sage. Das wäre dann alles für heute, meine Herren.«
Markovic schäumt innerlich, obwohl er sich nichts anmerken lässt. Dieser Potiorek will ein Theater aufführen, sich selbst zu Ehren. Das Ganze dient allein einer Sache: der Welt und vor allem dem Kaiser zu zeigen, was für ein vorzüglicher Landeschef er ist, dass er alles im Griff hat, dass die Bosnier gute Untertanen sind und die Monarchie unterstützen. Dank Feldzeugmeister Potiorek, dem Mann für alle Jahreszeiten. Prädestiniert für höhere Aufgaben.
Dabei weiß Markovic es besser. Ein Gutteil der Bevölkerung sieht in der Annexion durchaus einen Vorteil, besonders wirtschaftlicher Art. Nicht wenige, vor allem die bosnischen Serben, betrachten die Österreicher allerdings als Besatzer und Unterdrücker. Sie knirschen heimlich mit den Zähnen. Dazu noch dieses verdammte Manöver! Etwas Blöderes hätte Potiorek sich gar nicht einfallen lassen können. Tief besorgt verlässt Markovic die Versammlung.
Auf dem Flur gesellen sich Edmund Gede und Mayerhoffer zu ihm. »Ich bin ganz Ihrer Meinung, Herr Major«, sagt Gede. »Aber der Potiorek hat das Sagen. Was können wir tun?«
»Die Augen offen halten, mein lieber Gede. Die Augen offen halten. Das gilt auch für Sie, Herr Mayerhoffer. Sagen Sie das Ihren Männern. Sie sollen sich von jedem auch nur entfernt Auffälligen die Papiere zeigen lassen. Ich werde Ihnen eine Liste von möglichen Verdächtigen rüberschicken. Die nehmen Sie vorsichtshalber in Haft.«
»Mit welcher Begründung?«
»Herumlungern, Beamtenbeleidigung – was weiß ich? Denken Sie sich was aus. Wichtig ist nur, dass wir diese Elemente am Achtundzwanzigsten von der Straße haben. Natürlich werde auch ich weiterhin meine Fühler ausstrecken.«
Vielleicht sollte ich die Sache auch nach Wien melden, denkt er wenige Minuten später in seinem Büro. Ja, das sollte ich. Was der Potiorek da treibt, ist unverantwortlich. Der Erzherzog sollte sich zumindest der Lage bewusst sein.
Er greift zum Telefonapparat.
Schloss Chlumetz in Böhmen, 9:42 Uhr
Franzi, wir frühstücken. Leg doch bitte die Zeitung weg.«
Irritiert hebt Erzherzog Franz Ferdinand den Kopf aus dem Blatt, in das er vertieft ist. Sein Blick nimmt die vorwurfsvolle Miene seiner Gemahlin zur Kenntnis und streift flüchtig die blonden Köpfe seiner drei Kinder. Die essen gerade ihre Semmel, während der alte Hermann heiße Schokolade nachschenkt. Der Jüngste, der zehnjährige Ernst, den sie in der Familie Bululu nennen, leckt Marmelade vom Messer ab, grinst schuldbewusst, als er sich beobachtet sieht und legt schnell das Messer auf den Tellerrand.
Franz Ferdinand wendet sich wieder der Zeitung zu. »Entschuldige, Liebes!«, murmelt er. »Muss doch wissen, wie es um Durazzo steht.«
Er liest die Wochenendausgabe der Neuen Freien Presse, eine der wichtigsten Tageszeitungen Wiens. Ein Judenblatt, wie er es nennt, denn der Herausgeber ist hebräischen Glaubens. Das hält Franz Ferdinand aber nicht davon ab, das Blatt zu lesen. Da er gestern auf Schloss Namiest bei Brünn zum Wachtelnschießen geladen war und erst ziemlich spät heimgekommen ist, ist er nun begierig auf Nachrichten aus der Welt. Besonders, was diese Albanienkrise angeht.
Die Herzogin seufzt. Schon wieder Durazzo. Dieser Tage scheint von nichts anderem die Rede zu sein. Albanien hat sich vor zwei Jahren vom Osmanischen Reich lösen können und die Unabhängigkeit ausgerufen. Die Großmächte trauen den Albanern nicht zu, sich selbst zu regieren, und haben deshalb auf Drängen des Kaisers in Berlin diesen deutschen Adeligen, Wilhelm zu Wied, zum Fürsten von Albanien gemacht. Doch der Mann scheint sich in seinem neuen Reich nicht durchsetzen zu können. Schon jetzt, nach wenigen Monaten, ist es zum Aufstand moslemischer Bauern und Grundherren gekommen, die sich angeblich betrogen fühlen. Außer einem schmalen Küstenstreifen haben die Rebellen bereits ganz Zentralalbanien unter ihre Kontrolle gebracht. Jederzeit wird der Sturm auf Durazzo erwartet, wo sich, von einem Kontingent ausländischer Truppen eher schwach verteidigt, der Fürst aufhält.
Das also ist jetzt die Albanienkrise. Als gäbe es nicht schon genug Krisen. Besonders auf dem Balkan. Eine Hiobsbotschaft jagt die andere. Sophie wünscht, man könnte die verdammten Zeitungen abbestellen. Sie bringen nichts als Ärger ins Haus. Franz Ferdinand erregt sich gern über die Dummheit der Politiker und ist nach der Lektüre der Zeitungen oft stundenlang verstimmt.
Die morgendliche Junisonne fällt durch die hohen Fenster des Speisezimmers und lässt die Kristalle des Kronleuchters und das Silber des gedeckten Tisches glänzen. Außer dem Rascheln der Zeitung und dem gelegentlichen Klirren einer Porzellantasse ist es jedoch still. Die Bediensteten des Schlosses bleiben im Hintergrund, jederzeit bereit, sich nützlich zu machen. Schloss Chlumetz beschäftigt an die zwanzig von ihnen. Noch mehr, wenn die hohen Herrschaften so wie jetzt zugegen sind. Kammerdiener, Zofen, Zimmermädchen, Köchinnen, Gärtner, Chauffeure, Pferdeknechte, Jagdgehilfen und Hundeführer. Sie alle wissen, dass die Herzogin es nicht liebt, wenn sie allzu sehr in Erscheinung treten und die Intimität der Familie stören. Die ist ihr das Wichtigste überhaupt.
Auch die Kinder sind gehalten, bei Tisch nur das Nötigste von sich zu geben, besonders wenn der Vater die Zeitung liest. Sophie legt dem kleinen Ernst noch ein Butterhörnchen auf den Teller, ermahnt ihre Tochter, gerade zu sitzen, und wendet ihre Aufmerksamkeit wieder dem Ehemann zu. Der hält die Zeitung so, dass genug von der Morgensonne auf den Artikel fällt, in den er immer noch vertieft ist. Seine Haltung ist angespannt, die Lider beim Lesen verengt, als könne er so die klein gedruckten Zeilen besser entziffern. Seine Lippen bewegen sich unmerklich, fast so, als spräche er im Geiste den Text mit. Er braucht eine Brille, denkt die Herzogin. Wir werden langsam älter.
Der Gedanke betrübt sie nicht, im Gegenteil, ihr wird dabei warm ums Herz. Vor achtzehn Jahren haben sie sich auf einem Ball in Prag kennengelernt und ineinander verliebt, allen Widerständen getrotzt und vor vierzehn Jahren gegen den ausdrücklichen Wunsch des Kaisers geheiratet. Und sie lieben sich immer noch. Nur wenige Ehen, von denen sie weiß, sind so glücklich. Hier in Böhmen fühlen sie sich wohl, besonders in ihrem heimischen Nest auf Schloss Konopischt weiter nördlich, weit weg von der Hofburg und den widerwärtigen Ränken der Wiener Gesellschaft, aber auch hier in Chlumetz, das etwas näher an der Hauptstadt liegt. Auf dem Weg nach Wien machen sie hier zwei Tage Station, weil Franzi unbedingt der Jagdeinladung nach Brünn hat folgen wollen.
Sobald wir wieder in Konopischt sind, werde ich einen Augenarzt aufs Schloss bestellen, nimmt sie sich vor. Aus dem nahen Prag. Dort gibt es gute Ärzte. Oder vielleicht doch besser in Wien. Dann denkt sie mit ein wenig Bangen an die morgige Reise nach Bosnien. In der Nähe von Sarajevo sollen Manöver der österreichisch-ungarischen Armee abgehalten werden. Franzi hat vom Kaiser höchstpersönlich die Order erhalten, die Krone zu vertreten und den Truppen dort die Ehre zu erweisen. Alles ist bereit. Die Koffer wurden natürlich schon auf Konopischt gepackt.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, denkt sie. Mein Gott, Sarajevo! Jahrhundertelang unter türkischer Herrschaft. Wie es dort wohl sein mag? Wie wird man uns empfangen? So steif und formell wie in Wien? Oder doch ein wenig freundlicher? Was bedeutet den Bosniern überhaupt der Besuch des Thronfolgers und seiner Gattin?
Auf einmal knurrt Franz Ferdinand wie ein wütender Hund und reißt sie aus ihren Gedanken. Er schlägt die Zeitung zusammen, als hätte er genug davon, faltet sie dann aber doch sorgfältig und legt sie neben sich auf den Tisch. Er lehnt sich zurück und schüttelt genervt den Kopf. Die hochgedrehten Enden seines Schnauzbarts zittern vor Erregung. »Das reinste Chaos«, ruft er empört. »Das reinste Chaos, sag ich dir!«
Sophie streicht ihm sanft über die rechte Hand und lächelt entwaffnend. »Nun vergiss mal Albanien, Franzi, und iss lieber. Du musst doch hungrig sein.«
»Hast recht, Schatzerl.« Er hebt ihre Finger kurz an die Lippen. »Es hilft ja nicht, wenn ich mich aufrege. Bitte entschuldige.«
Der Erzherzog ist für sein explosives Temperament bekannt. Er kann sich schnell erregen. Dann vergisst er sich leicht, wird schroff und verletzend. Eine Erfahrung, die schon viele zu ihrem Leidwesen gemacht haben. Obwohl es ihm hinterher oft leidtut. Aber die Herzogin hat diese ruhige und sanfte Art, die so wohltuend ist und ihn meist schnell wieder beruhigt. Oder erst gar keinen Ärger aufkommen lässt. So wie jetzt. Trotz der schlechten Nachrichten aus Albanien.
»Erzähl uns doch, wie es gestern auf Schloss Namiest war«, sagt Sophie. »War die Jagd ergiebig? Hast du viel geschossen?«
Franz Ferdinand ist passionierter Jäger. Er verbringt viel Zeit damit und schießt, was ihm vor die Flinte kommt. Viel zu viel für Sophies Geschmack. Von seinen Erfolgen zeugen die zahllosen Geweihe, die in all seinen Jagdhütten und Schlössern hängen und ganze Wände bedecken. Aber was soll’s. Es ist seine Leidenschaft.
»Ach, es war nichts Besonderes. Man lässt dich übrigens herzlich grüßen. Die Gräfin war enttäuscht, dass du nicht dabei warst.«
»Ich dachte, sie kann mich nicht leiden.«
»Oh, ich glaube, du irrst dich.«
»Papa?«, lässt die fast dreizehnjährige Sophie sich vernehmen. Sie ist die Älteste. »Dürfen wir heute Nachmittag ein Theaterstück aufführen? Ich hab mir was ausgedacht. Aber ihr müsst mitmachen. Weil ihr doch morgen wegfahrt.«
Die Kinder sagen »Mamaah« und »Papaah«, mit Betonung auf der zweiten Silbe. Es klang fast ein wenig französisch.
»Was ausgedacht?«, fragt der Erzherzog.
»Etwas mit einem Wilderer. Den der Wildhüter jagt.«
»Einem Wilderer!« Er hebt die Brauen.
»Ja. Und den spielst du.«
»Ich soll den Wilderer spielen, Pinkie? Ich weiß nicht.« Pinkie ist der jungen Sophies Kosename. Max hat sie so genannt, als sie noch klein waren.
»Bitte, bitte, Papa.«
»Und deine Mama? Hat sie auch eine Rolle?«
»Sie ist seine Geliebte. Und sie versteckt den Wilderer.«
Franz Ferdinand lacht und zwinkert seiner Frau zu. »Na, meinetwegen. Weil wir morgen wegfahren und ihr die nächste Zeit ohne uns auskommen müsst. Da machen wir eine Ausnahme.«
Die Kinder sehen sich freudestrahlend an. Der kleine Ernst kichert. Auch die Herzogin lächelt. Es ist nicht das erste Mal, dass sie so etwas mit den Kindern spielen. Die Bediensteten beobachten es mit Erstaunen, wenn die Herzogin sich in wilde Kostüme wirft und sie den Erzherzog in irgendeiner Verkleidung auf Knien durch die ehrwürdigen Hallen schleichen sehen. Sehr zum Gaudi der Kinder.
Jetzt räuspert sich der elfjährige Maximilian. »Mama, dürfen wir aufstehen? Herr Kellermann wartet schon.«
Max ist ihr zweites Kind, ein ernster, gut aussehender Junge, der seinem Vater besonders ähnlich sieht und auch dessen hellblaue Augen hat.
Es ist in der Tat Zeit für den morgendlichen Unterricht. Herr Kellermann ist der Hauslehrer der beiden Jungen und hat die Kinder nach Chlumetz begleitet, wo sie bis zur Rückkehr der Eltern bleiben werden. Geometrie und Algebra, Erdkunde, ein wenig Latein und natürlich die gängigen klassischen Schriften. Nicht mehr und nicht weniger als das, was man für eine Offizierslaufbahn benötigt. Jagen und Schießen lernen sie beim Vater. Der hält nichts davon, ihr junges Hirn mit unnötigem Krimskrams vollzustopfen. Eine gute Figur zu Pferde und zu wissen, wie man sich in gehobenen Kreisen mit Anstand bewegt, ist seiner Meinung nach wichtiger als akademische Auszeichnungen. Gesunder Menschenverstand, darauf kommt es an. Das ist Franz Ferdinands Devise.
Tochter Sophie heißt nicht nur wie ihre Mutter, sie sieht ihr auch sehr ähnlich. Fast noch hübscher als die Mama, sagt Franz Ferdinand bisweilen. Sie ist die Lebendigste unter den drei Kindern, voller Fantasie und spontaner Einfälle. In Konopischt hat sie ihre eigene Lehrerin und folgt einem anderen Kurrikulum mit Schwerpunkten auf Poesie, Musikunterricht, Haushaltung und Sticken. Letzteres hasst sie allerdings von Herzen. Außerdem müssen alle drei zu Hause auch Englisch- und Französischunterricht bei einer Frau von Stein über sich ergehen lassen, einer verarmten Witwe aus niederem Adel, die den Kindern neben Sprachunterricht auch Etikette beibringt und wie man sich am Wiener Hof zu benehmen hat. Besonders der Englischunterricht liegt dem Erzherzog am Herzen, vielleicht weil er diese Sprache selbst so schlecht beherrscht und er sich bei ihrem letzten Besuch in England wie ein stammelnder Idiot vorgekommen ist.
»Geht nur, Kinder«, erwidert die Herzogin und streicht ihrem Jüngsten lächelnd über die Haare, bevor er sich trollt.
»Noch Kaffee, Hoheit?«, fragt der alte Diener mit der Kanne in der Hand.
Die Herzogin nickt und sieht zu, wie er ihre Tassen füllt, die Kanne abstellt und dem Erzherzog frischen Toast und Rührei bringt. »Darf es sonst noch etwas sein?«, fragt er.
»Danke, Hermann. Du kannst uns jetzt allein lassen.«
Franz Ferdinand streicht Butter auf eine Toastscheibe, beißt lustlos hinein und stochert dann in seinem Rührei herum. Schließlich legt er die Gabel weg. »Ich hab keinen rechten Hunger heute Morgen«, sagt er.
»Hat dir etwa Durazzo den Appetit verdorben?«
Sein Gesicht verdunkelt sich erneut. »Kaum sind die Osmanen vertrieben, versinkt dieses verdammte Land in Chaos. Man hätte lieber Truppen schicken sollen als diesen Dummkopf Wilhelm. Die Leute respektieren ihn einfach nicht.«
Sophie zuckt gleichmütig mit den Schultern. »Was regst du dich über Albanien auf, Franzi? Was gibt’s da schon außer Ziegenhirten?«
»Du hast recht, das Land ist arm. Aber die Serben haben ein Auge darauf. Zugang zum Meer, Sophie. Zugang zum Meer. Darauf spekulieren sie schon seit Langem. Das ist, was sie wollen. Aber wir werden es nicht zulassen. Das schwör ich dir.« Die letzten Worte hat er ziemlich heftig hervorgestoßen.
Sophie erschrickt. »Aber doch nicht Krieg, Franzi!«
Er schüttelt den Kopf. »Nein, Sopherl. Niemand redet von Krieg. Nur Conrad, dieser Schwachkopf.«
Franz Conrad von Hötzendorf ist Generalstabschef der österreichisch-ungarischen Streitkräfte und ein lautstarker Hetzer gegen die Serben. Franz Ferdinand selbst hat ihn vor acht Jahren auf diesen einflussreichen Posten gehoben, bereut es seitdem aber bitterlich. Denn seit Langem rät der Mann vehement zum Angriffskrieg gegen Serbien, das er für die Quelle allen Übels auf dem Balkan hält. Jedem, der es hören will, spritzt er sein Gift ins Ohr. Dabei ist Franz Ferdinand strikt dagegen. Die Lage in Europa ist schon angespannt genug. Ein Krieg mit Serbien würde Russland auf den Plan rufen, und das könnte allerhand nach sich ziehen.
»In einem hat der Conrad allerdings recht«, fährt er fort. »Die Serben muss man klein halten. Die wollen in ihrem pan-slawischen Ehrgeiz alles an sich reißen. Besonders nach ihrem Sieg über die Osmanen. Albanien käme ihnen gelegen, Montenegro auch, womöglich sogar unser Bosnien. Dem muss man einen Riegel vorschieben. Deshalb bin ich froh, dass die Marine vor der Küste liegt. Sie haben Schießbefehl, sollten die Aufständischen es wagen, Durazzo anzugreifen. Und diesmal ist sogar die italienische Flotte dabei. Die Serben werden einsehen, dass es uns ernst ist, dass sie sich, was Albanien betrifft, besser nicht einmischen.«
Sophie zieht einen Schmollmund. »Können wir nicht die Politik beiseitelassen? Reden wir lieber über unsere Reise. Ich bin schon ganz aufgeregt.«
Er nickt. »Ich hoffe, wir haben Zeit, uns ein wenig in Sarajevo umzuschauen. Es soll einen schönen türkischen Basar geben. Und du sollst ihn besuchen. Das steht jedenfalls in dem Programm, das sie mir geschickt haben.« Er hebt seine Tasse und nimmt einen Schluck Kaffee, in den er zuvor etwas Sahne und Zucker gerührt hat. »Aber wenn ich ehrlich bin, wäre es mir lieber, du würdest gar nicht erst mitkommen.«
Erstaunt sieht sie ihn an. »Aber freust du dich denn nicht, dass ich endlich einmal an deiner Seite auftreten darf?«