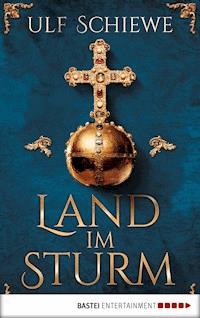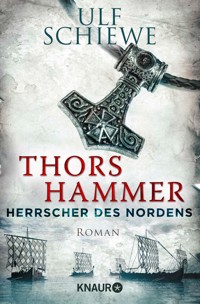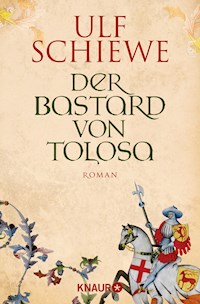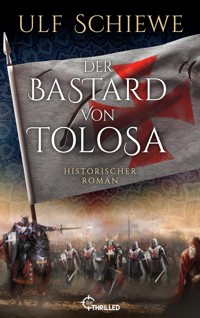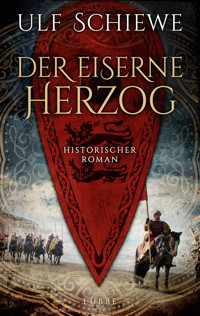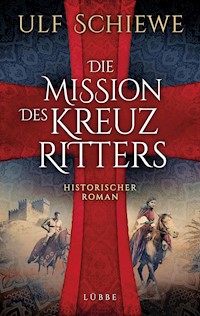9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Normannensaga
- Sprache: Deutsch
Süditalien 1054: Gerlaine, die Geliebte des jungen Normannen Gilbert, ist von Sklavenjägern entführt wurden. Die einzige Spur führt mitten in Feindesland nach Sizilien, dem Reich der Sarazenen. Nur zwei seiner Gefährten sind bereit, ihm zu folgen. Bald schon geraten sie in höchste Gefahr – Machtkämpfe zwischen Berberfürsten, tödliche Anschläge arabischer Gotteskrieger und die Heimtücke des berüchtigten schwarzen Emirs.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 571
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Ulf Schiewe
Der Schwur des Normannen
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Süditalien 1054: Gerlaine, die Geliebte des jungen Normannen Gilbert, ist von Sklavenjägern entführt wurden. Gilberts einzige Spur ist der schwarze Skorpion, eine geheimnisvolle Tätowierung, und die führt mitten in Feindesland - nach Sizilien, dem Reich der Sarazenen. Trotz aller Warnungen ist Gilbert fest entschlossen, seine Gerlaine zu suchen und heimzuholen. Nur zwei seiner Gefährten sind bereit, ihm zu folgen. Bald schon geraten sie in höchste Gefahr - Machtkämpfe zwischen Berberfürsten, tödliche Anschläge arabischer Gotteskrieger, die Heimtücke des berüchtigten, schwarzen Emirs. Doch Gilbert gibt nicht auf, auch wenn das heißt, den Krieg nach Sizilien zu tragen.
Inhaltsübersicht
Karte
In der Hitze Kalabriens
Unerwartetes Wiedersehen
Das geschändete Dorf
Die schöne Alberada
Heimliche Überfahrt
Gaukler und Sklavenhändler
Reise nach Taormina
Der Stich des Skorpions
Der dunkle Felsen
Verkauft wie Vieh
Die Fürstin von Catania
Die Burg im Meer
Der geheime Pakt
Wie ein Bruder
Der Burgfelsen
Monte Scalpello
Nachtangriff
Epilog
Die wichtigsten Personen der Normannen-Saga
Die Hauteville-Familie
Andere (historische) Normannen
Die Fürstenfamilie von Salerno
Fürsten der Sarazenen auf Sizilien
Fiktive Personen
Nachwort des Autors
In der Hitze Kalabriens
Manchmal steht man vor Entscheidungen, die einem alles abfordern, bei denen der Verstand nicht hilft, höchstens, auf das eigene Herz zu hören. Dabei weiß man oft vorher nicht, ob man etwas Ehrenhaftes tut oder ob man die größte Dummheit seines Lebens begeht. So ging es mir in jenen Tagen, von denen ich erzählen will.
Es war später Nachmittag und immer noch sengend heiß. Ich war schweißgebadet unter meinem schweren Kettenpanzer, und die gleißende Sonne über den Höhen der Montagna Magna schien mir unangenehm in die Augen. Mit zusammengekniffenen Lidern beugte ich mich im Sattel vor und trieb meine Stute Alba voran. Ich hatte es eilig.
Statt wie die anderen unten am Fluss im Schatten eines Baumes zu verschnaufen, hatte ich nichts Besseres zu tun, als diesen in der Hitze schwelenden Berg hinaufzureiten. Ich wollte so schnell wie möglich San Marco Argentano erreichen, dessen winzige Dächer weiter oben im grellen Licht des Südens glitzerten. Robert Guiscard hatte den Ort vor ein paar Jahren erobert und zur Festung ausgebaut. Und dort wartete jemand, so spürte ich, der mein Leben verändern würde.
Es war das Geständnis, das dieser Hundsfott Tancred mir gerade gemacht hatte, völlig überraschend und so unwahrscheinlich wie ein wirrer Traum. Und doch hatte er geschworen, dass es wahr sei. Und nun musste ich mich selbst überzeugen.
Die Getreidefelder und Olivenhaine der Ebene lagen längst hinter mir. Die Straße schlängelte sich steil bergan zwischen Büschen und niedrigem Baumbewuchs hindurch. Zikaden zirpten ihr eintöniges Lied. Rechts und links ragten grauweiße Felsbrocken aus dem Gestrüpp und warfen die aufgespeicherte Glut des langen Sommertages zurück, sodass es sich anfühlte, als ritte man durch einen Backofen. Albas verdrossenes Schnauben verriet, was sie davon hielt, sich in der Hitze abzumühen. Nicht nur der Anstieg machte ihr zu schaffen, auch die unregelmäßigen, in der Sonne hart gebackenen Karrenfurchen, die sich beim letzten Regen tief in den Weg gegraben hatten.
Wir waren nicht allein, denn am Seil führte ich Saura mit, mein zweites Pferd, eine kräftige Fuchsstute. Eigentlich war sie ein lebhaftes Tier, doch jetzt folgte sie nur widerwillig. Und auch mein struppiger Abruzzenhund Loki schleppte sich lustlos mit hängender Zunge dahin. Beide hatte ich während meines kurzen Aufenthalts in Salerno aufgegabelt. Saura war eines von Roberts vielen Ersatzpferden gewesen, und der Hund war mir zugelaufen.
Inzwischen war ich an einer flacheren Stelle angelangt. Hier standen Rebstöcke in sauberen Reihen hinter einer niedrigen, aus Feldsteinen aufgetürmten Mauer. Ein paar Hundert Schritte weiter und von dunklen Zypressen umgeben lag die Hütte des Weinbauers. Sein Wachhund bellte kurz, sonst war es still, als hätten Mensch und Tier sich vor der Sonnenglut verkrochen.
Hinter mir hörte ich Thore rufen, mein bester Freund unter den Kameraden, mit denen ich einst aus der Normandie in dieses Land gekommen war. Mehr als einmal verdankte ich mein Leben seinem Geschick mit dem Bogen. Warum ich es so eilig habe, brüllte er, und ich solle doch verdammt noch mal auf ihn warten.
Widerstrebend zügelte ich die Stute im Schatten einer mächtigen Pinie. Darunter stand ein steinernes Christenkreuz, vor dem ein Strauß vertrockneter Blumen lag. Wie überall in Italia waren auch in dieser Gegend die Menschen treue Anhänger des Gekreuzigten, wobei sie hier vor allem nach den Bräuchen der Ostkirche beteten. Den Unterschied habe ich bis heute nicht verstanden, obwohl die Christen ihn sehr ernst nehmen.
Ich sah mich nach Thore um, dessen helles Haar wie eine Fackel in der Sonne leuchtete. Dabei wanderte mein Blick über die im grellen Licht flimmernde Ebene des fiume Crati unter uns, mit ihren abgeernteten Weizenfeldern, Olivenhainen und kleinen Bauernhöfen. Weit im Osten waren im Dunst noch schwach die blauen Berge der Sila Greca zu erkennen. Zur Linken und in nördlicher Richtung die Umrisse eines mächtigen Gebirgszugs, den sie Pollino nennen. Zwischen beiden verwandelte sich die fruchtbare Ebene in fieberverseuchtes Sumpfland, durch das der Crati sich wand, bis er in weiter Ferne ins Ionische Meer strömte.
Ein sanftes Lüftchen wehte von dort herüber, aber viel zu schwach, um den Schweiß auf dem Gesicht zu kühlen. Irgendwo da unten musste das Dorf sein, in dem Gerlaine von Sarazenen geraubt und entführt worden war.
Ich hatte schon vor Wochen davon erfahren und war deshalb den langen Weg von Salerno hierhergekommen. Schließlich war sie einmal meine Liebste gewesen. Ich wollte nicht, wie andere, mich einfach mit der Sache abfinden, auch wenn ich ihr jetzt kaum noch helfen konnte. Immerfort verfolgten mich quälende Bilder. Gerlaine in Ketten auf dem Sklavenmarkt oder im Palast eines reichen Mauren, schlimmer noch, in einem Hurenhaus. Vielleicht wurde sie gerade in diesem Augenblick erniedrigt, geschlagen, gequält. Bei solchen Gedanken wurde mir ganz übel, und der Hass auf ihre Entführer wollte mir schier den Atem rauben.
Aber wer konnte wissen, wohin man sie verschleppt hatte? Überall mochte sie jetzt sein. In Palermo, Tunis oder Kairo. Orte, von denen ich gehört, aber keinerlei Vorstellung hatte. Wie sollte man sie jemals wiederfinden? Zu diesem Schluss war auch ich am Ende gekommen. Und außerdem: Hatte sie mich nicht verlassen und sich diesem verdammten Tancred an den Hals geworfen? Was sollte ich mich einmischen? Wenn, dann war er es, der zuständig war, der sich darum kümmern musste, was mit seinem Weib geschah. Unsinnig, überhaupt den langen Weg hierherzureiten.
So hatte ich gedacht in diesen letzten Tagen unserer Reise. Das heißt, bis wir heute Nachmittag eben diesem Tancred und seiner Patrouille über den Weg gelaufen waren. Bis er mich aufgeklärt hatte.
»Was zum Teufel ist denn los, Gilbert?«, rief Thore, als er endlich bei mir angekommen war. Er fluchte über die Hitze und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Was hat Tancred dir geflüstert, dass du wie ein Wilder losgeritten bist?«
Ich wies mit dem Kopf auf die fernen Festungsmauern über uns. »Es scheint, dass ich einen Sohn habe. Dass er da oben auf mich wartet.«
Thore tippte sich an die Stirn. »Einen Sohn? Verdammt, Gilbert, für Witze ist es zu heiß.«
Es war in der Tat zu heiß. Die Gäule standen lustlos mit hängenden Köpfen da. Nicht einmal das frische Gras ein paar Schritte weiter schien sie zu locken. Thore zog den Stöpsel aus seiner Feldflasche und nahm einen langen Zug. Dabei lief ihm Wasser in den blonden Bart. Den Rest goss er sich über Kopf und Gesicht. Er war ein gut aussehender Kerl mit kräftigen Armen und breiten Schultern, der unbekümmert durchs Leben schritt, immer gern mit einem Scherz auf den Lippen. Er hatte so einen Blick an sich, der die Weiber schwach werden ließ. Eine Tatsache, die er schamlos ausnutzte.
»Ich wollte es zuerst auch nicht glauben. Aber Tancred behauptet, nicht er, sondern ich sei der Vater. Und das Kind sehe mir ähnlich.«
»Das will er dir weismachen? Aber Gerlaine hat doch ihn geheiratet und nicht dich.«
»Das haben sie alle Welt glauben lassen, damit es besser aussieht. In Wirklichkeit wollte sie gar nicht heiraten. Und dass der Junge von mir ist, hat sie ihm am Ende gebeichtet. So behauptet er jedenfalls.«
»Hol mich doch der Teufel!«
»Das hab ich auch gedacht. Aber warum sollte er lügen? Und natürlich ist er wenig erfreut darüber, um es milde auszudrücken.«
»Warum ist sie dann nicht bei dir geblieben, das verrückte Weib? Wenn sie doch von dir schwanger war?«
»Das fragst du noch? Wegen Hermelinda natürlich.«
Hermelinda und Geretrudis waren zwei hübsche Schwestern in Melfi, mit denen Thore, immer flott mit den Weibern, angebändelt hatte. Sogar gewohnt hatte er eine Weile bei ihnen. Sein Liebchen war Geretrudis gewesen. Und ich war ein paarmal bei ihrer Schwester schwach geworden. Das war, als Gerlaine ein Jahr lang hier in Argentano im Dienste von Roberts Frau verbracht hatte. Dabei hatte ich ihr vorher hoch und heilig die Treue geschworen. Irgendjemand musste ihr meinen Fehltritt geflüstert haben, und als ich dann von der Schlacht bei Civitate heimgekehrt war, war sie verschwunden. Zurück nach Argentano, hieß es. Ich solle mich zum Teufel scheren und nie wieder blicken lassen, hatte sie mir von Maria, der Schankmagd, ausrichten lassen.
»Scheiße!« Thore grinste gequält. »Tut mir immer noch verdammt leid, dass ich dich da reingeritten habe. Aber wenn man sich auf eines verlassen kann, dann ist es, dass die Weiber tratschen. Trotzdem. Sie ist ein verdammter Hitzkopf. Sich so einfach ohne ein Wort davonzumachen. Sie wollte sich wohl rächen.«
»Wäre damals nicht Roberts eiliger Auftrag gewesen, hätte mich nichts gehalten, ihr nachzureiten. Als ich es endlich konnte, hieß es, sie habe diesen Tancred geheiratet.«
Thore lachte. »Tancred, die Wühlmaus.«
Das war, als wir zuerst nach Kalabrien gekommen waren, eine abgerissene Truppe von drei Dutzend beutegierigen Kerlen. Roberts Bruder hatte ihm diese verlotterte Burg nahe Cassano zugewiesen, Scribla hieß sie. Ein Teil ihrer kleinen Besatzung war an den Dämpfen aus den Fiebersümpfen erkrankt, die anderen der Trunksucht verfallen und den Huren, mit denen sie gehaust hatten, umgeben von ihrem eigenen Unrat. Robert war so wütend auf Tancred, ihren versoffenen Anführer, geworden, dass er ihn verprügelt und zum Teufel geschickt hatte. Aber der hatte nicht gehen wollen, und am Ende hatte Robert nachgegeben. Um sich seiner würdig zu erweisen, hatte der Mann tagelang ohne Essen oder Schlaf ganz allein geschuftet und eigenhändig den Burggraben vertieft. Das hatte uns Bewunderung abgerungen, und seitdem vertraute Robert ihm.
Auch ich musste lachen. »Wühlmaus ist gut. Weißt du noch, wie er ausgesehen hat? Schwarz vor Dreck von oben bis unten.« Aber dann wurde ich wieder ernst. »Ausgerechnet der ist jetzt der große Kastellan von Argentano und hat mir Gerlaine weggeschnappt.«
»Nur heiraten wollte sie ihn nicht.«
»Er meint, er habe schon gemerkt, dass sie immer noch mich im Kopf hatte. Das hat ihn verrückt gemacht. Und zuletzt habe sie es zugegeben. Klar, dass er sich aufs Kreuz gelegt fühlt.«
Eigentlich war ich nach Argentano gekommen, um mich mit diesem Kerl zu prügeln, Kastellan oder nicht. Dafür, dass der Hund nicht besser auf sie aufgepasst hatte. Doch nachdem er mir heute Nachmittag sein Leid geklagt hatte, hatte ich es nicht mehr gekonnt. Verdammt noch mal, die Weiber wissen oft nicht, was sie einem antun. Auch ein Tancred hatte das nicht verdient.
»Sie hat euch beide hintergangen«, sagte Thore. »Dich lässt sie sitzen und verheimlicht dir dein Kind. Und ihm wollte sie es unterschieben. Möchte wissen, was sie sich dabei gedacht hat.«
»Ist doch irgendwie auch meine Schuld. Hermelinda konnte sie mir nicht verzeihen. Du weißt, wie stolz sie ist.«
Gerlaine stammte aus unserem Dorf in der Normandie. Nachdem ihre Mutter gestorben war, hatte sie es nicht mehr bei ihrem griesgrämigen Stiefvater ausgehalten. Unbedingt hatte sie mit Roberts kleiner Truppe mitkommen wollen, die aufgebrochen war, um der Rache des Herzogs zu entfliehen. Wegen seiner Beteiligung an jenem blutigen Aufstand. Während des langen Marsches ins Mezzogiorno war Gerlaine allen ans Herz gewachsen. Mich aber hatte sie geliebt. Auch wenn es bei dieser Liebe nicht immer ohne Stürme abgegangen war. Denn Gerlaine war kein Mädchen, das sich von einem Kerl herumschubsen ließ.
»Ja, stolz ist sie«, sagte Thore. »Aber vor allem eigensinnig wie ein Esel. Und für eine Hellsichtige nicht besonders klug, wie mir scheint.«
Gerlaine hatte oft dunkle Ahnungen über Dinge, die in der Zukunft lagen. Selten irrte sie sich, weshalb die Kameraden sie mit besonderem Respekt behandelt hatten. Sie konnte auch die Runen legen und einem Mann daraus sein Schicksal lesen.
Ich zuckte mit den Schultern. »Solche Menschen wissen aus ihrer Gabe oft keinen eigenen Nutzen zu ziehen. Das ist doch bekannt. Außerdem steckt mehr hinter ihrem Verhalten, als du vermutest. Aber das erzähle ich dir ein andermal.«
Er warf mir einen spöttischen Blick zu. »Die Wahrheit ist, mein Lieber, dass du ihr einfach alles verzeihst.«
Was sollte ich darauf antworten? Ich wusste nur, dass mir seit Langem das Herz wehtat. Dass ich sie trotz allem nicht vergessen konnte. Deshalb ärgerte mich seine Bemerkung.
»Sag mal, wie redest du eigentlich von ihr? Sie ist doch eine von uns. Denkst du, sie hat es verdient, von Sklavenjägern geraubt zu werden?«
»Natürlich nicht. So war das auch nicht gemeint.«
»Kannst du dir vorstellen, wie ein Stück Fleisch verkauft und missbraucht zu werden?«, rief ich aufgebracht. »Ausgerechnet Gerlaine, der ihre Freiheit immer kostbar war. Jetzt werden die verfluchten Sarazenen sie nach Lust und Laune begrapschen, erniedrigen und schänden. Und wenn sie sich auflehnt, wird sie verprügelt. Du hast doch selbst gesehen, was sie mit ihren Sklaven machen.«
Im Hafen von Salerno waren wir Zeuge eines hässlichen Vorfalls geworden, als man Gefangene völlig nackt und in Ketten von einer maurischen Galeere geführt hatte, um sie vor Ort zu verkaufen. Einer jungen Frau hatte man vor allen Leuten genüsslich zwischen die Beine gegriffen, angeblich um zu sehen, ob sie noch Jungfrau war. Und als sie sich gewehrt hatte, war sie brutal zusammengeschlagen worden.
Thore senkte betroffen den Blick. »Ich weiß«, sagte er leise.
»Und was ist mit dem Kind? Es braucht doch seine Mutter.«
»Aber was zum Teufel willst du tun? Du kannst sie schließlich nicht wieder herzaubern.«
Nein, zaubern nicht. Aber etwas anderes konnte ich tun. »Ich muss sie finden und zurückbringen.«
Thore starrte mich entgeistert an. Dann lachte er wie über einen guten Scherz. »Du hast wohl den Verstand verloren. Sie ist weg, Alter. Weg und verschwunden, niemand weiß, wohin. Diese Kerle kommen in Schiffen, handeln mit Sklaven im ganzen Mittelmeer. Das ist ein großes Geschäft, und wer weiß, wohin die sie verkauft haben. Tut mir leid, aber schlag dir diesen Unsinn aus dem Kopf.«
Natürlich war es Unsinn. Ich war mir meiner Sache auch überhaupt nicht sicher und hatte nicht die leiseste Ahnung, wie ich es anstellen sollte. Und trotzdem. Da war dieses unbestimmte Gefühl in mir, dass ich es versuchen musste.
»Ich werde sie finden«, erwiderte ich trotzig und gewiss auch etwas leichtfertig. »Ich schwöre es dir, verdammt noch mal.«
Mein Freund schüttelte nachsichtig den Kopf. »Mit dem Schwören solltest du vorsichtig sein, Gilbert. Das hat so manchen schon um Kopf und Kragen gebracht.«
»Na und?«, rief ich hitzig, denn dass er meine Worte nicht ernst nahm, sie für dummes Gerede hielt, das stachelte mich nur noch mehr an. »Ich sage dir, Thore, ich schwöre es bei Odin und bei allen Göttern. Ich finde sie und bringe sie heim!«
Ich war noch in einem Alter, in dem man meint, die Welt einreißen zu können. Vor allem aber hatte ich Gerlaine im Kopf. Jetzt mehr denn je, seit ich wusste, dass ihr noch etwas an mir lag. Es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn ich sie nicht finden könnte, so dachte ich in meinem Leichtsinn.
»Hör zu, Gilbert. Es ist verdammt traurig für Gerlaine. Aber du bist jetzt Vater. Fast beneide ich dich darum. Aber nur fast.« Thore lachte kurz auf. Der Gedanke, Vater zu sein, schien ihn zu belustigen. Aber gleich wurde er wieder ernst. »Willst du dein Leben bei einem aussichtslosen Unterfangen aufs Spiel setzen? Selbst in dem völlig unwahrscheinlichen Fall, dass du sie findest, meinst du, die Bastarde würden sie dir überlassen? Die bringen euch beide um. Was hättest du damit gewonnen, eh?« Er packte mich am Arm. »Du musst jetzt an das Kind denken und ihm die Mutter ersetzen. Ob du’s willst oder nicht, du hast einen Sohn und Erben. Das heißt Verantwortung. Du wirst für ihn sorgen müssen, ihn aufziehen, ihm Dinge beibringen.«
Ich starrte ihn an. Das war mir noch gar nicht so recht bewusst geworden, aber natürlich hatte er recht. Tancred hatte mir schon deutlich zu verstehen gegeben, dass er den Bankert, wie er den Kleinen nannte, lieber heute als morgen loswerden wollte. Doch was bei allen Göttern sollte ich mit einem Kind anfangen? Ich fühlte mich überrumpelt. War ich nicht viel zu jung dafür? Vierundzwanzig war ich und hatte keine Ahnung von Kindern. Auf unseren Kriegszügen konnte ich ihn wohl schlecht mitnehmen. Wer sollte ihn versorgen?
Aber was half’s? Nun gab es ihn, diesen Sohn, und er hatte niemanden mehr außer mir. Mit einem Mal spürte ich eine ungewohnte Last auf den Schultern.
»Jetzt glotz nicht so blöd«, grinste Thore, den mein Gesichtsausdruck belustigte. »Wie heißt er eigentlich, dein Kleiner?«
»Sie hat ihn Ivo genannt. Nach ihrem Großvater.«
»Guter Name. Knapp und kurz. Komm, wir gehen ihn uns ansehen, deinen Ivo. Wer kümmert sich eigentlich um ihn?«
»Eine Amme in Tancreds Haus.«
»Also los!«, rief er und gab seinem Pferd die Fersen. »Vergiss deinen dummen Schwur. Niemand außer mir hat ihn gehört. Und ich sag’s nicht weiter.« Er lachte.
Mit äußerst gemischten Gefühlen folgte ich ihm.
Von Nordosten kommend ritten wir zur Hügelkuppe hinauf und dem Städtchen entgegen. Auf den Hängen um uns herum das silbrige Laub von Olivenbäumen, dazwischen Zypressen, die wie dunkle Kerzen in den Himmel ragten. Wein und Gemüse gediehen in von Steinmauern geschützten Terrassen. Die Hitze setzte uns weiterhin zu, und so konnten wir es kaum erwarten, in den Schatten der Häuser zu gelangen.
Auf halber Strecke kam uns eine Bauernfamilie entgegen. Ihre Erzeugnisse mussten sie losgeworden sein, denn die aus Weidenzweigen geflochtenen Tragekörbe, die der Alte und sein Sohn auf dem Rücken trugen, waren leer. Ein barfüßiger kleiner Junge starrte uns mit großen Augen an. Die Mutter zerrte ihn hastig aus dem Weg, und auch die Männer machten Platz, grüßten ehrerbietig mit der Mütze in der Hand und warteten, bis wir an ihnen vorübergeritten waren.
»Ich frage mich, was sie über uns denken«, sagte ich zu Thore. »Wir müssen ihnen doch ziemlich fremd vorkommen.«
»Die blonden Teufel aus dem Norden, meinst du?«
»Na ja, wir fallen über sie her, machen uns auf ihrem Land breit und tun so, als sei es unser.«
»Es ist unser, solange kein Stärkerer kommt. Oder willst du etwa die Welt verändern, Gilbert? Diese Leute sind gewohnt, zu kriechen und zu dienen. Seien wir mal ehrlich, das Land ist noch nie ihr eigenes gewesen. Vorher wurden sie von Lombarden und Byzantinern geknechtet. Jetzt sind wir dran.«
Das stimmte natürlich, obwohl Robert sich bemühte, Plünderungen zu vermeiden und eine gewisse Ordnung walten zu lassen. An seine Anführer und an verdiente Krieger hatte er Land verteilt. Einiges davon hatte vorher byzantinischen Landbesitzern gehört, denen keiner eine Träne nachweinte. Das meiste aber gehörte den kleinen Gemeinschaften von Bauern, die mit ihren bescheidenen Äckern nur mäßig über die Runden kamen. Die waren jetzt neuen Herren ausgeliefert. Vielleicht bekamen sie es mit der Angst zu tun, wenn sie uns sahen oder den Hufschlag unserer Pferde hörten. Ich wusste, wie sich das anfühlte, war ich doch selbst schon als Fünfjähriger Opfer eines nächtlichen Raubüberfalls fremder Krieger geworden. Aber auch ohne Schwert kann man wehrlosen Bauernfamilien Gewalt antun, wenn man ihnen ihr Saatgut oder ihre letzte Kuh nimmt. Ich hatte oft genug erlebt, wie es ist, wenn die Ernte verregnet ist und der Hunger an den Gedärmen nagt.
»Sind wir denn Besseres, nur weil wir Waffen tragen?«
»Du grübelst zu viel, Gilbert. Ich wette, es ist denen gleich, wer über sie herrscht. Solange man sie anständig behandelt und ihnen genug zum Leben lässt.«
»Das ist ja wohl das Mindeste«, brummte ich. »Bauern, die verhungern, nützen niemandem.«
An einer Stelle, von wo aus wir das Ausmaß der Befestigungen überblicken konnten, hielt Thore sein Pferd an. »Hier hat Robert seinem Spitznamen mal wieder alle Ehre gemacht.«
Ganz recht, denn das war es, was Guiscard bedeutete – das Schlitzohr. Diesen Beinamen trug er seit seiner Jugend. Der Mann scheute wahrlich keine Schlacht, aber wenn er sein Ziel durch List und Schläue erreichen konnte, freute es ihn diebisch. Und mittlerweile rankten sich Legenden um solche frechen Streiche, manche wahr, andere erfunden. Auch Argentano war eines Nachts nach langer, ergebnisloser Belagerung durch die Bestechung eines Wachhabenden gefallen, der eine Strickleiter über die Mauer gehängt hatte. Als die Stadt plötzlich vor Normannen wimmelte, hatten die Bewohner sich kampflos ergeben und selbst die byzantinische Besatzung entwaffnet.
Argentano ist eine römische Gründung, angeblich nach alten Silberminen in der Gegend benannt. Unsere Männer hatten lange danach gesucht, aber nichts gefunden.
»Vielleicht gibt es ja doch Silber in den Bergen«, meinte Thore. »Stell dir vor, wir würden eine Ader finden.«
Ich schüttelte den Kopf. »Die wäre schon längst ausgebeutet. Nein, das ist nur Gerede. Es soll mal eine Familie gegeben haben, die so hieß. Silber gibt’s hier jedenfalls nicht.«
Wir näherten uns der Wehrmauer, an manchen Stellen brüchig und verwittert, hier und da von Kraut überwuchert, aber hoch genug, um ein ernstes Hindernis darzustellen. Besonders auf diesem abschüssigen Gelände. Über der Mauer waren ziegelgedeckte Dächer nach römischer Art zu sehen und der Kampanile einer Christenkirche.
An der Ostseite der Stadt erhob sich Roberts neue Burg, zu deren Errichtung Hunderte von Bauern verpflichtet worden waren. Sie stand außerhalb der ursprünglichen Befestigung, war aber durch eine Mauererweiterung mit ihr verbunden und sah so eindeutig normannisch aus, als hätte man sie aus dem Norden hierher verpflanzt. Auf einer gewaltigen, kegelförmigen Motte, angehäuft aus Erdreich und Felsgestein und dazu noch von Mauer und Graben geschützt, stand ein mächtiger Holzturm, den man nur über eine schmale, hölzerne Brücke von der Stadt aus erreichen konnte. Sollten die Stadtmauern fallen, würden sich die Verteidiger hier noch lange halten können. Nur gegen Feuer war der Turm empfindlich. Weshalb es Pläne gab, ihn durch einen steinernen zu ersetzen.
Erstaunlich, was Robert in so kurzer Zeit zustande gebracht hatte. Nicht länger musste er als marodierender Raubritter sein Dasein fristen. Seine Taten in Kalabrien und besonders sein tapferer Einsatz während der Schlacht bei Civitate hatten ihm Respekt eingebracht, und so war er unter seinem Bruder Onfroi zu einem der wichtigsten Anführer der Normannen aufgestiegen.
Überhaupt hatte der Sieg bei Civitate unsere Stellung im Land mehr als gefestigt. Normannen beherrschten jetzt weite Gebiete im Landesinneren, die vormals zu lombardischen Fürstentümern oder zum byzantinischen Apulien und Kalabrien gehört hatten. Das mächtige Konstantinopel hätte gewiss ein Heer schicken können, um uns zu vertreiben, wenn das Oströmische Reich nicht vollauf damit beschäftigt gewesen wäre, sich Petschenegen und Seldschuken vom Leib zu halten, die seine Nord- und Ostgrenzen bedrohten. Truppen für Italia waren nur in geringem Umfang abkömmlich.
Dennoch war es uns bisher nicht gelungen, die reichen Küstenstädte einzunehmen und zu halten. Trotz Zulauf aus der Heimat fehlte es weiterhin an Kriegern, besonders aber an schwerem Belagerungsgerät. Selbst wo eine Erstürmung gelungen war, hatte sich die Einwohnerschaft bald erhoben und die normannische Besatzung wieder vertrieben oder gemeuchelt. Zu sehr war dort die Bevölkerung griechisch geprägt, zu verflochten mit den Oberen aus Konstantinopel. Auch Robert war es bisher nicht gelungen, mehr als weite Teile der Flusslandschaft des Crati zu kontrollieren.
Immerhin war dafür Argentano ein ausgezeichneter Stützpunkt. Leicht zu verteidigen, strategisch gut gelegen und groß genug, um eine beträchtliche Kriegerzahl zu versorgen. Von der obersten Plattform des neuen Turms spähten Wachen ins Tal hinab. Nichts konnte sich im meilenweiten Umkreis unbemerkt bewegen. Für größere Entfernungen waren schwer bewaffnete Patrouillen unterwegs. Die durchstreiften die Ebene, hielten nach feindlichen Truppen Ausschau und sammelten Tribute und Schutzgeldzahlungen der umliegenden Ortschaften ein.
Diese Einkünfte erlaubten es Robert, sein kleines Heer zu erweitern und seine Krieger großzügig zu entlohnen. Doch das war nicht der einzige Grund, warum Männer zu ihm hielten, sondern auch seine furchtlose Entschlossenheit, seine Klugheit und die Gewohnheit, nichts von seinen Leuten zu verlangen, was er nicht selbst zu leisten bereit war. Er war ein geborener Anführer, dem sie alles zutrauten.
Ich gab meiner Alba die Sporen, denn ich hatte genug von Turm und Mauern gesehen. »Komm jetzt«, rief ich über die Schulter. »Ich will endlich zu meinem Kind.«
Zu meinem Kind. Welch ungewohnte Worte. Sie hallten lange in mir nach. Nicht ohne ein beklemmendes Gefühl in der Brust, denn fast fürchtete ich mich davor, an die Wiege dieses Kindes zu treten, das so plötzlich in mein Leben getreten war. Doch ich war entschlossen, es gleich hinter mich zu bringen. Dann würde ich über die Sache nachdenken und mich dabei gründlich besaufen. Passierte einem ja nicht alle Tage, dass man auf diese Weise Vater wurde.
Das große Stadttor stand weit offen. Man erwartete uns, neugierig, wer wir sein mochten. Umso größer die Freude, als wir auf alte Kameraden stießen.
Da war Odo, ein graubärtiger, kampferprobter Recke, der schon lange im Land war und bereits vor vielen Jahren mit Roberts Brüdern Drogo und Williame in Sicilia gegen die Mauren gekämpft hatte. Ein ruhiger, wortkarger Geselle, den kaum etwas erschüttern konnte. Und dann vor allem der überschwängliche Pali, einer der albanischen Flüchtlinge aus den Bergen, die wir damals aus Mangel an Kriegern samt Familien in unsere Truppe aufgenommen hatten. Ihn zierte ein unbändiger, schwarzer Haarschopf, der ihm bis tief in die Stirn wuchs, dazu Augenbrauen so dick wie seine wurstigen Zeigefinger.
»He, ihr Teufelskerle! Willkommen in Argentano.« Er umarmte uns strahlend, nachdem wir von den Pferden gestiegen waren. »Ist gut, euch wiederzusehen.«
Sein Fränkisch war fließend, wenn auch von seiner Muttersprache gefärbt, was auch immer sie in Albanien sprechen mochten.
»Wie geht’s deinem Weib, Pali?«, fragte Thore. »Ich wette, du hast ihr noch ein paar Gören gemacht. Wie viele sind es denn jetzt?«
»Acht sind es. Jedes Jahr eines«, erwiderte der nicht ohne Stolz. »Man muss die Frauen beschäftigt halten, sonst fangen sie an zu grübeln. Und alle Kinder sind gesund, keines gestorben.«
»Einen Bauch hast du dir auch angefressen, wie ich sehe. Robert verwöhnt dich.«
»Kann nicht klagen, Mann. Und wie steht’s mit dir? Immer noch auf der Suche nach einem Weib?«
»Was heißt auf der Suche?«, entrüstete sich Thore. »Kann mich kaum retten vor Weibsbildern. Bin gekommen, mich mal auszuruhen.«
Pali lachte ausgelassen über solche Sprüche. »Dann bist du bei uns falsch.« Er senkte verschwörerisch die Stimme. »Weiber laufen hier rum, da läuft einem das Wasser im Maul zusammen.«
»He, du Herzensbrecher. Halt dich lieber an dein Eheweib, sonst stutzt sie dir die Ohren. Oder schlimmer, sie setzt dir Hörner auf deinen albanischen Dickschädel.«
»Von wegen! Mein Weib bekommt, was ihr zusteht. Was denkst du, warum ich so viele Blagen habe?«
Allgemeines Gelächter war die Antwort.
Achtfacher Vater! Bei Odin, ich war beeindruckt, obwohl seine Witze in den Jahren nicht besser geworden waren. Zumindest hatte er sich trotz seiner bescheidenen Herkunft zum Unterführer gemausert.
»Wo ist Tancreds Haus?«, unterbrach ich ihre Blödelei.
»Der ist nach Norden geritten, Gilbert. Mit einer Patrouille. Sie müssten in ein paar Tagen zurück sein.«
»Weiß schon. Wir sind ihnen gerade über den Weg gelaufen. Sie rasten noch unten am Fluss und werden bald nachkommen. Also sag schon. Wo ist sein Haus?«
»Was willst du denn da?«, wollte Pali etwas verunsichert wissen. Schließlich war Tancred sein Kastellan und würde es nicht gerne sehen, wenn er jeden Hanswurst in sein Haus ließe. Andererseits war ich ein Hauteville, und mit so einem wollte er es sich auch nicht verscherzen. »Solltet ihr nicht besser warten, bis er hier ist?«, fragte er vorsichtig.
»Er hat mir erlaubt, nach Gerlaines Sohn zu sehen.«
»Ah, Gerlaine.« Bei dem Namen machte er ein betrübtes Gesicht. »Habt ihr schon gehört?«
»Haben wir«, sagten Thore und ich im Chor.
»Schrecklich, schrecklich.« Pali schüttelte den Kopf. Dann schien ihm einzufallen, dass Gerlaine und ich aus demselben Dorf stammten und ein Paar gewesen waren. Er lächelte verständnisvoll. »Du bist bestimmt Klein Ivos Pate.«
Ich nickte, denn obwohl kein Christ, wusste ich natürlich, was ein Taufpate war, und die kleine Lüge durfte mir gestattet sein.
»Na gut«, sagte er. »Ich führe euch hin. Ist nicht weit.«
»Ich kümmere mich um die Gäule«, meinte Odo und winkte einen Knecht heran.
»Lass auch unser Gepäck bringen«, warf Thore über die Schulter, als wir uns auf den Weg machten.
»Warum nächtigt ihr nicht in Roberts Palast?«, fragte Pali. »Du bist doch sein Schildträger, Gilbert.«
»Nicht mehr«, brummte ich ohne weitere Erklärung.
Er sah mich verwundert an, merkte aber an meiner Miene, dass es besser war, keine Fragen zu stellen. Ich würde in diesen Tagen überall mein Lager aufschlagen, nur nicht in Roberts verdammtem Haus. Nicht nach dem gewaltigen Streit, den wir gehabt hatten. Ja, wir hatten uns gestritten. Fürchterlich sogar. Er hatte mich niedergeschlagen in seiner Wut. Woraufhin ich ihm meinen Schild mit den Hauteville-Farben vor die Füße geworfen hatte. Jetzt war ich nur noch einfacher Krieger. Aber das ging Pali nichts an.
»Außerdem hat Tancred uns eingeladen«, fügte ich hinzu.
Das stimmte zwar nicht, aber Pali konnte das nicht wissen. Wir wanderten durch die engen Gassen, die immer noch bergauf führten. Unter dem linken Arm trug ich meinen Helm, ein kostbares Stück, das ich mir in Melfi hatte anfertigen lassen, und mit der Rechten führte ich Loki an der Leine.
Pali redete die ganze Zeit, wie leid es allen täte, dass man Gerlaine geraubt hatte, aber sie hätte natürlich nicht ohne Schutz in dieses verdammte Dorf reiten sollen. Man habe versucht, die Sklavenjäger zu stellen, aber vergeblich. Es habe sogar Verluste dabei gegeben. Ich hörte nur halb hin, denn das wusste ich alles schon. Die Leute in den Gassen bedachten uns mit neugierigen Blicken, wichen aber scheu aus, wenn wir ihren Weg kreuzten. Besonders um Loki machten sie einen Bogen, denn der konnte durch seine Größe recht einschüchternd wirken.
»Was ist das für ein Hund, Gilbert?«
»Ist mir zugelaufen.«
Pali war ein netter Kerl, aber ich war jetzt nicht in der Stimmung, ihm von unseren Abenteuern in Salerno zu berichten, wo mir dieser streunende Straßenköter das Leben gerettet hatte und nachher nicht mehr abzuschütteln gewesen war. Mit der Zeit hatte ich mich an das Viech gewöhnt. Wenn ich ihn nicht an der Leine hielt, kam und ging er, wie es ihm passte, tauchte auf, wenn man es am wenigsten erwartete. Wie Loki, der verschlagendste und unberechenbarste der Götter. Deshalb hatte ich ihn auch so genannt. Inzwischen waren wir aber gute Freunde geworden, und ich mochte ihn nicht mehr missen.
Auf dem Marktplatz herrschte buntes Treiben, denn mittlerweile war es etwas kühler geworden und die umliegenden Häuser warfen lange Schatten über die Piazza. Obst und Gemüse wurden feilgeboten, Hühner in Käfigen, frisch geschlachtete Zicklein, Töpfe und Pfannen, grobes Tuch und Küchengerät. Die Händler priesen lautstark ihre Waren an, eine alte Frau brutzelte Fleischspießchen auf einem Rost, Scherze flogen hin und her. Man beachtete uns kaum. Auch unter den neuen Herren ging das Leben hier einfach weiter. Nur ein bärtiger Priester beäugte uns misstrauisch, während er unablässig an seinem Rosenkranz fingerte. Vom Kirchturm schallte eine Glocke, und im Hintergrund überragte Roberts Turm die Dächer, wie um die Argentanos daran zu erinnern, wer hier das Sagen hatte.
Pali wies auf ein großes Haus in römischem Stil. »Palast des einstigen Statthalters. Den und seine Familie hat Guiscard gegen gutes Silber ausgelöst. Jetzt wohnt er selbst dort, wenn er zugegen ist. Und hier gegenüber ist Tancreds bescheidene Hütte.« Das war spöttisch gemeint, denn der Bau, auf den er zeigte, stand Roberts Palast in wenig nach, außer dass er kleiner war. »Vorher hat hier der Hauptmann der byzantinischen militia gehaust.«
»Die Stadt scheint nicht von Armen bewohnt zu sein«, bemerkte Tancred, der sich neugierig umsah.
Pali nickte zustimmend. »Argentano ist nicht groß, aber nach Bisignano der wichtigste Ort im nördlichen Crati-Tal. Hier wird viel mit Getreide gehandelt, Olivenöl und Wein.« Er deutete in die Richtung des Wehrturms. »Da drüben ist das Judenviertel. Da wohnen die reichsten Händler. Und die Seidenfärber. Die verkaufen ihre Waren bis nach Rossano und Reggio.«
Das wollte ich alles gar nicht wissen und erinnerte unseren geschwätzigen Freund daran, warum wir hier waren. Er unterbrach seinen Redeschwall und führte uns zu Tancreds Haus hinüber, vor dessen Tor zwei Mann Posten standen. Pali wechselte einen Scherz mit ihnen, dann betraten wir das Innere durch einen kurzen Gang, der in ein schattiges atrium führte.
Es war ein nach römischer Bauart entworfenes, zweistöckiges Haus, wie man sie häufig hier im Süden trifft. Luftige Bogengänge umgaben das atrium. Offene Türen erlaubten einen Blick in geräumige Gemächer. Auf dem mit Mosaik ausgelegten Boden standen bequeme Lehnstühle.
»So also lebt jetzt die Wühlmaus«, sagte ich.
Thore musste lachen. Pali aber verstand den Scherz nicht und sah mich nur verständnislos an. Als ein Hausdiener erschien, trug er ihm auf, Wasser, Wein und etwas Obst zu bringen.
»Setzt euch«, sagte er. »Wollt ihr Schinken und Käse? Es gibt hier einen einzigartigen Käse. Der ist aus der Milch von Kühen, die zum ersten Mal gekalbt haben. Mild und unglaublich sahnig. Ein Genuss, sag ich euch.« Es fehlte nicht viel und er hätte sich die Finger geleckt.
»Vielleicht später, Pali«, sagte ich ungeduldig und warf meinen Helm auf einen der Stühle. »Ich will jetzt endlich das Kind sehen.«
Er nickte. »Ich rufe die Amme.«
Während Thore sich niederließ und die Beine von sich streckte, brüllte Pali lauthals nach einer Alessa, die nach kurzer Zeit auch erschien.
»Ich bitte euch, Signore«, sagte sie in holprigem Lombardisch und legte den Finger auf die Lippen. »Der Kleine schläft.«
Sie war ein junges Bauernweib, das ihr eigenes Kind verloren hatte, wie wir erfuhren, und sich um den kleinen Ivo kümmerte, der nicht mehr als fünf Monate alt war. Etwas linkisch und schüchtern stand sie da. Ihre Mundart war nicht leicht zu verstehen, vermutlich stark mit Griechisch durchsetzt, aber Pali, der hier schon länger lebte, half aus. Und als Thore sie freundlich anlächelte, entspannte sie sich ein wenig.
Sie trug einen groben Rock, darüber ein leichtes Baumwollhemd, das ihre geschwollenen Brüste eher betonte als verbarg. Unsere Gegenwart machte sie verlegen. Die Wangen waren vor Aufregung ganz rot, ansonsten hatte sie matte Haut und schwarze Haare, war wohl von griechischem Blut wie die meisten hier im Süden, nicht sehr groß, aber im Ganzen recht ansehnlich.
Pali stellte mich als Ivos Paten vor. Bemüht, meine Unruhe zu verbergen, bat ich Alessa, mir den Kleinen zu zeigen. Sie zögerte. Erst als Pali ihr aufmunternd zunickte, bedeutete sie mir scheu, ihr zu folgen.
Ich reichte Thore die Hundeleine. »Pass auf, dass er keine Dummheiten macht.«
Alessa führte mich durch den langen Bogengang an mehreren Türen vorbei, dann in den hinteren Teil des Hauses. Es war größer, als es von außen den Anschein hatte. Neben der Küche führte eine kleine Stiege in den zweiten Stock. Meine Stiefel polterten auf den Stufen, das Schwert verhakte sich im Geländer, und ich kam mir verschwitzt und unförmig in meinem Panzer vor, überhaupt ganz fehl am Platz. Besonders neben der zierlichen Amme, die oben auf dem Treppenabsatz auf mich wartete.
Dieser Bereich des Gebäudes musste der Dienerschaft vorbehalten sein. Sie öffnete die Tür zu einer bescheidenen Kammer, in der gedämpftes Licht herrschte. Nur ein kleiner Strahl der späten Nachmittagssonne drang durch die angelehnten Läden. In einer Ecke, auf einer großen, flachen Truhe, standen Krug und Waschschüssel, daneben ein Lehnstuhl und an der Seite ein einfaches Bett, vermutlich Alessas Schlafstatt. Und unter dem Fenster eine Wiege, aus gutem Holz geschnitzt und liebevoll bemalt. Aus ihr tönte ein kindliches Glucksen. Mein Herz begann zu klopfen.
»Er ist aufgewacht«, flüsterte Alessa und lächelte schüchtern, aber nicht ohne Stolz. Sie schien das Kind zu lieben.
Vorsichtig, mit angehaltenem Atem, trat ich näher und beugte mich über den Rand der Wiege. Auf Kissen gebettet und nur in eine leichte Windel gewickelt lag ein blonder Säugling. Seine Winzigkeit, sein rosiges Mäulchen, die zarte Haut, das waren die ersten Eindrücke von meinem Söhnchen. Seine kleine Brust hob und senkte sich unmerklich, während er tief in die Betrachtung der gegenüberliegenden Wand versunken war. Ab und zu ruderte er mit den weichen Ärmchen und gurrte leise vor sich hin.
Ich wagte kaum, mich zu bewegen. Da bemerkte mich das Kind, drehte sein Köpfchen und starrte mich aus runden, leuchtend blauen Augen an. Der Blick war so eindringlich, als wollte es mein ganzes Wesen erforschen. Plötzlich aber flog der Hauch eines schiefen Grinsens über das kleine Gesicht. Es dauerte nur einen winzigen Augenblick, und doch war mir, als hätte Gerlaine selbst mich angelächelt. Ich richtete mich auf und versuchte, die Rührung zu verbergen.
Aber die Amme hatte es bemerkt. Es schien sie zu freuen. Und es war, als bestünde auf einmal eine seltsame Verbundenheit zwischen uns, obwohl wir uns doch gar nicht kannten. Mit leuchtenden Augen trat Alessa an die Wiege und hob den Kleinen vorsichtig heraus, drückte ihn sanft an sich, wiegte ihn und murmelte leise Koseworte. Dabei sah sie mich an. Das Kind hob unsicher das Köpfchen, griff nach ihrer Haube und gluckste zufrieden.
»Möchtet Ihr ihn halten, Signore?«, fragte sie und lächelte mir aufmunternd zu.
Erst wollte ich erschrocken ablehnen, doch dann nickte ich befangen. Vorsichtig legte sie mir den Säugling in die Arme. So leicht. So winzig. So vertrauensvoll. Neugierig blinzelte der Kleine mich an. Und als ich etwas unbeholfen den Arm hob und seine kleine Wange an die meine legte, da gab er einen Laut von sich, der fast wie ein Lachen klang, und zog an meinem Bart. Wie wunderbar er roch. Ich war ganz und gar überwältigt.
»Ihr seid aber gar nicht sein Pate, oder?«, hörte ich Alessa neben mir sagen.
Erstaunt starrte ich sie an. »Wie kommst du darauf?«
»Signor Pali hat Euch Gilberto genannt.«
Ich nickte. »Ja, so heiße ich.«
Sie trat einen Schritt näher und sah sich um, als habe sie Angst, jemand könnte sie hören. »Dann seid Ihr also sein wirklicher Vater«, flüsterte sie. »Oder etwa nicht?«
Es war nicht immer leicht, sie zu verstehen. Die Hälfte musste ich erraten. Sie bemerkte mein verständnisloses Gesicht und wiederholte die Frage. Diesmal begriff ich.
»Du weißt davon?«
Sie holte tief Luft. »Die Signora hat es mir gesagt.«
Die Signora. Seltsam, Gerlaine als Herrin bezeichnet zu hören, denn für mich war sie immer noch das Mädchen aus meinem Dorf. Aber für Alessa waren wir natürlich die Herren. Stumm blickten wir einander an, die Amme und ich. Sie etwas furchtsam und unsicher, musste sich fragen, was von mir zu erwarten war. Und ich, ich war von Neuem sprachlos. Es stimmte also, Tancred hatte nicht gelogen. Wenn ich immer noch leise Zweifel gehabt hatte, nun waren sie ausgeräumt. Denn niemand würde es besser wissen als Gerlaine selber.
»Sie hat es dir anvertraut?«
Alessa nickte. »Und ich bin froh, dass Ihr gekommen seid.«
Da war dieses winzige Wesen in meinen Armen. Mein Kind. Nein, unser Kind. Gerlaine und ich hatten ein Kind gezeugt. Ich spürte plötzlich ihre Gegenwart zum Greifen nahe, als wäre sie hier mit uns im gleichen Raum. Mein Herz drohte zu zerspringen. Ich musste sie finden. Es musste einen Weg geben. Zum Teufel mit Thores klugen Worten.
Der Sturm, der in mir tobte, musste sich auf meinem Gesicht gespiegelt haben. Doch Alessa deutete die Zeichen falsch.
»Ich werde Euch nicht verraten«, flüsterte sie.
»Was sagst du?«
»Ich kann ein Geheimnis für mich behalten, Signore. Ihr könnt Euch auf mich verlassen.«
Fast musste ich lachen. »Es ist überhaupt kein Geheimnis. Tancred selbst hat es mir gesagt. Vor ein paar Stunden. Deshalb bin ich hier.«
Sie zog erstaunt die Brauen hoch. Für einen Moment schien sie mir nicht glauben zu wollen, aber dann lächelte sie erleichtert und strich dem Kind über die feinen Haare. »Er sieht Euch ähnlich, Signore.«
Ich runzelte die Stirn. Vielleicht wollte sie mir schmeicheln, denn ich konnte wenig Ähnlichkeit entdecken. »Ich weiß nicht. Sieht wie alle Säuglinge aus.«
»Aber nein! Die Augen so blau wie die des Vaters«, gurrte sie und streichelte Ivos Köpfchen. »Die Haut so weiß, die Haare wie Gold. Ein so liebes Kerlchen.« Sie schien ganz verrückt nach dem Kleinen zu sein.
»Ich danke dir, dass du dich um ihn gekümmert hast.«
Da machte sie ein erschrockenes Gesicht, als ihr dämmerte, was mein Erscheinen vielleicht bedeuten könnte. »Ihr werdet ihn mir doch nicht nehmen, Signore?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, gewiss nicht. Aber es ist alles noch zu neu für mich. Ich muss nachdenken. Wenn du ihn weiter versorgen möchtest, würde es mich freuen.«
Das schien sie zu beruhigen. Doch das Gerede musste den Kleinen erschreckt haben, denn er verzerrte plötzlich das Gesicht und begann zu greinen.
»Was ist mit ihm?«, fragte ich erschrocken.
»Er hat Hunger«, sagte sie und nahm ihn mir wieder ab. Sie wiegte den Säugling in den Armen, woraufhin er sich etwas beruhigte.
»Haben sie eigentlich viel gestritten?«, fragte ich. »Tancred und Gerlaine?«
Sie zögerte mit ihrer Antwort. Etwas zu lange für meinen Geschmack. »Ein wenig«, gab sie schließlich zu und sah betreten zur Seite. Ich hatte den Eindruck, dass sie mehr sagen wollte, sich aber nicht traute. Doch bevor ich weitere Fragen stellen konnte, schlug sie eine Hand vors Gesicht und fing an zu weinen. »Sie war so gut zu mir, die Signora«, schluchzte sie. »Nun ist sie weg. Und mit ihr mein halbes Dorf, auch mein Bruder. Meine Mutter haben sie umgebracht. Nur meine Schwester, die war zu krank, um sie mitzunehmen. Das war ihr Glück.«
Sie wandte das Gesicht ab, um ihre Tränen zu verbergen. Ich biss mir schuldbewusst auf die Lippe, denn bisher hatte ich nur an Gerlaine gedacht. Natürlich war ein ganzes Dorf von dem Überfall betroffen. Ein großes Unglück.
»Und was soll jetzt aus dem Kleinen werden?«, jammerte sie. »Signor Tancred hasst ihn. Ich darf mich mit dem Kind im Haus kaum zeigen.«
Das hörte ich nicht gern. Aber es war unter den Umständen verständlich. Für ihn war er doch nur der Bastard eines Rivalen. Immerhin hatte er Ivo nicht weggegeben. Dafür musste ich ihm dankbar sein.
»Wir reden morgen über alles«, sagte ich. Ich weiß nicht, ob der Kleine etwas von der gedrückten Stimmung mitbekommen hatte, jedenfalls begann er, lauthals nach seinem Recht zu brüllen, und war nicht mehr zu beruhigen.
»Ich muss ihn jetzt stillen«, erklärte Alessa und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht.
»Natürlich.« Es war Zeit für mich, zu verschwinden. Und doch hielt mich etwas zurück. An der Tür drehte ich mich um. »Darf ich noch einen Augenblick bleiben?«
Vielleicht war es ihr unangenehm, in meiner Gegenwart zu stillen. Jedenfalls wich sie einen Schritt zurück und hielt den Kleinen eng an die Brust gedrückt, als fürchtete sie sich vor mir. Nun, ich war ein großer, kräftiger Kerl und mit Schwert und Panzer sicher noch beeindruckender für diese zierliche Frau. Dachte sie etwa, ich wollte mich ihr unschicklich nähern? Ich lächelte ihr beruhigend zu und deutete auf das Bett.
»Ich möchte noch nicht gehen. Und Ivo ist doch mein Sohn. Ich setze mich auch ganz brav hier hin und störe dich nicht.«
Sie war rot geworden, nickte aber schließlich und ließ sich mit dem Kind im Arm auf dem Lehnstuhl nieder. Sie wandte sich kurz ab, während ich wegschaute, zog ihr Hemd hoch und schob dem Säugling einen geschwollenen Nippel zwischen die Lippen. Der saugte sich gierig fest und fing zu trinken an.
Alessa ließ sich zurücksinken und schloss mit einem leisen Seufzer die Augen. Ihr Atem beruhigte sich langsam, sie rückte sich etwas bequemer zurecht, dann wurde es still in der Kammer, nur ein gelegentliches Schmatzen war zu hören. Ich genoss das friedliche Bild, das sich mir bot. Winzige Staubteilchen tanzten im Sonnenstrahl, der durch die Läden fiel, inzwischen aber ein wenig weitergewandert war. Irgendwo summte eine Fliege. Ich wünschte mir, es wäre Gerlaine, die hier bei mir saß, um unser Kind zu stillen.
Nach einer kleinen Ewigkeit öffnete Alessa die Augen und sah mich an. »Es war meine Schuld, Signore«, flüsterte sie gequält.
»Was war deine Schuld?«
»Dass man sie entführt hat.«
»Erzähl mir, wie es geschehen ist«, bat ich sie sanft.
Sie starrte auf den Fußboden, wie um sich zu sammeln. Ihre Worte kamen erst stockend, dann flüssiger, schließlich nicht mehr ganz so von ihrer Mundart gefärbt, sodass ich sie besser verstehen konnte. Es hatte sich kurz nach der Weizenernte zugetragen. Ich zählte die Wochen an meinen Fingern ab. Das musste in etwa zu der Zeit gewesen sein, als wir in Salerno gewesen waren.
Anscheinend war in ihrem Dorf, das in der Nähe lag, das Fieber ausgebrochen und hatte viele erfasst. Sie selbst zum Glück nicht, denn man hatte sie schon Wochen zuvor nach Argentano geholt, da Gerlaine zu wenig Milch gehabt hatte. Alessas eigenes Kind war nur Tage nach seiner Geburt gestorben. Sie erwähnte das eher nebenbei, als sei es etwas Belangloses. Nun, dass Neugeborene starben, geschah oft genug, und offensichtlich hatte sie sich inzwischen mit Ivo getröstet.
Was für ein Fieber es denn gewesen sei, wollte ich wissen. Übelkeit, Erbrechen und schreckliche Schmerzen am ganzen Leib, als würde man verbrennen, erzählte sie. Manche waren ganz wild geworden und verrückt im Kopf, hätten geschrien wie Tiere. Am Ende wären die Erkrankten aber teilnahmslos geworden, hätten nur noch über die Kälte in ihren Gliedern geklagt. Bis ihr Herz versagt hatte.
Ich nickte grimmig bei dieser Beschreibung. »Haben deine Leute etwa fauliges Korn gegessen?«, fragte ich. »Hat es viel geregnet vor der Ernte?«
»Das ganze Frühjahr war verregnet«, erwiderte sie.
Es musste also das Antoniusfeuer gewesen sein. Ich schüttelte den Kopf. »Das Korn war wahrscheinlich verdorben, und sie haben trotzdem davon gegessen. Als wüsstet ihr es nicht besser, verdammt noch mal.«
Meine Worte brachten sie zum Schluchzen. Mutter und Schwester seien daran erkrankt, sagte sie unter Tränen, und der Bruder sei gekommen, um sie zu holen. Da habe sie die Herrin angefleht, mit ihr zu gehen, weil sie sich doch mit dem Heilen auskenne und mit Zauberkräften. Sie waren also ins Dorf geeilt, und während sie selbst sich um Ivo gekümmert habe, hatte Gerlaine keine Mühe gescheut, die Kranken zu pflegen. Mit Handauflegen und Besprechen und mit Kräuteraufgüssen. Bei vielen habe es geholfen. Für andere sei jede Hilfe zu spät gekommen.
Natürlich. Gerlaine kannte sich mit solchen Dingen aus. Ihre Mutter hatte ihr vieles von der Heilkunst der weisen Frauen des Nordens beigebracht, von den geheimen Runen und den Zauberkräften, die ihnen innewohnen. Mein wertvolles Schwert hatte sie ebenfalls mit einem Runenzauber versehen. Hatte es mich bisher nicht immer beschützt?
»Und dann? Was dann?«, fragte ich ungeduldig.
»Es war mitten in der Nacht. Die Signora hatte bei den Kranken bleiben wollen, und ich war allein mit dem kleinen Ivo. Plötzlich überall Fackelschein, alles schrie, die Hüttendächer brannten. Die Mauren waren gekommen. Sie trieben die Leute zusammen, die nicht krank waren.«
Jetzt weinte sie wieder und brauchte eine Weile, bevor sie weitersprechen konnte. Die Bilder, die ihre Worte heraufbeschworen hatten, die kannte ich nur zu gut. So war es in meiner Kindheit gewesen, als unser Dorf eines Nachts überfallen worden war. Strohdächer, die wie Fackeln brannten und den Dorfplatz geisterhaft erhellten. Leichen im Staub, Männer mit blitzenden Klingen in den Fäusten. Zwei Kerle waren in unsere Hütte eingedrungen und hatten sich an meiner Mutter vergriffen, sie vor meinen Augen geschändet und totgeschlagen. Diese Bilder spuken mir noch bis heute im Kopf herum und sind der Grund, warum ich Gewalt gegen Frauen und Kinder abgrundtief hasse. Dass es damals ausgerechnet Roberts Männer gewesen waren, machte es nicht besser. Die Schuldigen hatte er jedoch davongejagt und mich in sein Dorf mitgenommen, wo ich dann bei seiner Familie aufgewachsen war. Fast, als habe er etwas an mir gutmachen wollen.
»Ich hatte schreckliche Angst und bin weggelaufen«, hörte ich Alessa sagen. Ich schüttelte den Kopf, um die Albträume zu verscheuchen. »Nur den Ivo, den hab ich mitgenommen.«
Dann hat sie mehr Glück gehabt als meine Mutter, dachte ich bei mir. Und Ivo auch. Den hätten die Mauren sonst ins Feuer geworfen. Sie sei, so schnell sie konnte, davongerannt, fuhr Alessa fort, und habe sich im Gebüsch versteckt. Es sei nicht viel zu sehen gewesen, außer dass das halbe Dorf in Flammen gestanden hatte.
Die Erzählung hatte mich aufgewühlt. »Und deine Herrin?«, rief ich. »Was haben sie mit ihr gemacht? Was hast du gesehen?«
Alessa saß da wie ein Häuflein Elend, mit dem Kind im Arm, und schluchzte. »Perdona me, Signore. Ich weiß, es ist alles meine Schuld. Ich hab sie in unser Dorf geholt. Sonst hätte man sie nicht geraubt.«
»Hör auf zu jammern«, sagte ich grob. »Ich will wissen, was du gesehen hast.«
Sie schüttelte den Kopf. »Nichts. Nur dass sie unter den anderen war, die man zusammengetrieben hat. Fesseln hat man ihnen angelegt.«
»Wurde sie geschlagen, gequält?« Eigentlich hatte ich fragen wollen, ob man ihr Gewalt angetan hatte, aber ich brachte es nicht über die Lippen.
»Nein, Signore. Sie stand nur still da und ließ alles mit sich machen. Den anderen, die weinten, hat sie noch Mut zugesprochen, glaube ich. Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es. Bitte verzeiht mir, Herr.«
Ich atmete tief durch und versuchte, mich zu beruhigen. »Es gibt nichts zu verzeihen, Alessa. Es war nicht deine Schuld. Ganz im Gegenteil. Du hast den Jungen gerettet. Ich werde dir ewig dankbar sein.«
Sie fuhr sich mit dem Ärmel über die tränennassen Augen und blickte auf das Kind an ihrer Brust. Ivo regte sich nicht. Er war eingeschlafen. Nur seine kleinen Augenlider zuckten ab und zu, als ob er träumte.
»Du hast gesagt, deinen Bruder haben sie mitgenommen. Hast du noch andere Verwandte, die es überlebt haben?«
»Nur meine Schwester und ihr Mann. Er war an dem Tag mit seinen Schafen in den Bergen gewesen. Gott hat sie beide behütet.«
»Und du? Hast du keinen Mann?«
Sie schwieg einen Moment. Dann sah sie mich an. »Signor Tancred hat ihn aufhängen lassen«, erwiderte sie tonlos. »Es war im Frühjahr.«
»Was sagst du da? Warum zum Teufel?«
»Sie haben gesagt, er sei ein Viehdieb. Aber ich weiß, dass es nicht stimmt.«
»Bei Odin«, entfuhr es mir. Diese kleine Frau hatte einiges durchgemacht. Ich musste daran denken, was Thore und ich über die Bauern der Gegend gesagt hatten und über ihre neuen Herren. »Es tut mir leid, Alessa.«
Sie zuckte mit den Schultern. »Es war keine Liebe zwischen uns gewesen. Aber er war ein guter Mann. Meine Mutter hat mir später geholfen, das Kind zur Welt zu bringen. Leider ist es gestorben.« Sie blickte wieder auf Ivo an ihrer Brust. »Aber dann ist die Signora gekommen und hat mich zu sich geholt, weil sie zu wenig Milch hatte. So hat sich alles zugetragen.«
Wir schwiegen eine Weile. Nur Ivo seufzte zufrieden. Ich dachte darüber nach, wie hart und ungerecht das Leben sein kann. Für diese Frau. Und auch für uns. Als Gerlaine und ich damals mit den anderen aufgebrochen waren, war ich siebzehn gewesen. Wir hatten unsere Reise in den Süden als großes Abenteuer gesehen, uns keine Gedanken gemacht, wie es mal enden würde. Und nun war sie den Sklavenjägern in die Hände gefallen.
»Was hat Gerlaine über mich erzählt?«, fragte ich.
Ein kleines Lächeln tauchte auf ihren Lippen auf. »Nicht viel. Nur, dass sie einen Fehler gemacht hat. Und dass ich davon lernen sollte. Sie war oft traurig.«
Da hatte ich wieder diesen verdammten Kloß im Hals und biss die Zähne zusammen, um nicht loszuheulen. »Einen Fehler haben wir wohl beide gemacht«, murmelte ich.
»Sie haben sich nicht gut verstanden.«
Jetzt redete sie wohl wieder von Tancred. »Was meinst du damit? Haben sie gestritten?«
Alessa nickte nur und machte ein bekümmertes Gesicht. Da kam mir ein abscheulicher Verdacht. »Er hat sie doch nicht etwa geschlagen, oder?«, rief ich.
Sie bekam wieder feuchte Augen. »Er ist kein guter Mensch. Steckt voller Hass. Ich weiß nicht, was sie bei ihm wollte.«
Da sprang ich auf. »Ich schwöre, ich bring den Bastard um!«
Aber meine Wut machte ihr Angst. »Madonna! Ich habe nichts gesagt«, flehte sie. »Bitte verratet mich nicht.«
Bevor ich antworten konnte, hörte ich Pali rufen. »Gilbert! Alles in Ordnung?«, schallte es von unten herauf.
»Ich komme gleich«, rief ich gereizt zurück.
Ich hörte ihn lachen. »Hier wartet einer auf dich. Behauptet, er sei dein Bruder.«
Mein Bruder? Ich hatte keinen Bruder. Was zum Teufel sollte das heißen? Doch dann schwante mir, wer es sein könnte. Ich hatte ganz vergessen, dass er angeblich nach Argentano gekommen war.
»Alessa, hör zu«, raunte ich eindringlich. »Du bleibst keine Nacht länger in diesem Haus. Ich weiß noch nicht, wo ich euch unterbringe, aber pack alles zusammen, und nachher hole ich dich und das Kind.«
Sie sah mich ängstlich an. Es dauerte eine Weile, bis sie zögerlich nickte. »Sì, Signore.«
Unerwartetes Wiedersehen
Immer noch wütend auf Tancred polterte ich die Treppe hinunter. Wenn es stimmte, dass er sich an Gerlaine vergriffen hatte, würde ich ihn fertigmachen.
Als ich wieder das atrium betrat, sprang Loki schwanzwedelnd auf die Füße, als hätte er mich eine Ewigkeit nicht gesehen. Thore und Pali, die es sich auf ihren Stühlen bequem gemacht hatten, grinsten mich erwartungsvoll an. Was ging hier vor? Und wo war der Bruder, den sie mir angekündigt hatten?
Bevor ich sie fragen konnte, ertönte eine kräftige Stimme hinter mir. »Bei Odin, den Mann kenne ich doch!«
Ich fuhr herum. Da stand ein junger Kerl, hochgewachsen, sehnig und schlank. Er trug eine Tunika in Blau, die bis zu den Knien reichte, mit Riemen umwickelte Beinlinge, einen breiten Gürtel und einen langen Dolch an der Hüfte, ganz wie ein Normanne aus der Heimat. Dazu Haare, die bis auf die Schultern fielen und so gelb waren wie die seiner Mutter. Natürlich hatte er sich verändert, aber das unbekümmerte Grinsen in seinem bärtigen Gesicht hätte ich überall wiedererkannt.
»Roger, du Satansbraten!«, rief ich entzückt und schloss ihn in die Arme. Für einen Augenblick war alles andere vergessen.
Sieben Jahre hatten wir uns nicht gesehen. Sieben Jahre, in denen wir beide erwachsen geworden waren. Damals hatte er sich nicht einmal von mir verabschieden wollen, so wütend war er gewesen, dass er nicht hatte mitkommen dürfen. Aber Fressenda hätte es das Herz gebrochen, auch noch ihren Jüngsten, gerade erst sechzehn, in fremde Länder ziehen zu lassen.
Doch jetzt war er hier. Die Rührung überkam mich mit Wucht. Es war nicht nur die Freude, ihn wiederzusehen, sondern auch ein plötzliches Heimweh, das mich packte. Nach unserem Dorf, nach der Landschaft von feuchten Wiesen und dichten Wäldern, nach den einfachen Menschen, den Knechten und Mägden, den hart arbeitenden Bauern. Vor allem aber nach der guten, alten Fressenda, die ihre Brut mit Strenge und mit Liebe zusammengehalten hatte, immer für alle da. Auch für mich damals, den fünfjährigen Knirps, den Robert eines Nachts ins Haus geschleppt hatte. Meinen Namen Brynjarr hatte sie nicht gemocht und mich gleich in Gilbert umgetauft. Roger und ich waren bald unzertrennlich geworden. Er, der jüngste der Hauteville-Brüder, und ich, der porchon im Dorf, der Schweinehirt von zweifelhafter Abstammung.
»He, bring mich nicht gleich um«, rief er lachend, nachdem ich ihn erneut herzhaft an die Brust gedrückt hatte. Nicht ohne feuchte Augen machte er sich los.
»Hab schon gehört, dass du im Lande bist«, sagte ich und zauste ihm liebevoll durch die dichten Haare. »Endlich hast du dich mal hergetraut. Was hat dich aufgehalten?«
In seinen Augen blitzte der Schalk. »Hab gedacht, ich lass dich und meine Brüder erst mal die Arbeit machen und nehme mir dann, was mir zusteht.«
»Was dir zusteht?«, rief ich in gespielter Entrüstung. »Eine Ecke im Pferdestall vielleicht, du Faulpelz. Aber lass dich ansehen, Mann.« Ich trat einen Schritt zurück. Was ich sah, gefiel mir. Roger war ein ausgesprochen hübscher Bursche, wohl der bestaussehende unter den Hauteville-Brüdern. Und das wollte etwas heißen. Dabei war er beileibe kein Schönling, sondern ein gut gewachsener, junger Kerl, der aussah, als sei er zu allem bereit, was das Leben ihm vor die Füße warf.
»Aus dir ist ja ein richtiges Mannsbild geworden«, sagte ich. »Mindestens einen Kopf größer, als ich dich in Erinnerung habe. Und breite Schultern dazu. Ich wette, du kannst dich vor hübschen Weibern kaum retten.«
»Deshalb hat Serlo mich ja weggeschickt«, erwiderte er mit verschmitztem Grinsen. »Noch mehr namenlose Bastarde könne er nicht durchfüttern. Ich solle es doch lieber bei den Lombardinnen versuchen.«
Serlo war der älteste der Hauteville-Brüder. Er allein hatte Burg und Land behalten, da das Erbe zu gering war, um es unter zwölf Brüdern aufzuteilen.
Ich zwinkerte Thore und Pali zu. »Habt ihr gehört, was für ein Aufschneider aus dem geworden ist?«
Roger lachte vergnügt. Er war schon immer einer für Schabernack und verrückte Späße gewesen, dem kaum etwas die gute Laune verderben konnte. Als Knaben hatten wir heimlich gejagt oder die Fallen der Bauern geplündert, Feuer im Wald gemacht und unsere Beute halb verkohlt verschlungen. Roger, obwohl ein Jahr jünger als ich, war dabei immer der wildere von uns beiden gewesen, nichts konnte ihn zurückschrecken. Einmal hatten wir fast einen Waldbrand ausgelöst. Dem Schmied hatten wir halb fertige Waffen entwendet und damit gefährlich herumgespielt, was nicht ohne Wunden abgegangen war. Kein Obstgarten war vor uns sicher gewesen, und einmal hatte er mich angestiftet, von einem Nachbargut ein Pferd zu stehlen. Zwei ganze Tag lang waren wir zu zweit durch die Gegend geritten, bis man uns erwischt hatte. Nach der verdienten Tracht Prügel hatten wir tagelang nicht sitzen können.
Roger nahm mich nun ebenfalls in Augenschein und ließ seine Hand über meinen Kettenpanzer gleiten. »Du siehst wie ein erfahrener Kriegsmann aus. Da habe ich wohl einiges nachzuholen. Und Roberts Vertrauensmann bist du auch geworden, wie ich gehört habe.«
Gerade eben in Melfi angekommen, habe Robert ihn sofort nach Kalabrien geschickt, um nach dem Rechten zu sehen, erzählte er. Argentano gefalle ihm gut, und er hoffe, sich hier bald hervortun zu können, schließlich sei er nicht hier, um sich auszuruhen. Ich musste lächeln. Diese Ungeduld und überschwängliche Unternehmungslust, das kannte ich von früher. Die Erwähnung seines Bruders dämpfte allerdings meine Freude, aber ich ließ mir nichts anmerken, sondern stellte ihm Thore vor und erwähnte, dass wir gerade aus Salerno gekommen waren. Dann setzten wir uns alle.
»Wie ist es dort gegangen? Ich weiß nur, dass Robert überstürzt seine Krieger gesammelt hat, um angeblich einen Aufruhr der Lombarden niederzuschlagen. Ich wäre gern dabei gewesen.«
In kurzen Worten berichtete ich von unserem Abenteuer in Salerno, vom Aufstand und den Morden und von Roberts und Gaitelgrimas schrecklicher Rache. Sie war Prinz Guaimars Schwester und eine Prinzessin von Salerno, aber auch Roberts Schwägerin, denn sie hatte Drogo de Hauteville geheiratet und nach dessen Tod Onfroi, seinen Bruder und Nachfolger. Sie war in Salerno gewesen, um ihren Erstgeborenen taufen zu lassen, als das Unheil ausbrach und die ganze Stadt erfasste. Und ich, als Anführer ihrer Leibwache, hatte mitten im Tumult gesteckt. Wir konnten uns glücklich schätzen, Thore und ich, dass wir mit dem Leben davongekommen waren.
Roger aber freute sich wie ein Kind über die waghalsige List, mit der wir die Stadt eingenommen hatten. Die traurigen Ereignisse, die dem gefolgt waren, die unwürdige Rolle, die wir Normannen beim Massaker von Salerno gespielt hatten, sogar mein Streit darüber mit Robert, all das schien ihn weniger zu berühren.
»Was soll ich sagen, Gilbert? Ich war nicht dabei. Außerdem, im Krieg sterben Leute. Was regst du dich darüber auf? Und was deinen Streit mit Robert betrifft, du weißt doch selbst, was für ein Bastard mein Bruder sein kann. Aber er hat auch seine guten Seiten. Wo wärst du ohne ihn, eh?«