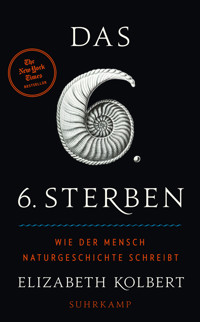
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Sie haben noch nie etwas vom Stummelfußfrosch gehört? Oder vom Sumatra-Nashorn? Gut möglich, dass Sie auch nie von ihnen hören werden, denn sie sind dabei auszusterben. Wir erleben derzeit das sechste sogenannte Massenaussterben: In einem relativ kurzen Zeitraum verschwinden ungewöhnlich viele Arten. Experten gehen davon aus, dass es das verheerendste sein wird, seit vor etwa 65 Millionen Jahren ein Asteroid unter anderem die Dinosaurier auslöschte. Doch dieses Mal kommt die Bedrohung nicht aus dem All, sondern wir tragen die Verantwortung.
Wie haben wir Menschen das Massenaussterben herbeigeführt? Wie können wir es beenden? Elizabeth Kolbert spricht mit Geologen, die verschwundene Ozeane erforschen, begleitet Botaniker in die Anden und begibt sich gemeinsam mit Tierschützern auf die Suche nach den letzten Exemplaren gefährdeter Arten. Sie zeigt, wie ernst die Lage ist, und macht uns zu Zeugen der dramatischen Ereignisse auf unserem Planeten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Sie haben noch nie etwas vom Stummelfußfrosch gehört? Oder vom Sumatra-Nashorn? Gut möglich, dass Sie auch nie von ihnen hören werden, denn sie sind dabei auszusterben. Wir erleben derzeit das sechste sogenannte Massenaussterbeereignis: In einem relativ kurzen Zeitraum verschwinden ungewöhnlich viele Arten. Experten gehen davon aus, dass es das verheerendste sein wird, seit vor etwa 65 Millionen Jahren ein Asteroid auf der Erde einschlug, mit den bekannten Folgen für die Dinosaurier. Doch dieses Mal kommt die Bedrohung nicht aus dem All, sondern wir tragen die Verantwortung.
Wie keine andere Gattung zuvor haben wir Menschen das Leben auf der Erde verändert. In ihrem New York Times-Bestseller erklärt uns Elizabeth Kolbert, wie das geschehen konnte: Sie spricht mit Geologen, die verschwundene Ozeane erforschen, begleitet Botaniker, die der Waldgrenze in den Anden folgen, und begibt sich gemeinsam mit Tierschützern auf die Suche nach den letzten Exemplaren gefährdeter Arten. Sie zeigt, wie ernst die Lage ist, und macht uns zu unmittelbaren Zeugen der dramatischen Ereignisse auf unserem Planeten.
Elizabeth Kolbert, geboren 1961, ist Journalistin und Autorin. Ihre Karriere begann sie 1983 in Deutschland als freie Mitarbeiterin für die New York Times. Seit 1999 arbeitet sie für das angesehene Magazin The New Yorker. Kolbert gilt als eine der renommiertesten Autorinnen zu Fragen des Klimawandels. Für ihre Reportageserie »The Climate of Man« erhielt sie 2006 den National Magazine Award in der Sparte Public Interest.
Elizabeth KolbertDas sechste Sterben
Wie der Mensch Naturgeschichte schreibt
Aus dem Englischenvon Ulrike Bischoff
Titel der Originalausgabe:
The Sixth Extinction. An Unnatural History
Erstmals erschienen 2014 bei Henry Holt and Company.
Copyright © 2014 by Elizabeth Kolbert
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2015.
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2015
© 2014 by Elizabeth Kolbert
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Satz: Satz-Offizin Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
Umschlaggestaltung: Brian Barth
Umschlagabbildung: nach Ernst Haeckel, Kunstformen der Natur
Inhalt
Prolog
1. Das sechste große Artensterben
2. Die Mastodontenzähne
3. Der ursprüngliche Pinguin
4. Das Glück der Ammoniten
5. Willkommen im Anthropozän
6. Das Meer um uns herum
7. Der Säuretropf
8. Wald und Bäume
9. Inseln auf trockenem Land
10. Das neue Pangaea
11. Ultraschalluntersuchung bei einem Nashorn
12. Das Wahnsinnsgen
13. Das Ding mit Federn
Anmerkungen
Danksagung
Bibliografie
Bildnachweise
Die Gefahr, die der Menschheit auf ihrem Weg in die Zukunft droht, bezieht sich weniger auf das Leben unserer eigenen Art als vielmehr auf die Erfüllung der höchsten Ironie der organischen Evolution: daß Leben in dem Augenblick, da es durch den Geist des Menschen zur Selbsterkenntnis gelangt, seine schönsten Schöpfungen dem Untergang geweiht hat.
Edward O. Wilson,
Der Wert der Vielfalt, München 1995 [1992], S. 420
Jahrhunderte um Jahrhunderte, und doch geschieht alles in der Gegenwart.
Jorge Luis Borges,
»Der Garten der Pfade, die sich verzweigen« [1941], in:Sämtliche Erzählungen. Das Aleph, Fiktionen, Universalgeschichte der Niedertracht, München 1970, S. 200
Prolog
Anfänge neigen dazu, im Dunkeln zu liegen, heißt es. So ist es auch bei dieser Geschichte, die mit dem Auftauchen einer neuen Spezies vor etwa zweihunderttausend Jahren beginnt. Diese Art hat – wie alles – noch keinen Namen, besitzt aber die Fähigkeit, Dinge zu benennen.
Ihre Lage ist wie bei jeder jungen Spezies prekär. Die Population ist klein, und ihr Lebensraum beschränkt sich auf ein überschaubares Gebiet in Ostafrika. Allmählich nimmt sie zu, schrumpft aber dann wahrscheinlich wieder auf wenige tausend Paare zusammen – was nach Ansicht mancher beinahe zu ihrem Aussterben geführt hätte.
Die Mitglieder dieser Spezies sind weder sonderlich schnell oder stark noch besonders fruchtbar. Aber sie sind ausgesprochen findig. Nach und nach dringen sie in Regionen mit unterschiedlichen klimatischen Bedingungen und verschiedenen Raub- und Beutetieren vor. Keiner der Faktoren, die andere Arten in ihrer Ausbreitung einschränken – spezifische Anforderungen an ihren Lebensraum, geografische Hindernisse –, scheint sie aufzuhalten. Sie überqueren Flüsse, Hochebenen, Gebirgszüge. In Küstenregionen sammeln sie Krebse und Muscheln, im Binnenland jagen sie Säugetiere. Überall, wo sie sich niederlassen, passen sie sich an und bringen Innovationen hervor. Als sie nach Europa kommen, treffen sie dort auf Lebewesen, die ihnen sehr ähnlich, aber gedrungener und wahrscheinlich kräftiger sind und schon wesentlich länger auf diesem Kontinent leben. Mit ihnen paaren sie sich und töten sie dann auf die eine oder andere Weise.
Das Ende dieser Affäre wird sich als exemplarisch erweisen. Bei der Ausweitung ihres Verbreitungsgebiets trifft diese Spezies auf Tiere, die zwei-, zehn- und sogar zwanzigmal größer sind: Großkatzen, Bären, elefantengroße Schildkröten, viereinhalb Meter große Faultiere. Diese Arten sind zwar stärker und häufig auch angriffslustiger, pflanzen sich aber langsamer fort und sterben aus.
Obwohl unsere Spezies zu den Landtieren gehört, überquert sie – erfinderisch, wie sie ist – das Meer. Sie erreicht Inseln, die von Ausreißern der Evolution bewohnt sind: Vögel, die gut dreißig Zentimeter große Eier legen, schweinsgroße Flusspferde, Riesenskinks. Diese an Isolation gewöhnten Tiere sind schlecht gerüstet für die Begegnung mit den Neuankömmlingen und ihren Begleitern (meist Ratten). Viele von ihnen sterben ebenfalls aus.
Dieser Prozess setzt sich in Wellen über Tausende Jahre fort, bis die nun nicht mehr ganz so junge Spezies sich praktisch auf der ganzen Erde ausgebreitet hat. An diesem Punkt passieren mehr oder weniger gleichzeitig mehrere Dinge, die dem Homo sapiens, wie er sich mittlerweile nennt, eine beispiellos schnelle Vermehrung ermöglichen. Innerhalb eines einzigen Jahrhunderts verdoppelt sich seine Population, dann verdoppelt sie sich ein zweites und ein drittes Mal. Riesige Wälder werden gerodet – eine gezielte Maßnahme der Menschen, um sich zu ernähren. Weniger gezielt schaffen sie Organismen von einem Kontinent auf den anderen und bringen damit die Biosphäre durcheinander. Zugleich setzen die Menschen einen noch merkwürdigeren, radikaleren Wandel in Gang. Die Entdeckung und Nutzung unterirdischer Energiereserven wirkt sich auf die Zusammensetzung der Atmosphäre aus, was wiederum Folgen für das Klima und die chemischen Eigenschaften der Meere hat. Manche Pflanzen und Tiere passen sich durch Migration an. Sie klettern Berge hinauf oder wandern in Richtung der Pole. Aber die große Mehrheit – zunächst einige Hunderte, dann Tausende und schließlich vielleicht Millionen – bleibt auf der Strecke. Immer mehr Arten sterben aus, und das Gefüge des Lebens verändert sich.
Noch nie zuvor hat eine Spezies so stark in das Leben auf der Erde eingegriffen, und doch haben bereits vergleichbare Ereignisse stattgefunden. Ganz vereinzelt erlebte die Erde in ferner Vergangenheit Momente eines so drastischen Wandels, dass die Artenvielfalt beträchtlich abnahm. Fünf dieser Ereignisse bilden wegen ihrer katastrophalen Auswirkungen eine eigene Kategorie: die fünf Massenextinktionen. Es wirkt wie ein fantastischer Zufall – ist aber vermutlich keineswegs ein zufälliges Zusammentreffen –, dass man die Geschichte dieser Ereignisse ausgerechnet zu einem Zeitpunkt enträtselt, an dem der Menschheit bewusst wird, dass sie ein weiteres Massenaussterben verursacht. Obwohl es noch zu früh ist, um sagen zu können, ob es die Ausmaße der fünf großen Artensterben erreichen wird, bezeichnet man es bereits als das sechste Massenaussterbeereignis.
Die Geschichte des sechsten großen Artensterbens, so wie ich sie erzähle, gliedert sich in dreizehn Kapitel. Jedes verfolgt die Spuren von Spezies, deren Schicksal in gewisser Weise exemplarisch ist: des Amerikanischen Mastodons, des Riesenalks oder der Ammoniten, die ebenso wie die Dinosaurier am Ende der Kreidezeit verschwanden. Die in den ersten Kapiteln behandelten Lebewesen sind bereits ausgestorben. Dieser Teil des Buches befasst sich überwiegend mit den großen Artensterben der Vergangenheit und der verzwickten Geschichte ihrer Entdeckung, angefangen bei den Arbeiten des französischen Naturforschers Georges Cuvier. Der zweite Teil des Buches ist weitgehend in der Gegenwart angesiedelt, im zunehmend fragmentierten Regenwald des Amazonasbeckens, an den sich immer schneller erwärmenden Hängen der Anden, an den Ausläufern des Great Barrier Reef. Diese Orte habe ich aus den üblichen journalistischen Gründen bereist – weil es dort eine Forschungsstation gibt oder jemand mir angeboten hat, eine Expedition zu begleiten. Aber der Wandel, der sich gegenwärtig vollzieht, hat mittlerweile solche Ausmaße angenommen, dass ich eigentlich überallhin hätte fahren können und mit der entsprechenden Anleitung Anzeichen dafür gefunden hätte. Ein Kapitel widmet sich einer Tragödie, die sich mehr oder weniger in meinem eigenen Garten vollzieht.
Wenn schon das Aussterben einer Art ein morbides Thema ist, gilt das für das Massenaussterben erst recht. Aber es ist auch ein faszinierendes Thema. In diesem Buch versuche ich, beiden Seiten gerecht zu werden: sowohl dem Faszinierenden als auch dem Erschreckenden der gegenwärtigen Erkenntnisse. Und ich hoffe, ich kann den Lesern vermitteln, dass wir in einer wahrhaft außerordentlichen Zeit leben.
1. Das sechste große Artensterben
Atelopus zeteki
Die Stadt El Valle de Antón liegt in Zentralpanama in einem Vulkankrater, der vor etwa einer Million Jahren entstanden ist. Er hat einen Durchmesser von zwölf Kilometern, aber bei klarem Wetter sieht man die zerklüfteten Berge, die den Ort wie die Mauern einer Turmruine umgeben. El Valle hat eine Hauptstraße, eine Polizeistation und einen Marktplatz. Neben dem üblichen Sortiment von Panamahüten und bunten Stickereien bieten die Markstände die wohl weltweit größte Auswahl an Figuren des Stummelfußfroschs: Frösche auf Blättern, auf den Hinterbeinen stehend und – was schon schwerer nachzuvollziehen ist – mit Handys zwischen den Vorderbeinen. Es gibt Stummelfußfrösche mit Rüschenröckchen, in Tanzposen und Frösche, die im Stil Franklin D. Roosevelts mit Zigarettenspitze rauchen. Der goldgelbe Panama-Stummelfußfrosch mit dunkelbraunen Flecken ist in der El-Valle-Gegend heimisch und gilt dort als Glücksbringer. Sein Bild ist (oder war zumindest bis vor einiger Zeit) auf Lotterielosen zu finden.
Noch vor zehn Jahren war der Panama-Stummelfußfrosch in den Bergen um El Valle leicht zu finden. Die Frösche sind giftig – das in der Haut eines einzigen Tieres enthaltene Gift reicht rein rechnerisch, um tausend Mäuse zu töten – und heben sich durch ihre leuchtende Farbe deutlich vom Waldboden ab. Ein Bach in der Nähe von El Valle trägt den Namen Tausend-Frösche-Bach, weil sich an seinen Ufern früher so viele Stummelfußfrösche sonnten, dass ein Herpetologe, der häufig dort war, zu mir sagte: »Es war verrückt, völlig verrückt.«
Doch irgendwann verschwanden die Frösche in der Umgebung von El Valle. Das Problem – das noch nicht als Krise wahrgenommen wurde – begann westlich des Vulkankraters in Panamas Grenzgebiet zu Costa Rica. Dort erforschte eine amerikanische Studentin Frösche im Regenwald. Als sie nach einem längeren Aufenthalt in den Vereinigten Staaten, wo sie ihre Dissertation schrieb, wieder zurückkehrte, fand sie keine Frösche und keinerlei Amphibien mehr vor. Sie hatte keine Ahnung, was passiert war, da sie aber für ihre Forschungen Frösche brauchte, suchte sie sich für ihre Beobachtungen ein neues Gebiet weiter östlich. Anfangs machten die Frösche dort einen gesunden Eindruck, doch dann passierte wieder dasselbe: Die Amphibien verschwanden. Immer mehr Regenwaldregionen waren betroffen, bis die Frösche 2002 auch in den Bergen und Gewässern um die Stadt Santa Fé, etwa achtzig Kilometer westlich von El Valle, praktisch ausgestorben waren. 2004 entdeckte man in dem noch näher an El Valle gelegenen Dorf El Copé kleine Kadaver. Zu diesem Zeitpunkt kam eine Gruppe von Biologen aus Panama und den USA zu dem Schluss, dass der Panama-Stummelfußfrosch ernsthaft bedroht war. Um eine Restpopulation zu retten, entschieden sie sich, einige Dutzend Pärchen aus dem Regenwald zu holen und in geschlossenen Räumen zu halten. Aber das, was die Frösche tötete, war schneller, als die Biologen befürchtet hatten. Noch bevor sie ihren Plan in die Tat umsetzen konnten, holte die Welle sie ein.
Auf die Stummelfußfrösche von El Valle stieß ich erstmals in einem Naturmagazin für Kinder, das ich bei meinen Söhnen gefunden hatte.1 Der mit Farbfotos des Panama-Stummelfußfrosches und anderer leuchtend bunter Arten illustrierte Artikel schildert die um sich greifende Seuche und die Bemühungen der Biologen, sie einzudämmen. Sie hatten auf den Neubau eines Labors in El Valle gehofft, der aber nicht rechtzeitig fertig wurde. Daher retteten sie in aller Eile so viele Tiere wie möglich, obwohl sie keine Räumlichkeiten hatten, um sie unterzubringen. Was machten sie also? Sie quartierten sie »natürlich in einem Froschhotel« ein! Das »unglaubliche Froschhotel« – eine örtliche Frühstückspension – erklärte sich bereit, die Tiere in angemieteten Zimmern (in Terrarien) aufzunehmen.
»Die Frösche genießen eine erstklassige Unterkunft mit Zimmermädchen und Roomservice, da Biologen ständig zu ihrer Verfügung stehen«, hieß es in dem Bericht. Zudem bekämen sie köstliches, frisches Essen, »so frisch, dass es vom Teller hüpfen kann«.
Einige Wochen nachdem ich über das »unglaubliche Froschhotel« gelesen hatte, stieß ich auf einen weiteren Artikel über Frösche, der allerdings in einer ganz anderen Tonart verfasst war. Er war in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences erschienen, stammte von den Herpetologen David Wake von der University of California in Berkeley und Vance Vredenburg von der San Francisco State University und trug die Überschrift »Befinden wir uns mitten im sechsten Massenaussterben? Ein Eindruck aus der Welt der Amphibien«.2 »In der Geschichte des Lebens auf der Erde«, so die Autoren, habe es »fünf große Massenaussterbeereignisse« gegeben, durch die die Artenvielfalt jeweils drastisch reduziert wurde. Das erste fand im Oberordovizium vor etwa 450 Millionen Jahren statt, als sich das Leben noch überwiegend im Wasser abspielte. Zum bislang verheerendsten Artensterben, das beinahe jegliches Leben auf der Erde vernichtet hätte, kam es am Ende des Perms vor etwa 250 Millionen Jahren. (Dieses Ereignis wird zuweilen als »die Mutter der Massenextinktionen« oder »das große Sterben« bezeichnet.) Das jüngste – und bekannteste – Massenaussterben löschte am Ende der Kreidezeit die Dinosaurier, Plesiosaurier, Mosasaurier, Ammoniten und Flugsaurier aus. Ausgehend von den Aussterberaten unter Amphibienarten, behaupten Wake und Vredenburg, dass in der Gegenwart eine ähnliche Katastrophe im Gange sei.
Der Artikel ist nur mit einem einzigen Foto bebildert, das ein Dutzend Frösche der Art Rana muscosa zeigt, die mit aufgeblähtem Leib tot auf dem Rücken liegen.
Dass eine Kinderzeitschrift lieber Fotos lebender als toter Frösche veröffentlichte, konnte ich durchaus verstehen, ebenso den Impuls, die reizvolle Kinderbuchszenerie von Amphibien, die den Zimmerservice kommen lassen, in den Mittelpunkt zu rücken. Dennoch drängte sich mir als Journalistin der Eindruck auf, dass die Zeitschrift das Eigentliche unter den Teppich gekehrt hatte. Wenn man irgendetwas als extrem selten einstufen konnte, dann ja wohl einen Vorgang, der sich erst fünfmal ereignet hat, seit vor gut fünfhundert Millionen Jahren die ersten Wirbeltiere auftauchten. Der Gedanke, dass ein sechstes Ereignis dieser Art gegenwärtig mehr oder weniger vor unseren Augen stattfand, überstieg im wahrsten Sinne des Wortes mein Vorstellungsvermögen. Die Sache mit den Fröschen war also Teil einer viel umfassenderen und düstereren Geschichte mit überaus weitreichenden Folgen, die ebenfalls jemand erzählen musste. Falls Wake und Vredenburg recht hatten, waren wir derzeit nicht nur Zeugen, sondern auch Verursacher eines der seltensten Ereignisse in der Geschichte des Lebens. »Eine unkrautartig wuchernde Spezies hat unwissentlich die Fähigkeit erlangt, ihr eigenes Schicksal und das der meisten anderen Arten auf der Erde unmittelbar zu beeinflussen«, heißt es in ihrem Artikel. Nur wenige Tage nachdem ich den Aufsatz von Wake und Vredenburg gelesen hatte, buchte ich einen Flug nach Panama.
Das El Valle Amphibian Conservation Center (EVACC) liegt an einer Schotterstraße nicht weit von dem Marktplatz entfernt, auf dem die Stummelfußfrosch-Figuren verkauft werden. Es hat die Größe eines Bauernhauses und steht im hinteren Teil eines kleinen, verschlafenen Zoos, gleich hinter einem Gehege mit besonders verschlafenen Faultieren. Das ganze Gebäude ist voller Terrarien. Wie Bücher in den Regalen einer Bibliothek stehen sie dicht gedrängt entlang der Wände und in der Mitte des Raums. Die größeren beherbergen Arten wie den Lemur-Laubfrosch, der Baumwipfel bevorzugt, in den kleineren leben Arten wie der Craugastor megacephalus, der auf dem Waldboden beheimatet ist. Neben Behältern mit Beutelfröschen, die ihre Eier in einer Hauttasche ausbrüten, befinden sich solche mit Vertretern der Spezies Hemiphractus fasciatus, die ihre Eier auf dem Rücken tragen. Einige Dutzend Terrarien sind dem Panama-Stummelfußfrosch (Atelopus zeteki) vorbehalten.
Stummelfußfrösche bewegen sich irgendwie schwankend fort und erinnern dabei an Betrunkene, die sich bemühen, auf einer geraden Linie zu gehen. Sie haben lange, dünne Gliedmaßen, eine spitze gelbe Schnauze und sehr dunkle Augen, mit denen sie die Welt argwöhnisch zu betrachten scheinen. Auch auf die Gefahr hin, albern zu klingen, möchte ich sagen, dass sie intelligent aussehen. In freier Wildbahn legen die Weibchen ihre Eier in flachen Bächen ab; Männchen verteidigen ihr Revier von bemoosten Felsen aus. Im EVACC wird jeder Stummelfußfroschbehälter über einen kleinen Schlauch mit fließendem Wasser versorgt, um die Brutplätze an den Gewässern zu simulieren, in denen die Tiere früher heimisch waren. In einem dieser Ersatzbäche bemerke ich eine Schnur perlenähnlicher Eier. Auf einem Whiteboard neben dem Terrarium hat jemand aufgeregt notiert, dass einer der Frösche Eier gelegt hat: »Depositó huevos!!«
Das EVACC befindet sich mehr oder weniger mitten im Verbreitungsgebiet der Panama-Stummelfußfrösche, ist aber vollkommen von der Außenwelt abgeschottet. Es kommt nichts ins Gebäude, bevor es nicht gründlich desinfiziert worden ist, einschließlich der Frösche, die vorher mit einer Chlorlösung gereinigt werden. Menschliche Besucher müssen Spezialschuhe tragen und Taschen, Rucksäcke und Gerätschaften, die sie im Feld benutzt haben, draußen lassen. Das Wasser, das in die Terrarien fließt, wird zuvor gefiltert und besonders behandelt. Durch seine Isolation wirkt das Zentrum wie ein U-Boot oder, vielleicht treffender, wie die Arche während der Sintflut.
Der Direktor des EVACC, der Panamaer Edgardo Griffith, ist groß und breitschultrig, hat ein rundliches Gesicht und ein strahlendes Lächeln. In jedem Ohr trägt er einen Silberring und am linken Schienbein ein großes Tattoo in Form eines Krötenskeletts. Er ist Mitte dreißig, hat einen Großteil seines Erwachsenenlebens den Amphibien von El Valle gewidmet und seine Frau – eine US-Amerikanerin, die als Freiwillige des Peace Corps nach Panama kam – mit seiner Passion für Frösche angesteckt. Es war Griffith, der die ersten Froschkadaver in der Gegend bemerkte; viele der mehreren hundert Amphibien, die im Froschhotel unterkamen, hatte er selbst eingesammelt. (Sobald das EVACC-Gebäude fertiggestellt war, zogen die Tiere dorthin um.) Wenn das EVACC eine Arche ist, ist Griffith ihr Noah, allerdings ist er schon erheblich länger als vierzig Tage im Dienst. Ein wesentlicher Teil seiner Arbeit besteht darin, die einzelnen Frösche kennenzulernen. »Für mich hat jeder von ihnen denselben Wert wie ein Elefant«, sagt er.
Als ich mich zum ersten Mal im EVACC aufhielt, zeigte Griffith mir Vertreter von Arten, die in der Wildnis mittlerweile ausgestorben sind. Dazu gehörte neben dem Panama-Stummelfußfrosch auch »Rabbs Fransenzehen-Laubfrosch« (Ecnomiohyla rabborum), der erst 2005 als eigenständige Art identifiziert wurde. Bei meinem Besuch hatte das EVACC nur noch ein Exemplar dieses Frosches, womit offenkundig keine Möglichkeit mehr bestand, wie seinerzeit Noah wenigstens ein Pärchen zu retten. Der etwa zehn Zentimeter lange Frosch war grünlich braun und gelb gesprenkelt; mit seinen übergroßen Füßen sah er aus wie ein unbeholfener Teenager. Das Habitat der Fransenzehen-Laubfrösche waren die Wälder oberhalb von El Valle; eine Eigenheit der Art bestand darin, dass die Weibchen ihre Eier in Baumhöhlungen ablegten. In einem ungewöhnlichen, vielleicht sogar einzigartigen Arrangement kümmerten sich die Froschmännchen um die Kaulquappen, indem sie sich von den Jungen buchstäblich die Haut vom Rücken fressen ließen. Griffith befürchtete, dass dem EVACC-Team bei der ersten, überstürzten Sammelaktion wahrscheinlich eine Vielzahl von Amphibienarten entgangen waren, die in der Zwischenzeit vermutlich verschwunden sind. Wie viele, ist schwer zu sagen, die Forscher wissen ja selbst nicht, welche Arten in der Gegend ursprünglich lebten. »Leider verlieren wir all diese Amphibien, bevor wir auch nur wissen, dass sie jemals existiert haben«, sagte er mir.
»Sogar den normalen Leuten in El Valle fällt es auf«, erzählte er. »Sie fragen mich: ›Was ist mit den Fröschen passiert? Wir hören sie gar nicht mehr quaken.‹«
Als vor einigen Jahrzehnten die ersten Meldungen über den drastischen Rückgang der Froschbestände kursierten, reagierten einige der sachkundigsten Fachleute auf diesem Gebiet äußerst skeptisch. Schließlich gehören Amphibien seit je zu den großen Überlebenskünstlern auf der Erde. Die Vorfahren der heutigen Frösche krochen vor 400 Millionen Jahren aus dem Wasser, und vor 250 Millionen Jahren entwickelten sich die ersten Vertreter, aus denen die heutigen Ordnungen der Amphibien oder Lurche hervorgegangen sind – die erste Ordnung umfasst die Froschlurche mit Fröschen, Kröten und Unken, die zweite die Schwanzlurche mit Molchen und Salamandern und die dritte die seltsamen Schleichenlurche, die keine Gliedmaßen besitzen. Lurche gibt es also schon länger als Säugetiere oder Vögel. Sie waren sogar schon vor den Dinosauriern da.
Die meisten Amphibien – das Wort leitet sich vom altgriechischen Adjektiv amphibios ab, das so viel bedeutet wie »doppellebig« – sind immer noch eng mit dem Wasser verbunden. (Die alten Ägypter glaubten, Frösche würden während des jährlichen Nilhochwassers von Land und Wasser gezeugt.) Ihre schalenlosen Eier müssen feucht gehalten werden, damit sie sich entwickeln können. Es gibt viele Frösche, die wie der Panama-Stummelfußfrosch ihre Eier in Bächen ablegen. Andere legen sie in vorübergehend vorhandene Tümpel, in die Erde oder in Nester, die sie aus Schaum bauen. Außerdem gibt es noch Frösche, die ihre Eier auf dem Rücken, in Beuteln oder um die Hinterbeine gewickelt tragen. Bis vor Kurzem existierten zwei Arten von Magenbrüterfröschen, die ihre Eier im Magen austrugen, bis die Jungfrösche aus dem Maul der Mutter schlüpften.
Amphibien entstanden zu einer Zeit, als die gesamte Landmasse der Erde noch einen einzigen Kontinent bildete, Pangaea genannt. Als Pangaea auseinanderbrach, passten sie sich den Bedingungen aller Kontinente außer der Antarktis an. Weltweit hat man bislang knapp über siebentausend Arten identifiziert, von denen die meisten in den tropischen Regenwäldern zu finden sind; es gibt allerdings einzelne Arten, die wie zum Beispiel der Australische Sandfrosch (Arenophryne rotunda) in der Wüste oder wie der Waldfrosch (Rana sylvatica oder Lithobates sylvaticus) nördlich des Polarkreises leben. Mehrere verbreitete nordamerikanische Froscharten wie der Spring Peeper (Pseudacris crucifer) können im Winter sogar Phasen überleben, in denen ihre Körper gefroren sind wie Eis am Stil. Aufgrund ihrer langen Evolutionsgeschichte können selbst Amphibiengruppen, die aus Sicht des Menschen recht ähnlich wirken, genetisch so verschieden sein wie Fledermäuse und Pferde.
David Wake, einer der Autoren des Artikels, der mich nach Panama führte, gehört zu den Fachleuten, die anfangs nicht an ein Verschwinden der Amphibien glaubten. Das war Mitte der achtziger Jahre. Doch dann kamen seine Studenten mit leeren Händen von ihren Exkursionen in die Sierra Nevada zurück, wo sie Frösche hatten sammeln sollen. Aus seiner eigenen Studentenzeit in den Sechzigern hatte Wake noch in Erinnerung, dass man dort den Fröschen kaum aus dem Weg gehen konnte. »Wenn man durch die Wiesen lief, trat man versehentlich darauf«, erzählte er mir. »Sie waren einfach überall.« Wake vermutete, seine Studenten hätten an den falschen Stellen gesucht oder einfach nicht gewusst, worauf sie achten sollten. Dann berichtete ihm ein Postdoktorand mit mehrjähriger Sammelerfahrung, dass auch er keine Amphibien finden konnte. »Ich sagte: ›Okay, ich fahre mit dir hin, und wir gehen an einige altbewährte Plätze‹«, erinnerte sich Wake. »Aber als ich ihn an diese altbewährte Stelle brachte, fanden wir vielleicht zwei Kröten.«
Es war nicht zuletzt die geografische Streuung, die das Phänomen so mysteriös machte: Die Frösche verschwanden nicht nur aus dicht besiedelten Gebieten, wo der Mensch ihre Lebensräume störte, sondern auch aus relativ unberührten Gegenden wie den Anden oder den zentralamerikanischen Gebirgen. Ende der achtziger Jahre fuhr eine US-amerikanische Herpetologin in das Monteverde-Nebelwaldreservat im Norden von Costa Rica, um das Fortpflanzungsverhalten der Goldkröte (Bufo periglenes oder Incilius periglenes) zu erforschen.3 (Die inzwischen als ausgestorben eingestufte Goldkröte war leuchtend gelborange und ganz entfernt mit dem Panama-Stummelfußfrosch verwandt, der ebenfalls Ohrdrüsen besitzt und zur Familie der Kröten gehört.) Um diese Zeit stellten Biologen in Zentral-Costa-Rica fest, dass die Bestände mehrerer heimischer Froscharten eingebrochen waren. Seltene, höchst spezialisierte Spezies waren ebenso betroffen wie weiter verbreitete Arten. In Ecuador verschwand die Jambato-Kröte (Atelopus longirostris), ein regelmäßiger Gartenbesucher, innerhalb weniger Jahre. In Nordostaustralien war der Southern Day Frog (Taudactylus diurnus), der früher zu den am häufigsten vorkommenden Froscharten der Region zählte, nicht mehr zu finden.
Der erste Hinweis auf die Ursache, die Frösche von Queensland bis Kalifornien dahinraffte, kam – vielleicht ironischerweise – von einem Zoo. Der National Zoo in Washington, D. C., hatte erfolgreich über mehrere Generationen hinweg Blaue Pfeilgiftfrösche (Dendrobates tinctorius azureus) gezüchtet, die in Suriname heimisch sind. Praktisch von heute auf morgen fielen die Frösche in den Terrarien des Zoos einer nach dem anderen tot um. Ein Veterinärpathologe des Zoos nahm Proben der toten Frösche und untersuchte sie mit einem Elektronenmikroskop. Auf der Haut der Tiere entdeckte er einen seltsamen Mikroorganismus, den er schließlich als Pilz aus der Abteilung der Töpfchenpilze identifizierte.
Töpfchenpilze sind nahezu überall zu finden, in Baumwipfeln ebenso wie tief im Erdreich. Diese spezielle Art hatte man jedoch noch nie gesehen. Sie war so ungewöhnlich, dass man sie keiner der bislang bekannten Gattungen zuordnen konnte. Die Spezies erhielt den Namen Batrachochytrium dendrobaditis – das griechische Wort batrachos heißt »Frosch« – und wird kurz BD oder auch Chytridpilz genannt.
Der Veterinärpathologe schickte Proben von infizierten Fröschen im National Zoo an einen Mykologen der University of Maine. Dieser legte Pilzkulturen an und schickte einige wieder nach Washington. Als man dort gesunde Blaue Pfeilgiftfrösche den im Labor gezüchteten Chytridpilzen aussetzte, erkrankten sie und starben innerhalb von drei Wochen. Weitere Untersuchungen ergaben, dass Chytridpilze die Fähigkeit der Frösche beeinträchtigen, lebenswichtige Elektrolyte über die Haut aufzunehmen. Letztlich erleiden sie so etwas wie einen Herzinfarkt.
Das EVACC wird ständig weiter ausgebaut. In der Woche, die ich dort verbrachte, half eine Gruppe US-amerikanischer Freiwilliger beim Bau von Ausstellungsräumen. Da sie für die Öffentlichkeit zugänglich sein sollten, mussten sie aus Gründen der Biosicherheit vom übrigen Zentrum getrennt sein und über einen separaten Eingang verfügen. In den Mauern befanden sich Öffnungen, in die später Vitrinen und Terrarien montiert werden sollten, und rund um diese Löcher hatte jemand eine Berglandschaft gemalt, die große Ähnlichkeit mit dem Panorama draußen vor der Tür hatte. Glanzlicht der Ausstellung sollte ein großes Terrarium mit Panama-Stummelfußfröschen werden, und die Freiwilligen versuchten nun, für sie eine Betonlandschaft mit einem meterhohen Wasserfall zu bauen. Da es jedoch Probleme mit der Pumpe gab und Ersatzteile in einem Tal ohne entsprechendes Fachgeschäft schwer zu bekommen waren, hingen die Freiwilligen häufig herum und warteten.
Ich verbrachte viel Zeit mit ihnen. Sie alle waren passionierte Froschfreunde wie Griffith. Mehrere von ihnen arbeiteten, wie ich erfuhr, in den Vereinigten Staaten als Tierpfleger mit Amphibien. (Einer erzählte mir, dass Frösche seine Ehe ruiniert hatten.) Ich war berührt von der Hingabe dieser Gruppe – sie zeigte dasselbe Engagement wie das Team, das die Frösche ins »Froschhotel« gebracht und das EVACC aufgebaut und in Betrieb genommen hatte, auch wenn es noch längst nicht fertig war. Aber gleichzeitig konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die gemalten grünen Berge und der künstliche Wasserfall etwas ungemein Trauriges ausstrahlten.
Da mittlerweile in den Wäldern rund um El Valle nahezu keine Frösche mehr leben, leuchtet allen ein, wie sinnvoll es war, die Tiere ins EVACC zu bringen. Aber je länger die Frösche im Zentrum bleiben, umso schwieriger lässt sich vermitteln, was sie dort sollen. Der Chytridpilz braucht, wie sich herausgestellt hat, keine Amphibien, um zu überleben. Selbst wenn er sämtliche Lurche der Umgebung getötet hat, wird er also fortbestehen und weiter sein Unwesen treiben. Würde man die Stummelfußfrösche aus dem EVACC wieder zurück in die Berge um El Valle entlassen, würden sie erkranken und sterben. (Der Pilz lässt sich zwar durch Desinfektionsmittel vernichten, aber es liegt auf der Hand, dass man unmöglich einen ganzen Regenwald desinfizieren kann.) Jeder, mit dem ich im EVACC sprach, versicherte mir, Ziel des Zentrums sei es, die Tiere so lange zu behalten, bis man sie freilassen könne, um im Regenwald einen neuen Bestand aufzubauen; zugleich räumten jedoch alle ein, dass sie keine Idee hatten, wie das gehen sollte.
»Wir können nur hoffen, dass sich irgendwie alles zusammenfügt«, sagte mir Paul Crump, ein Herpetologe vom Zoo in Houston, der das stockende Wasserfallprojekt leitete. »Darauf hoffen, dass irgendetwas passiert und wir in der Lage sind, das Puzzle zusammenzusetzen, und alles wieder so wird wie früher, was sich jetzt, wenn ich es laut ausspreche, ziemlich blöd anhört.«
»Es geht darum, dass wir sie wieder zurückbringen können. Aber das kommt mir von Tag zu Tag mehr wie eine Fantasievorstellung vor«, sagte Griffith.
Der Chytridpilz machte keineswegs Halt, nachdem er El Valle erobert hatte, sondern breitete sich weiter nach Osten aus. Auch aus der Gegenrichtung drang er von Kolumbien nach Panama vor. Er eroberte das südamerikanische Hochland sowie die Ostküste Australiens, gelangte nach Neuseeland und Tasmanien. Er raste durch die Karibik und wurde bereits in Italien, Spanien, der Schweiz und Frankreich entdeckt. In den USA breitet er sich offenbar nicht in einer großen Welle, sondern in einer Reihe kleinerer Wellen strahlenförmig von mehreren Punkten aus. Gegenwärtig ist er allem Anschein nach nicht aufzuhalten.
Biologen sprechen von »Hintergrundaussterben«, wie in der Akustik von »Hintergrundrauschen« die Rede ist. In normalen Zeiten – »Zeiten« meint hier ganze Epochen der Erdgeschichte – sterben nur sehr selten Arten aus, sogar noch seltener, als neue Spezies entstehen, und die natürliche Häufigkeit bezeichnet man als Hintergrundaussterberate. Sie variiert von einer Organismengruppe zur anderen und wird häufig in Aussterben pro Millionen Speziesjahren ausgedrückt. Die Berechnung der Hintergrundaussterberate ist eine mühsame Aufgabe, man muss ganze Fossiliendatenbanken durchforsten. Für die wohl am gründlichsten erforschte Gruppe, die Säugetiere, geht man von einem Wert von etwa 0,25 pro Millionen Speziesjahren aus.4 Da es gegenwärtig ungefähr 5500 Säugetierarten gibt, würde man erwarten, dass – grob geschätzt – etwa alle siebenhundert Jahre eine Spezies verschwindet.
Die fünf Massenextinktionen, die sich anhand von Ablagerungen mariner Fossilien rekonstruieren lassen, führten jeweils auf der Ebene der Familien zu einem starken Rückgang der Vielfalt. Wenn nur eine Art pro Familie durchkam, gilt die Familie als Überlebende; auf der Ebene der Arten waren die Verluste deutlich größer.
Bei einem Massenaussterben ist es anders. Aus einem Hintergrundrauschen wird ein lauter Knall, und die Artensterberaten schnellen in die Höhe. Die britischen Paläontologen Anthony Hallam und Paul Wignall, die viel zu diesem Thema geschrieben haben, definieren Massenaussterben als Ereignisse, die »einen signifikanten Anteil der Lebewesen auf der Welt in einem geologisch unbedeutenden Zeitraum« eliminieren.5 Ein weiterer Fachmann, der Paläontologe David Jablonski, charakterisiert Massenaussterben als »erhebliche Verluste an Artenvielfalt«, die sich schnell vollziehen und »globale Ausmaße« haben.6 Der Paläontologe Michael Brenton, der das Massenaussterben am Ende des Perms eingehend erforscht hat, verwendet das Bild des Lebensbaums: »Bei einem Massenaussterben werden große Teile des Baums abgehackt, als würden wildgewordene Verrückte mit Äxten darauf losgehen.«7 Ein fünfter Paläontologe, David Raup, versucht, die Sache aus der Sicht der Opfer zu betrachten: »Arten sind die meiste Zeit über nur einem geringen Aussterberisiko ausgesetzt.« Aber »dieser Zustand relativer Sicherheit wird nur gelegentlich durch Zeiten mit stark erhöhtem Risiko unterbrochen. Lange Phasen der Langeweile wechseln ab mit Augenblicken der Panik.«8
In Zeiten des Umbruchs können ganze Gruppen ehemals dominanter Organismen verschwinden oder auf untergeordnete Rollen reduziert werden; es ist, als würde auf der Erde das Ensemble ausgetauscht. Solche umfassenden Verluste veranlassten Paläontologen zu der Annahme, dass bei Massenaussterbeereignissen – außer den sogenannten Großen Fünf gab es noch zahlreiche kleinere – die üblichen Überlebensregeln außer Kraft gesetzt werden. Die Bedingungen verändern sich so drastisch und/oder so plötzlich, dass die Evolutionsgeschichte kaum noch zählt. Tatsächlich erweisen sich unter derart ungewöhnlichen Umständen vielleicht gerade jene Merkmale als fatal, die für den Umgang mit gewöhnlichen Bedrohungen besonders nützlich waren.
Für Amphibien hat bislang niemand die Hintergrundaussterberate wissenschaftlich berechnet, unter anderem wohl, weil Amphibienfossilien so selten sind. Es ist jedoch nahezu sicher, dass sie niedriger liegt als bei Säugetieren.9 Wahrscheinlich stirbt etwa alle tausend Jahre irgendwo auf der Welt eine Amphibienart aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch Zeuge eines solchen Ereignisses wird, geht also gegen null. Aber Edgardo Griffith hat bereits mehrere Amphibienarten aussterben sehen. Das gilt für nahezu jeden Herpetologen, der im Feld arbeitet. (Während der Recherchen zu diesem Buch begegnete selbst ich einer Spezies, die seither ausgestorben ist, und drei oder vier weiteren, die wie der Panama-Stummelfußfrosch nicht mehr in freier Wildbahn vorkommen.) »Ich habe eine Karriere in der Herpetologie angestrebt, weil ich gerne mit Tieren arbeite«, schrieb Joseph Mendelson, ein Herpetologe im Zoo von Atlanta. »Damals ahnte ich nicht, dass diese Tätigkeit irgendwann der Paläontologie ähneln würde.«10
Gegenwärtig genießen Amphibien die zweifelhafte Ehre, die am stärksten bedrohte Tierklasse der Erde zu sein. Berechnungen zufolge könnte ihre Aussterberate derzeit bis zu 45 000-mal höher sein als die Hintergrundrate.11 Doch auch bei vielen anderen Gruppen nähern sich die Raten jener der Amphibien. Experten schätzen, dass ein Drittel aller riffbildenden Korallen, ein Drittel aller Süßwassermollusken, ein Drittel der Haie und Rochen, ein Viertel aller Säugetiere, ein Fünftel aller Reptilien und ein Sechstel aller Vögel vom Aussterben bedroht sind.12 Überall kommt es zu Verlusten: im Südpazifik und im Nordatlantik, in der Arktis und der Sahelzone, in Seen und auf Inseln, auf Bergen und in Tälern. Wer weiß, worauf er achten muss, findet wahrscheinlich in seinem Garten Anzeichen des gegenwärtigen Artensterbens.
Das Verschwinden von Arten hat alle möglichen Gründe, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Verfolgt man den Prozess aber weit genug zurück, stößt man unweigerlich auf ein und denselben Schuldigen: »eine unkrautartig wuchernde Spezies«.
Der Chytridpilz ist in der Lage, sich eigenständig fortzubewegen. Er bringt mikroskopisch kleine Sporen mit langen, dünnen Schwänzen hervor, die in Bächen oder ablaufendem Regenwasser größere Distanzen zurücklegen können. (Wahrscheinlich drang die Plage in Panama auf diese Weise nach Osten vor.) Diese Art der Ausbreitung kann allerdings nicht erklären, wieso der Pilz mehr oder weniger gleichzeitig in so vielen Teilen der Erde aufgetaucht ist – in Mittelamerika, Südamerika, Nordamerika, Australien. Nach einer Theorie verbreitete sich der Chytridpilz mit Ladungen Afrikanischer Krallenfrösche, die in den fünfziger und sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts für Schwangerschaftstests verwendet wurden, über die ganze Welt. (Injiziert man Krallenfroschweibchen den Urin einer Schwangeren, legt es innerhalb von Stunden Eier.) Afrikanische Krallenfrösche sind zwar weithin mit dem Chytridpilz infiziert, werden aber bezeichnenderweise nicht von ihm beeinträchtigt. Eine zweite Theorie geht davon aus, dass der Pilz sich durch Nordamerikanische Ochsenfrösche ausbreitete, die teils versehentlich nach Europa, Asien und Südamerika gelangten, teils als Lebensmittel gezielt dorthin exportiert wurden. Auch ihnen kann der Chytridpilz nichts anhaben. Die erste Theorie bezeichnet man als »Out-of-Africa-Hypothese«, die zweite könnte man »Froschschenkelsuppen-Hypothese« nennen.
In beiden Fällen ist die Ursache dieselbe: Ein Frosch mit Chytridpilzen wäre niemals von Afrika nach Australien oder von Nordamerika nach Europa gelangt, wenn ihn nicht jemand auf ein Schiff oder in ein Flugzeug geladen und dorthin verfrachtet hätte. Wir mögen diese interkontinentale Durchmischung heute völlig normal finden, in der dreieinhalb Milliarden Jahre langen Geschichte des Lebens ist sie aber vermutlich beispiellos.
Obwohl sich der Chytridpilz inzwischen in ganz Panama ausgebreitet hat, macht sich Griffith nach wie vor gelegentlich auf die Suche nach überlebenden Fröschen, um sie für das EVACC zu sammeln. Ich hatte meinen Besuch so geplant, dass er mit einer dieser Exkursionen zusammenfiel, und machte mich mit ihm und zwei Freiwilligen, die am Wasserfall arbeiteten, auf den Weg. Wir überquerten den Panamakanal und verbrachten die Nacht in der Region Cerro Azul in einem Gästehaus, das von einem zweieinhalb Meter hohen Metallzaun umgeben war. Bei Morgengrauen fuhren wir zur Ranger-Station am Eingang des Nationalparks Chagres. Griffith hoffte, Weibchen von zwei Froscharten zu finden, die im EVACC knapp waren. Er holte seine amtliche Sammelgenehmigung heraus und zeigte sie den verschlafenen Parkwächtern. Ein paar unterernährte Hunde kamen heraus und beschnüffelten unseren Wagen.
Hinter dem Eingang verwandelte sich die Straße in eine Abfolge von Schlaglöchern, die durch tiefe Fahrrinnen verbunden waren. Griffith legte eine Jimi-Hendrix-CD ein, und begleitet von diesen fetzigen Rhythmen holperten wir weiter. Da man zum Fröschesammeln alle möglichen Ausrüstungsgegenstände braucht, hatte Griffith zwei Träger angeheuert. Bei der letzten Häusergruppe des Dörfchens Los Ángeles materialisierten sich die Männer aus dem Nebel. Wir rumpelten den Weg entlang, bis der Wagen nicht mehr weiterkam, dann stiegen wir aus und gingen zu Fuß weiter.
Die Piste wand sich als rotes Morastband durch den Regenwald. Alle paar hundert Meter kreuzten schmale Pfade den Hauptweg. Sie stammten von Blattschneiderameisen, die Millionen, vielleicht auch Milliarden Mal hin- und hergelaufen waren, um Blattstückchen in ihren Bau zu bringen. (Diese Ameisenbauten sehen aus wie Sägemehlhaufen und können die Ausmaße eines Stadtparks haben.) Einer der Amerikaner, Chris Bednarski vom Zoo in Houston, warnte mich vor den Soldatenameisen, deren Kiefer sich auch dann noch in die Waden krallen, wenn die Tiere längst tot sind. »Die machen dich fertig«, erklärte er. Der andere Amerikaner, John Chastain vom Zoo in Toledo, hatte einen langen Haken gegen Giftschlangen bei sich. »Zum Glück sind diejenigen, die einem wirklich zusetzen können, ziemlich selten«, versicherte Bednarski mir. In der Ferne schrien Brüllaffen. Griffith wies uns auf Jaguarspuren im weichen Boden hin.
Nach etwa einer Stunde kamen wir an einen Bauernhof, für den jemand den Wald gerodet hatte. Ein paar kümmerliche Maishalme standen auf dem Feld, aber es war kein Mensch zu sehen, und es war schwer zu sagen, ob der Bauer auf dem mageren Regenwaldboden aufgegeben hatte oder nur für einen Tag fort war. Eine Schar smaragdgrüner Papageien stieg auf. Nach einigen Stunden Fußmarsch kamen wir zu einer kleinen Lichtung. Ein Blauer Morphofalter flatterte vorbei, seine Flügel waren so blau wie der Himmel. Auf der Lichtung stand eine Hütte, aber sie war so verfallen, dass alle sich entschlossen, im Freien zu schlafen. Griffith half mir, mein Bett aufzuhängen – eine Kreuzung aus Zelt und Hängematte, die wir zwischen zwei Bäume spannten. Ein Schlitz an der Unterseite diente als Eingang, und das Dach sollte Schutz gegen den unvermeidlichen Regen bieten. Sobald ich in das Ding geklettert war, hatte ich das Gefühl, in einem Sarg zu liegen.
Am Abend kochte Griffith Reis auf einem Gaskocher. Wir setzten Stirnlampen auf und stiegen zu einem nahen Bach hinunter. Da viele Amphibien nachtaktiv sind, kann man sie nur im Dunkeln finden – eine Übung, die genauso vertrackt ist, wie es klingt. Immer wieder rutschte ich aus und verstieß gegen die oberste Sicherheitsregel im Regenwald: Greife nie nach etwas, wenn du nicht weißt, was es ist. Nach einem meiner Stürze machte Bednarski mich auf eine faustgroße Tarantel aufmerksam, die auf dem übernächsten Baum saß.
Erfahrene Jäger können nachts Frösche aufspüren, indem sie mit einer Lampe in den Wald leuchten und nach der Reflexion des Lichts in ihren Augen Ausschau halten. Die erste Amphibie, die Griffith entdeckte, war ein San-Jose-Cochran-Frosch (Cochranella euknemos), der auf einem Blatt saß. Die Art gehört zur Familie der »Glasfrösche«. Den Namen verdanken sie ihrer transparenten Haut, durch die man die Umrisse der inneren Organe erkennen kann. Dieser Glasfrosch war grün mit gelben Pünktchen. Griffith holte ein Paar Einmalhandschuhe heraus, blieb reglos stehen und schnellte dann wie ein Reiher vor, um ihn zu fangen. Mit der freien Hand strich er dem Tier mit etwas, was wie ein Wattestäbchen aussah, über den Bauch, steckte den Q-Tip in ein Plastikröhrchen – später würde er ihn in ein Labor schicken und auf Chytridpilze untersuchen lassen – und setzte den Frosch wieder auf das Blatt, da er nicht zu den Arten gehörte, die er suchte. Als er seine Kamera hervorholte, starrte der Frosch teilnahmslos ins Objektiv.
Wir tasteten uns weiter durch die Dunkelheit. Jemand entdeckte einen La Loma Robber Frog (Pristimantis caryophyllaceus), der genauso orangerot war wie der Waldboden; ein anderer fand einen hellgrünen, blattförmigen Warzewitsch-Frosch. Bei jedem Tier wiederholte Griffith dieselbe Prozedur: fangen, eine Probe von der Bauchhaut nehmen, fotografieren. Schließlich stießen wir auf ein Pärchen des Panamanian Robber Frog in fester Umklammerung – der Froschvariante von Sex. Griffith ließ die beiden in Ruhe.
Einer der Froschlurche, die Griffith zu fangen hoffte, der Horned Marsupial Frog (Gastrotheca cornuta), hat einen eigentümlichen Ruf, der klingt, als würde man eine Sektflasche entkorken. Als wir weitertrotteten – mittlerweile wateten wir in der Mitte des Bachs entlang –, hörten wir den Ruf, aber es klang, als käme er aus mehreren Richtungen gleichzeitig. Anfangs hatten wir den Eindruck, die Quelle des Geräuschs sei ganz in der Nähe, als wir uns näherten, schien sie sich jedoch zu entfernen. Griffith imitierte mit seinen Lippen das Korkenknallen. Schließlich meinte er, wir würden die Frösche mit unserem Geplansche verschrecken. Also watete er allein weiter; wir anderen blieben lange im knietiefen Wasser stehen und versuchten, uns nicht zu rühren. Als Griffith uns endlich zu sich winkte, fanden wir ihn vor einem großen gelben Frosch mit langen Zehen und eulenhaftem Gesicht stehen. Er saß knapp über Augenhöhe auf einem Zweig. Griffith suchte für die EVACC-Sammlung ein Weibchen dieser Spezies. Er ließ seinen Arm vorschnellen, packte den Frosch und drehte ihn um. Die Weibchen haben eine Bruttasche am Rücken, die bei diesem Exemplar leider fehlte. Griffith machte einen Abstrich, fotografierte das Tier und setzte es wieder auf den Baum.
»Du bist ein schöner Bursche«, raunte er dem Frosch zu.
Gegen Mitternacht traten wir den Rückweg ins Camp an. Die einzigen Tiere, die Griffith schließlich mitnahm, waren zwei winzige Baumsteiger (Dendrobates minutus) und ein weißlicher Salamander, den weder Griffith noch die beiden Amerikaner einordnen konnten. Sie verstauten die Frösche und den Salamander zusammen mit einigen Blättern, die sie feucht halten sollten, in Plastiktüten. Mir ging durch den Kopf, dass die Frösche und ihre Nachkommen, falls sie denn Nachkommen haben sollten, und gegebenenfalls deren Nachkommen nie wieder den Regenwaldboden berühren, sondern für den Rest ihrer Tage in desinfizierten Glasterrarien leben würden. In der Nacht schüttete es, und ich hatte in meiner sargähnlichen Hängematte wilde, unruhige Träume. Später konnte ich mich nur an eine einzige Szene erinnern: an einen leuchtend gelben Frosch, der mit Zigarettenspitze rauchte.
2. Die Mastodontenzähne
Mammut americanum
Dass Arten aussterben können, ist vielleicht die erste naturwissenschaftliche Theorie, mit der Kinder sich heutzutage auseinandersetzen müssen. Schon Einjährige bekommen Plastikdinosaurier zum Spielen, und Zweijährige begreifen zumindest vage, dass diese kleinen Figuren sehr große Tiere darstellen. Wenn sie eine schnelle Auffassungsgabe besitzen – oder in ihrer Sauberkeitserziehung Spätentwickler sind –, können schon Kinder, die noch Windeln tragen, erklären, dass es früher einmal viele Dinosaurierarten gab und alle schon lange ausgestorben sind. (Meine Söhne spielten als Kleinkinder stundenlang mit Dinosauriern, die sie auf einer Kunststoffmatte mit dem Bild eines Waldes aus dem Jura oder der Kreidezeit anordneten. In dieser Landschaft gab es einen lavaspeienden Vulkan, der ein schauriges Dröhnen von sich gab, wenn man darauf drückte.) Das alles belegt, dass uns das Aussterben von Arten als Selbstverständlichkeit erscheint. Aber das ist es keineswegs.
Aristoteles schrieb eine zehnbändige Tierkunde (die Historia animalium), ohne auch nur die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass die Tierwelt tatsächlich eine Geschichte hat. Plinius beschreibt in seiner Naturgeschichte reale Tiere und Fabelwesen, aber keine ausgestorbenen Tierarten. Auch im Mittelalter und in der Renaissance kam diese Idee noch nicht auf, als man alles im Boden Gefundene als »fossil«, als »ausgegraben« bezeichnete (daher der Begriff »fossile Brennstoffe«). In der Aufklärung herrschte die Auffassung vor, dass jede Spezies ein Glied in einer großen, unverbrüchlichen »Seinskette« darstellte. So schrieb Alexander Pope in seinem Philosophischen Lehrgedichtvom Menschen:
Die Wesen, wie sie sind, sind Theile einer Welt,
ihr Leib ist die Natur, ihr Geist Gott, der sie hält.1
Als Carl von Linné sein System der binären Nomenklatur einführte, machte er keinen Unterschied zwischen lebenden und ausgestorbenen Arten, weil es seiner Ansicht nach nicht erforderlich war. Die 1758 erschienene zehnte Auflage seines Werkes Systema Naturae listet 63 Arten des Blatthornkäfers, 34 Arten von Conus-Schnecken und 16 Arten von Plattfischen auf. Aber tatsächlich enthält dieses Werk nur eine Sorte von Tierarten: nämlich solche, die damals existierten.
Trotz zahlreicher Belege des Gegenteils hielt sich diese Sichtweise hartnäckig. Kuriositätenkabinette in London, Paris und Berlin waren voller Spuren seltsamer Lebewesen, die niemand je gesehen hatte – Überreste von Tieren, die man mittlerweile als Trilobiten, Belemniten und Ammoniten identifiziert hat. Einige Ammoniten waren so groß, dass ihre versteinerten Schalen das Ausmaß von Wagenrädern hatten. Als im 18. Jahrhundert vermehrt Mammutknochen aus Sibirien nach Europa gelangten, zwängte man auch sie in das bestehende System. Sie hatten große Ähnlichkeit mit Elefantenknochen. Da es im damaligen Russland aber eindeutig keine Elefanten gab, schloss man, dass sie zu Tieren gehört haben mussten, die die biblische Sintflut nach Norden gespült hatte.
Die Vorstellung, dass Spezies aussterben können, tauchte schließlich im revolutionären Frankreich auf, was vermutlich kein Zufall war. Zu verdanken war das weitgehend einem Tier, das heute den Namen Amerikanisches Mastodon oder Mammut americanum trägt, und dem französischen Naturforscher Jean Léopold Nicolas Frédéric Cuvier, nach einem verstorbenen Bruder kurz Georges genannt. Cuvier ist eine zwiespältige Gestalt in der Wissenschaftsgeschichte. Einerseits war er seinen Zeitgenossen weit voraus, andererseits wirkte er auf viele von ihnen auch bremsend, er konnte charmant, aber auch grausam sein, und er war visionär, zugleich aber auch reaktionär. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts gerieten viele seiner Ideen in Verruf. Allerdings bestätigen die jüngsten Entdeckungen tendenziell gerade diejenigen seiner Theorien, die am gründlichsten verteufelt wurden, mit dem Ergebnis, dass Cuviers eigentlich tragische Sicht der Erdgeschichte mittlerweile prophetisch wirkt.
Wann genau die Europäer erstmals über die Knochen eines Amerikanischen Mastodons stolperten, ist unklar. Ein einzelner Backenzahn, den man in einem Feld im Norden des Bundesstaates New York gefunden hatte, wurde 1705 nach London geschickt und als »Zahn eines Riesen« bezeichnet.2 Die ersten Mastodontenknochen, die – wie man es anachronistisch nennen könnte – eine wissenschaftliche Untersuchung erfuhren, wurden 1739 entdeckt. In jenem Jahr zog Charles le Moyne, der zweite Baron de Longueuil, mit einer vierhundert Mann starken Truppe, die aus Franzosen wie ihm, überwiegend aber aus Algonkins und Irokesen bestand, den Ohio hinunter. Der Marsch war beschwerlich und der Proviant knapp. Auf einer Etappe ernährten die Männer sich nur noch von Eicheln, wie ein französischer Soldat sich später erinnerte.3 Irgendwann, vermutlich im Herbst, schlugen Longueuil und seine Truppe ihr Lager am Ostufer des Ohio unweit der Stelle auf, an der sich heute die Stadt Cincinnati befindet. Einige der amerikanischen Ureinwohner gingen auf die Jagd und kamen nach ein paar Kilometern an ein Sumpfgebiet, aus dem Schwefelgestank aufstieg. Aus allen Richtungen führten Büffelspuren in den Sumpf, und Hunderte – vielleicht sogar Tausende – riesiger Knochen ragten aus dem Morast wie die Spieren eines Schiffswracks. Die Männer kehrten mit einem meterlangen Oberschenkelknochen, einem riesigen Stoßzahn und mehreren großen Zähnen ins Lager zurück. Jede Zahnwurzel war so groß wie eine Menschenhand und wog annähernd zehn Pfund.
Longueuil war von den Knochen so fasziniert, dass er seine Truppe anwies, sie mitzunehmen, als sie ihr Lager abbrachen. So kämpften sich die Männer mit dem gewaltigen Stoßzahn, dem Oberschenkelknochen und den Backenzähnen weiter durch die Wildnis. Schließlich erreichten sie den Mississippi und trafen dort auf ein zweites französisches Truppenkontingent. In den folgenden Monaten starben viele von Longueuils Männern an Krankheiten, und ihr Feldzug gegen die Chickasaw endete mit einer demütigenden Niederlage. Dennoch bewahrte Longueuil die seltsamen Knochen gut auf. Er schlug sich nach New Orleans durch und schickte Stoßzahn, Backenzähne und Oberschenkelknochen nach Frankreich. Dort wurden sie Ludwig XV. übergeben, der sie in sein Museum, das Cabinet du Roi, aufnahm. Noch Jahrzehnte später bestanden Landkarten des Ohio-Tales überwiegend aus weißen Flecken – bis auf den »Endroit où on a trouvé des os d'Éléphant«, den »Ort, an dem man Elefantenknochen fand«. (Heute ist dort in Kentucky ein Naturschutzgebiet mit dem Namen Big Bone Lick.)
Longueuils Knochenfunde stürzten alle, die sie untersuchten, in Verwirrung. Der Oberschenkelknochen und der Stoßzahn sahen aus, als könnten sie einem Elefanten oder einem Mammut gehört haben, was nach der damaligen Taxonomie weitgehend dasselbe war. Aber die Backenzähne des Tieres gaben Rätsel auf. Sie ließen sich nicht einordnen. Bei Elefanten (und Mammuts) sind die Zahnkronen flach und mit kleinen, quer verlaufenden Schmelzleisten versehen, so dass die Kaufläche dem Sohlenprofil eines Laufschuhs ähnelt. Mastodontenzähne haben dagegen spitze Höcker und sehen aus, als hätten sie einem Riesenmenschen gehört. Jean-Étienne Guettard, der als erster Naturkundler eines dieser Fundstücke begutachtete, lehnte es ab, auch nur Vermutungen über dessen Herkunft anzustellen.
»Von welchem Tier stammt er«, fragte er ratlos in einem Aufsatz, den er 1752 der französischen Akademie der Wissenschaften vorlegte.4
Der Leiter des königlichen naturhistorischen Kabinetts, Louis-Jean-Marie Daubenton, versuchte 1762 das Rätsel der seltsamen Zähne mit der Erklärung zu lösen, dass es sich bei dem »unbekannten Tier vom Ohio« gar nicht um ein einziges, sondern um zwei verschiedene Tiere handelte. Stoßzähne und Oberschenkelknochen stammten von Elefanten, die Backenzähne aber von einer völlig anderen Spezies, wahrscheinlich von einem Flusspferd, vermutete er.
Um diese Zeit gelangte eine zweite Sendung mit Mastodontenknochen nach Europa, dieses Mal nach London. Auch diese Funde stammten aus Big Bone Lick und hatten die gleichen verwirrenden Merkmale: Knochen und Stoßzähne ähnelten denen von Elefanten, während die Backenzähne knotige Höcker aufwiesen. William Hunter, ein Arzt im Dienst der Königin, fand, dass Daubentons Erklärung für die Diskrepanzen zu wünschen übrigließ. Er schlug eine andere Schlussfolgerung vor – die erste, die halbwegs zutraf.
Seiner Ansicht nach handelte es sich bei dem »angeblichen Amerikanischen Elefanten« um ein völlig neuartiges Tier, das »Anatomen unbekannt war«.5 Es sei ein Fleischfresser, daher habe es so furchterregende Zähne, schloss er und nannte es das Amerikanische Incognitum.
Frankreichs führender Naturkundler, Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, gab der Debatte noch eine andere Wendung. Er vertrat die Theorie, die fraglichen Überreste stammten nicht von einem oder zwei, sondern von drei verschiedenen Tieren: von einem Elefanten, einem Flusspferd und einer dritten, bislang unbekannten Art. Unter großen Vorbehalten räumte Buffon die Möglichkeit ein, dass diese Spezies – »die größte von allen« – offenbar untergegangen war.6 Das einzige Landtier, so Buffon, dem es je so ergangen sei.
In diese Kontroverse schaltete sich 1781 Thomas Jefferson ein. In seinen Betrachtungen über den Staat Virginia, die er kurz nach dem Ende seiner Amtszeit als Gouverneur dieses Bundesstaates schrieb, entwarf er seine eigenen Vorstellungen vom Incognitum. Jefferson vertrat ebenso wie Buffon die These, dass dieses »Geschöpf von fünf- bis sechsmal größerem Umfang als der Elefant« eines der größten Tiere der Erde war.7 (Das hätte die damals in Europa populäre Theorie widerlegt, wonach die Tiere der Neuen Welt kleiner und »degenerierter« waren als die der Alten Welt.) Wie Hunter hielt er es für einen Fleischfresser, glaubte aber im Gegensatz zu ihm, dass es irgendwo da draußen noch existierte. Selbst wenn es in Virginia nicht mehr zu finden sei, durchstreife es andere Gegenden des Kontinents, die sich »noch in ihrem ursprünglichen Zustand« befänden, da »weder wir noch andere sie erforscht oder verändert« hätten.8 Als Präsident schickte Jefferson Meriwether Lewis und William Clark auf eine Expedition in den Nordwesten Amerikas in der Hoffnung, dass sie in den Wäldern noch lebende Incognitum-Exemplare finden würden.
Denn er war überzeugt: »Die Haushaltung der Natur ist so beschaffen, daß man noch kein Beispiel anführen kann, wo sie eine ihrer Tierarten hätte aussterben lassen oder irgendein Glied ihrer großen Kette so schwach gebildet hätte, daß es zerbrochen wäre«.9
Cuvier kam 1795 nach Paris, ein halbes Jahrhundert nachdem die Knochenfunde aus Ohio in der Stadt eingetroffen waren. Er war damals fünfundzwanzig Jahre alt, hatte weit auseinanderliegende graue Augen, eine große Nase und ein Temperament, das einer seiner Freunde mit der Erdoberfläche verglich: im Allgemeinen kühl, aber zu heftigen Erschütterungen und Ausbrüchen fähig.10 Cuvier war in einer Kleinstadt an der Schweizer Grenze aufgewachsen und kannte kaum jemanden in der Hauptstadt. Dennoch war es ihm gelungen, sich dort eine angesehene Stellung zu sichern, was er einerseits dem Niedergang des absolutistischen Regimes und andererseits seinem außergewöhnlichen Selbstbewusstsein zu verdanken hatte. Ein älterer Kollege sagte später über ihn, er sei in Paris »wie ein Pilz« aus dem Boden geschossen.11
Im Pariser Naturkundemuseum – dem demokratischen Nachfolger des königlichen Naturkundekabinetts – war Cuvier offiziell als Dozent angestellt. Aber in seiner Freizeit stürzte er sich in die Museumssammlung. Stundenlang untersuchte er die Knochen, die Longueuil an Ludwig XV. geschickt hatte, und verglich sie mit anderen. Am 4. April 1796 – beziehungsweise nach dem damals geltenden Revolutionskalender am 15. Germinal des Jahres 4 – präsentierte er seine Forschungsergebnisse in einem öffentlichen Vortrag.
Zunächst erörterte Cuvier die Elefanten. Europäer wussten seit Langem, dass es in Afrika Elefanten gab, die als gefährlich galten, und in Asien solche, die leichter zu zähmen waren. Aber Elefanten blieben Elefanten, wie es auch bei Hunden sanftere und wildere gab. Bei seinen Untersuchungen der im Museum vorhandenen Elefantenknochen, darunter ein besonders gut erhaltener Schädel aus Ceylon und einer vom Kap der Guten Hoffnung, hatte Cuvier – natürlich völlig richtig – erkannt, dass beide unterschiedlichen Spezies angehörten.12
»Es ist klar, dass der Elefant aus Ceylon sich von dem aus Afrika stärker unterscheidet als das Pferd vom Esel oder die Ziege vom Schaf«, erklärte er. Zu den zahlreichen Unterscheidungsmerkmalen der Tiere gehörten ihre Zähne. Der Elefant aus Ceylon hatte Backenzähne mit welligen Lamellen »wie Girlanden«, während sie bei Elefanten vom Kap der Guten Hoffnung rautenförmig angeordnet waren. Diesen Unterschied hätte die Betrachtung lebender Tiere nicht offenbaren können, denn wer habe schon den Mut, einem Elefanten ins Maul zu schauen? »Allein der Anatomie hat die Zoologie diese interessante Entdeckung zu verdanken«, schloss Cuvier.13
Sobald er die Elefanten erfolgreich in zwei Arten unterteilt hatte, setzte er seine Zergliederung fort. Nach »gründlicher Untersuchung« der Indizien kam er zu dem Schluss, dass die anerkannte Theorie über die Riesenknochen aus Russland falsch war. Die Zähne und Kieferknochen aus Sibirien »gleichen nicht exakt jenen eines Elefanten«. Vielmehr gehörten sie zu einer völlig anderen Spezies. Und was die Zähne des Tieres aus Ohio anginge, so sei ein Blick »ausreichend, um zu erkennen, dass sie sich noch stärker unterscheiden«.
»Was wurde aus diesen beiden riesigen Tieren, von denen man keine lebendigen Spuren mehr findet«, fragte er. Seiner Ansicht nach beantwortete sich diese Frage von selbst: Sie waren espèces perdues, untergegangene Arten. Damit hatte Cuvier die Zahl der ausgestorbenen Wirbeltierarten bereits von (möglicherweise) einer auf zwei verdoppelt. Aber er kam gerade erst in Schwung.
Einige Monate zuvor hatte er Skizzen eines Skeletts bekommen, das man am Ufer des Rio Lujàn westlich von Buenos Aires gefunden hatte. Dieses – 3,60 Meter lange und 1,80 breite – Skelett hatte man nach Madrid gebracht und dort in mühevoller Kleinarbeit zusammengesetzt. Anhand der Skizzen erkannte Cuvier darin – wiederum zutreffend – ein befremdlich übergroßes Faultier, das er Megatherium, »Riesentier«, nannte. Obwohl er nie nach Argentinien oder überhaupt weiter als nach Deutschland gereist war, war er überzeugt, dass das Megatherium





























