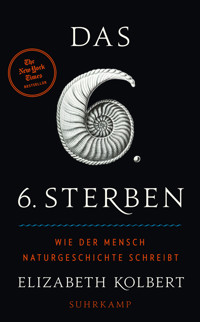13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Klima verändert sich, weil wir das Klima verändern. So tiefgreifend beeinflusst unser Handeln den Planeten, dass Wissenschaftler vom Erdzeitalter des Menschen sprechen, dem Anthropozän. Wir stehen vor einem Dilemma: Unsere Eingriffe in die Umwelt haben uns an einen Punkt geführt, an dem weitere Interventionen womöglich die letzte Hoffnung im Kampf gegen die globale Erderwärmung sind. Vielleicht sind sie aber auch der letzte Schritt auf dem Weg in die Klimakatastrophe.
In ihrem neuen Buch gewährt uns Elizabeth Kolbert einen Blick auf die Natur der Zukunft. Die Pulitzer-Preisträgerin erzählt von Ingenieuren, die mit aberwitzigen Folgen für das Ökosystem den Verlauf von Flüssen ändern oder ganze Küstenstreifen vor dem ansteigenden Meerwasser schützen. Sie trifft Biologen, die den Teufelskärpfling, den wohl seltensten Fisch der Erde, retten wollen, und sie berichtet von den kühnen Plänen, CO2 aus der Luft zu saugen oder winzig kleine Diamanten in der Stratosphäre zu verteilen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
Elizabeth Kolbert
Wir Klimawandler
Wie der Mensch die Natur der Zukunft erschafft
Aus dem Englischen von Ulrike Bischoff
Suhrkamp
Widmung
Meinen Jungs
Motto
Er weiß, daß er mit diesem Hammer keinen Splitter von der Mauer schlagen kann, er will es auch nicht, er streicht nur manchmal leicht mit dem Hammer über die Wände, als könne er mit ihm das Taktzeichen geben, das die große wartende Maschinerie der Rettung in Bewegung setzt. Es wird nicht genauso sein, die Rettung wird einsetzen in ihrer Zeit, unabhängig vom Hammer, aber irgend etwas ist er doch, etwas Handgreifliches, eine Bürgschaft, etwas, was man küssen kann, wie man die Rettung niemals wird küssen können.
Franz Kafka, Fragmente aus Heften und losen Blättern
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Motto
Inhalt
I
Flussabwärts
1
2
II
In die Wildnis
3
4
5
III
In die Luft
6
7
8
Danksagung
Bildnachweise
Fußnoten
Anmerkungen
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
IFlussabwärts
1
Flüsse eignen sich gut als Metapher – vielleicht zu gut. Sie können trüb und bedeutungsschwanger sein wie der Mississippi, der für Mark Twain »ein unangenehmer und überaus ernster Lesestoff« war.1 Sie können aber auch hell, klar und spiegelnd sein. Als Henry David Thoreau eine Woche lang auf dem Concord River und dem Merrimack River unterwegs war, geriet er bereits am ersten Tag in den Bann der Spiegelungen, die er auf dem Wasser sah. Flüsse können symbolisch für das Schicksal stehen oder für Erkenntnis oder für die Begegnung mit etwas, was man lieber nicht wissen möchte. »Den Fluß hinaufzufahren war, als reiste man zurück zu den frühesten Anfängen der Welt, in eine Zeit, da die Pflanzen die Erde überwucherten«, erinnert sich Joseph Conrads Romanfigur Marlow.2 »Man kann nicht zwei Mal in denselben Fluss steigen«, soll Heraklit gesagt haben, worauf einer seiner Anhänger, Kraylos, erwiderte: »Man kann nicht ein einziges Mal in denselben Fluss steigen.«
Es ist ein strahlender Morgen nach mehreren Regentagen, als ich auf dem Chicago Sanitary and Ship Canal fahre. Er ist eigentlich kein richtiger Fluss, sondern ein knapp fünfzig Meter breiter, schnurgerader Kanal. Auf dem Wasser, das die Farbe von altem Pappkarton hat, schwimmen Bonbonpapierchen und Styroporschnipsel. An diesem Morgen sind hier vor allem Frachtkähne mit Sand, Kies und petrochemischen Produkten unterwegs. Die einzige Ausnahme ist das Boot, auf dem ich mich befinde, ein Ausflugsboot namens City Living.
Die City Living ist mit wollweißen Sitzbänken und einer Markise ausgestattet, die in der Brise flattert. An Bord sind außer mir noch der Eigner und Kapitän des Bootes und einige Mitglieder einer Gruppe, die sich Friends of the Chicago River nennt. Die Freunde sind nicht gerade das, was man anspruchsvoll nennen würde. Bei ihren Ausflügen waten sie häufig knietief in Schmutzwasser, um es auf coliforme Bakterien aus Fäkalien zu testen. Unsere Expedition soll auf dem Kanal weiter nach Süden führen, als sie je zuvor gefahren sind. Alle sind aufgeregt und, ehrlich gesagt, auch ein bisschen ängstlich.
Wir sind vom Lake Michigan über den South Branch des Chicago River in den Kanal gelangt und fahren nun nach Westen, vorbei an Bergen von Streusalz, Schrott und rostenden Containern. Knapp hinter dem Stadtrand passieren wir die Auslassrohre des Klärwerks Stickney, des angeblich größten der Welt. Von Deck der City Living können wir das Klärwerk zwar nicht sehen, wohl aber riechen. Das Gespräch wendet sich den letzten Regenfällen zu. Sie haben die Abwassersysteme der Region überfordert und zu einer »Überflutung der Mischkanalisation« geführt. Wir spekulieren, welche »Schwimm- und Schwebstoffe« dabei wohl freigesetzt wurden. Jemand fragt sich, ob wir im Chicago River auf »Weißfische« treffen werden, wie gebrauchte Kondome im hiesigen Slang genannt werden. Wir tuckern weiter. Schließlich mündet ein weiterer Kanal in den Sanitary and Ship Canal, der sogenannte Cal-Sag. An ihrem Zusammenfluss liegt ein V-förmiger Park mit malerischen Wasserfällen – künstlich angelegt wie fast alles auf unserer Route.
Wenn Chicago die Stadt der breiten Schultern ist, könnte man den Sanitary and Ship Canal als ihren übergroßen Schließmuskel bezeichnen. Bevor er ausgebaggert wurde, wanderten sämtliche Abwässer der Stadt – mit menschlichen Exkrementen, Rindergülle, Schafdung und den verwesenden Eingeweiden aus den Schlachthöfen – in den Chicago River, der an manchen Stellen so verschmutzt war, dass ein Huhn angeblich von einem Ufer ans andere gehen konnte, ohne nasse Füße zu bekommen. Der ganze Unrat gelangte mit dem Fluss in den Lake Michigan, der damals wie heute die einzige Trinkwasserquelle der Stadt war. Regelmäßig kam es zu Typhus- und Choleraausbrüchen.
Der Kanal, der im ausgehenden 19. Jahrhundert gebaut und zu Beginn des 20. Jahrhunderts eröffnet wurde, stellte den Chicago River sozusagen auf den Kopf und zwang ihn, seine Fließrichtung zu ändern, so dass Chicagos Abwässer nicht mehr in den Lake Michigan, sondern von der Stadt fort in den Des Plaines River und von dort in den Illinois, den Mississippi und letztlich in den Golf von Mexiko flossen. »Das Wasser des Chicago River hat nun Ähnlichkeit mit Flüssigkeit«, lautete damals eine Schlagzeile in der New York Times.3
Die Fließrichtung des Chicago River umzukehren war das umfangreichste öffentliche Bauprojekt seiner Zeit, ein Musterbeispiel für das, was man ohne jede Ironie als Naturbeherrschung bezeichnete. Es dauerte sieben Jahre, den Kanal auszubaggern, und erforderte die Entwicklung völlig neuer Technologien – wie die Förderanlage von Mason & Hoover oder die Schrägförderanlage von Heidenreich –, die zusammen als Chicagoer Erdbewegungsschule (Chicago School of Earth Moving) bekannt wurden.4 Insgesamt grub man über dreißig Millionen Kubikmeter Erde und Gestein aus, genug, um eine zweieinhalb Quadratkilometer große und 15 Meter hohe Insel aufzuschütten, wie ein Kommentator voller Bewunderung ausrechnete.5 Der Fluss prägte die Stadt, und die Stadt gestaltete den Fluss um.
Aber mit der Umkehrung der Fließrichtung des Chicago River wurde nicht nur Abwasser nach St. Louis geleitet, sondern der Wasserhaushalt von zwei Dritteln der Vereinigten Staaten drastisch verändert. Die ökologischen Folgen dieser Maßnahme hatten finanzielle Auswirkungen, die wiederum eine ganze Reihe von Eingriffen in den rückwärts fließenden Fluss notwendig machten. Zu einigen dieser Eingriffe war die City Living nun unterwegs. Wir näherten uns diesem Kanalabschnitt vorsichtig, wenn auch vielleicht nicht vorsichtig genug, denn einmal wurde unser Boot beinahe zwischen zwei großen Lastkähnen eingequetscht. Die Deckshelfer brüllten Anweisungen, die zunächst unverständlich waren, sich dann aber als nicht druckreif erwiesen.
Knapp fünfzig Kilometer kanalabwärts – oder flussaufwärts? – erreichen wir unser Ziel. Das erste Anzeichen, dass wir bald dort sind, ist ein Schild in der Größe einer Plakatwand und der Farbe einer Plastikzitrone: »Achtung«, verkündet es, »Schwimmen, Tauchen, Angeln und Anlegen verboten.« Unmittelbar dahinter steht ein weiteres Schild, diesmal in Weiß: »Alle Passagiere, Kinder und Haustiere im Auge behalten.« Nach einigen hundert Metern taucht ein drittes Schild auf, maraschinorot: »Achtung! Elektrische Fischbarrieren. Gefahr von Elektroschocks!«
Alle kramen ein Mobiltelefon oder eine Kamera hervor. Wir fotografieren das Wasser, die Warnschilder und uns gegenseitig. An Bord wird gewitzelt, einer solle in den unter Strom gesetzten Fluss steigen oder zumindest eine Hand hineinhalten, um zu sehen, was passiert. Sechs Kanadareiher haben sich in der Hoffnung auf eine leicht erbeutete Mahlzeit Seite an Seite am Ufer versammelt wie Studierende, die in der Mensa Schlange stehen. Wir fotografieren auch sie.
Aus der Prophezeiung, der Mensch solle sich »die Erde untertan« machen und herrschen »über alles Getier, das auf Erden kriecht«, ist eine Tatsache geworden. Welche Kennzahl man auch nehmen mag, jede erzählt die gleiche Geschichte. Mittlerweile haben die Menschen über die Hälfte der eisfreien Landflächen der Erde – gut siebzig Millionen Quadratkilometer – unmittelbar und die Hälfte der übrigen Fläche mittelbar verändert.6 Wir haben die meisten großen Flüsse eingedämmt oder umgeleitet. Unsere Düngemittelfabriken und die angebauten Hülsenfrüchte binden mehr Stickstoff als alle Ökosysteme der Erde zusammen, und unsere Flugzeuge, Autos und Kraftwerke stoßen 100 Mal mehr Kohlendioxid aus als Vulkane. Regelmäßig lösen wir Erdbeben aus. (Ein besonders starkes, von Menschen verursachtes Beben erschütterte am Morgen des 3. September 2016 Pawnee, Oklahoma, und war noch in der 650 Kilometer entfernten Stadt Des Moines zu spüren.)7 Was die reine Biomasse angeht, sind die Zahlen verblüffend: Gegenwärtig übersteigt das Gesamtgewicht aller Menschen das der wild lebenden Säugetiere um das Achtfache. Rechnet man die domestizierten Tiere hinzu – überwiegend Rinder und Schweine –, so ergibt sich ein Verhältnis von zweiundzwanzig zu eins. »Tatsächlich übersteigt die Biomasse aller Menschen und Nutztiere die sämtlicher Wirbeltiere zusammen, Fische ausgenommen«, stellte ein Beitrag in den Proceedings of the National Academy of Sciences kürzlich fest.8 Wir sind zu einem Haupttreiber des Artensterbens, vermutlich aber auch der Artenbildung geworden. Der Einfluss des Menschen ist so allgegenwärtig, dass manche sagen, wir lebten in einer neuen erdgeschichtlichen Epoche – im Anthropozän. Im Zeitalter des Menschen gibt es keinen Ort, auch nicht in den tiefsten Meeresgräben und mitten im antarktischen Eisschild, der nicht bereits unsere Fußabdrücke trägt wie Robinson Crusoes Insel die von Freitag.
Aus dieser Entwicklung lässt sich eine offenkundige Lehre ziehen: Sei vorsichtig mit deinen Wünschen. Die Erwärmung der Atmosphäre und der Ozeane, die Versauerung der Meere, der Anstieg des Meeresspiegels, das Verschwinden der Gletscher, die Wüstenbildung, die Nährstoffanreicherung – das sind nur einige der Begleiterscheinungen, die der Erfolg des Menschen mit sich bringt. Dieser weltweite Wandel, wie man es verharmlosend nennt, vollzieht sich mit einer Geschwindigkeit, für die es in der Erdgeschichte nur eine Handvoll Beispiele gibt, das jüngste ist der Asteroideneinschlag, der vor 66 Millionen Jahren die Herrschaft der Dinosaurier beendete. Menschen produzieren beispiellose Klimaverhältnisse, beispiellose Ökosysteme, eine ganze beispiellose Zukunft. An diesem Punkt mag es ratsam sein, unsere Ansprüche zurückzuschrauben und die Auswirkungen unseres Handelns zu reduzieren. Aber wir sind so viele – derzeit annähernd acht Milliarden –, und wir sind so weit fortgeschritten, dass eine Umkehr nicht machbar scheint.
Somit sehen wir uns mit einem beispiellosen Dilemma konfrontiert. Wenn es denn eine Antwort auf das Problem der Kontrolle geben soll, wird sie in mehr Kontrolle bestehen. Allerdings ist das, was es nun zu beherrschen gilt, keine Natur mehr, die unabhängig vom Menschen existiert – oder ohne menschliche Eingriffe gedacht werden könnte. Vielmehr gehen die neuen Bestrebungen bereits von einem umgestalteten Planeten aus und drehen sich um sich selbst: Es geht weniger um die Beherrschung der Natur als um die Kontrolle der Naturbeherrschung. Zunächst kehrt man die Fließrichtung eines Flusses um, dann setzt man ihn unter Strom.
Das United States Army Corps of Engineers hat sein Bezirkshauptquartier in einem neoklassizistischen Gebäude auf der Chicagoer LaSalle Street. Eine Plakette an der Hausmauer verkündet, dass dort 1883 die General Time Convention mit dem Ziel tagte, die Uhren des Landes zu synchronisieren. Im Zuge dessen wurden Dutzende regionale Zeitzonen auf vier reduziert, was in vielen Gemeinden zum sogenannten Tag mit zwei Mittagen führte.
Seit seiner Gründung unter Präsident Thomas Jefferson befasste sich das Pionierkorps mit der Durchführung von Großprojekten. Zu den zahlreichen weltverändernden Vorhaben, an denen es beteiligt war, gehörten der Panamakanal, der Sankt-Lorenz-Seeweg, der Bonneville-Damm im Colorado River und das Manhattan-Projekt. (Für die Entwicklung der Atombombe schuf das Pionierkorps eine neue Abteilung, die es Manhattan District nannte, um den eigentlichen Zweck zu kaschieren).9 Es ist ein Zeichen der Zeit, dass sich das Pionierkorps zunehmend mit nachgelagerten, zweitrangigen Aufgaben wie der Wartung von elektrischen Fischsperren im Sanitary and Ship Canal betraut sieht.
An einem Morgen nicht lange nach meiner Bootsfahrt mit den Friends of the Chicago River besuchte ich das Chicagoer Hauptquartier des Pionierkorps, um mit dem für die Fischsperren zuständigen Ingenieur, Chuck Shea, zu sprechen. Das Erste, was mir neben der Rezeption ins Auge fiel, waren zwei riesige Silberkarpfen auf Felsen. Wie bei allen Silberkarpfen lagen die Augen im unteren Kopfbereich, so dass sie aussahen, als habe man sie verkehrt herum montiert. In einer seltsam zusammengestellten Faunanachbildung waren die Plastikfische von kleinen Plastikschmetterlingen umgeben.
»Als ich vor Jahren mein Ingenieurstudium absolvierte, hätte ich nie gedacht, dass ich mich so viel mit Fischen beschäftigen würde«, erzählte mir Shea. »Aber eigentlich ist es ganz gut für Partygespräche.« Shea, ein schlanker Mann mit angegrautem Haar und Drahtgestellbrille, strahlte die Zurückhaltung aus, die aus dem Umgang mit Problemen erwächst, die sich mit Worten nicht lösen lassen. Auf meine Frage, wie die Fischsperren funktionieren, streckte er seine Hand aus, als wolle er meine schütteln.
»Wir geben elektrische Impulse ins Wasser«, erklärte er. »Im Grunde muss man nur genügend Strom ins Wasser leiten, um zu gewährleisten, dass in dem gesamten Gebiet ein elektrisches Feld entsteht.«
»Die Stärke des elektrischen Feldes nimmt zu, wenn man flussabwärts darauf zuschwimmt oder umgekehrt, wenn meine Hand also ein Fisch wäre, wäre die Nase hier«, er zeigte auf die Spitze seines Mittelfingers, »und der Schwanz ist hier.« Er deutete auf sein Handgelenk und wackelte mit der ausgestreckten Hand.
»Nun passiert Folgendes: Wenn der Fisch hineinschwimmt, spürt seine Nase eine Stromspannung und sein Schwanz eine andere. Das führt dazu, dass der Strom tatsächlich durch seinen Körper fließt. Der Strom, der durch einen Fisch fließt, verursacht einen Schock oder versetzt ihm einen Stromschlag. Bei einem großen Fisch besteht eine große Spannungsdifferenz zwischen Nase und Schwanz. Bei einem kleinen Fisch ist der Abstand, den die Spannung zurücklegen muss, nicht so groß, daher ist der Schock kleiner.«
Der Chicago Sanitary and Ship Canal leitete den Chicago River vom See fort.
Vor der Umkehrung der Fließrichtung mündete der Chicago River in den Lake Michigan.
Er lehnte sich zurück und ließ seine Hand in seinen Schoß sinken. »Das Gute ist, dass Silberkarpfen sehr große Fische sind. Sie sind der Staatsfeind Nummer eins.« Ein Mensch ist auch ziemlich groß, stellte ich fest. »Alle Menschen reagieren unterschiedlich auf Strom«, erwiderte Shea. »Aber im Endeffekt kann er leider tödlich sein.«
Wie Shea mir erzählte, war das Pionierkorps in den ausgehenden neunziger Jahren auf Drängen des Kongresses in den Betrieb der Fischsperren involviert worden. »Es war eine ziemlich unbefristete Anweisung«, erzählte er. »Macht was!«
Die Aufgabe, vor die sich das Pionierkorps gestellt sah, war schwierig: Es sollte den Sanitary and Ship Canal für Fische unpassierbar machen, ohne Menschen, Lastkähne und Abwasser in ihrer Bewegung einzuschränken. Die Ingenieure zogen über ein Dutzend möglicher Herangehensweisen in Betracht, unter anderem das Wasser des Kanals mit Gift zu versehen, mit ultraviolettem Licht zu bestrahlen, mit Ozon zu versetzen, mit dem Kühlwasser aus Kraftwerken zu erwärmen und gigantische Filter zu installieren.10
Sie überlegten sogar, es mit Stickstoff anzureichern, um eine anoxische (also nahezu sauerstofffreie) Umgebung zu schaffen, wie sie typischerweise in ungeklärtem Abwasser herrscht. (Diese Option wurde teils wegen der Kosten verworfen, die schätzungsweise 250 000 Dollar am Tag betragen hätten.) Schließlich entschieden sie sich für die elektrischen Fischsperren, weil sie kostengünstig waren und als humanste Option erschienen. Alle Fische, die sich ihnen näherten, würden hoffentlich abgeschreckt, bevor sie getötet würden.
Die erste elektrische Fischsperre wurde am 9. April 2002 in Betrieb genommen. Ursprünglich war sie dazu gedacht, die Schwarzmundgrundel abzuschrecken, einen froschgesichtigen Eindringling, der im Kaspischen Meer beheimatet ist und aggressiv die Eier anderer Fische frisst. Sie hatte sich im Lake Michigan angesiedelt, und es gab Befürchtungen, dass sie über den Sanitary and Ship Canal in den Des Plaines River und von dort weiter in den Illinois River und den Mississippi wandern könnte. »Bevor das Projekt aktiviert werden konnte, war die Schwarzmundgrundel schon auf der anderen Seite«, erklärte mir Shea. So wurde der Kanal unter Strom gesetzt, nachdem der Fisch schon ausgerissen war.
Unterdessen wanderten andere Eindringlinge – asiatische Karpfen – in umgekehrter Richtung den Mississippi aufwärts nach Chicago. Wären sie durch den Kanal gelangt, hätten sie im Michigansee Unheil angerichtet, so fürchtete man, bevor sie sich weiter ausgebreitet hätten in den Oberen See sowie in den Huron-, Erie- und Ontariosee. Ein Politiker aus Michigan warnte, die Fische könnten »unsere Lebensweise ruinieren«.11
»Asiatische Karpfen sind eine sehr gute invasive Spezies«, erklärte mir Shea, korrigierte sich dann aber: »Na ja, nicht ›gut‹ – sie sind gut darin, invasiv zu sein. Sie sind anpassungsfähig und können in vielen unterschiedlichen Umgebungen gedeihen. Und das macht es so schwierig, mit ihnen umzugehen.«
Später installierte das Pionierkorps zwei weitere Fischbarrieren mit einer weitaus höheren Stromspannung im Kanal und ersetzte, als ich die Anlage besuchte, gerade die erste Fischsperre durch eine erheblich stärkere Version. Zudem plante es, den Kampf mit einer Fischsperre, die Lärm und Blasen erzeugte, auf eine völlig neue Ebene zu heben. Die Kosten dieser Blasensperre wurden zunächst auf 275 Millionen Dollar geschätzt und stiegen später auf 775 Millionen Dollar.
»Die Leute nennen sie scherzhaft eine Diskosperre«, erzählte Shea. Es war ein Satz, den er gut auf einer Party hätte anbringen können, fand ich.
Häufig ist von asiatischen Karpfen die Rede, als ob es sich dabei um eine einzige Spezies handelte, tatsächlich handelt es sich jedoch um einen Oberbegriff für vier Fischarten. Alle vier sind in China heimisch, wo man sie kollektiv als 四大家鱼 bezeichnet, ein Ausdruck, der etwa die »vier berühmten heimischen Fische« bedeutet. Schon seit dem 13. Jahrhundert züchten Chinesen diese berühmten Vier zusammen in Teichen. Diese Praxis gilt als »das erste dokumentierte Beispiel für integrierte Polykultur der Menschheitsgeschichte«.12
Jede Spezies der berühmten Vier besitzt ihre besonderen Talente, und wenn sie ihre Kräfte vereinen, sind sie ebenso wie die Fantastischen Vier der Comicreihe praktisch kaum aufzuhalten. Der Graskarpfen (Ctenopharyngodon idella) frisst Wasserpflanzen. Der Silberkarpfen (Hypophthalmichthys molitrix) und der Marmorkarpfen (Hypophthalmichthys nobilis) filtern ihre Nahrung aus dem Wasser, indem sie es durch den Mund einsaugen und das Plankton in kammartigen Strukturen in den Kiemen zurückhalten. Der Schwarze Amur oder Schwarze Graskarpfen (Mylopharyngodon piceus) frisst Weichtiere wie Schnecken. Wirft man Schnittgut von einem Bauernhof in einen Teich, werden Graskarpfen es fressen. Ihre Ausscheidungen fördern das Algenwachstum. Diese Algen ernähren den Silberkarpfen und winzige Wassertierchen wie Wasserflöhe, die zur bevorzugten Nahrung des Schwarzen Amurs gehören. Dieses System hat es den Chinesen ermöglicht, ungeheure Karpfenmengen zu ernten – allein 2015 annähernd fünfzig Milliarden Pfund.13
In einer jener ironischen Wendungen, die es im Anthropozän in Hülle und Fülle gibt, ist die Zahl frei lebender Karpfen in China eingebrochen, während die der Zuchtpopulationen in die Höhe geschnellt ist. Aufgrund von Projekten wie der Drei-Schluchten-Talsperre im Jangtsekiang haben Flussfische Probleme zu laichen. Somit sind die Karpfen zugleich Instrumente und Opfer menschlicher Kontrolle.
Die berühmten vier Fischarten gelangten zumindest teilweise dank Rachel Carsons Der stumme Frühling in den Mississippi – eine weitere Ironie des Anthropozäns. In diesem Buch, das den Arbeitstitel The Control of Nature (Die Beherrschung der Natur) hatte, verwarf die Autorin die Vorstellung einer Herrschaft über die Natur.14
»Die ›Herrschaft über die Natur‹ ist ein Schlagwort, das man in anmaßendem Hochmut geprägt hat. Es stammt aus der ›Neandertal-Zeit‹ der Biologie und Philosophie, als man noch annahm, die Natur sei nur dazu da, dem Menschen zu dienen und ihm das Leben angenehm zu machen«, schrieb sie. Herbizide und Pestizide stünden für die schlimmste Art von »Höhlenmenschen«-Denken, sie seien eine Keule, die sich gegen die »Gemeinschaft der Lebewesen« richte.15
Der unterschiedslose Einsatz von Chemikalien schade Menschen, töte Vögel und mache die Gewässer des Landes zu toten Flüssen, warnte Carson. Statt Pestizide und Herbizide zu fördern, sollten die Behörden sie verbieten, da uns »eine wahrlich außerordentliche Vielzahl anderer Möglichkeiten zur Verfügung« stünden. Eine Alternative, die Carson besonders empfahl, war der Einsatz einer biologischen Art gegen eine andere. So könne man einen Parasiten importieren, der sich von einer unerwünschten Insektenart ernähre.
»In ihrem Buch war das Problem – der Übeltäter – der breite, nahezu uneingeschränkte Einsatz von Chemikalien, besonders der Chlorkohlenwasserstoffe wie DDT«, erklärte mir Andrew Mitchell, ein Biologe an einem Forschungszentrum für Wasserwirtschaft in Arkansas, der die Geschichte der asiatischen Karpfen in Amerika eingehend untersucht hatte. »Das ist der Kontext von alledem: Wie kommen wir von diesem massiven Einsatz von Chemikalien weg und behalten dennoch eine gewisse Kontrolle? Und das hat vermutlich ebenso viel mit dem Import von Karpfen zu tun. Diese Fische waren biologische Kontrollinstrumente.«
1963, ein Jahr nach dem Erscheinen von Der stumme Frühling, brachte der U. S. Fish and Wildlife Service die erste dokumentierte Ladung asiatischer Karpfen nach Amerika.16 Dahinter stand die Vorstellung, der Karpfen solle Wasserpflanzen in Schach halten, wie Carson es empfohlen hatte. (Wasserpflanzen wie das Ährige Tausendblatt – eine weitere importierte Spezies – können sich in Teichen und Seen so stark ausbreiten, dass diese Gewässer für Boote und Schwimmer unpassierbar werden.) Die eingeführten Fische waren junge Graskarpfen – »Setzlinge« – und wurden in der Fish Farming Experimental Station der Behörde in Stuttgart, Arkansas, aufgezogen. Drei Jahre später gelang es Biologen der Station, einen der mittlerweile ausgewachsenen Karpfen zum Laichen zu bringen. Daraus entstanden Tausende weitere Setzlinge, von denen einige nahezu auf Anhieb entwischten. So gelangten junge Graskarpfen in den White River, einen Nebenfluss des Mississippi.
In den siebziger Jahren fand die Arkansas Game and Fish Commission Verwendung für Silber- und Marmorkarpfen.17 Kurz zuvor war der Clean Water Act verabschiedet worden, und die Kommunen standen unter Druck, die neuen Standards für die Wasserreinhaltung umzusetzen. Viele Städte und Gemeinden konnten es sich jedoch nicht leisten, ihre Klärwerke nachzurüsten. Die Game and Fish Commission war der Ansicht, es könne hilfreich sein, Karpfen in Klärteichen einzusetzen. Sie würden die Nährstoffbelastung reduzieren, indem sie die Algen fräßen, die durch den übermäßigen Stickstoffgehalt wucherten. Im Rahmen einer Studie setzte man Silberkarpfen in Kläranlagen in Benton, einem Vorort von Little Rock, ein. Tatsächlich senkten die Fische den Nährstoffgehalt, bevor auch sie entwischten. Wie es genau dazu kam, weiß niemand, weil niemand es beobachtete.
»Damals suchten alle nach einer Möglichkeit, die Umwelt sauberer zu machen«, erklärte mir Mike Freeze, ein Biologe, der bei der Arkansas Game and Fish Commission arbeitete. »Rachel Carson hatte Der stumme Frühling geschrieben, und alle waren wegen der ganzen Chemikalien im Wasser besorgt. Wegen der nicht heimischen Fischarten machten sie sich nicht annähernd so große Sorgen, was bedauerlich ist.«
Die Fische – überwiegend Silberkarpfen – lagen auf einem blutigen Haufen. Es waren unzählige, lebendig in das Boot gehievt. Stundenlang hatte ich zugesehen, wie sie angehäuft wurden, und während die unten liegenden mittlerweile wohl tot waren, wie ich vermutete, zappelten die oberen immer noch und rangen nach Luft. Ich meinte in ihren tiefsitzenden Augen einen vorwurfsvollen Blick zu erkennen, hatte aber keine Ahnung, ob sie mich überhaupt sehen konnten oder ob es eine Projektion war.
Es war ein schwüler Sommermorgen einige Wochen nach meinem Ausflug auf der City Living. Die zappelnden Karpfen, drei Biologen im Dienst des Staates Illinois, mehrere Fischer und ich dümpelten auf einem See in Morris herum, einer Kleinstadt knapp 100 Kilometer südwestlich von Chicago. Der See hatte keinen Namen, da er aus einer Kiesgrube entstanden war. Um Zugang zu ihm zu bekommen, hatte ich dem Unternehmen, dem das Gelände gehörte, eine Einverständniserklärung unterschreiben müssen, in der ich mich unter anderem verpflichtete, keine Schusswaffen zu tragen, nicht zu rauchen und keine »Flammen produzierenden Geräte« zu benutzen. Auf dem Formular waren die Umrisse der zum See gewordenen Kiesgrube abgebildet, die aussahen wie die Kinderzeichnung eines Tyrannosaurus. Dort, wo der Bauchnabel des Tyrannosaurus saß, falls er überhaupt einen solchen hatte, verband ein Kanal den See mit dem Illinois River. Diese Verbindung war für das Vorkommen der Silberkarpfen im See verantwortlich. Denn zur Fortpflanzung brauchen sie fließendes Wasser – oder Hormongaben –, aber sobald sie gelaicht haben, ziehen sie sich in stehende Gewässer zurück, um sich zu ernähren.
Man kann sich Morris als das Gettysburg im Kampf gegen den asiatischen Karpfen vorstellen. Südlich der Stadt gab es sie in Hülle und Fülle, nördlich kamen sie nur selten vor (wie selten ist allerdings umstritten). Viel Zeit, Geld und Fisch wird auf Bemühungen verwandt, dass es so bleibt. Diese Bestrebungen bezeichnet man als »Fischsperrenschutz«, der verhindern soll, dass große Karpfen die elektrischen Fischsperren erreichen. Wären die Stromschläge eine sichere Abschreckung, dann wäre der Fischsperrenschutz nicht notwendig, aber niemand, mit dem ich sprach, einschließlich Beamte wie Shea beim Army Corps of Engineers, war sonderlich darauf erpicht, die Technologie auf die Probe zu stellen.
»Unser Ziel ist es, den Karpfen von den Großen Seen fernzuhalten«, erklärte mir einer der Biologen, als wir über die ehemalige Kiesgrube tuckerten. »Wir verlassen uns nicht auf die elektrischen Sperren.«
Zu Tagesbeginn hatten die Fischer Hunderte Meter Stellnetze ausgebracht, die sie nun von drei Aluminiumbooten aus einholten. Heimische Fischarten – wie Flachkopfwelse oder Süßwassertrommler –, die ins Netz gegangen waren, sortierten sie aus und warfen sie wieder in den See. Asiatische Karpfen ließen sie im Boot verenden.
In diesem namenlosen See gab es anscheinend einen unerschöpflichen Bestand an Karpfen. Meine Kleider, mein Notebook und mein Aufnahmegerät waren bald voller Blut- und Schleimspritzer. Kaum waren die Netze eingeholt worden, brachten die Fischer sie auch schon wieder aus. Wenn sie von einer Seite des Bootes auf die andere gehen mussten, wateten sie einfach durch die zappelnden Karpfen. »Wer hört die Fische, wenn sie schreien?«, fragte Thoreau. »Irgendein Gedächtnis wird es nicht vergessen, dass wir Zeitgenossen waren.«18
Gerade die Eigenschaften, durch die diese »heimischen Fischarten« in China berühmt wurden, machten sie in den Vereinigten Staaten berühmt-berüchtigt. Ein gut genährter Graskarpfen kann gut achtzig Pfund wiegen.19 An einem einzigen Tag kann er eine Nahrungsmenge fressen, die nahezu der Hälfte seines Körpergewichts entspricht, und er legt beim Laichen jeweils Hunderttausende Eier. Marmorkarpfen können ein Gewicht von bis zu 100 Pfund erreichen. Mit ihrer vorgewölbten Stirn sehen sie übellaunig aus. Da sie keinen echten Magen besitzen, fressen sie mehr oder weniger ununterbrochen.
Silberkarpfen sind ebenso gefräßig und filtern die Nahrung so effektiv aus dem Wasser, dass sie bis zu vier Mikrometer kleine Planktonteilchen heraussieben können – das entspricht einem Viertel des Durchmessers des feinsten menschlichen Haars. Wo immer sie auftauchen, verdrängen sie die heimischen Fischarten, bis praktisch nur sie allein übrig sind. Der Journalist Dan Egan sagte: »Marmor- und Silberkarpfen dringen nicht nur in Ökosysteme ein. Sie erobern sie.«20 Im Illinois River machen asiatische Karpfen gegenwärtig nahezu drei Viertel der Fischbiomasse aus, und in manchen Gewässern ist ihr Anteil noch höher.21 Der ökologische Schaden reicht jedoch über die Fischbestände hinaus; so befürchtet man, dass der Schwarze Amur, der sich von Weichtieren ernährt, den ohnehin schon bedrohten Süßwassermuscheln den Rest gibt.
»In Nordamerika gibt es die größte Muschelvielfalt der Welt«, erzählte mir Duane Chapman, ein Forschungsbiologe des U. S. Geological Survey, der sich auf asiatische Karpfen spezialisiert hat. »Viele Arten sind bedroht oder bereits ausgestorben. Und jetzt haben wir im Grunde den effizientesten Süßwassermolluskenfresser der Welt auf einige der am stärksten bedrohten Weichtierarten losgelassen.«
Einer der Fischer, die ich in Morris traf, Tracy Seidemann, trug einen wasserdichten Overall voller geronnener Blutflecken und ein T-Shirt, dessen Ärmel abgeschnitten waren. Mir fiel auf, dass er auf einem seiner sonnenverbrannten Arme einen Karpfen eintätowiert hatte. Es war ein europäischer Karpfen, wie er mir erklärte. Auch sie gehören einer invasiven Spezies an, die in den 1880er Jahren aus Europa eingeführt wurde und vermutlich auf ihre Art ebenfalls Schaden anrichtete. Aber sie sind schon so lange hier, dass die Menschen sich an sie gewöhnt haben. »Wahrscheinlich hätte ich mir einen asiatischen Karpfen tätowieren lassen sollen«, meinte er achselzuckend.
Seidemann erzählte mir, dass er früher hauptsächlich Büffelfische fing, die im Mississippi und in seinen Nebenflüssen heimisch sind. (Büffelfische sehen Karpfen ein bisschen ähnlich, gehören aber einer anderen Familie an.) Als die asiatischen Karpfen kamen, gingen die Büffelfischbestände drastisch zurück. Mittlerweile verdiente Seidemann sein Geld überwiegend damit, dass er im Auftrag des Illinois Department of Natural Resources asiatische Karpfen tötete. Es erschien mir taktlos, ihn nach seinem Einkommen zu fragen, aber später erfuhr ich, dass Vertragsfischer damit pro Woche über fünftausend Dollar brutto erzielen können.
Am Ende des Tages luden Seidemann und die anderen ihre Boote mitsamt den Karpfen auf Hänger und fuhren in die Stadt. Dort verfrachteten sie die inzwischen reglosen Fische mit ihren glasigen Augen in einen wartenden Sattelschlepper.
Dieser Einsatz zum Fischsperrenschutz wurde noch drei Tage lang fortgesetzt. Die Männer holten 6404 Silberkarpfen und 547 Marmorkarpfen mit einem Gesamtgewicht von über 50 000 Pfund aus dem Wasser. Der Sattelschlepper brachte sie nach Westen, wo sie zu Dünger verarbeitet wurden.
Das Einzugsgebiet des Mississippi ist das drittgrößte der Welt nach dem des Amazonas und des Kongo und erstreckt sich über gut drei Millionen Quadratkilometer auf 31 US-Bundesstaaten und Teile von zwei kanadischen Provinzen. Es hat etwa die Form eines Trichters, dessen Hals in den Golf von Mexiko hineinragt.
Auch die Großen Seen haben ein riesiges Einzugsgebiet von mehr als 750 000 Quadratkilometern, das achtzig Prozent der nordamerikanischen Süßwasservorkommen umfasst. Dieses System, das die Form eines überfütterten Seepferdchens hat, fließt über den St. Lawrence River in den Atlantik ab.
Diese beiden großen Einzugsgebiete liegen nebeneinander, bilden – oder bildeten – jedoch zwei getrennte Wasserwelten. Es bestand keinerlei Möglichkeit, dass Fische (oder Weichtiere und Krustentiere) aus einem Einzugsgebiet in das andere wechselten. Als Chicago sein Abwasserproblem löste, indem es den Sanitary and Ship Canal baute, öffnete sich ein Tor, das die beiden Wassergebiete miteinander verband. Über weite Teile des 20. Jahrhunderts hinweg stellte das kein Problem dar, weil der Kanal durch Chicagos Abwässer zu stark verschmutzt war, um Fischen als Wanderweg zu dienen. Durch das Inkrafttreten des Clean Water Act und die Arbeit von Umweltschutzgruppen wie den Friends of the Chicago River besserten sich die Bedingungen, und so begannen Fische wie die Schwarzmundgrundel über diesen Verbindungsweg zu entwischen.
Die Umkehrung der Fließrichtung des Chicago River schuf eine Verbindung zwischen den Einzugsgebieten von zwei großen Flusssystemen.
Im Dezember 2009 schaltete das United States Army Corps of Engineers eine der elektrischen Fischsperren im Kanal ab, um routinemäßige Wartungsarbeiten durchzuführen. Es nahm an, dass sich die nächsten asiatischen Karpfenbestände etwa 25 Kilometer flussabwärts befanden. Als Vorsichtsmaßnahme versetzte das Illinois Department of Natural Resources das Wasser jedoch mit 14 000 Litern Gift. Das Ergebnis waren 54 000 Pfund toter Fische.22 Darunter entdeckte man einen asiatischen Karpfen – einen 55 Zentimeter langen Marmorkarpfen. Zweifellos waren viele Fische auf den Grund gesunken, bevor sie mit Netzen abgefischt werden konnten. Gab es darunter noch weitere asiatische Karpfen?
Aus den benachbarten Bundesstaaten kamen heftige Reaktionen. Fünfzig Kongressabgeordnete unterzeichneten einen Brief an das Pionierkorps, in dem sie ihrer Verärgerung Ausdruck verliehen. »Es gibt möglicherweise keine größere Bedrohung für das Ökosystem der Großen Seen als die Einschleppung des asiatischen Karpfens«, hieß es in dem Schreiben.23 Michigan strengte eine Klage mit der Forderung an, dass die Verbindung zwischen den Einzugsgebieten wieder unterbrochen würde.24 Nachdem das Army Corps of Engineers die Optionen untersucht hatte, veröffentlichte es 2014 einen 230 Seiten starken Bericht.
Nach Einschätzung des Pionierkorps bestand die effektivste Möglichkeit, asiatische Karpfen aus den Großen Seen fernzuhalten, tatsächlich darin, wieder eine »hydrologische Trennung« herbeizuführen.25 Dies würde nach seinen Schätzungen 25 Jahre – dreimal so lang wie der Bau des Kanals – dauern und bis zu 18 Milliarden Dollar kosten.
Viele Experten, mit denen ich sprach, waren der Meinung, diese Milliarden wären gut angelegt. Sie wiesen darauf hin, dass jedes der beiden Einzugsgebiete seine eigene Palette invasiver Arten hatte, von denen manche wie die asiatischen Karpfen absichtlich dort angesiedelt, die meisten aber unbeabsichtigt in Ballastwasser eingeschleppt wurden. Im Mississippi-Gebiet zählten dazu der Nilbuntbarsch, das Peruanische Wassergras und der Zebrabuntbarsch aus Mittelamerika. Im Bereich der Großen Seen waren es das Meerneunauge, der Dreistachelige und der Vierstachelige Stichling, der Stachelige Wasserfloh, der Angelhaken-Wasserfloh, die Neuseeländische Zwergdeckelschnecke, die gemeine Federkiemenschnecke, die Ohrschlammschnecke, die Große Erbsenmuschel, die Dreieckige Erbsenmuschel, die Falten-Erbsenmuschel, der Rote Sumpfkrebs und die Rote Schwebegarnele.26 Der sicherste Weg, die Eindringlinge in den Griff zu bekommen, wäre, den Kanal zu schließen.
Aber niemand, der sich für eine »hydrologische Trennung« aussprach, glaubte, dass dies jemals passieren würde. Das Abwassersystem Chicagos wieder zu ändern würde bedeuten, den Schiffsverkehr umzuleiten, den Hochwasserschutz und die Kläranlagen umzubauen. Es gab zu viele Wähler, die ein Interesse daran hatten, dass alles blieb, wie es war. »Politisch würde das einfach nie vorankommen«, sagte mir der Vorsitzende einer Gruppe, die auf die hydrologische Trennung gedrängt, aber die Idee letztlich aufgegeben hatte. Es war viel einfacher, sich eine erneute Umgestaltung des Flusses – mit elektrischen Fischsperren, Blasen, Lärm und allem Erdenklichen – vorzustellen, als das Leben der Menschen in seinem Umfeld zu verändern.
Das erste Mal, dass ich von einem Karpfen getroffen wurde, war in der Nähe der Kleinstadt Ottawa, Illinois. Es fühlte sich an, als hätte mir jemand mit einem Wiffleball-Schläger gegen das Schienbein geschlagen.
Was Menschen an asiatischen Karpfen vorrangig auffällt – was sie buchstäblich anspringt –, ist die Angewohnheit der Silberkarpfen, zu springen. Ein Geräusch, das sie aufschreckt, ist das Knattern von Außenbordmotoren, daher ist Wasserskifahren in von Karpfen befallenen Gebieten des Mittleren Westens zu einer besonderen Extremsportart geworden. Der Anblick von Silberkarpfen, die in hohem Bogen durch die Luft fliegen, ist zugleich schön wie ein Wasserballett und erschreckend wie eine heranrollende Feuerwalze. Einer der Fischer, die ich in Ottawa traf, erzählte mir, dass ihn die Begegnung mit einem fliegenden Karpfen bewusstlos zurückgelassen hatte. Ein anderer erklärte, er habe schon lange aufgehört, seine karpfenbedingten Verletzungen zu zählen: »Du wirst praktisch jeden Tag getroffen.« Ich las von einem Vorfall mit einer Frau, die von einem Karpfen von ihrem Jet-Ski geworfen wurde und nur überlebte, weil ein vorbeifahrender Bootsfahrer ihre Schwimmweste im Wasser dümpeln sah.27 Auf YouTube gibt es unzählige Videos über Karpfenakrobatik mit Titeln wie »Asiatische Karpfokalypse« oder »Angriff des springenden asiatischen Karpfens«. Die Kleinstadt Bath, Illinois, die an einem besonders karpfenreichen Flussabschnitt liegt, versucht Kapital aus dem Chaos zu schlagen und veranstaltet alljährlich ein »Redneck-Angelturnier«, zu dem Teilnehmer sich kostümieren sollen. »Schutzkleidung wird dringend empfohlen!«, heißt es auf der Webseite des Turniers.
An dem Tag, als mich ein Karpfen traf, war ich mit einer Gruppe von Vertragsfischern, die »Fischsperrenschutz« betrieben, auf dem Illinois River. Außer mir waren noch mehrere Beobachter mit an Bord, darunter ein Professor namens Patrick Mills. Er lehrt am Joliet Junior College nur wenige Kilometer von der Stelle entfernt, an der das Pionierkorps seine Geräusch-und-Wasserstrahl-Disco-Sperre errichten wollte. »Joliet ist so etwas wie eine Speerspitze«, erklärte er mir. Er trug eine Baseballkappe des Joliet Junior College, an deren Schirm er eine Helmkamera befestigt hatte.
In Illinois traf ich eine Reihe von Leuten, die wie Mills aus für mich nicht immer ganz nachvollziehbaren Gründen beschlossen hatten, sich in den Kampf gegen den asiatischen Karpfen zu stürzen. Als gelernter Chemiker hatte er einen Köder in besonderen Geschmacksnoten entwickelt, der Karpfen ins Netz locken sollte. Mithilfe eines örtlichen Konditors hatte er eine Wagenladung von Prototypen hergestellt. Sie hatten die Form und Größe von Ziegelsteinen und bestanden vorwiegend aus geschmolzenem Zucker. »Sie sind ein bisschen wie von MacGyver zusammengebastelt«, gab er zu.
Werden Silberkarpfen aufgeschreckt, springen sie aus dem Wasser.
Die Geschmacksrichtung, die an diesem Tag getestet werden sollte, war Knoblauch. Ich probierte einen der Köder, der nicht einmal unangenehm nach einem Knoblauchbonbon schmeckte. Mills erzählte mir, in der folgenden Woche sei Anisgeschmack an der Reihe: »Anis ist ein sehr gutes Flussaroma.«
Mills' Arbeit hatte das Interesse des U. S. Geological Survey geweckt, und so war ein Forschungsbiologe aus – dem sechs Autostunden entfernten – Columbia, Missouri, gekommen, um sich anzusehen, wie die Tests verliefen. Auch der Konditor, der die Köder produziert hatte, und seine Frau waren gekommen. An dieser Stelle, knapp 130 Kilometer von Chicago entfernt, war der Fluss breit und unbefahren. Zwei Weißkopfseeadler kreisten über uns,