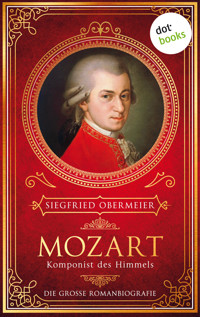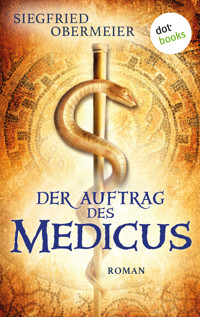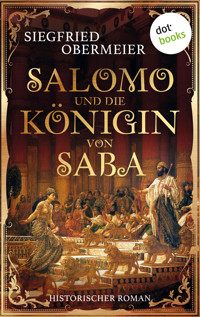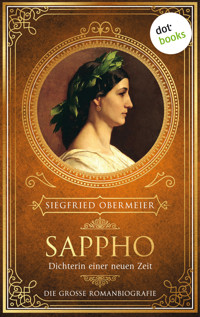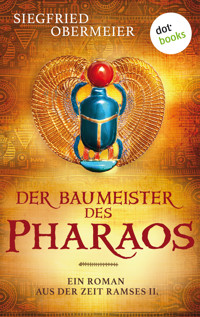Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ihre Reize entwaffneten selbst die mächtigen Borgias: Der historische Roman »Das Spiel der Kurtisanen« von Siegfried Obermeier als eBook bei dotbooks. Rom am Ende des 15. Jahrhunderts. Seit Rodrigo Borgia die Papstwürde an sich gerissen hat, lastet die Machtlust seiner Familie wie ein blutiger Schatten über der Stadt. Doch es sind zwei Frauen, die insgeheim die Fäden ziehen: Imperia, die »Kaiserin der Kurtisanen«, bei der die Vertrauten des Papstes ein- und ausgehen, und Fiametta, die edler Abstammung ist und sich den machthungrigen Cesare Borgia gefügig macht. Die beiden Rivalinnen sind so scharfsinnig wie betörend … und nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Nach Jahren des Wartens wollen sie endlich aus den Schatten heraustreten – doch werden Männer, die die Macht in den Händen halten, sie jemals teilen? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der spannende historische Roman »Das Spiel der Kurtisanen« von Siegfried Obermeier präsentiert ein bestechendes Sittengemälde vom Rom zur Zeit der Borgias - ein Lesevergnügen für alle Fans der Bestseller von Hilary Mantel und Matteo Strukul. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 692
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Rom am Ende des 15. Jahrhunderts. Seit Rodrigo Borgia die Papstwürde an sich gerissen hat, lastet die Machtlust seiner Familie wie ein blutiger Schatten über der Stadt. Doch es sind zwei Frauen, die insgeheim die Fäden ziehen: Imperia, die »Kaiserin der Kurtisanen«, bei der die Vertrauten des Papstes ein- und ausgehen, und Fiametta, die edler Abstammung ist und sich den machthungrigen Cesare Borgia gefügig macht. Die beiden Rivalinnen sind so scharfsinnig wie betörend … und nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Nach Jahren des Wartens wollen sie endlich aus den Schatten heraustreten – doch werden Männer, die die Macht in den Händen halten, sie jemals teilen?
Über den Autor:
Siegfried Obermeier (1936–2011) war ein preisgekrönter Roman- und Sachbuchautor, der über Jahrzehnte zu den erfolgreichsten deutschen Autoren historischer Romane zählte. Seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt.
Bei dotbooks veröffentlichte Siegfried Obermeier die historischen Romane »Der Baumeister des Pharaos«, »Die freien Söhne Roms«, »Der Botschafter des Kaisers«, »Blut und Gloria: Das spanische Jahrhundert«, »Die Kaiserin von Rom« und »Salomo und die Königin von Saba« sowie die großen Romanbiographien »Sappho, Dichterin einer neuen Zeit« und »Mozart, Komponist des Himmels«. Weitere Titel sind in Vorbereitung.
***
eBook-Neuausgabe November 2021
Copyright © der Originalausgabe 2008 LangenMüller in der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Tarzhanova, RODINA OLENA, CoffeeTime
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-96655-716-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Spiel der Kurtisanen« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Siegfried Obermeier
Das Spiel der Kurtisanen
Ein Roman aus der Zeit der Borgias
dotbooks.
Erstes Buch
Kapitel 1
Rom war nicht nur die Ewige Stadt, wo der Thron Petri über der Grabstätte des Apostelfürsten stand und seine Nachfolger residierten – Rom war nicht nur das ersehnte Ziel von Pilgern und Büßern, es war auch die Stadt der Kurtisanen. Zwar gab es hier nicht weniger Arme als in anderen großen Städten, dafür aber ungleich mehr Reiche. Das waren vor allem die hier lebenden Kardinäle und Bischöfe, die aus mancherlei fernen Pfründen große Gelder bezogen, ohne jemals gezwungen zu sein, sich darum kümmern zu müssen. So war Cesare Borgia, Domherr, Abt und Bischof zahlreicher Kirchen, Klöster und Städte, und diese Einkünfte flossen in einem stetigen Strom in die Ewige Stadt und ein beträchtlicher Teil davon gelangte in die Truhen der Kurtisanen.
Zu ihnen zählte Diana di Pietro Cognati, die es in den etwa fünfzehn Jahren ihrer Tätigkeit zu einigem Wohlstand gebracht hatte. Ihre Mutter, eine Gemüsehändlerin, hatte etliche Kinder schon im Säuglingsalter verloren, nur sie, Diana, war gesund aufgewachsen und dabei immer schöner geworden. Ein Vater war nicht vorhanden und Diana wusste nicht einmal, ob er tot oder nur verschwunden war. Darüber nicht zu reden, war ein stillschweigendes Abkommen zwischen Mutter und Tochter.
Als das Geschäftsleben unter den Päpsten Sixtus und Innozenz aufzublühen begann, brachte auch der kleine Obsthandel genug ein, um Diana auf einer Klosterschule eine gründliche Ausbildung zu ermöglichen. Der Unterricht bei den braven Nonnen war freilich stark religiös geprägt, und wenn die Mädchen lesen konnten, dann wurde das nicht an Ovid, Bocaccio oder Petrarca erprobt, sondern an Heiligenlegenden und frommen Gedichten. Mit anderen Seiten der Dichtkunst machte sie ihr Musiklehrer bekannt, der ihr nicht nur das Lautenspiel beibrachte, sondern auch einige Lieder, die dazu gesungen wurden. Besonders liebte er das »Canzoniere«, ein von Petrarca noch selber zusammengestelltes Liederbuch. Da ging es nicht um die himmlische, sondern um die irdische Liebe, und nicht die Heilige Jungfrau wurde angerufen, sondern Amor, der heidnische Liebesgott.
Trovommi Amor del tutto disarmato,
et aperta la via per gli occhi al core …
(Es fand mich Amor völlig unbewaffnet,
und offen seinen Weg zum Herzen hin durch Augen …)
Der noch ziemlich junge Musiklehrer musste seinen Unterricht bei offener Tür abhalten, sodass ihre Mutter auch beim Obstverkauf ein Ohr auf die beiden hatte. Dann kam aber doch ein unbelauschter Augenblick, den der musico gleich nutzen wollte, um seiner Schülerin die praktische Seite der canzoni erotiche zu zeigen, aber die Mutter fuhr noch rechtzeitig dazwischen und hatte bald darauf mit Diana ein klärendes Gespräch.
»Töchterchen, du bist jetzt vierzehn geworden und erblüht wie eine wunderschöne Rose. Schönheit und Duft aber halten nicht lange an und du hast nur zwei Möglichkeiten, sie einzusetzen. Ich könnte versuchen, für dich einen braven Mann zu finden, aber das ist natürlich riskant. Heute ist dieser Mann brav, genießt seine junge und schöne Frau, aber dann werden die Kinder geboren und sie kommt in die Jahre. Männer, musst du wissen, altern anders als wir. Einer, der etwas auf sich hält, Körper und Kleidung pflegt, der kann mit vierzig, ja sogar mit fünfzig, noch recht passabel daherkommen. Bei einer Frau ist es mit dreißig, höchstens fünfunddreißig mit Schönheit und Anziehungskraft vorbei. Wenn es sich fügt, dass sie mit einem älteren Mann verheiratet wird – einem, der den vor Gott geleisteten Treueschwur ernst meint, dann hat sie großes, großes Glück, mit dem du aber nicht rechnen kannst.
Nun zur anderen Möglichkeit. Wir sparen deine verginità auf, bis einer kommt, der sie dir teuer abkauft. Nicht irgendeiner, bei Gott, nein! Das muss einer von hohem Stand sein, einer, dem es nichts ausmacht, für dein Jungfernkränzchen um die hundert Dukaten zu bezahlen. Das ist eine schöne Mitgift und hat den Vorteil, dass sie dir allein gehört und du dich auf eine Weise einrichten und ausstatten kannst, dass dein erster Freier ähnliche nachzieht. Lass dir Zeit, Diana, überlege es dir in Ruhe und wähle dann.«
Seltsam genug, Diana brauchte keine Zeit der Überlegung, für sie genügte es, sich vorzustellen, an einen Mann gebunden zu sein, für den sie waschen und kochen musste, begleitet von Schwangerschaft und Geburten. Dennoch wollte sie nicht vor der Mutter als leichtfertig erscheinen und bat um Bedenkzeit. Als sie zwei Tage später ihren Entschluss mitteilte, atmete die Frau Mama sichtlich auf und bereitete sorgsam das Nötige vor.
Sie gehörten zur Pfarrei Santo Spirito im Borgo-Viertel, und nun wurde jeden Sonntag der Kirchgang zelebriert. Diana, schicklich, aber erlesen gekleidet, schritt an der Seite ihrer Mutter zu der besuchtesten Messe um zehn Uhr vormittags. Das war auch ein gesellschaftliches Ereignis, bei dem sich die Bewohner von Borgo Nuovo und Borgo Vecchio trafen, Neuigkeiten austauschten, Geschäfte abschlossen und den heiratsfähigen Nachwuchs begutachten konnten.
Der Borgo war kein vornehmes, aber beileibe auch kein schlechtes Viertel – dem Vatikan benachbart und deshalb mit Palästen von Prälaten durchsetzt. Freilich dominierten hier die Pilgerherbergen, meist von Deutschen oder Schweizern geführt, aber die Nähe zu Peterskirche und Papstpalast gab dem Viertel doch ein gewisses Gewicht. Dass sich darunter auch ein paar üble Kneipen befanden, sogar solche, wo man einen bravo dingen konnte, das wurde achselzuckend hingenommen.
Schon nach einigen Kirchgängen kamen gewisse Anfragen, doch Dianas Mutter hielt sich bedeckt, verstand immer nur Ehe und Heirat und sagte, dafür sei es noch viel zu früh. Erst als nach Sonnenuntergang der Sekretär eines noch jungen, neu ernannten Kardinals erschien, erklärte sie sich zu Verhandlungen bereit. Zweihundert Dukaten sei ihr die Sache schon wert, dazu eine notarielle Bestätigung, für ein mögliches Kind aufzukommen. Der Sekretär wiegte bedenklich seinen Kopf und sagte, das müsse er noch mit seinem Herrn besprechen. Der aber hatte sich nicht nur in das jugendfrische und bildschöne Mädchen verliebt, er hatte mit Freunden gewettet, der Erste zu sein, der diese Blume knickte. So erklärte er sich mit der notariellen Bestätigung einverstanden, wollte aber nur hundert Dukaten bezahlen, die Dianas Mutter auf einhundertzwanzig hinaufhandelte. Ein teurer Spaß, gewiss, aber in römischen Kreisen nicht ungewöhnlich. Freilich muss man sich fragen, welches Vergnügen solche Herren von einem unerfahrenen Mädchen denn erwarteten. Die meisten von ihnen lagen scheu, ängstlich und verkrampft in ihren Betten, aber es gab wohl Männer, denen das Zerreißen des Hymens einen Triumph bedeutete, der alles andere überwog.
Der junge Kardinal konnte den Mund nicht halten, prahlte mit seiner »Eroberung« und machte andere neugierig. Was ihn bei seinem ersten Besuch gestört hatte, war die bescheidene Wohnung, obwohl Dianas Mutter alles getan hatte, um den Empfangsraum angemessen auszustatten.
Bei seinem zweiten Besuch sagte er:
»Für dich, Diana, ist das hier nicht der richtige Rahmen. Verstehst du, was ich meine? Du siehst aus wie die wiedererstandene Göttin Juno, aber anstatt in der Pracht des Olymp zu hausen, bist du von Armut umgeben. Das werden wir ändern!«
Der junge Kardinal hatte sich mit einem überraschend geerbten Vermögen die rote Robe und zwei Bistümer erkauft, was unter dem habgierigen Sixtus IV. leicht möglich war. Dieser Papst hatte eine Liste mit sechshundertfünfundzwanzig kirchlichen Ämtern erstellen lassen, die jedermann kaufen konnte. Das reichte von einem nichtssagenden Ehrentitel wie »päpstlicher Hauskaplan« für hundert Dukaten bis zur Kardinalswürde, die nicht unter zwanzigtausend zu haben war.
Die Einkünfte von Dianas Verehrer reichten für einen kleinen Palast im Ponte-Viertel und gestatteten eine luxuriöse Lebensführung. Er hatte Diana nicht nur entjungfert, sondern sich auch in sie verliebt und gedachte, sich dieses Mädchen als concubina zu halten. So richtete er ihr und ihrer Mutter im Borgo Vecchio ein schönes Haus ein. Der Obsthandel wurde verpachtet und Diana lebte zunächst als die erklärte Mätresse des jungen Kirchenfürsten, der es aber nicht lassen konnte, ihre Schönheit zu rühmen, um seinen Standesgenossen etwas voraus zu haben, denn innerhalb des Kardinalskollegiums bildete er – wie so treffend gesagt wird – das Schlusslicht. Obwohl sein Amtsbruder Pietro Riario etwa gleich alt war, stand er als Neffe des Papstes in der ersten Reihe, aber das ließ sich wohl nicht ändern. Als der Kardinal für einige Wochen nach Norden reiste, um sein in der Toskana gelegenes Bistum aufzusuchen, sah Dianas Mutter keinen Grund, nicht auch andere, sorgsam ausgewählte Besucher zu empfangen.
Diana, inzwischen fast siebzehn geworden, hatte eine Art majestätischer Schönheit erreicht, die sie älter erscheinen ließ. Das kastanienfarbige Haar fiel – in der Mitte gescheitelt – offen auf ihre wohlgeformten Schultern. Die dunklen Augen in dem ovalen Gesicht blickten etwas schwermütig, doch sie konnte ihnen ein solch feuriges Strahlen verleihen, dass den Herren die Kehlen trocken wurden. Ihr voller Busen war unter den schweren prunkvollen Stoffen, die sie bevorzugte, kaum zu erahnen, sodass ihre Liebhaber nichts sehnlicher wünschten, als dass sie sich bald ihrer Kleider entledigte. Aber damit hatte es eine cortigiana onesta nicht eilig, und es wurde auch nicht ernsthaft von ihr erwartet. Spielend gelang es ihr, die Wartestunden mit Lautenspiel, Gesprächen und Vorträgen schlüpfriger Gedichte kurzweilig zu gestalten, und sie hatte es sich zur Regel gemacht, niemals vor Sonnenuntergang ihre Kleider abzulegen. Ein älterer steinreicher banchiere hatte es ihr erklärt:
»Auch erfahrene Männer schätzen an Frauen das Verborgene, Geheimnisvolle. Wenn eine billige Hure bei hellem Tageslicht unter einer Brücke die Beine breit macht, dann tut sie das, was der Freier von ihr erwartet. Tagelöhner, Fischer, Lastenträger sind körperlich meist so ausgemergelt und verbraucht, dass ihnen nur ein solcher Anblick auf die Beine helfen kann.«
Er schien etwas verlegen und schaute Diana dabei zärtlich an.
»Wir aber, die wohlerzogenen und gebildeten Herren, verlangen weniger und zugleich mehr. Weniger, weil keiner von uns von einer cortigiana erwartet, unverzüglich ins Schlafzimmer geführt zu werden. Mehr, weil es für dich und deinesgleichen schon einigen Aufwand bedeutet, uns in prachtvoller Kleidung über Stunden hin geistvoll und gebildet zu unterhalten. Das stimmt die meisten von uns auf die zu erwartenden Freuden ein. Wenn du dann beim Flackerlicht einiger Kerzen deine kostbaren Kleider ablegst und Stück um Stück deinen schönen Körper enthüllst, dann ist es das, was die Gebildeten und Wohlerzogenen erwarten.«
Gewiss ein guter Rat des alten erfahrenen banchiere, aber Diana erkannte bald, dass es nicht immer angebracht war, ihn zu befolgen. Bei den »gebildeten und wohlerzogenen Herren« gab es auch solche, die Latein und Griechisch sprachen, Catullus, Ovid und Petrarca aus dem Stegreif zitieren konnten, außerdem hatten ihre Erzieher ihnen eingebläut, wie man in allen Lebenslagen eine »bella figura« macht, was aber nichts daran änderte, dass sich ihre feurige Jugendkraft nur auf ein Ziel richtete. Sie wussten, wie eine Laute klang, kannten die schlüpfrigen carmina des Catullus, doch im Grunde wollten sie nur eines – nämlich das lustvolle Spiel von cazzo und potta betreiben, möglichst bald, möglichst lange und möglichst oft. Gerade noch, dass diese Herren ein Glas Wein nahmen, dazu ungeduldig eine confettura knabberten und sie dabei mit glänzenden hungrigen Augen verschlangen, während sie ihr in Gedanken schon die Kleider vom Leib rissen. Auch auf eine solche Kundschaft musste sich eine angesehene cortigiana einstellen und – warum auch nicht? – Diana tat es gern, manchmal sogar mit einer gewissen Leidenschaft.
Einer dieser feurigen jungen Herren war es dann, der sie – trotz aller Vorsicht –, als sie achtzehn war, schwängerte. Sie wollte das Kind abtreiben lassen, doch die Mutter gab ihr zu bedenken:
»Du brauchst eine Nachfolgerin! Eine, die schon erwachsen ist, wenn du dich zurückziehen musst. Du kannst ihr eine Hilfe sein, kannst sie lehren, was du weißt, kannst …«
»Halt, Mutter, halt! Was tue ich, wenn es ein Sohn wird?«
»Gleich nach der Geburt ins Kloster abschieben und es noch einmal versuchen.«
Zum Glück war es eine Tochter, die im Herbst des Jahres 1481 von der levatrice ans Licht gezogen wurde. Zuerst blieb sie stumm, bis sie nach einigen kräftigen Klapsen auf das Hinterteil laut und empört zu schreien begann. Diana nannte sie Lucrezia und ließ es bei der Erziehung an nichts mangeln – ersparte ihr sogar die Klosterschule. Erfahrene und erprobte Hauslehrer hatten mit der Wissenshungrigen nicht viel Mühe, und als die bestochenen Kardinäle Rodrigo Borgia auf den Stuhl Petri hoben, war Lucrezia fast elf Jahre alt und ihre Brüste begannen sich schüchtern zu wölben.
Um diese Zeit wurde Dianas Mutter krank und damit auch fromm, zog sich in ein Kloster zurück, wo sie kurz darauf starb. Lucrezia war fassungslos und beweinte die geliebte Nonna tagelang. Ihre Mutter versuchte sie zu trösten.
»Das ist der Lauf der Welt, mein Täubchen – werden und vergehen, so hat es Gott bestimmt. Es ist ehrenvoll, eine gewisse Zeit zu trauern, aber dann – vor allem, wenn man jung ist – heißt es nach vorne blicken und sich so gut wie möglich im Leben einrichten. Deine Nonna war noch eine kleine Gemüsehändlerin, aber sie hat ihre und meine Möglichkeiten genutzt und ihr ist es zu verdanken, wenn ich heute zu den ersten cortigiane Roms zähle. Aus dir aber werde ich die Allererste machen, die Königin der Kurtisanen – nein, Königinnen gibt es viele, du wirst die Kaiserin sein!«
Lucrezia wusste, dass ihre Mutter manchmal zum Überschwang neigte, und lächelte geduldig.
»Ich werde mein Möglichstes tun, Frau Mama.«
Doch Diana schüttelte verbissen ihren Junokopf.
»Nein, das genügt nicht! Zwei Eigenschaften gehören dazu, die eine ist angeboren, die andere muss erworben werden. Das Angeborene ist die Schönheit, und die hat dir Gott in die Wiege gelegt. Erwerben aber musst du dir ein Wissen um Musik, Dichtung, vornehme Lebensart, erlesene Kleidung, vor allem aber ein Wissen um die Männer. Seit du denken kannst, habe ich dich im Rahmen des Schicklichen an meinem Gewerbe teilhaben lassen und ich weiß, dass du eine gute Beobachterin bist. Das Weitere wird dich die Erfahrung lehren, aber eines möchte ich dir ans Herz legen, in den Kopf hämmern, in die Seele brennen: Verliebe dich niemals in einen Mann! Wenn du liebst, bist du für unser Gewerbe verloren, weil es dich schwach und angreifbar macht. Sollte es dennoch sein, dann heirate ihn und ziehe hier weg. Eines verträgt sich nicht mit dem anderen, hörst du? Versprich es mir!«
»Ich verspreche es Euch, Frau Mama.«
Diana nickte, wusste aber zugleich, dass ihre Mühe vergeblich sein würde, käme nur der Richtige. Ich musste es ihr sagen, dachte sie trotzig, denn ich möchte mir später nicht vorwerfen lassen, ich hätte sie nicht gewarnt.
Am nächsten Tag fügte sie noch hinzu:
»Wenn ich dich vor der Liebe zu einem Mann warnte, dann heißt es nicht, dass du nicht später heiraten sollst. Das aber tue aus praktischen Erwägungen und um deinen Lebensabend zu sichern. Für eine Kurtisane über dreißig gibt es im Wesentlichen drei Möglichkeiten: Langsam in die Armut und ins Elend abgleiten und als kranke Groschenhure im Armenhospiz enden; ins Kloster gehen und Buße tun; heiraten und vielleicht einer Tochter den Weg in unser Gewerbe ebnen.«
Sie lachte spöttisch.
»Du kannst es dir ja aussuchen …«
Bald darauf folgte Diana de Cognatis ihrem eigenen Rat und heiratete Paolo Trotti, einen Sänger in der päpstlichen Kapelle. Sie kaufte ihm den Titel eines »continuo commensale«, was etwa als »Tischgenosse des Papstes« zu verstehen wäre, aber nur bedeutete, dass er bei großen Festbanketten im Vatikan in einer finsteren Ecke sitzen durfte. Das Ehepaar erwarb einige Häuser und baute das von ihnen bewohnte auf der Piazza Scossacavalli zu einem kleinen Palast aus.
Dort begann Lucrezia ihre Laufbahn als cortigiana onesta und legte sich den Namen Imperia zu. Sie sah es als eine Verpflichtung, diesem Namen Ehre zu machen, um tatsächlich zur Kaiserin der Kurtisanen zu werden.
Äußerlich glich sie ihrer Mutter wie eine jüngere Schwester. Ihre schwere dunkle Schönheit hellte sie damit auf, dass sie ihrem fast schwarzen Haar durch eine geheim gehaltene Sonderbehandlung einen leuchtenden Kupferton verlieh. Dazu gehörte, dass sie ihre Haarflut stundenlang der brennenden Mittagssonne aussetzte, wobei sie auf einer eigens dafür gebauten Ruhebank im Schatten lag, während ihre Locken hinter einem Vorhang in der Sonne bleichten. Mit ihrer hohen Stirn, den ernsten dunklen Augen wirkte sie älter, als sie war, was sie noch durch prunkvolle, aber zu einer reiferen Dame passende Kleidung betonte. Gut, ihre leicht gebogene Nase ragte ein wenig zu weit vor, aber das war nur vom Profil aus zu erkennen und, da Imperia dies wusste, zeigte sie ihr Gesicht nur von vorne.
Mit siebzehn wurde Imperia schwanger und sie gebar eine Tochter, die sie Lucrezia nannte, damit es, wie sie sagte, wieder eine solche gab, nachdem ihr eigener Name dem stolzen »Imperia« hatte weichen müssen.
In den letzten drei Monaten ihrer Schwangerschaft empfing sie nur Freunde im salotto, aber keinen Liebhaber in der alcova. So blieb sie über die Stadtereignisse am Laufenden und erfuhr von einem ihrer Verehrer, einem dicken Prälaten, dass seit einiger Zeit eine junge, aus Florenz zugezogene Kurtisane viel von sich reden machte.
»Und?«, fragte sie. »Muss mich das interessieren?«
Der Prälat nickte bedächtig.
»Ich glaube schon. Sie soll – sie soll etwas ganz Besonderes sein …«
Imperia lachte weich und dunkel.
»Aber Monsignore, das bin ich doch auch!«
Da wurde er ganz eifrig.
»Da bin ich der Letzte, der dies bezweifelt, aber wie man so hört, muss sie anders sein – als – als die anderen …«
Sein feistes Gesicht glänzte vor Verlegenheit, denn wie immer, wenn er in Bedrängnis geriet, begann er fürchterlich zu schwitzen. Imperia blickte ihn mitleidig an. Sie wusste, dass er zu ihren ergebensten Freunden zählte und dass er sich bemühte – soweit es ihm möglich war –, ihr jeden Wunsch zu erfüllen. Nun aber war sie neugierig geworden und wollte nicht einfach das Thema wechseln.
»Anders – was heißt das? Älter, jünger, größer, kleiner, reicher, ärmer – schöner als ich?«
»Ich habe sie noch nicht gesehen, Donna Imperia, nur von ihr gehört. Ihr könnt Euch ja denken, dass der Vatikan eine einzige riesige Gerüchteküche ist. Da bleibt anscheinend nichts verborgen, was der Papst tut und was seine Kardinäle treiben, aber das geht dann von Mund zu Mund und was am Ende herauskommt, enthält – wenn es gut geht – noch einige Körnchen der Wahrheit. Schöner als Ihr? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, und was das andere betrifft – nun, sie mag etwa Eures Alters sein und hat mit ihrer Mutter einen kleinen Palast im Ponte-Viertel bezogen, nahe der Kirche Santa Maria della Pace. Das lässt ja nicht gerade auf Armut schließen …«
»Da habt Ihr recht, Monsignore. Solltet Ihr diese Dame einmal persönlich kennenlernen, dann erstattet mir Bericht.«
Der Dicke atmete auf und sagte dienstbeflissen:
»Da werde ich mich sofort umtun, Donna Imperia, Ihr wisst ja, für Euch tue ich alles – alles!«
Sie strahlte ihn an und zauberte in ihre schönen dunklen Augen eine Versprechung, die sie nicht einzulösen gedachte, die aber dem dicken Prälaten die schönsten Hoffnungen bescherte.
Kapitel 2
Was Fiammetta und ihre Mutter betraf, so hatte Papst Alexander in allem Wort gehalten. Einer seiner Sekretäre wurde beauftragt, im noblen Ponte-Viertel ein geräumiges Haus zu mieten, notfalls auch zu erwerben, um Tadea de Michelis mit ihrer Tochter Fiammetta eine angemessene Wohnstätte in Rom zu schaffen. Alexander hatte nie die reizvolle Kurtisane Tadea vergessen, die ihm damals in Florenz, in seiner Zeit als päpstlicher Legat, für einige Wochen so nahe gekommen war. Er glaubte zu fühlen, dass auch sie über das Berufliche hinaus für ihn eine tiefe Zuneigung empfunden hatte. Seit einem halben Jahr wusste Fiammetta, wer tatsächlich ihr Vater war, der nun als Stellvertreter Christi auf Erden über die katholische Menschheit gebot.
Ihrem Wunsch, dem Bußprediger Savonarola das Handwerk zu legen, hatten die beiden päpstlichen Kommissäre schnell und zügig entsprochen. Als Tadea später hörte, wie man mit dem Frate umgesprungen war, versuchte sie, das aufkommende Mitgefühl mit dem Gedanken an ihren ermordeten Sohn zu ersticken. Francesco hatte sich in Florenz einer der vielen Banden jugendlicher Heißsporne angeschlossen, die, von Savonarolas hasserfüllten Tiraden gegen die Sittenverderbnis angeheizt, in die Häuser der Wohlhabenden eindrangen und die Bewohner zur Aushändigung weltlicher Prunkstücke drängten. Der Junge war, gerade fünfzehn Jahre alt, bei einem dieser Raubzüge in ein Handgemenge geraten und dabei zu Tode gekommen.
Im Sommer des Jahres 1498 klopfte ein seltsamer Besucher an die Tür ihres Hauses, doch dieser Mann wollte nicht der jetzt 16-jährigen Fiammetta seine Aufwartung machen, sondern begehrte ein Gespräch unter vier Augen mit Donna Tadea de Michelis. Zu dieser Zeit empfing sie nur noch auserwählte Kundschaft, denn die jetzt über Dreißigjährige war dabei, sich ganz in den Matronenstand zurückzuziehen und nur noch auf die Finanzen ihrer Tochter ein Auge zu haben.
Dieser Francisco Remolines war ein Mann Mitte dreißig mit einem intelligenten, scharf geschnittenen Gesicht, als habe ein Bildhauer Wangen, Stirn, Nase und Mund sorgfältig geformt. Er sei geborener Spanier, von Beruf Jurist, mit der Familie Borgia befreundet und wolle später eine kirchliche Laufbahn einschlagen. Dass dieses »später« hieß, so lange seine Frau lebte, erfuhr Tadea erst durch andere.
Sie führte den Besucher in ein kühles Nordzimmer, das zu den ihr vorbehaltenen Wohnräumen gehörte und hauptsächlich zu geschäftlichen Besprechungen diente – welcher Art auch immer. Remolines nahm erst Platz, nachdem Tadea sich gesetzt hatte, wie er überhaupt in Sprache und Gestik einen vollendeten Kavalier verkörperte. Jedenfalls ließ nichts an seinem Auftreten erkennen, dass er die geistliche Laufbahn anstrebte.
»Seine Heiligkeit hat mir in einem kürzlichen Gespräch nicht nur sein Lob über den schnellen Abschluss des Ketzerprozesses ausgedrückt, sondern auch angedeutet, Euch, Donna Tadea, könnte an einer Aufklärung über diesen Fall gelegen sein. Ihr hättet, so Seine Heiligkeit, mit dem Frate eine persönliche Rechnung zu begleichen …«
Remolines sah sie fragend an, und in seinen eng stehenden schwarzen Augen lag etwas wie eine Drohung. Diese Augen, so nachtschwarz, dass keine Pupille zu erkennen war, hatten etwas – etwas Teuflisches an sich. Tadea erschrak und wies diesen Vergleich sofort zurück. Ein Mann, der dabei war, die Priesterlaufbahn einzuschlagen – nein! So zwang sie sich zu einer besonders liebenswürdigen Entgegnung.
»Ja, so kann man es auch ausdrücken, aber ich werde nicht die Einzige sein, die durch den vom Frate entzündeten Aufruhr einen Sohn, einen Bruder oder einen Gatten verloren hat.«
Remolines zeigte höfliches Bedauern.
»Ja, Seine Heiligkeit hat etwas angedeutet, doch ich sehe, wie es Euch bewegt, und so wollen wir es nicht weiter aufrühren. Darf ich Euch jetzt berichten?«
Nein, drängte es Tadea zu sagen, nein, ich habe von seinem Tod erfahren und mehr will ich nicht wissen, aber ein Instinkt gebot ihr, Remolines geduldig anzuhören. Sie nickte und schenkte noch etwas von dem leichten Frascati nach, der wie Gold in den Gläsern funkelte, wenn ihn ein Lichtschein traf. Um diese heiße Jahreszeit waren sämtliche Fensterläden im Haus geschlossen, doch ein schmaler Lichtstreifen drang durch die Lattenöffnungen wie ein helles Band ins Zimmer und traf zufällig das Weinglas des Gastes. Der bemerkte es und rückte das Glas mit einer schnellen anmutigen Geste beiseite.
»Guter Wein verträgt keine Sonne …«
Sie nickte.
»Also, Don Francisco, lasst mich Euren Bericht hören.«
»Wie Ihr vielleicht wisst, hat Seine Heiligkeit zwei Kommissäre ernannt, Fra Turriano, den General des Dominikanerordens, und mich als Mitglied der Sacra Rota, des päpstlichen Gerichtshofs. Schon vor unserem Erscheinen war Savonarola der peinlichen Befragung unterworfen worden, aber offenbar nicht mit dem nötigen Nachdruck, weil er sein Geständnis jedes Mal danach widerrief. Einem erfahrenen Berufsjuristen wird ein solcher Fehler nicht unterlaufen. Jedes Mal, wenn dieser störrische Mönch nach der Folterung seinen Mund zum Widerruf öffnete, ließ ich ihn gleich wieder hochziehen. Schon einige Tage vorher hatten ungeschickte Büttel ihm dabei den linken Arm gebrochen, sodass wir ihn nur noch am rechten aufziehen konnten, aber danach verzichtete er auf einen Widerruf, und so erfolgte die Anklage wegen Verschwörung gegen den Heiligen Stuhl und einiger schwerwiegender Irrlehren. So waren wir uns bei der Schlusssitzung am 22. Mai im Schuldspruch einig, der übrigens nicht nur ihn, sondern auch zwei Mitverschworene traf, nämlich Fra Silvestro und Fra Domenico.
Ja, meine Liebe, mitgefangen – mitgehangen, da musste man schon konsequent sein. Der jetzige Papst ist ja nun wirklich kein Hexenjäger, und seine Begriffe von Ketzerei und Häresie sind so weitherzig, dass bis jetzt – nach immerhin fast sechs Jahren Pontifikat – meines Wissens aus solchen Gründen weder eine Frau noch ein Mann vor ein geistliches Gericht treten mussten. Aber dieser Mönch ging zu weit! Er verunglimpfte den Papst auf das Schlimmste und hielt sich meist nicht an das Predigtverbot.«
Tadea konnte jetzt nicht mehr schweigen und lispelte vor Aufregung und Befangenheit.
»Aber die Lebensführung Seiner Heiligkeit entspricht ja tatsächlich nicht ganz …«
»Aber Donna Tadea! Sind wir nicht alle Sünder vor dem Herrn? Im Übrigen kennt jedermann die verzeihliche Schwäche Seiner Heiligkeit gegenüber euch Frauen – nun, aber darum geht es nicht. Das kanonische Recht besagt, dass auch ein sündiger Priester – selbst wenn er ein Mörder wäre – nichts von seiner durch die Weihe erhaltenen Kraft einbüßt. Wenn Euer Beichtvater gestern seine Eltern grausam ermordet hätte und Ihr würdet heute bei ihm beichten, so ist seine Absolution ebenso gültig, als hättet Ihr sie von einem Heiligen erhalten. Auf den Papst übertragen bedeutet das: Er ist Stellvertreter Christi auf Erden und Oberhaupt der katholischen Christenheit, auch wenn sein privates Leben mit Sünden gepflastert ist. Diese wichtige Tatsache hat der Frate abgeleugnet und war damit als Irrlehrer entlarvt. Im Übrigen brauche ich Euch nicht zu sagen, welches Elend er über viele Florentiner Familien gebracht hat, denn Ihr selber wart eine der Leidtragenden. Inzwischen schien die ganze Stadt aus einem Albtraum zu erwachen. Wenn jetzt über ihn abgestimmt worden wäre, hätte sich kaum eine Hand zu seinen Gunsten erhoben. Am 23. Mai war es dann so weit und der Frate musste mit seinen beiden Kumpanen den Weg zum Scheiterhaufen antreten. Dieser war mitten auf der Piazza della Signoria aufgebaut worden, rund um einen hohen Pfahl, an dessen Spitze zuerst die Frati Silvestro und Domenico, zuletzt Savonarola erhängt wurden. Seine Heiligkeit hatte, in mir unverständlicher Milde, ein Verbrennen bei lebendigem Leib untersagt und ihnen zudem eine Generalabsolution erteilt. Wie auch immer, es wird anderen eine Lehre sein und sie daran hindern, ihre Mitmenschen mit ketzerischen Predigten zu irritieren. Aber für Euch, Donna Tadea, muss es doch eine Genugtuung sein, wenn …«
Sie stand auf.
»Nein, Don Francisco, so sehe ich es nicht. Erstens einmal macht der Tod dieses – dieses Mönches meinen Sohn nicht wieder lebendig, und zum zweiten wollte ich keine Rache, sondern Gerechtigkeit. Mir hätte es genügt, wäre der Frate in ein fernes Kloster verbannt worden.«
Später wunderte sie sich selber über ihre Worte, denn so hatte sie es nicht sagen wollen. Ja, sie hatte tatsächlich eine tiefe Genugtuung empfunden, als sie vom Tod des Frate erfuhr, aber etwas hatte sie gezwungen, in dieses selbstzufriedene Juristengesicht hinein ihre Worte anders zu formulieren.
Remolines hob erstaunt seine buschigen Augenbrauen und seine schwarzen blicklosen Augen weiteten sich.
»Ah – so seht Ihr es heute? Warum auch nicht, das ist christlich gedacht, aber ich hoffe, Ihr zweifelt nicht den Gerechtigkeitssinn Seiner Heiligkeit an …«
»Das steht mir nicht zu, Don Francisco.«
Die letzten Sätze hatten sie im Stehen gesprochen, weil sich Remolines sofort nach Tadea erhoben hatte.
»Und Donna Fiammetta? Geht es ihr gut? Darf ich ihr meine Aufwartung machen?«
Nein, Ihr dürft nicht, drängte es sie zu sagen, doch sie nickte nur und schickte die serva in Fiammettas Wohnräume. Dann zwang sie sich zu einem Lächeln.
»Wenn es ihr nicht passt, wird sie es uns wissen lassen.«
Sie glaubte, auf Remolines’ scharf gezeichnetem Gesicht so etwas wie Spott zu entdecken, aber es konnte auch ein Irrtum sein. Die Magd kehrte mit der Nachricht zurück, man möge sich noch etwas gedulden, aber sie sagte nicht, warum, was Tadea mit stiller Freude erfüllte. Ihr Gast aber verneigte sich lächelnd.
»Wer bei Frauen keine Geduld zeigt, hat das Spiel schon halb verloren.«
Welches Spiel?, überlegte Tadea, doch sie wollte nicht fragen. Sie plauderten Belangloses, und nach einer knappen halben Stunde betrat Fiammetta den Raum.
Schlank und zierlich stand sie da, ihr goldblondes Haar war in aufgesteckte, mit Perlen umwundene Zöpfe geflochten. Im Gegensatz zur römischen Mode trug sie helle luftige Kleidung. Ihr blaues, um Schultern und Brust eng anliegendes Seidengewand war von einem goldenen, edelsteinbesetzten Gürtel umfasst, den langen schmalen Hals schmückte eine Kette aus Perlen und Lapissteinen. Weiter war kein Schmuck zu sehen, aber ein Blick in ihre großen türkisfarbenen Augen ließ diesen Mangel vergessen.
Tadea stellte ihr den Gast vor.
»Venus ist vom Olympos herabgestiegen«, murmelte Remolines und verbeugte sich tief. Seine Erfahrungen mit Frauen waren der unterschiedlichsten Art, aber ein solches Wesen war ihm noch nicht begegnet.
»Ihr seid schon im Gehen, Don Francisco?«
»Ja, leider, aber ich komme wieder – wenn ich darf.«
»Wir werden sehen …«, sagte Fiammetta unbestimmt, während die serva den Gast hinausbegleitete. Die beiden Frauen traten ans Fenster, sahen, wie Remolines sein Pferd bestieg und – von einem Diener begleitet – in Richtung Castello Sant’Angelo ritt.
»Dieser Mann – dieser Mensch gefällt mir nicht …«
Fiammetta wandte sich zu ihrer Mutter.
»Was gefällt Euch nun nicht – der Mensch oder der Mann?«
Tadea drohte mit dem Finger und lachte leise.
»Aber was soll uns das kümmern! Wir haben andere Sorgen – und andere Freuden! Übrigens ist immer häufiger von dieser Imperia die Rede, sie soll ja die Kaiserin der Kurtisanen sein. Wir sollten sie uns einmal ansehen …«
»Wie stellt Ihr Euch das vor?«
»Ein banchetto veranstalten – sie dazu einladen.«
»Und der Anlass?«
Fiammetta krauste ihre sonst marmorglatte Stirn und rieb sich das zierliche Näschen. Dann lächelte sie erleichtert.
»Natürlich! Alessandro Farnese, unser Cardinale gonnella, ist doch ständig auf der Suche nach Anlässen zu einem Fest. Soviel ich weiß, feiert er im September seinen Geburtstag …«
Tadea unterbrach sie.
»Seinen wievielten?«
»Er muss wohl um die dreißig sein, aber darüber spricht er nicht gerne. Manchmal benimmt er sich wie ein Junge, der nicht erwachsen werden will. Trotzdem soll man seinen Einfluss auf den Papst nicht unterschätzen – schließlich ist er der Bruder von Giuliabella.«
»Also gut – ich werde die Sache in die Wege leiten. Übrigens hat Alessandro seine Kardinalserhebung nicht nur im Kreis seiner Brüder in Christo, sondern auch in meinem Bett gefeiert, da war er noch keine fünfundzwanzig …«
Fiammetta blies erstaunt ihre Backen auf.
»Was? Alessandro ist auch bei Euch gelegen?«
Tadea blicke sie ruhig an.
»Ja, Töchterchen, damit musst du dich abfinden. Nicht wenige deiner jetzigen Liebhaber sind auch durch meine alcova gewandert, und ich nehme es als Ausdruck von Treue und Verbundenheit, wenn sie dies bei meiner Tochter fortsetzen. Aber sei beruhigt. Ich hatte damals nicht genügend Zeit, mir in Rom eine clientela zu schaffen, gehörte aber immerhin zu einem guten Dutzend der angesehensten cortigiane. Du aber bist mit fast achtzehn schon ganz oben …«
»Gäbe es nicht diese Imperia«, warf Fiammetta ein.
»Darum werden wir sie uns jetzt ansehen. Ihr Name muss nicht bedeuten, dass sie quasi die oberste der römischen Kurtisanen ist. Sie hat einmal Lucrezia geheißen und will vielleicht die Borgia-Tochter nicht verärgern, obwohl gerade sie gegen uns Kurtisanen keine Vorbehalte kennt, denn sie lebt ja bekanntlich mit Giulia Farnese in einem Palast.« Fiammetta tat empört.
»Du wirst doch die Geliebte des Papstes nicht als cortigiana ansehen? Das Volk nennt sie die ›Braut Christi‹ …«
Tadea winkte ab.
»Das Volk hat immer ein loses Maul. Aber es ist nicht gewiss, ob Imperia unserer Einladung folgen wird.«
»Aber Frau Mama! Für wie dumm haltet Ihr mich? Die Einladung wird natürlich vom Kardinal Farnese kommen.«
»Aha – dann bin ich ja wohl überflüssig …«
Lachend umarmte Fiammetta ihre Mutter und küsste sie heftig auf beide Wangen.
»Jetzt redet Ihr aber Unsinn, Frau Mama! Überflüssig? Was wäre ich denn ohne Euch?«
Fiammetta, schon dabei, dem Kardinal Farnese eine Einladung überbringen zu lassen, konnte sich durch sein plötzliches Erscheinen die Mühe sparen. Hatten Rangniedere einen Kardinal mit Reverendissimus Princeps anzureden, so blieb Fiammetta der Regel ihrer Mutter treu und nannte alle geistlichen Würdenträger »Monsignore«.
Konnte man den Papst als stattlichen Mann bezeichnen, so traf auf Alessandro Farnese eher der Ausdruck »schöner Mann« zu. Nicht wenige scheuen davor zurück, einen Mann schön zu nennen, weil sie dieses Attribut nur auf Frauen anwenden wollen und es bei den Herren als unmännlich empfinden. Dennoch – an Farnese war nichts Weibliches, seine großen schönen Augen vielleicht ausgenommen, die auch einer Frau Ehre gemacht hätten. Die hohe Stirn, eine schmale, leicht gekrümmte Nase und der eher kleine volllippige Mund – halb verborgen unter dem sorgsam gestutzten Bart – fügten sich zu einem angenehmen Bild. Seine Gewohnheit, aus allem und jedem einen Scherz zu machen, seine immer spendable Großzügigkeit – nicht nur Frauen gegenüber – ließen vergessen, auf welch schäbige Art er seinen Kardinalsrang erworben hatte.
Wenn Farnese zum eigenen Vergnügen unterwegs war, dann hielt er es wie früher Cesare Borgia – er trat in ziviler Kleidung auf. Unbekümmert, wie er war, begleitete ihn dann keine Leibwache, sondern nur ein vertrauter Diener.
»Monsignore!«
Fiammetta setzte ihr strahlendstes Lächeln auf, und es war nicht einmal gespielt.
Farnese blickte wie ein gescholtener Junge drein und sagte:
»Ja, ich bin’s – hatte auf meiner Bank zu tun, und da es zu Euch nur ein paar Schritte sind …«
»Aber Ihr braucht Euch doch nicht zu entschuldigen, Monsignore! Euer Besuch ist mir willkommen, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wenn Ihr wollt, könnt Ihr gleich zur cena bleiben – das Lamm schmort schon seit einiger Zeit im Topf.«
Der Kardinal schnalzte mit der Zunge.
»Lamm! Da trefft Ihr wieder einmal meinen Geschmack … Wisst Ihr das Neueste schon?«
Kaum hatte er gefragt, schlug er sich mit der Hand auf den Mund.
»Dio mio – eigentlich dürfte ich Euch nicht davon erzählen, aber ich glaube, dass es ohnehin bald allgemein bekannt werden wird.«
Fiammetta gähnte verhalten.
»Etwas Politisches? Das behaltet lieber für Euch, davon möchte ich nichts wissen.«
Ach, Fiammetta, dachte der Kardinal, was du auch sagst oder tust, du bist immer schön, immer begehrenswert … Was hat sie eben gesagt? Vom Politischen wolle sie nichts wissen …
»Aber es kommt auch eine Frau darin vor, und sie wird demnächst eine tragende Rolle in der künftigen Politik spielen.«
»Eine Frau? Ach, wisst Ihr, weibliche Wesen interessieren mich nur, wenn ich mit ihnen verwandt oder befreundet bin. Bei Euch ist das wohl etwas anderes – Eure zahlreichen Geliebten, die schöne Schwester …«
Der Kardinal drohte scherzhaft mit dem Finger.
»Meine Schwester lasst bitte aus dem Spiel, und was meine Geliebten betrifft, so gibt es im Grunde nur eine, die mein Herz besiegt hat, und das wisst Ihr genau.«
Sie spielte die Erstaunte.
»Aber Monsignore – ich dränge mich doch nicht in Euer Privatleben …«
»Da seid Ihr aber schon mittendrin …«, sagte Farnese trocken und fuhr fort: »Da ich vorhin etwas wie Neugier aus Eurem Antlitz zu lesen glaubte, werde ich Euch nun doch den Namen dieser Frau nennen: Er ist Caterina Sforza, die Witwe von Girolamo Riario. Sie hat für ihren unmündigen Sohn die Herrschaft über Imola und Forli übernommen, doch das sind seit alters Kirchenlehen, und Cesare Borgia ist dabei, sie dem Patrimonium Petri wieder anzugliedern.«
»Diesen Cesare möchte ich einmal kennenlernen«, sagte sie versonnen. Farnese hob bedauernd beide Hände.
»Dazu wird es in nächster Zeit wohl nicht kommen, der Gonfaloniere ist zu sehr beschäftigt. Seit er dem Papst das Kardinalsgewand vor die Füße geworfen hat, ist er ein anderer Mensch geworden – nein, wohl kein anderer, sondern er kann jetzt tun, wozu er sich aufgerufen fühlt. Seine Heiligkeit hätte ihn nicht zum Kardinal machen dürfen …«
»Ja, aber da gab es noch Juan, Cesares Bruder, der soll ja mit weltlichen Ämtern überladen gewesen sein, aber mehr weiß ich auch nicht.«
»Er ist seit zwei Jahren tot …«
»Das ist allgemein bekannt.«
»Wie er zu Tode kam, konnte man bis heute nicht herausfinden.«
Das sagte der Kardinal mit Nachdruck und Fiammetta verstand ihn sehr wohl, denn das hieß: Schlusspunkt! Bis hierher und nicht weiter! Da und dort waren damals Stimmen laut geworden, Cesare selbst habe diesen Bruder beseitigen lassen, aber als man einen dieser Verleumder fasste, ihm die Zunge herausschnitt und ihn durch die Stadt führte, wobei die blutende Zunge um seinen Hals hing – von da an wurde der Fall totgeschwiegen. Man hatte längst erkannt, dass es gefährlich war, sich mit den Borgia anzulegen und dass nicht nur der Verlust einer Zunge auf dem Spiel stand.
Dann wurde das Abendessen aufgetragen; auch Tadea nahm daran teil. Der Kardinal Farnese errötete wie ein kleiner Junge, während er ihr die Hand küsste. Fiammetta hielt es für besser, wenn ihre Mutter die Einladung aussprach.
»Wenn ich mich recht erinnere, naht Euer Geburtstag mit Riesenschritten – im September?«
»Ja, am 9. September …«
»Ist es unschicklich, Euch nach dem Alter zu fragen?«
Fiammettas türkisfarbene Augen strahlten ihn aufmunternd an.
»Nein – nein, warum auch? Da werde ich einunddreißig Jahre alt …«
Tadea nickte.
»Keine runde Zahl, aber ich denke, Ihr werdet Euer Geburtsfest dennoch feiern?«
»Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht …«
Tadea lächelte sanft.
»Wir schon. Es wäre uns eine große Ehre, wenn das Bankett in unserem Haus stattfinden könnte. Eurem geistlichen Amt angemessen, haben wir an zwölf Herren gedacht …«
Da lachte der Kardinal laut heraus.
»Eine Imitation des Abendmahls? Nein, das dürfen wir uns nicht anmaßen; ich schlage vor, dazu zwölf Damen einzuladen.«
Jetzt waren es die beiden Frauen, die das Lachen ankam. Als sie nach der Mahlzeit auf die Gästeliste zu sprechen kamen, winkte der Kardinal ab.
»Ich bedinge mir nur aus, dass Ihr, Donna Fiammetta, meine Tischdame seid.«
Dann nannte er noch einige persönliche Freunde, die er dazu laden wollte.
»Welche Damen sie mitbringen, will ich den Herren selber überlassen.« Tadea zog sich bald zurück, ihre Tochter begleitete sie hinaus und fragte flüsternd:
»Und wer soll Imperias Begleiter sein?«
»Das kannst du mir überlassen«, sagte Tadea und ging die Treppe in ihre Räume hinauf.
Als sie in den salotto zurückkehrte, stand Farnese sofort auf. Fiammetta zeigte sich überrascht.
»Ihr wollt schon gehen?«
Nun schien es, als hätte er alles Schüchterne und Jungenhafte abgelegt.
»Ach, Fiammetta, ich kann doch nicht sitzen, solange Ihr steht. Außerdem küsst es sich im Stehen besser …«
Er ging auf sie zu, legte zärtlich seine Arme um sie und flüsterte ihr ins Ohr:
»Sobald ich bei Euch bin, fallen mich monogame Empfindungen an … Da scheint es mir plötzlich gottgewollt und selbstverständlich, nur eine Frau zu haben und nur sie zu lieben – ein ganzes Leben lang. Ach, Fiammetta, wie gelingt es dir nur, in mir solche Empfindungen auszulösen?«
»Da bin ich überfragt …«
Er küsste sie ungestüm, ließ keinen Fleck in ihrem Gesicht aus, traf sie auf Stirn, Wangen, Lippen, Ohren und Hals, bis sie ihn sanft zurückschob.
»Aber Alessandro, seid doch nicht so stürmisch …«
Bei der Anrede gab es so etwas wie einen Kanon. In Gesellschaft, aber auch bei Besprechungen unter vier Augen hielten sich beide an die Höflichkeitsform. Kam es zu Intimitäten, dann wartete Fiammetta ab, bis der amante sie duzte, worauf sie ihn beim Vornamen nannte. Zum vertraulichen Du ging sie erst über, wenn sie beide nackt im Bett lagen. Aber das galt auch nur für wenige vertraute Besucher. Bei würdigen älteren Herren blieb sie bei der Höflichkeitsform, es sei denn, der Kunde wollte ausdrücklich geduzt werden. Das war aber bis jetzt kaum einmal geschehen …
Alessandro Farnese wusste, was sich gehörte, und fügte sich Fiammettas sanfter Abwehr.
»Wir wollen uns ein wenig einstimmen«, schlug sie vor und ließ von der serva neuen Wein bringen, gleich mit dem Hinweis, sie brauche das Mädchen nicht mehr. Die Kleine war erst vierzehn, hatte aber inzwischen gelernt, bei solchen Befehlen nicht vielsagend zu grinsen, sondern mit todernstem Gesicht einen artigen Knicks zu machen und rückwärts aus dem Raum zu gehen.
Schweigend tranken sie sich zu. Der rubinrote Wein war mit aphrodisischen Kräutern gewürzt, deren Wirkung sich erst richtig entfaltete, wenn die Liebesbereitschaft schon vorhanden war. Farnese hätte dieser Anregung nicht bedurft, er verfolgte jede Bewegung Fiammettas mit hungrig glänzenden Augen. Sie kannte ihn, wusste um seine Ungeduld, wusste aber auch, dass er es liebte, ein wenig hingehalten zu werden. Fiammetta griff zur Laute und stimmte sie ein wenig.
»Vor einiger Zeit bin ich auf ein anakreontisches Lied gestoßen, das Ihr unbedingt hören müsst.«
Er nickte nur stumm, doch war ihm kein Ärger wegen der Verzögerung anzumerken. Sie lächelte und begann mit klangvoller geschulter Stimme ihren Vortrag.
»Physis kerata, taurois
oplas d’edoken hippois …
Es gab Natur die Hörner
dem Stier, dem Ross die Hufe,
Schnellfüßigkeit dem Hasen,
dem Löwen Rachenzähne,
dem Fische seine Flossen,
dem Vogel seine Schwingen.
Dem Manne gab sie Denkkraft,
doch für das Weib blieb nichts mehr.
Was tun? Sie gab ihm Schönheit
statt aller unsrer Schilde,
statt aller unsrer Lanzen.
Ja, über Stahl und Feuer
siegt eine Frau, die schön ist.«
Der Kardinal klatschte begeistert und wiederholte die letzte Liedzeile:
»Siegt eine Frau, die schön ist! Mag das im Großen und Ganzen stimmen, so sind doch unsere, die Ansprüche der Männer, seit den Tagen der alten Griechen ein wenig gestiegen. Schau dich doch nur selber an, Fiammetta! Du bist schön, deine Augen strahlen wie Türkise, dein schlanker Hals ist wie aus Carrara-Marmor gemeißelt, dein goldenes Haar umfängt dein liebliches Gesicht wie eine Aureole – aber ist das alles? Nein und nochmals nein! Du sprichst Latein wie ein Kleriker, trägst griechische Lieder zur Laute vor und Namen wie Ovid, Catull oder Petrarca sind für dich keine Rätsel, denn du kennst ihre Werke. Es mag Männer geben, die dergleichen weniger schätzen, die es nur als lästigen Aufschub betrachten, sich Lautenklang und Petrarcas Poesie anhören zu müssen.«
»Dazu gehört Ihr aber nicht, Alessandro …«
»Gewiss nicht! Das weißt du so gut wie ich, und wenn ich dir jetzt sage, dass ich noch stundenlang mit Vergnügen deinen Liedern lauschen könnte, dann ist das keine Lüge.«
Er hatte sich in Begeisterung geredet; ihm war heiß geworden und er legte sein Wams ab.
»Stundenlang? Nein, mein Lieber, dagegen möchte ich mich verwahren. Stundenlang vielleicht bei einem alten banchiere, weil wir beide wissen, dass danach nicht mehr viel kommt, aber bei Euch …«
Der Blick ihrer Augen fuhr ihm wie ein Liebespfeil in die ohnehin schon vom Würzwein erhitzten Lenden. Ja, wenn es darauf ankam, sich wie ein Mann – ein ganzer Mann zu fühlen, dann wusste diese Frau die richtigen Worte dazu.
Nach zwei Sonetten von Petrarca und einigen anzüglichen Liedern des unvergleichlichen Catullus gingen sie eng umschlungen ins dormitorio, wo sie der Alkoven mit zurückgeschlagenen Brokatvorhängen wie mit einer stummen Einladung empfing.
Es gibt Männer, die sehen in geistlichen oder weltlichen Festgewändern recht stattlich aus, weil sich da manches verbirgt, was Natur oder Alter nicht ganz so vorteilhaft gestaltet hatten. Alessandro Farnese aber war auch nackt ein schöner Mann. Er hatte eine vornehme Ausbildung genossen und war als junger Adelsspross auch in körperlicher Hinsicht nach dem von Juvenal verkündeten Vorbild »mens sana in corpore sano« erzogen worden.
Fiammetta saß auf dem Bett, doch als Farnese sich ihr nähern wollte, forderte sie ihn auf:
»Alessandro, lass dich anschauen, denn anders als vielleicht unsere Dichter von Liebesliedern bin ich der Meinung, dass auch ein nackter Mann einen durchaus erfreulichen Anblick bieten kann.«
In gespielter oder vielleicht sogar echter Verlegenheit wandte er sich ab, um den schon steil aufgerichteten Phallus zu verbergen.
Fiammetta kicherte.
»Aber Alessandro, seit die gebildeten Leute die antiken Statuen sammeln, anstatt sie zum Häuserbau zu verwenden, wissen wir doch alle, wie die Römer ihren Wald- und Wiesengott Faunus dargestellt haben …«
Nun war auch für Farnese der Zeitpunkt gekommen, da ihm jede Verzögerung ärgerlich war, und sie wusste das und öffnete weit ihre Arme. Als vollendeter Kavalier war er beim Liebesspiel nicht nur auf sich bedacht, sondern auch darauf, die Wünsche seiner Partnerin zu berücksichtigen. Ja, der Kardinal Farnese gehörte zu den wenigen Männern, mit denen Fiammetta gern – sehr gern sogar – eine Liebesnacht verbrachte.
Als er sie am nächsten Morgen nach dem Frühmahl verließ, hatte er, wie es seine Art war, ohne viele Worte eine gefüllte Börse auf der Fensterbank hinterlassen.
»Richtet damit das Bankett aus, Donna Fiammetta«, sagte er nur.
Das Zusammenstellen der Gästeliste überließ sie ihrer Mutter, die sie ihr dann unaufgefordert vorlegte. Flüchtig glitten ihre Augen über die Namen.
»Ah, die beiden Chigis, Finanzberater Seiner Heiligkeit. Warum hast du Remolines eingeladen? Wir mochten ihn doch beide nicht …«
»Aus Berechnung! Einen Mann, der bei den Borgia – wenigstens zurzeit – derart persona grata ist, können wir nicht übergehen.«
»An wessen Seite wird Imperia sein?«
»An der von Lorenzo Chigi, der mit seinem Bruder seit einiger Zeit um ihre Gunst wetteifert.«
Fiammetta schüttelte belustigt den Kopf.
»Um eine Kurtisane kann es doch keine Eifersüchteleien geben.«
Tadea blickte auf.
»Das glaubst du vielleicht! Ich könnte dir da einiges berichten, aber diese Erfahrungen sollst du selber machen.«
»Wenn ich die Herren auf der Liste nachzähle, komme ich nur auf elf.« Tadea nickte.
»Ja, doch Farnese hat mich gebeten, einen Platz freizulassen für einen hohen Gast.«
Wie das Volk über den Papst, seine Kardinäle und über die politischen wie sozialen Zustände dachte, war seit einiger Zeit am Pasquino nachzulesen. Dieser Marmortorso einer antiken Statue war beim Straßenbau gefunden worden und stand nun vor dem Palast des Kardinals Carafa. Seinen Namen erhielt er von einem Kneipenwirt, der für sein Schandmaul bekannt war. Was irgendein Lästerer des Nachts dort auf einen Zettel geschrieben hatte, flog am Morgen in Windeseile durch Rom – etwa über die junge Geliebte des Papstes.
Giuliabella, stets lieb und nettist zwar verheiratet, doch nicht faulfindet man sie eher in Alexanders Bettund der stopft mit Gold Orsinis Maul.
Kapitel 3
Offiziell war Cesare Borgia nach Frankreich gereist, um in seinem Herzogtum Valence nach dem Rechten zu sehen und natürlich auch, um seiner Gattin Charlotte d’Albret – eine Nichte des französischen Königs – einen Besuch abzustatten. Mögen diese Gründe auch mitgespielt haben, so war es doch Cesares Hauptanliegen, von König Ludwig XII. ein Truppenkontingent zu erhalten, um die Städte der Romagna – vor allem Rimini, Pesaro, Imola, Forli und Faenza – in den Schoß der Kirche zurückzuführen, wie es so schön hieß. Tatsächlich waren alle diese Orte Kirchenlehen gewesen, doch im Lauf der letzten Jahrzehnte hatten dort Tyrannen die Macht übernommen, die nicht im Traum daran dachten, einen Tribut nach Rom zu senden.
Nun, da er dabei war, Imola und Forli der wegen ihrer Grausamkeit berüchtigten Caterina Sforza zu entreißen, verfügte er über viertausend französische Söldner. Sie war die Witwe des Girolamo Riario, hatte neun Kinder geboren und wechselte schnell ihre meist jüngeren Liebhaber. Die Schönheit der hochgewachsenen blonden Frau war weithin berühmt; sie liebte Schmuck und kostbare Kleider, galt als geistreich und war von einer bezaubernden Beredsamkeit.
In ihrer schlimmen, fast aussichtslosen Lage verfiel Caterina auf eine grausame List. In Forli hatte die Pest geherrscht, die jetzt am Erlöschen war. Sie besorgte sich ein Tuch, in das tagelang eine Pestleiche gehüllt gewesen war, und wickelte es um ein scheinbares Kapitulationsangebot, in der Hoffnung, ganz Rom und vor allem Cesare und den Papst damit anzustecken. Der Plan kam auf, und nun hatte Alexander einen hieb- und stichfesten Grund, Caterina zu entmachten, nämlich wegen eines »Mordanschlags auf Seine Heiligkeit Papst Alexander VI.«.
Cesare, der keinem Boten traute, ritt – nur von einer kleinen Leibwache begleitet – in aller Eile nach Rom, um sich mit seinem Vater zu besprechen. Alexander, sonst durch nichts aus der Ruhe zu bringen, zeigte sich vom Plan der Catarina Sforza mehr empört als erschreckt.
»Wenn es um die Existenz einer ganzen Sippe geht, verstehe ich schon, dass man gelegentlich zu unsauberen, ja verabscheuungswürdigen Mitteln greift, um dem Feind zu schaden. Aber bin ich der Feind? Ich bin die Kirche, bin der gesalbte und erwählte Vikar Christi! Hätte sie dir, César, einen Mörder ins Haus geschickt, wäre das schlimm, aber ich könnte es noch verstehen. Sich am Papst zu vergreifen, ist jedoch ein Sakrileg und ich möchte diese Dame – auch wenn es kaum zu vergleichen ist – mit Savonarola in einen Topf werfen!«
»Beruhigt Euch, mein Vater, und seid guten Mutes. Diese selbst ernannte Amazone werde ich als Erstes vernichten. Freilich, auf den Scheiterhaufen können wir sie nicht schicken, aber meine Spione haben aus Forli und Imola berichtet, dass sie bei ihren Untertanen höchst unbeliebt ist, bei nicht wenigen sogar verhasst. Die französischen Söldner – berüchtigte Raufbolde aus der Gascogne – kennen keine Gnade und jeder Einzelne würde sich der Lächerlichkeit preisgeben, vor dieser Furie zu weichen. Ihr, Heiliger Vater, könnt dieser Ketzerin inzwischen einen Platz in der Engelsburg reservieren.«
Der Papst lachte erfreut und erleichtert.
»Deine Zuversicht gefällt mir, und zudem weiß ich Gott den Herrn auf unserer Seite. Kirchenlehen sind Gotteslehen, aber das scheinen diese Leute vergessen zu haben. Ich meine damit auch Malatesta von Rimini, den Sforza in Pesaro und Manfredi, den Zwingherrn von Faenza. Doch lass dir Zeit, César, und überstürze nichts!«
Sohn und Vater blickten einander in stillem Einvernehmen an.
»Überstürzen? Nein, das verbietet sich von selber, weil immer wieder die Geldmittel ausgehen. Mein Vater, ich werfe mich Euch zu Füßen und bitte nur um eines: Schafft Geld – Geld – Geld! Sobald eine Lohnzahlung länger überfällig wird, lassen mich die Söldner im Stich oder laufen zu den Tyrannen über.«
Alexanders Gesicht wurde ungewöhnlich ernst.
»Geld herbeischaffen, das sagt sich so leicht: Auch einem Papst sind gewisse Grenzen gesetzt …«
»Ich habe Euch nur meine Lage geschildert.«
Alexander legte seine kräftige, doch schon altersfleckige Hand auf den Arm des Sohnes.
»Eines kann ich dir jedenfalls versprechen: Das Jubeljahr 1500 steht vor der Tür, und es werden so viele Pilger nach Rom kommen wie nie zuvor. Ich werde Generalablässe verkünden, und – glaube mir – es wird Geld regnen! Im nächsten Jahr sieht alles ganz anders aus.«
»Vielleicht solltet Ihr inzwischen einige Kardinalswürden verkaufen …«
»Das habe ich vor einigen Jahren getan, und es entspricht nicht der Würde unserer Kirche, dies schnell zu wiederholen. Im Übrigen …«
Der Papst erhob sich und griff in das Regal an der Wand. Dann warf er einen Stapel Papiere auf den Tisch.
»Anfragen? Dutzende von Anfragen nach Kardinals- und Bischofswürden. Nicht, dass diese Leute kein Geld hätten – nein, darum geht es nicht. Aber wer sind sie? Überwiegend Gauner, Emporkömmlinge, Betrüger …«
Cesares gebräuntes Gesicht mit dem sorgfältig gestutzten Kinn- und Wangenbart blieb unbewegt. Dann richtete er sich auf und blickte den Papst ruhig an.
»Ich bin da, mein verehrter Herr Vater, etwas anderer Meinung. Alle Leute aus vornehmen oder altadeligen Familien, mögen sie nun Colonna oder Savelli, della Rovere oder Orsini heißen, haben irgendwann klein angefangen, oft genug als Landräuber, Brudermörder oder Piraten. Nach einigen Generationen wird das Erraubte und Erschlichene mit der Zeit ehrbar, ein Titel kommt hinzu, später ein höherer, und dann macht man sich einem König oder Herzog, einem Papst oder Bischof nützlich und der Aufstieg setzt sich fort. So wandelte sich eine zähe schlaue Bauersfamilie aus den Albaner Bergen in das Fürstengeschlecht der Colonna und bei den Orsini, Savelli, Cibo, Carafa, della Rovere und auch bei den Borgia wird es nicht anders gewesen sein. Freilich sind Hunderte von Familien, die denselben Ehrgeiz hatten, sang- und klanglos untergegangen, aber so ist es nun einmal. Mein Vater, ich würde mir niemals anmaßen, Euch in kirchliche Entscheidungen hineinzureden, aber was nützt es Euch, wenn Ihr einen Colonna, Orsini oder Cibo zum Kardinal erhebt? Damit setzt Ihr Euch nur eine Schlange mehr an die Brust, während der Weinhändlerssohn für Euch vor Dankbarkeit durchs Feuer geht. Ich bitte Euch, dies zu bedenken.«
Der Papst als kluger und langjährig erfahrener Kirchenmann musste seinem Sohn im Stillen recht geben. Seit er aber auf dem Thron Petri saß, hatten sich seine Ansichten in manchen Dingen geändert.
»Ja, César, das ist das eine – gewiss. Als Papst bin ich außer Gott niemandem Rechenschaft schuldig, kann aber dennoch nicht nach Lust und Laune handeln. Wie jeder geistliche oder weltliche Fürst bin ich zu gewissen Rücksichten verpflichtet, und bei mir müssen sie vor allem dem Kardinalskollegium gelten. Etwa die Hälfte davon weiß ich auf meiner Seite, entweder weil sie unserer Sippe angehören oder weil sie von mir ernannt worden sind. Aber die anderen, die Orsini und Savelli, die Colonna und Riario sind meine geheimen und manchmal auch offenen Feinde. Sicher kennst du den alten Spruch: Der Feind unseres Feindes ist mein Freund. Da sowohl die Colonna wie auch die Orsini mich als ihren Feind betrachten, beginnt der eigene generationslange Zwist zu verblassen. Dagegen muss ich mich – müssen wir uns – zur Wehr setzen. Das heißt aber auch, dass jede Kardinalserhebung sorgsam bedacht sein muss, um nicht durch Unachtsamkeit der Hydra ein weiteres Haupt wachsen zu lassen.«
Cesare verneigte sich im Sitzen.
»Ihr habt recht daran getan, mich zu belehren, padre santissimo, aber so seht Ihr auch, dass ich für die weltlichen Dinge weitaus geeigneter bin.«
Er stand auf und hob fordernd die Hand.
»Das ändert aber nichts daran, dass ich für meine Truppen Geld – sehr viel Geld benötige. Den Kriegszug gegen die Furie Caterina Sforza stehe ich noch durch, aber wenn es gegen Rimini, Pesaro und Faenza geht, müsst Ihr mir neue Mittel verschaffen. Doch bedenkt auch, mein Vater, dass die Kirchenlehen, sobald sie wieder ihre Tribute an das Patrimonium Petri zahlen, die verlorenen Gelder im Laufe der Zeit vielfach wieder einbringen.«
Der Papst nickte.
»Das weiß ich, und so, wie ich dir vertraue, darfst du mir – und auf Gottes Hilfe – vertrauen. Schlafe dich jetzt aus!«
Alexander erhob sich und zeichnete das Segenskreuz über Cesares gebeugtem Haupt.
Was empfand der Valentino, so nannte ihn jetzt alle Welt nach seinem französischen Herzogtum, was empfand Cesare Borgia dabei? Glaubte er an Segen und Beistand Gottes? Oder hatte er sich als rechtes Kind seiner Zeit von der inneren Bedeutung des christlichen Glaubens entfernt und beachtete nur noch die äußeren Formen?
Darüber befragt, was niemand, auch nicht sein Vater, wagte, hätte vermutlich auch er keine schlüssige Antwort gewusst. Im Vordergrund seines Bemühens stand – daraus machte er keinen Hehl – die Bereicherung seiner Sippe und die Erhöhung der eigenen Person, mit dem Ziel, Herzog, vielleicht auch König der Romagna zu werden. Zur höheren Ehre Gottes natürlich, aber wer war Gott – wo war er? Gewiss im Himmel, aber sehr, sehr fern. So fern, dass er auf Erden einen Stellvertreter brauchte, weil er offenbar weder willens noch gesonnen war, selber in irdische Belange einzugreifen. Die dies behaupteten – etwa Bußprediger mit dem Hinweis auf Gottes Zorn, der die Menschheit jederzeit mit Seuchen, Missernten, Hungersnöten und anderem zu strafen bereit war –, glaubten entweder aus geistiger Einfalt selber daran, oder sie nutzten ihre Drohpredigten, um das einfache Volk mit dem Glaubensknüppel zu beherrschen.
Cesare aber handelte in allem so, dass er weder seinem Schicksal noch auf himmlische Hilfe vertraute, sondern ausschließlich dem eigenen Wollen und Können. Sein fast krankhaft anmutendes Misstrauen entsprang einer bis aufs Äußerste geübten Vorsicht. Selbst seinem bösen Schatten, der eiskalten, immer gehorsamen Tötungsmaschine Michelotto, traute Cesare nicht zur Gänze. So hatte er auch diesmal den erschöpfenden Gewaltritt nach Rom auf sich genommen, um alles Wichtige mit dem Papst persönlich zu besprechen. Jetzt aber war er todmüde und schlief schon halb, als er sich auskleiden ließ.
Miguel da Corella, den alle Welt Michelotto nannte, war aus Spanien nach Rom gekommen, als Rodrigo Borgia zum Papst gewählt wurde. Bald war Cesares Auge auf diesen Mann gefallen, der fechten konnte wie ein Teufel und bei dem Wort Gewissen nur die Achseln zuckte. Er war es auch, der Cesares Bruder Juan in aller Stille beseitigt hatte, und zwar nur auf die vage Bemerkung seines Herrn, dass dieser in jeder Beziehung unfähige Mensch inzwischen entbehrlich geworden sei.
Äußerlich suchte Michelotto seinem Herrn in allem zu gleichen. Er trug den gleichen Bart, bevorzugte dunkle schmucklose Kleidung und verhielt sich, wenn es um die Borgia ging, sehr schweigsam. Von seiner Gestalt her fehlte ihm das vornehm Feingliedrige und, wenn Cesare auf seine Umgebung wirkte wie ein gezogener Degen, so hätte man Michelotto mit seiner etwas plumpen, gedrungenen Gestalt eher als schlagbereiten Knüppel bezeichnen müssen.
Sonst immer an seiner Seite, hatte Cesare es diesmal vorgezogen, Michelotto bei der Truppe zu belassen. Vielleicht bekam er da manches zu hören, das in der Anwesenheit des Heerführers nicht oder nur hinter vorgehaltener Hand ausgesprochen wurde.
Cesare erwachte in den späten Vormittag hinein und erfuhr, dass Seine Heiligkeit schon dabei sei, eine Morgenmesse in der Capella Sistina zu lesen. Wider Willen kam ihn ein Lächeln an, als er an diese privaten, nur für Freunde und hohe Gäste zugänglichen Messfeiern dachte. Rodrigo Borgia, zeit seines Lebens mit Wichtigerem beschäftigt, als eine Messe zu lesen, beherrschte auch als Papst den lateinischen Text nur ungenügend. Er mischte spanische Brocken dazwischen, überging auch längere Passagen mit undeutlichem Gemurmel. Saßen unter den Besuchern Frauen, die er kannte, so konnte er es sich nicht versagen, ihnen eine Kusshand zuzuwerfen und dabei bedeutungsvoll zu blinzeln.
Cesare gähnte. Aber was zählt das schon, dachte er zufrieden, nur auf die Macht kommt es an, die hinter der Gestalt eines Papstes steht. Noch heute ging die Legende von Baldassare Cossa um, einem ehemaligen Seeräuber, der es auf krummen Wegen zum Kardinal und 1414 sogar zum Papst gebracht hatte. Er nannte sich Johannes XXIII. Und hielt sich mit Hilfe einer beachtlichen Truppenmacht immerhin fünf Jahre auf dem päpstlichen Thron. Auf dem Konzil von Konstanz wurde er abgesetzt und starb wenig später im florentinischen Exil. Die Chronisten reihten ihn später unter die Gegenpäpste ein. Aber für Cesare zählte nur, dass sich dieser Mann mit Mut, Zähigkeit und manchmal grausamer Rücksichtslosigkeit einige Jahre auf dem Stuhl Petri hatte behaupten können. Wir aber, ging es ihm durch den Kopf, stehen hinter einem Papst, der nicht nur einstimmig gewählt und von aller Welt anerkannt wird und sich zudem auf eine ansehnliche Truppenmacht stützen kann.