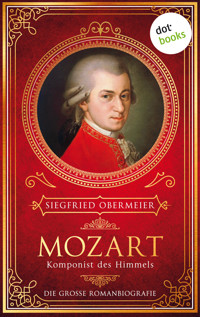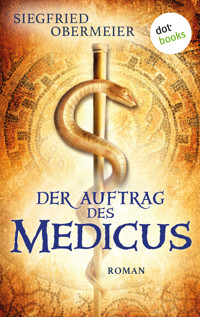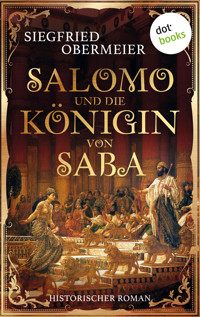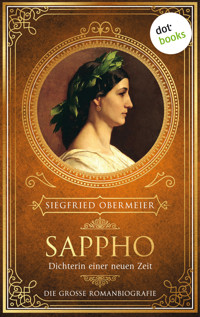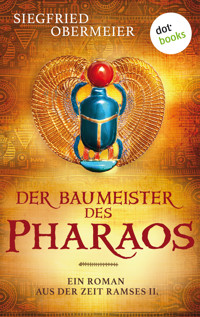Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ihre grausamen Launen waren berühmt und berüchtigt: Der historische Roman »Die Kaiserin von Rom« von Siegfried Obermeier als eBook bei dotbooks. Rom im 1. Jahrhundert nach Christus. Valeria Messalina sieht sich zu Großem berufen: Als Mitglied der Kaiserfamilie liegt ihr das Leben im pulsierenden Herzen des römischen Imperiums zu Füßen. Als ihr größenwahnsinniger Cousin Caligula schließlich den Blutzoll für seine grausame Herrschaft bezahlen muss, ist ihre Zeit gekommen – Messalina steigt auf zur Kaiserin von Rom. Doch schon bald verbreiten sich Gerüchte vom ausschweifenden Leben der Femme fatale wie ein Lauffeuer in der römischen Oberschicht: Die Unersättliche nimmt sich jeden Mann, den sie begehrt; wer der bildschönen Aristokratin in die Quere kommt, den lässt sie eiskalt verschwinden. Doch eine Frau, die so ungezügelt ihre eigenen Wege geht, hat immer mehr Feinde als Bewunderer … Sie ist die Frau mit dem wohl schlechtesten Ruf der Weltgeschichte – und soll sich gar mit Roms berühmtester Hure einen Wettstreit um die meisten Männer pro Nacht geliefert haben (den sie gewann): Siegfried Obermeier erzählt in bestechender Eindringlichkeit vom Leben dieser schillerndsten aller römischen Kaiserinnen. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Die mitreißende Romanbiografie »Die Kaiserin von Rom« von Siegfried Obermeier - ein farbenprächtiges Lesevergnügen für alle Fans von Rebecca Gablé und Hilary Mantel. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 600
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Rom im 1. Jahrhundert nach Christus. Valeria Messalina sieht sich zu Großem berufen: Als Mitglied der Kaiserfamilie liegt ihr das Leben im pulsierenden Herzen des römischen Imperiums zu Füßen. Als ihr größenwahnsinniger Cousin Caligula schließlich den Blutzoll für seine grausame Herrschaft bezahlen muss, ist ihre Zeit gekommen – Messalina steigt auf zur Kaiserin von Rom. Doch schon bald verbreiten sich Gerüchte vom ausschweifenden Leben der Femme fatale wie ein Lauffeuer in der römischen Oberschicht: Die Unersättliche nimmt sich jeden Mann, den sie begehrt; wer der bildschönen Aristokratin in die Quere kommt, den lässt sie eiskalt verschwinden. Doch eine Frau, die so ungezügelt ihre eigenen Wege geht, hat immer mehr Feinde als Bewunderer …
Sie ist die Frau mit dem wohl schlechtesten Ruf der Weltgeschichte – und soll sich gar mit Roms berühmtester Hure einen Wettstreit um die meisten Männer pro Nacht geliefert haben (den sie gewann): Siegfried Obermeier erzählt in bestechender Eindringlichkeit vom Leben dieser schillerndsten aller römischen Kaiserinnen.
Über den Autor:
Siegfried Obermeier (1936–2011) war ein preisgekrönter Roman- und Sachbuchautor, der über Jahrzehnte zu den erfolgreichsten deutschen Autoren historischer Romane zählte. Seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt.
Bei dotbooks veröffentlichte Siegfried Obermeier die historischen Romane »Der Baumeister des Pharaos«, »Die freien Söhne Roms«, »Der Botschafter des Kaisers«, »Blut und Gloria: Das spanische Jahrhundert«, »Salomo und die Königin von Saba« und »Das Spiel der Kurtisanen« sowie die großen Romanbiographien »Sappho, Dichterin einer neuen Zeit« und »Mozart, Komponist des Himmels«. Weitere Titel sind in Vorbereitung.
***
eBook-Neuausgabe November 2021
Dieses Buch erschien bereits 2002 unter dem Titel »Messalina - Die lasterhafte Kaiserin« bei nymphenburger.
Copyright © der Originalausgabe 2002 nymphenburger in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung eines Gemäldes von Hans Makart
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-96655-714-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Kaiserin von Rom« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Siegfried Obermeier
Die Kaiserin von Rom
Historischer Roman
dotbooks.
Prolog
Sie hasste es, ein Kind zu sein. Sie hasste es, sich jedes Ding befehlen und vorschreiben zu lassen. Ihr Benehmen, ihre Kleidung, ihren Gang, ihre Frisur, ihre Essens- und Schlafenszeiten, ihre Lektüre, die Frei- und Arbeitsstunden ‒ über all dies wurde von Erwachsenen verfügt. Tu dies, tu das, lass dies, lass das, so nicht, so schon, dieses nicht, aber jenes. Eltern, Verwandte, Lehrer ‒ man brauchte nur erwachsen zu sein, um Messalina gängeln und bevormunden zu können.
Wenn sie mit gleichaltrigen Mädchen zusammenkam, dann herrschte fast einhellig die Meinung, Kind zu sein sei wundervoll, man müsse diesen Zustand genießen und so lange wie möglich hinauszögern. Mit Grauen und Abscheu wurde meist jenes gar nicht mehr so fernen Tages gedacht, da die Monatsblutung einsetzen würde und das Mädchen zur Frau machte, für die es galt, möglichst schnell einen geeigneten sponsus zu finden. Schon der Gedanke daran sei ekelhaft, demütigend, grässlich.
So redeten sie, die dummen Gänschen, und Messalina hielt es nicht für der Mühe wert zu protestieren. Sie jedenfalls sehnte diese Stunde herbei, erwartete ungeduldig den Tag, da man sie als Erwachsene betrachten und behandeln würde. Freilich, als Frau hatte man ohnehin das schlechtere Los gezogen, doch da es nun einmal so war, wollte sie das Beste daraus machen. Dass man sie nach ihrer Frauwerdung bald verheiraten würde, nahm sie gerne in Kauf, denn damit waren schließlich auch gewisse Freiheiten verknüpft: Theaterbesuche, kleine und größere Reisen, Einkäufe auf dem Markt, natürlich immer in Begleitung, und, falls der Gatte alt oder impotent war und man es geschickt anstellte, einen amator oder auch mehrere. Der konnte es einem dann so richtig besorgen im Bett … So hatte es eine Verwandte formuliert, die vor kurzem an einen älteren Witwer verheiratet worden war. »Der alte Zausel«, so flüsterte sie im Kreis der andächtig lauschenden Mädchenrunde, »der kriegt ja keinen mehr hoch, da war, wie ihr euch denken könnt, die Brautnacht kein besonderes Vergnügen. Doch schon auf der Hochzeitsfeier gab es einige, die mir schöne Augen machten und auf die ich zählen kann.«
Das waren für die elfjährige Messalina zunächst einmal Rätselworte. Doch hätte sie sich lieber die Zunge abgebissen, als andere oder gar die Erzählerin danach zu fragen. Alle taten sehr wissend, nickten und kicherten, Messalina hätte jedoch eine Hand darauf verwettet, dass nur ganz wenige wirklich Bescheid wussten. Hätte sie ihre Mutter danach fragen sollen? Nicht, dass ihr der Mut dazu fehlte, denn Domitia Lepida war kein Ausbund an Tugend, ganz im Gegenteil. Doch etwas hielt Messalina davon ab, sie hätte nicht deutlich benennen können, was es war. Scham? Furcht vor einer abschlägigen Antwort oder gar einem rüden Verweis? Vielleicht, aber wohl auch der unbewusste Wunsch, diese Dinge selbst zu erfahren, selbst zu erproben. Brüder hatte sie keine, es wäre jedoch auch undenkbar gewesen, einen Mann danach zu fragen, obwohl es ja eigentlich die Männer betraf. Sie waren es ja, die keinen mehr hochkriegten oder es einem so richtig besorgten im Bett …
Schön wäre es schon gewesen, wenn der Kleine überlebt hätte ‒ in diesen Tagen wäre er acht geworden. Der Vater war vor Freude außer Rand und Band geraten, als endlich der männliche Spross zur Welt gekommen war, der Erbe, der Stammhalter, der Namensträger. Doch dann …
Die Familie wollte damals gerade zum Sommeraufenthalt in das Landgut bei Praeneste aufbrechen, als diese tückische Kinderkrankheit ihre mörderischen Spuren durch Rom zog. Wie Hunderte andere war der Fünfjährige qualvoll gestorben und der Vater hatte sich von diesem Schlag niemals erholt. Bald darauf gab Valerius Messalla seinen Sitz im Senat auf und widmete sich nur noch der Verwaltung seines Vermögens. Er begann zu trinken und wies jedem Medicus die Tür, der es ihm verbieten wollte.
Es gab eine Zeit, da wäre Messalina lieber ein Junge gewesen, um dem Vater den schmerzlichen Verlust zu ersetzen. Sie hatte am kleinen Tempel der Venus Genetrix, gleich hinter dem Forum Julium, bescheidene Opfergaben niedergelegt, ohne den erstaunten Eltern den Grund zu nennen. Wochenlang betastete sie gleich nach dem Erwachen die Stelle, an der sie hoffte, dass ein kleiner Penis wachsen würde, doch entweder waren die Götter taub oder sie wollten das von ihnen bestimmte Geschlecht nicht ändern. Später hatte sie sich dann über ihre Einfalt geärgert. Was hätte sie schon groß davon gehabt, ein Junge zu sein? Gewiss, ein freieres Leben, ein paar Vorrechte, aber ständig wachsende Pflichten. Nein, nein, es war schon gut so.
Messalinas Elternhaus lag am nördlichen Stadtrand zwischen der Via Flaminia und den Horti Luculliani, die Valerius Asiaticus, ein entfernter Verwandter, prächtig hatte ausbauen und verschönern lassen. Wenn er jemand um seinen Besitz beneide, hatte der Vater einmal gesagt, dann diesen Vetter um seine wundervollen Gärten. »Wenn ich das Geld hätte, würde ich dir diese Horti kaufen«, hatte sie unwillkürlich gesagt.
Der Vater lachte. »Lieb von dir, mein kleiner Schatz, aber Asiaticus würde den Park um nichts in der Welt hergeben ‒ das hat er mir selbst gesagt.«
Messalina sprang so schnell auf, dass der Hocker umfiel, auf dem sie gekauert hatte. Sie ging ans Fenster ihres im Obergeschoss liegenden Zimmers und schaute nach Osten. Die Kronen der mächtigen Pinien in den Horti Luculliani waren von hier aus zu sehen und was von den Bäumen und Sträuchern im Winter die Blätter verloren hatte, schmückte sich jetzt, Anfang März, mit kräftigem Grün.
Messalina nahm es wahr, nahm es jedoch nicht auf. Noch siebenundvierzig Tage bis zu ihrem zwölften Geburtstag! Sie könnte Nike fragen, die griechische serva, von der Mutter gesagt hatte, dass jeder männliche Sklave im Haus schon in ihrem Bett gewesen sei. Insgesamt verabscheute Messalina diese Sklaven, doch ein paar davon mochte sie. Die meisten von ihnen hatten so etwas Verschlagenes an sich, buckelten und schlugen die Augen nieder, doch hinter ihrer demütigen Sklavenmiene lauerten Frechheit und Aufruhr.
Bei Nike war das anders. In ihrem hübschen Gesicht trat die Frechheit offen zutage, vor allem, was die Männer betraf. Denen gegenüber gab sie sich kratzbürstig, schnippisch und kurz angebunden. Das, so vermutete Messalina, legte sie ab, wenn ein Mann ihre Kammer betrat. Sie jedenfalls müsste schlüssig erklären können, was es bedeutete, wenn ein Mann und eine Frau zusammenkamen.
Nike war die bevorzugte famula der Hausherrin und bekannt für ihr Geschick, zerstörte Frisuren aufs Beste wieder herzurichten.
Im Haus herrschte die übliche nachmittägliche Stille und um die Eltern nicht zu stören, ging Messalina hinüber ins Sklavenquartier. Sie winkte Nike heran, legte einen Finger auf die Lippen und zog sie hinauf in ihr Zimmer.
»Soll ich dir die Haare richten, Virgo?«
Dass Nike sie nicht Domina, also Herrin, nannte, sondern spaßhaft mit Jungfrau anredete, ließ Messalina hingehen. Sie wies auf den Hocker. »Nein, setz dich.«
Messalina ließ sich ihr gegenüber aufs Bett fallen und redete nicht lange herum. »Du kennst dich doch mit Männern gut aus.«
»Ich bin keine virgo mehr, wenn das gemeint ist …«
Messalina nickte ungeduldig. »Ja, genau das meine ich. Ich werde bald zwölf, bekomme dann wohl auch meine Monatsblutung und möchte über Verschiedenes Bescheid wissen.«
Auf Nikes frischem, rundlichem Gesicht erwachte das Misstrauen. »Ich bin nur eine serva, vielleicht solltest du besser die Domina fragen.«
»Das will ich eben nicht! Meine Mutter würde wahrscheinlich nur um den heißen Brei herumreden, von dir erwarte ich die Wahrheit! Hast du verstanden?«
Nike seufzte. »Also gut, worum geht es?«
»Was bedeutet es, wenn von einem Mann gesagt wird, dass er es den Frauen im Bett so richtig besorgt?«
Nike schüttelte ihren Kopf und blies die Wangen auf. »Woher hast du das?«
»Das ist unwichtig und geht dich nichts an ‒ also?«
»Lass es mich so sagen: Wenn ein Mann jung ist und stark und weiß, was den Frauen gut tut, dann, ja dann sagt das Volk, er besorgt es ihnen richtig. Nur in euren Kreisen …«
»Wird auch nicht immer so vornehm geredet. Was genau tut er dabei?«
Nike blickte flehentlich zur Decke und stieß hervor: »Diana, Schutzherrin der Sklaven, steh mir bei!«
Sie wandte sich an Messalina und flüsterte: »Weißt du überhaupt, was zwischen Liebesleuten vorgeht?«
»So ungefähr schon …«
»Also ‒ der Mann umarmt die Frau, beide sind nackt, beide sind erregt, der Schoß der Frau öffnet sich, der Mann dringt mit seinem Dingsda ein und rammelt nicht anders als Rüden und Hengste es tun. Das genießen die Liebesleute und so werden die Kinder gemacht.«
»Aha …«
»Noch etwas, meine Virgo?«
»Und wenn er keinen mehr hochkriegt?«
Nike kicherte. »Dann geschieht eben nichts. Wenn der Mann erregt ist, muss sein Dingsda hart und steif werden wie ein Stock. Sonst geht nichts … Habe ich es deutlich genug erklärt?«
Messalina nickte. »Ja, schon ‒ du kannst dann gehen.«
Sie wollte sich vor der Sklavin keine Blöße geben. Nike war schon unter der Tür, da sagte Messalina mit leiser scharfer Stimme: »Dieses Gespräch bleibt unter uns, verstanden? Wenn du es herumtratschst, werde ich dich so hart auspeitschen lassen, dass du eine Woche auf dem Bauch schlafen musst.«
Nike tat, als erschrecke sie. »Nein, nein ‒ kein Wort kommt über meine Lippen, das schwöre ich bei allen Göttern!«
»Dann hinaus mit dir!«
Sklavenpack! Leider braucht man es, wie man Kleider, Pferde und Werkzeuge braucht.
Der zwölfte Geburtstag kam, es gab eine kleine Feier, doch Messalinas Schoß blieb trocken und so wurde sie weiterhin als Kind behandelt.
Im Juni zog die Familie in ihr Landhaus bei Praeneste und Messalina durfte nicht auf einem Maultier reiten, sondern wurde mit Mutter und Nike in den geräumigen Reisewagen gesperrt, den vier Ochsen langsam genug voranbrachten. Die eisenbeschlagenen Räder machten auf dem buckligen Straßenpflaster einen solchen Lärm, dass man sein eigenes Wort nicht verstand, und ganze Stapel von Polstern konnten nicht verhindern, dass einem die Eingeweide durchgeschüttelt wurden wie Würfel in einem Becher. Und da geschah es.
Sie hatten die Stadt durch die Porta Praenestina schon verlassen, als ein besonders harter Stoß des dahinpolternden Reisewagens in Messalina zuerst einen dumpfen, dann einen ziehenden, sich schnell steigernden Schmerz auslöste, der sie laut auf stöhnen ließ, was der Lärm jedoch übertönte. Mit einer Hand packte sie ihre Mutter am Arm, die andere presste sie auf den Bauch und zugleich spürte sie, dass es darunter warm und feucht wurde. Sie tastete danach und als sie ihre Hand hervorzog, glänzten ihre Finger dunkelrot.
Die aufmerksame Nike wusste gleich Bescheid und schrie, um den Lärm zu übertönen: »Wir müssen anhalten, Domina! Aus unserer Virgo ist eine Frau geworden.«
Da niemand auf Domitias erregtes Winken achtete, sprang Nike kurz entschlossen aus dem langsam dahinrumpelnden Wagen und fiel dem daneben reitenden Bediensteten in die Zügel.
Eine große Aufregung entstand, weil der Sklave in seiner männlichen Beschränktheit etwas von einer schweren Verletzung verstanden hatte, doch das klärte sich bald. In einem schnell am Straßenrand errichteten Tuchzelt wurde Messalina von Frauen fachgerecht versorgt. Um ihre Tochter zu trösten, meinte Domitia Lepida: »Mach dir nichts daraus, meine Kleine.
So geht es allen Frauen und man gewöhnt sich schnell an das Übel.«
Messalina blickte sie erstaunt an. »Übel? Wer spricht von Übel? Ich bin froh, dass es endlich so weit ist. Jetzt kann ich zu leben beginnen.«
Domitia konnte mit den rätselhaften Worten ihrer Tochter wenig anfangen ‒ doch schon einige Jahre später wusste sie, wie es gemeint gewesen war.
Kapitel 1
Tiberius Claudius Nero Germanicus, Enkel des vergöttlichten Augustus und letzter kaiserlicher Prinz aus julisch-claudischem Geschlecht, erwartete in wenigen Wochen seinen neunundvierzigsten Geburtstag und zweifelte daran, ob er ihn noch erleben würde. Sein Neffe Gaius Julius Caesar Augustus, genannt Caligula, das Stiefelchen, schändete seit über zwei Jahren den römischen Kaiserthron mit seinen blutigen, tödlich-grausamen »Scherzen«. Mehrmals hatte er wütend ausgerufen: »Ach, hätte ganz Rom nur einen Hals!« Ein halbes Jahr nach seiner Thronerhebung war Caligula schwer krank geworden und nach seiner Genesung hatte er sich für göttlich erklärt. Er sah sich als auf Erden weilender Zwilling des Jupiter und ließ sich einen Tempel auf dem Palatin errichten.
Wer aus der julisch-claudischen Familie die Mordtaten des unter Tiberius wütenden Sejanus überlebt hatte, der fand unter Caligula sein Ende ‒ ausgenommen bisher Prinz Claudius. Wegen seiner stillen und wortkargen Art hatten Eltern und Verwandte ihn von Jugend an für geistig zurückgeblieben erachtet und er hatte wenig getan, um diesen Eindruck zu widerlegen ‒ aus kluger Berechnung, weil er ungestört bleiben und Ruhe für seine wissenschaftliche Arbeit haben wollte. Aus Claudius war nämlich in aller Stille ein Gelehrter geworden, der Freude und Genugtuung in historischen Studien fand, mehrbändige Werke über römische, etruskische und karthagische Geschichte schrieb, und zwar in der von ihm vollendet beherrschten griechischen Sprache.
Zum Glück hatte sein mörderischer kaiserlicher Neffe ihn genauso wenig ernst genommen wie alle anderen Verwandten und ihn niemals als möglichen Thronanwärter angesehen.
Herrschen war tatsächlich etwas, was sich Claudius so wenig wünschte wie Krankheit oder Tod. Er hatte sich in die Rolle des stotternden, hinkenden und Gesichter schneidenden Trottels so eingelebt, dass er sie nicht mehr zu spielen brauchte, sie war ihm zur zweiten Natur geworden.
Mehr um ihn zu ärgern und noch lächerlicher zu machen, hatte Caligula ihm politische Ämter aufgedrängt. Er musste den Senator und zeitweise den Konsul spielen, blieb dabei seiner Rolle treu und brachte mit seinem Ungeschick halb Rom zum Lachen. Caligula dachte nicht daran, auf diesen wohlfeilen Hofnarren zu verzichten, und so musste Claudius, sobald er sich zum Beispiel über den Sommer in sein Landhaus bei Neapolis zurückziehen wollte, untertänigst um Erlaubnis ansuchen.
Sein römisches Domizil lag am Rande der Stadt und besaß einen kleinen, schattigen Park. Hier vergrub sich Claudius in seine Arbeit und suchte häufig die Bibliotheken auf, deren wichtigste von seinem Großvater Augustus gegründet worden war, mit einem umfangreichen Bestand an historischen Werken in lateinischer und griechischer Sprache.
So schritt seine Arbeit zügig und ziemlich ungestört voran ‒ ungestört auch deshalb, weil er sich vor kurzem von seiner zweiten Gemahlin Aelia Paetina getrennt hatte. Sie war ihm dauernd mit Forderungen in den Ohren gelegen, er sei zu wenig ehrgeizig, strebe weder Macht noch Einfluss an, vergrabe sich in seinen Büchern und sei alles andere als ein guter pater familias. Da habe sie nicht Unrecht, entgegnete er und schlug eine Trennung von Tisch und Bett vor. Falls sie Wert darauf lege, würde er auch einer Scheidung zustimmen. Diesen Schritt wollte Aelia jedoch nicht tun, denn sie hatte ihm die Tochter Claudia geboren und hegte die unsinnige Hoffnung auf einen Sohn.
Äußerlich betrachtet, hätte Claudius als schöner Mann gelten können. Mittelgroß, von körperlichem Ebenmaß, war er schlank, ohne mager zu sein. In seinem vollen Haar überwog der Grauton; seine klugen, etwas nachdenklichen Augen hielt er auf Gesellschaften meist halb geschlossen, als wolle er nicht wahrnehmen, wo er sich befand und wer um ihn war. Seine kräftige, ein wenig zu kurze Nase schien manchmal misstrauisch zu schnuppern, der gut geformte Mund lächelte höchst selten und wenn, dann wurde eine Grimasse daraus.
Kurz gesagt ‒ wenn Claudius schweigend auf einem Stuhl saß, bot er das anmutige Bild eines würdigen älteren Mannes, doch wenn er ging, redete oder aß, wurde ein Zerrbild daraus. Von Jugend an war er etwas schwach in den Kniegelenken gewesen, doch weder Eltern noch Erzieher versuchten durch gezielte athletische Übungen den Schaden zu beheben oder zu mildern. Bei einem Claudius schien alle Mühe vergebens, wenn schon seine Mutter von ihm sagte, er sei ein Scheusal unter den Menschen und es gebe wohl nur wenige, die noch dümmer seien als er. So erfuhr er von Kindheit an Spott und Missachtung und zog sich mehr und mehr in sich selbst zurück, fand Trost bei seinen Büchern und bald bei seinen wissenschaftlichen Arbeiten, die ihn so fesselten, dass sie zu einer Leidenschaft wurden, die sein Leben prägte.
Eine andere waren die Frauen. Manchmal dachte er bei sich, an seiner Wiege müsse Priapus gestanden und ihm die Eigenschaft eingehaucht haben, vor allem Weiblichen schwach zu werden. Es fiel den Frauen nicht schwer, Claudius zu verführen, und da er trotz allem ein kaiserlicher Prinz war, fehlte es ihm niemals an Bewerberinnen. Er kannte diese Schwäche genau und lehnte sich von Zeit zu Zeit dagegen auf, wohl wissend, dass er schon der nächsten Versuchung nicht widerstehen konnte.
Claudius hatte sich schon auf den stillen November gefreut, den einzigen Monat, der keine Staatsfeierlichkeiten kannte, ausgenommen die Feriae Jovi in der Monatsmitte. Bei Caligula gab es keine Regel, ob er an solchen Festen teilnahm oder nicht, keine Regel auch, ob sein Onkel Claudius geladen war oder nicht. Der kaiserliche Tages-, Wochen- und Monatskalender wurde ausschließlich von Caligulas Launen diktiert und wenn er gestern noch für den nächsten Tag einen Ausflug zu seinem Prunkschiff im Lacus Nemorensis angekündigt hatte, so konnte er wenige Stunden vorher seine Pläne ändern. So war es auch diesmal.
Ein kaiserlicher Cursor lud Claudius zu dem Jupiter-Fest auf den Palatinus und Claudius wusste, dass dies ein Befehl war. Nicht selten war es geschehen, dass ein Geladener aus irgendeinem Grund der Aufforderung nicht Folge leisten konnte und sich zu spät oder nicht ausreichend entschuldigte. Wenn Caligulas Sekretäre zudem herausfanden, dass dieser Mensch wohlhabend war, dann wurde er mit der Androhung eines Hochverratsprozesses in den Tod getrieben. Zuvor musste er jedoch zumindest zwei Drittel seines Nachlasses dem Kaiser überschreiben. Die eingetriebenen Steuern reichten für Caligulas maßlose Prunksucht längst nicht mehr aus und so hatte er sich reiche römische Bürger als Geldquelle erschlossen. Immer häufiger machten Wohlhabende von der Möglichkeit Gebrauch, sich unter einem falschen Namen in einer fernen Provinz zu verkriechen, um dort ihr Leben und zumindest einen Teil des Besitzes zu retten, bis der kaiserliche Massenmörder beseitigt war und der Blutdunst über Rom sich verzogen hatte.
So machte sich Claudius seufzend auf den Weg und ließ sich, da am Morgen ein kräftiger Regen eingesetzt hatte, in einer geschlossenen Sänfte zum Palatium tragen. Dort hatte der kaiserliche Palast unter Caligulas Bauwut so groteske Formen angenommen, dass er wie ein Krebsgeschwür den Mons Palatinus überwucherte, wozu nicht wenige ältere Bauten abgerissen oder, wie der Tempel von Castor und Pollux, den göttlichen Zwillingssöhnen, quasi zum vestibulum des Kaiserpalastes herabgewürdigt wurden. Dort stellte sich der Kaiser manchmal neben die Statuen des Götterpaares und ließ sich als Jupiter Latiaris anbeten.
Claudius sah wohl, wie die wachhabenden Prätorianer feixend ihre Gesichter verzogen, als er Grimassen schneidend die Treppe hinaufhumpelte, aber wie immer in der Öffentlichkeit verschloss er seinen Sinn vor den ihn umgebenden Menschen und Ereignissen.
Die religiösen Zeremonien der Feriae Jovi hatten bereits am frühen Morgen stattgefunden und jetzt geruhte der göttliche Imperator als irdisches Erscheinungsbild des Jupiter für die auserwählten Gäste eine Nachfeier zu veranstalten.
Caligula war noch nicht erschienen, es herrschte Gedränge und Stimmengewirr und es dauerte eine Weile, bis alle ihre Plätze eingenommen hatten.
Claudius ließ sich in dem abgesperrten Bereich nieder, der einstmals für Mitglieder der kaiserlichen Familie vorgesehen war und nun von Caligulas Günstlingen und Vertrauten genutzt wurde. Er senkte die Lider und blickte unauffällig in die Runde. Im Vorjahr hatten hier noch Agrippina und Julia Livilla, die Schwestern des Kaisers, gesessen, die er wegen angeblicher Verschwörungspläne auf die wüsten Pontinischen Inseln verbannt hatte. Claudius dachte an seine beiden Nichten ‒ die sanfte Livilla hatte er immer geschätzt ‒ und fragte sich, ob sie jemals nach Rom zurückkehren würden. Nicht, solange Caligula lebte …
Jetzt traten Valerius Messalla und seine Frau Domitia Lepida ein. Ah, das Töchterchen hatten sie heute auch dabei! Messalina war jetzt wohl volljährig geworden. Da die Familie in seiner unmittelbaren Nachbarschaft wohnte und mit ihm entfernt verwandt war, kannte er sie flüchtig.
Es ist schon seltsam, ging es ihm durch den Kopf, dass Eltern von nichts sagender, manchmal sogar hässlicher Erscheinung so schöne Kinder zeugen.
Messalina trug seit kurzem die Haare hochgesteckt, in kunstvolle Wellen gelegt und an der Stirn mit kleinen Löckchen verziert, die aussahen wie niedliche Schnecken. Ihr Gesicht war eher schmal mit leicht betonten Wangenknochen, großen leuchtenden Augen, einer schön geformten, schmalen Nase und einem Mund, Claudius schluckte, einem so süßen Mund … Nicht zu groß und nicht zu klein, Ober- und Unterlippe vollendet geformt.
Solange der göttliche Imperator nicht erschienen war, richteten sich die neugierigen Augen auf Claudius und so auch die von Messalina. Hatte sie ihn angelächelt? Claudius war sich nicht ganz sicher, die Entfernung war zu groß.
Ob Caesonia Augusta heute erscheinen würde? In vierter Ehe hatte Caligula sie geheiratet und sie schien endlich eine Frau nach seinem Geschmack. Launisch, heimtückisch, grausam und schamlos, gehörte sie zu den wenigen, die den Kaiser nicht fürchteten, und dies vor allem gefiel und beeindruckte ihn. Sie hatte ihm vor einem Jahr die Tochter Drusilla geboren, auf die er so stolz war, dass er, wie man hörte, den Plan erwog, sie jetzt schon zur Gottheit erklären zu lassen. So, wie er es mit seiner gleichnamigen Schwester getan hatte, die vor zwei Jahren gestorben war und mit der Caligula in stolz eingestandener Blutschande gelebt hatte.
Caesonia kam nicht, stattdessen erschien Pyrallis, des Kaisers bevorzugte concubina. Sie gehörte zu den wenigen Menschen, die auf Caligula einen mildernden Einfluss ausübten. Seine angemaßte Göttlichkeit nahm sie nicht zur Kenntnis und redete ihn auch vor anderen mit seinem Vornamen Gaius an. Sie sagte ihm einfach, was ihr gefiel und was nicht ‒ ganz unaufgeregt gab sie ihm etwa zu bedenken: »Hältst du das für angemessen, Gaius? Ich finde, es passt nicht zur Würde eines Imperators.« Oder: »Warum zerrst du gerade den vor Gericht? Der Mann hat Frau, Kinder und arme Verwandte zu versorgen. In Rom gibt es genügend gemeine Wucherer, die du schröpfen kannst.«
Erstaunlicherweise hörte der Kaiser oft auf ihren Rat und wer Pyrallis näher kannte, wusste, dass sie ihre Stellung weder missbrauchte, um anderen zu schaden, noch um sich selbst zu bereichern. Als einziges größeres Geschenk hatte sie ein eher bescheidenes Haus in Tibur angenommen mit den Worten: »Dahin kann ich mich zurückziehen, wenn du mich satt hast, Gaius.«
Ihr nobles Verhalten hatte sich längst in Rom herumgesprochen und immer häufiger erreichten sie Bittbriefe. Die gab sie stets an Callistus weiter, des Kaisers obersten Sekretär, dem er vertraute wie keinem anderen. Callistus aber, durch die Ereignisse der letzten Zeit vorsichtig geworden, begann eigene Pläne zu entwickeln. Pyrallis begrüßte Claudius mit einer leichten Verneigung.
»Wann wird der Augustus erscheinen?«
Sie hob ihre schmalen Schultern. »Er hat nur gesagt, dass er kommen wird ‒ er und Helikon.«
Bei diesem Namen spürte Claudius ein solches Grauen, dass ihm der Schweiß auf die Stirn trat.
»Helikon …«, murmelte er, »das ist kein gutes Zeichen.«
Pyrallis gab nicht zu erkennen, ob sie seine Worte verstanden hatte, nahm ungezwungen zu Füßen des erhöhten Thronsitzes Platz und blickte in die Runde. Sie war kaum geschminkt, trug als einzigen Schmuck eine Gemme um den Hals mit dem Bildnis des Kaisers. Mit ihrem verschlossenen Gesicht, den nachdenklichen kieselgrauen Augen und dem etwas großen, volllippigen Mund konnte man sie kaum hübsch nennen, doch war es weniger ihr Äußeres, das Caligula an ihr schätzte, sondern vielmehr ihre Art, sich zu geben; Caligula spürte, dass sie ihn aufrichtig liebte, und Pyrallis glaubte, hinter der blutigen Maske des zynischen Henkers und Verderbers einen ängstlichen, oft hilflosen Menschen zu erkennen. Diesen aber liebte sie und nichts konnte sie darin beirren.
Hinein in das frohe Stimmengewirr schnitten die grellen, scharfen Töne der kaiserlichen Fanfarenbläser und kündigten den Auftritt des göttlichen Augustus an, der irdischen Erscheinung des Jupiter Latiaris.
Endlose Prassereien und unmäßiger Weingenuss hatten den Kaiser fett werden lassen, doch das betraf nur den schlaffen aufgetriebenen Körper. Im Gesicht war davon nichts zu bemerken. Sein schmales, nicht unschönes Antlitz wirkte bei näherer Betrachtung dennoch befremdlich durch die starren, kalten, fast blicklosen Augen, den schmalen, verpressten Mund und die krankhaft blasse Haut.
Die Gespräche verstummten, alles erhob sich, der Kaiser blickte auf gekrümmte Rücken, einige hatten sich in übertriebener Devotion auf den Boden gekniet.
Caligula nahm auf dem Thronsitz Platz und schon ertönte seine scharfe, geschulte, weithin vernehmbare Rednerstimme: »Dieses Fest habt ihr nicht meiner Eigenschaft als Imperator zu verdanken ‒ nein, Jupiter Latiaris, der uralte Gott des römischen Volkes, ist es, der euch zu Tisch lädt. Und vergesst dabei nicht: Mag der Augustus Gaius Caesar Germanicus einiges übersehen von dem, was ihr plant, denkt, ausbrütet, Jupiter blickt in eure Herzen, ihm entgeht keine Regung, er kennt euch und eure Absichten, ob gut oder böse, bis auf den Grund.«
Caligula erhob sich und reckte die geballte Faust empor.
»Mögt ihr euch auch Konsuln und Senatoren nennen, Ritter und römische Patrizier, so seid ihr doch nichts als Menschen ‒ Menschen ‒ Menschen! Ich aber bin ein Gott! Ja, ein Gott! Wer dies missachtet, hat die Folgen zu tragen!«
Sein bleiches Gesicht hatte sich gerötet, die Stimme war laut und schrill geworden.
Da wandte Pyrallis sich um und blickte ihn lächelnd an. Caligula nickte leicht und setzte sich wieder und flüsterte:
»Du hast Recht, Pyrallis, dieses Geschmeiß ist die Aufregung nicht wert. Sollen sie jetzt essen und trinken, bis sie platzen, einigen wird es gar nicht wohl bekommen …«
Hinter dem Thronstuhl stand Helikon, den Kopf vorgebeugt, als erwarte er jeden Augenblick die kaiserlichen Befehle. Der noch junge griechische Freigelassene hatte sich eine Stellung errungen, die man als des Kaisers bösen Schatten bezeichnen konnte. Er verwaltete die Todeslisten und führte ein Buch mit drei Spalten. Da gab es die »Überführten« mit einer Lebensfrist von nur wenigen Tagen, dann die »Verdächtigen«, von denen die meisten in naher Zukunft der kaiserlichen Habgier zum Opfer fallen würden, und die »Zweifelhaften«, bei denen es zu überprüfen galt, ob sich eine Anklage lohnte. Geschickte Spitzel untersuchten die Lebensumstände der »Verdächtigen« und »Zweifelhaften«, sodass es, wie einmal geschehen, nicht mehr dazu kommen konnte, dass ein wegen Hochverrats Hingerichteter sein Vermögen schon Monate zuvor an Freunde und Verwandte verschenkt hatte und sogar noch Schulden hinterließ. Damals hatte der Kaiser empört ausgerufen: »Der Kerl hat mich getäuscht! Da hätte er genauso gut am Leben bleiben können.«
Jeder im Saal wusste, wer Helikon war, und nur wenige blieben ahnungslos, als des Kaisers große starre Augen die Gäste genau musterten und er Helikon Anweisungen zuflüsterte.
Der Metzger wählt seine Schlachtlämmer aus, dachte Claudius, und ich werde nicht dazugehören. Es lag kein Triumph in dieser Überlegung, nur der eigensinnige Trotz, den kaiserlichen Henker zu überleben.
Claudius hatte sich nicht getäuscht ‒ Messalina hatte ihm tatsächlich zugelächelt, ganz kurz nur und nicht ohne leisen Spott, denn auch sie kannte, wie ganz Rom, die traurige Rolle, die des Kaisers Onkel zu spielen hatte. Allerdings hatte sie etwas wie ein hässliches, widerliches Wesen erwartet und nicht einen würdigen älteren Herrn, der sie an einen ihrer Lehrer erinnerte.
»Aber ‒ aber, das soll Claudius sein?«, flüsterte sie ihrer Mutter zu. »Der sieht doch ganz normal aus …«
Domitia lächelte. »Solange er nur dasitzt und nichts sagt, doch wenn du ihn reden hörst oder gehen siehst …«
Schon nach kurzer Zeit zog sich der Kaiser mit Claudius, Pyrallis, Helikon und einigen anderen in einen Nebenraum zurück. Laut lachend warf er sich auf eine kline.
»Während ihr euch voll gefressen habt, waren wir beide sehr fleißig, nicht wahr, mein Helikon?«
»So kann man es sagen, göttliche Majestät.«
Der Schreiber verneigte sich und über sein spitzes Gesicht huschte ein zufriedenes Grinsen. Jeder hier wusste, wovon die Rede war, doch keiner wagte ein Wort darüber zu äußern, ausgenommen Asiaticus, Senator und gewesener Konsul. Er lächelte und meinte: »Als Freunde des Kaisers sind wir vor Helikons Liste sicher, nicht wahr, denn dort stehen nur Gegner, heimliche Verschwörer, Hochverräter …«
»So ist es, mein Freund, und darauf wollen wir jetzt trinken.«
Caligula war manchmal schon nahe daran gewesen, den überaus reichen Valerius Asiaticus auf seine Todesliste zu setzen. Allein der Wert seiner Lucullischen Gärten hätte Millionen von Sesterzen ausgemacht. Doch er würde die Gespräche mit diesem furchtlosen Zyniker vermissen ‒ das Leben war auch so langweilig genug.
Dann wurde Helikon gnädig entlassen, Pyrallis sang zur Laute freche Liebeslieder und Caligula begann, maßlos zu trinken. Auch der bereits todmüde Claudius musste mithalten und nickte schließlich ein. Dem Kaiser entging es nicht, er bückte sich und zog Pyrallis die zierlichen goldbestickten Sandalen von den Füßen. Schwankend beugte er sich über den leise schnarchenden Claudius und band das Schuhwerk an dessen schlaff herabhängende Hände. Dann wandte er sich zu den anderen und flüsterte: »Jetzt rufen wir alle gemeinsam Feuer!«
Er hob die Hand und alle brüllten gehorsam »Feuer!«.
Claudius schreckte hoch, fasste sich an den Kopf und zerkratzte sich dabei die Stirn. Verwirrt starrte er auf seine Hände und streifte die Sandalen ab, während alle ‒ ausgenommen Pyrallis ‒ laut lachten.
»Wa… was ist das … habt ihr … bi… bin ich …«
Asiaticus spottete: »Aufgewacht bist du und merke dir künftig, mein Caesar, dass man in Gegenwart seiner göttlichen Majestät nicht einschlafen darf. Allerdings sind wir Menschen dabei dir gegenüber, Augustus, im Nachteil, denn Götter brauchen gewöhnlich wenig Schlaf.«
Ob es nun Spott war oder ernst gemeint, dem Kaiser schmeichelten diese Worte und er nickte gnädig.
»Valerius weiß immer, was sich gehört. Pyrallis, spiel uns noch etwas auf!«
Helikon hatte sich in sein Arbeitszimmer zurückgezogen und war wie immer, wenn er bei solchen Festen nach des Kaisers Anweisungen die Todeslisten ergänzte, danach so angeregt, dass er keinen Schlaf finden konnte. Das war ein Leben! Er spürte die Macht, wenn er auf die geduckten Köpfe schaute, die besorgten, oft angstvoll verzerrten Gesichter sah. Keiner konnte wissen, ob es ihn heute traf oder morgen oder gar nicht. Helikon machte sich einen grausamen Spaß daraus, Menschen mit düsteren Blicken zu fixieren, die nicht betroffen waren, sich dadurch jedoch betroffen glaubten. Dabei ahmte er seinen Herrn nach, denn der Kaiser liebte es, auf abendlichen Symposien gerade solche mit besonderer Huld auszuzeichnen, die am nächsten Morgen von Prätorianern aus dem Bett und vor
Gericht gezerrt wurden. Andere wieder, die er missachtete oder zornig anfuhr und die keinen as mehr für ihr Leben gaben, ließ er dafür unbehelligt.
Helikon, der nicht dumm war, genoss zwar seine bevorzugte Stellung, wusste allerdings recht gut, dass die eigentliche Macht in den Händen des dicken Callistus lag, dessen Tochter Nymphidia zudem seit etlichen Monaten zu den kaiserlichen Geliebten zählte. Callistus, mit einem phänomenalen Gedächtnis begabt, war Caligulas lebendes Archiv. Er wusste von jedem, der in Rom etwas galt, die Familien- und Besitzverhältnisse zu nennen, und was er nicht im Kopf hatte, stand in seinen Akten. Caligula, der sonst allem und jedem mit Argwohn begegnete, vertraute Callistus ‒ wenn auch nicht blind, so doch mit einem Rest von Vorsicht.
Helikon, im Grunde nur ein Henkersgehilfe, hatte die Anweisung erhalten, Callistus die Namen der »Überführten«, also der unwiderruflich zum Tod Verdammten, von Zeit zu Zeit mitzuteilen. Kürzlich hatte Callistus es durchgesetzt, auch über die »Verdächtigen« informiert zu werden. Der Kaiser war diesem Wunsch zuerst abgeneigt gewesen und in seinen kalten starren Augen leuchtete die Frage nach dem Warum.
Callistus hatte gelächelt und sein dickes Gesicht vor Biederkeit geglänzt. »Aber Majestät, bin ich nicht dein treues Gedächtnis, muss ich nicht alles wissen, was auf dem Mons Palatinus vorgeht? Wie stünde ich vor mir da, wenn ich von einem der ›Verdächtigen‹ glaubte, er sei ein ehrenwerter Bürger? Das hieße für mich, meinen Beruf schlecht auszuüben, und ein unzureichend informierter Sekretär wäre nicht würdig im Dienst deiner Göttlichkeit zu stehen.«
Dem hatte der Kaiser nichts entgegenzusetzen und so erhielt Callistus von da ab auch die Namen der »Verdächtigen«.
Noch in der Nacht machte Helikon eine Abschrift davon und ließ sie am nächsten Morgen an Callistus weiterreichen. Dieser überflog die Namen, stutzte da und dort, machte sich jedoch keinerlei Notizen. Er behielt im Kopf, wen er warnen wollte.
Warnen? Für andere den eigenen Kopf wagen? Warum? Callistus ‒ klug, berechnend und auch vorausblickend ‒ war seit längerem der festen Überzeugung, dass Caligulas mörderischem Regiment keine lange Dauer mehr beschieden war. Zu viele fühlten sich bedroht, zu viele hatten Freunde und Familienmitglieder den Weg zum Henker gehen sehen.
Der Tag, der Callistus dies drastisch vor Augen geführt hatte, lag schon einige Zeit zurück, es war im August nach dem Erntefest gewesen. Schon angetrunken hatte Caligula mit schwerer Zunge, aber doch sehr deutlich gesagt: »Ja, mein Callistus, auch ich muss ernten, um die Pracht des kaiserlichen Haushalts aufrechtzuerhalten. Das kostet, mein Lieber, das kostet …« Die starren, kalten, vom Wein etwas belebten Augen funkelten boshaft. »Du bist inzwischen reich geworden, mein Freund, sehr reich … Besitzt Häuser, Fabriken, Weinberge, Landgüter ‒ ist das auf die Dauer nicht zu viel für dich?«
Callistus hatte lähmende Angst in sich aufsteigen gefühlt, doch er beherrschte sich. »Das habe ich alles dir zu verdanken, göttliche Majestät, ich bin mir dessen durchaus bewusst. Wenn es dir hilft, dann lege ich all meinen Besitz in deine Hände zurück und diene dir weiter wie bisher. Es macht mir nichts aus, mein Herz hängt nicht daran.«
Trotz seiner Trunkenheit zeigte sich der Kaiser verblüfft. »Das würde dir tatsächlich nichts ausmachen?«
»Nein, Majestät. Ich finde Freude und Vergnügen in deinem Dienst und mein Lohn ist ausreichend. Was will ich mehr?«
Der Kaiser drohte scherzhaft mit dem Zeigefinger. »Dir gelingt es, mich immer wieder in Erstaunen zu setzen. Als irdische Erscheinung des Jupiter sind für mich die Köpfe der Menschen wie Glas. Ich kann ihre Gedanken lesen, als läge ein offenes Buch vor mir, und ich sehe, du sprichst die Wahrheit.«
Callistus kannte seinen Herrn jedoch gut genug, um zu wissen, dass seine Meinung sehr schnell Umschlagen konnte. So begann er, sich auf »die Zeit danach« vorzubereiten. Er schaffte nach und nach einen Teil seines Vermögens in entfernte Provinzen und begann Menschen, die er schätzte und auf der Liste der »Verdächtigen« fand, anonym zu warnen. Und tat es so, dass er zu gegebener Zeit überzeugend nachweisen konnte, dass er, Callistus, dieser Warner gewesen war.
Auf der Verdächtigenliste fand er eines Morgens auch den Namen des Senators Valerius Messalla Barbatus, Gatte der Domitia Lepida und Vater der gerade flügge gewordenen Messalina. Als »Verbrechen« war vermerkt: Hat einige Male unentschuldigt im Senat gefehlt. Dass Valerius krankheitshalber längst seinen Senatssitz aufgegeben hatte, spielte keine Rolle.
Als Caligula diesen Namen seinem Schreiber Helikon zuflüsterte, fügte er hinzu: »Die Kleine ist ja recht hübsch, vielleicht hole ich sie mir in mein Bett. Ich werde mir das noch überlegen, setz ihn zunächst auf die Liste der ›Verdächtigen‹.«
Valerius Messalla hatte als römischer Bürger aus alteingesessener Patrizierfamilie und als ehemaliger Senator einen makellosen Ruf. Kein schlechter Fürsprecher für »die Zeit danach«, überlegte Callistus und der Name setzte sich in seinem Kopf fest.
Kapitel 2
Der lästigen Pflichten ledig, ging Claudius an seine Arbeit zurück, doch es wollte sich keine Konzentration einstellen. Zwischen die Schriftzeilen drängte sich Messalinas reizendes Antlitz und es erwachte die durch intensive Arbeit nur verdrängte Lust auf Frauen. Zugleich musste er sich eingestehen, dass eine Vierzehnjährige für ihn nicht die geeignete Partnerin und es unsinnig sei, das junge Ding aus der Ferne anzuschmachten. Mochte er auch Caesar und damit kaiserlicher Prinz sein, so gab es vermutlich in ganz Rom keine Eltern, die ihre Tochter mit einem stotternden und humpelnden Sonderling an der Schwelle des Greisenalters verbinden wollten. Es war pure Zeitverschwendung, solche Vorstellungen weiterzuverfolgen; schließlich gab es noch andere Frauen. Die Stimme der Vernunft blieb jedoch ungehört und weiter drängte sich Messalinas Bild zwischen alle Tagesgeschäfte, störte und verhinderte jeden Ansatz zu vernünftiger Arbeit.
Schließlich gab sich Claudius einen Ruck und wollte nun jedenfalls den ersten Schritt tun, der vermutlich auch der letzte sein würde ‒ er lud Messalinas Eltern zu Tisch und bat, bei dieser Gelegenheit auch die Tochter kennen lernen zu dürfen.
Domitia Lepida zeigte sich begeistert, ihr Gemahl aber schüttelte den Kopf.
»Wozu soll das führen? Schließlich ist Claudius Caesar verheiratet, hat eine Tochter, die etwa so alt ist wie die unsere ‒ zudem ist seine Rolle am kaiserlichen Hof nicht gerade dazu angetan …« Domitia winkte ab. »Man wird doch noch einen Nachbarn besuchen dürfen, der noch dazu mit uns verwandt ist? Zudem schickt es sich nicht, die Einladung eines Mitglieds des Kaiserhauses abzulehnen.«
Valerius Messalla brummte etwas von »meinetwegen, mach, was du willst«, weil er wusste, dass seine Gemahlin ihm so lange um den Bart gegangen wäre, bis er zugestimmt hätte. Und was die Verwandtschaft betraf, so konnte nur Domitia die komplizierten Verbindungen erklären ‒ er vergaß sie immer wieder.
Für Claudius war es das erste in seinem Haus veranstaltete Symposion seit langem, sodass die Dienerschaft aufgeregt durcheinander lief, denn, um den Schein des Harmlosen zu wahren, hatte er noch einige Freunde dazugeladen ‒ auf dessen eigenen Wunsch auch Callistus, der wegen seines Einflusses als Gast stets umworben und willkommen war, allerdings von Helikons Spitzel auf Schritt und Tritt beobachtet wurde. Callistus’ gutes, fast freundschaftliches Verhältnis zu Claudius Caesar war allgemein bekannt, sodass nicht einmal Caligula Verdacht hätte schöpfen können.
Ob die Einladung einen bestimmten Grund habe, fragte Messalina ihre Eltern. Claudius habe nur erwähnt, er finde es an der Zeit, dass sich fast unmittelbare Nachbarn etwas näher kennen lernten. Natürlich läge es an ihm und seiner schwierigen Arbeit, die ihn zum Einsiedler werden ließen; nun wolle er dieser unguten Entwicklung entgegenwirken.
»Vielleicht will er mich kennen lernen? Ich gehöre ja jetzt zu den Erwachsenen, jedenfalls hat er mich auf dem Jupiter-Fest länger beobachtet.«
Domitia Lepida lachte schallend. »Das bildest du dir nur ein! Claudius Caesar hat Wichtigeres zu tun, als nach kleinen Mädchen Ausschau zu halten.«
»Er lebt von seiner Frau getrennt, und es heißt, also man sagt, dass … dass er ganz allgemein den Frauen sehr zugetan ist.«
Domitia zog ihre Tochter spaßhaft am Ohr. »Dann werde mal erst eine Frau! Dass du monatlich Blut absonderst, genügt nämlich nicht. Eine richtige Frau wirst du erst in den Armen eines Mannes.« Sie sagte es mit glänzenden Augen und blickte ihre Tochter dabei nachdenklich an.
»Ich werde es mir merken, liebe Mutter«, erwiderte Messalina und sie sagte es ganz ernst.
Beim Symposion machte Messalina einen tiefen Knicks vor dem Prinzen und als sie aufblickte, fand sie ihren damaligen Eindruck bestärkt.
Claudius besaß ein angenehmes Gesicht und wirkte aus der Nähe eher jünger. Im Gegensatz zum Kaiser, der seine beginnende Kahlheit verbergen musste, lockte sich das Haar des Prinzen, wenn auch stark mit Grau durchsetzt, um seine breite, von einigen Denkerfalten gefurchte Stirn. Seine klugen Augen blickten zerstreut und etwas ratlos, als stelle ihn diese Einladung vor schwierige Aufgaben. Ja, Claudius stotterte, das stimmte schon, im engen Freundeskreis war jedoch bestenfalls ein leichtes Stocken vor Wörtern zu bemerken, die mit Konsonanten begannen. Dabei war seine Rede flüssig, er gebrauchte seltene kunstvolle Ausdrücke und flocht manchmal griechische Wörter mit ein. Das war unter gebildeten Menschen in Rom üblich und sogar Messalina hatte dabei kaum Schwierigkeiten, da ihr Vater auf einen längeren Unterricht in Griechisch bestanden hatte. Sie nahm am Gespräch der Erwachsenen, denen sie sich noch nicht ganz zugehörig fühlte, kaum teil, verlegte sich aufs Zuhören und Beobachten.
Auch ihr Vater Valerius Messalla versuchte dies bei Callistus zu tun. Natürlich kannte er wie jeder patricius den kaiserlichen Sekretär, allerdings nicht aus nächster Nähe und im persönlichen Gespräch. Hinter der biederen Maske war eine gewisse Arroganz zu erkennen, im sicheren Bewusstsein der eigenen Bedeutung und des großen Einflusses auf den Herrn des Römischen Weltreiches. Er sprach nur mit größter Ehrerbietung vom Kaiser, lobte seine Vorzüge, seinen Weitblick, erwähnte jedoch auch eine gewisse Neigung zur Heftigkeit, zu unüberlegten Handlungen. Lächelnd hob er eine Hand.
»Wer ist schon frei davon? Im Übrigen ist der Augustus noch jung und manches wird sich mit den Jahren klären und abmildern.«
Alles in allem war es ein heiterer Nachmittag gewesen mit kultivierten Gesprächen und im gegenseitigen Wohlwollen. Messalina war schnell zu der Einsicht gelangt, dass sie, würden ihre Eltern darauf bestehen, auch mit einem Mann im Alter des Prinzen Claudius zurechtkäme. Diese Herren, dachte sie, haben gewiss mit vielen Frauen ihre Erfahrungen gemacht und die kämen dann mir zugute.
Claudius hielt sich mit seinen Absichten zurück, denn es gab noch einiges zu bedenken, ehe er seine Pläne offen legte. Auch aus der Nähe gefiel ihm Messalina überaus und er fand, dass sie älter und vernünftiger wirkte, als man es von einer kaum Fünfzehnjährigen erwarten durfte. Jedenfalls ist sie reif für eine Ehe, dachte er und beschloss, die schon länger geplante Scheidung mit Aelia Paetina in die Wege zu leiten.
Als die Gesellschaft sich nach Sonnenuntergang auflöste, bat Callistus, so dass alle es hörten, wegen der bald anstehenden zahlreichen religiösen Feste im Dezember noch um eine kurze Unterredung mit Claudius Caesar.
Dann waren sie allein und Callistus fragte leise, ob es im Hause einen Raum gebe, der nicht abhörbar sei.
»Natürlich, mein Arbeitszimmer.«
Claudius schloss die schalldichte Tür, schob den Riegel vor und prüfte die Läden des auf den Park schauenden Fensters. Callistus sagte: »Sollten wir beide danach gefragt werden: Wir haben uns ausführlich über die Gestaltung der Dezemberfeste unterhalten, also über agonium, consualia, saturnalia und andere.«
Claudius nickte und blickte den anderen mit einer Mischung aus Besorgnis und Neugierde an.
»Was ich dir jetzt sage, betrifft uns alle, hauptsächlich aber die Wohlhabenden unter uns. Im römischen Imperium ist es fast schon ein Verbrechen geworden, Besitz zu haben, und der Kaiser ist offenbar zunehmend damit beschäftigt, alle Reichen aufzuspüren, ihnen irgendwelche, manchmal geradezu lächerlichen Vergehen anzudichten, um sie in den Freitod oder dem Henker in die Arme zu treiben. Jeder von uns, und das gilt inzwischen auch für mich, zergrübelt sich den Kopf, wie die Herrschaft dieses schamlosen Massenmörders zu überleben ist, und es wird von Tag zu Tag schwieriger. Der Kaiser hat mich schon mehrmals gefragt, ob mir mein Reichtum nicht bald zur Last wird, und ich habe ihm jedes Mal geantwortet, es mache mir nichts aus, wenn ich ihm alles zurückerstatte. Aber, mein Valerius, das ist ihm zu einfach. Was glaubst du, wie viele reiche Römer ihm gerne die Hälfte oder auch zwei Drittel ihres Besitzes übereignen würden, gegen die Garantie, sie dann in Ruhe und am Leben zu lassen? Das aber will er nicht, das macht kein Vergnügen. Er weidet sich daran, uns alle zittern zu sehen, er genießt unsere besorgten Mienen, freut sich, wie wir uns abzappeln, um der Bedrohung zu entgehen. Du, mein Claudius, willst diese Schreckensherrschaft überstehen, ich will es und tausend andere auch. Was also tun?«
»Ein offenes Wort, Callistus, erschreckend und erfreulich zugleich. Erschreckend, weil du unsere Lage so erbarmungslos genau geschildert hast, und erfreulich, weil du offenbar etwas dagegen tun willst.«
»Ja, heute vor allem eines, nämlich dich zu fragen, ob du Caligulas Nachfolge antreten würdest?«
Claudius erhob sich langsam, ging leicht hinkend zum Fenster, öffnete die Läden und blickte in den Park. Behutsam schloss er sie wieder und wandte sich um.
»Nein, Callistus, mit aller Gewissheit und mit Nachdruck ‒ nein! Ich verabscheue die Macht, hasse Verantwortung, bin unfähig zu politischem Handeln. Nein, Callistus, da müsst ihr euch schon einen anderen suchen.«
»Es gibt außer dir kein Mitglied der julisch-claudischen Kaiserfamilie mehr.«
»Kein männliches! Holt Agrippina aus der Verbannung zurück, das ist eine Frau von hohem politischem Verstand, verheiratet sie mit einem fähigen Mann aus guter konsularischer Familie, der wird auch die Prätorianer und den willfährigen Senat für sich gewinnen. Ich könnte ihn zudem adoptieren, dann ist er de jure ein Claudier und die übrigens nicht vorgeschriebene Erbfolge ist geregelt. Aber mich lasst aus dem Spiel!«
Callistus blieb ruhig. »Wie lange willst du noch den kaiserlichen Narren spielen, Claudius Caesar? Wie lange willst du noch hinken, stottern und Gesichter schneiden ‒ du, einer unserer klügsten und fähigsten Männer?«
Claudius ließ sich nicht provozieren. »Das kann ich dir zurückgeben. Wie lange willst du, Callistus, als einer der fähigsten und klügsten Beamten im Römischen Reich, vor diesem tückischen Mordbuben den Rücken beugen, ihm gehorsam dienen, in allem zu Willen sein, wieder und wieder seine angemaßte Göttlichkeit bestätigen?«
Callistus lächelte fein. »Nicht mehr lange, Claudius. Genau darum geht es. Bisher sind zwei Verschwörungen jämmerlich gescheitert ‒ und warum? Weil überwiegend Idealisten daran beteiligt waren, Männer, die von den Zeiten der Republik träumten, harmlose Trottel mit Verlaub gesagt, die den Mordanschlag auf einen Tyrannen für so einfach hielten wie Nüsse zu stehlen. Diesmal aber geht es um Existenz und Leben von vielen, denn jeder Reiche ist Caligulas Feind und wird früher oder später auf die Todesliste des elenden Helikon geraten. Und weil wir schon dabei sind ‒ auch Valerius Messalla steht nun darauf, als der Verschwörung verdächtig.«
Claudius sprang entsetzt auf. »Was? Valerius der Verschwörung verdächtig? Wer hat dem Kaiser solche Hirngespinste eingegeben? Das ist doch barer Unsinn! Ich selbst kann bezeugen …«
Callistus hob die Hand. »Beruhige dich, mein Freund. Fast alle Anklagen wegen Hochverrats, Verschwörung oder Majestätsbeleidigung gründen auf solchen Hirngespinsten. Es braucht nicht viel, um in die Mühlen der kaiserlichen Justiz zu geraten. Valerius ist einige Male unentschuldigt dem Senat ferngeblieben …«
»Der Mann ist schwer krank, hat sein Amt aufgegeben und wird vermutlich nicht mehr lange leben. Wer kümmert sich da noch um Entschuldigungen?«
»Ich weiß das, doch um den Schein des Rechts zu wahren, muss ein Vorwand gefunden werden. Wenn ich dir sage, auf welche absurden Vorwürfe sich die Anklagen in letzter Zeit stützen, du würdest es nicht glauben. Genug davon. Nur noch eines: Seit einiger Zeit habe ich begonnen, an unmittelbar Bedrohte anonyme Warnungen zu senden. So ist etlichen Todeskandidaten schon die Flucht ins Ausland gelungen und gerade du wirst nichts dagegen haben, wenn ich auch Valerius Messalla eine Warnung zukommen lasse.«
»Warum betonst du es so, gerade ich?«
Über das feiste Gesicht des Callistus flog ein ironisches Grinsen. »Mir ist nicht entgangen, mit welchen Augen du die Kleine ‒ will sagen Valeria Messalina ‒ betrachtet hast. Bahnt sich da etwas an, Claudius Caesar? Bitte verzeihe die ungehörige Frage.«
»Sie ist tatsächlich ungehörig. Was veranlasst dich zu glauben, dass ich …« Er sprach nicht weiter und setzte sich wieder hin.
»Ich habe Augen im Kopf. Messalinas Eltern werden sich sehr geehrt fühlen, wenn du um das Töchterlein anhältst.«
»Noch ist es nicht so weit.«
»Gut, und zum Abschluss noch einmal: Unser Gespräch hat sich ausschließlich um die kommenden Festveranstaltungen gedreht ‒ ausschließlich!«
»Darauf hast du mein Wort! Im Übrigen freut es mich, dass wir in Bezug auf Caligula einer Meinung sind.«
»Nicht nur wir! Noch möchte ich dir keine Namen nennen, aber du würdest dich wundern. Glaube übrigens ja nicht, dass ich diese Warnungen aus purer Menschenfreundlichkeit erteile! Es ist der jedem lebenden Wesen innewohnende Selbsterhaltungstrieb ‒ du kannst es auch als Notwehr bezeichnen. Dem übereifrigen Helikon fehlt es da an der nötigen Fantasie und er wird mit Caligula untergehen.«
»Gibt es schon konkrete Pläne, auf welche Weise …?«
»Wir sind uns zumindest so weit einig, dass ein Anschlag von Prätorianer-Offizieren ausgehen muss, denn nur sie dürfen sich bewaffnet dem Kaiser nähern.«
»Aber gerade diese Leute überhäuft er doch ständig mit donativi. Da wird man keinen finden, der sich gegen ihn stellt.«
»Inzwischen schon, denn einige gibt es doch, die sich auf die Dauer nicht ihre Ehre mit Geld abkaufen lassen. Zu gegebener Zeit werde ich dich informieren.«
Kapitel 3
Messalina hatte gar nicht in Erwägung gezogen, dass Claudius Caesar um sie anhalten könnte. Ein Glied der julisch-claudischen Kaiserfamilie hatte freie Auswahl und da kam die kleine Valeria Messalina wohl nicht in Betracht, es sei denn, er maß der entfernten Verwandtschaft ein solches Gewicht bei. Aber Vettern und Basen, die auf irgendeine Weise mit den Claudiern verwandt oder verschwägert waren, gab es mehrere.
So richtete sie ihren Blick auf das Naheliegende, denn sie hatte die Worte ihrer Mutter nicht vergessen, dass man erst in den Armen eines Mannes zur Frau wird. Mochten andere Mädchen auf ihre virginitas stolz sein und sie bis zur Ehe bewahren, ihr war sie eine Last. Wie hatte ihr alter Naturkundelehrer es schmunzelnd formuliert? »Jedes Geschöpf, ob Pflanze, Tier oder Mensch, ist darauf aus, sich fortzupflanzen, seine Art zu bewahren, und deshalb haben die Götter das Liebesverlangen als einen der stärksten Triebe in uns gelegt. Freilich, wir sind verstandesbegabte Wesen und so haben unsere Dichter, wie etwa Ovidius Naso, dieses Verlangen auf eine höhere Ebene gebracht, haben eine ›Kunst der Liebe‹ daraus gemacht und sie vollmundig besungen. Letztlich läuft es jedoch immer darauf hinaus, dass das Weibchen verführt werden will und das Männchen es brav tut.« So etwa hatte der Lehrer geredet, sie war damals allerdings erst acht oder neun gewesen und hatte es kaum verstanden. Jetzt aber wusste sie was gemeint war und vor kurzem war sie durch Zufall Zeugin einer heftigen Liebesstunde geworden.
Da gab es diesen Gartensklaven Cletus, ihr Vater nannte den aus Hellas stammenden natürlich Kleitos, erworben auf dem Sklavenmarkt in Ostia. Der Bursche musste nur kräftig sein und das sah man dem stämmigen Sechzehnjährigen gleich an. Er wurde angelernt, die erforderlichen Arbeiten in Haus und Garten auszuführen, und zeigte sich recht geschickt. Körperlich wuchs er sich so aus, dass er mit achtzehn aussah wie ein junger Gott mit seinen großen, feucht schimmernden Augen, muskelbepackten Armen und Schenkeln, dazu eine breite, fast haarlose Brust, wie von einem Bildhauer gemeißelt. Freilich, seiner etwas niedrigen Stirn entsprach der kleine, eher zu einem Zehnjährigen passende Verstand. Doch wen störte das schon? Die Frauen und Mädchen des Hausgesindes verfolgten ihn mit hungrigen Blicken und als sich erwies, dass er sich gern in ihre Betten locken ließ und dort, so wurde geflüstert, Wunderdinge verrichtete, wurde er quasi zum Hahn im Korb.
Der Hausherr sah vorerst keinen Grund, dieses in seinen Augen harmlose Treiben zu stören, solange alle willig ihren Dienst taten. Als der von den Sklavinnen Vielgeliebte schon zwei Kinder gezeugt hatte, bemerkte Valerius ironisch: »Der gute Kleitos weiß offenbar nicht, dass er mich von Mal zu Mal reicher macht, denn diese Bälger gehen dem Gesetz nach in meinen Besitz über.«
So war es nun einmal, Cletus zeigte jedoch keine Neigung, den zärtlichen Vater zu spielen, war er im Grunde doch selbst noch ein unreifer Junge und Valerius war keiner jener Sklavenhalter, die aus schnöder Gewinnsucht Mutter und Kind auseinander rissen. Das hatte er schon vor Jahren bewiesen, als er auf dem Sklavenmarkt eine Küchenhilfe gesucht und die verzweifelt vor sich hin Schluchzende zusammen mit ihrer damals achtjährigen Tochter Sabina erworben hatte, obwohl der Händler die beiden getrennt hatte verkaufen wollen. Dieses Mädchen ‒ inzwischen vierzehn geworden ‒ ersetzte in der Küche ihre Mutter, die auf dem Markt beim Einkäufen durch ein wild gewordenes Pferdegespann zu Tode gekommen war.
Cletus tat nun alles, um die kleine Sabina zu gewinnen, denn sie war wohl die einzige serva im Haus, die ihn geflissentlich übersah und seinem heißen Bemühen die kalte Schulter zeigte. Doch das spornte den Gärtner nur an und entfachte seinen kindlichen Trotz, denn er war es nicht gewohnt, den Frauen nachlaufen zu müssen.
Mag zwischen Herrenhaus und Sklaventrakt auch eine räumliche wie geistige Trennung bestehen, so ließ es sich gerade in den städtischen Häusern doch kaum vermeiden, dass es kaum Geheimnisse gab, wobei die Sklaven in der Regel von der Herrschaft so gut wie alles, die Herrschaft vom Gesinde zumindest das Wichtigste wusste.
Valerius Messalla hatte seiner Tochter von Kindheit an eingebläut, in das intime Leben der Sklaven nur einzugreifen, wenn Beschwerden kamen oder ein Schiedsspruch gefällt werden musste. Im Grunde seines Herzens ein Republikaner, vertrat er die altrömischen Tugenden. Für ihn umfasste der Begriff familia alle Hausgenossen und als pater familias versuchte er seiner Aufgabe gerecht zu werden. Er gehörte auch zu jenen, die das contubernium förderten, die so genannte Sklavenehe, und gewiss nicht deshalb, um damit eine ergiebige Zuchtanstalt für weitere Sklaven einzurichten.
Messalina verfolgte mit zunehmendem Interesse das muntere Treiben des Cletus und fand auch bald heraus, wem derzeit sein Bemühen galt. Ein abwegiger Gedanke begann in ihr zu reifen. Zuerst dachte sie leichthin: Da ist Sabina wohl besser dran als ich … Sie jedenfalls muss nicht fürchten, aus Familienrücksichten mit einem bejahrten Witwer verkuppelt zu werden, der den Wein oder das Schachspiel weit höher schätzt als anstrengende Liebesstunden mit seiner jungen Frau. Warum also nicht einmal erleben, was jeder serva hier im Haus vergönnt war, nämlich in den kräftigen Armen des Cletus zu liegen, von seinen harten Schenkeln gepresst zu werden, seine glatte muskulöse Brust zu streicheln … Vielleicht hätte Messalina diesen unsinnigen Gedanken wieder begraben, wäre sie nicht Zeugin geworden, wie Cletus ‒ dem Werben um Sabina überdrüssig geworden ‒ sich anderweitig tröstete.
Der Küche stand eine aus Numidia gebürtige, olivenhäutige Frau vor, die man einfach Coqua, die Köchin, nannte, denn ihr unaussprechlicher Barbarenname war längst in Vergessenheit geraten. Sie hatte ihre Kunst niemals richtig erlernt, war jedoch schon als kleines Mädchen nicht aus der Küche wegzubringen gewesen. Dazu kam eine unerschöpfliche Fantasie, die sie häufig auf ungewöhnliche Art würzen und zubereiten ließ, und was herauskam, fand fast immer den Beifall des Hausherrn.
Coqua war auch der Liebeskunst zugetan, hatte sich aber niemals fest gebunden. Cletus gegenüber machte sie sich rar, lief ihm weder nach noch warb sie um seine Gunst. So kam es dahin, dass er, der von Frauen Verwöhnte, sich beschenkt glaubte, wenn sie ihm von Zeit zu Zeit nach ihrem Belieben zu Willen war. Das geschah dann üblicherweise in der nach Norden, halb unter der Erde gelegenen, kühlen Vorratskammer, die statt der Fenster nur eine schmale, vergitterte Luke besaß und deshalb in stetem Dämmer lag.
Messalina hatte das bald herausgefunden und als sie Cletus während der meridiatio in Richtung Küche verschwinden sah, wartete sie eine Weile ab, schlüpfte in den von der kühlen Dezemberluft etwas frostigen Garten und schlich geduckt zu jener tief gelegenen Fensterluke. Als ihre Augen sich an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, sah sie das Liebesspiel der beiden schon in vollem Gange. Coqua hatte sich, auf einem Sack Nüsse sitzend, mit gespreizten Schenkeln weit zurückgelehnt. Cletus hielt ihre schmalen Hüften umklammert und pflügte mit Hingabe ihren Schoß. Obwohl sich beide bemühten, wenig Lärm zu machen, war sein Stöhnen und ihr wie Schmerzenslaute klingendes Wimmern deutlich zu vernehmen. Cletus warf mit geschlossenen Augen den Kopf zurück, aus seinem halb geöffneten Mund kamen seltsam kehlige Laute und Coqua, hingerissen von höchster Lust, stieß einen heiseren Schrei aus, der Messalina zurückfahren ließ. Das hätte auch ein Schmerzenslaut sein können, wenn ein gepeitschter Sklave nach dem zehnten oder zwölften Hieb seine Pein hinausschrie.
Wie nahe dies beieinander liegt, Schmerz und Lust, dachte Messalina. Vorsichtig spähte sie wieder hinunter, aber da saßen die beiden nur eng umschlungen da, Cletus saugte wie ein zufriedener Säugling an Coquas Brustwarzen und sie knetete liebevoll sein kleines festes Gesäß.
Messalina spürte ihren Schoß feucht und ihren Mund trocken werden. Das war schon seltsam anzusehen, dieses Verschmelzen zweier Körper und wirkte auf sie anziehend und abstoßend zugleich. Aber die Anziehungskraft überwog, denn, von ihren Lehrern zur Logik erzogen, dachte sie, würde es den Menschen nicht so großes Vergnügen bereiten, so würden sie es eher meiden.
So kam Messalinas Plan zur Reife und Cletus sollte der Mann sein, sie von ihrer verhassten virginitas zu befreien. Nur wie? Es war nicht ungewöhnlich, dass freie erwachsene Römerinnen ‒ als Witwen oder von ihren Männern geschieden ‒ sich einen jungen wohl gebauten Sklaven zum Liebhaber erkoren. Wurde es diskret gehandhabt, fand niemand etwas dabei; doch ihr, der kaum Fünfzehnjährigen im Haus der Eltern, war diese Möglichkeit verwehrt. Sie musste täuschen und vorspiegeln und da sie es unbedingt wollte, fand sie auch einen Weg.
Dabei kam ihr zugute, dass das Fest der Saturnalia nach den Iden des Dezember kurz bevorstand. Da war, so wollte es ein alter Brauch, die Welt auf den Kopf gestellt und die Herren mussten sieben Tage lang ihre Sklaven bedienen. Ganz allgemein war es eine Zeit unbeschwerter Lustbarkeit und wem es von den Herrschaften nicht passte, den eigenen Sklaven dienstbar zu sein, der zog sich aufs Land oder in ein Bad zurück und beglich seine Schuld mit Geldgeschenken.
Valerius Messalla, den alten Bräuchen unbedingt treu, entzog sich und seine Familie diesen Pflichten nicht und Messalina nutzte die Gelegenheit, mit Sabina unter einem Vorwand allein zu sein. Sie habe, sagte sie der kleinen Sklavin, so schönes Haar und pflege es so wenig.
»Komm mit in mein Zimmer, ich werde dir die Haare so schön richten, wie ich es der famula meiner Mutter abgeschaut habe.« Sabina, über dieses Ansinnen etwas verschreckt, nickte nur schüchtern.
Zum ersten Mal betrat sie das Zimmer der Tochter des Hauses und war sogleich erstaunt, mit wie wenig Aufwand es eingerichtet war. Sie hielt ihren Dienstherrn für unermesslich reich, wusste jedoch nichts über dessen vom Geist der Republik geprägte Einstellung, da Aufwand und Luxus, zumindest bei Männern, als weibisch und unrömisch galten.
Messalina bemühte sich um ein freundliches Wesen, bot Sabina Platz an, holte Kamm und Bürste hervor, drückte ihr einen Spiegel in die Hand. Während sie sich mit wenig Geschick um die Haare der kleinen Sklavin bemühte, kam sie auf ihr Anliegen zu sprechen. Sie tat es mit einfachen Worten, von denen sie glaubte, dass Sklaven sich ihrer bedienten.
»Cletus gibt keine Ruhe, nicht wahr? Dass er dir nachstellt, ist ja kaum zu übersehen.«
Sabina nickte. »Ich will das nicht, nur was soll ich tun?«
»Kümmere dich einfach nicht drum ‒ lass ihn links liegen!«
»Der gibt so schnell nicht auf …«
»Du magst ihn nicht?«
»Der hat es mit allen Frauen, da wäre ich nur eine von vielen.«
»Unter uns gesagt ‒ meinen Eltern gefällt es auch nicht, doch sie mischen sich nicht gerne in Sklavenangelegenheiten. Sie meinen, ich soll ihn mir einmal vorknöpfen. Nachdem ich nun erwachsen bin …«
»Du?«