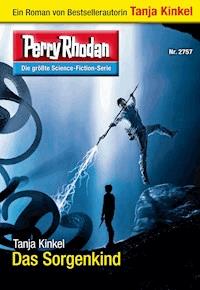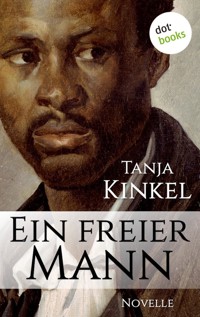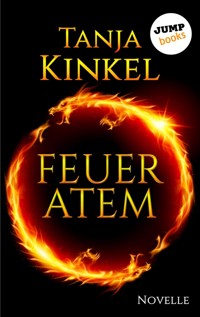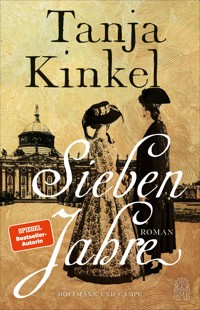6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ende des 12. Jahrhunderts beginnt ein Junge aus ärmsten Verhältnissen seinen unaufhaltsamen Aufstieg an die Spitze der Minnesänger, um den sich die Fürstenhöfe streiten – und das, obwohl Walther von der Vogelweide mit allen Konventionen bricht und dem Minnesang die Keuschheit nimmt. Was keiner seiner Gönner ahnt, die ihn als »Nachtigall« preisen: Walther dient nur einem Herren, und das ist er selbst. Geschickt sammelt er Informationen und verkauft nicht nur seine Kunst, sondern auch sein Wissen für einen hohen Preis. Dabei kreuzen seine Wege immer wieder die der gefährlich klugen Judith, einer jüdischen Ärztin, die manchmal seine Gegnerin, manchmal seine Verbündete ist – und immer entschlossen, die Welt zu verändern. Für Walther wird sie die Frau seines Lebens. Doch er ahnt nicht, dass er sich für sie auf ein höchst gefährliches Spiel einlassen muss … Das eBook enthält zusätzlich ein exklusives Bonus-Kapitel, ein Interview mit der Autorin sowie einen Hintergrundartikel!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1484
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Tanja Kinkel
Das Spiel der Nachtigall
Roman
Knaur e-books
Über dieses Buch
Er war von ihr nach allen Regeln der Kunst ausgehorcht worden, und er war nicht sicher, ob das, was er empfand, Bewunderung oder Groll war, Zorn, verletzte Eitelkeit - oder eine unsinnige Verliebtheit.
Ende des 12
Inhaltsübersicht
Dramatis Personae
Wien
Walther von der Vogelweide:Held des Romans, Minnesänger
Markwart: sein Jugendfreund
Herzog Leopold von Österreich: in seiner Ehre gekränkter Fürst
Friedrich und Leopold von Österreich: seine Söhne, nach ihm Herzöge
Helena von Ungarn: Herzogin von Österreich, mit einem Geheimnis
Mathilde: Wirtin mit unerwarteten Gästen
Reinmar: Minnesänger aus dem Elsass, Kampfgefährte des alten Herzogs
Wolfger von Passau: ehrgeiziger Bischof mit Sinn für Dichtung
Salomon: Münzmeister in Wien, Judiths Vetter
Otto von Poitou: Geisel für seinen Onkel Richard Löwenherz, Welfenerbe
Köln
Judith: Heldin des Romans, Ärztin
Stefan: ihr zum Christentum konvertierter Onkel, Weinhändler
Paul: sein Sohn
Adolf von Altena: Erzbischof von Köln mit dem Recht, Könige zu krönen
Gilles: ein Aquitanier, arbeitet für Stefan
Hagenau
Philipp von Schwaben: jüngster Sohn des Kaisers Friedrich I., genannt Barbarossa, und Bruder Kaiser Heinrichs VI.
Heinz von Kalden: Reichshofmarschall
Irene von Byzanz: Tochter des Kaisers Isaak Angelos, später Philipps Gemahlin
Beatrix:Irenes und Philipps älteste Tochter
Salerno
Salvaggia: Judiths erste Patientin
Meir ben Eleasar: Augenarzt, ist als Judiths Ehemann vorgesehen
Lucia: Judiths Magd
Francesca von Bologna: Judiths Lehrerin
Thüringen
Hermann von Thüringen: wetterwendischer und dabei sehr erfolgreicher Landgraf
Dietrich von Meißen: Markgraf, sein Schwiegersohn
Jutta: Herrmanns Tochter, Dietrichs Gemahlin
Freiburg im Breisgau
Herzog Berthold von Zähringen: der Krone würdig, aber nicht um jeden Preis
Braunschweig
Maria: Besitzerin eines Badehauses, Dirne; Judiths Patientin und spätere Freundin
Heinrich von Braunschweig: Pfalzgraf, Welfe, älterer Bruder Ottos und von diesem übervorteilt
Agnes von Hohenstaufen: Pfalzgräfin, Heinrichs Gemahlin, Philipps Base
Würzburg
Konrad von Querfurt: Bischof von Würzburg, Jugendfreund des Papstes, Philipps Kanzler
Botho von Ravensburg: Konrads Dienstmann, Heinz von Kaldens Neffe
Bamberg
Eckbert von Andechs: Fürstbischof aus der mächtigen Familie der Andechs-Meranier
Berthold von Andechs: sein jüngerer Bruder, Dompropst
Gertrud von Ungarn: ihre Schwester, Königin von Ungarn
Georg: Kreuzritter mit verhängnisvollem Wien-Aufenthalt
Sizilien
Diepold von Schweinspeunt: mächtiger deutscher Adliger
Friedrich von Sizilien: Sohn Kaiser Heinrich VI. und Konstanzes von Sizilien; Staufererbe
Brüssel
Mathilde von Brabant: stolze und ehrgeizige Gemahlin des Herzogs
Marie: ihre älteste Tochter und Erbin
PrologAufgesang
21. Dezember 1192Erdberg bei Wien
Am gleichen Tag, als Walther zum ersten Mal in seinem Leben einem Herzog und einem König begegnete, seine Fertigkeit entdeckte, wildfremde Menschen zu beeinflussen, und Gold in seinen Händen hielt, schlief er auch zum ersten Mal mit einer Frau.
Soweit er wusste, war er noch lange keine zwanzig Jahre alt, obwohl er sich für älter ausgab, um Eindruck auf die Leute zu machen. Zum Glück hatte er kein rundes Kindergesicht, sondern eines, das mit seiner Raubvogelnase, den schmalen Lippen und der hohen Stirn ohnehin ein paar Jahre reifer wirkte. In ein paar Tagen würde das Weihnachtsfest gefeiert werden, und er hatte erneut alle Hände voll zu tun, seinen besten Freund Markwart zu überreden, nicht kurz vor ihrem ersten großen Ziel einen Rückzieher zu machen, nur, weil sie die letzte Nacht in einem Stall hatten verbringen müssen. Schließlich war das nicht ihre Schuld gewesen: Ihr mühsam Erspartes hätte noch gereicht für eine warme Bank im Gasthof zum Bunten Ochsen, oder sogar für einen Strohsack in einem der Gemeinschaftszimmer. Aber dann war der angebliche Kaufmann erschienen, dem man den feinen Herrn schon von weitem an der hocherhobenen Nase ablas, und hatte kurzerhand für sich und sein Gefolge alle Zimmer verlangt, was bedeutete, dass die Wirtin die anderen Gäste in den Schankraum umquartieren musste. Für Walther und Markwart war nur noch der Stall geblieben.
»Daran kannst du erkennen, dass dir niemand den Herrn Walther abnimmt«, sagte Markwart klagend, während sie sich gegenseitig die Überröcke abklopften. Im Stall war es warm gewesen, zugestanden, aber wenn Walther damit zufrieden gewesen wäre, mit Kühen, Pferden und Ziegen zu übernachten, hätte er auch daheimbleiben können. Immerhin war er so schlau gewesen, sein Festtagsgewand im sorgfältig zugeschnürten Ranzen zu lassen; auf dem grauen Leinen, das er wie die meisten Leute an den Wochentagen trug, sah man den Dreck nicht so schnell. »Ob du nun einen angeblichen Knappen dabeihast oder nicht«, fuhr Markwart fort, »dir steht der Hungerleider auf der Stirn geschrieben.«
»Unsinn«, entgegnete Walther kurz angebunden. Markwart war schnell wehleidig; seine ständigen Beschwerden glichen Mühlrädern, klapp, klapp, klapp, immer dasselbe. Andererseits gab es fast nichts, zu dem Walther ihn nicht überreden konnte. Wenn es hart auf hart ging, hatte Markwart ihn noch nie im Stich gelassen. Lass uns unser Glück am Hof zu Wien versuchen war bei Markwart zunächst auf Einwände gestoßen, die alle mit »aber« begannen, doch etwas Geld für die Reise hatte er trotzdem zusammengebracht. Das Pferd, das sie sich teilten, kam zwar von Walthers Vater, doch das Sattelzeug von Markwart. Er hatte sogar geschluckt, dass er den Knappen spielen musste, obwohl es nicht einfach war, ihm das zu vermitteln: »Spielmänner haben keine Knappen. Wenigstens keine, die ich je gesehen habe.«
»Eben. Ich will kein Spielmann werden, sondern ein Minnesänger. Das sind Herren, die an den Höfen der Mächtigen weilen, verstehst du? Und die brauchen Knappen, damit man sie als Herren erkennt.«
»Herr Walther«, murrte Markwart jetzt, während sie den Schankraum betraten, um sich für ihre ehrlichen Pfennige wenigstens ordentlich zu sättigen. »Herr Walther vom Eselsmist, mehr glaubt man dir nicht. Und dafür haben wir Bayern verlassen! Warum kann eigentlich nicht ich Herr Markwart sein und du mein Spielmann? Schließlich habe ich, im Gegensatz zu dir, schon bei Frauen gelegen«, spielte er seinen liebsten Trumpf aus, »während du noch keine Ahnung von diesen Spielchen hast.«
Ich warte eben noch auf eine Meisterin, dachte Walther, kein Küken, das genauso neugierig ist wie ich und mir nicht zeigen kann, was ich zu tun habe, um uns beide glücklich zu machen. Ich will mich nicht blamieren wie du und hören, ich solle keine Butter mit ihren Brüsten schlagen, oder nicht in ihren Bauch beißen, wie in einen harten Apfel. Für mich muss es etwas Besonderes sein. Ich will Lippen spüren, die so zart sind, dass man sie außer mit den eignen nur mit der Zunge berühren kann, und ich will wissen, warum die eine Frau Angst vor den Männern hat, die nächste aber glänzende Augen bekommt, wenn sie an die vergangene Nacht denkt. Aber hier und jetzt war nicht die Zeit für Schwärmereien. »Weil du nicht weißt, was du tun willst, wenn sie uns erst bei Hofe aufnehmen, außer die großen Herren und ihre Damen anzustaunen. Doch was ich will, das weiß ich ganz genau«, gab Walther zurück und versuchte, den Blick der Wirtin auf sich zu ziehen. Sie war eine Witwe, die den Bunten Ochsen mit ihren Söhnen betrieb, von denen der ältere gewiss so alt wie Walther und Markwart war. Das sah man ihr allerdings kaum an: Die Grübchen in ihren runden Wangen zeigten nur, dass sie gerne lachte, und der Busen war, soweit sich das unter ihrem Hemd und dem Oberrock erkennen ließ, noch üppig und fest. An der Art, wie sie die Hände auf die Hüften stemmte, um einen Gast anzufahren, der sich immer noch auf der Bank lang gestreckt hatte, statt Platz für die anderen Gäste zu machen, die nun in den Schankraum drängten, konnte man sehen, dass auch der Rest ihrer Gestalt und ihres Wesens nicht von Traurigkeit bestimmt war.
Markwart war Walthers Blicken gefolgt und gab ihm einen Rippenstoß. »Die könnte deine Mutter sein.«
Walther grinste. »Nicht, wenn ich zweiundzwanzig bin.«
»Zweiund… Walther, gestern waren es noch neunzehn Jahre und die schon übertrieben!«
»Nun und? Zweiundzwanzig ist besser.«
»Du bist verrückt«, stellte Markwart fest. »Ich bleibe jedenfalls achtzehn Jahre.«
»Deswegen bist du ja auch mein Knappe«, sagte Walther gönnerhaft. »Die sind immer jünger als ihre Herren.«
Markwart versetzte ihm einen heftigeren Rippenstoß, gerade, als die Wirtin endlich in ihre Richtung schaute, was dazu führte, dass er sich krümmte und aufächzte, statt ihren Blick inniglich erwidern zu können. Sie wies mit dem Kinn zu dem Tisch, an dem bereits zwei Mönche saßen, und wandte sich wieder ab.
»Danke«, sagte Walther mit saurer Miene zu Markwart. Sie begaben sich zu den Mönchen, die ihrer Aussprache nach nicht aus der Gegend stammten. Stattdessen schwadronierten sie in einem Deutsch, das aus jedem zweiten s ein sch machte, darüber, ob es wohl eine größere Sünde sei, mit einer schönen oder einer hässlicheren Frau zu schlafen. Einer von beiden brachte vor, dass der größere Genuss bei einer schönen Frau auch einen höheren Grad von Sünde bedeute, während der andere ihm entgegenhielt, da eine schöne Frau einem Mann eher die Sinne raube als eine hässliche, sei er für seine Taten nicht mehr voll verantwortlich und daher auch kein so großer Sünder. Walther, der sich wünschte, die Wirtin hätte etwas länger zu ihm herübergeblickt, fragte ein wenig spöttisch: »Sprecht Ihr nicht in einem wie im anderen Fall wie ein Weinkenner, der nie einen Tropfen gekostet hat, Brüder? Denn wenn nicht, dann spielt es keine Rolle, was die größere Sünde ist, denn gesündigt hättet Ihr allemal.«
Markwart barg sein Gesicht in den Händen.
»Junger Mann«, entgegnete der eine Mönch grimmig, »ich kann dir sagen, welche Sünde du als erste zu beichten hast, wenn du das nächste Mal eine Kirche von innen siehst – mangelnde Achtung und respektlose Reden wider die Diener des Herrn!«
»Ich bin nicht derjenige an diesem Tisch, der Demut gelobt hat«, sagte Walther. Der Mönch versetzte ihm eine Kopfnuss. Das hatten die Lehrer in der Klosterschule, die ihm Lesen, Schreiben, Rechnen und ein wenig Latein beigebracht hatten, ständig getan, und es wäre den Spaß mit den zwei Mönchen wert gewesen, doch aus den Augenwinkeln erkannte Walther, dass die Wirtin wieder zu ihrem Tisch herüberblickte. Sofort setzte er sich etwas gerader und sagte so würdig wie möglich: »Sünder oder nicht? Das ist nach Eurem Gerede doch keine Frage mehr. Ihr hättet in der Beichte die Sünden vergeben, nicht aber den Sünderinnen als Buße aufgeben sollen, das Gebeichtete mit Euch gleich wieder neu zu begehen. Ich jedenfalls bin ein Mann von Stand, Mönch, und Ihr werdet mich als solchen behandeln.«
Wenn Markwart noch tiefer in sich zusammen hätte sinken können, dann wäre er von der Bank gerutscht. Walther trat ihm auf den Fuß. Schließlich war es die Aufgabe von Knappen, die Ehre ihrer Herren zu verteidigen.
Die beiden Mönche starrten ihn einen Herzschlag sprachlos an, dann bliesen sie in seltener Einmütigkeit die Backen auf und lachten. Das erzürnte Walther mehr, als er es für möglich gehalten hatte. Immerhin hatte er es in seiner neuen Rolle bis hierher geschafft, weniger als eine halbe Tagesreise vor Wien. Er war nicht mehr der Junge, der keine bessere Zukunft vor sich hatte als die, in seines Vaters Fußstapfen zu treten. Außerdem war es keine wirkliche Lüge: Sein Vater war kein einfacher Bauer, er war ein Zöllner. Das machte ihn zu einem der Ministerialen, welche mit etwas Glück – oder genügend Phantasie, neue einträgliche Zölle oder Steuern für ihren Herzog zu erfinden – häufig mit dem Ritterstand belohnt und zu einem Mann von Stand wurden. Wenn der augenblickliche Stand nicht ganz so hoch war, wie seine Worte es klingen ließen, was tat das?
Wenn du noch nicht einmal zwei Mönche und eine Wirtin überzeugen kannst, sagte eine Stimme in Walther, die verdächtig wie die Markwarts klang, dann wird dir auch der Herr Reinmar keinen Herzschlag lang Gehör schenken und dich nicht zu seinem Schüler machen, wie du dir das erhoffst. Er wird dich umgehend hinauswerfen.
»Ihr wollt Männer Gottes sein«, sagte Walther und zwang sich, so laut wie möglich zu sprechen, wie bedeutende Männer nach seiner Meinung eben sprachen, die nie Rücksicht auf andere Menschen im Raum nehmen mussten, »und geht doch nur nach dem Augenschein. Mein Knappe und ich mögen keinen eitlen Firlefanz tragen und bescheiden reisen …« In diesem Moment betrat der hochnäsige Herr, der alle Räume in Beschlag gelegt hatte, samt seines Anhangs den Schankraum. Walther holte tief Luft. »… ganz anders als dieser Kerl da!« Er deutete auf den Mann, der mit seinem feingewebten blauen Mantel eher zu reich als zu arm für einen Kaufmann wirkte. »Aber wer sagt euch allen denn, dass ihm auch nur die Kleider gehören, die er am Leibe trägt? Kennt ihr ihn besser als mich? Ihr habt keinen von uns beiden vorher je gesehen. Ich habe schon gestern bezahlt, wie es üblich ist, gleich nach meiner Ankunft, für mich und meinen Knappen. Hat er das auch getan? Ich möchte wetten, das hat er nicht. Und doch seid ihr alle ganz sicher, er wird es noch tun, nur, weil er und seine Leute in Gewändern stecken, die kein vernünftiger Kaufmann, der zu rechnen versteht, auf Reisen bei diesem Wetter tragen würde. Ein Kaufmann will er sein? Niemals.«
Eigentlich hatte er nichts gegen den Mann, es ärgerte ihn nur, dass die Wirtin und die anderen eine offensichtliche Lüge als wahr hinnahmen, wenn sie von so einem eingebildeten Kerl kam, aber nicht, wenn jemand wie er die Wahrheit nur ein ganz klein wenig zurechtbog. Deswegen überwältigte ihn das Ergebnis, das seine Worte erzielten. Im Schankraum war es ruhiger und ruhiger geworden. Dem Fremden war durch Walthers ausgestreckten Arm wohl klargeworden, dass von ihm die Rede war, aber sein Gesicht mit dem rotblonden Bart wirkte nicht erzürnt, sondern eher erstaunt. Er beugte sich zu einem seiner Begleiter, der eine Priesterkutte trug. Dieser flüsterte ihm etwas ins Ohr.
Inzwischen standen tiefe Falten auf der Stirn der Wirtin. Als der Mann im blauen Mantel sich umdrehte, um der Aufmerksamkeit der Leute in der Gaststube zu entgehen, stellte sie sich ihm rasch in den Weg. »Nichts für ungut, Herr«, sagte sie. »Aber ich habe wirklich noch kein Geld von Euch gesehen.«
Der Mann machte eine Handbewegung, die wohl bedeuten sollte, sie möge zur Seite treten, doch die Witwe blieb, wo sie war. Einer ihrer Söhne, der gerade noch frische Brotlaibe verteilt hatte, eilte an die Seite seiner Mutter.
»Gute Frau, Ihr werdet bekommen Euer Geld«, sagte der Begleiter in der Kutte mit starkem Akzent; die Wortstellung machte klar, dass die deutsche Zunge nicht die seine war. Nun begriff Walther auch, warum der Mann im blauen Mantel nicht erzürnt schien: Er sprach kein Deutsch und brauchte den Priester zum Übersetzen.
»Jetzt«, beharrte die Wirtin. »Ich will es jetzt sehen.«
Einige Männer in der Schenke erhoben sich. Es kam Walther in den Sinn, dass nun die Gelegenheit war, sich vor der Witwe als Held zu beweisen, denn der Blaubemäntelte hatte zehn Begleiter, und wenigstens fünf davon schienen Schwerter zu tragen, wenn Walther die Ausbuchtungen unter ihren Mänteln richtig deutete. Niemand sonst in der Schenke war bewaffnet. Schwerter waren etwas für Waffenknechte im Krieg, Bauern durften sie überhaupt nicht besitzen; sie waren etwas für Ritter, oder Räuber.
»Gebt unserer holden Wirtin ihr Geld, dann ist alles gut, Fremder«, sagte er begütigend, aber wie sich herausstellte, war es einfacher, mit Anklagen die Aufmerksamkeit von Menschen zu erringen, als diese mit Worten in eine ruhige Richtung zu lenken. Niemand im Schankraum achtete mehr auf ihn, alle starrten auf die Wirtin und die Fremden um den rotblonden Gast.
»Zahlen!«, rief irgendjemand, und sofort nahm der Rest im Raum das Wort auf und schrie laut: »Zahlen, zahlen!«
»Setz dich, um Himmels willen«, zischte Markwart, was in dem Rumoren zum Glück niemand außer Walther hörte. Selbst die Mönche schauten wie gebannt auf den Fremden, der schließlich die Achseln zuckte und einem seiner Begleiter zunickte. Dieser holte einen gut gefüllten Beutel unter seinem Mantel hervor. Von seinem Platz aus konnte Walther nicht erkennen, was er daraus zog, aber er sah sehr wohl, dass die Falten nicht von der Stirn der Wirtin wichen.
»Das ist nicht unser Geld«, sagte sie zu Walthers Überraschung.
»Es ist eine byzantinische Goldmünze«, gab der Priester empört zurück.
»Davon kann ich mir hier nichts kaufen«, beharrte die Wirtin. »Ich will mit ordentlichem Geld bezahlt werden.«
Einer der Mönche räusperte sich. »Mit Verlaub, uns ist das Problem nicht unvertraut. Gar mancher, der in den letzten Monaten vom Kreuzzug wiederkehrte, hat sein Geld irgendwo umtauschen müssen. In Wien gibt es …«
Leider war das der Moment, in dem der als Zechpreller verdächtigte Blaumantel die Geduld verlor und einen wütenden Strom von Worten von sich gab, die niemand im Raum außer seinen Begleitern verstand. Walthers Phantasie reichte immerhin so weit, dass er ahnte, was gesagt wurde. Auch das nun zornige Gesicht des Mannes brauchte keine Übersetzung. Und da waren immer noch die bewaffneten Begleiter.
Der Sohn der Witwe stand neben seiner Mutter und war es gewiss schon gewohnt, betrunkene Gäste hinauszuwerfen, aber was der Mönch über Kreuzfahrer gesagt hatte, klang gar nicht gut. Wenn es sich bei dem Blaumantel und seinen Leuten um Kreuzfahrer handelte, die sich aus irgendwelchen Gründen als Kaufleute ausgaben, obwohl sich jeder geehrt fühlen würde, wenn sie das Kreuz offen auf ihren Mänteln getragen hätten, dann waren sie Kämpfe mit den grausamen Heiden gewohnt und hatten mit Schankwirten und ein paar Gästen leichtes Spiel.
»Edler Herr«, rief Walter. Er kletterte eilig auf die Bank, damit ihn auch jeder sah, raffte sein Schullatein zusammen, samt all der Messlieder und Evangelientexte, an die er sich erinnerte, und radebrechte, so gut er es eben vermochte, in der Sprache der Römer: »Der Weihnachtstag naht! Friede auf Erden! Lasst uns singen und jubilieren! Schickt Boten zum Geldwechsel in die Stadt des Kaisers Augustus, die da heißt Wien, und derweilen wir warten auf die Ankunft des Boten, der kommt in Herrlichkeit, ich werde singen zur Vertreibung der Zeit und zum Lob des Herrn – und der Dame … der Herrin, bei der es war kein Platz in der Herberge!«
Für einen bedrohlich langen Moment starrten alle ihn entgeistert an. Doch dann warf der Blaumantel den Kopf zurück und brach in schallendes Gelächter aus. Walther zwang sich, ruhig zu bleiben: Gelächter war besser als Schwerter. Die Fremden fielen in das Lachen ein, als seien sie es gewohnt, ihm alles nachzumachen. Sogar die Mönche an Walthers Tisch glucksten.
Schließlich wischte sich der Mann die Lachtränen aus den Augen und sagte in einem Latein, das geschmeidig und beschwingt klang, wie es selbst der Dorfpfarrer zu Hause nie gesprochen hatte: »Wohlan, dann unterhaltet uns.«
Er winkte der Wirtin zu, offensichtlich gewohnt, dass man seinen Wünschen sofort nachkam. Nun war nicht die Zeit, ihn zu belehren, dass auch er ein Herr war. Walther kletterte vom Tisch hinunter und flüsterte Markwart ins Ohr: »Hole Hilfe, es könnte hier zum Kampf kommen.«
»Aber wen soll ich denn …?«, protestierte Markwart, während Walther sich den Weg durch den Schankraum zu dem Fremden bahnte, der inzwischen dem Mann mit dem Beutel und dem Priester, der ihre Sprache verstand, bedeutete, mit dem Geld loszuziehen, vermutlich um Münzen zu wechseln. War das alles nur ein Missverständnis gewesen? Hatte es nie eine gefährliche Situation gegeben? Nein, diese Möglichkeit wiesen Walthers Phantasie und Eitelkeit zurück. Außerdem ruhte der Blick der Wirtin auf ihm, und das gefiel ihm sehr. Als er vor ihr und dem Fremden stand, machte er eine schwungvolle Verbeugung: »Holde Herrin dieser gastlichen Stätte, wie hieß Euch Eure Mutter?«
»Auf alle Fälle nannte sie mich nicht dumm«, gab sie unbeeindruckt zurück. »Wenn es hier zu einer Schlägerei kommt, weil du dein loses Maul gewetzt hast, mein Junge, dann musst du für mehr zahlen als für eine Schlafstätte, schreib dir das ruhig hinter die Ohren, bevor du weitersprichst.«
Das fand Walther ein wenig ungerecht, zumal er gerade angefangen hatte, in der schönen Wirtin eine mögliche Lehrmeisterin für das zu sehen, was er vor seinem neuen Leben in Wien unbedingt noch kennenlernen musste. Doch er ließ sich nicht so leicht entmutigen.
»Und Ihr, werter Herr?«, fragte er auf Latein. Der rotblonde Fremde, der sich inzwischen an einem Tisch niedergelassen hatte, der von den anderen Gästen hastig frei gemacht worden war, hob eine Augenbraue. Es wurde Walther bewusst, dass seine Worte an die Wirtin, da auf Deutsch, für den anderen unverständlich geblieben waren, was die Frage zusammenhangslos machte. »Nomen?«, setzte Walther also mit einem Lächeln hinterher, das der Fremde hoffentlich als freundlich erkannte.
»Peregrinus«, gab der Mann zurück. Das war sowohl das lateinische Wort für Kreuzfahrer als auch für Fremder; wenn man ein falco dazu setzte, dann hieß es Wanderfalke. Ein Wortspiel also, keine Lüge, aber eine Wahrheit in Verkleidung; das gefiel ihm. Er machte sich daran, seine eigene zu weben.
Sich in Liedern zu verlieren, war etwas, das Walther schon als Kind begeistert hatte, doch in den letzten Jahren war der Wunsch dazu gekommen, sie zu gestalten. Nicht nur derjenige zu sein, der vortrug, sondern derjenige, der die Worte schmiedete. Er hatte sich auch schon Verse zurechtgereimt, nur wusste er, dass ihnen jenes wunderbare Ebenmaß fehlte, das so manche Weise der großen Sänger zierte, die von den Höfen bis zu den Marktplätzen der Dörfer gedrungen waren. Deswegen brauchte er einen Meister, nicht irgendeinen, sondern den berühmtesten Sänger, von dem er gehört hatte: Reinmar, der am herzoglichen Hof zu Wien weilte. Deswegen war er hier. Nur würde bescheiden sein und zu erklären, alles, was er vortragen könne, seien ein paar unfertige Reime, ihm jetzt nichts nutzen. Ganz abgesehen davon, dass Peregrinus ein deutsches Lied ohnehin nicht verstehen würde, die Wirtin jedoch von einem lateinischen unbeeindruckt bleiben würde.
Nun, zwischen Regen und Traufe stehend hatte er schon immer seine besten Ideen gehabt.
»Edler Herr«, sagte er, »damit Ihr nicht für immer ein Peregrinus bleiben müsst, sondern als Conviva heimelig werdet, gebt doch ein Carmen aus Eurer Heimat zu Ehren unserer Domina Pulchra hier zum Besten; ich will es in die Lingua Germanica übersetzen?« Walther hatte nicht viel Hoffnung, dass der andere tatsächlich ein Minnelied kannte, nicht, wenn er wirklich ein Kreuzfahrer war, und erst recht nicht, wenn es sich bei der Gruppe doch nur um Räuber handeln sollte. Doch Peregrinus überraschte ihn und lächelte geradezu erfreut.
»Poeta sum«, erklärte er. Auf diese Behauptung, er sei ein Dichter, folgte eine schweißgetränkte Stunde für Walther. Peregrinus hatte nicht nur eines, sondern mehrere Lieder auf Lager, allerdings nicht auf Latein, sondern in der Sprache der welschen Troubadoure, die Walther nicht beherrschte, so verwandt sie dem Lateinischen auch war. Also musste Peregrinus ihm erst die Verse ins Lateinische übersetzen, und dann galt es, deutsche Worte zu finden, bei denen die Musik des ursprünglichen Lieds nicht verlorenging. Sein Gehör war alles, was Walther dabei half. Die anderen Gäste und selbst ein Teil von Peregrinus’ Begleitern hatten längst das Interesse verloren, während sich Walther und Peregrinus halbfertige Sätze in drei Sprachen vorsummten, bis Walther endlich seine deutsche Fassung zum Besten geben konnte: »Dass eine Frau nicht wissen kann/Wer es ehrlich mit ihr meint,/darin liegt, so wie mir scheint,/die Schwierigkeit für jeden Mann …«Er war sich sehr bewusst, dass diese Fassung noch stark verbesserungsfähig war, doch zu froh und aufgeregt darüber, überhaupt einen Wortklang gefunden zu haben, dessen er sich nicht gänzlich schämen musste, um die Lösung zu verschweigen. Weiter kam er allerdings nicht. Das lag nicht etwa daran, dass er sein Publikum mit diesen Zeilen langweilte. Nein, es war einzig und allein die Schuld der Bewaffneten, die in einem kein Ende nehmenden Strom in den Bunten Ochsen eindrangen, mit grimmiger Miene und gezogenen Schwertern. Ihr Anführer war ein Mann, der über seinem Kettenhemd das herzogliche Wappen von Österreich trug, fünf goldene Adler auf grünem Grund. Er schaute sich um, machte Peregrinus aus und donnerte mit einer Stimme, um deren Wucht Walther ihn unwillkürlich beneidete: »Das ist er! Bei Gott, das ist er, der Hund!«
Überrascht, dass seine aus dem Stegreif erfundene Geschichte über Räuber in unangebrachten Gewändern sich am Ende doch noch als richtig herausstellen konnte, drehte sich Walther zu Peregrinus um – und fand sich von dessen Begleiter am Hals gepackt und gewürgt, während der Kerl unfreundliche Worte in der welschen Sprache ausstieß, die erneut keiner Übersetzung bedurften. Offenbar dachten Peregrinus und seine Männer, Walther sei Teil einer Falle, die man ihnen gestellt hatte. Mit einer abgeschnürten Kehle war er aber kaum in der Lage, das richtigzustellen. Bald tanzten ihm Sterne vor den Augen, ihm wurde seltsam leicht, und gleichzeitig ergriff ihn Zorn, denn es war einfach nicht gerecht, hier und jetzt zu sterben, wo noch kein einziges Lied von ihm überleben würde, da schleuderte ihn der Fremde einfach zur Seite, um sein Schwert ziehen und sich vor Peregrinus zu stellen. Walther machte unliebsame Bekanntschaft mit einer Tischkante, doch immerhin war er noch am Leben. Mit weit aufgerissenen Augen sah er, wie Peregrinus’ Mannen und die Neuankömmlinge aufeinander losgingen, ohne im Geringsten auf die anderen Menschen in der Schenke zu achten. Diese schrien entsetzt auf; wer nicht zu Boden gestoßen wurde, stürzte in Richtung Tür, doch die wurde von noch mehr Bewaffneten blockiert. Das Geschrei nahm zu. Walther blickte sich nach der Wirtin um und fand sie mit einer Daubenschale in der Hand, die sie gerade eben noch davor gerettet hatte, zwischen zwei Streitern zerschlagen zu werden. In ihr Gesicht schien das pure Entsetzen geschrieben.
»Fürchtet Euch nicht, ich werde Euch beschützen«, schrie er durch das allgemeine Gebrüll, obwohl er nicht die geringste Ahnung hatte, wie er das anstellen sollte, waffenlos und ohnehin nicht in der Lage, mit einem Schwert umzugehen.
»Du Narr«, gab sie zurück, »meine Schenke ist es, um die ich fürchte! Wer soll mir den Schaden je ersetzen?«
Wie um ihre Worte zu unterstreichen, ging eine der Bänke zu Bruch, als zwei Bewaffnete auf sie stürzten. Walther schluckte. Sie hatte recht. Ganz gleich, wer sich hier durchsetzte, für den Hausrat der Wirtin würde keiner aufkommen.
»Es tut mir …«, begann er, als Peregrinus seine Stimme erhob und offenbar seinen Anhängern in der welschen Zunge befahl, ihre Waffen niederzulegen. Dann schritt er auf den Mann mit dem herzoglichen Wappen zu und sagte formell auf Latein: »Wir stehen unter Gottes Schutz. Das wisst Ihr am besten. Was Ihr hier tut, ist Sünde.«
»Ihr habt es nötig, von Sünde zu reden«, gab der andere in einem Latein zurück, das nicht weniger geschmeidig klang, und schnaubte verächtlich. »Ehrabschneider! Ergebt Euch jetzt, dann werde ich dem Rest der Welt nicht erzählen, dass ich Euch als Küchenjunge in einer Schenke gefunden habe. Oder lasst es und schlagt Euch noch eine Weile, aber bezahlen werdet Ihr für Akkon, o ja. So ein Lösegeld hat die Welt noch nicht gesehen wie das, was ich für Euch fordern werde!«
Als die Bedeutung dessen, was der Mann da sagte, Walther klarwurde, fiel ihm das Kinn hinunter. Wenn an Ort und Stelle ein Löwe in die Schenke spaziert wäre, dann hätte ihm das nicht wundersamer erscheinen können.
Ein heftiger, kurzer Schmerz machte Walther darauf aufmerksam, dass die Wirtin ihn gerade in die Wangen gezwickt hatte. »Was sagen sie?«, flüsterte sie. »Und mach den Mund wieder zu, er hängt dir so weit offen, dass Tauben hineinfliegen könnten.«
»Frau Wirtin«, entgegnete Walter leise, »wenn ich mich nicht sehr täusche, dann habt Ihr den Herzog selbst in Eurer Schenke …«
»Aber warum sollte denn der Herzog …«
»… und den König der Engländer.«
Jetzt war es an ihr, den Mund nicht mehr schließen zu können.
Walther hatte die Geschichte gehört, natürlich hatte er sie gehört, doch nicht viel darauf gegeben. Am Anfang des Monats, gerade, als Markwart und er die Berge hinter sich gelassen hatten, da verbreiteten sich die ersten Gerüchte, dass man den König von England in Kärnten gesehen haben wollte, oder in Bruck an der Mur, wie andere erzählten, und dass der Herzog Leopold befohlen hatte, ihn gefangen zu nehmen. Der Herzog selbst war schon vor einem Jahr aus dem Heiligen Land heimgekehrt, obwohl der Kreuzzug damals noch längst nicht beendet war. Den Grund dafür erzählte man sich bald auf jedem Marktplatz: Bei der Erstürmung von Akkon hatte der Herzog seine Fahne neben die der Könige von England und Frankreich aufgestellt; Richard, den man Löwenherz nannte, hatte sie abnehmen und vom Burgturm werfen lassen. Weil es einem Herzog nicht gebühre, sich auf die gleiche Stufe mit Königen zu stellen, so hatte er gesagt – weil er den Österreichern keinen gleichen Anteil an der Beute gönnte, grollte der Herzog, der ihm deswegen ewige Rache schwor. Warum allerdings der König von England ausgerechnet über Österreich in sein Königreich zurückkehren sollte, konnte sich Walther nicht vorstellen. Er war kein Kartenzeichner, doch er war sich sicher, dass es einfachere Wege vom Heiligen Land nach England geben musste, oder auch nach Aquitanien und in die Normandie, die gleichermaßen zu Richards Reich gehörten. Deswegen hatte ihm das Gerücht vom gejagten König zwar gefallen, weil es eine spannende Geschichte war, aber geglaubt hatte er sie nicht. Bis jetzt. Bis zu dem Zeitpunkt, als Peregrinus kühl sagte: »Alles Geld der Welt wird Euch nicht helfen, wenn der Papst den Bann über Euch spricht, und das wird er, wenn Ihr Hand an einen Kreuzfahrer legt, ehe der seine Pilgerfahrt beendet hat.«
Der Herzog lachte. »Prahlt Eure Familie nicht damit, vom Teufel selbst abzustammen? Euer Vater hat einen Erzbischof vor dem Altar umbringen lassen, und Ihr, Ihr habt die Waffen gegen Euer eigenes Fleisch und Blut erhoben. Der Papst weiß, wer Ihr seid, und er weiß, was für ein guter Christ ich bin.« Nach einer kurzen Pause setzte er hinzu: »Und der Kaiser weiß, dass ich sein treuer Untertan bin. Nein, ich bin im Recht. Es gibt nichts und niemanden, den ich fürchten muss. Ergebt Ihr Euch, oder wollt Ihr noch mehr winseln?«
Die Wirtin zupfte ihn am Arm. Walther hatte es besser gefallen, in die Wange gekniffen zu werden; dabei hatte sie sich über ihn gebeugt und ihm so einen tiefen Blick auf jenen Busen gewährt, der sich wahrlich nicht unter zwei Lagen Leinen zu verstecken brauchte.
»Der Herzog will Geld«, flüsterte er, denn letztendlich lief alles, was gesagt wurde, darauf hinaus, und er glaubte nicht, dass die Wirtin über die Drohung mit dem Bann Bescheid wissen wollte. Es würde schlimm genug sein, wenn es wirklich dazu kam. Wenn der Papst den Bann über einen Fürsten aussprach, dann waren auch alle Untertanen betroffen; das bedeutete, dass das Seelenheil vieler auf dem Spiel stand. Auch sein eigenes, denn Walther hoffte, längere Zeit in Wien zu bleiben am Hof jenes Herzogs, der nur wenige Schritte von ihm entfernt stand; Walther stammte aus der Nähe von Bozen, doch deren Herr, der Herzog von Bayern, war nicht als Musenfreund berühmt, also war Wien das lohnendere Ziel für ihn. So musste er darauf setzen, dass Leopold recht behielt.
Walther beäugte den entlarvten Peregrinus. In der letzten Stunde war der Mann sehr umgänglich gewesen. Er schien eine aufrichtige Vorliebe für Dichtung und Gesang zu haben, doch eigentlich gab es wirklich keinen guten Grund, warum sich ein König in einer gewöhnlichen Schenke herumtreiben und den übrigen Gästen den Raum wegnehmen sollte, statt in Glanz und Gloria von Burg zu Burg, von Pfalz zu Pfalz zu ziehen. Könige sollten Hoffeste feiern und dabei Sänger beschenken, nicht Länder um ihre Seligkeit und Wirtsleute um ihren Hausrat bringen.
»Geld war alles, was ich wollte, und nun werde ich es bestimmt nicht mehr bekommen«, seufzte die Wirtin.
Auf einmal hatte Walther einen weiteren Einfall. »Wenn Ihr Euer Geld doch noch bekommt, gewährt Ihr mir dann einen Kuss?«
Sie musterte ihn überrascht, fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und sagte dann mit einem amüsierten Lächeln: »Nun, warum nicht.«
Inzwischen hatte sich König Richard offenbar entschlossen, das Unvermeidliche nicht länger hinauszuzögern, und übergab dem Herzog sein Schwert. Seine Begleiter ließen ihre Mienen wie die Schultern hängen, da es nicht in ihrem ritterlichen Sinne schien, die Waffen nach so kurzem Kampf bereits zu strecken. Trotzdem, binnen kurzem würden sie und die Leute des Herzogs die Schenke verlassen. Jetzt oder nie, dachte Walther, quetschte sich an zwei gerüsteten Männern vorbei und schaffte es gerade noch, sich zwischen dem Herzog und dem König auf die Knie fallen zu lassen. Seine Kehle schmerzte noch etwas von der Misshandlung, die ihr vorhin zuteilgeworden war, doch er sprach klar und deutlich auf Deutsch: »Edler Herzog, Eure treue Untertanin, die Wirtin dieser Herberge, hat ihren Lohn noch nicht erhalten, und daher bitte …«
»Welchen Lohn?«, knurrte Leopold. Aus der Nähe wirkte er sehr einschüchternd: Sein dunkler Bart war mit grauen Strähnen durchzogen, und seine Haut war dunkler, als Walther es je zuvor gesehen hatte; später erfuhr er, dass die Mutter des Herzogs aus Byzanz stammte. Die braunen Augen, deren Äderchen rot angeschwollen waren, blickten keineswegs freundlich. »Dafür, dass sie meinen gottverfluchten Feind beherbergt hat, den ich überall habe suchen lassen?«
Es war Walther, als ob heute ein Fluch auf ihm lastete: Alles, was er begann, machte die Lage nur noch schlimmer. Nein, so dachte nur Markwart. Es galt, das richtige Wort zu finden und die Gelegenheit zu nutzen, die sich ihm bot. So entstanden Lieder! Wenn ein Wort nicht passte, den falschen Klang hatte, niemandem zu Herzen ging, dann fand man eben ein anderes. Wenn die Zuhörer schlecht gestimmt waren, dann … dann lenkte man die schlechte Stimmung einfach von sich weg.
»Dafür, dass sie Euren Feind so lange hingehalten hat, bis Ihr Gerechtigkeit walten lassen konntet«, gab Walther zurück. »Herr, er wollte heute Morgen gleich aus dem Haus, da hielten diese tapfere Frau und ich ihn zurück. Jeder hier im Raum kann das bestätigen.«
Der Mann aus Richards Gefolge, der Walther vorhin an der Kehle gepackt hatte, verstand offenbar genug Deutsch, um sich sofort wutschnaubend auf Walther zu stürzen. Ein besseres Zeugnis hätte er sich gar nicht wünschen können, zumal es ihm diesmal gelang, sich rechtzeitig wegzuducken, ehe sein Angreifer von den Leuten des Herzogs gepackt und zurückgestoßen wurde.
»Es stimmt«, warf einer der anderen Gäste ein. »Die Wirtin hat nämlich das Geld für die Nacht haben wollen, und der junge Mann hier …«
»… hat sofort gespürt, dass etwas mit dem angeblichen Kaufmann nicht stimmen konnte«, setzte Walther hastig hinzu.
»Herr, wir sind benachrichtigt worden, weil ein einfacher Priester gleich fünf Münzen byzantinischen Goldes umtauschen wollte«, sagte einer der Leute des Herzogs.
»Dann seid Ihr meinem Knappen nicht begegnet?«, fragte Walther mit nur halb gespielter Enttäuschung. »Ich hatte ihn losgeschickt, um Hilfe zu holen!«
»Da war dieser Junge, der uns vom Wechsler aus den Weg gewiesen hat und etwas von Räubern plapperte«, sagte der Gefolgsmann zögernd.
»Mein treuer Diener«, strahlte Walther.
»Hmm«, machte der Herzog, kniff die Augen zusammen und musterte Walther. »Wie lautet Euer Name?«
Walther versuchte mit allen Kräften, keinen Triumph über das Ihr in der Anrede zu zeigen. »Walther von der Vogelweide, Euer Gnaden.« Vogelweiden gab es überall, wo es Herrschaften gab, die reich genug waren, um mit Falken zu jagen, und Walthers Vater hatte in der Tat auch ein kleines Zusatzeinkommen von einem Vogelweidenhof bezogen. Wenn der Herzog glauben sollte, dass die Vogelweide in diesem Namen viel größer war als in der realen Welt, nun, dann war es nicht Walthers Schuld.
»Wollt Ihr noch viel Zeit mit Eurem Spitzel verplaudern?«, fragte König Richard auf Latein. »Dann erinnert ihn doch daran, dass er mir immer noch ein Lied schuldet.« Er schenkte Walther ein sehr dünnes, spöttisches Lächeln. »Es wäre schade, wenn Ihr es nicht beendet. Ihr seid nicht ohne Talent … für einen Ränkeschmied.«
Es war eine seltsame Mischung aus Ohrfeige und Lob. Obwohl es nichts gab, das Walther diesem fremden Herrscher schuldete, der weder die Wirtin noch ihn bezahlt hatte, fühlte er sich für einen Moment doch beschämt und errötete.
»Ihr seid ein Sänger?«, fragte der Herzog auf Deutsch.
»Auf der Suche nach einem Meister«, entgegnete Walther so bescheiden wie möglich, »und daher auf dem Weg an Euren Hof, edler Herr, wo der große Reinmar so gastliche Aufnahme fand.«
»Hmm«, machte der Herzog zum zweiten Mal. »Reinmar ist ein alter Waffengefährte, der mit mir gegen die Heiden gekämpft hat. Aber Weihnachten steht vor der Tür, da können wir weitere Unterhaltung gebrauchen.« Seine Mundwinkel hoben sich. »Besonders in diesem Jahr, wo es wirklich etwas zu feiern gibt«, setzte er hinzu, absichtlich ins Lateinische fallend und mit einem höhnischen Blick auf den englischen König. »Es sei Euch also gestattet, an den Hof zu kommen. Wie Ihr Euch dort macht, nun, das werden wir ja sehen.«
Da sich mit diesen Worten einer von Walthers größten Wunschträumen erfüllte, brauchte es ein leichtes Räuspern der Wirtin, bis ihm wieder einfiel, dass er eigentlich um etwas anderes bitten sollte. »Ihr seid die Gnade selbst, edler Herr«, sagte er hastig, »und ich danke Euch aus ganzem Herzen, jedoch …«
Der Donner kehrte sehr schnell in die Stimme des Herzogs zurück. »Was denn, wollt Ihr noch mehr?«
Vielleicht wäre es das Gescheiteste gewesen, einfach den Kopf zu schütteln und sich in die nächste Ecke zu drücken, um das Gewonnene nicht sofort wieder aufs Spiel zu setzen. Doch die nächste Ecke war voller Holzsplitter von zerbrochenen Tischen, Bänken und Stühlen, und wenn Walther den Hof zu Wien betrat, dann wollte er nicht an die Wirtin denken, wie sie Schulden machen musste, um überleben zu können. Ganz zu schweigen davon, dass ihr Mund vorhin aus nächster Nähe wirklich ausgesprochen verlockend ausgesehen hatte …
»Der König von England schuldet der Wirtin hier noch seine Zeche«, sagte er also leise, aber bestimmt auf Latein, damit es auch Richard verstand, und zwang sich, dem Herzog weiter ins Auge zu schauen, statt seinen Blick auf den Boden zu richten.
Schweigen legte sich über den Schankraum, genug, um das Fußscharren der Gäste und Kämpfer zu hören, die den Atem anzuhalten schienen. Dann stieß der Herzog ein bellendes Gelächter aus. »Das sieht ihm ähnlich! Bei Gott, das sieht ihm ähnlich!«
König Richard runzelte die Stirn, aber er erteilte demjenigen seiner Begleiter, der gerne arme Sänger würgte, einen Befehl, worauf dieser seine Geldbörse zückte, eine Münze herausnahm und sie der Wirtin gab. »Es wird bei byzantinischem Gold bleiben müssen, gute Frau«, sagte der König trocken, »da ich mein Wechselgeld noch nicht erhalten habe.«
Walther übersetzte das schnell, doch weder Herzog noch König blieben, um die Antwort der Wirtin abzuwarten. Stattdessen schritten sie aus der Schenke hinaus, gefolgt von ihren Anhängern und einem Gutteil der Gäste, die nie vorher einen leibhaftigen König zu Gesicht bekommen hatten, geschweige denn einen, der als Geisel genommen wurde.
Jetzt, wo sich nur noch wenige Menschen in der Schenke befanden, konnte man den Schaden sehen, der angerichtet worden war; er war noch schlimmer als erwartet. »Ihr werdet in Wien sicher jemanden finden, der Euch die Münze wechselt«, sagte Walther.
Die Wirtin nahm die Münze und biss darauf. »Ich habe noch nie eine solche Münze in Händen gehabt«, sagte sie erstaunt, »aber es ist wohl Gold.« Ihr Gesicht veränderte sich: Die Grübchen kehrten auf ihre Wangen zurück. Sie gab die Münze Walther in der Hoffnung, von ihm eine Bestätigung zu bekommen.
»Vielleicht reicht es ja für neue Bänke?«, fragte Walther hoffnungsvoll.
Sie lachte. »Du weißt wirklich nicht viel von Geld, wie? Wenn es Gold ist, dann ist es mehr als genug, um alles in der Schenke zweimal zu kaufen. Das ist mein Glückstag!« Ohne weiteres Federlesens beugte sie sich zu ihm, um ihn auf die Wange zu küssen. Diesmal nahm Walther die Bewegung rechtzeitig genug wahr, um den Kopf so zu drehen, dass ihre Lippen stattdessen die seinen trafen. Viel Übung hatte er nicht, doch er legte all die Aufregung des Tages in diesen Kuss, die Freude, die Furcht und die Sehnsucht nach mehr. Ihr Mund war warm und schmeckte ein wenig nach Milch. Ihre Zunge indes war, nach einem Moment des Erstaunens, gelenkig wie ein Schlänglein und tat unerhörte Dinge mit der seinen; außerdem führte die Wirtin seine Hand so, dass er ihr Herz klopfen spürte.
Als sie sich von ihm löste, neigte sie den Kopf ein wenig zur Seite. »Mathilde«, sagte sie. »Mein Name ist Mathilde. Ich denke, wir beide sollten gleich mit dem Aufräumen beginnen.«
Das war nicht ganz das, was er erwartet hatte, doch er nickte benommen.
»Im Zimmer dieses Königs von England«, sagte sie bedeutsam. »Bei Gott, so werde ich es von nun an vermieten. Das Zimmer, in dem ein König geschlafen hat! Ja, lass uns dort sofort mit dem Aufräumen beginnen.«
I.Werbelied
1194–1195 Wien/Klosterneuburg
Kapitel 1
Der Schnee war frisch, eine weiße Decke, deren Glanz in den Augen brannte. Die Luft war so kalt, dass man die eigene Nasenspitze nicht mehr spürte. Doch die Sonne schien, und der Herzog hatte darauf bestanden, auszureiten. Reinmar hatte nicht oft Heimweh nach dem Elsass, doch an diesem Morgen wünschte er sich unwillkürlich in das mildere Klima seiner Heimat zurück. Andererseits konnte er Leopold verstehen: Durch das schlechte Wetter waren sie alle wochenlang in der Residenz in Klosterneuburg eingesperrt gewesen. Zeit, sehr viel Zeit, um über die eigene Verdammnis zu brüten.
Zwei Jahre war es jetzt her, dass der Herzog Richard von England gefangen genommen hatte, um seine Schmach bei Akkon zu rächen und, wie bösere Zungen meinten, das Staatssäckel gehörig aufzupolstern. Vor etwas weniger als einem Jahr war der König ausgelöst worden, für die ungeheure Summe von 100000 Mark Silber, gut 23 Tonnen, von Richards Mutter Alienor überbracht. Damit hätte alles ein gutes Ende haben sollen; zwar musste der Herzog das Geld mit Kaiser Heinrich teilen, weil der Kaiser nun einmal sein Lehnsherr war, doch selbst die Hälfte war mehr als genug gewesen, um in Friedberg und Hainburg Stadtmauern zu errichten und vor Wien eine neue Stadt zu gründen. Außerdem waren prunkvollere Feste gefeiert worden, als sie der Wiener Hof je zuvor gesehen hatte. Auch Reinmar zog wiederholt aus der großzügigen Stimmung des Herzogs seinen Nutzen und hatte allen Grund, dankbar zu sein. Woran all das Geld nichts änderte, war jedoch der Bann des Papstes, der umgehend und sofort nach Richards Gefangennahme erfolgte und immer noch nicht aufgehoben war. Und das, obwohl Leopold sich von Richard hatte versprechen lassen, dass dieser sich beim Papst für ihn einsetzen werde. Bisher hatte es dafür aber kein Anzeichen gegeben.
»Wundert Euch das wirklich?«, hatte der junge Walther gefragt, als Reinmar über die Treulosigkeit der Welt klagte. »Der Herzog kann doch nicht ernsthaft geglaubt haben, dass ihm eine Geisel für die Gefangennahme auch noch dankbar ist.«
»Eines Mannes Wort ist eines Mannes Wort«, hatte Reinmar streng entgegnet, schon, weil Walther eine lose Zunge hatte und zur Respektlosigkeit neigte, etwas, dem man begegnen musste, wenn sein Schüler es in der Welt je zu etwas bringen sollte. Doch im Geheimen musste er dem jüngeren Mann recht geben. Reinmar hatte selbst am Kreuzzug teilgenommen. Er hatte König Richard erlebt, nicht erst bei der Eroberung von Akkon. Der Mann war zu Recht wegen seines Mutes berühmt, der nicht einmal den Tod zu fürchten schien; er versteckte sich nie hinter seinen Leuten. Aber niemand hatte ihm je Milde oder Nachsicht zugeschrieben; Gnadenlosigkeit traf es schon eher. Richard gefiel der Gedanke zweifellos, dass der fromme Leopold seit Jahr und Tag weder an der Messe teilnehmen noch die Beichte ablegen durfte, dass er und alle, die ihm dienten, in den Augen der Kirche nicht besser dastanden als gottlose Ketzer. Der Herzog hatte Gesandtschaft auf Gesandtschaft nach Rom geschickt, um daran etwas zu ändern, aber ohne Erfolg. Reinmar fröstelte. Auch um seine eigene Seele stand es nicht zum Besten, wenn er mit einem Gebannten das Brot teilte, doch er hätte seinem Gönner und Waffenbruder nie deswegen den Rücken gekehrt.
»Warum schickt der Herzog nicht einen Teil des Silbers nach Rom?«, fragte Walther, als wieder ein abschlägiger Bescheid eintraf und der schlechtgelaunte Leopold deswegen umgehend unterhalten und auf neue Gedanken gebracht werden wollte. »Als Buße, versteht sich. Wer weiß, dann würde der Heilige Vater vielleicht …«
»Du wirst noch Glück haben, wenn deiner eigenen Seele die Flammen der Hölle erspart bleiben. Wenn du unbedingt Witze über den Papst reißen musst, mein Sohn, dann tue es, um dem armen Herzog die Zeit zu vertreiben, nicht, um mir meinen Seelenfrieden zu rauben.«
»Aber Herr Reinmar«, sagte der vorwitzige Kerl, »Ihr predigt mir doch tagein, tagaus, dass ein glücklicher Dichter ein schlechter Dichter sei und nur das Unglück unsere Muse zum Singen bringe. Wenn ich Euch wirklich den Seelenfrieden raube, dann solltet Ihr mir eigentlich dafür danken.« So war er, der junge Springinsfeld von der Vogelweide, statt glücklich darüber zu sein, dass ihn Reinmar als Schüler akzeptiert hatte.
Nun war es nicht so, dass es Walther an Fleiß oder Auffassungsgabe mangelte, im Gegenteil. Man brauchte ihm nicht zweimal zu erklären, was ein Werbelied war, ein Frauenlied, ein Tagelied und ein Preislied, warum Aufgesang und Abgesang nötig waren und was ein Wechsellied von einem Gesprächslied unterschied. Er übte Tag und Nacht und steckte seine lange Nase in alle Abschriften der alten Lieder, die Reinmar besaß. Das Einzige, was er so eifrig wie die Kunst des Minnesangs studierte, war zunächst jene Wirtin gewesen, von der er Reinmar in den Ohren gelegen hatte, nur um dann seine sogenannten Studien auf die Frauen bei Hofe auszudehnen. Leider war in Walther – der immer und überall schnell eine eigene Meinung anzubieten hatte – damals die Idee erwacht, dass man doch die Freuden der Liebe ebenso besingen könne wie deren Entbehrung.
»Unsinn. Das mag etwas für die Bauern sein, aber nicht für den Hof«, sagte Reinmar verächtlich. »Wenn zwei sich im Stroh wälzen, wo liegt darin die Poesie? Wo das christliche Ideal? Wir leben in harten Zeiten, Walther. Da ist es die Aufgabe des Dichters und seiner Kunst, die Gedanken auf Schöneres, Hehreres zu richten. Nicht das Leben, wie es ist, sondern das Leben, wie es sein soll. Was gibt es Edleres, als einer Dame zu dienen, ohne die Hoffnung, je wiedergeliebt zu werden? Liebe, die eigene Vorteile erwartet, ist selbstsüchtig. Die aber, die nur gibt, nie nimmt, ist das Beste, was ein christlicher Ritter empfinden kann. Daher ist sie auch der Dichtkunst einzig würdiges Thema.«
»Herr Reinmar, mit Verlaub, wann hat Euch das letzte Mal eine Frau mehr als ein Lächeln geschenkt? Ihr habt Euch schon viel zu lange in einer Burg versteckt, anstatt am wirklichen Leben teilzunehmen. Es ist hart, und es gibt nicht immer genug zu essen auf den Bauernhöfen, weil sie das meiste abliefern müssen. Aber diese Menschen leben, Reinmar, sie lieben, sie lachen und singen miteinander, sie sind da füreinander. Sie werden mit Tieren groß, die balzen und schnäbeln, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Deswegen mag es auf den Bauernhöfen alltäglich sein, im Stroh zu liegen, aber was ist falsch daran? Dort wollen es beide, er sie und sie ihn, und daraus erwächst Liebe, welche die Paare verbindet – nicht aus Verzicht!«
»Deswegen bist du jetzt auch dort und nicht hier«, hatte Reinmar spöttisch erwidert, »weil es auf dem Land so herrlich ist? Der Walther, den ich vor mir sehe und der so eifrig darum bat, bei Hof aufgenommen zu werden, das muss ein Geist sein.«
»Nein, nur ein Mann, der beides kennt und von Frauen mehr als nur angelächelt wird, im Gegensatz zu Euch.«
So ist die Jugend, dachte Reinmar, als er den Herzog auf seinem Ausritt nicht nur begleitete, um frische Luft zu schnappen, sondern auch, um seinem Schüler zu entkommen, Walther und der Allwissenheit eines jungen Mannes, der sein Leben noch vor sich hatte. Es war manchmal nicht auszuhalten, mit ihm zusammen zu sein. War Reinmar vor ein paar Jahren auch so überzeugt gewesen, alles über das Leben und die Liebe zu wissen? Vermutlich. Wenn man Menschen sterben sah, sei es auf dem Kreuzzug durch Pfeil, Lanze oder Schwert, oder an einer Krankheit, wenn die Mädchen, deren Lächeln einem einst das Herz höher hatten schlagen lassen, nach sieben Kindern und noch mehr Fehlgeburten zu alten Frauen wurden, wenn das eigene Herz ein paarmal gebrochen worden war und man nicht länger glaubte, unsterblich zu sein, erst dann verlor man diese jugendliche Selbstgerechtigkeit. Erst dann wusste man, wie kostbar ein Augenblick war. Wie viel die Berührung von Fingerspitzen bedeuten konnte. Warum ein Lied nicht einer wirklichen Frau gelten durfte, denn alles Fleisch war des Todes und zerfiel zu Staub, sondern einem Ideal, das wahrlich alterslos und unsterblich blieb. Walther würde das noch früh genug herausfinden, wenn sein braunes Haar schütter oder grau werden würde, wenn aus den Sommersprossen auf seinem Gesicht Altersflecken geworden waren. Falls er überhaupt so lange lebte, statt sich vorher um Leib und Leben zu reden. Er würde die Wahrheit von Reinmars Worten verstehen, wenn ihn die Gicht plagte und ein warmer Körper nicht mehr tat, als die Winterkälte fernzuhalten, ohne das Herz zu erwärmen. Und doch ist es gut, dass er jetzt noch nicht begreift, wie töricht er oft ist, dachte Reinmar und unterdrückte den Wunsch, selbst noch einmal so sein zu können.
Heute Abend würde er für den Herzog singen, ein gutes Lied, ein zeitloses, darüber, was es hieß, allein durch den Anblick seiner Dame glücklich zu werden. Es würde sie beide der rauhen Wirklichkeit entheben. Vielleicht würde Leopold dabei auch erkennen lassen, warum er die Herzogin seit seiner Rückkehr vom Hoftag in Gelnhausen, wo er mit dem Kaiser zusammengetroffen war, nicht mehr um sich haben wollte. Vielleicht führt das Lied dazu, die beiden wieder miteinander zu versöhnen und das Rätselraten am Hofe verstummen zu lassen. Und wenn das Kaminfeuer stark genug geschürt wurde, dann könnten sie alle zumindest die Winterkälte vergessen, für eine Weile.
Als Reinmar seinem Pferd das Knie in den Leib drückte, um seinem Herrn zu folgen, blendete ihn die Sonne für einen Moment, so dass er blinzelte. Auf diese Weise sah er nicht, was das Pferd des Herzogs zum Scheuen brachte; ein Hase mit weißem Pelz, sagten die anderen Ritter später. Für das Pferd musste es so ausgesehen haben, als würde der Schnee für einen Moment lebendig. Es wieherte erschrocken, stieg auf, und der Herzog, der im Heiligen Land mit den besten Streitern Saladins gefochten hatte, ohne sich eine ernsthafte Verwundung zuzuziehen, konnte sich nicht halten und stürzte.
Zuerst herrschte betretenes Schweigen: Dergleichen passierte dem Herzog einfach nicht. Seine Gefolgschaft wusste nicht, ob sie so tun sollte, als hätten sie nichts gesehen und nichts gehört, vor allem den Aufschrei nicht, als er auf den vereisten Boden prallte. Doch der Herzog schwang sich nicht wieder in den Sattel. Stattdessen lag er auf dem Boden. Sein rechtes Bein stand in einem unnatürlichen Winkel ab, und der Schnee unter ihm färbte sich langsam rot. Das Bein war so gebrochen, dass Knochen spitz aus der Haut hervorstachen.
Die Feiern, die am Weihnachtstag geplant gewesen waren, wurden abgesagt. Walther war damit beschäftigt gewesen, sich ein Lied auszudenken, um Reinmar zu necken, nichts Ernstes, nur etwas, das dessen ewigem Klageton etwas Abwechslung entgegensetzen würde, als er hörte, dass man den Herzog mit gebrochenem Bein in die Residenz zurückgebracht hatte.
Kein Festtagsschmaus bedeutete jedoch nicht, dass es in dieser Nacht in der Residenz still war. Um Mitternacht, als die meisten zu schlafen begonnen hatten, bestellte der Herzog Spielleute in sein Gemach, und sowohl Walther als auch Reinmar. Zuerst dachte Walther, sie seien hier, um den Herzog von seinen Schmerzen abzulenken. Dann befahl ihnen Friedrich, der mit neunzehn Jahren ältere der Herzogssöhne, so laut wie möglich zu spielen und zu singen, ohne den Wunsch nach einem bestimmten Lied zu äußern oder zu bedenken, dass zwei nicht miteinander abgestimmte Sänger nicht wohlklingender als streunende Katzen sein konnten. Man brauchte kein Ausbund an Klugheit zu sein, um zu begreifen, dass es nur darauf ankam, das Unvermeidliche zu übertönen. Da der Herzog keinen Laut von sich gab, als Walther den Raum betrat, sondern nur mit zusammengebissenen Zähnen dalag, und den Ruf hatte, im Heiligen Land bei glühender Sonne in voller Rüstung mit einem Liedchen auf den Lippen durch die Wüste gelaufen zu sein, schien das zunächst eine überflüssige Vorsichtsmaßnahme.
Dann aber sah er das Bein, das nicht verbunden war, auf die Wunde, deren Ränder voller Blasen waren, auf das Fleisch, das aussah wie das einer Ente, die man zu lange hatte hängen lassen. Und er bemerkte die gewaltige Axt, die am Bett des Herzogs lehnte.
»Die Wunde wird brandig«, flüsterte Reinmar. »Ich habe das oft genug im Heiligen Land gesehen. Das Bein wird abgenommen werden müssen, sonst ist unser Herr des Todes.«
»Seid Ihr sicher, Vater?«, fragte Friedrich. »Ich habe nach Wien geschickt. Der Medicus wird morgen hier sein.«
»Der wird mir auch nicht anders helfen können«, knurrte der Herzog zwischen zusammengebissenen Zähnen hindurch. »Ich weiß, was ich tue.«
»Aber vielleicht lässt sich das Bein doch noch retten«, protestierte Friedrichs jüngerer Bruder, der wie sein Vater den Namen Leopold trug.
Der Herzog ignorierte ihn. »Fangt schon an, zu spielen!«, brüllte er. Der Fiedler und der Trommler hoben gehorsam ihre Instrumente. Walther blickte zu Reinmar. »Ein Erntelied ist lauter«, sagte er mit gesenkter Stimme und brauchte nicht hinzuzusetzen, als eine Klage.
Reinmar gab nicht vor, keine bäuerlichen Erntelieder zu kennen. Stattdessen stimmte er den Sommergruß an, und Walther stimmte ein. Er warf alles über den Haufen, was er in den letzten zwei Jahren am Hof über Zurückhaltung gelernt hatte, und sang so laut, als gelte es, Felsen zu erweichen.
Gegen den markerschütternden Schrei, der die Wände erzittern ließ, konnten sie alle trotzdem nicht ankommen. Ein Aufbrüllen, ein einziges nur; dann fiel der Herzog in endlose Flüche, während der Heiler, der eigentlich für die Pferde zuständig war, sein Bestes tat, um die Blutung zu stillen. Walther unterdrückte die Übelkeit, während er sich zwang, weiterzusingen. Der Herzog, den er nur bei Festlichkeiten erlebte, war für ihn immer ein Wesen aus einer anderen Welt gewesen. Obwohl er ihm dankbar war, bei Hof sein zu dürfen, und durchaus der Meinung, ein Teil des englischen Silbers hätte nicht auf Stadtmauern und die Gewänder der Herzogin verteilt, sondern auch an einen jungen Sänger gegeben werden können, hatte er keine starken Gefühle für den Herzog, weder im Guten noch im Bösen. Bis jetzt. Er konnte sich nicht vorstellen, wie es sich anfühlen musste, ein Teil seines Beins zu verlieren; das allein genügte, um in ihm Mitleid und Grauen zu erregen, auch ohne den beißenden Geruch nach Blut und dem Inhalt des Darms, den der Herzog unwillkürlich von sich gegeben hatte. Kein Mensch verdiente das.
Was Ihr hier tut, ist Sünde, sagte der englische König in seiner Erinnerung, und es wurde Walther bewusst, dass es bis auf ein paar Tage genau zwei Jahre her war, dass der Herzog Hand an einen Kreuzfahrer gelegt und ihn gefangen genommen hatte. Etwas, an dem Walther sogar einen Anteil beansprucht hatte. Markwart, wäre er jetzt hier, würde ihm sicher raten, umgehend eine Kerze zu stiften und vorsichtshalber ein besseres Leben zu geloben. Doch sein Freund war nicht hier, weil er sich viel zu schnell einschüchtern ließ. Statt glücklich darüber zu sein, dass ihnen der Zufall den erhofften Eintritt zum herzoglichen Hof gewährt hatte, war Markwart bereits mit dem Schmelzen des ersten Schnees wieder in Richtung ihrer Heimat verschwunden.
»Du hast mir versprochen, die Frauen hier wären alle rollig, wie unsere Katzen zu Hause, aber ganz verschwiegen, dass vorher Kupfer und Silber in ihren Händen dafür klingeln muss«, war seine erste Beschwerde gewesen. Außerdem fühlte er sich nicht wohl unter den anderen Bediensteten, die ihn als »Handlanger eines Habenichts« hänselten und mit den angeblichen Gepflogenheiten der hohen Herren: »Die könnten einen krumm schlagen, nur weil ihnen der Magen verstimmt ist. Der Stallmeister schwört, das sei auch schon passiert.« Den größten Trumpf aber sparte er sich bis zum Schluss auf: »Zu Hause kann ich wieder als guter Christenmensch zur Messe gehen und beichten, statt bei einem Fürsten zu leben, den der Papst gebannt hat, und das solltest du auch tun.« Walther hatte schweren Herzens nicht versucht, ihn aufzuhalten, auch wenn Markwart seiner Meinung nach unrecht hatte. Der König von England war nach allem, was man hörte, beileibe keine verfolgte Unschuld gewesen; der Allmächtige hatte gewiss Besseres zu tun, als kleine Sänger zu bestrafen, nur, weil sie die Gunst der Stunde zu nutzen verstanden.
Der Herzog unterbrach seine schmerzgequälte Flucherei, um den Pferdepfleger von sich zu stoßen, so heftig, dass der Mann zu Boden fiel. »Nutzlos«, keuchte er, »nutzlos. Ich will jemanden, der mir helfen kann!«
»Vater, wir haben sofort nach dem Medicus geschickt, ich schwöre es!«
»Noch ein Schlächter hilft mir auch nicht. Bringt mir den Bischof von Passau!«
Das war eine Überraschung. Der Bischof von Passau hätte die Weihnachtsfeiertage eigentlich gar nicht mit einem Exkommunizierten verbringen dürfen und tat es laut Hoftratsch nur deswegen, weil der Herzog versuchte, aus Klosterneuburg ein neues, eigenständiges Bistum zu machen, was ihm selbst in besseren, nicht vom Papst gebannten Tagen nicht zugestanden wäre. Natürlich war jedem klar, warum er das versuchte. Bisher gehörte Wien noch in den Bereich der Erzdiözese Passau, und deren Bischof, Wolfger von Erlau, galt nicht als ein Mann, der Macht abgab. Pfarreien durfte ein Herzog durchaus vergeben, einen Bischof zu ernennen war aber seit geraumer Zeit schon allein dem Papst vorbehalten. Der Herzog hätte aber in Klosterneuburg zu gerne einen Bischof gehabt, der ihm zu Dank verpflichtet war. Seit seiner Ankunft war Wolfger ein paarmal mit dem Herzog hinter geschlossenen Türen zusammengetroffen, und jedes Mal hatte der Bischof danach den Raum mit grimmiger Miene verlassen.
»Den Bischof? Bist du …«
»Ich will ihn sehen«, brüllte der Herzog und setzte zu einer neuen Litanei von Flüchen an.
Walther ertappte sich dabei, wie er auf das knapp oberhalb des Knies abgetrennte Bein starrte, das immer noch auf dem Boden lag, auf die schwärende Wunde, auf den Fuß. Einen Moment lang glaubte er, die Zehen noch zucken zu sehen, und stockte in seinem Gesang. Reinmar war von seinem plötzlichen Verstummen überrascht genug, um ebenfalls innezuhalten, so dass nur noch die Musikanten spielten. Mit einem Mal hörten sie alle den Herzog sehr, sehr deutlich – und der hörte sich auch.
»Habe ich irgendjemandem gestattet, still zu sein? Singt, zum Teufel!«
»Mit Verlaub, Herr«, sagte Reinmar, »Lieder können beruhigend auf die Seele und den Körper wirken, wenn es Gott gefällt. Lasst mich wirklich für Euch singen.«
Das Gesicht des Herzogs wurde ein wenig weicher, doch dann schüttelte er den Kopf. »Du und ich haben zu viel Tote gesehen, als dass deine Lieder für mich lügen könnten, Reinmar. Wenn ich dich anschaue, steht dir Frau Sorge ins Gesicht geschrieben. Lass den Jungen singen, er giert noch zu sehr nach dem Leben, um nicht gut im Lügen zu sein.«