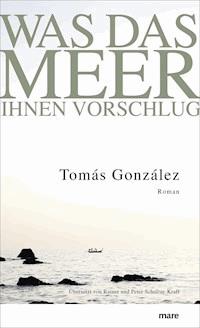9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Tomás González ist einer der aufregendsten Erzähler Kolumbiens. Seine Romane kommen scheinbar leise daher, aber sie haben einen langen Nachhall, sie nisten sich tief im Herzen ein. So auch »Das spröde Licht«. Eine Familie, drei Söhne. Jacobo, der Älteste, ist nach einem schweren Unfall vom Hals ab gelähmt. Das ist nicht das Schlimmste, das Schlimmste sind die Schmerzen, die so unerträglich werden, dass er ihnen schließlich im Freitod ein Ende setzt. In einer klaren, messerscharfen Sprache erzählt Tomás González die Geschichte einer Familie, die es vermag, den Tod in ihr Leben zu lassen, um sich umso mehr ihrer Liebe zu versichern. Ein wunderbarer Roman, der einen nicht nur Traurigkeit, sondern auch viel Zuversicht und Liebe zum Leben schenkt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 157
Ähnliche
Tomás Gonzáles
Das spröde Licht
Roman
Aus dem Spanischen von Rainer Schultze-Kraft und Peter Schultze-Kraft
Fischer e-books
Für Dora
Würden die Pforten der Wahrnehmung geputzt, erschiene den Menschen alles, wie es ist: unendlich.
William Blake (1757–1827)
Die Vermählung von Himmel und Hölle
Die Welt ist unbeständig wie ein Haus in Flammen.
Lin-Chi (810–866)
eins
In dieser Nacht lag ich lange wach. Auch Sara neben mir schlief nicht. Ich sah ihre braunen Schultern, ihren Rücken, der trotz ihrer neunundfünfzig Jahre noch schlank war, und fand Trost in ihrer Schönheit. Von Zeit zu Zeit hielten wir einander an den Händen. Keiner in der Wohnung schlief, keiner sprach. Manchmal hörte man, wie jemand hustete oder auf die Toilette ging und sich wieder hinlegte. Unsere Freunde Debrah und James waren gekommen, um uns nahe zu sein; sie lagen auf einer Matratze im Wohnzimmer. Venus, Jacobos Freundin, hatte sich in dessen Zimmer zurückgezogen. Unsere Söhne Jacobo und Pablo waren vor zwei Tagen mit einem gemieteten Kombi nach Chicago aufgebrochen und von dort nach Portland geflogen. Irgendwann war mir, als hörte ich leise Gitarrentöne aus dem Zimmer von Arturo, unserem dritten Sohn. Von der Straße drang der nächtliche Lärm der Lower East Side herauf, Schreie, zersplitternde Flaschen, so wie immer. Etwa um drei dröhnten ein paar Motorräder der Hells Angels vorbei, die ihren Treffpunkt zwei Häuserblocks von unserer Wohnung entfernt hatten. Dann schlief ich fast vier Stunden durch, ohne zu träumen, bis mich um sieben Uhr ein stechender Schmerz tief in mir weckte, es war die Angst vor dem Tod meines Sohns Jacobo, den wir für sieben Uhr abends in Portland, zehn Uhr nachts New Yorker Zeit, geplant hatten.
zwei
Ich küsste Sara, stand auf, machte Kaffee. Unwillkürlich sah ich mir das Bild an, an dem ich gerade arbeitete. Es war noch zu früh, um die Jungen anzurufen, die die Nacht in einem Motel in der Nähe des Flughafens von Portland verbringen wollten. Das Motiv meines Bildes war der Schaum, der auf dem hochsprudelnden grünen Wasser entsteht, wenn es von der Schraube des anfahrenden Fährschiffs durchgewirbelt wird. Die smaragdene Farbe des Wassers war zu fahl geraten, fand ich, zu oberflächlich, wie das gläserne Grün eines Pfefferminzbonbons. Es war mir noch nicht gelungen, ohne ein konkretes Bild zu verwenden, die abgründige Tiefe des Wassers, den Tod spürbar zu machen. Der Schaum war schön, unfassbar, chaotisch, vom Wasser gelöst und doch nicht von ihm zu trennen. Der Schaum war gut.
Mit diesem Bild hatte ich ein Jahr zuvor – im Sommer 1998 – angefangen. Damals verbrachte ich ganze Tage auf dem Fährschiff, immer zwischen Manhattan und Staten Island hin- und herpendelnd, manchmal mit einem Bier in der Hand, immer aufs Wasser schauend. Dabei freundete ich mich auch mit den Leuten an, die auf den Schiffen Musik machten und von einer Fähre zur anderen wechselten, und mit einem Louis Larrota, den ich scherzhaft Luis Bancarrota nannte, aber er verstand das Wortspiel nicht, weil er kein Spanisch oder Italienisch konnte. Louis war der letzte Schuhputzer, der auf der Fähre übrig geblieben war. Noch heute höre ich ihn auf den Gängen an Deck Shine! Shine! rufen. Er hatte immer weniger Kundschaft, weil die meisten Menschen inzwischen Sportschuhe trugen. Wenn das von Möwen durchzogene Abendrot hinter den Hafenkränen von New Jersey erlosch, kehrte ich in unsere Wohnung zurück.
Als ich Sara heiratete, waren wir beide 26. Wir lebten fünfzig Jahre zusammen, bis sie vor zwei Jahren an einer Herzkrankheit starb. Andere Frauen habe ich nicht gehabt: Alle Frauen waren sie. Es ist nicht leicht, zu erklären und zu verstehen, aber alle Frauen in meinem Leben, die nicht Sara waren und die ich haben wollte, aber nicht hatte, und auch die wenigen, mit denen ich geschlafen habe – natürlich ohne dass Sara es wusste, denn das wäre das Ende gewesen –, alle diese Frauen waren Sara. Die Male, die ich untreu war, fielen in die ersten zwei Jahre, als unsere Beziehung noch nicht gefestigt war und es noch Lücken und Kanten zwischen uns gab. Danach hatte ich nie wieder etwas mit einer anderen Frau und auch kein Verlangen nach einer anderen.
Auch auf ihrer Seite hat es Untreue gegeben, glaube ich, aber wenn es sie gab, dann erst später. Als wir schon in New York wohnten, sah ich sie einmal mit einer Arbeitskollegin in einem Café, Händchen haltend. Am Abend fragte ich sie danach, und sie stritt es weder ab, noch gab sie es zu. Sie sagte nur, Beziehungen zwischen Frauen würden für Männer immer ein Rätsel sein. Diese Antwort beruhigte mich zwar nicht, denn man kann die Hand eines anderen Menschen so oder so halten, doch mit der Zeit wuchs Gras über die Geschichte. Das zweite Mal war, als sie mit James und Debrah in Jamaika Urlaub machte. Aus irgendeinem Grund konnte oder wollte ich nicht mitfahren, und später rutschte James etwas heraus, das auf ein Abenteuer Saras mit einem jungen Einheimischen hindeutete. Auch diesmal fragte ich sie danach, aber jetzt protestierte sie, ich sei wohl verrückt, so etwas zu denken. Dennoch sagt mir bis heute etwas, dass sie damals eine Affäre hatte. Sara konnte ihre Hemmungen leicht ablegen, vor allem wenn sie ein wenig getrunken hatte. Die Sache hat mich lange gewurmt und geschmerzt, ob nun etwas dran war oder nicht, aber schließlich bin ich darüber hinweggekommen.
Eifersucht vielleicht.
Das Verlangen nach einander, das uns immer verband, ließ erst nach, als wir älter wurden. Ich habe den Unterschied zwischen Liebe und Verlangen nie richtig verstanden, und so kann ich heute sagen, dass wir uns unser ganzes Leben lang sehr geliebt haben. Ich habe mich immer gefreut, sie wiederzusehen, auch wenn wir nur für ein paar Stunden getrennt waren. Wenn ich von der Fähre heimkam, war auch sie schon von ihrer Arbeit im Krankenhaus zurück, und dann lagen wir eine Weile miteinander auf dem Bett und redeten. Ich erzählte ihr, was ich im Meer gesehen hatte, und danach kümmerte ich mich um Jacobo und seine Brüder.
drei
Nach New York kamen wir 1986. 1983 waren wir von Bogotá nach Miami gezogen, wo wir drei lange Jahre lebten, die ich nicht bereue, denn es war keine schlechte Zeit. Ich kannte Miami und die Florida Keys schon von einer früheren Reise her und wollte diese Orte jetzt als Maler erkunden. Man kann sagen, dass es die Suche nach dem Wasser und dem Licht war, die mich nach Miami zog. Sara und ich haben das Meer während dieser drei Jahre sehr genossen, obwohl wir unter der geistigen Enge litten, von der die Stadt damals geprägt war. Am Ende entschlossen wir uns, mit unseren drei Kindern nach New York zu ziehen.
In Miami malte ich eine Reihe von Landschaftsbildern in Öl, Studien des Lichts und des Wassers, insgesamt fünfzehn 2 x 2-Meter-Gemälde, die ich auf einer Ausstellung in Key West schnell und recht gut verkaufen konnte. Einige Gemälde waren abstrakte Darstellungen der Meerlandschaften, die man von der Straße aus, die die Keys verbindet, sehen kann. Andere zeigten das Meer von Miami: an den Stränden El Farito und Crandon Park und in downtown Miami. Bald nach unserer Ankunft kauften Sara und die Kinder einen kleinen, ziemlich abgetakelten Katamaran, mit dem sie an den Wochenenden am Strand entlangsegelten, im seichten Wasser, aber mit einem Vergnügen, als ginge es über den Ozean.
In Miami feierte ich meinen dreiundvierzigsten Geburtstag.
Später hörten wir von den wenigen guten Freunden, die wir dort hatten, dass sich die Stadt sehr verändert habe, sie sei jetzt weniger provinziell, es gäbe keine rednecks mehr und durch den Zuzug von Einwanderern hätte sich das ganze Milieu verbessert; sogar die neue Generation der Kubaner sei etwas weniger engstirnig und erdrückend. Selbst wenn das stimmte, wären weder Sara noch ich nach Miami zurückgekehrt. Auch die Kinder hätten nicht mehr zurückgewollt. Nach zwei Jahren in New York waren sie schon keine Kinder mehr: Jacobo war 18 und plante ein Medizinstudium an der NYU. Pablo war 16 und ging auf ein alternatives Gymnasium in der 23rd Street 8th Avenue, in dem viele Jungen Ringe in Nase und Ohren trugen. Arturo war 14 und hatte sich für die La Salle-Schule in der 2nd Street 2nd Avenue entschieden, einzig und allein deshalb, weil sie nur ein paar Schritte von unserer Wohnung – unserer zweiten Wohnung – entfernt war und er morgens länger schlafen konnte. Spät ins Bett gehen, spät aufstehen, ständig Gitarre spielen und zeichnen, das war das, was er damals am liebsten tat. Nun gut. In Miami hatten wir also drei gute Jahre, damit war es aber auch genug. Immerhin war ich produktiv gewesen. Sogar dass es in dieser Stadt keine Kultur gab, hatte sein Gutes, da ich mich so ganz in der Kapsel einschließen konnte, die meine Arbeit ist oder, besser gesagt, die meine Arbeit war, denn vor etwa anderthalb Jahren, nach meinem sechsundsiebzigsten Geburtstag, begann mein Augenlicht so sehr nachzulassen, dass ich mit dem Malen aufhören musste und – mit Hilfe einer Lupe – zu schreiben anfing.
In New York hatten wir zuerst eine sehr kleine Wohnung in der 101 West Street, einen Block vom Central Park entfernt. Die Nähe zum Park war das einzig Gute an diesem Viertel, das an ein Latino-Ghetto grenzte, mit viel Krach in der Nacht, Flaschen, die auf dem Asphalt zerbarsten, lautes Schimpfen und Fluchen auf Englisch und Spanisch, eine gärende Menschlichkeit, die mich nicht schlafen ließ, zumal ich an Miami gewöhnt war, eine Stadt, die um lauter Golfplätze herum gebaut war. An Malen war überhaupt nicht zu denken. Die ersten Monate in New York waren schlimm, weniger für Sara und die Kinder als für mich, der ich so viel Licht und Platz und Ruhe brauchte und ähnliche Arbeitsbedingungen, die man sich in diesem Alter als unverzichtbar einredet, um sich das Leben zu erschweren.
Aber in Miami wollte ich ebenso wenig sein wie in der 101 West Street, auch in Bogotá nicht und nicht in Medellín. Nirgendwo wollte ich sein. Ich verließ die Wohnung am frühen Morgen, um stundenlang im Park herumzulaufen und mir zu befehlen, mich zusammenzureißen und an die Arbeit zu gehen und Sara und den Kindern mit einem fröhlicheren Gesicht gegenüberzutreten, da sie gern in New York waren und unter meiner Niedergeschlagenheit litten. Sara, die in einem Krankenhaus eine Stelle als Betreuerin HIV-infizierter Patientinnen gefunden hatte (in Kolumbien hatte sie Soziologie studiert), erkannte, dass der Grund meiner Depression das Viertel war, in dem wir wohnten, vielleicht wegen seiner Nähe zum Ghetto. Dazu kam die Enge unserer Wohnung. Im Wohnzimmer gab es so wenig Platz, dass der Fuß der Staffelei fast Arturos Schulter berührte, wenn er sich mit seinem unvermeidlichen Nintendo auf dem Boden herumlümmelte. Und wenn alle drei Jungen da waren, barst die Wohnung vor Krach, der mich, potenziert mit dem Lärm der Straße, von der Staffelei forttrieb, hinaus in den Park, wo ich mir immerhin in Ruhe die Bäume anschauen konnte.
Ich mochte die Bäume im Central Park, obwohl sie in mir eine wehmütige Erinnerung an die in meiner Heimat wachriefen, eine Erinnerung an den Urwald von Urabá, wo einer meiner Brüder ein Landgut gehabt hatte, auf dem er den Tod fand. Die Bäume im Central Park waren auch schön, die uralten Ulmen und Eichen zum Beispiel, aber sie kamen mir fast wie Spielzeug vor im Vergleich zu der ungestutzten Üppigkeit der Ceibas und der Caracolíes in Urabá. Wenn ich nicht im Park war, fuhr ich – eine Stunde mit dem Subway – nach Coney Island, das ich bald nach unserer Ankunft entdeckt hatte und das mich wie jeden faszinierte. (Es gibt sogar ein Foto von Sigmund Freud, wie er, offenbar auch begeistert, auf dem Riegelmann Boardwalk steht.) Später, nach unserem Wohnungswechsel, begann ich mit meinen New Yorker Meerlandschaften, darunter auch die Bilder vom Meer bei Brighton Beach und Coney Island.
Eines Abends kam Sara von der Arbeit und sagte:
»Ich habe eine neue Wohnung gefunden. Unten bei der Houston Street, 2nd Street 2nd Avenue. Sie ist groß, verwahrlost und teuer. Die Fenster schauen auf einen wunderschönen Friedhof, Marble Cemetery.«
Ich fragte sie, ob die Wohnung denn hell sei, und sie sagte ja, und so gingen wir mit den Jungen hin, um sie uns anzuschauen. Gemessen an ihrer Größe kam sie mir nicht teuer vor, aber heruntergekommen war sie wirklich, genauer gesagt, verwohnt und dreckig. Doch das wäre mit einer gründlichen Reinigung, ein paar Kübeln Farbe und einer Flitspritze gegen die Kakerlaken zu ändern. Große Fenster, ausgezeichnetes Licht. Ein sehr geräumiges Wohnzimmer, in dem alles Platz hätte, die Jungen mit ihren elektronischen Anhängseln, ein Sofa, zwei Sessel und meine Staffelei.
Und das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Bloß mit den Kakerlaken wurden wir nicht fertig. Wir rückten ihnen mit Gift zu Leibe, und einige verendeten auch, aber die meisten lebten weiter, mit uns zusammen. Sie waren da, immer wenn man nachts das Licht anmachte, klein, zahlreich, schnell, in dunklen Spalten verschwindend. Wir achteten sehr auf Sauberkeit, und ich sprühte in regelmäßigen Abständen von neuem Gift, legte Boraxpulver aus, zerquetschte sie mit dem Schuh, aber ohne Erfolg: Wenn ich das Licht anmachte, waren sie alle da. Aus den alten Wohnungen kann man die Kakerlaken nicht vertreiben, sie sind unausrottbar wie das Leben. Um sie loszuwerden, müsste man das Gebäude abreißen und den Schutt mit Benzin oder Napalm übergießen und anzünden … Ich mag Pflanzen und habe einen grünen Daumen, also besorgte ich Farne und Zimmerpalmen, und schon bald sah es in unserer Wohnung wie in einem kleinen Urwald aus. In einem Zoogeschäft in der Bleecker Street kauften wir für 200 Dollar einen Papagei, den die Kinder Sparky tauften. Er wurde nie zahm, kreischte wie verrückt und flatterte in der ganzen Wohnung umher. Ein paar Jahre später bekamen wir Cristóbal, den Kater, der den Papagei eines Tages so erschreckte, dass er aus dem Fenster hinaus zum Friedhof flog. Dort saß er eine Woche lang kreischend in den Bäumen und war nicht zur Rückkehr zu bewegen, obwohl wir ihn immer wieder von den Fenstern aus riefen. Dann verschwand er.
»Er ist nach Südamerika abgehauen«, sagte ich zu den Jungen, um sie aufzumuntern, »Chontaduros essen im Chocó.«
»Chontawho?«, fragte Arturo, der die Pfirsichpalme nicht kannte und keine Gelegenheit ausließ, sich über einen lustig zu machen, selbst damals, als die Stimmung bei uns wegen Sparky gedrückt war.
In der neuen Wohnung kehrten meine Lebensgeister zurück. Ich begann, an der Küste von Brooklyn und New Jersey entlangzuwandern und sie zu fotografieren und zu malen. Ich malte ein Motorrad, das an einem Strand halb aus dem Sand ragte, über und über mit Algen bedeckt. Ich sehe gern, wie das, was der Mensch aufgegeben hat, zerfällt und allmählich menschenfremd und wieder schön wird. Ich liebe diese fließenden Übergänge. Dieses Mangrovenhafte. Ich malte eine Serie von acht Bildern, deren Motiv immer dasselbe war: die Pfeilschwanzkrebse oder horseshoe crabs, die an die Strände von Coney Island kommen, dort im Sand sterben und neben Gummisandalen und Plastikflaschen als leere Hüllen herumliegen, bevor sie bald zu Staub zerfallen, was bei den Sandalen und dem Plastik jahrhundertelang dauert. Das war, auch wenn ich es nie gesagt habe, ein sehr anspruchsvolles, weitreichendes und eigentlich unfassbares Thema: Es ging um den finsteren Abgrund der Zeit. Pfeilschwanzkrebse sind überhaupt nicht schön und haben sich über Millionen Jahre hinweg erhalten, ohne sich zu verändern, so wie das auch bei den Kakerlaken und Krokodilen sein soll. Ich habe einmal im Internet gelesen, dass die Pfeilschwanzkrebse trotz ihres Namens keine Krebse sind. Sie sind den Krustentieren zwar ähnlich, sind in Wirklichkeit aber mit den Spinnen und Skorpionen verwandt. Die ältesten fossilen Funde von Pfeilschwanzkrebsen sind 450 Millionen Jahre alt.
Die Bilder wiesen gerade den Hauch von Helligkeit auf, der nötig war, um die Kadavergestalt des armen Krebses erahnen zu lassen. Und diese Bilder fanden tatsächlich Käufer, auch wenn es lange dauerte und nicht viel einbrachte. Jahre später dann wechselten sie ihre Besitzer für unverschämt hohe Summen. In meinem Arbeitszimmer hängt noch eines, ich halte es für das beste. Es wird immer undeutlicher und dunkler, je mehr mein Augenlicht nachlässt und auch ich mich dem Zerfall nähere.
»Du bist auf dem besten Weg zum Tenebrismus. Das nächste Bild wird wohl ganz schwarz sein, oder?«, sagte Sara neckend, fügte aber schnell hinzu: »Glaub mir kein Wort! Natürlich gefallen sie mir.«
Fast zwei Jahre lang schöpfte ich aus dem Vollen. Ich erlebte ein künstlerisches Hoch, das nur von der Angst vor zu viel Glück getrübt war, denn mir ging es wie dem Wanderer, dem alle Steine am Wegesrand zu Edelsteinen werden. Wie hätte ich damals ahnen können, was auf uns zukam! Das Unglück ist wie der Wind: Es kommt immer unerwartet, ganz von allein und ohne Mühe. Damals malte ich besser und intensiver denn je und war manchmal so in die Arbeit vertieft, dass ich sogar das Rauchen und Kaffeetrinken vergaß. Ich malte das mit Algen bedeckte Motorrad, auch ein bisschen tenebristisch, aber jetzt waren Farbtöne dabei. In New Jersey fand ich auf einem verlassenen Grundstück am Meer ein verrostetes Dreirad; das malte ich ganz groß und in so viel Licht getaucht, dass es kaum zu sehen war. (Vor zwei Jahren bin ich diesem Gemälde wiederbegegnet, in einem Museum in Rom, wohin ich zu irgendeiner Ehrung eingeladen war, aber da konnte ich es nur noch aus den Augenwinkeln betrachten, denn die Krankheit war schon so weit fortgeschritten, dass alles verschwamm, wenn ich geradeaus schaute. Es gefiel mir, mein Dreirad, auch nach so vielen Jahren noch, aber manche Stellen hätte ich gern überarbeitet, weil sie mir jetzt besser gelungen wären.) Ich hatte auch angefangen, auf Coney Island die vor sich hin rostende und von violetten Prunkwinden überwucherte Thunderbolt-Achterbahn (die später abgerissen wurde) zu fotografieren. Morning glory heißt diese Winde auf Englisch. Ich wollte eine Serie großformatiger Bilder malen, mit Einzelheiten des Gerüsts und der Blüten, aus Blickwinkeln, von denen aus ich die Ordnungsprinzipien der Größe und der Perspektive, die das A und O aller Malerei sind, aus den Angeln heben wollte, um mich von dem Joch der Perspektive – entweder nach außen oder nach innen zu blicken – zu befreien. Ich spürte, dass ich dabei war, aus einem Verlies auszubrechen, und dass ich schon fast das Freie erreicht hatte, um leichter atmen zu können. Ich spannte die Leinwand für das erste Achterbahngemälde auf. Die Blüten der Prunkwinde sollten auf jeden Fall schön werden, um die Bilder auch an den Mann zu bringen. Von etwas mussten wir schließlich leben.
Dass ich mir nicht zu schade bin, die Witzeleien wiederzukäuen, die ich noch bis vor zwei Jahren gemacht habe, als Sara noch lebte. »Witzeleien, die keiner lustig findet«, hätte sie an dieser Stelle eingewendet, denn genau in dem Moment, in dem ich die Leinwand aufspannte, wurde das Taxi, in dem mein ältester Sohn saß, vom Pick-up eines betrunkenen Junkies über den Haufen gefahren, in der 6th Street, Ecke 1st Avenue, weniger als vier Straßenblocks von unserer Wohnung entfernt, und damit wurden wir, ich und Sara und alle von uns, in die tiefste aller Höllen gestoßen.