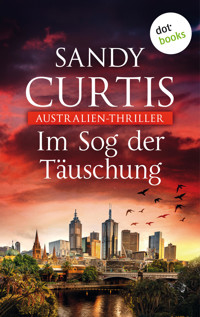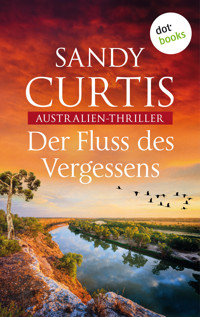Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Australian-Heat
- Sprache: Deutsch
Dunkle Geheimnisse, Action und atemlose Spannung: der Australien-Thriller »Das Tal der Angst« von Sandy Curtis jetzt als eBook bei dotbooks. Denn wer Rache sucht, kennt kein Erbarmen … Ein verheerender Sturm zieht auf über einem einsamen Tal der australischen Hochebene. Während die junge Ärztin Emma fieberhaft die letzten Vorkehrungen treffen muss, um ihr kleines Haus gegen die Naturgewalt zu wappnen, stockt ihr plötzlich der Atem: Wie aus dem Nichts taumelt ein Schwerverwundeter auf sie zu! Seine Wunden zeigen, dass er gekreuzigt wurde – aber wie konnte er dieses Martyrium überleben? Dank Emmas beherztem Eingreifen überlebt der attraktive Anwalt Drew, doch er kann sich an nichts erinnern. Und schon bald mehren sich die Anzeichen, dass ein Wahnsinniger immer noch Jagd auf ihn macht, um sein blutiges Werk zu vollenden … »Ein beeindruckender Thriller und eine gelungene Mischung aus Action, Abenteuer und Romantik!« Robinsons Book News Jetzt als eBook kaufen und genießen: der temporeiche Australien-Thriller »Das Tal der Angst« von Sandy Curtis wird Leserinnen und Leser von Karen Rose und Sandra Brown begeistern! Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Denn wer Rache sucht, kennt kein Erbarmen … Ein verheerender Sturm zieht auf über einem einsamen Tal der australischen Hochebene. Während die junge Ärztin Emma fieberhaft die letzten Vorkehrungen treffen muss, um ihr kleines Haus gegen die Naturgewalt zu wappnen, stockt ihr plötzlich der Atem: Wie aus dem Nichts taumelt ein Schwerverwundeter auf sie zu! Seine Wunden zeigen, dass er gekreuzigt wurde – aber wie konnte er dieses Martyrium überleben? Dank Emmas beherztem Eingreifen überlebt der attraktive Anwalt Drew, doch er kann sich an nichts erinnern. Und schon bald mehren sich die Anzeichen, dass ein Wahnsinniger immer noch Jagd auf ihn macht, um sein blutiges Werk zu vollenden …
»Ein beeindruckender Thriller und eine gelungene Mischung aus Action, Abenteuer und Romantik!« Robinsons Book News
Über die Autorin:
Sandy Curtis lebt an der Küste des australischen Bundesstaates Queensland. Die Mutter von drei erwachsenen Kindern hat in den verschiedensten Bereichen gearbeitet – doch seit sie als junges Mädchen ihre erste Geschichte geschrieben hat und es ihr sogar gelang, für die Recherche dazu von der örtlichen Polizei eingeladen zu werden, stand ihr Herzenswunsch fest, als Spannungsautorin erfolgreich zu werden.
Mehr Informationen über die Autorin und ihre Thriller finden sich auf ihrer Website: www.sandycurtis.com
Bei dotbooks erschienen Sandy Curtis’ Thriller der locker zusammenhängenden Spannungsserie »Australian Heat« mit den unabhängig voneinander lesenswerten Bänden »Der Fluss des Vergessens«, »Im Meer der Furcht«, »Am Abgrund der Vergeltung« und »Im Sog der Täuschung« sowie der Einzelband »Der Sturm der Rache«.
***
eBook-Neuausgabe April 2021
Die australische Originalausgabe erschien erstmals 1991 unter dem Originaltitel »Dance with the Devil«. Die deutsche Erstausgabe erschien 2003 unter dem Titel »Im Tal der Angst« bei Bastei Lübbe.
Copyright © der australischen Originalausgabe 1991 by Sandy Curtis
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2003 by Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung mehrerer Motive von shutterstock/Lev Kropotev, Nature Style, OskarWells, James M, U-Design, Jackson Stock Photography
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96655-362-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Tal der Angst« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Sandy Curtis
Das Tal der Angst
Thriller
Aus dem Englischen von Cécile G. Lecaux
dotbooks.
Kapitel 1
Stille senkte sich auf das Land herab.
Bleierne, dicke Wolken beherrschten den Himmel, nur wenige schwefelgelbe Sonnenstrahlen fanden ihren Weg zur Erde.
Die Stille war unnatürlich, beklemmend. Das Tal schien unter ihrer Last zu schrumpfen, die Berge wirkten noch mächtiger, als wollten sie das Tal erdrücken. Ein Fluss, der oben in den Bergen der Great Dividing Range entsprang, schlängelte sich in großen Windungen durch das Tal und trennte Nachbar von Nachbar, hier und da überspannt von alten Holzbrücken entlang der einzigen Zufahrtstraße.
An einer Flussbiegung stand eine kleine Ranch inmitten üppiger grüner Weiden und vereinzelter Felsen. Das Haus war im typischen Queensland-Stil erbaut, gedrungen, alt und ein wenig heruntergekommen. Die Stallungen waren früher einmal modern gewesen, wiesen jedoch inzwischen ebenfalls Spuren der Vernachlässigung auf.
Es war totenstill.
Langsam nahm Emma Randall das Plätschern von Wasser wahr. Es tropfte von den Bäumen, lief in kleinen Bächen an ihren Stämmen hinab und sammelte sich in Pfützen. Sie registrierte den durchdringenden Eukalyptusgeruch, den Myriaden zerfetzter Blätter verströmten, und den Schweiß, der zwischen ihren Schulterblättern hinabrann.
Emma wurde bewusst, dass der Körper in ihren Armen schwer geworden war. Nicht nur rein physisch. Die Last in ihren Armen war nichts verglichen mit jener in ihrem Herzen.
Seine Stirn fühlte sich rau an unter ihren Fingerspitzen, als sie ihm Haarsträhnen aus dem wettergegerbten Gesicht strich. Seine Wimpern waren hell, von der Sonne gebleicht. Sie berührte sie sanft. Weich wie Federn. Komisch, sie hatte erwartet, sie seien hart. Hart und spröde wie er selbst es gewesen war.
Noch nie hatte er so friedlich ausgesehen. Sogar im Schlaf war der grimmige, dickköpfige Ausdruck nur selten von seinen Zügen gewichen. Aber jetzt, im Tod, war der immerwährende Zorn von ihm abgefallen.
Sie wünschte, sie könnte weinen. Hatte sie so viele Tote gesehen, dass sie das Weinen verlernt hatte? Alles was sie spürte war ein erdrückendes Gefühl des Versagens. Ansonsten nur Taubheit.
Eine Bewegung weit draußen auf einer der Weiden erregte ihre Aufmerksamkeit. Eine humpelnde Gestalt, die mehrmals stürzte, sich jedoch immer wieder aufrappelte und langsam auf den Stall zuwankte, neben dem sie selbst kniete. Sie ließ den Leichnam zu Boden gleiten; der Instinkt, die Toten sich selbst zu überlassen, um den Lebenden zu helfen, gewann sofort überhand.
Schlamm spritzte auf, und sie glitt mehrmals beim Laufen auf dem nassen Gras aus. Sie machte einen Bogen um einen umgestürzten Eukalyptusbaum, dessen skelettartige Wurzeln wie Klauen nach den tiefhängenden Wolken zu greifen schienen. Der Sturm hatte ein Stück Wellblech vom Dach geweht, das sich tief in die weiche Erde gebohrt hatte. Wie ein abstraktes Kunstwerk ragte es aus dem Gras. Einige Sekunden lang verdeckte es ihr die Sicht, dann lief sie noch schneller.
Die Gestalt war erneut gestürzt, und diesmal stand sie nicht wieder auf. Sie kniete sich neben den schlanken, nur mit Shorts bekleideten Körper und streckte die Hände aus, um ihn auf Verletzungen hin zu untersuchen, hielt jedoch abrupt inne.
Ein Geflecht blutiger Striemen bedeckte seinen Rücken. Es war kein vom Zufall bestimmtes Muster, wie es durch die Naturgewalten entstanden wäre, sondern stammte eindeutig von Menschenhand.
»Man hat Sie ausgepeitscht«, flüsterte sie verblüfft.
Der Mann stöhnte und versuchte aufzustehen, fluchte jedoch gleich darauf vor Schmerzen und ließ sich ins Gras zurückfallen. Emma wischte ihm den Schmutz von den Händen. Nur ein scharfes Einatmen verriet ihre Reaktion auf das, was sie unter der Erdkruste sah. Hastig inspizierte sie den Rest seines Körpers und erstarrte, als sie zu den Füßen kam.
Sie hatte eigentlich geglaubt, dass sie nichts mehr erschüttern könnte. Das war ein Irrtum gewesen.
Der Fremde hatte in der Mitte beider Handflächen und beider Fußrücken blutende kreisrunde Wunden. Emma hatte solche Verletzungen schon einmal gesehen, in einem Land, in dem religiöse Kriege das Volk terrorisiert und vernichtet hatten.
Der Mann drehte sich um, und seine Züge verzerrten sich vor Schmerz, als sein Rücken das Gras berührte. Durchdringende blaue Augen richteten sich auf ihr Gesicht. Dann wurden sie glasig, und seine mit dunklen Stoppeln bedeckten Wangen fielen ein.
»Ich bin Ärztin«, sagte Emma beruhigend.
Überraschung spiegelte sich auf seinen Zügen. Er rollte sich auf die Seite und versuchte erneut, auf die Beine zu kommen. Emma stützte ihn, so gut es ging. Sein Kopf baumelte kraftlos herab und fiel gegen sie, als sie losging. Sie sah seinen Augen an, dass er am Ende seiner Kräfte war, und rechnete damit, dass er wieder hinfallen würde, aber stattdessen schüttelte er entschieden den Kopf und richtete sich auf. Er biss die Zähne zusammen und humpelte weiter. Sie konnte sich vorstellen, wie schmerzhaft das Gehen für ihn sein musste. Die Nägel, die durch seine Füße geschlagen worden waren, hatten vermutlich mindestens je einen der 26 Knochen gebrochen.
Emma schaute in Richtung Stall und verspürte einen Stich im Herzen, als ihr Blick auf die leblose Gestalt fiel, die dort im Schlamm lag. Sie zögerte kurz, dann konzentrierte sie sich wieder auf den Verletzten an ihrer Seite. Er war sehr schlank, aber drahtig, mit kräftigem Knochenbau und einen Kopf größer als sie.
Zweimal verließen ihn die Kräfte, die Beine knickten unter ihm weg, und er hätte sie beinahe mit zu Boden gerissen. Aber sie packte seine Handgelenke, zog seine Arme fester um ihre Schultern und half ihm wieder hoch. Er knirschte mit den Zähnen vor Schmerzen, aber in seinen Augen flackerte fieberhafte Entschlossenheit. Er keuchte, seine Atemzüge klangen in der Stille nach dem Sturm unnatürlich laut.
Emma beschleunigte den Schritt und schleifte ihn fast die zwei Verandastufen hinauf.
Mit dem Fuß trat sie die Tür zum vorderen Zimmer auf, in dem sie sich ein kleines Behandlungszimmer eingerichtet hatte, und half dem Fremden, sich bäuchlings auf den Operationstisch zu legen. In der Sekunde, als sein Kopf das Kissen berührte, versank er in tiefer Bewusstlosigkeit.
Emma wusch ihren Patienten zügig, zog ihm die durchnässten Shorts aus und untersuchte ihn dann gründlicher. Die Striemen an seinem Rücken waren zwar stellenweise recht tief, mussten aber nicht genäht werden. Sie desinfizierte die Wunden und klebte einen großen Verband über den ganzen Rücken. Ihn umzudrehen erwies sich als schwierig, aber sie hatte schon Schlimmeres erlebt, und das vergangene Jahr auf der Ranch hatte ihre Muskeln gestählt.
Seine Haut war erstaunlich warm. Ihre Hände bewegten sich geschickt über Brust, Bauch und Unterleib.
Er schien keine inneren Verletzungen zu haben. Sein Blutdruck war ebenfalls in Ordnung, der Puls kräftig. An Handgelenken und Knöcheln stellte sie massive Hautabschürfungen fest. Emma hatte solche Verletzungen schon früher gesehen und schauderte.
Sie nutzte seine Bewusstlosigkeit, um die Wunden an seinen Händen und Füßen zu säubern und zu versorgen. Er stöhnte mehrmals, jedoch ohne das Bewusstsein wiederzuerlangen. Dann gab sie ihm eine Pethidin- und eine Tetanus-Spritze.
Der Wind frischte wieder auf und unterbrach die unheimliche Stille. Regen trommelte gegen die Fenster und auf das Dach, und die Wände erzitterten unter dem Ansturm heftiger Sturmböen.
Die Fliegengittertür schlug immer wieder krachend zu. Emma blickte aus dem Fenster auf den Leichnam neben der Stalltür. Eine kalte Hand schloss sich um ihr Herz. Sie konnte ihn dort nicht liegen lassen.
Sie sah noch einmal nach ihrem Patienten, und nachdem sie sich davon überzeugt hatte, dass es ihm den Umständen entsprechend gut ging, lief sie hinaus in das Unwetter. Der Wind zerrte an ihr, und sie musste darauf achten, nicht von abgerissenen Brettern oder Wellblechen getroffen zu werden, die der Sturm aus ihrer Verankerung gerissen hatte. Die dicken Regentropfen klatschten mit solcher Wucht auf ihr Gesicht und ihre nackten Arme, dass es wehtat. Sie kniff die Augen zusammen und versuchte, gegen die Kraft des Windes anzulaufen, doch er war zu stark.
Endlich war sie bei dem Leichnam. Der Wind kreischte und heulte. Sie packte seine Handgelenke und zog mit aller Kraft, aber er bewegte sich kaum.
Sie versuchte es noch einmal. Wieder nur Zentimeter.
»Verdammt!«, schrie sie, so ungehalten wie der Wind. »Hilf mit! Wenn du mir schon im Leben keine Hilfe warst, dann versuch es wenigstens jetzt!«
Im dunklen Stall bellte ein Hund, und sie rief ihm hastig ein paar beruhigende Worte zu. Plötzlich ließ sich der Leichnam leicht über den glitschigen Boden ziehen. Mit letzter Kraft schleifte sie ihn ins Trockene. Emma wollte ihn zudecken, wollte ihn nicht schlammbedeckt und leblos liegen lassen, begnügte sich jedoch damit, die Tür zu schließen und zu verriegeln, ehe sie sich in den fast horizontalen Regen zurückwagte.
Das schrille Kreischen hatte zugenommen. Ein Eimer wurde gegen ihre Knie geschleudert und riss sie fast von den Beinen. Dann wirbelte er weiter quer über den Hof. Emma wankte vom Wind förmlich angeschoben zum Haus und prallte schließlich gegen einen der Verandapfosten. Sie klammerte sich an das Geländer und hangelte sich in Richtung Treppe. Als sie der Kraft des Sturmes nicht länger im Stehen trotzen konnte, kroch sie auf allen vieren weiter, die Stufen hinauf und zur Tür.
Die Fliegengittertür schlug unkontrolliert auf und zu, nur noch von einem Scharnier gehalten. Emma packte sie, bekam den Griff der Haustür zu fassen und stolperte hinein. Drinnen stemmte sie sich mit dem Rücken gegen die Tür, bis das Schloss einrastete.
Als es geschafft war, ließ sie sich mit dem Rücken an der Tür entlang zu Boden gleiten und atmete erleichtert aus. Ihre durchweichten Kleider tropften, und es bildete sich bereits eine Pfütze auf dem polierten Holzboden. Sie warf einen Blick ins Behandlungszimmer. Ihr Patient lag reglos da und atmete tief und gleichmäßig.
Sie knöpfte ihre Bluse auf und ließ sie zu Boden fallen. Stiefel und Jeans folgten. Dann wrang sie ihre Haare aus und lief barfuß ins Schlafzimmer, wo sie auch die Unterwäsche wechselte und in Shorts und T-Shirt schlüpfte.
Danach eilte Emma zurück in den Behandlungsraum. Der Fremde schlief noch, sein Körper ganz erschlafft vor Erschöpfung. Etwa eine Woche alte Stoppeln bedeckten ein maskulines, ebenmäßiges Gesicht mit einer langen geraden Nase und vollen Lippen. Dunkle Brauen wölbten sich über weit auseinander stehenden Augen.
Ein unheimliches Ächzen ließ sie zum Fenster stürzen. Der gewaltige Mangobaum neben dem Stall neigte sich gefährlich im Wind. Äste brachen ab und krachten gegen Stallwände und Verandabrüstung. Emma fuhr mit den Fingern über die Klebestreifen auf der Fensterscheibe, wohl wissend, dass sie dem Ansturm wahrscheinlich nicht standhalten würden. Wenn das Fenster zersprang oder das Dach weggeweht wurde, gab es nur noch einen sicheren Ort im ganzen Haus. Sie warf einen Blick auf den Mann auf ihrem Operationstisch.
»Ich kann Sie hier nicht liegen lassen. Dieses alte Haus ist zwar solide gebaut, aber Wirbelsturm Bertha könnte noch ein klein wenig stärker sein.«
Emma schüttelte ihn an der Schulter, um ihn zu wecken. Er bewegte sich kurz und schlief dann gleich wieder ein. Seufzend holte sie ein Fläschchen Ammoniak, entfernte den Stöpsel und hielt es ihm unter die Nase. Er wachte schnaubend auf und fluchte.
»Wir müssen ins Bad.« Obwohl sie schrie, wurde ihre Stimme fast vom Sturm übertönt. Sie half ihm, die Beine über die Tischkante zu schieben und sich aufzusetzen. »Das ist der sicherste Raum im ganzen Haus.«
Der verständnislose Ausdruck auf seinem Gesicht wich Zustimmung, als die Erinnerung zurückkehrte. Dann senkte er den Blick, und Emma musste fast lächeln, als sie die Verlegenheit in seinen Augen sah.
»Ich bin wirklich Ärztin. Und ich habe schon andere nackte Männer gesehen«, versicherte sie ihm.
»Ich hoffe, ich halte dem Vergleich stand.« Sein verlegenes Lächeln erlosch, als er versuchte aufzustehen. Seine bandagierten Hände zuckten zurück, und er unterdrückte einen Schmerzensschrei.
Emma legte seinen Arm über ihre Schultern und stützte ihn, als er sich langsam vom Tisch gleiten ließ. »Versuchen Sie, den Großteil Ihres Gewichts auf den rechten Fuß zu stützen. Rechts ist der Nagel nicht sehr tief eingedrungen.« Flüchtig fragte sie sich, wie er es geschafft hatte zu fliehen, bevor die Kreuzigung vollendet worden war.
Langsam schlurften sie den Flur entlang zum Bad. Emmas Herz zog sich zusammen beim Anblick der Decken und der Matratze in der alten frei stehenden Badewanne. Wenn er doch nur dort geblieben wäre! Ich habe ihm gesagt, er soll da drinbleiben! Ich hätte wissen müssen, dass er nicht auf mich hören würde.
Sie verdrängte die Gewissensbisse.
In dem kleinen Raum war das Toben des Windes ohrenbetäubend.
»Legen Sie sich in die Wanne«, schrie sie ihrem Patienten ins Ohr. »Oben auf die Decken. Ich ziehe die Matratze über Sie.«
»Und was ist mit Ihnen?«
»Ich setze mich auf den Boden.«
»Kommt nicht in Frage. Ich werde nicht zulassen, dass Sie meine Sicherheit über Ihre eigene stellen. Ich werde mich auf den Boden setzen.« Der sture Zug unter den dunklen Stoppeln verriet ihr, dass es ihr schwer fallen würde, sich gegen ihn durchzusetzen.
Etwas Schweres krachte gegen die Außenwand. Eine Dose Rasierschaum fiel aus dem Regal und landete klappernd im Waschbecken.
»Also gut«, seufzte sie, »wir legen uns beide in die Wanne.« Sie sandte ein Dankesgebet gen Himmel, dass es ihrer Mutter nie gelungen war, ihren Vater dazu zu bewegen, das Bad zu renovieren. Die altmodische Badewanne war so groß, als hätten damals alle Familienmitglieder gleichzeitig gebadet.
Sie zog an seinem Arm. »Kommen Sie.«
»Reichen Sie mir erst ein Handtuch.«
»Wie?« Sie konnte ihn über das Heulen des Windes hinweg kaum verstehen.
Er beugte sich so weit herab, dass sein Mund ganz dicht an ihrem Ohr lag. »Hören Sie, Lady, wenn ich schon die nächsten Stunden mit Ihnen in einer Badewanne verbringen soll, sollte etwas zwischen uns sein. Ich meine, gewisse Körperteile von mir sind unversehrt geblieben.«
Emma nahm ein Handtuch von der Stange und wollte es ihm gerade reichen, als ihr aufging, dass er es sich nicht selbst um die Hüften schlingen konnte. Sie bückte sich und übernahm das für ihn. Als ihre Wange dabei seine Brust streifte, war sie sich der kurzen krausen Härchen auf der sonnengebräunten Haut plötzlich sehr bewusst.
»Beeilen Sie sich und klettern Sie rein«, rief sie. »Und passen Sie auf den Verband an Ihrem Rücken auf.«
Sie half ihm hinein, zog die Matratze über die Wanne und stieg dann ebenfalls hinein, wobei sie sich mit dem Rücken zu ihm legte. Wieder dankte sie Gott für die Größe der Wanne.
Ein Knall wie von einer Explosion ließ Emma vor Schreck zusammenfahren. Wahrscheinlich war ein Fenster zu Bruch gegangen. Sie ließ sich wieder auf die Decken zurücksinken.
Eine kräftige Hand legte sich auf ihre Schulter. Ansonsten regte er sich nicht, und sie wusste nicht, ob er sie oder sich selbst beruhigen wollte. Überraschenderweise hatte sie keine Furcht, weder vor dem Sturm noch vor dem Fremden an ihrer Seite. Allerdings war sie in der vergangenen Stunde auch viel zu beschäftigt gewesen, um Angst zu verspüren.
Minuten verstrichen, und seine Hand wurde schwer. Er atmete tiefer, und sie merkte, dass er eingeschlafen war. In Gedanken ging sie immer wieder die Ereignisse der vergangenen Stunde durch und quälte sich sinnlos mit einer Reihe von Was-wäre-Wenns.
Ihre geistige Selbstkasteiung bewirkte, dass sie die Bewegung in ihrem Rücken nicht gleich bemerkte, aber als sie sie dann wahrnahm, erstarrte sie.
Sie spürte seine harte Erektion an ihrem Po. Instinktiv griff sie nach dem Badewannenrand, um sich aus der Wanne zu hieven, aber dann registrierte sie, dass seine Hand auf ihrer Schulter noch völlig entspannt war und dass er leise schnarchte.
»Gott sei gedankt für das Handtuch«, murmelte sie.
In einem anderen Zimmer splitterte Glas. Das alte Haus erzitterte, und allerlei Schutt hagelte wie Schrapnelle gegen die Wände. Emma zuckte zusammen, und Erinnerungen an ein anderes Versteck gingen ihr durch den Kopf. Sie und Hanna hatten drei Stunden zusammengekauert in der halb verfallenen Hütte ausgeharrt, während um sie herum die Granaten eingeschlagen waren. Und Hanna hatte von Philippe erzählt, wie sie es immer getan hatte, wenn sie die Anspannung nicht mehr aushielt.
»Je ernster die Situation«, hatte Hanna erzählt, »desto größer sein Verlangen nach Sex. Ich weiß nicht, ob es der Urinstinkt war sich fortzupflanzen, für den Fall, dass er selbst nicht überlebte, oder ob er sich einfach von der Gefahr ablenken wollte. Vielleicht war es ihm ja ein Trost.« In ihre Augen war ein wehmütiger Blick getreten, und Emma wusste, dass Hanna daran dachte, dass keine Zeit mehr für die Liebe geblieben war, als die Landmine Philippe zerfetzt hatte. Emma hatte Hanna in den Arm genommen und ihren Worten gelauscht, die vom Staccato des Maschinengewehrfeuers übertönt wurden.
Nun fühlte Emma die Wärme des kräftigen Körpers hinter ihr. Sie lauschte seinem schweren Atem, während der Sturm um sie herum heulte, und überall im Haus vom Wind umhergewirbelte Projektile einschlugen. Sie legte eine Hand auf die Finger an ihrer Schulter und spendete so wenigstens ein bisschen Mut.
In einer düsteren Hütte hob ein kräftiger großer Mann ein Jagdmesser auf und fuhr mit dem Finger an der scharfen Klinge entlang.
Die schwieligen Hände zitterten, und die Frau, die ihm zusah, bebte vor Furcht. Sie wusste, was das Zittern zu bedeuten hatte, wusste um den Zorn und den Frust, die sich dahinter verbargen. Sie lebte seit vielen Jahren damit und hatte doch erst so viele Male, wie sie Finger an beiden Händen hatte, erlebt, wie die grenzenlose Wut sich entlud. Sie hatte all die Jahre mit der Angst vor dem Tag gelebt, an dem der Zorn sich gegen sie richten würde. Und dieser Tag war nun gekommen.
»Er war tot.« Ihre Stimme zitterte, so wie ihr ganzer Körper. »Der Blitz hatte ihn getroffen und dich bewusstlos gemacht. Ich wusste, dass wir die Leiche loswerden mussten und habe sie in den Fluss geworfen. Wenn man ihn findet, wird man glauben, er sei im Sturm umgekommen.« Die Lügen sprudelten nur so aus ihr hervor, klangen jetzt jedoch lange nicht mehr so überzeugend wie auf der Rückfahrt von der Ranch der Ärztin.
Sie hob den Kopf und schaute in die schwarzen Augen ihres Mannes, in denen sich die nackte Glühbirne spiegelte, die einzige Lichtquelle im Schuppen. Sie war ein großes Risiko eingegangen, als sie ihn niedergeschlagen und den Verteidiger befreit hatte, aber sie hatte einfach nicht zulassen können, dass er die Kreuzigung vollzog. Sie konnte seine Beweggründe verstehen – blutete nicht ihr eigenes Herz von dem unerträglichen Verlust? Aber Töten verstieß nun einmal gegen die Gebote Gottes, und sie hatte nicht zusehen können, wie er die Unsterblichkeit seiner Seele aufs Spiel setzte.
Ihr ganzes Leben hatten sie getreu den Worten der Heiligen Bibel gelebt, und ihre Furcht vor dem Zorn Gottes war größer als die Angst vor ihrem eigenen Mann.
Er blickte auf seine Frau, die an der Schuppenwand kauerte. Das Blut pochte in seinen Adern, pulsierte hinter seinen Augen, und er knirschte mit den Zähnen in seinem Bemühen, sich zu beherrschen. Er zwang sich, tief ein- und langsam auszuatmen.
Das Rauschen in seinen Ohren ließ nach, und erst jetzt wurde ihm bewusst, dass er die rechte Hand erhoben hatte und dass aus seiner Faust eine schimmernde Klinge ragte. Abrupt wandte er sich ab und fuhr sich mit der linken Hand über das Gesicht.
Er hätte den Verteidiger nicht hierher bringen dürfen, aber er war nicht sicher gewesen, was Gott von ihm erwartete. Beim Täter war es leicht gewesen, da hatte die Bibel zu ihm gesprochen: Wenn dein Auge Gott beleidigt, dann reiß es heraus. Wenn deine Hand dich zur Sünde verleitet, dann hacke sie ab. Er hatte das weiche Fleisch des Täters in der Hand gehalten, hatte gefühlt, wie es sich zusammenzog, während sich die Augen vor Entsetzen weiteten. Dann hatte der Körper sich vor Schmerzen aufgebäumt, als die Klinge durch das Fleisch schnitt ...
Seine Frau legte ihm eine Hand auf den Arm.
»Bitte, Hadley. Lass uns ins Haus gehen, bevor der Sturm noch schlimmer wird.«
Hadley blickte auf seine Frau herab, auf das von silbernen Strähnen durchzogene blonde Haar, in die freundlichen flehenden Augen in ihrem faltigen Gesicht. Sie war außer sich gewesen, als er den Verteidiger hergebracht hatte. Sie verstand nicht, dass er Gottes Willen befolgen und das Unrecht sühnen musste. Aber er liebte sie. Sie war eine gute Frau, und sie hatte genug gelitten.
Er würde die anderen nicht herbringen.
Das würde nicht nötig sein.
Er wusste jetzt, auf welche Art sie sterben mussten.
Kapitel 2
Schwärze. So undurchdringlich, dass sie beklemmend wirkte.
Drew bemühte sich, die aufsteigende Panik zu unterdrücken, und wartete auf die Schritte, die ein weiteres Duell mit dem Teufel ankündigten. Ein verbales und sehr einseitiges Duell, weil er zwar die Fragen stellte, der Teufel sich jedoch weigerte, klar zu antworten. Stattdessen gab er ihm Rätsel auf oder erging sich in Parabeln.
Aber irgendetwas war anders. Er fühlte etwas Weiches unter den Fingern. Wärme und Weichheit, die in ihm die Sehnsucht nach mehr weckten. Und dieser Duft. Der Duft einer Frau. Kein Parfum, sondern der frische Geruch sauberer Frauenhaut, weicher Haut, die ihn mit der Verheißung fleischlicher Freuden verlockte. Er spürte die Reaktion seines Körpers, das Ziehen in den Lenden, die Sehnsucht danach, dass ein liebes, gutherziges Wesen ihn aus diesem Höllenloch befreite.
Die Schwärze verdichtete sich, wurde massiver. Der Teufel war zurück, quälte ihn, verfluchte ihn. Der Teufel schwang den Hammer, und ein heftiger Schmerz durchzuckte seinen Fuß. Er hörte sich selbst in der Finsternis stöhnen.
»Es ist alles gut. Sie sind in Sicherheit. Niemand wird Ihnen etwas tun. Ich bin gegen Ihren Fuß gestoßen. Es tut mir Leid.«
Die Stimme war weich und warm wie geschmolzene Butter. Die Frau – ihre Stimme. Ihre Hand fuhr über seine Brust, und sein Herz raste unter der kühlen Handfläche. Die Erinnerung kehrte schlagartig zurück.
»Schon gut.« Er zögerte, als er seinen glitschigen Schweiß unter ihren Fingern fühlte. Er holte tief Luft. »Ich habe nur ... geträumt.«
Sie musste die Matratze fortgeschoben haben, denn plötzlich strich kühlere Luft über ihn hinweg. Die Intensität des Sturmes hatte nachgelassen, dafür hatte sintflutartiger Regen eingesetzt. Er versuchte, Einzelheiten ihrer Silhouette wahrzunehmen, aber nachdem sie die Matratze von der Wanne entfernt hatte, war es nicht viel weniger dunkel als zuvor.
»Ich hole nur Kerzen und Streichhölzer, die ich hier deponiert habe.« Sie nahm die Hand von seiner Brust, und ihre Stimme klang irgendwie körperlos. »Rühren Sie sich nicht, bis ich Licht gemacht habe.«
Drew hörte, wie sie aus der Wanne stieg und umhertastete. Kurz darauf fiel flackernder gelber Kerzenschein auf die Wände. Die Flamme spiegelte sich in bernsteinfarbenen Augen, die ihn abschätzig musterten. Augen, die viel zu groß wirkten in einem blassen fein geschnittenen Gesicht mit hohen Wangenknochen, das eingerahmt war von Haaren, die von ihrem Kopf abstanden wie erstarrte Karamellfäden eines abstrakten Zuckerbäcker-Kunstwerks.
»Bleiben Sie, wo Sie sind.«
Es war ein Befehl, und der Ton erregte sofort seinen Widerwillen.
»Warum?«
»Ich gehe in die Küche, um Tee zu kochen. Ich denke, wir können beide einen brauchen.«
Ehe er hierauf etwas erwidern konnte, war sie durch die Tür, und ihr zuckender Schatten verschwand von der Wand. Erst jetzt wurde ihm bewusst, dass sie eine zweite Kerze auf dem Waschbeckenrand aufgestellt hatte.
Wer zum Teufel war sie? Sie hatte gesagt, sie wäre Ärztin, und seine Verbände sahen professionell aus. Hatte man ihn deshalb hergebracht? Damit sie ihn versorgte? Oder gehörte auch das zu der psychologischen Marter, die er in der vergangenen Woche durchlebt hatte? Vielleicht hatte der Sturm ja die Mordpläne des Teufels durchkreuzt. Vielleicht rief die Frau, die sich als Ärztin bezeichnete, in eben diesem Augenblick den Teufel an und verriet ihm, wo er ihn finden konnte. Die Zweifel stürmten auf ihn ein und verursachten ihm Kopfschmerzen.
Wie auch immer, er konnte nicht einfach daliegen und abwarten, was passierte. Vorsichtig stand er auf und stieg aus der Wanne. Von den Schmerzen in den Füßen wurde ihm ganz flau, aber er biss die Zähne zusammen und wartete, bis der Schwindel nachließ.
Verflucht! Wenn der Teufel jetzt eintraf, waren seine Chancen, ihm zu entkommen, gleich null. Er konnte nur beten, dass diese Frau tatsächlich die war, die sie zu sein vorgab.
Er nahm die Kerze und ging langsam den Flur hinunter auf das Licht am anderen Ende zu. Mit der freien Hand stützte er sich an der Wand ab. Die Holzverkleidung fühlte sich kühl und glatt an unter seinen Fingern.
Der Flur endete in einer großen altmodischen Wohnküche, die an einem Ende von einem massiven Tisch mit sechs Stühlen beherrscht wurde und am anderen von einem alten Holzofen mit einem Lachenden Hans auf der grünen Ofentür. Eine Öllampe auf der Anrichte tauchte den Raum in warmes Licht.
Die Frau war nicht hier. Einen Moment fühlte er Panik in sich aufsteigen. Wo zum Teufel steckte sie? Holte sie den Mann, den er für sich nur den »Leibhaftigen Teufel« nannte? Er nahm eine Bewegung hinter einer Türöffnung auf der gegenüberliegenden Seite der Küche wahr. Er schaute sich suchend nach etwas um, das er als Waffe benutzen konnte, aber noch bevor er etwas Geeignetes entdeckt hatte, kehrte die Frau zurück in den Raum.
»Ich sagte doch, Sie sollen im Bad bleiben!«, sagte sie kopfschüttelnd. »Sie sollten sich nicht zu viel bewegen, sonst brechen die Wunden an Ihren Füßen wieder auf.«
Sie ging um den Tisch herum und zog einen Stuhl für ihn zurück. »Setzen Sie sich.«
Ihr Ton verriet, dass sie es gewohnt war, dass man ihre Anweisungen befolgte. Gehorsam war nicht seine Stärke, und er hätte sich gerne widersetzt, aber die Schmerzen in seinen Füßen ließen ihm gar keine Wahl. Er schlurfte zu dem Stuhl und setzte sich.
»Wo waren Sie?« Er hatte nicht so schroff klingen wollen, aber nach allem, was er durchgemacht hatte, fiel es ihm schwer, sich zu beherrschen.
Die Frau bückte sich, öffnete einen Schrank und nahm einen Campingkocher heraus, den sie auf die Arbeitsfläche stellte. Sie warf ihm einen flüchtigen Blick zu.
»Der Strom ist schon zu Beginn des Sturmes ausgefallen, aber wir haben das hier und den Holzofen, Kochen ist also kein Problem. Ich musste nur den alten, kerosinbetriebenen Kühlschrank in der Waschküche anwerfen. Sobald er kalt ist, räume ich den Inhalt aus dem Kühlschrank in der Küche um.«
Sie schloss den Kocher an eine Gasflache an, die unten im Schrank stand, zündete ihn an, füllte einen Kupferkessel mit Wasser und stellte diesen auf die Flamme. Sekunden später standen Tassen und Teekanne mit Tee bereit, und sie setzte sich ihm gegenüber an den Tisch.
»Wie heißen Sie?«
Er musterte sie forschend. Er hatte geglaubt, ihre Augen wären bernsteinfarben, aber jetzt sah er, dass ihre Farbe mehr an dunklen Sherry erinnerte und sie von solcher Tiefe waren, dass ein Mann in ihnen ertrinken konnte. Warme, aufrichtige Augen, mit Wimpern, die so lang und gebogen waren, dass sie ihn an jene einer Porzellanpuppe erinnerten.
»Drew. Drew Jarret. Und wer sind Sie?«
Emma holte tief Luft. Sie spürte die Frustration ihres Gegenübers, die mühsam unterdrückte Erregung.
»Emma Randall.« Sie wählte die folgenden Worte mit Bedacht. »Wer hat Ihnen ... das angetan ... Drew?«
»Ich weiß es nicht.«
»Sie wissen es nicht!«, entfuhr es Emma in ungläubigem Tonfall. »Hat man Ihnen die Augen verbunden?«
»Man hat mir eine Kapuze übergezogen. Sie war am Hals festgeklebt und hatte nur einen Schlitz in Mundhöhe zum Essen und Trinken. Ich war angekettet, sodass ich sie mir nicht ausziehen – oder fliehen – konnte. Und ich wurde mit Drogen ruhig gestellt.«
Drews ruhige, ausdruckslose Stimme und die Bilder, die seine Worte vor ihrem geistigen Auge aufsteigen ließen, jagten Emma einen kalten Schauer über den Rücken.
»Wie hat man Ihnen die Drogen verabreicht?«
»Sie waren dem Essen beigemischt.«
»Und warum haben Sie es dann gegessen?«
»Es ist schwer, zu widersprechen, wenn jemand einem eine Gewehrmündung an die Stirn hält.«
Emma schauderte. Sie hatte im Rahmen ihrer Arbeit oft erlebt, wie grausam Menschen zueinander sein konnten, hatte die physischen und psychologischen Folgen dieser Grausamkeit gesehen, aber kaltblütige Unmenschlichkeit erschütterte sie immer wieder. Sie versuchte sich auszumalen, welche Angst sie selbst in einer solchen Situation empfunden hätte. Inmitten militärischer Auseinandersetzungen festzusitzen war eine Sache und schon schlimm genug, aber angekettet zu sein wie ein Tier ...
»Und wie lange waren Sie angekettet?«
»Eine Woche. Zumindest glaube ich, dass es eine Woche war. Ich habe versucht, die Tage festzuhalten, aber aufgrund der Drogen fiel es mir schwer, mich zu konzentrieren. Ich bin immer wieder eingeschlafen.«
»Was hatten die Drogen noch für eine Wirkung?«
»Wo sind wir hier?«
Emma blinzelte angesichts dieses abrupten Schwenks. Er hatte ihre Fragen bis dahin recht offen beantwortet, aber nun lag Misstrauen in seinen Augen. Er traute ihr nicht, das konnte sie an seinem Gesicht ablesen, aber das beruhte auf Gegenseitigkeit. Er sah aus, als könnte er einer dieser Aussteiger sein, die völlig verwildert draußen im Busch lebten. Zwar sprach er nicht wie einer dieser Wilden, aber diese stammten ja auch nicht alle aus den unteren Gesellschaftsschichten. Es gab sogar den einen oder anderen Akademiker, dem das moderne Leben zu stressig geworden war und der es vorgezogen hatte auszusteigen. Sie erinnerte sich, dass ihr Vater ihr in einem seiner lichten Momente erzählt hatte, dass vor einigen Jahren eine Bande solcher Wilder oben in den Bergen ihre Zelte aufgeschlagen hatten und um das Lagerfeuer herumgetanzt wären wie Indianer.
Das Pfeifen des Wasserkessels riss sie aus ihren Gedanken. Als sie zwei dampfende Tassen Tee auf den Tisch stellte, hätte sie Drew fast angeboten, seine für ihn zu halten, aber das dickköpfige Leuchten und der Argwohn in seinen Augen hielten sie davon ab.
»In O'Connor Valley. Das Tal reicht bis zu den Bergen südsüdwestlich von Cairns. Wo wohnen Sie?«
Er runzelte die Stirn. »Cairns.«
Emma seufzte in die hierauf folgende Stille hinein. Er war ganz offensichtlich nicht erpicht darauf, mehr zu verraten als unbedingt nötig, aber wenn er längere Zeit bei ihr blieb – und in Anbetracht des sturzbachartigen Regens sah es ganz danach aus – wollte sie doch wissen, mit wem sie es zu tun hatte.
»Wie sind Sie hergekommen?«
Der leicht verkniffene Zug um seinen Mund verriet, dass es ihm widerstrebte, darauf zu antworten. Emma zwang sich, ihre Ungeduld zu zügeln. Ihre Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Die Ereignisse des heutigen Tages drohten, den Panzer eiserner Selbstdisziplin zu durchbrechen, den sie sich in den Jahren der Arbeit in Kriegs- und Krisengebieten zugelegt hatte.
»Drew, Sie können mir vertrauen, ich will Ihnen nichts Böses. Habe ich das nicht bereits bewiesen?«
Verdammt, sie hat Recht, dachte Drew. Aber in der vergangenen Woche hatte er mehr als einmal seinen Geisteszustand angezweifelt. Das Gefühl der Isolation unter dieser Kapuze, die Desorientierung aufgrund der Drogen und die allgegenwärtige Frucht vor dem Tod hatten ihre Spuren hinterlassen.
»Jedes Jahr um diese Zeit mache ich drei Wochen Angel-Urlaub in einer kleinen Hütte bei der Quelle des Archer River nördlich von Cairns«, begann er. »Vor etwa einer Woche ging ich zum Angeln, kehrte zurück in die Hütte, trank ein paar Bier und schlief ein. Als ich später aufwachte und an den Kühlschrank ging, fand ich es seltsam, dass nur noch eine Flasche Bier da war. Ich war sicher, dass noch zwei übrig gewesen waren. Das Bier schmeckte etwas schal, aber mir war warm, und das Bier war kalt.« Er zuckte die Achseln und verzog prompt das Gesicht. Offenbar waren die Striemen auf seinem Rücken noch sehr schmerzhaft.
»Als ich wieder zu mir kam, war ich in einem Schuppen angekettet. Ich hatte zwar eine Kapuze über dem Kopf und konnte nichts sehen, aber ich roch Holzspäne, Öl, Schmiere und rostiges Metall.«
»Haben Sie eine Ahnung, wer Ihnen das angetan haben könnte?«
»Nein.« Er schüttelte den Kopf und schauderte bei der Erinnerung. »Auch wenn er mir das Essen brachte und ... den Eimer, in den ich mich erleichtern konnte ... löste er nur eine Fessel. Er hat ständig die Bibel zitiert und von Opfern, Buße und dergleichen gefaselt. Ich hatte den Eindruck, dass er mich für irgendjemandes Tod verantwortlich machte, habe aber keinen Schimmer, wer das gewesen sein sollte.«
Er trank noch einen Schluck Tee und genoss das Gefühl, als die heiße Flüssigkeit seine Kehle hinunterrann. Alles, was er in der vergangenen Woche zu essen und zu trinken bekommen hatte, war lauwarm gewesen, und obgleich das seine geringste Sorge hätte sein sollen, hatte auch das ihm immer wieder sein Ausgeliefertsein vor Augen geführt, die Macht, die sein Peiniger über ihn hatte. Sein einziger Fluchtversuch hatte ein abruptes Ende gefunden, als der Mann ihm mit dem Gewehrkolben fast den Schädel eingeschlagen hatte. Hiernach hatte der Teufel die Drogenmenge erhöht und die Kette nicht mehr abgenommen, sondern lediglich so weit gelöst, dass er ein wenig mehr Bewegungsfreiheit hatte.
»Darf ich Ihr Telefon benutzen?«
»Tut mir Leid.« Das Bedauern in ihrer Stimme klang echt. »Die Leitung ist tot. Ich habe es vorhin versucht.«
Sofort regte sich sein Misstrauen wieder. »Wen wollten Sie denn anrufen?«
Ein Hauch von Resignation trat in ihre Augen. »Meine Mutter. Sie lebt in einem Vorort von Cairns – in der Nähe von The Cascades. Der Sturm sollte zuerst Cairns erreichen, und ich mache mir Sorgen um sie.« Sie runzelte die Stirn. »Was ist mit Ihnen? Gibt es jemanden, der sich Sorgen um Sie macht? Wenn Sie eine ganze Woche nichts von sich haben hören lassen, wird doch sicher jemand ...«
»Nein. Während meines Angel-Urlaubs melde ich mich für gewöhnlich nicht. Mein Büro weiß, dass es mich nur in einem absoluten Notfall anrufen darf. Diese drei Wochen im Jahr sind ausschließlich dem Fischen, Tauchen und Lesen all der Romane vorbehalten, die sich in den vergangenen elfeinhalb Monaten angesammelt haben.«
Ehe sie etwas darauf erwidern konnte, knurrte sein Magen laut, und er merkte verblüfft auf, als sie leise lachte, ein tiefer, kehliger Laut, bei dem ihm ein wohlig-prickelnder Schauer den Rücken hinunterjagte. »Was bin ich nur für eine Ärztin, dass ich die elementarsten Bedürfnisse meines Patienten vergesse.«
Sie stand auf und holte eine große Schüssel aus dem Kühlschrank. Drew beobachtete sie und registrierte die Sparsamkeit ihrer Bewegungen und die anmutigen Konturen ihrer schlanken Gestalt. Als sie ihm ins Bad geholfen und dabei den Arm um seine Taille gelegt hatte, hatte er gespürt, dass sie keinen BH trug. Jetzt zeichneten sich ihre festen Brüste unter dem dünnen Stoff ihres T-Shirts ab, als sie Suppe in einen Topf gab und diesen auf den Herd stellte. Unwillkürlich breitete sich angenehme Wärme in seinen Lenden aus, als er sich vorstellte, wie diese Brüste über ihm wippten, während sie ein anderes seiner elementaren Bedürfnisse befriedigte, noch elementarer als Essen.
»Ich hoffe, Sie mögen Gemüsesuppe mit Rindfleischeinlage.« Als sie sich ihm wieder zuwandte, hoffte er, dass sie seinen lüsternen Blick nicht bemerkte. »Ich mache Feuer im Ofen und röste Toast.«
Er versuchte, seine Gedanken in konstruktivere Bahnen zu lenken. »Haben Sie kein Handy?«
»Bedaure.« Sie schüttelte den Kopf und hielt ein brennendes Streichholz an das Papier unter den Holzstücken im Ofen. Dann schloss sie die Klappe wieder. »Hier unten im Tal funktioniert kein Mobilfunknetz.«
»Wäre es Ihnen dann vielleicht möglich, mich morgen nach Cairns zurückzufahren?«
Sie legte den Kopf schräg und lauschte dem Rauschen des Regens. Es goss immer noch in Strömen. »Inzwischen dürfte es unmöglich sein, mehrere der Bäche hier im Tal zu durchqueren. Sie werden aus Quellen in den Bergen gespeist, und es regnet nun schon seit ...« Sie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. »... fast fünf Stunden unablässig. Sie haben geschlafen wie ein Stein.«
»Wie halten Sie in der Regenzeit Kontakt zur Außenwelt?« Seine Stimme klang unbeabsichtigt schroff vor Frustration, und er hatte schreckliche Kopfschmerzen – wohl Nachwirkungen der Droge, die man ihm über Tage verabreicht hatte.
»Gar nicht. Das gehört zum Leben hier draußen dazu, und man stellt sich entsprechend darauf ein. Wir decken uns mit einer ausreichenden Menge an Vorräten ein, die Wassertanks sind voll, geheizt wird mit dem Holzofen, und Licht liefern Öllampen und Kerzen. Das mag Ihnen ein wenig primitiv erscheinen, aber ich bin schon an Orten gewesen, wo man das als puren Luxus angesehen hätte.«
Obgleich ihr Tonfall unverändert freundlich blieb, fühlte Drew sich – zu Recht – in die Schranken verwiesen. »Tut mir Leid, wenn ich gereizt geklungen habe«, sagte er, »aber ...«
»Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Ich an Ihrer Stelle wäre so verdammt wütend und frustriert, dass ich vermutlich versuchen würde, nach Cairns zu laufen.« Sie blickte auf seine Füße. Die weißen Verbände hoben sich deutlich von den dunklen Holzdielen ab. »Allerdings dürfte Laufen bei Ihnen in nächster Zeit ausfallen.«
Emma kümmerte sich wieder um das Essen, wobei sich sich die ganze Zeit bewusst war, dass er sie sehr genau beobachtete. Und noch bewusster war ihr ihre eigene Reaktion darauf. Sie sagte sich immer wieder, dass sie nur deshalb so empfand, weil sie selbst unter großem seelischen Druck stand – es war in zu kurzer Zeit zu viel passiert, um das alles zu verkraften, geschweige denn zu verarbeiten.
»Glauben Sie, Sie können den Löffel halten?«, fragte sie, als sie einen Teller heiße Suppe vor ihn hinstellte.
»Es wird schon gehen.«
Emma schaute ihm beim Essen zu. Anfangs hatte er noch einige Schwierigkeiten, aber nach und nach entwickelte er eine geeignete Technik, indem er sich den Löffelstiel zwischen die Finger klemmte. Lange starke Finger. Fähige Hände. Seine Brust schimmerte im Licht der Öllampe wie Bronze. Dunkle Haare bedeckten den muskulösen Brustkorb und verschwanden unter dem Handtuch, das einen Teil seiner Anatomie verbarg, der, wie sie wusste, großzügig ausgefallen war.
Hitze durchzuckte sie, und sie verspürte eine Sehnsucht, die sie sehr, sehr lange nicht mehr empfunden hatte. Sie rief sich zur Ordnung und richtete ihre Gedanken auf praktische Dinge. Kleidung – sie würde etwas zum Anziehen für ihn heraussuchen müssen; er konnte ja schlecht die nächsten Tage nur mit einem Lendenschurz bekleidet herumlaufen. Nicht, wenn sie selbst ihre Instinkte unter Kontrolle halten wollte.
»Wir sollten etwas zum Anziehen für Sie heraussuchen«, sagte sie, als sie den leeren Teller in die Spüle stellte. »Und ein Bett für Sie herrichten. Sie sehen todmüde aus.« Sie lächelte schwach. »Und mir geht es auch nicht viel besser.«
Sie nahm die Lampe und hoffte, dass er sie nicht bat, ihm beim Aufstehen zu helfen. Ihre Nerven lagen blank, und ihre gewohnte eiserne Selbstdisziplin war stark angeschlagen. Aber er nickte nur, stand auf und zog dabei das Handtuch um seine Hüften enger.
Gedämpftes Lampenlicht warf ihre Schatten an die Flurwand. Emma machte kurz in der Tür zu ihrem Schlafzimmer Halt und atmete erleichtert auf, als sie sah, dass es noch intakt war. Als sie jedoch die Tür zum Gästezimmer öffnete, sank ihr das Herz. Ein großer Ast war ins Fenster geweht worden und hatte Glassplitter im ganzen Zimmer verteilt. Die Vorhänge waren zerfetzt und klatschnass, ein Regal war quer über das Bett gefallen, und überall lagen Bücher herum wie tote Vögel.
Sie fühlte Drews Körperwärme, als er an ihre Seite humpelte, und sein warmer Atem strich über ihr Haar, als er das Chaos betrachtete. Ihre Haut prickelte, als hätte er sie berührt.
Seufzend schloss sie die Tür wieder. Es war nur noch ein Zimmer übrig. Sie straffte die Schultern und atmete tief ein und aus, unbewusst eine Technik anwendend, die ihr schon in manch schwieriger Situation geholfen hatte.
Widerstrebend ging sie ans Ende des Flurs und betrat das letzte der drei Schlafzimmer. Irgendwie hatte sie erwartet, dass es anders aussehen würde, so verändert und gezeichnet wie sie sich fühlte. Aber der alte seidigschimmernde Eichenschrank, die passende Kommode und das Bett sahen so solide und beständig aus wie eh und je. Die Tagesdecke war braun-golden gemustert und entsprechend unempfindlich, und auf der Kommode lag eine Männer-Haarbürste neben einem altmodischen Wecker. Die cremefarbenen Spitzengardinen waren der einzige feminine Touch in diesem ansonsten sehr maskulinen Zimmer.
Emma hatte plötzlich einen Kloß im Hals, schluckte diesen jedoch tapfer hinunter. Sie stellte die Lampe auf die Kommode und öffnete eine Schublade. Ihre Hand zitterte leicht, als sie die Shorts herausnahm. Dann holte sie ein Hemd aus dem Schrank und legte beides auf das Bett. Sie wandte sich wieder Drew zu und hoffte, dass er nicht fragen würde, wessen Zimmer das war, aber sein Gesicht war völlig ausdruckslos. Was er wohl dachte?
»Ich lasse Ihnen die Lampe. Ich nehme die Kerze aus dem Bad.« Er sagte immer noch nichts. »Brauchen Sie sonst noch etwas?«
»Eine Zahnbürste wäre toll, falls Sie eine übrig haben. Ich habe gelernt, dass die Antworten auf die Frage ›Was würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?‹ sich mehr auf Hygieneartikel beziehen als auf gute Bücher und edlen Scotch. Obwohl ...« Er lächelte schief. »... ich denke, der Teil mit der schönen Frau ist ganz okay.«
Der bewundernde Ausdruck in seinen Augen verschlug Emma den Atem. Einen Moment stand sie sprachlos da, dann ging sie an ihm vorbei zur Tür. »Ich lege eine Zahnbürste und Zahnpasta für Sie ins Bad. Gute Nacht.«
»Emma.« Er legte ihr die Hand auf den Arm und hielt sie zurück. Er schien zu zögern, dann ließ er die Hand sinken. »Danke.«
Sie nickte und ging zurück zum Bad. Als sie sich das Gesicht wusch und die Zähne putzte, sah sie im Spiegel eine Frau mit hoffnungslos zerzaustem Haar und einem vor Erschöpfung eingefallenen Gesicht. Eine schöne Frau, ja?, dachte sie spöttisch.
Sie fand in einer Schublade noch eine neue Zahnbürste, die sie neben die Zahnpastatube legte.
In ihrem Schlafzimmer zog sie sich zügig aus und schlüpfte dann in ein Baumwollnachthemd. Sie öffnete das Fenster und lauschte dem gleichmäßigen Trommeln des Regens auf dem Verandadach. Die feuchte Luft duftete leicht nach Eukalyptus. Es war nicht mehr so drückend wie vor dem Wirbelsturm, aber immer noch sehr warm. Sie nahm ihre Haarbürste von der Kommode und begann, ihr Haar zu entwirren, bis es ihr in hellbraunen weichen Strähnen über die Schultern fiel. Sie cremte sich das Gesicht ein, legte sich auf das Bett und blies die Kerze aus.
Hätte sie Drew mehr Fragen stellen und versuchen sollen, mehr über ihn zu erfahren? War er vielleicht ein Krimineller, der seine Komplizen gelinkt hatte? Aber wie klang ein Krimineller und wie sah er aus? Emma lebte schon zu lange fern der polierten Zivilisation, um sich auch nur Spekulationen diesbezüglich zu gestatten.
Warum sollte jemand einen anderen Menschen auf so bizarre Art und Weise töten wollen? War Drew in irgendeinen abstrusen religiösen Kult verstrickt? Oder war er vielleicht geistesgestört? Emma dachte eine Weile über letztere Möglichkeit nach, kam aber zu dem Schluss, dass er sich, auch wenn er derzeit sehr angespannt war, besser unter Kontrolle hatte, als es bei den meisten anderen Menschen in seiner Situation der Fall wäre.
Trotzdem konnte sie ihre Ängste und ihr Misstrauen nicht ganz überwinden. Sie stand auf und schob ihren Schaukelstuhl unter die Türklinke. Anschließend ließ sie sich auf das Bett zurücksinken, in dem sie schon als kleines Mädchen geschlafen hatte, und kuschelte sich auf der vertrauten Matratze zurecht.
Müdigkeit rollte in Wellen über sie hinweg. Sie zwang sich, sich auf die Aufgabe zu konzentrieren, die sie am Morgen erwartete, und überlegte, wo sie die Leiche für die nächsten Tage sicher unterbringen konnte. Schuldgefühle plagten sie, aber sie kämpfte sie nieder und bemühte sich, die Kraft zu mobilisieren für das, was getan werden musste.
Und über all diesen Empfindungen lag die erschreckende Gewissheit, dass da draußen in der Dunkelheit ein Mörder herumlief.
Kapitel 3
Drew setzte sich kerzengerade im Bett auf. Das Herz schlug ihm bis zum Hals, und jeder Nerv in seinem Körper war zum Zerreißen gespannt.
Angespannt lauschte er auf das Geräusch, das ihn so abrupt geweckt hatte, hörte jedoch nur das Rauschen des Regens. Wenigstens fühlte sein Kopf sich an diesem Morgen schon viel klarer an. Trotzdem fragte er sich, wie lange es dauern würde, bis sein Körper die Drogen vollständig abgebaut hatte.
Als er sich streckte, spürte er den Schmerz in jedem Knochen und Muskel. Nur eine Woche erzwungener Bewegungslosigkeit – er hatte sich nicht einmal umdrehen können – hatte genügt, um ihn zu schwächen. In den wenigen Augenblicken, da die Wirkung der Droge nachgelassen hatte, hatte er sich gezwungen, ein paar gymnastische Übungen zu machen, so gut es ging, aber das hatte nicht viel gebracht.
Er ließ die Schultern kreisen und fühlte ein Brennen, als sich die verkrusteten Wunden vom Verband lösten. Es war ihm schwer gefallen, auf dem Bauch zu schlafen, und als er schließlich zu müde gewesen war, um noch Schmerz zu fühlen, hatte er sich auf den Rücken gerollt.
Da war es wieder.
Ein Heulen. Das Heulen eines Hundes, gespenstisch und klagend durchdrang es das Plätschern des Regens. Tageslicht schimmerte durch die Spitzenvorhänge, wenn auch gedämpft und grau. Ein Blick auf den Wecker verriet ihm, dass es kurz nach neun war.