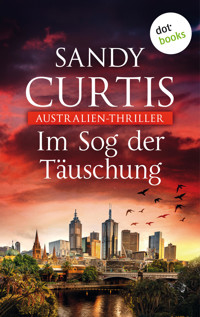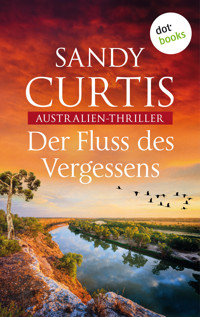Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Australian-Heat
- Sprache: Deutsch
Denn manche Schuld darf nie vergeben werden: Der Australien-Thriller »Der Sturm der Rache« von Sandy Curtis jetzt als eBook bei dotbooks. Wie gut kennen wir die Menschen, denen wir am nächsten sind? Sein letzter Einsatz hat ihn schwer mitgenommen – nun muss Mark, Undercoveragent der australischen Regierung, auch noch den rätselhaften Tod seines Vaters verkraften. War dieser in dunkle Machenschaften verstrickt, oder ist er von einem Verbrechen eingeholt worden, das vor langer Zeit begangen wurde? Die Spuren führen Mark zu einer Firma, die offenbar viele Geheimnisse zu verbergen hat – und zu Julie, der Tochter des Besitzers, in die er seit seiner Jugend unglücklich verliebt ist … Während die lang verdrängten Gefühle zwischen den beiden wieder aufflammen, muss Mark sich die immer drängendere Frage stellen: Kann er Julie vertrauen, oder ist sie nur der Köder in einem Netz aus Schuld, Gier und düsteren Geheimnissen? »Die Thriller von Sandy Curtis sind stets clever konstruiert – und die Hauptfiguren in ihrem neuen Werk sind vielleicht die besten, die wir bisher kennenlernen durften!« Bundaberg Regional Jetzt als eBook kaufen und genießen: der temporeiche Australien-Thriller »Der Sturm der Rache« von Sandy Curtis wird Leserinnen und Leser von Karen Rose und Lisa Jackson begeistern! Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wie gut kennen wir die Menschen, denen wir am nächsten sind? Sein letzter Einsatz hat ihn schwer mitgenommen – nun muss Mark, Undercoveragent der australischen Regierung, auch noch den rätselhaften Tod seines Vaters verkraften. War dieser in dunkle Machenschaften verstrickt, oder ist er von einem Verbrechen eingeholt worden, das vor langer Zeit begangen wurde? Die Spuren führen Mark zu einer Firma, die offenbar viele Geheimnisse zu verbergen hat – und zu Julie, der Tochter des Besitzers, in die er seit seiner Jugend unglücklich verliebt ist… Während die lang verdrängten Gefühle zwischen den beiden wieder aufflammen, muss Mark sich die immer drängendere Frage stellen: Kann er Julie vertrauen, oder ist sie nur der Köder in einem Netz aus Schuld, Gier und düsteren Geheimnissen?
»Die Thriller von Sandy Curtis sind stets clever konstruiert – und die Hauptfiguren in ihrem neuen Werk sind vielleicht die besten, die wir bisher kennenlernen durften!« Bundaberg Regional
Über die Autorin:
Sandy Curtis lebt an der Küste des australischen Bundesstaates Queensland. Die Mutter von drei erwachsenen Kindern hat in den verschiedensten Bereichen gearbeitet – doch seit sie als junges Mädchen ihre erste Geschichte geschrieben hat und es ihr sogar gelang, für die Recherche dazu von der örtlichen Polizei eingeladen zu werden, stand ihr Herzenswunsch fest, als Spannungsautorin erfolgreich zu werden.
Mehr Informationen über die Autorin und ihre Thriller finden sich auf ihrer Website: www.sandycurtis.com
Bei dotbooks erschienen Sandy Curtis‘ Thriller der locker zusammenhängenden Spannungsserie »Australian Heat« mit den unabhängig voneinander lesenswerten Bänden »Das Tal der Angst«, »Der Fluss des Vergessens«, »Im Meer der Furcht«, »Am Abgrund der Vergeltung« und »Im Sog der Täuschung«.
***
eBook-Neuausgabe Juni 2021
Die australische Originalausgabe erschien erstmals 2007 unter dem Originaltitel »Fatal Flaw«.
Copyright © der australischen Originalausgabe 2007 by Sandy Curtis
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2009 by Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, Memmingen, unter Verwendung eines Bildmotivs von Shutterstock/f11photo.
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96655-357-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Sturm der Rache« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Sandy Curtis
Der Sturm der Rache
Australien-Thriller
Aus dem Englischen von Cécile G. Lecaux
dotbooks.
Prolog
»Du solltest vorsichtiger sein. Deine Hintertür war nicht abgeschlossen.«
Die Stimme aus der Diele bereitete Gordon Talberts Nickerchen ein jähes Ende. Er schreckte hoch und hätte beinahe aufgeschrien, als ein stechender Schmerz seinen Nacken durchzuckte.
Ein Schatten trat aus dem dunklen Flur ins Wohnzimmer.
»Was zum ...« Gordon verstummte abrupt, als er sah, dass die Gestalt Toby, seinen achtzehn Monate alten Enkelsohn, im Arm hielt. Die Augen des kleinen Jungen standen einen Spaltbreit offen, aber der kleine Herzmund nuckelte im Schlaf an einem imaginären Schnuller. Er spürte weder den Arm um seinen Oberkörper noch die Messerspitze an seinem zarten Hals.
Gordons Lippen zuckten, aber er gab keinen Laut von sich. Mit zitternden Knien stand er von der Liege auf und vergewisserte sich, dass seine Beine ihn auch trugen, ehe er einen Schritt nach vorn machte.
»Das ist nah genug. Wenn du noch näher kommst, könnte ich in Panik geraten und etwas tun, das du später bereust.« Der freundliche, fast spöttische Tonfall ließ darauf schließen, dass die Drohung nicht ganz ernst gemeint war.
Gordon blieb stehen. Er versuchte fieberhaft, das Geschehen zu begreifen, jedoch vergeblich. »Wer sind Sie?«, fragte er schließlich. »Was wollen Sie? Was soll das alles?«
Der Eindringling lächelte. Seine Zähne schimmerten weiß im gedämpften Licht. »Wie heißt es noch gleich in einem alten Kinoklassiker? Ich bin dein schlimmster Albtraum.«
»Ich kenne Sie doch nicht einmal!«, protestierte Gordon hilflos.
»O doch, wenn es auch einundvierzig Jahre her ist. Damals hast du zugesehen, wie mein Leben zerstört wurde. Du hast tatenlos zugesehen, wie man mich gequält und erniedrigt hat.«
Gordon fühlte, wie ihm alles Blut aus dem Gesicht wich, und er kämpfte verzweifelt gegen die Erinnerung an, die die Worte heraufbeschworen. »Nein! Nein. Sie ... Du bist nicht ...«
»O ja, ich habe mich verändert. Sehr sogar, wie du siehst.« Der Eindringling verzog abschätzig die Oberlippe. »Aber ich habe nie vergessen.«
»Ich war damals erst fünfzehn«, verteidigte sich Gordon, doch die Schuldgefühle, die er so viele Jahre verdrängt hatte, waren schlagartig wieder da.
»Und ich erst dreizehn. Dreizehn, Gordon. Stell dir vor, dein Sohn hätte mit dreizehn Jahren durchmachen müssen, was ich durchgemacht habe.«
»Aber ich habe dir doch nichts getan.«
»Du hast nicht verhindert, dass man mir etwas antut. Ein weiser Mann hat einmal gesagt: ›Unrecht geschieht, wenn rechtschaffene Menschen es geschehen lassen‹«, zitierte die Gestalt sarkastisch, und Gordon zuckte zusammen, als er den Slogan aus seinen Wahlkampftagen wiedererkannte. »Du hast es geschehen lassen, Gordon Talbert«, fuhr die anklagende Stimme fort. »Und das hat den Verlauf meines Lebens nachhaltig und unwiderruflich verändert.«
»Ich habe am nächsten Tag versucht, zu dir vorzudringen. Ich wollte dir sagen, wie leid mir das alles tut, wollte fragen, wie ich dir helfen kann ...«
»Zu wenig und zu spät.« Die Hand mit dem Messer bewegte sich leicht, und das Kind zuckte zusammen, als es die Spitze der Messerklinge an der Kehle spürte. »Aber ich bin trotz allem geneigt, dir gegenüber großherziger zu sein, als du es seinerzeit gewesen bist. Du kommst erst an zweiter Stelle.«
»An zweiter Stelle?« Blankes Entsetzen lähmte Gordon, als Toby die Augen aufschlug und versuchte, sich zu befreien. Er war ein kräftiges Kleinkind, doch er wurde unerbittlich festgehalten, und die schmale Messerklinge verharrte, wo sie war.
»Mit Ethan habe ich bereits abgerechnet. Er war noch derselbe Feigling wie vor einundvierzig Jahren. Er hat gewinselt, Gordon. Gewinselt wie ein Hund und mich angefleht, ihn zu verschonen.«
Bittere Galle verätzte Gordons Kehle. Er wollte sich auf sein Gegenüber stürzen, ihm Toby entreißen und das Kind vor dem abgrundtiefen Hass seines Peinigers beschützen. Er trat einen weiteren Schritt nach vorn.
Die Messerspitze grub sich noch etwas tiefer in das zarte Fleisch.
Toby heulte auf.
»Nicht! Bitte!« Gordon hob beschwichtigend beide Hände und wich zurück. »Ich tue alles, was du willst, aber tu dem Jungen nichts zuleide. Er kann doch nichts dafür.«
Langsam entfernte sich die Klinge von der Kehle des Kindes, aber Toby beruhigte sich nicht, sondern schluchzte verzweifelt weiter. Tränen rollten über seine runden Wangen und tropften auf die Hand des Mannes, der ihn immer noch mit eisernem Griff festhielt.
»Hol den Schlüssel zu deinem Waffenschrank«, befahl der Eindringling.
»Was?«
»Dein Waffenschrank. Schließ ihn auf!«
Gordon ging in die Küche, öffnete mit zitternden Händen einen Eck-Hängeschrank, langte hinein und nahm einen Schlüsselbund von einem Haken. Seine Gedanken überschlugen sich. Fieberhaft überlegte er, was er tun konnte, um Toby vor Schaden zu bewahren. Küchenmesser. Im Messerblock. Nein ... Er wäre nicht schnell genug. Die schmale Klinge könnte Tobys Kehle aufschlitzen, noch bevor er ein Messer aus dem Holzblock gezogen hätte. Er ging hinüber in die Waschküche, gefolgt von dem Mann mit dem Kind, der auf der Schwelle stehen blieb, während Gordon den Wäscheschrank öffnete und den darin verborgenen Wandsafe aufsperrte. Im Inneren lag der Kasten mit seiner Pistole.
»Nimm die Waffe heraus.«
Er klappte den Deckel auf. Die Pistole lag schwer und kalt in seiner Hand.
»Lade sie. Auf der Waschmaschine findest du eine Patrone.«
Gordon schaute sich um. Tatsächlich, dort stand eine Patrone, aufrecht wie ein Miniaturmonument. Das hier war keine Affekthandlung. Alles war sorgfältig geplant. Seine Panik wuchs, bis er das Gefühl hatte zu ersticken.
Toby ruderte vergeblich mit den kleinen Armen und trat um sich. Das Gesicht über dem Kopf des Kindes glühte förmlich vor Hass, und Gordon war klar, dass er alles tun musste, was von ihm verlangt wurde, um Tobys Leben zu schützen. Obwohl seine Finger feucht und glitschig waren vom Angstschweiß, gelang es ihm, die Patrone in die Kammer zu schieben.
»Gut. Jetzt hast du die Wahl.«
Die Wahl? Gordon klammerte sich an dieses Wort wie an einen Strohhalm, hin- und hergerissen zwischen Hoffnung und Argwohn.
»Du kannst versuchen, mich zu erschießen, und hoffen, so schnell und treffsicher zu sein, dass ich nicht mehr dazu komme, dem Kleinen die Kehle durchzuschneiden, oder aber ...«
»Du kannst kein unschuldiges Kind umbringen.« Es war mehr ein Flehen als ein Befehl, und Gordon hörte die Panik in seiner eigenen Stimme, als die Worte aus ihm hervorsprudelten.
Sein Gegenüber lachte kalt. »Du hast ja keine Ahnung, wozu ich alles fähig bin. Aber du weißt ja noch gar nicht, wie die Alternative lautet.«
Gordons Mund war plötzlich staubtrocken. »Ich höre«, krächzte er.
»Wenn du den Lauf in den Mund steckst und abdrückst, verspreche ich, den Kleinen unversehrt in sein Bettchen zurückzubringen.«
»W... wie bitte?«
»Du hast mich verstanden. Ich will, dass du dich erschießt. Ich wurde dahingehend erzogen, an göttliche Gerechtigkeit zu glauben, und da dachte ich mir, ich helfe etwas nach. Mir scheint, der liebe Gott ist etwas langsam.«
Die Absurdität der Situation lähmte Gordon beinahe. Obgleich er seit Jahren Mitglied im örtlichen Sportschützenverein war, war nie ein besonders guter Schütze aus ihm geworden, und die Wahrscheinlichkeit, dass es ihm gelingen würde, das Gesicht zu treffen, das zur Hälfte von Tobys blondem Haarschopf verdeckt wurde, war verschwindend gering. So wie seine Hände zitterten, würde er vermutlich eher das Kind treffen. Er könnte natürlich auf die Beine zielen ... Aber auch wenn er traf, durfte er nicht hoffen, bei den beiden zu sein, bevor sie zu Boden gingen, und er stellte sich vor, wie das Messer sich in Tobys Kehle bohrte, während der Angreifer ihn unter sich begrub.
Schweiß strömte aus jeder Pore seines Körpers. Er hörte das hämische Gelächter. »Du hast drei Sekunden Zeit, dich zu entscheiden. Eins ...«
Wie in einem Albtraum, dem er machtlos ausgeliefert war, stand Gordon kraftlos und zitternd da. Die Pistole in seiner Hand schien eine Tonne zu wiegen. Ich kann nicht sicher sein, dass Toby nichts passiert, ganz egal, wie ich mich entscheide.
»Zwei ...« Das Messer ritzte die Haut. Toby schrie, und weitere Tränen rannen über seine geröteten Wangen.
Gordon dachte an seine Frau und seine Tochter. Er malte sich aus, wie sie Tobys leblosen Körper fanden, fühlte, wie ihr Schmerz sein Herz durchbohrte, und die Last seiner eigenen Schuld am Tod des Kindes. Wenn ich ihn in den Kopf treffe, überlegte er fieberhaft, wird er von der Wucht des Einschlags zurückgeschleudert werden, und damit wäre Toby außer Gefahr.
»Dr...«
Gordon hob die Waffe.
Kapitel 1
Mit einem dankbaren Seufzen stellte Julie Evans ihren Kaffee auf dem Tisch der Cafeteria ab und ließ sich auf einen Stuhl fallen. Sie warf einen Blick auf die Uhr an der Wand: gleich elf, wie sie grimmig feststellte. Zum Frühstück hatte es nur eine Scheibe Toast und ein paar Schlucke Tee gegeben, und sie hatte eigentlich damit gerechnet, etwas früher eine Pause einlegen zu können, um den Akku wieder aufzuladen. Aber ihr Vater war heute Morgen noch unleidlicher gewesen als sonst, und sie war froh, zumindest für kurze Zeit von seiner schlechten Laune verschont zu bleiben.
Sie wickelte das Salat-Schinken-Brot, das sie auf dem Weg von der Bushaltestelle gekauft hatte, aus dem Papier und griff nach der Tageszeitung. Schockiert erstarrte sie mitten in der Bewegung, das Brot dicht vor dem Mund, die Finger in das Zeitungspapier gekrallt. Langsam legte sie das Brot aus der Hand und las den Artikel von der ersten bis zur letzten Zeile. Hinterher nippte sie an ihrem Kaffee, knabberte abwesend an ihrem Schinkenbrot und starrte dabei wie gebannt auf die Schlagzeile und die Fotos, überwältigt von ungläubiger Trauer. Schließlich stand sie auf und kehrte zurück ins Büro.
»Ist Ray schon zurück?«, fragte sie den Mann mittleren Alters, der dort auf einen Computerschirm starrte und dabei lässig mit der schnurlosen Maus agierte.
Michael Devine hielt den Blick auf den Entwurf gerichtet, der langsam auf dem Monitor Gestalt annahm, und schüttelte den Kopf. Julie seufzte erleichtert. Während der Zeitungsartikel Rays schlechte Laune an diesem Morgen erklären mochte, war dies doch keine Entschuldigung dafür, dass er sie und Michael derart angeraunzt hatte. Nicht zum ersten Mal fragte sie sich, wie Michael es schaffte, sich von Rays scharfer Zunge nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Michael besaß eine beneidenswerte Gelassenheit. Mit seinem dichten grauen Haar, den kantigen Zügen und der glatten Haut, die auch am frühen Abend nur selten einen Hauch von Stoppeln aufwies, war er trotz seines Alters ein attraktiver Mann. Julie war rein zufällig dahintergekommen, dass er älter war, als er zu sein behauptete oder auch aussah, aber sie hatte dieses Wissen für sich behalten. Sie wusste nur zu gut, wie schwer es heutzutage war, Arbeit zu finden, und sie konnte es Michael nicht verdenken, dass er etwas nachgeholfen hatte, um die Stelle bei GalCorp zu bekommen. Immerhin lebte sie selbst ja auch mit einer Lüge.
In der nächsten halben Stunde versuchte Julie, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren, gab es dann jedoch auf. Die Erinnerung ließ sie nicht mehr los und spulte die verschiedensten Szenarien vor ihrem inneren Auge ab.
»Stimmt etwas nicht?« Michael musterte sie besorgt. Sie mochte Michael, aber manchmal empfand sie seine Sensoren auch als leicht irritierend.
»Doch, alles in Ordnung. Ist nur nicht mein Tag heute, und ich komme einfach nicht mit diesem Auftrag zurande.«
»Vielleicht hat dich ja Rays Auftritt heute Morgen aus dem Konzept gebracht.«
»Ray bringt mich regelmäßig aus dem Konzept«, grummelte sie und winkte ab, als Michael den Kopf fragend zur Seite neigte. »Es ist nichts. Ich muss nur mit ihm sprechen.« Ihr Magen verkrampfte sich bei dem Gedanken an die bevorstehende Auseinandersetzung, als sie den Flur hinunterging und den großzügigen offenen Empfangsbereich mit dem geschmackvollen Schreibtisch und der gemütlichen Besucherecke mit dem Couchtisch aus geschnitztem Rosenholz und den samtbezogenen Sesseln betrat. Heute hatte sie keinen Blick für die Gemälde an den Wänden, obgleich ihr sehr bewusst war, dass der Verkauf nur eines dieser Kunstwerke genügen würde, um ein ganzes Jahr lang ihre Hypothekenraten zu bezahlen.
Der Stuhl hinter dem Schreibtisch war leer, und Julie fragte sich, ob Rays Sekretärin gerade bei ihm war. Gaynor Farrell war hübsch und zierlich wie ein Laufsteg-Model, dabei aber in etwa so freundlich wie ein Schleifer im Erziehungslager. Ein Schleifer mit Zahnschmerzen. Manchmal kam es ihr vor, als wäre Gaynor die Verkörperung all dessen, wofür GalCorp stand: hart, unsentimental und mit einer »Du-kannst-mich-mal«-Einstellung gesegnet.
Julie ging ein paar Meter am Empfang vorbei und wollte eben an Ray Galloways Tür klopfen, als ihr auffiel, dass die gar nicht richtig verschlossen war. Sie hielt inne, denn sie hörte zornige Stimmen. Reglos blieb sie vor der Tür stehen und lauschte, aber es dauerte einen Moment, ehe sie verstand, worum es ging.
»Wenn das in die falschen Hände gerät«, knurrte Ray, »können wir das Tak-Lee-Projekt vergessen.«
Das Tak-Lee-Projekt? Julie beugte den Oberkörper leicht vor.
»Aber das ist doch sowieso gelaufen.«
Julie erkannte die raue Stimme von Eric Sweetman, Buchhalter von GalCorp und enger Freund von Ray.
»Sie werden vermutlich etwas Zeit verstreichen lassen, bevor sie sein Büro räumen«, erwiderte Ray. »Das verschafft uns eine Chance, das Sicherheitssystem auszutricksen. Gelingt das nicht, können wir nur hoffen, dass er es zu Hause aufbewahrt hat. Wenn es dort ist, besteht zumindest eine kleine Chance, es zurückzuholen.«
Hätte sie nicht so konzentriert die Unterhaltung der beiden Männer belauscht, hätte sie gehört, wie die Eingangstür zum Empfangsbereich aufglitt.
»Möchten Sie zu Mr. Galloway?« Wie um ihren Worten Nachdruck zu verleihen, klopfte Gaynor Farrell mit dem Kugelschreiber rhythmisch gegen die Akte, die sie in der Hand hielt.
Julie wich hastig einen Schritt zurück. Gaynor besaß die Gabe, andere in unangenehmen Situationen zu überraschen, und so war sie froh, dass ihre Hand noch erhoben war, als hätte sie eben anklopfen wollen. »Ja. Sie waren nicht da, und da dachte ich ...«
»Ich werde Mr. Galloway fragen, ob es ihm gerade passt.« Gaynor verscheuchte Julie mit einer herrischen Geste von der Tür, setzte sich an ihren Schreibtisch und griff nach dem Telefon. »Miss Evans möchte Sie sprechen, Mr. Galloway«, schnurrte sie in den Hörer.
Julie hatte es längst aufgegeben, Gaynor darauf hinzuweisen, dass es Mrs. Evans hieß und nicht Miss, trotzdem ärgerte es sie immer noch, dass die Sekretärin dies nach wie vor demonstrativ ignorierte.
Rays Bürotür schwang auf, und Eric Sweetman nickte Julie mit dem üblichen Stirnrunzeln zu, als er herauskam. Er hatte seine Krawatte gelockert, und sein schmales Gesicht wirkte ungewöhnlich gerötet. Als Buchhalter der Firma wurde Eric eigentlich nur nervös, wenn die Bilanzen nicht stimmten, und Julie überlegte, was es mit dem Tak-Lee-Projekt auf sich haben mochte.
Gaynor führte Julie in Raymond Galloways weiträumiges Büro mit dem traumhaften Panoramablick auf den Brisbane River. Als die Tür mit leisem Klicken hinter ihr zufiel, drängten die Gefühle, die sie bei der Lektüre des Zeitungsartikels übermannt hatten, erneut an die Oberfläche. »Du hast von Gordons Tod gewusst, habe ich recht, Dad? Warum hast du mir nichts gesagt?«
»Wir sind noch in der Firma, Julie.« Seine Lippen saugten an der Zigarre in seinem Mund. »Muss ich dich erst daran erinnern?«
Julies Zornpegel stieg um ein weiteres Grad. »Lass gut sein, Ray.« Sie betrachtete den neutralen Ausdruck auf dem eckigen Gesicht ihres Vaters und wusste, dass er mit ihr Katz und Maus spielte. Sie verkniff sich die scharfe Erwiderung, die verraten hätte, dass sein Spielchen Erfolg hatte. »Hast du Gordons Frau angerufen? Weißt du, wie es seinen Angehörigen geht?«
Ray Galloway lehnte sich entspannt in seinen bequemen Chefsessel zurück und drehte diesen leicht zur Seite, sodass er die Füße auf die Kante seines riesigen Eichenschreibtisches legen konnte. Er legte die Zigarre in einen Aschenbecher und musterte Julie über die dachförmig aneinandergelegten Finger beider Hände hinweg. »Ich habe Claire heute Morgen angerufen und ihr mein Beileid ausgesprochen.«
Hiernach entstand eine Pause, die sich scheinbar endlos in die Länge zog.
»Und? Wie geht es ihr?«
»Wie du dir denken kannst, ist sie ziemlich verstört.«
Eine Welle der Hilflosigkeit stieg in ihr auf. Sofern sie je geglaubt hatte, dass eine Beziehung allen Widrigkeiten des Lebens standhalten konnte, dann dank Gordon und Claire Talbert. Und jetzt war Gordon tot.
»Du gehst zur Beerdigung?« Eigentlich war es mehr eine Feststellung als eine Frage. Umso schockierter war sie, als Ray bloß mit den Schultern zuckte. Julie gelang es nur schwer, die Frage zurückzuhalten, die sich ihr aufdrängte. Stattdessen holte sie tief Luft. »Also ich gehe auf jeden Fall hin.«
»Ich weiß noch nicht, ob du Urlaub bekommst.«
Trotz des freundlichen Tonfalls entging Julie die verborgene Drohung nicht. »Du kannst mich ja feuern.« Hierauf machte sie auf dem Absatz kehrt und verließ das Büro.
Der Berg schien noch ebenso weit entfernt zu sein wie bei seinem Aufbruch früh am Morgen. Majestätisch und unerreichbar ragte er in der Ferne auf. Zumindest kam es Mark Talbert so vor. Beinahe ein Symbol des Friedens, den er auf seiner Wanderung suchte, der ihm jedoch bislang nicht beschieden war.
Schweiß rann ihm über Gesicht und Rücken und durchweichte sein Hemd und die Gürteltasche, die er über der khakifarbenen Hose trug. Er schmeckte das Salz auf seinen Lippen. Schon den zweiten Tag in Folge zweifelte er, ob sein Entschluss, sich in der frühen Märzhitze von Queensland an den Bicentennial National Trail heranzuwagen, wirklich vernünftig gewesen war. Die angenehm milden Temperaturen bei seinem Aufbruch vor einer Woche waren sengender Hitze gewichen, und auch die Nächte brachten kaum Kühlung, sodass Mark froh war, wenigstens nicht von Cooktown im tropischen Norden aus aufgebrochen zu sein.
Eine Gruppe Wanderer hatte ihn am vierten Tag überholt, aber seitdem hatte er keine Menschenseele mehr zu Gesicht bekommen. Die Einsamkeit kam ihm allerdings gerade recht. Eigentlich hätte sie ihm Zeit zum Nachdenken verschaffen sollen, Zeit, sich mit der neuen Rastlosigkeit auseinanderzusetzen, aber stattdessen hatte er sich ganz dem Rhythmus der Wanderung hingegeben, der Hitze, die seine Sinne einlullte, und dem ununterbrochenen Konzert der Zikaden, das sein Denken überlagerte.
Erst abends, wenn er am Lagerfeuer seine karge Mahlzeit zubereitete, holten ihn die Dämonen wieder ein. Er hatte es aufgegeben, seine Gefühle analysieren zu wollen. Ihm war bewusst, dass der Psychologe recht hatte, dass jeder, der dem Tod so nahe gekommen war wie er, sein Leben neu ordnen musste, aber er wusste auch, dass es mehr war als das.
Sein Vater hatte Verständnis gehabt für sein Bedürfnis, der Route entlang der Ostküste Australiens zu folgen. Zwischen ihnen bestand eine seltene Innigkeit, aber nicht nur das Leid hatte sie zusammengeschweißt, sondern vor allem gegenseitiges Verständnis und Respekt. Als er Mark nach Kilkivan gefahren hatte, dem Ausgangspunkt seiner Wanderung, hatte Gordon Talbert ihm wie immer seine volle Unterstützung signalisiert, wofür Mark ihm über die Maßen dankbar gewesen war.
Eine Stunde später gelangte er an einen hohen Grat, der scheinbar geradewegs bis zum Gipfel führte. Bäume gab es hier nur noch wenige, aber weiter vorn verdichteten sie sich wieder zu einem grünen Teppich, der die Berghänge bis hinunter in die Täler auf beiden Seiten des Grates bedeckte. Er konnte nirgendwo eine menschliche Behausung entdecken, und plötzlich wurde er von einer Welle der Einsamkeit übermannt, die ihn in ihrer Intensität überraschte. Früher hatte er sich nur selten einsam gefühlt, aber in letzter Zeit ...
Er setzte den Rucksack ab, fischte das Handy aus einer Seitentasche und schaltete es ein. Er hatte den Akku geschont, indem er das Telefon immer nur sporadisch eingeschaltet hatte, um seine Nachrichten abzufragen und knapp zu beantworten. Diesmal waren gleich mehrere Nachrichten eingegangen, in denen er aufgefordert wurde, sich dringend bei seinen Eltern zu melden. Er drückte auf »Rückruf«, wartete, eine vertraute Stimme zu hören, und lauschte dann mit wachsender Fassungslosigkeit dem stockenden Bericht seiner von der Trauer überwältigten Stiefmutter.
Sein Instinkt schaltete sich ein. Mark versprach ihr, baldmöglichst heimzukommen, und beendete das Gespräch. Er holte seinen GPS-Empfänger aus dem Rucksack und las die Gebrauchsanweisung durch. Dann wählte er die angegebene Service-Nummer und erklärte der Frau, die sich meldete, dass er dringend einen Hubschrauber bräuchte. Innerhalb weniger Minuten war alles geregelt, und er setzte sich in den Schatten eines Baumes, um auf den Helikopter zu warten. Ihm war bewusst, dass er seine Kompetenzen überschritten hatte, aber das kümmerte ihn nicht im Mindesten. Er hatte fast sein Leben für sein Vaterland gegeben, verglichen damit war ein Hubschrauberflug ja wohl ein Klacks.
Seine Stiefelspitzen waren staubig. Ein winziges Insekt krabbelte über den Arm, den er um die angezogenen Knie geschlungen hatte. Mark beobachtete, wie es sich zwischen den schwarzen Haaren hindurchkämpfte. Seine Armeemütze beengte ihn plötzlich, und er schob sie weiter in den Nacken. Er hatte sein Haar in den vergangenen drei Monaten wachsen lassen, und es fiel ihm weit in die Stirn und wellte sich in Höhe des Hemdkragens.
Er hatte seine Gefühle immer unter Kontrolle gehabt, aber in den nun folgenden Minuten bekam seine Selbstbeherrschung erste Risse und fing an zu bröckeln. Das Gefühl der Beklemmung, das ihm die Luft abschnürte, war jedoch noch stärker, und schließlich tat er etwas, das er seit seinem siebten Lebensjahr nicht mehr getan hatte.
Er weinte bittere Tränen.
Kapitel 2
Als er durch die schmale Calcutta Lane hastete, spürte Yuusuf Haasan die Nerven in seinem schlanken Bauch zucken. Der Gestank nach Stroh, lehmiger Erde, Schweiß, Urin und Fäkalien war jedoch nicht der Grund für sein Unwohlsein, sondern vielmehr die Furcht, jemand könnte erkennen, dass sich in der Tasche, die er bei sich trug, mehr Geld befand, als alle Bewohner des Elendsviertels zusammen in ihrem ganzen Leben verdienen konnten. Menschen und Tiere verließen die verfallenen Gebäude, plaudernd, lachend und rufend, eine nie verstummende Kakofonie, die die Fertigung der religiösen Figuren begleitete, die sie verkaufen mussten, um die Miete für eins der winzigen Zimmer hier aufzubringen.
Nur in einem kleinen Abschnitt der Gasse wurde nicht gearbeitet. Yuusuf wich einem Verkaufsstand aus, der Figuren feilbot, deren rote und goldene Kostümierung sich grell von den welligen schwarzen Haaren und den blauen Armen und Gesichtern der Götzen abhob. Er schaute noch einmal hin. Es waren mehrere Paar Arme. Yuusuf schüttelte den Kopf. Ihm war unbegreiflich, wie man nicht nur mehrere, sondern zudem auch noch so hässliche Gottheiten verehren konnte.
Der Winter war noch nicht vorbei, aber es war bereits mehr nass als kalt. Yuusufs buschige graue Brauen leiteten den Schweiß um, der auf seiner Stirn perlte.
Weiter vorn waren zwei Männer eben damit beschäftigt, Rohlinge aus Stroh mit einer Mischung aus Lehm und Erde zu bedecken. Yuusuf blieb kurz stehen, fasziniert von der üppigen Oberweite der Figur, dann hastete er weiter. Endlich entdeckte er inmitten des Gewirrs von Werbeschildern und schiefen Markisen den Laden, den er suchte. Er trat ein.
Der Verkaufsraum besaß kein Fenster, durch das zusätzliches Tageslicht hätte fallen können, und es dauerte einige Sekunden, bis seine Augen sich so weit an die Dunkelheit gewöhnt hatten, dass er Regale voller Statuetten aller Größen erkennen konnte, dazu eine mitsamt der Bettdecke zusammengerollte Matratze, einen Kerosinofen und diverse Kochutensilien. In dem Laden roch es penetrant nach Curry und Öl, als hätten die Wände die Gerüche so lange absorbiert, bis sie gesättigt waren, und als dünsteten sie diese inzwischen wieder aus. Yuusufs Magen grummelte, wenngleich er selbst nicht genau zu sagen vermochte, ob vor Hunger oder Ekel, und er drückte die Tasche fester an die Brust. Ein hochgewachsener drahtiger junger Mann tauchte an seiner Seite auf. Im eigentümlichen Singsang der Straßenverkäufer pries der junge Bursche seine Waren an und fragte schließlich, wie viele Figuren Yuusuf zu kaufen wünsche. Yuusuf wartete, bis der Redestrom seines Gegenübers versiegte, und sagte dann nur ein einziges Wort. Das einschmeichelnde Lächeln verflog augenblicklich, und der junge Bursche eilte durch eine Innentür hinaus.
Gleich darauf tauchte in ebenjener Tür eine ältere Ausgabe des jungen Mannes auf. »Sie haben das Geld?«
Beinahe hätte Yuusuf sich ein erleichtertes Aufatmen gestattet. Der Deal war etwas heikel gewesen, von einem Mittelsmann arrangiert, und Yuusuf war nicht sicher gewesen, ob auch wirklich alles planmäßig ablaufen würde. Er nickte. Der Mann richtete den Blick auf die Tasche, die Yuusuf bei sich trug, aber der schüttelte den Kopf. »Erst die Ware.«
Der junge Mann kehrte zurück, einen rechteckigen, etwa dreißig Zentimeter langen Kasten in den Händen. Der ältere Mann nahm ihm ihn ab und sagte etwas Unverständliches, woraufhin der jüngere Mann sich in der Eingangstür aufbaute, um zu verhindern, dass jemand hereinkam. Oder dass Yuusuf den Laden verließ. Ohne erkennbares Zögern hielt der ältere Mann Yuusuf den Kasten hin.
Yuusufs ausgestreckte Hand zitterte vor Nervosität und freudiger Erwartung gleichermaßen. Der Metallkasten war schwerer, als seine Größe vermuten ließ, aber damit hatte er gerechnet. Der Verschluss klemmte ein wenig, und er zögerte kurz, ehe er den Deckel ein wenig anhob. Er atmete geräuschvoll ein, klappte den Deckel abrupt wieder zu und reichte dem Mann die Tasche, die er unter den Arm geklemmt hielt.
Der Mann holte die Geldbündel heraus, zählte grob nach und ließ die Scheine dann unter seiner wallenden Kleidung verschwinden. Darauf bedacht, nicht an der Schnalle der Tasche hängen zu bleiben, verstaute Yuusuf den Kasten darin. Mit einem knappen Nicken machte er kehrt und ging zur Tür. Der junge Bursche trat beiseite, und Yuusuf tauchte mit wachsender Euphorie ein in die Hitze, die Gerüche und den Lärm der Straße. Er warf nur einen allerletzten Blick zurück. Der junge Mann stand neben der Tür und schaute ihm nach. Yuusuf fragte sich, ob er den Inhalt des Kastens berührt hatte. Wenn ja, würde er bald mehr Hilfe benötigen, als alle seine mehrarmigen Götzen ihm leisten konnten.
Stunden später fuhr Yuusuf langsam durch dunkle Straßen zu einem reparaturbedürftigen Kai. Alte Holzhäuser drängten sich hier aneinander wie furchtsame Kinder, und eine einzelne Straßenlaterne warf gelbe Lichtflecken zwischen ihre Schatten. Schiffe, groß und klein, aber alle gleichermaßen heruntergekommen, waren entlang des alten Holzsteges vertäut.
Yuusuf parkte den Wagen am unteren Ende des Kais, schaltete die Scheinwerfer aus und wartete. Eine Stunde später wartete er immer noch. Aber Warten war längst fester Bestandteil seines Lebens geworden, sodass seine Geduld gefestigt genug war, um die Aufregung in Schach zu halten, die seine Eingeweide in Aufruhr versetzte.
Minuten später fuhr sein Kopf herum, als jemand an die Seitenscheibe des Wagens klopfte. Ein Pistolenlauf zielte auf ihn. Langsam ließ Yuusuf die Scheibe herunter.
Er murmelte dasselbe Codewort, das der Übergabe des Kastens vorausgegangen war, der, inzwischen sorgfältig zugeklebt und in Tücher gewickelt, in der Tasche verstaut war. Der Mann ließ die Waffe leicht sinken, und Yuusuf reichte ihm die Tasche. »Der Transfer wurde arrangiert«, sagte Yuusuf. »Die Hälfte des Geldes wird noch heute Abend Ihrem Konto gutgeschrieben werden. Den Rest erhalten Sie, sobald Sie Ihre Mission abgeschlossen haben. Von Ihrem Kontakt in Australien werden Sie alle notwendigen Informationen zur Ausführung unseres Vorhabens erhalten. Er darf allerdings nichts von unserer kleinen Überraschung erfahren«, fügte er mit einem schiefen Lächeln hinzu.
Zähne schimmerten weiß in der Dunkelheit, gleich darauf wurde der Mann wieder von den tiefen Schatten verschluckt.
Yuusuf wartete noch einige Minuten, ehe er den Motor anließ und davonfuhr.
Kapitel 3
Ruth Bellamy rückte ihre Sonnenbrille zurecht und zog ihren schlichten schwarzen Hut tiefer in die Stirn, um ihr Gesicht vor der sengenden Sonne zu schützen. Von ihrem Platz ganz hinten in der Menge aus konnte sie nur hin und wieder einen Blick auf die Zeremonie weiter vorn erhaschen, aber sie brauchte gar nicht mehr zu sehen, da die Prozedur ihr nur zu vertraut war.
Der Geistliche hatte seine Lobrede auf den Mann, dessen Sarg langsam in die Grube herabgelassen wurde, abgeschlossen, und in das leise Sirren der Motorrollen mischte sich lediglich das Schluchzen einer jungen Frau, die sich schwer auf den Mann an ihrer Seite stützte.
Ruth veränderte ihre Position geringfügig. Eine ältere Frau mit der gleichen schlanken Silhouette, dem gleichen hellen Teint und blonden Haar tätschelte ihr den Arm, aber es war eine mechanische, beinahe unbewusste Geste. Sie hielt sich sehr gerade und schien die stützende Hand um ihren anderen Arm gar nicht zu registrieren. Ruth vermutete, dass es sich um Gordon Talberts Witwe Claire handelte und bei der jüngeren Frau um ihre Tochter Susan. Sie versuchte, etwas mehr von dem Mann zu sehen, der Claire zur Seite stand, aber in diesem Augenblick bewegte sich die Menge vorwärts und rückte enger zusammen. Frustriert ging sie rechts herum an der Mauer aus Rücken entlang, bis sie realisierte, dass einige Trauergäste vortraten, um eine Rose aus dem Korb zu nehmen, den ein Angestellter des Bestattungsunternehmens in der Hand hielt, und diese auf den Sarg zu werfen.
Ein Lächeln umspielte Ruths Lippen. Es wäre so passend, so ... angebracht, allerdings könnte jemand unter den Anwesenden sie wiedererkennen. Sie zögerte einen Moment und beschloss dann, das Risiko einzugehen. Unter dem breitkrempigen Hut fiel ihr das volle hellbraune Haar in Wellen über die Schultern, und ihr konservatives marineblaues Kostüm würde auch keine weitere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sie war nur eine unter vielen, die gekommen waren, um Gordon Talbert die letzte Ehre zu erweisen. Der Gedanke gefiel ihr, und so reihte sie sich in den Menschenstrom ein, der sich langsam auf das Grab zubewegte.
Als die Rose aus ihrer Hand auf den polierten Sargdeckel fiel, verspürte sie eine Woge der Genugtuung, und sie beugte den Kopf, um ihr Gesicht vor neugierigen Blicken zu schützen. Sollen sie doch denken, dass ich trauere, sagte sie sich und setzte eine entsprechende Miene auf.
Mit gesenktem Haupt wandte sie sich ab und ging, aber ein kurzer Blick genügte, um ihr zu bestätigen, dass es sich bei dem Mann, der Gordon Talberts Witwe stützte, um den Sohn des Verstorbenen handelte. Die Ähnlichkeit war unverkennbar. Das gleiche braune Haar, die gleiche stämmige Statur und ganz ähnliche durchschnittliche Gesichtszüge. Nur die Augen waren irgendwie anders. Ruth konnte nicht sagen, was genau an ihnen anders war, und aus der Entfernung vermochte sie auch ihre Farbe nicht zu erkennen, aber vielleicht lag es an der Wachsamkeit auf seinem Gesicht, daran, wie aufmerksam er jeden der Trauergäste musterte.
Als der Geistliche ein letztes Gebet anstimmte und die Trauergemeinde zu einem kleinen Empfang in einem nahe gelegenen Restaurant einlud, löste Ruth sich von der Menge. Auf der Kuppe eines kleinen Hügels drehte sie sich noch einmal um und schaute zurück auf die sich auflösende Menschenansammlung. Eine Gestalt erregte ihre Aufmerksamkeit, und sie beobachtete, wie Julie Evans auf Mark Talbert und seine Stiefmutter Claire zuging, die nun etwas abseits von den anderen standen. Ruth seufzte. Wie passend, dachte sie bei sich, dass die Kinder der Verdammten auf der Beerdigung zusammenkamen.
Tränen verschleierten Julies Sicht, als Claire sie umarmte.
»Julie, ich freue mich ja so, dich zu sehen! Es ist so schrecklich lange her, seit wir uns das letzte Mal getroffen haben. Wie geht es deiner Mutter?«
»Gut, Claire. Ich soll dir ausrichten, wie sehr sie es bedauert, heute nicht hier sein zu können. Derek macht mit ihr Urlaub in Neuseeland, weißt du.« Julie verspürte eine Welle der Zuneigung für Claire, als sie daran zurückdachte, wie sehr diese ihr während und nach der Scheidung ihrer Eltern zur Seite gestanden hatte. Sie nahm Claires kalte Hand in ihre und drückte sie leicht. Dann wandte sie sich Mark zu.
Er hatte nur eine Sekunde gebraucht, um zu erkennen, dass es sich bei der dunkelhaarigen Frau, die die Hand seiner Stiefmutter hielt, um Julie Evans handelte. Das letzte Mal hatte er sie vor dreizehn Jahren gesehen, und damals war sie schwanger gewesen. Die prallen Rundungen waren vollständig verschwunden. Ihr Gesicht hatte seine engelsgleiche Fülle verloren, und die hohen Wangenknochen betonten umso mehr ihre blassgrünen Augen. Augen, die ihm jetzt verrieten, dass sie um das Ausmaß seines Schmerzes wusste.
Er nahm ihre Hand und hielt sie länger fest, als die Höflichkeit es verlangte, aber die Flut der Erinnerungen ließ sich nicht mehr aufhalten, und er brauchte diesen Augenblick und ihre mitfühlenden Worte.
»Schön, dich zu sehen, Mark. Es tut mir ja so leid wegen deines Vaters!« In ihrer Stimme lag aufrichtige Wärme, und nach den zahlreichen Plattitüden, die er sich aus dem politischen Lager hatte anhören müssen sowie von alten Freunden, die mehr aus Pflichtgefühl gekommen waren denn aus aufrichtiger Anteilnahme, berührte ihn dies mehr, als er erwartet hätte.
»Danke, dass du gekommen bist, Julie. Ich ... es bedeutet mir viel.« Er war selbst überrascht davon, wie ernst es ihm damit war. So viele der Trauergäste waren ihm gänzlich fremd gewesen, und das hatte ihm noch einmal vor Augen geführt, wie sehr er sich seiner Familie entfremdet hatte. Er lebte drüben in Canberra in einer völlig anderen Welt, und inzwischen war er nicht mehr sicher, ob er dorthin zurückkehren wollte. Eine Stimme unterbrach seine Gedanken.
»Mum, wir sollten jetzt gehen.«
Julie wandte sich der jungen Frau zu, die sich ihnen näherte, und lächelte herzlich. Susan war zwar Marks Halbschwester, kam jedoch ganz nach ihrer Mutter. Sie war schlank und blond wie Claire und besaß den gleichen zierlichen Körperbau und eine ganz ähnliche weiche Stimme. Sie starrte Julie an, als sähe sie sie zum ersten Mal.
»Julie? Julie Evans?« Sie umarmte sie. »Wie nett von dir zu kommen. Dad ...« Ihre Stimme versagte, und sie wischte sich die Tränen aus den Augenwinkeln. »Dad hat dich sehr gern gehabt.«
»Und ich ihn, Susan.«
»Komm doch bitte mit zum Essen. Mark und du habt euch doch sicher viel zu erzählen.«
Julie schüttelte den Kopf. »Ich bin mit dem Bus gekommen. Ich fürchte, ich kann nicht ...«
»Mark kann dich doch heimfahren«, wischte Claire ihren Einwand beiseite. »Ich fahre mit Susan und Tom.« Sie legte Julie eine Hand auf den Arm. »Bitte, Julie.«
»Danke. Es wäre tatsächlich nett, nach so langer Zeit mal wieder mit euch allen zu plaudern.«
Die Klimaanlage beseitigte rasch die Hitze, die sich in Marks Falcon angestaut hatte. Als er hinter seinem Schwager her zum Restaurant fuhr, war er sich Julies auf dem Beifahrersitz nur zu bewusst, erst recht, als der Rock ihres kurzärmeligen grünen Kostüms beim Überschlagen der Beine höher rutschte. Er zwang sich, den Blick wieder auf den Verkehr zu richten.
»Es hat mir sehr leidgetan, als ich von deiner Scheidung erfahren habe«, sagte er.
»Das braucht dir nicht leidzutun. Es war unausweichlich. Wir haben eigentlich nie wirklich zueinander gepasst. Wäre ich bei meiner Heirat mit Luke nicht so jung gewesen, hätte ich das vermutlich früher erkannt und mir viel Herzschmerz ersparen können.«
Mark wusste nicht recht, was er darauf erwidern sollte. Julie und er waren schon so lange befreundet, dass er sich beinahe im Stich gelassen gefühlt hatte, als sie Luke Evans geheiratet hatte. Aber schon kurz darauf hatte er sich in seine Militärkarriere gestürzt und sich fortan darauf verlassen, dass Claire ihn auf dem Laufenden hielt, was Julie und ihre Familie betraf.
»Ich war bis dahin schon so lange die seelische Krücke meiner Mutter gewesen, dass ich mir richtig orientierungslos vorkam, als sie sich endlich von Dad trennte und Derek heiratete. Du warst damals ja schon nach Canberra gezogen.« Sie warf ihm einen raschen Seitenblick zu. »Nicht, dass du mich je gebraucht hättest, aber ich denke, ich hatte mich daran gewöhnt, dass du immer für mich da warst. Du warst der einzige Mensch in meinem Leben, der sich wirklich für meine Gedanken und Gefühle interessiert hat. Dann lernte ich Luke kennen.« Sie wickelte sich den Riemen ihrer Handtasche um die Finger. »Er war charmant, lustig ... und er brauchte mich. Und ich brauchte das Gefühl, gebraucht zu werden.« Sie verstummte, als Mark auf den Parkplatz des Restaurants abbog. »Es hat lange gedauert, das zu erkennen und abzulegen.«
Mark schaltete den Motor ab und zog den Schlüssel aus dem Zündschloss. »Du irrst dich, weißt du«, sagte er milde. »Damit, dass ich dich nicht gebraucht hätte, meine ich. Vier Jahre meines Lebens warst du der einzige Mensch, mit dem ich sprechen konnte, die Einzige, die verstanden hat, was in mir vorging. Ich glaube, ich habe dir bis heute nie dafür gedankt, Julie.«
Überrascht wandte Julie sich ihm zu. In seinen braunen Augen lag ein verwundbarer Ausdruck, der sie zurückversetzte auf eine andere Beerdigung vor dreißig Jahren. Damals hatte sie mit ihren Eltern zugesehen, wie der Sarg von Marks Mutter aus der Kirche getragen und in den Leichenwagen geschoben wurde. Während die anderen Trauergäste sich um Gordon Talbert geschart hatten, war sie zu Mark gegangen, hatte seine Hand genommen und diese in stummem Trost festgehalten. Er hatte sie mit Tränen in den Augen angesehen und ihre kleinen Finger so fest gedrückt, dass sie beinahe aufgeschrien hätte vor Schmerz.
Ihre Eltern waren befreundet gewesen, aber Mark hatte ganz selbstverständlich mit den anderen Jungen gespielt, wenn die Familien sich gegenseitig besucht hatten, und Julie weitestgehend ignoriert. Der Tod seiner Mutter hatte eine Wende herbeigeführt. Ihre Freundschaft war aus dem beiderseitigen Bedürfnis nach Verständnis heraus entstanden, da Marks Vater seine Trauer im Alkohol ertränkt hatte und Julie sich stets von Neuem Rays Bestrebungen widersetzen musste, ihren Willen zu brechen.
Ruth Bellamy hatte einen Arztbesuch als Ausrede für ihr Fehlen im Büro angegeben. Jetzt hastete sie von der abgeschiedenen öffentlichen Toilette des wenig frequentierten Parks, in der sie sich umgezogen hatte, zurück zu ihrem Wagen, verstaute die Reisetasche im Kofferraum und fuhr davon.
Sie war euphorisch. Gordon Talberts Beerdigung beizuwohnen, war riskant gewesen, aber es hatte sich gelohnt. Sie hatte sich davon überzeugen können, in welchem Maße sein Tod seine Familie getroffen hatte, und sie freute sich schon jetzt auf die Auswirkungen von Ray Galloways Ableben. Noch hatte sie sich nicht weiter mit den näheren Umständen seines Todes beschäftigt. Zuerst sollte Ray noch leiden, so wie sie gelitten hatte, und es gab nur eins auf der Welt, das Ray Galloway mehr liebte als Geld. Erst wenn sie ihm das genommen hatte, was er am meisten liebte, würde sie ihm erlauben zu sterben.
Sie lächelte vor sich hin, während sie sich durch den Freitagnachmittagverkehr in Brisbane kämpfte. Es war leichtsinnig gewesen, Gordon zum Selbstmord zwingen zu wollen. Aber der Ausdruck in seinen Augen hatte ihr seine Absichten verraten. Sie war nach vorn gestürzt und hatte dabei den kleinen Jungen wie ein Schutzschild vor sich gehalten. Der Überraschungsmoment hatte genügt, um ihm erst das Messer in den Bauch zu rammen und anschließend die Kehle durchzuschneiden. Sie hatte den Bewegungsablauf unzählige Male geprobt, nachdem sie ihren Plan ersonnen hatte, und das hatte sich letztlich bezahlt gemacht.
Sie war selbst überrascht gewesen von ihrer emotionalen Distanz, während sie ihm beim Sterben zugesehen hatte. Vielleicht hatte das lieblich duftende Kind in ihren Armen sie von der Euphorie abgelenkt, mit der sie fest gerechnet hatte. Sie hatte die blutbesudelten Handschuhe ausgezogen und in ihre Tasche gestopft, die ebenfalls blutige Kleidung des Kindes gewechselt und den Jungen in sein Bettchen zurückgebracht. Sie war bei ihm geblieben, bis er wieder eingeschlafen war, und hatte anschließend mit ihrem Taschentuch die Pistole abgewischt, die Patrone entfernt und die Waffe in den Safe zurückgelegt. Damit die Polizei annahm, Gordon hätte seine Waffe holen wollen, um sich gegen seinen Angreifer zur Wehr zu setzen, hatte sie den Schlüssel auf dem Fußboden liegen lassen. Dann hatte sie hastig die Schlafzimmerschubladen durchwühlt und Geld und den Schmuck seiner Frau an sich genommen, damit es aussah, als hätte er einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Darauf bedacht, nicht in die Blutlache um Gordon zu treten, hatte sie das Haus durch die Waschküchentür verlassen und diese angelehnt gelassen, um eine überstürzte Flucht vorzutäuschen.
Messer, Schmuck und blutige Kleider waren mit einem befriedigenden klatschenden Geräusch in den Brisbane River eingetaucht, als sie die beschwerte Tasche ins Wasser geworfen hatte.
Jetzt galt es, neue Pläne zu schmieden. Noch zwei weitere Menschen mussten vor Ray sterben. Und ihr Tod sollte Ray Galloway vor Augen führen, dass Kinder immer für die Sünden ihrer Väter büßen mussten.
Mark führte Julie in eine ruhige Ecke des Restaurants, wobei er tunlichst die Grüppchen von Trauergästen mied, deren einziges Bestreben darin zu bestehen schien, sich möglichst große Mengen Wein einzuverleiben, während sie über alles Erdenkliche diskutierten, außer darüber, wer den Platz seines Vaters einnehmen sollte. Dabei war Mark sicher, dass dies und der Mord an Gordon in den vergangenen Tagen das Gesprächsthema gewesen waren. Die politischen Kreise, denen auch sein Vater angehört hatte, waren so klug gewesen, sich für eine kurzfristige Autopsie einzusetzen. Ihnen war daran gelegen, diese unappetitliche Angelegenheit möglichst vor den unausweichlichen Neuwahlen abzuschließen.
Er warf einen Blick auf Claire, seine Schwester und seinen Schwager, die zusammen an einem Tisch saßen. Wenigstens befanden sie sich in Gesellschaft wahrer Freunde. Seine Stiefmutter sah aus, als wäre sie am Ende ihrer Kräfte.
»Möchtest du etwas trinken?«, fragte er, als Julie an einem kleinen Tisch Platz nahm.
»Ein Kaffee wäre schön, aber du kannst ruhig etwas Stärkeres trinken, wenn dir danach ist.« Sie lächelte. »Oder bist du immer noch Abstinenzler?«
»Nicht ganz. Ich habe gelernt, dass in manchen Situationen ein kräftiger Schluck mehr bringt als der schwärzeste Kaffee.«
Er ging hinüber zum Büfett und schenkte ihnen beiden einen Kaffee ein. Als er einen Zuckerwürfel in Julies Tasse gab, wurde ihm bewusst, dass er aus alter Gewohnheit heraus gehandelt hatte, während ihr tatsächlicher Geschmack sich möglicherweise in den vergangenen Jahren verändert hatte. Sie hatten einander so lange so nahegestanden, dass er richtig schockiert war, als er realisierte, dass er sich seit damals niemandem mehr so verbunden gefühlt hatte.
»Du bist mit so großen Ambitionen von hier fortgegangen, Mark«, sagte sie, als er an ihren Tisch zurückkehrte. »Hat sich alles so entwickelt, wie du es dir vorgestellt hast?«
Er dachte eine Weile darüber nach, bevor er antwortete. »In gewisser Hinsicht schon, aber nicht in jeder.« Er sah, dass ihre Mundwinkel zuckten, und wusste, dass sie ihn auslachte. Er erinnerte sich an ihr neckendes Grinsen, als sie damals versucht hatte, ihn von seinen Sorgen abzulenken, und plötzlich bedauerte er, dass er ihre Freundschaft einfach so hatte einschlafen lassen.
»Claire hat meiner Mutter erzählt, du wärst ›in geheimer Mission‹ für die Regierung tätig. Ich dachte mir, das passt zu deiner Verschlossenheit.« Plötzlich veränderte sich ihr Gesichtsausdruck, und sie legte ihre Hand auf die seine. »Bist du glücklich gewesen in den vergangenen Jahren, Mark? Ich habe mich das oft gefragt, weißt du.«
Die Geste mochte Mitgefühl und Sorge ausdrücken, aber die Berührung löste in ihm eine völlig andere Reaktion aus. Wie von selbst streichelte sein Daumen ihre Finger. Langsam drehten sich ihre Hände, so lange, bis sie einander fest umschlossen. »Meine Karriere ist zufriedenstellend verlaufen.« Noch während er die Worte aussprach, wurde ihm bewusst, dass er eine Vergangenheitsform benutzt hatte. Gleichzeit erkannte er, dass »zufriedenstellend« ihm nicht mehr genügte. Er brauchte mehr. Viel mehr.
Er spürte, wie Julie erstarrte. Ihr Blick war auf den Eingang des Lokals gerichtet. Aus reiner Gewohnheit hatte Mark einen Platz gewählt, von dem aus er fast den ganzen Saal überblicken konnte, ohne den Kopf zu drehen.
Ray Galloways einstmals dichtes schwarzes Haar war grau geworden, aber seine selbstbewusste, beinahe arrogante Haltung war noch dieselbe. Er ließ den Blick gleichermaßen wachsam und entspannt durch den Raum wandern, nickte andeutungsweise, als er Julie und Mark entdeckte, und richtete seine Aufmerksamkeit dann auf Claire Talbert. Mark beobachtete, wie Ray eine mitfühlende Miene aufsetzte, bevor er ohne besondere Eile ihren Tisch ansteuerte.
Mark wusste sehr genau, was seine Stiefmutter von Ray Galloway hielt, trotzdem war er nicht überrascht, als Claire Rays Hand ergriff und sich von ihm die Wange küssen ließ. Als Ehefrau eines Politikers hatte sie Schlimmeres ertragen müssen als das.
»Also, das überrascht mich«, brummte Julie.
»Wieso?«
Sie zuckte die Schultern. »Ich hätte nicht gedacht, dass er kommt. Andererseits hatte er das ja vielleicht von Anfang an vor.«
»Glaubst du?« Mark war irritiert von den negativen Schwingungen, die sie aussandte. Von dem Augenblick an, da Claire in Gordon Talberts Leben getreten war, hatte sie sich wunderbar mit Anne Galloway verstanden. Zwischen den beiden Frauen hatte sich eine tiefe Freundschaft entwickelt, der zuliebe Claire Ray toleriert hatte. Während die beiden Männer auch nach Annes und Rays Scheidung nur noch sporadisch Kontakt zueinander gehabt hatten, hatte die Freundschaft der beiden Frauen sogar Annes Wiederheirat und ihren Umzug nach Sydney überdauert.
Julie machte sich längst keine Illusionen mehr, was ihren Vater betraf. »Nein. Wenn mein Vater hier ist, dann nicht aus Anstand oder Respekt, sondern aus irgendeiner ganz eigennützigen Motivation heraus.«
Sie setzten ihre Unterhaltung fort, wenn auch auf weniger persönlicher Ebene, und mieden dabei sorgsam die Umstände um Gordons Tod, aber Mark entging nicht, dass Julies anfängliche Freude über ihr Wiedersehen verflogen war. Sie schaute immer wieder zu ihrem Vater hinüber, der an Claires Seite saß, und die Sorgenfalten auf ihrer Stirn verrieten ihre innere Anspannung.
Eine Viertelstunde später sah Mark, wie Ray sich erhob, Claire aufmunternd die Hand auf die Schulter legte und anschließend betont lässig auf seinen und Julies Tisch zuschlenderte. Mark stand auf. Als er Ray die Hand reichte, stieg ihm der Zigarrengeruch in die Nase, den Rays Anzug verströmte. »Danke, dass du gekommen bist, Ray.«
Rays Lippen lächelten, aber seine Augen blickten kalt, als er Mark die Hand schüttelte. »Dein Vater war mir viele Jahre ein guter Freund, Mark. Ich war es ihm schuldig, ihm die letzte Ehre zu erweisen. Reist du schon bald wieder ab, oder bleibst du eine Weile?«
»Ich denke, Claire wird mich noch ein Weilchen brauchen.«
»Natürlich.« Ray wandte sich Julie zu. »Du kannst mit mir ins Büro zurückfahren.«
Es war kein freundliches Angebot, sondern ein Befehl, und Mark sah das ärgerliche Aufflackern in Julies Augen. Sie nahm Kugelschreiber und Notizblock aus der Handtasche, kritzelte etwas auf das oberste Blatt, riss es heraus und reichte Mark den Zettel.
»Meine Privatnummer. Ich würde unser Gespräch gern fortführen.«
Mark beobachtete, wie sie unnatürlich steif vor Ray herging und das Restaurant verließ.
Mark drückte den Knopf der Fernbedienung und fuhr in die Garage seines zweistöckigen cremefarbenen Elternhauses. Seit seine Stiefmutter jedoch vor einer Woche Gordons Leiche dort gefunden hatte, fühlte sie sich in dem Haus inmitten des fast siebentausend Quadratmeter großen Grundstücks nicht mehr wohl, sodass sie bis auf Weiteres zu Susan und Tom gezogen war.
Das Abendessen bei seiner Schwester war eine freudlose Angelegenheit gewesen, und so war Mark schon früh gegangen, zumal ihn quälende Kopfschmerzen plagten.
Als er den Motor des Falcon abschaltete und per Fernbedienung das Tor hinter sich schloss, widerstand er der Versuchung, den Kopf auf das Lenkrad sinken zu lassen und dem Schmerz nachzugeben. Er stolperte zur Tür, die direkt von der Garage in die Küche führte, und sperrte auf.
Im Haus war es dunkel und kühl, und er empfand die Stille beinahe als wohltuend. Im Mondlicht, das durch das Fenster hereinfiel, nahm er ein Glas aus dem Schrank und füllte es mit Wasser. Auch auf der Treppe verzichtete er auf Licht und knipste erst im Schlafzimmer die Nachttischlampe an, deren warmer Schein ausreichte, um die Tabletten zu finden, die der Arzt ihm verschrieben hatte.
Als er später im Dunkeln auf dem Bett lag und versuchte, Abstand zu gewinnen von dem Hämmern in seinem Kopf, sehnte er sich nach der zärtlichen Berührung einer Frau.
Um drei Uhr nachts waren im Einkaufszentrum nicht einmal mehr die Spinner anzutreffen, die sich einen Spaß daraus machten, mit ihren Reifen schwarze Spuren auf dem Asphalt des Parkplatzes zu hinterlassen. Die Gestalt, die vom angrenzenden Häuserblock herüberschlenderte, schien es nicht sonderlich eilig zu haben. Der Mann war froh, dass das Büro, das er suchte, sich auf der Außenseite des Gebäudekomplexes befand. Das Alarmsystem der gesamten Anlage abzuschalten, wäre ohne umfangreiches Insider-Wissen schlicht unmöglich gewesen, aber er wusste, dass er dort, wo er hinwollte, keine Schwierigkeiten mit den Sicherheitsvorkehrungen haben würde. Zudem sorgte der Winkel, in dem er sich näherte, dafür, dass die Überwachungskamera ihn nicht erfassen konnte.