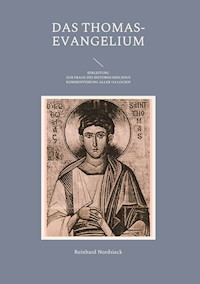
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der vorliegende Kommentar des 1945 in Nag Hammadi entdeckten Thomas-Evangeliums besteht aus einer Einleitung, Kriterien für die Erforschung des historischen Jesus sowie einer ausführlichen Kommentierung aller 114 Logien des Thomas-Evangeliums. Er tritt der Behauptung einer gnostischen Herkunft der Logien entgegen und widerspricht auch der Abhängigkeit des Thomas-Evangeliums von den Synoptikern oder auch dem Johannes-Evangelium. Im Zuge einer redaktions-, traditions- und formgeschichtlichen Untersuchung der einzelnen Logien kommt er vielmehr zu dem Ergebnis, dass das Evangelium aus gegenüber den biblischen Evangelien selbstständigen Traditionen herrührt und in den Raum eines früheren Judenchristentums gehört. Es enthält in einer Reihe von Fällen Überlieferungen, die mit erheblicher Wahrscheinlichkeit auf den historischen Jesus zurückgeführt werden können oder ihm jedenfalls nahe stehen. Reinhard Nordsieck, (1937 - 2021) studierte evangelische Theologie an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal und Rechtswissenschaften an der Universität Köln, danach langjährige Tätigkeit als Richter am Landgericht Wuppertal und Amtsgericht Mettmann, blieb auch im Ruhestand als Autor christlicher Bücher aktiv. Herausgeber: Hans-Jürgen Sträter, Adlerstein Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 850
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
5. durchgesehene und erweiterte Auflage 2021, mit Liste authentischer Jesus-Worte
INHALT
A. EINLEITUNG
B. ZUR FRAGE DES HISTORISCHEN JESUS
C. KOMMENTAR
D. ANHANG: LISTE AUTHENTISCHER JESUS-WORTE
E. LITERATUR
A. EINLEITUNG
Die vorliegende Arbeit beabsichtigt, das 1945 in Nag Hammadi / Oberägypten entdeckte Thomas-Evangelium (EvThom) zu kommentieren und dabei besonders auch historisch-kritisch zu überprüfen, ob und in welchem Umfang es Traditionen enthält, die auf den historischen Jesus zurückgeführt werden können. Ich gehe insofern davon aus, wie sich auch im Laufe der Arbeit im einzelnen ergeben wird, dass das Thomas-Evangelium ein hohes Alter und damit auch einen erheblichen Grad an Authentizität aufweist, woraus sich auch eine Nähe zum historischen Jesus ergeben kann. Dafür sprechen eine Reihe von Umständen, die im folgenden einleitend ausgeführt werden sollen:
1. Der in Nag Hammadi von einem ägyptischen Bauern aufgefundene Codex II aus insgesamt 13 koptischen Papyrus-Codices, in dem u.a. das Thomas-Evangelium enthalten war (NHC II, 2), wird nach paläografischen und sprachlichen Feststellungen auf ca. 350 - 400 n.C. datiert. Das EvThom ist in koptischer Sprache verfasst, und zwar in sahidischem Dialekt und mit achmimischen und subachmimischen Einschlägen. Es wird in der Subscriptio als „Evangelium nach Thomas“ bezeichnet, wobei die Einleitung (das Incipit) diesen Titel bestätigt. Es ist anzunehmen, dass die gefundene Handschrift noch eine bedeutend ältere koptische Vorlage gehabt hat (s. dazu näher L. LEIPOLDT, EvThom, 1967, 1ff; B. BLATZ in W.Schneemelcher, NtApokr, I, 6.A., 1990, 93ff m.w.N.).
In den Jahren 1897 und 1903 wurden von A.P. GRENFELL und A.S. HUNT im mittelägyptischen Oxyrhynchos drei Papyri, die sog. Oxyrhynchos-Papyri (POxy) Nr. 654, 1 und 655 aufgefunden, die, besonders aufgrund paläografischer Beobachtungen, wiederum älter, nämlich auf ca. 200 - 250 n.C. zu datieren sind. Sie enthielten die Logien 1-7 (Nr. 654), 26-33, 77 S.2/3 (Nr. 1) und 24, 36-39 (Nr. 655) des EvThom in griechischer Sprache, allerdings mit kleineren Abweichungen von der Fassung des EvThom aus Nag Hammadi. Diese muss aus einer vom Griechischen ins Koptische übersetzten Version herrühren. Zwischen der griechischen und der koptischen Fassung des EvThom ist danach eine Entwicklung des Textes anzunehmen. Die textlichen Veränderungen vom griechischen zum koptischen Text sind freilich durchweg unbedeutend und wenig sinnverändernd. Es handelt sich um kleinere Zusätze und inhaltliche Verschiebungen, allerdings mit folgenden wichtigen Ausnahmen, s. bei Log 2, 3, 4, 5, 6, 30/77, 36. Im übrigen weisen die griechischen POxy-Versionen, die nach GRENFELL und HUNT gemäß ihrem Inhalt und ihrer Sprache aus der Zeit von ca. 100 - 140 n.C. stammen müssen, auf noch frühere schriftliche oder mündliche Quellen hin, wie noch auszuführen sein wird (zu den Papyri im einzelnen, s. die Obg., Logia Jesou: Sayings of Our Lord, 1897 u. New Sayings of Jesus and Fragment of a Lost Gospel from Oxyrhynchus, 1904; ferner H.W. ATTRIDGE, The Greek Fragments, in B. Layton, Nag Hammadi Codex II, 2-7, pp., 1989; J.A. FITZMYER, The Oxyrhynchus Logoi of Jesus and the Coptic Gospel According to Thomas, ThSt 20, 1959, 505ff; R.A. KRAFT, Oxyrhynchos Papyrus 655 Reconsidered, HThR 54, 1961, 252ff; O. HOFIUS, Das koptische Thomasevangelium und die Oxyrhynchus-Papyri Nr. 1, 654 und 655, EvTh 20, 1960, 21ff. 122ff und D. LÜHRMANN - E. SCHLARB, Fragmente apokryph gewordener Evangelien, 2000, 112ff sowie kritisch dazu W. EISELE, Welcher Thomas?, 2010).
Sonstige Bezeugungen des EvThom kennen wir u.a. auch noch von den Kirchenvätern. So von Hippolyt (ca. 160-235; Ref V 7,20), der eine alternative spätere Lesart von Log 4 zitiert, ferner von Origenes (ca. 185-253/4; Luc hom 1), von Euseb (ca. 263-339; KG III 25,6) und von Kyrill von Jerusalem (ca. 348; Cat 4,36 u. 6,31). Sie nennen das EvThom unter den heterodoxen Evangelien, sind allerdings inhaltlich sonst wenig ergiebig (näher dazu auch BLATZ, s.o., 93ff; S. GATHERCOLE, GosThom, 65ff). Als weitere indirekte Bezeugungen kommen auch noch die Thomas-Akten (ActThom, ca 200-250), das Thomas-Buch (LibThom, von ähnl. Alter) und die Pistis Sophia (PS, ca. 250-350) in Betracht; nach der letzteren hat Jesus seinen Jüngern Philippus, Thomas und Matthäus befohlen, seine Reden aufzuschreiben.
2. Das EvThom hat nicht die Form später gnostischer Exegese (wie z.B. das Evangelium Veritatis, EvVer, ca. 150 n.C.) oder gnostischer Offenbarungsschriften (wie etwa das Apokryphon des Johannes, Apokr Joh), obwohl es wie diese in einer gnostischen Codex-Sammlung gefunden wurde. Es hat aber auch nicht die entwickelte Struktur der kanonischen Evangelien, weder die des um 100 - 110 entstandenen Johannes (Joh)-Evangeliums, noch die der früher, zwischen ca. 64 - 90 verfassten Synoptiker Markus (Mk), Matthäus (Mt) und Lukas (Lk). Es hat vielmehr die Form einer losen Aneinanderreihung von 114 Jesus zugeschriebenen Aussprüchen, nämlich Logien (weisheitlichen und apokalyptischen Inhalts sowie Gesetzes- und Ich-Worte), Gleichnissen, Dialogen und kleinen Szenen, die in einem Jesuswort gipfeln. Diese steht in auffälliger Analogie zur sog. Logienquelle der Synoptiker (Q), im weiteren Sinn auch zu anderen Spruchsammlungen wie den jüdischen „Sprüchen der Väter“ Pirqe Abot, Sammlungen jüdischer Weisheitsworte und Aussprüchen griechischer Philosophen, z.B. nach Diogenes Laertius. Die auf die Zeit um 40 - spätestens 70 zu datierende, aus dem Matthäus- und Lukas-Evangelium rekonstruierte Spruchsammlung Q, die wiederum wahrscheinlich aus mehreren später verbundenen kleineren Sammlungen nebst Hinzufügungen und Zusätzen zusammengesetzt war, gilt nach herrschender Auffassung als die älteste literarische Gattung der evangelischen Überlieferung. Sie wird als Vorstufe zu den Synoptikern Matthäus und Lukas angesehen, die nach der allgemein vertretenen Zweiquellen-Theorie außerdem aus Markus und anderen Sonder-Quellen schöpften (vgl. dazu auch P. VIELHAUER, Geschichte der urchristlichen Literatur, 1975, 311ff. 624ff; H. KÖSTER - J.M. ROBINSON, Entwicklungslinien durch die Welt des frühen Christentums, 1971, 121ff; H. KÖSTER, Einführung in das Neue Testament, 1980, 478ff; ders., Ancient Christian Gospels, 1990, 86ff u.a.).
Diese vorhandene Analogie zur synoptischen Spruchquelle Q wird noch dadurch erhärtet, dass mindestens 22 ganze und 18 Teilabschnitte im EvThom mit dem Spruchgut, das Q zugeschrieben wird, übereinstimmen. KÖSTER zählt in J.E. Goehring pp., Gospel Origins and Christian Beginnings, Festschr. J.M. Robinson, 1990, 55, mindestens 36 und höchstens 45 solche Parallelen. Dabei ist zudem bemerkenswert, dass besonders viele Q-Logien, die zur ältesten Schicht der Q zugrunde liegenden Sammlungen gerechnet werden, Parallelen zu EvThomSprüchen haben (nämlich Lk [Q] 6,20. 21. 22. 30. 39. 41f. 43ff zu Log 54; 69 S.2; 68/69 S.1; 95; 34; 26; 43 u. 45 S.1-4; Lk 9,57; 10,2. 8. 9 zu Log 86; 73; 14 S.4; Lk 11,9; 12,2f. 22ff. 33; 13,18ff zu Log 92/94; 5 S.2; 6 S.5; 33 S.1; 36; 76 S.3; 20 u. Lk 14,26f zu Log 55 u. 101; s. J.S. KLOPPENBORG, Formation, 171ff; Excavating Q, 143ff; P. HOFFMANN - C. HEIL, Q, 16f, m.w.N.; ähnl. schon D. ZELLER, Mahnsprüche, 191). Allerdings sollte das letztere Argument nicht überbewertet werden, da die verschiedenen Schichten von Q (Q1, Q2, Q3) nicht völlig sicher abgrenzbar sind und überdies in verhältnismäßig kurzen Abständen entstanden sein können (s. auch J. SCHRÖTER, Erinnerung, 105ff.118ff). Immerhin ist das EvThom aber auch deshalb der frühesten Schicht von Q sehr ähnlich, weil diese ebenso wie das EvThom nur geringfügige biografisch-historisierende Elemente aufweist, die den späteren Schichten von Q angehören (vgl. etwa Lk [Q] 3,2ff; 4,1ff; 7,1ff; 11,14ff; s. ebenfalls KLOPPENBORG, w.o., u.a.; ferner B.H. MCLEAN in R.A. Piper (Ed.), The Gospel behind the Gospels, 1995, 321ff).
Eine Entsprechung besteht auch zu Logiensammlungen, wie sie (jedenfalls teilweise) dem Markus-Evangelium zugrunde liegen. Das ergibt sich deutlich aus der vielfach unverbundenen Aufreihung von Jesus-Worten in Mk 4,1-34, ferner Mk 8 und 9 (beide am Ende) sowie 13 (s. z.B. H.-W. KUHN, Ältere Sammlungen im Markusevangelium, 1970, 99ff). Auch diese Spruchsammlungen stehen in Analogie zum EvThom bzw. seinen Sammlungen (s. dazu schon O. CULLMANN, Das Thomas-Evangelium und das Alter der in ihm enthaltenen Tradition, 1960, ThLZ 85, 323ff). Nahe stehen der Sammlung in Mk 4 etwa die Logien in EvThom 5,6 S.5 (Mk 4,22), 8 S.4 u.ö. (Mk 4,9/23), 9 (Mk 4,1ff), 20 (Mk 4,30ff), 21 S.9/10 (Mk 4,26ff), 33 S.2/3 (Mk 4,21), 41 (Mk 4,25), 62 (Mk 4,10ff) (s. R. NORTH, Chenoboskion and Q, CBQ 24, 1962, 168ff).
3. Auf eine Herkunft des EvThom aus Spruchsammlungen sehr früher Datierung deutet ferner die Tatsache, dass dessen Sprüche nur einen losen strukturellen Gesamtzusammenhang und in aller Regel keine Rahmenerzählung oder einen sonstigen Kontext haben. Dergleichen kompositionelle Elemente gelten als spätere Entwicklungen, wie sie aus den Evangelien geläufig sind (s. schon K.L. SCHMIDT, Der Rahmen der Geschichte Jesu, 1919 u.a.). Ein Rahmen erscheint nur ansatzweise in Log 13, 22, 60, 61, 99, 113 und 114. Die Logien des EvThom sind vielmehr regelmäßig kurz und isoliert, nur gelegentlich länger, und mehrfach mit offenbar späteren Zusätzen versehen. Sie werden meist durch die Formulierung „Jesus sagte“, „Er sagte“, „Seine Jünger fragten ihn“ o.ä. eingeleitet, manchmal aber auch ohne diese aneinander gereiht (s. BLATZ, s.o., 96f; VIELHAUER, s.o., 623f. u.a.).
Sie sind noch nicht weit von der mündlichen Tradition entfernt. Das ergibt sich daraus, dass sie nirgends auf schriftliche Texte verweisen. Sie sagen nie: „wie geschrieben steht“ (s. Mk 1,1; Mt 2,5; Lk 3,4) oder: „damit das Schriftwort erfüllt werde“ (s. Joh 19,36 u.ä.). Wenn sie sich z.B. inhaltlich auf das Alte Testament berufen, geschieht dies ohne entsprechende Zitation (s. Log 66 beim Wort über den „Eckstein“, i. Ggs. z. Mk 12,10-11, wo Ps 118,22 zitiert wird; s. ferner Log 21 S.9 über die „reife Ernte“, i. Ggs. z. Mk 4,29, m. Bezugnahme a. Joel 3,13) (vgl. dazu V.K. ROBBINS, SBL.SPS 1997, 86ff).
Außerdem sind die einzelnen Logien durchweg durch StichwortZusammenhänge und Wortanklänge, manchmal auch durch motivische bzw. inhaltliche Verknüpfungen miteinander verbunden. Da dies regelmäßig mnemotechnische Hilfsmittel sind, spricht das ebenfalls für frühe, der mündlichen Überlieferung nahestehende Spruchsammlungen (s. CULLMANN, ThLZ 85, 1960, 330f; VIELHAUER, s.o., 623f). Vgl. z.B. Log 1/2 durch „finden“, 2/3 durch „Königsein“, 3/4/5 durch „erkennen“, 5/6 durch „Verborgenes“, 6/7 durch „essen“, 7/8 durch „Mensch“, 8/9/10 durch „werfen“, 10/11 durch den Weltuntergang, 11/12 durch „Himmel“, 12/13 durch den „Gerechten“, 13/14 durch den Gegensatz „berauschen / fasten“, 14/15 durch „beten“, 15/16 durch „Vater“, 16/17 durch „Menschen“ (gelegentlich zweifelhaft; nach Log 17 liegt eine Zäsur mit Stichwort-Abbruch vor). Dann folgt eine erneute Reihe von Stichwort-Zusammenhängen, evtl. von Log 20 bis 35. Hier ist ebenfalls ein stichwortmäßiger Einschnitt (und gleichzeitig der Beginn von POxy 655) zu konstatieren. Von Log 38 bis 48 und Log 51 bis 61 S.1 scheinen weitere Sammlungen vorzuliegen, die den Hauptteil der QParallelen enthalten. Die folgenden Sammlungen könnten sich nach den Stichwort-Zusammenhängen von Log 62 bis 76, Log 78 bis 82, Log 85 bis 113 erstrecken, s. näher die Kommentierungen.
Diese Sammlungen haben rudimentäre kompositorische Gehalte, die sie als redaktionell zusammengehörig erscheinen lassen, so vom „Suchen und Finden des Reichs Gottes“ (Log 2 - 17), vom „Anbruch des Reichs Gottes in und gegenüber der Welt“ (Log 20 - 35), vom „Inhalt der Jüngerschaft in der Gottesherrschaft“ (Log 38 – 48), von „Reich Gottes und Welt als Leben und Tod“ (Log 51 – 61 S.1), von „den Geheimnissen und Anstößen der Gottesherrschaft“ (Log 62 – 76), vom „Reich Gottes und der Person Jesu“ (Log 78 – 82) und vom „Neuen Menschen und der Neuen Welt des Reichs Gottes“ (Log 85 – 113). (s. i.e. die Komm.). Die Schnittpunkte der Sammlungen sind inhaltlich dadurch gekennzeichnet, dass hier vermutlich spätere Stücke mit entwickelterem theologischen Charakter eingefügt worden sind, und zwar wohl zwecks nachträglicher Interpretation und Überformung des ursprünglichen Traditionsguts (s. z.B. Log 1, 18/19, 36/37, 49/50, 61 S.2f, 77, 83f, 114).
Die genannten (Haupt-) Sammlungen enthalten wiederum noch kleinere, aus meist 2, 3, 4 oder mehr zusammenhängenden Logien bestehende (Einzel-) Sammlungen (also Spruch-Paare, z.B. Log 2/3, 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 20/21 usw., Spruch-Gruppen bzw. -Reihen, z.B. Log 2-5, 6-9, 10-17, 20-23, 24-27, 28-31 usw., und strukturierte Kompositionen, s. evtl. 2-9, 10-17, 20-27 usw., deren kompositorische Zusammenstellung jeweils ebenfalls Verkündigungs-Interessen dient, s. näher wieder die Komm.). Die zugrunde liegenden Einzel-Logien weisen außerdem noch gelegentlich (frühere oder spätere) redaktionelle Zusätze und Anhängsel auf, gleichfalls zum Zweck der Interpretation oder zur besonderen Charakterisierung der Worte (s. zu den StichwortZusammenhängen auch E. HAENCHEN, Die Botschaft des Thomas-Evangeliums, 1961, 12f; S.J. PATTERSON, The Gospel of Thomas and Jesus, 1993, 100ff; A. CALLAHAN, No Rhyme or Reason, HTR 90, 4, 1997, 411ff; zur Gliederung im übrigen s. D.H. TRIPP, The Aim ot the „Gospel of Thomas“, ExpTim 92, 1980/1, 41ff; W.E. ARNAL, The Rhetoric of Marginality, HTR 88, 1995, 471ff; J.-D. KAESTLI, L’Utilisation de l’ Évangile de Thomas dans la Recherche actuelle sur les Paroles de Jésus, in D. Marguerat (Hg.), Jésus de Nazareth, 1998, 373ff; A.D. DE CONICK, The Original Gospel of Thomas, VigChr 2, 2002, 167ff u. R. NORDSIECK, BZ 52,2, 2008, 174ff).
Für das Vorliegen dieser mehreren Sammlungen spricht ferner das häufige Vorkommen von (ganzen oder teilweisen) Dubletten. So in Log 11 S.1.2/111 S.1.2, 21 S.5/103, 41/70, 55/101, 56/80, 81/110, im weiteren Sinn auch in Log 2/92/94, 3/51/113, 38 S.1/92 S.2, 22 S.4ff/48/106, 87/112.
Bemerkenswert ist, dass zum Ende des EvThom hin die Dubletten auffällig zunehmen; diese scheinen theologisch oft auch weiter entwickelt zu sein. Auch andere Eigenarten zeigen sich in den letzten Sammlungen: Der Weckruf lautet in Log 8,21,24: „Wer Ohren hat zu hören, soll hören“, dagegen in Log 63,65,96: „Wer Ohren hat, soll hören“. Das Reich Gottes heißt in Log 3,20,54: „Reich der Himmel“, in Log 57,76,96,97,98,99,113: „Reich des Vaters“ (im übrigen kommt auch einfach „Reich“ vor). Auch diese Besonderheiten verstärken die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Sammlungen von Logien vorliegen, die vielleicht nach und nach entstanden und miteinander verknüpft worden sind.
Die Dubletten sind insgesamt charakteristische Anzeichen dafür, dass verschiedene Überlieferungen und daraus gespeiste Sammlungen über ein und dasselbe Wort anzunehmen sind. Sie sind offenbar später, evtl. wegen sekundärer Veränderungen, vom Bearbeiter bzw. Endredaktor nicht als solche erkannt worden und im Gesamtbestand aus verschiedenen redaktionellen Gründen verblieben (vgl. auch CULLMANN, s.o., 328; VIELHAUER, s.o., 624f u.a.; abw. J.M. ASGEIRSSON, Arguments and Audience(s) in the GosThom, SBL.SPS 36, 1997, 47ff u. 1998, 325ff, der die Dubletten für rhetorische Konstruktionen hält, was jedoch nur einen Teilaspekt von ihnen beleuchtet und ihrer Traditionsgeschichte nicht gerecht wird).
Zusammengefasst liegt bei allen genannten Aspekten eine Verwandtschaft des EvThom mit der Spruchquelle Q vor, bei der ebenfalls dürftige Rahmung, Stichwort-Zusammenhänge und Dubletten vorkommen. Auch die kompositorische Gestaltung von Q folgt ähnlichen Gesetzmäßigkeiten (s. z.B. H. SCHÜRMANN in Festschr. G. Schneider, 1991, 325ff), wenn auch zeitliche und örtliche Umstände bei Q stärker bestimmt sind. Die Tatsache, dass die Logien des EvThom (im Gegensatz zu Q) regelmäßig mit „Jesus sagte“ o.ä. eingeleitet sind, ist ohne Bedeutung, da vermutlich auch bei Q solche Markierungen ursprünglich vorhanden waren, aber später bei der Aufnahme in die Evangelien fortgefallen sind (s. schon BULTMANN, Tradition, 349).
4. Das EvThom kann nach im einzelnen noch zu begründender Auffassung nicht als später pseudepigrapher Auszug aus den Synoptikern zuzüglich anderer Quellen wie dem Johannes-Evangelium oder apokryphen Evangelien angesehen werden. Das folgt daraus, dass insbesondere die den synoptischen Evangelien entsprechenden Stücke zum größten Teil keine Anzeichen der speziellen und charakteristischen redaktionellen Arbeit der Evangelisten zeigen, wie die Kommentierungen i.e. nachweisen werden. Außerdem sind die Stücke im EvThom nicht nur von der Redaktion der Evangelisten unabhängig, sondern auch so verstreut, als kämen sie „aus einer Pfefferdose“ (so WILSON). Sie ermangeln der Reihenfolge in den Evangelien, aber auch derjenigen in Q oder dem synoptischen Sondergut, wie B. SOLAGES, L’Évangile de Thomas et les évangiles canoniques, BLE 80, 1979, 102ff aufgewiesen hat. Beispielhaft ist dies etwa bei den sog. Seligpreisungen der Bergpredigt der Fall, die in Mt 5 bzw. Lk 6 in typischer Weise redaktionell geordnet sind, jedoch im EvThom (s. Log 54,69 S.2,69 S.1, 68) ganz unabhängig davon erscheinen. Die Logien des EvThom entbehren ferner in der Regel einer gezielten, etwa stilisierenden oder gar mystifizierenden inhaltlichen Abänderung. Die Stellen haben auch keineswegs den Charakter einer nachträglichen Bearbeitung der Synoptiker oder des JohEv; denn auch deren Aufbaustrukturen fehlen im EvThom fast völlig. Es sind auch keine sinnvollen Harmonisierungen synoptischer Stellen, sondern (manchmal) Vermischungen von Logien, die typisch sind für vorliterarische Spruchsammlungen. Die im EvThom vorliegende Aneinanderreihung von solchen Einzelsprüchen macht gelegentlich sogar (nach VIELHAUER) noch „einen archaischeren Eindruck als Q“. Somit spricht alles dafür, dass diese Stücke grundsätzlich aus einer selbstständigen und zwar möglicherweise auch manchmal älteren Tradition als die synoptischen Evangelien stammen. Ausgenommen sind insofern nur einige wenige nachgetragene Stücke, s. u.a. die Komm. z. Log 5 S.2, 14 S.4, 55 S.2, die wohl zur späteren Angleichung an die Synoptiker hinzugefügt wurden (insofern darf die Unabhängigkeit des EvThom von den Synoptikern auch nicht zu einem Dogma erhoben werden).
So insbesondere H. KÖSTER - J.M. ROBINSON, Entwicklungslinien durch die Welt des frühen Christentums, 1971, 67ff; 118ff, 155ff; H. KÖSTER, Einführung in das Neue Testament, 1980, 586ff; P. VIELHAUER, s.o., 1975, 618ff; B. BLATZ, s.o., 1990, 93ff; ferner J. JEREMIAS, Die Gleichnisse Jesu, 3.A., 1969, 16ff; F. CORNELIUS, Die Glaubwürdigkeit der Evangelien, 1969, 45ff; J.H. SIEBER, A Redactional Analysis of the Synoptic Gospels with Regard to the Question of the Sources of the Gospel According to Thomas, 1966; S.J. PATTERSON, s.o., 7ff; S.L. DAVIES, The Gospel of Thomas and Christian Wisdom, 1983, 1ff sowie Christology and Protology, 1992, JBL 111, 662ff; J.D. CROSSAN, Four Other Gospels, 1985, 13ff; K. BERGER, Einführung in die Formgeschichte, 1987, 120ff; C.W. HEDRICK, Thomas and the Synoptics, SecCen 7, 1989/90, 39ff u. in H.-G. Bethge u.a. (ed.), For the Children, 2002, 113ff; R. CAMERON, ABD 6, 1992, 535ff; G. THEISSEN - A. MERZ, Der historische Jesus, 1996, 52ff; B.L. MACK, Wer schrieb das Neue Testament?, 2000, 88ff; J. LIEBENBERG, Language of the Kingdom of Jesus, 2001 u.a.
Anderer Meinung (a.M.) ist besonders W. SCHRAGE, Das Verhältnis des Thomas-Evangeliums zur synoptischen Tradition und zu den koptischen Evangelienübersetzungen, 1964 (und i. Anschl. an ihn der Kommentar von M. FIEGER, Das Thomasevangelium, 1991): Er behauptet Abhängigkeit des EvThom von den Synoptikern und will besonders beweisen, dass die koptische Übersetzung des EvThom mit den koptischen Evangelien-Übersetzungen weithin übereinstimmt. Allerdings sind diese Evangelien-Übersetzungen erst im 3. Jahrhundert entstanden. Welcher Übersetzer ins Koptische sich an wen angelehnt hat, ist damit auch nicht festzustellen. Im übrigen widerlegen derartige mögliche Beeinflussungen nicht das Vorliegen einer selbstständigen früheren Tradition mit den dafür sprechenden Anzeichen. S. ferner R.M. GRANT - D.N. FREEDMAN, Geheime Worte Jesu, 1960, 91ff.79ff, die annehmen, dass die Sprüche im EvThom das Ergebnis bewusster Veränderungen, Umstellungen und Verknüpfungen synoptischer Logien seien, wofür sich aus dem EvThom selbst jedoch keine hinreichenden Anhaltspunkte ergeben; die gnostisierende Praxis der Kombination kanonischer Herrenworte durch die Naassener entspricht erheblich späterer Praxis. Für Abhängigkeit der Thomas-Logien von den Synoptikern plädieren auch E. HAENCHEN, Die Botschaft des Thomas-Evangeliums, 1961; B. GÄRTNER, The Theology of Thomas, 1961; R. KASSER, L’ Évangile selon Thomas, 1961; H. SCHÜRMANN, Das Thomasevangelium und das lukanische Sondergut, BZ 7, 1963, 236ff; J.-É. MÉNARD, L’Évangile selon Thomas, 1975; A. LINDEMANN, Zur Gleichnisinterpretation im Thomas-Evangelium, ZNW 71, 1980, 214ff; A.J. HULTGREN, The Parables of Jesus, 2000, 430ff; M. GOODACRE, Thomas and the Gospels, 2012 u.a.; oftmals im Zusammenhang mit der Behauptung, dass das EvThom gnostischer Herkunft sei und sich daraus auch ein entsprechender tendenzieller Gebrauch der Synoptiker ergebe (s. dazu noch später bei der Komm.).
Zurückhaltender hält C. TUCKETT, Das Thomasevangelium und die synoptischen Evangelien, BThZ 2, 1995, 186ff die Verbindung einzelner Logien mit der Redaktion der Synoptiker für möglich und nimmt deshalb an, dass eine indirekte Abhängigkeit des EvThom von den Synoptikern vorliege (s. auch Nov Test 30, 1988, 132ff u. ETL 67, 1991, 346ff; ähnlich J.H. CHARLESWORTH u. C.A. EVANS in B.D. Chilton u. C.A. Evans [ed.], Studying the Historical Jesus, 1994, 496ff). Auch S. GATHERCOLE, Composition, 152ff; GosThom, 178ff untersucht eine große Reihe von Einzelstücken und behauptet die Rezeption besonders von lk Redaktion (in Log 5,31,33,47,65,66,104) und mt Redaktion (in Log 13,14,44). Bei den meisten dieser Fälle ist diese jedoch nicht nachweisbar und sind lediglich äußere Ähnlichkeiten festzustellen, wie ebenfalls die Kommentierung i.e. ergeben wird. Oft wird in diesen Fällen auch an eine „sekundäre orale“ Überlieferung gedacht, vgl. R. URO, „Secondary Orality“ in the Gospel of Thomas?, F & F Forum 9, 1993, 305ff u. J.H. WOOD, JR, The New Testament Gospels and the Gospel of Thomas: A New Direction, NTS 51, 2005, 579ff. Weiterhin wird angenommen, dass auch eine solche Abhängigkeit von einer Harmonie aller Evangelien nach der Art von Tatians Diatessaron bestehen könne (J.P. MEIER, A Marginal Jew, 1.Bd., 1991, 137.165) oder ein Exzerpt aus einem Evangelien-Kommentar wie dem des Papias vorliegen könne (H.-M. SCHENKE, On the Compositional History of the Gospel of Thomas, F & F Forum 10, 1994, 9ff).
Ausreichende Anzeichen für den Einfluss einer vorhergehenden Verschriftlichung sind jedoch nicht sicher feststellbar. Es handelt sich bei der Figur der „secondary orality“ überwiegend um ein künstliches Konstrukt, das oft mit unbeweisbaren Vermutungen arbeitet. Auch der typische Aufbau und Rahmen einer Evangelien-Harmonie oder eines entsprechenden Kommentars sind nicht feststellbar, abgesehen davon, dass wir diese Schriftstücke kaum kennen. Insgesamt entspricht das EvThom nicht einem Auszug aus einem vorher festliegenden Text, wie dies etwa bei dem EvPhil der Fall sein mag, sondern dürfte noch am ehesten aus der Zusammenfügung kleinerer Spruchsammlungen erwachsen sein, die wiederum aus mündlicher Überlieferung entstammen, ähnlich wie dies bei Q anzunehmen ist; daraus dürften sich zumeist auch die von SCHENKE festgestellten „Aporien“ am besten erklären lassen.
Die Beziehung des EvThom zum Johannes-Evangelium hat besonders R.E. BROWN, NTS 9, 1962/3, 155ff untersucht und insofern eine mögliche Einflussnahme des JohEv auf das EvThom oder eine seiner Quellen angenommen (ähnl. später M. MARCOVICH, JTS 20, 1969, 72ff u. J. SELL, Persp. in Rel. Studies 7, 1980, 24ff). Dem ist jedoch ebenfalls nicht zuzustimmen, da eine literarische Abhängigkeit des EvThom in keinem Fall nachzuweisen ist (s. KÖSTER in Entwicklungslinien, 124; vgl. auch die Komm. i.e.). Allerdings besteht in manchen Teilen eine bemerkenswerte Nähe zur Vorstellungswelt des JohEv und zu einzelnen joh Überlieferungen (vgl. näher I. DUNDERBERG in R. Uro (Hg.), Thomas at the Crossroads, 1998, 33ff m.w.N. u. die ausf. Untersuchung von S. WITETSCHEK, Thomas und Johannes – Johannes und Thomas, 2015). Die Beziehung zum JohEv wird dadurch kompliziert, dass dieses gleichfalls in einem sehr verwickelten Traditions- und Redaktions-Prozess über einen langen Zeitraum hin entstanden sein wird. Über die damit zusammenhängenden Fragen ist allerdings in der nt Wissenschaft noch keineswegs Einigkeit erzielt worden, trotz vielfältiger Forschungsbemühungen. Das klassische Quellen- und Schichten-Modell R. BULTMANNs (Johannes, 1986 u. RGG III, 3.A., 1959, 842) ist zwar inzwischen weitgehend relativiert, aber jedenfalls insofern noch erheblich, als es von einer Redenquelle als einer der Grundlagen des JohEv ausgeht, die allerdings nicht als gnostisch, sondern als hellenistisch-judenchristlich zu qualifizieren sein wird, und besonders die „Ich-bin“- und die „Lebens“-Worte, ferner Sprüche über den „Sohn“, den „Menschensohn“, den „Tröster“ und die Einheit mit Gott umfasst haben könnte (s. VIELHAUER, Geschichte der urchristlichen Literatur, 425ff.427; KÖSTER, Einführung in das NT, 616ff; NORDSIECK, Johannes, 45ff u.a.). Diese joh Redenquelle könnte ebenfalls eine Parallelerscheinung zum EvThom sein, das in analoger Weise Worte wie Log 77; 13,108; 28,43,62 („Ich“-Worte); Log 4,58,101; 1,18,19,111 („Lebens“-Sprüche), ferner Worte über die Präexistenz Jesu und der Seinen, über „Geist“, „Fleisch“ und „Welt“ und das Einssein u.ä. enthalten hat. Die joh Redenquelle war zwar wohl dem JohEv vorgelagert, sie wird aber jedenfalls später als Q anzusetzen sein. Auch insoweit ist eine Abhängigkeit des EvThom nicht auszumachen; eher könnten Worte des JohEv vom EvThom beeinflusst sein, s. z.B. Joh 7,34.36;8,21;13,33 von Log 38 S.2 oder Joh 5,39.40 von Log 52 (a.M. L.R. ZELYCK, John among the Other Gospels, 102f, der Beeinflussung des EvThom durch das JohEv annimmt, so bei Log 1 S.2; 38 S.2; 43; 77 durch Joh 8,52; 7,34; 8,25f; 8,12, was mir jedoch mangels Abhängigkeit von redaktioneller Arbeit nicht feststellbar erscheint; dagegen auch VALANTASIS, GosThom, 54, 114, 118, 155). Schließlich ist bemerkenswert, dass im EvThom auch keinerlei Spuren des Einflusses einer letzten sog. „kirchlichen“ Redaktion des JohEv sich finden. Diese enthielt nach BULTMANN gewisse Ergänzungen, die von spezifisch kirchlichen Interessen getragen waren (so über die Taufe, die Eucharistie, den Jüngsten Tag, Kreuzestod und leibliche Auferstehung Jesu sowie at Reflexionszitate); derartige Fragen sind im EvThom (noch) nicht eingearbeitet.
Schließlich ist auch die Beziehung des EvThom zu den Briefen des Paulus für die zeitliche Einordnung des EvThom von Interesse. Eine Abhängigkeit des EvThom von paulinischen oder deuteropaulinischen Schriften ist nicht festzustellen. Auch hier sind eher Anzeichen vorhanden, dass in einigen Fällen das EvThom oder seine Tradition Paulus beeinflusst haben. So z.B. könnten Log 22 S.4-7 oder seine Tradition Gal 3,28 (ca. 55 n.C), 1Kor 10,16f, 12,13, Eph 2,13ff u.ä. geprägt haben. Dies spricht schwerwiegend für ein hohes Alter der Kernaussage von Log 22 und seiner Vorstellung vom Einssein, die dann vielfach sekundär in dem EvThom ausgebreitet worden ist (s. die Komm. i.e.). Auch Log 53 mit seiner Kritik an der Beschneidung könnte Gal 5 und 6,15, 1Kor 7,17ff und Röm 2,25ff zur Folge gehabt haben (s. die Komm.). Log 17 bzw. seine Überlieferung könnte 1Kor 2,9 über die Gaben der Weisheit beeinflusst haben und damit die von Paulus bezeichnete „Schrift“ sein. Schließlich könnte auch Log 14 S.4 (Kritik von Speisevorschriften) den Paulus beeinflusst haben (s. 1 Kor 10,27).
Log 3 S.4-5, Log 37 und Log 83-85 scheinen dagegen eher spätere Zusätze zu sein. Analogien finden sich hier in Gal 4,9, 1Kor 13,12 (vom Erkennen und Erkanntwerden); 2Kor 5,1ff, Eph 4,22ff (vom Ausziehen und Anziehen von Kleidern); 1Kor 11,7, 15,45ff und 2Kor 4,4 (von Bildern und Abbildern). Eine irgendwie geartete gegenseitige Abhängigkeit scheint insoweit jedoch nicht gegeben zu sein (das ist allerdings noch wenig erforscht, s. z.B. S.L. DAVIES, Christology and Protology, 668f u. R. URO, Thomas, 2003, 74ff; dagegen S. GATHERCOLE in J. Frey u.a. (Hg.), EvThom, 72ff u. ders., GosThom, 180. Insgesamt wird auch in diesem Zusammenhang das wahrscheinlich hohe Alter von Überlieferungen des EvThom erkennbar.
5. Das Vorliegen einer selbstständigen früheren Tradition im EvThom gegenüber den Synoptikern und auch dem JohEv lässt sich ferner auch aus einer Reihe von typischen Einzellogien und deren Form folgern, wie später noch näher aufzuweisen sein wird. Hier sei beispielhaft verwiesen auf Log 8 (Gleichnis vom großen Fisch), das älter sein dürfte als die Par Mt 13,47ff, da es in seiner formalen Struktur der eschatologischen Reich-Gottes-Verkündigung Jesu offenbar nähersteht als die von matthäischer Apokalyptik geprägte Parallele (Par), so bereits J. JEREMIAS, HUNZINGER u.a., vgl. i.e. die Kommentierung. Ferner ist Log 31 (Prophetenspruch) wahrscheinlich früher als Lk 4,24 Par Mk 6,4; denn es handelt sich um eine zusammenhängende Kurzform weisheitlicher Herkunft, die regelmäßig Grundlage später ausgestalteter Szenarien wie Mk 6,1ff ist; außerdem kann sie nicht aus Lk wegen dessen Fragmentcharakters abgeleitet sein, sondern wird dort eher vorausgesetzt (vgl. schon BULTMANN und DIBELIUS zur gleichlautenden POxyPar). Log 65 (Gleichnis von den bösen Winzern) ist wie übrigens viele Gleichnisse vermutlich älter als Mk 12,1ff Par, was sich aus der stärker fortgeschrittenen Allegorisierung bei Mk und seinen synoptischen Par ergibt; es hat eine Form, die bereits vor Entdeckung des EvThom hypothetisch als Grundform des Gleichnisses angenommen worden ist (s. schon J. JEREMIAS, BULTMANN; dies gilt auch bei anzunehmender eschatologischer Deutung). Auch bei einer weiteren Zahl von aphoristischen Sprüchen und Gleichnissen spricht aus traditions- und formgeschichtlichen Gründen vieles dafür, dass sie von älterer Tradition sind als ihre synoptischen Pendants, s. des näheren die Kommentierung bei Log 9,26,55,63,64,76,86,89,93,95; andere wiederum sind diesen jedenfalls ebenbürtig. Wenn SCHRAGE etwa meint, Thomas habe „das Wort [Log 31] aus seiner historischen Situation, die ihm die Synoptiker zuweisen, gelöst und wieder zu einem ‚freien Logion’ gemacht“ (s. o., 76), oder LINDEMANN, ZNW 71 (1980), 236 eine „sekundäre Entallegorisierung“ der Gleichnisse annimmt, so vernachlässigen sie damit grundlegende Erkenntnisse der formgeschichtlichen Forschung (s. auch KÖSTER in Entwicklungslinien, 121ff.163f.168f). Das gilt im übrigen auch für die Vorstellung von E. RAU (Jesus, Freund von Zöllnern und Sündern, 2000, 88), der eine „Tendenz zur Fragmentierung“, zu „kontextueller Isolierung“ und damit zur „Enthistorisierung“ in den Logien des EvThom sehen will.
6. Allgemein spricht für die Herkunft des EvThom aus einer sehr alten Tradition das große Gewicht der Reich-Gottes-Verkündigung in ihm, die als authentisch und besonders charakteristisch für den historischen Jesus gilt. Der Terminus „Reich“ kommt im EvThom 9mal (Log 3,22,27, -in POxy: „Reich Gottes“ - ,46,49,82,107,109,113), das „Reich des Vaters“ bzw. „meines Vaters“ 7mal (Log 57,76,96,97,98,99,113) und das „Reich der Himmel“ 3mal (Log 20,54,114) vor. In keiner anderen frühchristlichen Schrift, abgesehen von Q und den synoptischen Evangelien ist die Basileia daher so häufig thematisiert wie im EvThom (s. auch K.L. KING, Kingdom in the Gospel of Thomas, F & F Forum 3,1, 1987, 48ff; P. PERKINS in C.W. HEDRICK, Historical Jesus and Rejected Gospels, 1988, 79ff; D.C. DULING, ABD 4,49ff, 1992). Ähnliches gilt für den inhaltlich gleichbedeutenden Terminus „Leben“, der ebenfalls ursprünglich ist und auch bereits bei den Synoptikern für die Gottesherrschaft verwendet wird, vgl. Log 4,58,101, s. auch Log 11 (dazu näher M. LELYVELD, Les Logia de la Vie dans l’ Évangile de Thomas, 1987). Das Reich Gottes wird allerdings zentral in der Gegenwart gesehen (vgl. besonders Log 3,51,113), doch entfällt der Zukunftsaspekt durchaus nicht ganz (s. dazu Log 22,46,99, auch 11 S.1/2, 111 S.1/2 u.ö.); daneben kommt auch der Vergangenheitsaspekt, dass der Jünger aus dem Reich Gottes stammt, vor (s. z.B. Log 49). Das Reich kann „erkannt“ werden (Log 46, s. auch Log 3), es kann „gefunden“ werden (Log 27,49), und man kann darin „eingehen“ (Log 99,114, s. auch Log 39,64,75).
Auch der altertümliche Begriff „Menschensohn“ tritt 3mal auf, einmal für Jesus selbst und zweimal für seine Nachfolger bzw. die Menschen allgemein (s. Log 86; ferner Log 13 u. 106). Dasselbe gilt für den Begriff „Sohn“, ebenfalls in nicht-exklusiver Verwendung (s. Log 44; ferner s. Log 61 S.3). Kennzeichnend für das EvThom ist weiter die erstaunlich umfangreiche Aufnahme von Gleichnissen (14-mal, s. die Komm., vielfach zur Ausdeutung des Reichs Gottes). Sie entspricht inhaltlich durchaus der synoptischen (und vielfach jesuanischen) Verwendung und unterscheidet sich deutlich vom frühjüdischen wie auch sonstigen frühchristlichen Gebrauch. Bemerkenswert sind dabei besonders die Gleichnisse von der Frau mit dem Krug und dem Attentäter (Log 97,98), die in keinem kanonischen Evangelium auftauchen (vgl. auch die Auflistung von D.W. KIM, Unknown Parables, Bibl. 94.4, 2013, 585ff). Weiter sind typisch die Seligpreisungen, besonders der Armen, Leidenden und Verfolgten (s. Log 54,58,68,69 u.a.). Schließlich auch Worte der Weisung wie das Liebesgebot (Log 25), Gebote zu einer Gerechtigkeit, die diejenige der Pharisäer und Schriftgelehrten überschreitet (z.B. Log 95,43; s. auch Log 39,102) sowie der Kultkritik (vgl. Log 6,14,52,53,71,89,104). Ähnliches gilt schließlich für die sonstigen aphoristischen Logien, so mit den von Jesus auch sonst bevorzugten Redewendungen wie dem passivum divinum, Hyperbeln und Paradoxien sowie dem antithetischen Parallelismus membrorum (s. schon J. JEREMIAS, Theologie, 19ff).
Dagegen fehlen im EvThom eine explizit ausgestaltete Christologie mit Vergöttlichung Jesu und eine entwickelte Ekklesiologie nebst institutionellen Autoritätsstrukturen, ferner auch Geburts-, Sakraments- und Wundergeschichten sowie besonders ein ausgebildetes Kerygma von Kreuz und Auferstehung Jesu, das später bei Paulus und Johannes so bedeutsam werden sollte. Das ändert aber nichts daran, dass Jesus und seinem Wirken dennoch eine besondere Heilsbedeutung zugeschrieben wird, nicht nur als Lehrer, Prophet und Arzt, s. Log 13,31, sondern als „Lebendiger“, somit als Vermittler des Reichs Gottes und „Lebens“, vgl. Log 52,59 (s. auch M. FRANZMANN, Jesus in the Nag Hammadi Writings, 1996, 78ff). Sein Tod und seine Erhöhung werden freilich nur in verhüllter Weise angedeutet, s. Log 12 S.1,38,55,65,104 und Log 66, und eine Heilsgemeinschaft wird in der Form der neuen Familia dei nahe gelegt, s. Log 99 (s. zum Ganzen VIELHAUER, s.o., 633ff; BLATZ, s.o., 97; THEISSEN - MERZ, s.o., 54). Insgesamt ist auch hier eine erhebliche Nähe des EvThom zur Spruchquelle Q zu konstatieren, die ebenfalls die Verkündigung Jesu vom Reich Gottes und vom Menschensohn ins Zentrum stellt, während das Kerygma vom Kreuzestod und von der Auferstehung Jesu, soweit feststellbar, fehlt.
Auch eine gnostische Mythologie ist trotz mancher „gnostisierender“, weisheitlicher Färbung der Logien nicht ausgeführt. Die Gnosis soll hier typologisch als synkretistische religiöse Bewegung des 2./3. Jahrhunderts angesehen werden, die von einem scharfen Dualismus zwischen der göttlichen Sphäre und der materiellen Welt geprägt ist. Neben dem völlig jenseitigen, fernen obersten Gott werden weitere göttliche Figuren, Engelmächte, Sphären u.ä. eingeführt wie auch besonders der niedere Schöpfergott („Demiurg“). Die böse Welt und Materie sind in einem mythologischen Drama entstanden, bei dem ein „göttlicher Funken“ in die niedere Welt gefallen ist, der darin schlummert und nunmehr durch Erkenntnis über diesen Zustand („Gnosis“) befreit werden muss. Diese Befreiung ist nur durch eine jenseitige Erlösergestalt zu gewinnen, die aus einer oberen Sphäre hinab- und wieder hinaufsteigt. Diese Gestalt wird oft doketistisch gesehen, d.h. nur als mit einem Scheinleib aus pneumatischer Substanz versehen.
Die in den gnostischen Systemen vorgetragene Mythologie fehlt indessen völlig im EvThom. Der Dualismus und die Ablehnung der „Welt“ (s. Log 21,27,56,80,110,111 u.ö.) entsprechen johanneischen und paulinischen Parallelen. Selbst der Terminus „Gnosis“ kommt nur einmal, nämlich in dem Log 39 mit synoptischer Par (s. Lk 11,52), vor. Gelegentlich herrscht sogar eine ausgesprochen un- oder antignostische Tendenz (vgl. z.B. die Komm. z. Log 24,28,29,55,67,89,113). Es liegen auch keine „Gespräche“ des auferstandenen Christus mit seinen Jüngern oder eine sonstige Offenbarung von Mysterien durch den Erhöhten vor, wie sie für die Gnosis kennzeichnend sind. Desgleichen fehlt eine für die naassenische und valentinianische Gnosis typische Exegese. Der „lebendige“ Jesus ist vielmehr (wie auch Gott, s. Log 3,37) der das Leben Besitzende und Spendende. Seine Worte sind vorösterlich geprägt und sollen zur Rettung zuvörderst in diesem Leben führen, wenn sie auch (redaktionell) als „geheim“ bezeichnet werden (s. näher Log 1) und der Deutung bedürfen, vgl. Log 8,21,24,63 usw.: „Wer Ohren hat (zu hören), der soll hören!“ (s. K. RUDOLPH, Die Gnosis, 3.A., 1990; H.-J. KLAUCK, Die religiöse Umwelt des Urchristentums, 1996, 161ff; C. MARKSCHIES, Die Gnosis, 2001; K.W. TRÖGER, Die Gnosis, 2001 u.a.).
Auch eine Zugehörigkeit des EvThom zu dem der Gnosis nahestehenden Enkratismus ist nicht festzustellen (entgegen G. QUISPEL, ferner A.D. DE CONICK, Recovering, 175ff). Die für den Enkratismus typische asketische und zölibatäre Haltung ist im EvThom trotz seiner Distanz gegenüber der „Welt“ nicht ausgebildet (s. z.B. S.L. DAVIES, Wisdom, 21f u. Christology and Protology, 663ff; R. URO, Thomas at the Crossroads, 1998, 140ff m.w.N.). Aus den zur Begründung herangezogenen Log 22,48,106, ferner 37,75,114 u.a. lässt sich dies nicht entnehmen, auch wenn diese später, s. ActThom und LibThom enkratitisch interpretiert worden sein mögen (vgl. die Kommentierung i.e.).
Schließlich ist das EvThom auch nicht antijüdisch und etwa deshalb als Gnosis-nahe zu qualifizieren (so aber GÄRTNER, Theology, 157; ähnl. POPKES, Menschenbild, 56ff). Die dafür angeführten Log 6,14,52,53,71,89,104, die gesetzes- bzw. kultkritisch sind, oder Log 39,43,102 betr. „Pharisäer“ und „Juden“ bewegen sich in einem Rahmen, der auch vom synoptischen oder johanneischen Jesus geläufig ist (zur Kritik der Reinheitsvorschriften s. etwa Mk 7,15; Mt 15,11; Lk 11,39-41; zur Fastenhalacha s. Mk 2,19 Par; Mt 6,1ff; zum kultischen Beten s. Mt 6,5ff.8; Lk 18,1; zu den Opfersatzungen s. Mt 9,13; 12,7; zur Sabbatheiligung s. Mk 2,27f; 3,4; Mt 12,10ff; Lk 13,15; 14,5; zur Pharisäerschelte Mt 23,1ff Par und zum Streit mit den „Juden“ Joh 8,37ff usw.). Diese Worte des EvThom sind eher als charakteristische innerjüdische Auseinandersetzungen zu würdigen und keineswegs als „Distanzierung von den jüdischen Wurzeln der Botschaft Jesu“ (POPKES). Ein Antijudaismus oder auch eine Trennung von der Geschichte Israels ist aus ihnen nicht zu entnehmen. Vgl. dazu auch besonders die Komm. zu Log 6,14,52,53,71, wo ausgeführt wird, dass diese in ihrer Aussage durchaus nicht die Radikalität des historischen Jesus überschreiten. Insgesamt gehören diese Logien Überlieferungen an, die einem jüngeren Judenchristentum besonderer Prägung entsprechen. Dafür spricht auch deutlich die betont starke Stellung, die nach Log 12 dem für seinen Eifer für das Gesetz bekannten Herrenbruder Jakobus zugedacht ist (s. dazu schon G. QUISPEL, s. unten; S.L. DAVIES, Christology and Protology, 682; H. KÖSTER - J.M. ROBINSON, Entwicklungslinien, 127f u.a.).
7. Es sprechen danach entscheidende Umstände dafür, dass das EvThom aus frühen, gegenüber den Synoptikern und dem Johannes-Evangelium sowie Paulus selbstständigen und nicht-gnostischen Spruchsammlungen stammt, die dem frühesten Judenchristentum angehören und dem historischen Jesus jedenfalls nahestehen und somit authentisches Gut der Jesus-Verkündigung enthalten können.
Vgl. dazu schon L. LEIPOLDT, ThLZ 83, 1958, 481ff und O. CULLMANN, ThLZ 85, 1960, 321ff; dann besonders J. JEREMIAS, Gleichnisse, 3.A., 1969, 60ff; C.-H. HUNZINGER, ThLZ 85, 1960, 843ff und Festschr. J. Jeremias, BZNW 26, 209ff; R.MCL. WILSON, Studies in the Gospel of Thomas, 1960 und TRE 3, 1978, 323ff; H. MONTEFIORE, NTS 7, 1960/61, 220ff; K. GROBEL, NTS 8, 1961/2, 367ff; R. HAARDT in K. Schubert (Hg.), Der historische Jesus und der Christus unseres Glaubens, 1962, 257ff; T. SCHRAMM, Der Markusstoff bei Lk, 1971, 10ff; Norman PERRIN, Jesus, 1972, 27ff; B. BLATZ, s.o., 93ff; R. VALANTASIS, The Gospel of Thomas, 1997,12ff; J. ROLOFF, Jesus, 2000, 25f u.a.
Besonders der eigenwillige Gelehrte G. QUISPEL geht von sehr alten, gegenüber den Synoptikern unabhängigen und nicht-gnostischen Quellen des EvThom aus, bei denen er allerdings zum größten Teil an außerkanonische Evangelien wie das judenchristliche Nazaräer- bzw. Hebräer-Evangelium und das alexandrinisch-christliche ÄgypterEvangelium denkt (s. The Gospel of Thomas and the New Testament, VigChr 11, 1957, 189ff; Makarius, das Thomasevangelium und das Lied von der Perle, 1967; Some Remarks on the Gospel of Thomas, NTS 5, 1958/9, 276ff; VigChr 45, 1991, 78ff u.ö.); ähnlich, aber differenzierter A.D. DE CONICK, Recovering the Gospel of Thomas, 2005 u. The Original Gospel of Thomas in Translation, 2006.
Einen davon unabhängigen Zugang zur Echtheit von EvThom-Logien suchen J.B. BAUER in W.C. van Unnik, Evangelien aus dem Nilsand, 1960, 57ff und R. SUMMERS, The Secret Sayings of the Living Jesus, 1968. Auch J.D. CROSSAN, Der historische Jesus, 1994, 563ff.; G. LÜDEMANN, Jesus nach 2000 Jahren, 2000, 753ff und R. FUNK, R.W. HOOVER and the Jesus-Seminar, The Five Gospels, 1993, 471ff setzen sich in differenzierter Weise für die Möglichkeit einer Authentizität von Logien des EvThom ein.
Anderer Meinung sind wiederum E. HAENCHEN, s.o., 1961, und W. SCHRAGE, s.o., 1964 sowie M. FIEGER, dgl., 1991, die den gnostischen Anteil im EvThom für so groß halten, dass authentische Jesusüberlieferungen nicht zu erwarten seien (ähnlich auch J.-É. MÉNARD, L’ Évangile selon Thomas, 1975, jedoch mit Differenzierungen; ferner GRANT - FREEDMAN, GÄRTNER, KASSER, LINDEMANN, TUCKETT, s.o., ferner noch J.P. MEIER, A Marginal Jew, 124ff; N.T. WRIGHT, The New Testament and the People of God, 1992, 435ff; L.T. JOHNSON, The Real Jesus, 1996, 88f; W. SCHMITHALS, Die Evangelisten als Schriftsteller, 2001, 106ff; E.E. POPKES, Menschenbild, 2007; B. DEHANDSCHUTTER, K.R. SNODGRASS und J.M. SEVRIN in ihren Gleichnis-Untersuchungen und zumeist auch A.J. HULTGREN in The Parables of Jesus, 2000, 430ff).
Diese Untersuchungen verkennen jedoch das Verhältnis der verarbeiteten alten Traditionen zu der späteren theologischen und manchmal „gnostisierenden“ Überarbeitung und Ergänzung, die möglich ist, aber durchaus von dem ursprünglichen Gut abgehoben werden kann. DAVIES, The Gospel of Thomas and Christian Wisdom, 1983, geht sogar nicht einmal von einer solchen Überarbeitung aus, sondern hält das EvThom für den Ausläufer einer christlichen Weisheitstradition, die Jesus mit der Weisheit identifizierte. Ähnlich tritt auch PATTERSON, The Gospel of Thomas and Jesus, 1993 für Unabhängigkeit der Überlieferung der Logien des EvThom ein, die er im Zusammenhang mit dem Wanderradikalismus der Jesus-Bewegung sieht (s. auch THEISSEN - MERZ, s.o., 55). Das gleiche akzeptieren auch zum Teil, allerdings mit verschiedener Gewichtung, in sorgfältiger Untersuchung der Rezeption der Logienüberlieferung J. SCHRÖTER, Erinnerung an Jesu Worte, 1997, und T. ZÖCKLER, Jesu Lehren im Thomasevangelium, 1999, ferner U.-K. PLISCH, EvThom, 2007 und P. POKORNY, GosThom, 2009 sowie aus feministischer Sicht S. PETERSEN, Zerstört die Werke der Weiblichkeit, 1999 u. J. HARTENSTEIN - S. PETERSEN, Das EvThom, in Kompendium Feministische Bibelauslegung, 1998, 768ff.
8. Die Zeit der Entstehung der meisten der dem EvThom zugrundeliegenden schriftlichen Spruchsammlungen wird man danach etwa in die Zeit der Entstehung der Logienquelle Q (ca. 40-70 n.C.) anzusetzen haben. Dabei wird man zunächst von mündlichen Überlieferungen auszugehen haben, die angesichts wahrscheinlicher Aramaismen vielleicht noch einen aramäischen Sprach-Hintergrund hatten, s. dazu A. GUILLAUMONT, Sémitismes dans les Logia de Jésus, Journal asiatique, 1958, 113ff u. Les Sémitismes dans l’ Évangile de Thomas, Festschr. G. Quispel, 1981, 190ff; vgl. ferner K.H. KUHN, Le Muséon 73, 1960, 317ff u. P. NAGEL, Erwägungen, 1969, 379ff; a. M. Nicholas PERRIN in J. Frey u.a. (Hg.), EvThom, 50ff m.w.N., der allerdings eher eine syrische Sprachvermittlung annimmt, dagegen überzeugend jedoch P.J. WILLIAMS, VigChr 63, 2009, 71ff, sowie S. GATHERCOLE, Composition, 24ff, der lediglich eine griechische Sprachgrundlage für nachweisbar hält.
Die genannten Überlieferungen sind wohl zuerst mündlich zu SpruchPaaren und zu Spruch-Gruppen und später schriftlich zu kleineren und größeren Spruch-Sammlungen zusammengestellt worden (s. des näheren R. NORDSIECK, BZ 52,2, 174ff). Inhaltlich ist die älteste Schicht der zugrunde liegenden Spruch-Sammlungen stark weisheitlich, aber auch apokalyptisch geprägt (s. DAVIES, Wisdom, 18ff.100ff; DE CONICK, The Original Gospel, VigChr 2, 167ff.195 u. Recovering, 113ff). Man kann sagen, dass in dieser eschatologischen Verkündigung, die auf Jesus zurückgeführt werden kann, apokalyptische und weisheitliche Züge untrennbar miteinander verbunden sind und auf eine charakteristische Weise ausbalanciert werden. Eine einseitig weisheitliche Prägung, zumal in der Nähe des hellenistischen Kynismus (so bes. MACK, The Lost Gospel, 1993 u.a.) ist nicht anzunehmen; dagegen spricht, dass besonders in der ältesten Schicht gerade das eschatologische Element mit seiner auf grundlegende und endgültige Veränderung zielenden Stoßrichtung maßgeblich ist (s. auch J.W. MARSHALL in W.E. Arnal u. M. Desjardins (ed.), Whose Historical Jesus?, 1997, 37ff [59] u. A.L.A. HOGETERP in A. Hilhorst u. G.H. van Kooten (ed.), Wisdom of Egypt, 2005, 381ff [393]).
Die vorliegende Zusammenstellung und Verknüpfung der (Einzel- und der Haupt-) Sammlungen zu dem vorhandenen Spruch-Evangelium ist dann in einem länger währenden Prozess wohl für die Zeit bis ca. 100 - 110 n.C. anzunehmen, somit bis zur Zeit der (wahrscheinlichen) Abfassung des JohEv, und zwar in griechischer Sprache (s. R. VALANTASIS, JECS 7, 55ff; a.M. z.B. H.C. PUECH in Schneemelcher, NtApokr, I, 3.A., 1959, 205f u. GOODACRE, Thomas and the Gospels, 171: ca. 140 n.C.); dabei ist nicht auszuschließen, dass einzelne Logien bzw. Ergänzungen dazu auch noch später hinzugefügt worden sind.
Die abschließende Redaktion kann ähnlich wie das JohEv (nach seiner Grundschrift) als „gnostisierend“ bezeichnet werden, und zwar in einer Weise, die eine kreative Auseinandersetzung mit der sich allmählich entwickelnden Gnosis darstellt; zur Gnosis gehört die Endredaktion jedoch nicht. Sie enthält vielmehr im Ergebnis eine Verstärkung der weisheitlichen und schöpfungstheologischen Bestandteile und der Präexistenz-Christologie des EvThom, besonders in den Knotenpunkten der Log 18/19 S.1,3-4, 37, 49/50, 61 S.2-5, 77 S.1 und 83/84, aber auch in einer Reihe von Zusätzen und Anhängseln mit nur selten synoptischem Inhalt (s. z.B. Log 5 S.2, 14 S.4,2 u. 55 S.2), mehrfach quasi-synoptischen und -johanneischen Erweiterungen (z.B. Log 21 S.6-8, 44 S.1, 64 S.12, 92 S.2, 100 S.4), aber meist ebenfalls protologischen und spiritualisierenden Weiterentwicklungen (s. z.B. Log 3 S.4-5, 4 S.3, 11 S.3-4, 16 S.4, 23 S.2 und ganz auffällig 111 S.3). Das hat gleichfalls besonders johanneische, ferner aber auch paulinische und sonstige frühchristliche Parallelen; dagegen enthält diese abschließende Redaktion noch keinerlei Elemente der späteren joh „kirchlichen“ Redaktion (zur Entwicklung des EvThom i.e. s. auch die Modelle von W.E. ARNAL, The Rhetoric of Marginality, HTR 88, 1995,477ff u. DE CONICK, The Original Gospel of Thomas, 185ff, die jedoch die genannte redaktionelle Schicht für „gnostisch“ bzw. „enkratitisch“ und „hermetisch“ halten; zutreffend dagegen besonders VALANTASIS, GosThom, 19ff; DAVIES, Wisdom, 18ff.100ff; GosThom, XXIVff; PAGELS, JBL 118/3, 477ff.488; CROSSAN, Der historische Jesus, 563ff u.a.).
Vom Inhalt her deutet diese Endredaktion die Gegenwärtigkeit des Reichs Gottes in einer besonderen Innerlichkeit, nämlich der Erkenntnis des zu Gott gehörigen Selbst der Menschen (Log 3 S.4-5, 50 S.2, 67, 70, 111 S.3). Dieses stammt aus dem präexistenten Lichtreich Gottes und wird auch wieder dorthin gehen (s. Log 18, 19 S.1,3-4, 49, 50 S.1). Dies Reich entspricht der ursprünglichen Ordnung der Schöpfung, die durch paradiesische Einheit und Gleichheit gekennzeichnet war und zu der die Menschen zurückkehren sollen (Log 4 S.3, 11 S.4, 16 S.4, 23 S.2, 49 S. 1, 50). Dazu müssen sie sich ihres Ego entkleiden und sich von den Mächten der Welt abwenden, die das Reich verhindern wollen, jedoch zum Tode führen (Log 21 S.6, 37, 56, 80, 110). Dies entspricht auch der Rede von den „Lichtmenschen“, die die Welt erleuchten sollen (Log 24 S.3, s. auch POPKES, Platonisches Christentum, 96f). Jesus personifiziert dies Lichtreich (Log 77 S.1) und entspricht vorbildhaft dem Ur-Bild der Menschen, zu dem diese auch letztlich gelangen sollen (Log 83ff, 37, 50 S.1, 61 S.2-5), s. auch M.W. MEYER in ders. u. C. Hughes (ed.), Jesus Then & Now, 2001, 74.83f, der die letzte spiritualisierende und schöpfungstheologische Redaktion des EvThom „esoterisch“ nennt, was jedoch wie auch die sonstigen Pauschalierungen eher missverständlich ist.
Als Ort der genannten Zusammenfassung kommt der ostsyrische Raum um Edessa (heute Urfa, Türkei) in Frage. Ägypten, wo die griechischen Oxyrhynchos-Papyri und später das koptische EvThom gefunden worden sind, scheint erst später von Bedeutung geworden zu sein. Auf das ursprüngliche Zentrum des Thomas-Christentums im ostsyrischen Raum verweist besonders die Aussage des Prologs des EvThom (Log 1) in der Gestalt des POxy 654, wonach „Judas Thomas“ der Verfasser des Evangeliums gewesen sein soll (s. auch den Schluss und Log 13, wo er nur „Thomas“ genannt wird). Die Namensform „Judas Thomas“ gilt dem Jünger Thomas (vgl. zu ihm Mt 10,3 Par Lk 6,15 [Q]; Mk 3,18; Apg 1,13 und Joh 11,16; 14,5; 20,24.26ff; 21,2). Sie ist, wie besonders die Thomas-Akten, ferner das Thomas-Buch und die von Euseb zitierte Abgarlegende zeigen, dort beheimatet (s. G.J. RILEY, Thomas Tradition and the Acts of Thomas, SBL.SP 30, 1991, 533ff u. P.-H., POIRIER, in The Nag Hammadi Library after Fifty Years, ed. b. J.D. Turner a. A. McGuire, 1997, 295ff m.w.N.). Sie kommt schließlich auch noch in der syrischen Version von Joh 14,22 vor. Im übrigen ist nachzuweisen, dass der Raum um Edessa Mittelpunkt der Thomas-Tradition war. Deutliche Anklänge weisen insofern auch das syrische Liber Graduum, der Ps.-Makarios, die Ps.-Clementinen und das Diatessaron auf (s. z.B. BLATZ, s.o., 95f u. Nicholas PERRIN, Thomas and Tatian: The Relationship between the Gospel of Thomas and the Diatessaron, 2002, 29ff).
Thomas ist zu Missionszwecken nach Indien gezogen, wo er als Märtyrer seines Glaubens gestorben sein soll (s. auch schon H.C. PUECH in Schneemelcher, NtApokr, I, 3.A., 1959, 199ff; näher auch H. KÖSTER - J.M. ROBINSON, Entwicklungslinien, 119f und besonders A.F. KLIJN, Edessa. Die Stadt des Apostels Thomas, 1965; kritisch dazu B. EHLERS, NovTest 12, 1970, 284ff und antwortend KLIJN, Christianity in Edessa and the Gospel of Thomas, NovTest 14, 1972, 70ff sowie DRIJVERS, H.J.W., Thomas, Apostel, TRE Bd.33, 2002, 430ff). Dass die ältesten Teile der Sammlung(en) evtl. sogar von Jerusalem oder Antiochia stammen und insoweit auch dem Herrenbruder Jakobus eine Rolle als Gewährsmann zufällt, vgl. Log 12, ist durchaus möglich, s. auch M. DESJARDINS, Toronto Journal of Theology 8, 1992, 121ff. Die letzte Fassung des EvThom und die Edition könnten noch von einem oder mehreren Schülern des Thomas erfolgt sein.
Insgesamt ist von Bedeutung, wie besonders PATTERSON, GosThom, 113ff ausgeführt hat, dass die Thomas-Bewegung wie auch diejenige Jesu selbst personell von wandernden judenchristlichen Charismatikern mit einem eschatologischen und sozial-radikalen Bewusstsein geprägt war und erst nach und nach, wohl im ostsyrischen Raum von Edessa, zur Sesshaftigkeit gelangt ist, zusammen mit inzwischen dazugestoßenen heidenchristlichen Anhängern. Hier wird es auch zu einer stärkeren Spiritualisierung der Thomas-Bewegung mit protologischen und schöpfungstheologischen Vorstellungen gekommen sein. Nicht auszuschließen ist, dass es dabei auch teilweise stärkere Konflikte und Trennungen von der Großkirche gegeben hat. An die Gemeinschaft der Thomas-Bewegung wird dann das EvThom als Ganzes auch adressiert gewesen sein, und zwar als eine Art Predigt-Instruktion, ähnlich wie KLOPPENBORG dies für Q angenommen hat (Excavating Q, 143ff).
9. Die Gründe, die das EvThom später als häretisch erscheinen ließen und vielleicht auch zu seiner Nichtaufnahme in den Kanon geführt haben, zeigen die teilweise heftige Auseinandersetzung bereits der frühesten christlichen Gruppierungen um den richtigen Weg. Sie dürften aber heute nicht mehr überzeugungskräftig sein. Es sind dies wohl in erster Linie die Hervorhebung der Rolle des Apostels Thomas als eines besonders herausragenden Offenbarungs-Vermittlers und seine deutliche Überordnung gegenüber Simon Petrus und Matthäus mit ihren Traditionen (s. Log 13) und wohl auch die Zurückweisung der Kritik des Petrus an Maria Magdalena (Log 114). Die kanonischen Evangelien betonen demgegenüber die Führungsrolle des Petrus (s. besonders Mt 16,13ff; aber auch Mk 8,27ff; Lk 9,18ff und Joh 6,66; ferner 1Kor 15,4) gegenüber allen anderen Jüngern bzw. -innen.
Inhaltlich war das EvThom wohl bekämpft wegen seiner freien und individualistischen Haltung, die dem aufkommenden kirchlichen Institutionalismus abhold war, wegen seiner Infragestellung des Patriarchalismus und last not least wegen seiner besonders ausgestalteten Christologie. Insbesondere bestanden wohl auch Spannungen der Johannes-Gemeinde(n) zu dem Apostel Thomas und seiner Gemeinde, und zwar trotz ihrer Nähe zueinander. Das zeigt die johanneische Hervorhebung des „Glaubens“ an den „einzig gezeugten Sohn Gottes“ und damit seine Vergöttlichung, gegenüber dem kritisierten „Sehen“ und Erkennen, das dem „ungläubigen“ Thomas vorgeworfen wird, s. Joh 20,24ff.29, aber auch die Kritik an dem sonstigen unverständlichen Verhalten des Thomas, s. Joh 11,16 u. 14,5f. Näher zur Vertiefung dazu sei verwiesen auf G.J. RILEY, Resurrection Reconsidered, 1995, 100ff; aber auch I. DUNDERBERG, John and Thomas in Conflict? in The Nag Hammadi Library after Fifty Years, ed. by J.D. Turner a. A. McGuire, 1997; ferner A. D. DE CONICK, Voices of the Mystics, 2001, 19ff; E.E. POPKES, „Ich bin das Licht“, in Kontexte des Johannesevangeliums, hg. v. J. Frey u. U. Schnelle, 2004 und E. PAGELS, JBL 118, 1999, 478 u. Beyond Belief, 2003, 30ff, dtsch.: Das Geheimnis des 5. Evangeliums, 2004, 36ff. Anderer Meinung M. C.W. SKINNER, John and Thomas - Gospels in Conflict ?, bes. 231f, der einen Konflikt der Gemeinden bezweifelt, vielmehr Konflikte von Einzelpersönlichkeiten und ihrem Glauben annimmt.
Schließlich mag auch noch von Bedeutung sein, dass das EvThom nicht im breiten Strom des frühen Christentums, sondern eher in Randgruppen in Gebrauch war. Die offenbare Verwendung des EvThom in manchen der Großkirche fernstehenden und des Gnostizismus beschuldigten Gemeinschaften wie den Naassenern und dem Manichäismus mag dann der Grund dazu gewesen sein, dass das EvThom nicht kanonisiert wurde.
Dies alles spricht jedoch nicht für einen heterodoxen oder gar sektiererischen Charakter des EvThom (s. auch T. KAZEN, Sectarian Gospels for Some Christians?, NTS 51, 2005, 561ff) und dürfte auch heute für die Authentizität oder den Wert von Logien aus dem EvThom nicht mehr durchgreifend sein. Vielmehr muss, wie im folgenden versucht wird, jedes einzelne Stück dieses „5. Evangeliums“ (so schon DAVIES) in seinem historischen Kontext samt der vorliegenden Traditions-, Form- und Redaktions-Geschichte auf seine Echtheit überprüft werden. Dies muss gelten, selbst wenn dadurch möglicherweise dogmatische Erschütterungen zu erwarten sind, auch damit keine dieser Kostbarkeiten in Vergessenheit gerät. Durch seine weitgehend vordogmatische Haltung könnte das EvThom auf diese Weise dann auch einen Beitrag zur Wiedergewinnung der ursprünglichen spirituellen Weite der christlichen Botschaft und damit zu einer Erneuerung der Kirche(n) sowie zur Entkrampfung des Verhältnisses der Konfessionen und Religionen zueinander leisten.
10. Zum Text des EvThom i.e. s. zunächst die Editio princeps von A. GUILLAUMONT, H.-C. PUECH, G. QUISPEL, W. TILL und YASSA ´ABD AL MASIH unter dem Titel „Das Evangelium nach Thomas“, 1959 (von ihr stammt die jetzt übliche Einteilung in 114 Logien); dazu neben HAENCHEN und FIEGER ferner J. LEIPOLDT, Das Evangelium nach Thomas, 1967; B. BLATZ in W. Schneemelcher, Neutestamentliche Apokryphen, I, 6.A., 1990, 98ff; K. BERGER u. C. NORD, Das Neue Testament und frühchristliche Schriften, 1999, 644ff; J. SCHRÖTER u. H.-G. BETHGE, Das Evangelium nach Thomas, in Nag Hammadi Deutsch, hg. v. H.-M. SCHENKE pp., 2001, 151ff; U.K. PLISCH, Das Thomas-Evangelium, 2007; S. GATHERCOLE, The Gospel of Thomas, 2014; ferner O. BETZ - T. SCHRAMM, Perlenlied und Thomas-Evangelium, 1985; K. DIETZFELBINGER, Apokryphe Evangelien aus Nag Hammadi, 1988; W.C. VAN UNNIK, Evangelien aus dem Nilsand, 1960 sowie T.O. LAMBDIN, The Gospel According to Thomas, in B. LAYTON, Nag Hammadi Codex II, 53ff. Ergänzend sei schließlich auf die hervorragenden Forschungs-Berichte von P. PRIGENT, L’Évangile selon Thomas: État de la Question, RHPR 39, 1959, 39ff; E. HAENCHEN, Literatur zum Thomasevangelium, ThR 27, 1961/2, 147ff.306ff; K. RUDOLPH, Gnosis und Gnostizismus, ThR 34, 1969, 121ff,181ff u. 359ff; F.T. FALLON - R. CAMERON in ANRW II, 25/26, 1988, 4195ff; S.J. PATTERSON, The Gospel of Thomas and the Synoptic Tradition in F & F Forum 8,1-2, 1992 sowie G.J. RILEY, The Gospel of Thomas in the Recent Scholarship, Currents in Research, Biblical Studies 2, 1994, 227ff verwiesen. Einen bemerkenswerten „spirituellen Kommentar“ zum EvThom bietet G.M. MARTIN, Das Thomas-Evangelium, 1998. Eine besonders sorgfältige Textausgabe in Koptisch, Deutsch und Englisch enthält schließlich die 15. Auflage der Synopsis Quattuor Evangeliorum v. K. ALAND, 1996, ausgeführt von dem Berliner Arbeitskreis für koptisch-gnostische Schriften, unter Initiative von H.-M. SCHENKE und Federführung von H.-G. BETHGE. Dieser Ausgabe und auch der Übersetzung folge ich auch im folgenden (mit kleineren von mir erläuterten Abweichungen, auch unter Berücksichtigung der Ausführungen von P. NAGEL, Neuübersetzung, ZNW 95, 2004, 209ff). Dabei werden nur noch gelegentlich Sigel angewandt, nämlich ( ) für Ausfüllung von größeren Lücken bzw. Ergänzung des Textes, [ ] für Beseitigung von entsprechenden Fehlern und [( )] für beides zugleich.
Die Überschriften zu den einzelnen Logien sind von mir in ( ) hinzugefügt und vorangestellt und gehören somit nicht zum ursprünglichen Text.
B. ZUR FRAGE DES HISTORISCHEN JESUS
Eine historisch-kritische Arbeit wie die folgende erfordert eine sorgfältige Besinnung über die Kriterien, nach denen sie in ihrer Durchführung vorgehen will. Dazu sei einführend besonders auf die nachfolgenden Merkmale hingewiesen, die für die Einbeziehung einer Tradition in die Verkündigung und das Leben des historischen Jesus angewandt werden sollen. Dabei muss freilich betont werden, dass diese Besinnung wie jede Beschäftigung mit der Vergangenheit immer nur fragmentarische, vorläufige und wandelbare Ergebnisse zeitigen und daher nicht mit der Wirklichkeit hinter den Zeugnissen gleichgesetzt werden kann (deshalb wird auch genauer statt vom „historischen“ vom „erinnerten Jesus“ gesprochen werden müssen, so DUNN).
1.1. Das zunächst gebrauchte Kriterium ist das der Unableitbarkeit oder jedenfalls Differenz der authentischen Jesustradition sowohl im Hinblick auf das zeitgenössische Judentum als auch auf die Urchristenheit. Besonders kennzeichnend sind dabei die Überlieferungs-Stücke, die einerseits die christliche Gemeinde erkennbar gestört haben oder ihr anstößig waren, und andererseits diejenigen, die zur Verwerfung durch Teile des Judentums geführt haben. Dieses sog. Differenz-Kriterium hat angesichts der historischen Ablehnung Jesu durch eine Mehrheit des zeitgenössischen Judentums, aber auch eines feststellbaren Abdriftens der christlichen Gemeinde von der Jesus-Tradition trotz der dagegen erhobenen Einwendungen seine bleibende Bedeutung. Allerdings ist G. THEISSEN u.a. darin Recht zu geben, dass es flankiert werden muss durch ein historisches Plausibilitäts-Kriterium, das mit erheblichen, ja grundlegenden Wirkungen Jesu auf das Urchristentum rechnet und das auch seine prinzipielle und unaufgebbare Einbindung in den frühjüdischen Verband berücksichtigt. Die Jesus-Überlieferungen müssen daher als charakteristische individuelle Erscheinungen im frühjüdischen Kontext gesehen werden. Gleichzeitig sollte eine historische WirkungsPlausibilität im urchristlichen Rahmen zu erkennen sein (s. im einzelnen näher G. THEISSEN - A. MERZ, Der historische Jesus, 1996, bes. 116ff; G. THEISSEN - D. WINTER, Die Kriterien der Jesusforschung, 1997; J. BECKER, Jesus von Nazaret, 1996, 17f u.a.).
1.2. Ferner ist ein weiteres entscheidendes Kriterium die Konsequenz der Überlieferung, ihr Zusammenhang im Gesamtbild der Verkündigung und des Wirkens Jesu und somit besonders die Kohärenz des überlieferten Materials mit unzweifelhaft echtem Gut. Dazu gehört auch eine gute Einbettung in den gesamten Rahmen der feststellbaren Biografie und Verkündigung Jesu selbst. Auch insofern sei näher auf THEISSEN - MERZ und BECKER verwiesen.
2.1. Zusätzlich ist das Kriterium der vielfachen Bezeugung in den verschiedenen Überlieferungssträngen und -formen erheblich (wie besonders J.D. CROSSAN, Der historische Jesus, 1994, 28ff, 563ff, aber auch schon Norman PERRIN, Was lehrte Jesus wirklich?, 1967, 40ff betont haben). Das sollte direkt in jedenfalls zwei voneinander unabhängigen und möglichst alten Überlieferungslinien oder -formen der Fall sein.
2.2. Die mehrfache Bezeugung kann auch indirekt in einer noch größeren Ansammlung von zumindest einander ähnlichen, sich nahe stehenden und früh anzusetzenden Stücken der Jesus-Tradition vorliegen. Es kann sich um Wort-Traditionen, aber auch um Handlungs- bzw. EreignisTraditionen handeln, die sich zudem wechselseitig stützen können.
Dabei sind alle diese Maßstäbe unter näherer Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden allgemein-wissenschaftlichen, religions- und traditionsgeschichtlichen, quellen-, literar- und oralitäts-kritischen sowie form- und redaktionsgeschichtlichen Methoden anzuwenden. Es sind aber auch, wie schon J. JEREMIAS, Theologie, 1997, 13ff betont hat, sprachliche, psychologische und sozialwissenschaftliche Gesichtspunkte maßgeblich einzubeziehen, bis hin zu dem Versuch einer ganzheitlichen Betrachtungsweise.
Die Gesichtspunkte zu 1. und 2. sollen einander komplementär ergänzen: Je stärker ein Gesichtspunkt zu 1.1. bzw. 1.2. zu Buche schlägt, also ein frühes Jesus zugeschriebenes Traditionsstück im Vergleich mit dem Urchristentum und Judentum historisch plausibel und von charakteristischer Eigenart ist sowie mit dem herausgearbeiteten sonstigen Jesus-Gut kohärent ist, desto weniger bedarf es der Bezeugung durch besonders viele Traditionen. Je umfassender andererseits die Bezeugung eines solchen Stücks durch mehrfache und als alt und ursprünglich ausgewiesene Überlieferungen vorliegt, desto weniger müssen die inhaltlichen Kriterien zu 1.1 bzw. 1.2 vorliegen. Die Ursprünglichkeit der jeweiligen Überlieferung ist in jedem Fall durch text- und literarkritische, redaktions- und traditions- sowie formgeschichtliche Untersuchung abzuklären. Grundsätzlich sollte versucht werden, jeweils beide Gesichtspunkte zu 1. und 2. in Anschlag zu bringen, um die Gefahren der Einseitigkeit einer Methode, insbesondere einer bloß statistischen Betrachtungsweise zu vermeiden und auch nicht in die Falle einer Projektion persönlicher Überzeugungen zu treten (so im Ergebnis auch die vom Jesus-Seminar, vgl. R.W. FUNK, R.W. HOOVER and the JS., Five Gospels, 1993, 2ff u. von G. LÜDEMANN, Jesus nach 2000 Jahren, 2000, 14ff verwendeten Kriterien; dabei ist das noch genannte „Anstößigkeits-Kriterium“ natürlich unter das modifizierte Differenzkriterium zu subsumieren, das „Wachstumskriterium“ entspricht der Forderung nach Einbeziehung der gesamten Traditions-, Form- und Redaktions-Geschichte, und die „Unechtheitskriterien“ sind allemal die Kehrseite der positiven Echtheitskriterien; s. auch noch ergänzend zur neueren Entwicklung J.P. MEIER, A Marginal Jew, 1994, 167ff; B.D. CHILTON - C.A. EVANS (ed.), Studying the Historical Jesus. Evaluations of the State of Current Research, 1994; B. WITHERINGTON III, The Jesus Quest. The Third Search for the Jew of Nazareth, 1995; N.T. WRIGHT, The New Testament and the People of God, 1992, 81ff sowie Jesus and the Victory of God, 1996, u. zusammenfassend T. SCHRAMM, Festschr. W. Popkes, 1996, 257ff u. THEISSEN-MERZ, Der historische Jesus, 21ff).
3. Hinzukommt insgesamt noch zu Inhalt und Form der Bezeugung (1. und 2.) die Person des/der Zeugen, die allerdings oft noch unsicherer, dennoch nicht völlig unwichtig ist, weil damit die Kontinuität und Zuverlässigkeit der Bezeugung bekräftigt werden kann. Das ist besonders bei der Bezeugung aus dem näheren oder weiteren Kreis der Schüler/-innen (= Jünger/-innen) des historischen Jesus der Fall.





























