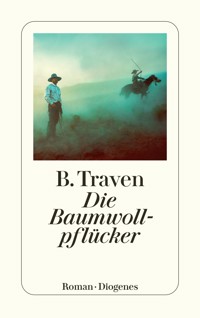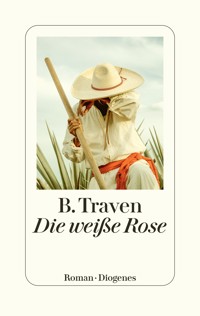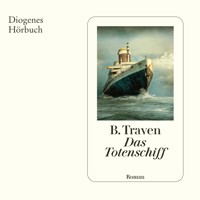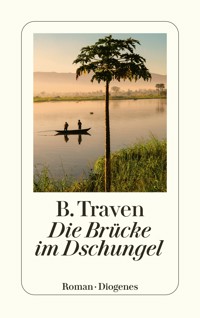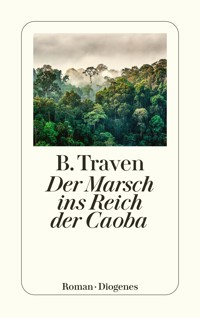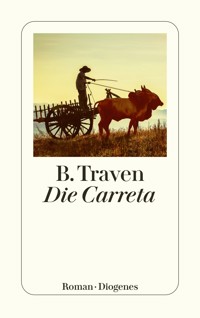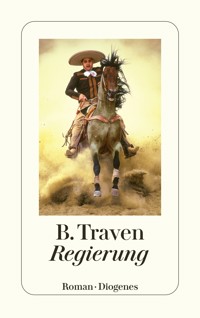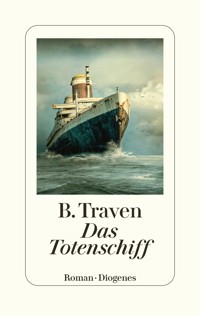
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der amerikanische Seemann Gales verpasst in den Kneipen Antwerpens sein Schiff, auf dem sich sein einziges Identitätsdokument befindet, wird als Staatenloser über europäische Landesgrenzen abgeschoben und heuert schließlich in Barcelona auf dem Schiff ›Yorikke‹ mit illegaler Ladung und Besatzung und höllischen Arbeitsbedingungen an. Und es kommt noch schlimmer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
B. Traven
Das Totenschiff
roman
Mit einem Nachwort von Volker Kutscher
Diogenes
Erstes Buch
Song of an American Sailor
Now stop that crying, honey dear,
The Jackson Square remains still here
In sunny New Orleans
In lovely Louisiana
She thinks me buried in the sea,
No longer does she wait for me
In sunny New Orleans
In lovely Louisiana
The death-ship is it I am in,
All I have lost, nothing to win
So far off sunny New Orleans
So far off lovely Louisiana
Lied eines amerikanischen Seemanns
Mädel, heul doch nicht so sehr,
Wart auf mich am Jackson Square
Im sonn’gen New Orleans
Im schönen Louisiana
Mein Mädel glaubt, ich lieg’ im Meer,
Sie steht nicht mehr am Jackson Square
Im sonn’gen New Orleans
Im schönen Louisiana
Doch ich lieg’ nicht an einem Riff,
Ich fahre auf dem Totenschiff
So fern vom sonn’gen New Orleans
So fern vom schönen Louisiana
1
Wir hatten eine volle Schiffsladung Baumwolle von New Orleans rübergebracht nach Antwerpen mit der S.S. Tuscaloosa. Sie war ein feines Schiff. Verflucht noch mal, das ist wahr. First rate Steamer, made in U.S.A. Heimathafen New Orleans. O du sonniges, lachendes New Orleans, so ungleich den nüchternen Städten der vereisten Puritaner und verkalkten Kattunhändler des Nordens! Und was für herrliche Quartiere für die Mannschaft! Endlich einmal ein Schiffbauer, der den revolutionären Gedanken gehabt hatte, dass die Mannschaft auch Menschen seien und nicht nur Hände. Alles sauber und nett. Bad und viel saubere Wäsche und alles moskitodicht. Die Kost war gut und reichlich. Und es gab stets saubere Teller und geputzte Messer, Gabeln und Löffel. Da waren schwarze Boys, die nichts andres zu tun hatten, als die Quartiere sauber zu halten, damit die Mannschaft gesund bliebe und bei guter Laune. Die Kompanie hatte endlich entdeckt, dass sich eine gut gelaunte Mannschaft besser bezahlt macht als eine verlotterte.
Zweiter Offizier? No, Sir. Ich war nicht Zweiter Offizier auf diesem Eimer. Ich war einfacher Deckarbeiter, ganz schlichter Arbeiter. Sehen Sie, Herr, Matrosen gibt es ja kaum noch, werden auch gar nicht mehr verlangt. So ein modernes Frachtschiff ist gar kein eigentliches Schiff mehr. Es ist eine schwimmende Maschine. Und dass eine Maschine Matrosen zur Bedienung braucht, glauben Sie ja gewiss selbst nicht, auch wenn Sie sonst nichts von Schiffen verstehen sollten. Arbeiter braucht diese Maschine und Ingenieure. Sogar der Skipper, der Kapitän, ist heute nur noch ein Ingenieur. Und selbst der A.B., der am Ruder steht und noch am längsten als Matrose angesehen werden konnte, ist heute nur noch ein Maschinist, nichts weiter. Er hat nur die Hebel auszulösen, die der Rudermaschine die Drehungsrichtung angeben.
Die Romantik der Seegeschichten ist längst vorbei. Ich bin auch der Meinung, dass solche Romantik nie bestanden hat. Nicht auf Segelschiffen und nicht auf der See. Diese Romantik bestand lediglich in der Fantasie der Schreiber jener Seegeschichten. Jene verlogenen Seegeschichten haben manchen braven Jungen hinweggelockt zu einem Leben und zu einer Umgebung, wo er körperlich und seelisch zu Grunde gehen musste, weil er nichts sonst dafür mitbrachte als seinen Kinderglauben an die Ehrlichkeit und an die Wahrheitsliebe der Geschichtenschreiber. Möglich, dass für Kapitäne und Steuerleute eine Romantik einmal bestanden hat. Für die Mannschaft nie. Die Romantik der Mannschaft ist immer nur gewesen: unmenschlich harte Arbeit und eine tierische Behandlung. Kapitäne und Steuerleute erscheinen in Opern, Romanen und Balladen. Das Hohelied des Helden, der die Arbeit tut, ist nie gesungen worden. Dieses Hohelied wäre auch zu brutal gewesen, um das Entzücken derer wachzurufen, die das Lied gesungen haben wollten. Yes, Sir.
Ich war nur eben gerade schlichter Deckarbeiter, das war alles. Musste alle Arbeit machen, die vorkam. Ganz ehrlich gesagt, ich war nur ein Anstreicher. Die Maschine läuft von selbst. Und da die Arbeiter beschäftigt werden müssen und andre Arbeit nur in Ausnahmefällen vorkommt, wenn nicht Laderäume gereinigt werden sollen oder etwas repariert werden muss, so wird eben immer angestrichen. Von morgens bis abends, und das hört nie auf. Da ist immer etwas, was angestrichen werden muss. Eines Tages wundert man sich dann ganz ernsthaft über dieses ewig währende Anstreichen, und man kommt ganz nüchtern zu der Auffassung, dass alle übrigen Menschen, die nicht zur See fahren, nichts andres tun, als Farbe anzufertigen. Dann empfindet man eine tiefe Dankbarkeit gegen diese Menschen, weil, wenn sie sich eines Tages weigerten, noch weiter Farbe zu machen, der Deckarbeiter nicht wüsste, was er nun tun soll, und der Offizier, unter dessen Kommando die Deckarbeiter stehen, in Verzweiflung geriete, weil er nicht wüsste, was er nun den Deckhands kommandieren soll. Sie können doch ihr Geld nicht umsonst bekommen. No, Sir.
Der Lohn war ja nicht gerade hoch. Das könnte ich nicht behaupten. Aber wenn ich fünfundzwanzig Jahre lang keinen Cent ausgäbe, jede Monatsheuer sorgfältig auf die andre legte, während der ganzen Zeit nie ohne Arbeit wäre, dann könnte ich nach Ablauf jener fünfundzwanzig Jahre unermüdlichen Arbeitens und Sparens mich zwar nicht zur Ruhe setzen, könnte aber nach weiteren fünfundzwanzig Jahren Arbeitens und Sparens mich mit einigem Stolz zur untersten Schicht der Mittelklasse zählen. Zu jener Schicht, die sagen darf: Gott sei gelobt, ich habe einen kleinen Notpfennig auf die Seite gelegt für Regentage. Und da diese Volksschicht jene gepriesene Schicht ist, die den Staat in seinen Fundamenten erhält, so würde ich dann ein wertvolles Mitglied der menschlichen Gesellschaft genannt werden können. Dieses Ziel erreichen zu können, ist fünfzig Jahre Sparens und Arbeitens wert. Das Jenseits hat man sich dann gesichert und das Diesseits für andre.
Ich machte mir nichts daraus, mir die Stadt anzusehen. Ich mag Antwerpen nicht leiden. Da treiben sich so viele Huren, schlechte Seeleute und ähnliche Elemente herum. Yes, Sir.
Aber die Dinge im Leben spielen sich nicht so einfach ab. Sie nehmen nur selten Rücksicht auf das, was man leiden mag und was nicht. Es sind nicht die Felsen, die den Lauf und den Charakter der Welt bestimmen, sondern die kleinen Steinchen und Körnchen.
Wir konnten keine Ladung bekommen und sollten darum in Ballast heimgehen. Die ganze Mannschaft war in die Stadt gegangen am letzten Abend vor der Heimfahrt. Ich war völlig allein im Forecastle. Des Lesens war ich müde, des Schlafens war ich müde, und ich wusste nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Um zwölf war Feierabend gemacht worden, weil dann bereits die Wachen für die Fahrt verteilt wurden. Das war auch der Grund, warum alle in die Stadt gegangen waren, um noch einen scharfen Kleinen mitzunehmen, den wir zu Hause nicht haben konnten.
Bald lief ich zur Reling, um ins Wasser zu spucken, bald wieder lief ich in die Quartiere. Von dem ewigen Anstarren der leeren Quartiere und dem ewigen Herunterglotzen auf die langweiligen Hafenanlagen, Speicher, Stapelhäuser, auf die öden Kontorlöcher mit ihren trüben Fenstern, hinter denen man nichts sah als Briefordner und Haufen von beschriebenen Geschäftspapieren und Frachtbriefen, wurde mir ganz erbärmlich zumute. Es war so unsagbar trostlos. Es ging auf den Abend zu, und es war kaum eine Menschenseele in diesem Teil des Hafens zu sehen.
Es überkam mich eine ganz gewöhnliche Sehnsucht nach dem Gefühl, festen Boden, Erde, unter meinen Füßen zu haben, eine Sehnsucht nach einer Straße und nach Menschen, die schwatzend durch die Straße schlendern. Das war es: Ich wollte eine Straße sehen, just eine Straße, nichts weiter. Eine Straße, die nicht von Wasser umgeben ist, eine Straße, die nicht schwankt, die ganz fest steht. Ich wollte meinen Augen ein kleines Geschenk machen, ihnen den Anblick einer Straße gönnen.
»Da hätten Sie früher kommen sollen«, sagte der Offizier, »ich gebe jetzt kein Geld heraus.«
»Ich brauche aber unbedingt zwanzig Dollar Vorschuss.«
»Fünf können Sie haben, nicht einen Cent mehr.«
»Mit einem Fünfer kann ich gar nichts anfangen. Ich muss zwanzig haben, sonst bin ich morgen krank. Wer soll denn dann vielleicht die Galley anstreichen? Vielleicht wissen Sie das? Ich muss zwanzig haben.«
»Zehn. Aber das ist nun mein letztes Wort. Zehn oder überhaupt nichts. Ich bin gar nicht verpflichtet, Ihnen auch nur einen Nickel zu geben. Nicht meine Sache.«
»Gut, geben Sie zehn. Das ist zwar ein ganz gemeiner Geiz, der hier an mir verübt wird, aber wir müssen uns ja alles gefallen lassen, das ist man nun schon gewöhnt.«
»Unterschreiben Sie die Quittung. Wir werden es morgen in die Listen übertragen. Dazu habe ich jetzt keine Lust.«
Da hatte ich meinen Zehner. Ich wollte ja überhaupt nur zehn haben. Hätte ich aber gesagt zehn, so würde er auf keinen Fall mehr als fünf gegeben haben, und mehr als zehn konnte ich nicht gebrauchen, weil ich nicht mehr ausgeben wollte; denn was man einmal in der Tasche hat, kehrt nicht mehr heim, wenn man erst in die Stadt geht.
»Betrinken Sie sich nicht. Das ist hier ein ganz böser Platz«, sagte der Offizier, als er die Quittung an sich nahm.
Das war eine unerhörte Beleidigung. Der Skipper, die Offiziere und die Ingenieure betranken sich zweimal des Tages, solange wir nun schon hier lagen, aber mir wird gepredigt, mich nicht zu betrinken. Ich dachte gar nicht daran. Warum auch? Es ist so dumm und so unvernünftig.
»Nein«, gab ich zur Antwort, »ich nehme niemals einen Tropfen von diesem Gift. Ich weiß, was ich meinem Lande selbst in der Fremde schuldig bin. Yes, Sir. Ich bin Abstinenzler, knochentrocken. Können sich drauf verlassen, das bin ich. Schwöre, Hand aufs Herz.« Raus war ich und runter vom Eimer.
2
Es war eine lange, wunderschöne Sommerdämmerung. Ich schlurkste zufrieden mit der Welt durch die Straßen und konnte mir nicht denken, dass irgendjemand auf der Welt sei, dem diese Welt nicht gefallen möchte. Ich sah mir die Schaufenster an, und ich sah mir die Leute an, denen ich begegnete. Hübsche Mädels, verflucht noch mal, alles, was recht ist. Manche freilich beachteten mich gar nicht; die aber, die mich anlachten, waren gerade die hübschesten. Und wie nett sie lachen konnten! Dann kam ich zu einem Hause, dessen Front herrlich vergoldet war. Es sah so lustig aus, das ganze Haus und die Vergoldung. Die Türen waren weit offen und sagten: ›Komm nur rein, Freund, gerade für eine kleine Weile. Setz dich, mach dir’s bequem, und vergiss deine Sorgen.‹ Ich hatte überhaupt keine Sorgen, aber es war doch drollig, dass jemand zu einem sagte, man möge die Sorgen vergessen. Das war so lieb. Und drinnen, in dem Hause, da waren schon eine ganze Menge Leute, und die waren alle so lustig, hatten ihre Sorgen vergessen, sangen und lachten, und da war so eine vergnügte Musik. Nur um zu sehen, ob das Haus drinnen ebenso vergoldet sei wie draußen, ging ich hinein und setzte mich auf einen Stuhl. Sofort kam ein Bursche, lachte mich an und setzte mir eine Flasche und ein Glas gerade vor die Nase. Man musste es mir wohl an der Nasenspitze ansehen, denn er sagte sofort in Englisch: »Bedienen Sie sich, mon ami, und seien Sie vergnügt wie alle die Übrigen hier.«
Nur fröhliche Gesichter rundherum, und wochenlang hat man nichts weiter vor Augen gehabt als Wasser und stinkende Farbe. Und so war ich halt vergnügt, und von jenem Augenblick an konnte ich mich auf nichts Bestimmtes mehr besinnen. Ich tadele nicht jenen freundlichen Burschen, wohl aber die öden Predigten, die uns so schwach gegenüber Versuchungen machen. Predigten machen immer schwach, weil es einem in der Natur liegt, ihnen nicht zu folgen.
Die ganze Zeit hindurch war ein ganz drolliger Nebel immer um mich herum, und spät in der Nacht fand ich mich in dem Zimmer eines hübschen lachenden Mädchens. Endlich sagte ich zu ihr: »Well, Mademoiselly, wie spät haben wir es denn?«
»Oh«, sagte sie mit ihrem hübschen Lachen, »du hübscher Junge« – yes, Gentlemen, ganz gewiss, das sagte die Mademoiselly zu mir –, »hübscher Junge, o du hübscher Junge«, sagte sie, »nun sei kein Spaßverderber, sei ein Kavalier, lass eine zarte junge Dame nicht allein um Mitternacht. Da können vielleicht Einbrecher in der Nähe sein, und ich bin so schrecklich furchtsam, die Einbrecher könnten mich vielleicht gar ermorden.«
Na, ich kenne doch die Pflicht eines rotblütigen amerikanischen Jungen unter solchen Umständen, wenn er ersucht wird, einer hilflosen schwachen Dame beizustehen. Von meinem ersten Atemzuge an ist mir gepredigt worden: Benimm dich anständig in Gegenwart von Damen, und wenn dich eine Dame um etwas bittet, dann hast du zu flitzen und es zu tun, selbst wenn es dich das Leben kosten sollte.
Gut, am Morgen, sehr früh, sauste ich raus zum Hafen. Aber da war keine Tuscaloosa zu sehen. Der Platz, wo sie gelegen hatte, war leer. Sie war heimgegangen nach dem sonnigen New Orleans, heimgegangen, ohne mich mitzunehmen.
Ich habe Kinder gesehen, die sich verlaufen hatten und denen die Mutter abhandengekommen war; ich habe Leute gesehen, denen ihr Häuschen abgebrannt oder von Wasserfluten fortgeschwemmt war, und ich habe Tiere gesehen, denen ihr Gefährte abgeschossen oder weggefangen war. Das alles war sehr traurig. Aber das Traurigste aller Dinge ist ein Seemann in fremdem Lande, dem soeben sein Schiff fortgefahren ist, ohne ihn mitzunehmen. Der Seemann, der zurückgeblieben ist. Der Seemann, der übrig geblieben ist.
Es ist nicht das fremde Land, das seine Seele bedrückt und das ihn weinen macht wie ein kleines Kind. Er ist fremde Länder gewöhnt. Er ist oft freiwillig zurückgeblieben und hat abgemustert aus Gründen irgendwelcher Art. Da fühlt er sich nicht traurig oder bedrückt. Aber wenn das Schiff, das seine Heimat ist, wegfährt, ohne ihn mitzunehmen, dann kommt zu dem Gefühl der Heimatlosigkeit das tötende Gefühl des Überflüssigseins. Das Schiff hat nicht auf ihn gewartet, es kann ohne ihn fertig werden, es braucht ihn nicht. Ein alter Nagel, der irgendwo herausfällt und zurückbleibt, kann dem Schiff zum Verhängnis werden; der Seemann, der sich gestern noch so wichtig dünkte für das Wohl und für das Wandern des Schiffes, ist heute weniger wert als jener alte Nagel. Der Nagel könnte nicht entbehrt werden, der Seemann, der übrig gebliebene, wird nicht vermisst, die Kompanie spart seinen Lohn. Ein Seemann ohne Schiff, ein Seemann, der nicht zu einem Schiff gehört, ist weniger als der Dreck auf der Gasse. Er gehört nirgends hin, niemand will etwas mit ihm zu tun haben. Wenn er jetzt da ins Meer springt und ersäuft wie eine Katze, niemand vermisst ihn, niemand wird nach ihm suchen. »Ein Unbekannter, offenbar ein Seemann«, das ist alles, was von ihm gesagt wird.
Das ist ja recht lieblich, dachte ich, und jener Welle des Verzagtseins gab ich rasch ordentlich eins auf den Kamm, sodass sie sich davonmachte. Mache das Beste aus dem Schlechten, und das Schlechte verschwindet im Augenblick.
Gosh, schiet den ollen Eimer, da sind andre Schiffe in der Welt, die Ozeane sind ja so groß und so weit. Kommt ein andres, ein besseres. Wie viel Schiffe gibt es auf der Welt? Sicher eine halbe Million. Davon wird doch eines einmal einen Deckarbeiter gebrauchen können. Und Antwerpen ist ein großer Hafen, da kommen sicher alle diese halbe Million Schiffe einmal her, irgendwann und irgendeinmal sicher. Man muss nur Geduld haben. Ich kann doch nicht erwarten, dass gleich da drüben schon so ein Kasten liegt und der Kapitän in Todesangst schreit: »Herr Deckarbeiter, kommen Sie schnell rauf zu mir, ich brauche einen Deckarbeiter, gehen Sie nicht zum Nachbarn, ich flehe Sie an.«
So sehr kümmerte ich mich auch wahrhaftig nicht um die treulose Tuscaloosa. Wer hätte das von diesem schönen Weibsbild gedacht? Aber so sind sie, alle, alle. Und sie hatte so saubere Quartiere und ein so gutes Essen. Jetzt haben sie gerade Breakfast, diese verfluchten Halunken, und essen meine Portion Ham and Eggs mit. Wenn sie wenigstens noch der Slim kriegen wollte, denn diesem Hund von einem Bob gönne ich sie nicht. Aber der wird ja gleich der Erste sein, der meine Sachen durchstöbert und sich das Beste heraussucht, ehe sie abgeschlossen werden. Diese Banditen werden die Sachen überhaupt nicht abschließen lassen, sie werden sie glatt unter sich verteilen und sagen, ich hätte nichts gehabt, diese Banditen, diese niederträchtigen. Dem Slim ist ja auch nicht zu trauen, er stahl mir so schon immer die Toilettenseife, weil er sich mit der Kernseife nicht waschen wollte, dieser geschniegelte Broadwayhengst. Yes, Sir, das machte der Slim, Sie hätten das nicht von ihm geglaubt, wenn Sie ihn gesehen hätten. Wahrhaftig nicht, so sehr kümmerte ich mich nicht um den davongelaufenen Kasten. Aber was mich ernsthaft bekümmerte, war: Ich hatte nicht einen roten Cent in meiner Tasche. Jenes hübsche Mädchen erzählte mir in der Nacht, dass ihre so herzinnig geliebte Mutter schwer krank sei und sie hätte kein Geld, um Arznei und kräftiges Essen zu kaufen. Ich wollte für den Tod der Mutter nicht verantwortlich sein, deshalb gab ich dem hübschen Mädchen alles Geld, das ich bei mir trug. Ich wurde reichlich belohnt durch die tausend beglückten Danksagungen des Mädchens. Gibt es irgendetwas in der Welt, das beglückender wäre als die tausend Danksagungen eines hübschen Mädchens, dessen geliebte Mutter man soeben vom Tode errettet hat? No, Sir.
3
Ich setzte mich auf eine große Kiste, die da lag, und folgte der Tuscaloosa auf ihrem Wege über das Meer. Ich hoffte und wünschte, dass sie auf einen Felsen aufrennen möchte und so gezwungen wäre, zurückzukommen oder wenigstens die Mannschaft auszubooten und zurückzuschicken. Aber sie ging den Felsenriffen schön aus dem Wege, denn ich sah sie nicht zurückkommen. Jedenfalls wünschte ich ihr von Herzen alle Unglücksfälle und Schiffbrüche, die einem Schiffe nur begegnen können. Was ich mir aber am deutlichsten ausmalte, das war, dass sie Seeräubern in die Hände fiele, die das ganze Schiff von oben bis unten ausplündern und dem Biest Bob die ganzen Sachen wieder abnehmen würden, die er sich ja nun inzwischen wohl angeeignet haben wird, und dass sie ihm eins so mächtig auf seine grinsende Fratze hauten, dass ihm sein Grinsen und Sticheln für sein ganzes Leben verginge. Gerade als ich mich anschickte, ein wenig einzudröseln und von jenem hübschen Mädchen zu träumen, klopfte mir jemand auf die Schulter und weckte mich auf. Er begann sofort so rasend schnell auf mich einzureden, dass mir ganz schwindlig wurde.
Ich wurde wütend und sagte ärgerlich: »Oh rats, lassen Sie mich in Ruh; ich mag Ihr Gequassel nicht. Außerdem verstehe ich nicht ein einziges Wort von Ihrem Geklatter. Scheren Sie sich zum Teufel!«
»Sie sind Engländer, nicht wahr?«, fragte er nun in Englisch.
»No, Yank.«
»Aha, also Amerikaner.«
»Yes, und nun lassen Sie mich ungeschoren, und machen Sie, dass Sie fortkommen. Ich will mit Ihnen nichts zu tun haben.«
»Aber ich mit Ihnen, ich bin von der Polizei.«
»Da haben Sie aber Glück, lieber Freund, guter Posten«, sagte ich darauf. »Was ist denn los? Geht es Ihnen dreckig, oder was haben Sie sonst für Sorgen?«
»Seemann?«, fragte er weiter.
»Yes, old man. Haben Sie vielleicht einen Posten für mich?«
»Von welchem Schiff?«
»Tuscaloosa von New Orleans.«
»Ist rausgegangen um drei Uhr morgens.«
»Ich brauche Sie nicht, damit mir das erzählt wird. Dieser Witz ist schon sehr alt und stinkt bereits straßenweit.«
»Wo haben Sie Ihre Papiere?«
»Was für Papiere?«
»Ihre Seemannskarte.«
Ei, Schokoladencreme mit Appelsoße! Meine Seemannskarte? Die steckte in meiner Jacke, und die Jacke war in meinem Kleidersack, und mein Kleidersack lag mollig unter meiner Bunk in der Tuscaloosa, und die Tuscaloosa war – ja, wo konnte sie jetzt sein? Wenn ich nur wüsste, was sie heute für Breakfast bekommen haben! Den Speck hat der Schwarze sicher wieder anbrennen lassen, na, ich will ihm mal etwas erzählen, wenn ich die Galley streichen komme.
»Ihre Seemannskarte! Verstehen doch, was ich meine?«
»Meine Seemannskarte. Wenn Sie die meinen sollten, nämlich meine Seemannskarte. Da muss ich Ihnen doch die Wahrheit gestehen. Ich habe keine Seemannskarte.«
»Keine Seemannskarte?« Das hätte man hören müssen, in welch einem entgeisterten Ton er das sagte. Ungefähr so, als ob er sagen wollte: »Was, Sie glauben nicht, dass es Meerwasser gibt?«
Ihm war das unfassbar, dass ich keine Seemannskarte hatte. Er fragte es zum dritten Male. Aber während er es diesmal fragte, offenbar rein mechanisch, hatte er sich von seinem Erstaunen erholt und fügte hinzu: »Keine andern Papiere, Pass oder Identitätskarte oder etwas Ähnliches?«
»Nein.« Ich durchsuchte meine Taschen emsig, obgleich ich genau wusste, dass ich nicht einmal einen leeren Briefumschlag mit meinem Namen bei mir hatte.
»Kommen Sie mit mir!«, sagte darauf der Mann.
»Wohin kommen?«, fragte ich, denn ich wollte doch wissen, was der Mann vorhat und auf welches Schiff er mich verschleppen will. Auf ein Kontrabandboot gehe ich nicht, das kann ich ihm schon jetzt vorher erzählen. Da kriegen mich keine zehn Pferde mehr rauf.
»Wohin? Das werden Sie gleich sehen.« Dass der Mann besonders freundlich gewesen wäre, hätte ich nicht behaupten können, aber die Heuerbaase sind ja nur dann schietfreundlich, wenn sie für einen Kasten durchaus niemand kriegen können. Das also schien hier ein ganz wackeres Bötchen zu sein, auf das er mich bringen wollte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell wieder auf einen Eimer kommen würde. Glück muss man haben und nur nicht immer gleich verzagen. Endlich landeten wir. Wo? Richtig geraten, Sir, in der Polizeistation. Da wurde ich nun gleich gründlich durchsucht. Als sie mich durch und durch gesucht hatten und ihnen keine Naht mehr ein Geheimnis war, fragte mich der Mann ganz trocken: »Keine Waffe? Keine Werkzeuge?« Na, da hätte ich ihm aber doch so schlankweg eine brennen können. Als ob ich ein Maschinengewehr in der oberen Hälfte des Nasenloches und eine Brechstange unter dem Augenlid hätte verstecken können! Aber so sind die Leute. Wenn sie nichts finden, behaupten sie, man habe es versteckt; denn dass man das nicht besitzt, wonach sie suchen, das können sie nicht begreifen und lernen sie auch nie begreifen. Damals wusste ich das noch nicht.
Dann hatte ich mich vor einem Schreibpult aufzustellen, an dem ein Mann saß, der mich immer so ansah, als hätte ich seinen Überzieher gestohlen. Er öffnete ein dickes Buch, in dem viele Fotografien waren. Der Mann, der mich hierher gebracht hatte, spielte den Übersetzer, weil wir uns sonst nicht hätten verständigen können. Als sie unsre Jungens brauchten, im Kriege, da haben sie uns verstanden; jetzt ist das längst vorbei, und da brauchen sie nichts mehr zu wissen.
Der Hohepriester, denn so sah er aus hinter seinem Schreibpult, sah immer auf die Fotografien und dann auf mich, oder genauer, auf mein Gesicht. Das tat er mehr als hundertmal, und seine Halsmuskeln wurden nicht müde, so gewohnt war er diese Arbeit. Er hatte viel Zeit, und die nahm er sich auch ganz unbekümmert. Andre mussten es ja bezahlen, warum sollte er sich da beeilen!
Endlich schüttelte er den Kopf und klappte das Buch zu. Offenbar hatte er meine Fotografie nicht gefunden. Ich konnte mich auch nicht erinnern, dass ich mich jemals in Antwerpen hätte fotografieren lassen. Schließlich wurde ich hundemüde von diesem langweiligen Geschäft, und ich sagte: »Jetzt habe ich aber Hunger. Ich habe heute noch kein Frühstück gehabt.«
»Das ist recht«, sagte der Dolmetscher und führte mich in einen schmalen Raum. Viel Möbel waren nicht drin, und die, die drin waren, die waren nicht in einer Kunstwerkstätte angefertigt worden. Aber was ist denn das mit dem Fenster? Merkwürdig, das Zimmer hier scheint für gewöhnlich dazu zu dienen, den belgischen Staatsschatz aufzubewahren. Der Staatsschatz liegt hier sicher, denn es kann ganz bestimmt niemand von draußen hier herein, durchs Fenster einmal sicher nicht, no, Sir.
Ich möchte wissen, ob die Leute das wirklich Frühstück nennen. Kaffee mit Brot und Margarine. Sie haben sich von dem Kriege noch nicht erholt. Was immer auch die Zeitungen schreiben mögen, ein solches Krümchen müssen sie schon vor dem Kriege Frühstück genannt haben, weil es das Minimum an Qualität und Quantität ist, das man gerade noch Frühstück nennen kann, weil man das Stück früh bekommt.
Gegen Mittag wurde ich wieder vor den Hohenpriester gebracht. »Wünschen Sie nach Frankreich zu gehen?«
»Nein, ich mag Frankreich nicht, die Franzosen müssen immer setzen und können nie sitzen. In Europa müssen sie immer besetzen und in Algier immer entsetzen. Und dieses Setzen macht mich nervös, sie können vielleicht Soldaten brauchen und mich, da ich ja keine Seemannskarte habe, unabsichtlich verwechseln und mich für einen ihrer Setzer halten. Nein, nach Frankreich gehe ich auf keinen Fall.«
»Wie denken Sie über Deutschland?«
Was die Leute alles von mir wissen wollen!
»Nach Deutschland mag ich auch nicht gehen.«
»Warum, Deutschland ist doch ein recht hübsches Land, da können Sie auch wieder leicht ein Schiff bekommen.«
»Nein, ich mag die Deutschen nicht. Wenn ihnen die Rechnungen vorgelegt werden, dann sind sie die Entsetzten, und wenn sie die Rechnungen nicht bezahlen können, dann sind sie die Besetzten. Und weil ich doch keine Seemannskarte habe, könnte man mich dort vielleicht auch verwechseln, und ich müsste mit bezahlen. So viel kann ich ja als Deckarbeiter nie verdienen. Da könnte ich nie die unterste Schicht der Mittelklasse erklimmen und ein wertvolles Mitglied der menschlichen Gesellschaft werden.«
»Was reden Sie so viel herum? Sagen Sie einfach, ob Sie dahin wollen oder nicht.«
Ob sie das verstehen, was ich da sage, weiß ich nicht. Aber es scheint, dass sie viel Zeit haben und froh sind, dass eine Unterhaltung im Gange ist.
»Also, dann kurz und bündig und abgemacht, Sie gehen nach Holland«, sagt der Hohepriester, und der Dolmetscher erzählte es mir wieder.
»Ich mag aber die Holländer nicht«, erwiderte ich, und ich will nun auch gleich erzählen, warum, als mir gesagt wird: »Ob Sie die Holländer mögen oder nicht, das geht uns hier gar nichts an. Machen Sie das mit den Holländern ab. In Frankreich wären Sie am besten aufgehoben gewesen. Aber da wollen Sie ja nicht hin. Nach Deutschland wollen Sie auch nicht, das ist Ihnen auch nicht gut genug, und jetzt gehen Sie einfach nach Holland. Fertig und Schluss. Eine andre Grenze haben wir nicht. Ihretwegen können wir uns auch keinen andern Nachbarn aussuchen, der vielleicht Ihre Wertschätzung erwerben könnte, und ins Wasser wollen wir Sie vorläufig noch nicht schmeißen, das ist die einzige Grenze, die uns noch bleibt als letzte. Also nach Holland, und nun Schluss. Seien Sie froh, dass Sie so billig davonkommen.«
»Aber, meine Herren, Sie sind im Irrtum, ich will gar nicht nach Holland. Die Holländer sitzen –«
»Ruhig nun. Die Frage ist entschieden. Wie viel Geld haben Sie?«
»Sie haben doch meine Taschen und Nähte alle durchsucht. Wie viel Geld haben Sie denn gefunden?« Da soll man nun nicht wütend werden. Sie durchsuchen einen stundenlang mit Vergrößerungsgläsern, und dann fragen sie noch ganz scheinheilig, wie viel Geld man habe. »Wenn Sie nichts gefunden haben, dann habe ich kein Geld«, sage ich.
»Das ist gut. Das ist jetzt alles. Nehmen Sie ihn wieder in die Zelle.«
Damit beendete der Hohepriester seine Zeremonien.
4
Am späten Nachmittag wurde ich zum Bahnhof gebracht. Zwei Mann, darunter der Dolmetscher, begleiteten mich. Offenbar dachten sie, ich sei noch nie in meinem Leben mit der Bahn gefahren, denn ich durfte nichts allein tun. Einer löste die Fahrkarten, während der andre dicht bei mir stehen blieb und aufpasste, damit nicht etwa ein Taschendieb sich die vergebliche Arbeit machen sollte, noch einmal meine Taschen durchzusuchen, denn wo einmal die Polizei Taschen durchsucht hat, findet auch der geschickteste Taschendieb keinen Copper mehr.
Der Mann, der die Karten gelöst hatte, gab mir aber meine Karte nicht. Wahrscheinlich dachte er, ich würde sie sofort wieder verkaufen. Sie begleiteten mich dann sehr höflich auf den Bahnsteig und brachten mich zu meinem Abteil. Ich glaubte, sie würden sich hier von mir verabschieden. Aber das taten sie nicht. Sie setzten sich zu mir in das Abteil, und um mich vor dem Hinausfallen zu bewahren, nahmen sie mich in ihre Mitte. Ob belgische Polizeibeamte immer so höflich mit Leuten sind, weiß ich nicht. Ich jedenfalls konnte mich über sie nicht beklagen. Sie gaben mir dann Zigaretten. Wir rauchten, und der Zug dampfte los. Nach einer kurzen Fahrt verließen wir den Zug und kamen in ein kleines Städtchen. Wieder wurde ich zu einer Polizeistation gebracht. Ich musste mich auf eine Bank setzen in jenem Raum, wo sich alle die Polizeibeamten aufhielten, die in Reserve waren. Die beiden Leute, mit denen ich gekommen war, erzählten eine große Geschichte über mich. Die übrigen Cops, ich meine die übrigen Polizeibeamten, glotzten mich alle der Reihe nach an, manche interessiert, als ob sie noch nie einen solchen Mann gesehen hätten, und andre wieder, als hätte ich irgendwo einen Doppelraubselbstmord verübt. Gerade diejenigen, die mich in so verhängnisvoller Weise anstarrten, die mich der Verübung der grässlichsten Verbrechen, deren Täter man noch nicht erwischt hatte, fähig hielten und die mir noch viel schwerere Verbrechen in Zukunft zutrauten, als ich, ihrer untrüglichen Meinung zufolge, schon verübt habe, flößten mir plötzlich den Gedanken ein, dass ich hier auf den Henker zu warten habe, der augenscheinlich nicht zu Hause war und erst gesucht werden musste.
Da war nichts zu lachen, no, Sir. Es war eine sehr ernste Sache. Man braucht nur ein wenig darüber nachzudenken. Ich hatte keine Seemannskarte, ich hatte keinen Pass, ich hatte keinen Identitätsausweis, ich hatte kein sonstiges Papier, und meine Fotografie hatte der Hohepriester in seinem dicken Buche auch nicht gefunden. Wenn da wenigstens noch meine Fotografie gewesen wäre, dann hätte er doch gleich gewusst, wer ich bin. Von der Tuscaloosa achtern abgeblieben zu sein, das konnte jeder erzählen, der sich da herumtrieb. Eine Wohnung hatte ich nirgendwo auf der Welt. Entweder ein Eimer oder eine Seemannsherberge. Mitglied irgendeiner Handelskammer war ich auch nicht. Ich war eben ein Niemand. Na, nun frage ich, warum sollten die armen Belgier einen Niemand durchfüttern, wo sie doch schon so viele Niemandskinder durchzufüttern haben, die wenigstens immer noch zur Hälfte hierher gehören. Ich aber gehörte mit keiner Hälfte hierhin. Ich war nur eine weitere Ursache, dass sie in Amerika wieder Geld pumpen mussten. Mich zu hängen, war der kürzeste und einfachste Weg, um mich loszuwerden. Ich konnte es ihnen nicht einmal verdenken. Kein Mensch kümmerte sich um mich, kein Mensch würde nach mir fragen, meinen Namen brauchten sie gar nicht einmal in ihre dicken Bücher zu schreiben. Und hängen würden sie mich – ganz sicher. Sie warteten nur noch auf den Henker, der das Geschäft versteht, sonst wäre es ja ungesetzlich und ein Mord.
Wie recht ich hatte. Da war der Beweis. Einer der Cops kam auf mich zu und gab mir zwei dicke Pakete mit Zigaretten, die letzte Gabe an den armen Sünder. Dann gab er mir auch noch Zündhölzer, setzte sich zu mir und radebrechte mit mir, lachte und war freundlich, klopfte mir auf die Schulter und sagte: »Ist nicht so schlimm, Junge, nehmen Sie es nicht zu tragisch. Rauchen Sie, damit Ihnen die Zeit nicht lang wird. Wir müssen warten, bis es finster wird, sonst können wir es nicht gut machen.«
Nicht tragisch nehmen, wenn man gehenkt werden soll. Ist nicht so schlimm. Ich möchte wissen, ob es mit ihm schon mal versucht worden ist, dass er so bestimmt sagen kann: Ist nicht so schlimm. Warten, bis es finster ist. Freilich, bei Tage trauen sie sich nicht so recht, es könnte uns ja vielleicht jemand begegnen, der mich kennt, und dann wäre der Spaß verdorben. Aber es hat ja keinen Zweck, den Kopf hängen zu lassen, er wird bald genug von selber hängen. Und ich rauche erst einmal wie ein Fabrikschlot, damit sie nicht am Ende gar noch die Zigaretten sparen.
Die Zigaretten schmecken nach gar nichts. Das reine Stroh. Verflucht noch mal, ich will nicht hängen. Wenn ich nur wüsste, wie ich hier herauskomme. Aber die sind ja immerfort um mich herum. Und jeder Neue, der abgelöst ist und hereinkommt, glupscht mich an und will von den andern wissen, wer ich bin, warum ich hier sei und wann ich gehängt werde. Und dann grient er übers ganze Gesicht. Ein widerliches Volk. Ich möchte wissen, warum wir denen geholfen haben.
Später bekam ich mein letztes Essen. Aber solche Geizhälse gibt es auf der ganzen Erde nicht mehr. Das nennen sie nun eine Henkersmahlzeit: Kartoffelsalat mit einer Scheibe Leberwurst und ein paar Schnitten Brot mit Margarine. Zum Heulen ist es. Nein, die Belgier sind keine Guten, und es fehlte nicht viel, und ich wäre beinahe verwundet worden, als wir sie aus der Suppe ziehen mussten und unser Geld los wurden. Einer, der mir die Zigaretten gab und mir einzureden versuchte, es sei nicht so schlimm, gehenkt zu werden, sagte nun: »Sie sind doch ein guter Américain, Sie trinken doch keinen Wein, nicht wahr?« Und dabei lachte er mich an. Teufel noch mal, wenn er nicht ein solcher Heuchler wäre mit seinem ›nicht so schlimm‹, man könnte beinahe glauben, dass es auch feine und nette Belgier gibt.
»Guter Amerikaner? Schiet auf Amerika. Ich trinke Wein, aber feste.«
»Das habe ich mir doch gleich gedacht«, sagte der Cop schmunzelnd. »Sie sind echt. Aber was die Mehrzahl betrifft, das ist ja alles Altweiberhumbug. Lasst euch von Tanten und Betschwestern kommandieren. Mich geht es ja nichts an. Aber hier bei uns, da haben wir Männer noch die Hosen an.«
Gosh, da ist endlich einer, der den Pfahl im Fleische sieht. Der Mann kann nicht verloren gehen, er kann durch dickes Wasser bis auf den Grund sehen. Schade um den Mann, dass er Cop ist. Aber wenn er nicht Cop wäre, würde ich wahrscheinlich dieses Riesenglas voll guten Weines, das er jetzt vor mich hinstellte, nie gesehen haben. Prohibition ist eine Schande und eine Sünde, Gott sei’s geklagt. Ich bin sicher, dass wir irgendwann und irgendwo etwas Furchtbares verbrochen haben müssen, weil uns diese köstliche Gottesgabe genommen wurde.
Gegen zehn Uhr abends sagte der Weinspender zu mir: »So, nun ist es Zeit für uns, Seemann, kommen Sie mit mir.«
Was hätte es für Sinn, zu schreien: »Ich will nicht gehenkt werden!«, wenn da vierzehn Mann um einen herum sind, und alle vierzehn vertreten das Gesetz. Das ist eben Schicksal. Zwei Stunden hätte die Tuscaloosa nur zu warten brauchen. Aber zwei Stunden bin ich nicht wert, hier bin ich noch viel weniger wert. Der Gedanke an diese Wertlosigkeit empörte mich aber doch, und ich sagte: »Ich geh nicht mit. Ich bin ein freier Amerikaner, ich werde mich beschweren.«
»Ha!«, schrie einer höhnisch herüber. »Sie sind kein Amerikaner. Beweisen Sie es doch. Haben Sie eine Seemannskarte? Haben Sie einen Pass? Nichts haben Sie. Und wer keinen Pass hat, ist niemand. Mit Ihnen können wir machen, was uns beliebt. Und das werden wir jetzt, und Sie werden nicht gefragt. Raus mit dem Burschen.«
Es war nicht nötig, dass ich mir vielleicht erst noch einen Hieb über den Schädel holte, am Ende war ich ja doch nur der Dumme. So musste ich halt lostrotten.
An meiner linken Seite ging der lustige Mann, der radebrechen konnte, und an meiner rechten Seite ging ein andrer. Wir verließen das kleine Städtchen und befanden uns bald auf offenen Feldern. Es war entsetzlich finster. Der Weg, auf dem wir gingen, war ein holpriger, zerfahrener Landweg, wo man schlecht laufen konnte. Ich hätte nur gern gewusst, wie lange wir so wandern wollten, bis das traurige Ziel erreicht war.
Nun verließen wir auch noch diese elende Straße und bogen in einen Wiesenpfad ein. Eine gute Weile ging es über Wiesen.
Jetzt war es Zeit, abzuhäuten. Aber diese Burschen waren augenscheinlich Gedankenleser. Gerade als ich einen ausschwingen will, um zuerst einmal dem einen Nachbarn einen sanften Bläser an die Kinnbacken zu haken, packt mich der Mann am Arm und sagt: »Nun sind wir da. Jetzt haben wir einander Lebewohl zu sagen.«
Ein entsetzliches Gefühl, wenn man die letzte Minute so klar und trocken heranschleichen sieht. Nicht einmal schleichen. Sie stand gleich ganz nüchtern vor mir. Es wurde mir trocken in der Kehle. Ich hätte gern einen Schluck Wasser gehabt. Aber nun war ja wohl an Wasser nicht mehr zu denken. Die paar Augenblicke würde es auch noch ohne Wasser gehen, das hätten sie mir sicher geantwortet. Ich hätte den Weinspender nicht für einen solchen Heuchler gehalten. Einen Henker stellte ich mir anders vor. Es ist doch ein dreckiges, ein schäbiges Geschäft; als ob es nicht andre Berufe gäbe. Nein, gerade Henker sein, und das sogar noch als Beruf.
Nie vorher im Leben hatte ich so stark gefühlt, wie wunderschön das Leben ist. Wunderschön und über alle Maßen köstlich ist sogar das Leben, wenn man müde und hungrig zum Hafen kommt und erkennt, dass einem das Schiff weggefahren ist und man zurückgelassen ist ohne Seemannskarte. Leben ist immer schön, wenn es auch noch so trübe aussieht. Und in einer so finstern Nacht auf freiem Felde einfach so fortgewischt zu werden, als wäre man nur gerade ein Wurm –! Hätte ich von den Belgiern nicht gedacht. Aber schuld daran ist die Prohibition, die einen so schwach macht gegen Versuchungen.
»Oui, Mister, wir haben Lebewohl zu sagen. Sie mögen ja ein ganz netter Mensch sein, aber augenblicklich haben wir gar keine Verwendung für Sie.«
Deshalb brauchen sie einen doch aber nicht gleich zu henken. Er hob seinen Arm. Offenbar, um mir die Schlinge über den Kopf zu werfen und mich zu erdrosseln; denn die Mühe, einen Galgen aufzubauen, hatten sie sich nicht gemacht. Hätte zu viel Ausgaben verursacht.
»Da drüben«, sagte er nun und zeigte mit ausgestrecktem Arme in die Richtung, »da drüben, geradewegs, wo ich hinweise, da ist Holland. Netherland. Haben Sie doch sicher schon davon gehört?«
»Ich glaube, ja.«
»Jetzt gehen Sie geradewegs in jene Richtung, die ich Ihnen hier mit meinem Arme andeute. Ich denke nicht, dass Sie da jetzt einen Kontrollbeamten treffen werden. Wir haben uns erkundigt. Sollten Sie aber jemand sehen, dann gehen Sie ihm sorgfältig aus dem Wege. Nach einer Stunde Gehens immer in dieser Richtung kommen Sie an die Eisenbahnlinie. Folgen Sie der Linie noch eine kurze Strecke in derselben Richtung, dann kommen Sie zur Station. Halten Sie sich da in der Nähe auf, aber lassen Sie sich nicht sehen. Gegen vier Uhr morgens kommen dann eine Menge Arbeiter, und dann gehen Sie zum Schalter und sagen nur: ›Rotterdam, derde klas‹, aber sagen Sie kein einziges Wort mehr. Hier haben Sie fünf Gulden.«
Er gab mir fünf Geldscheine.
»Und da ist noch ein Happen zu essen für die Nacht. Kaufen Sie nichts auf der Station. Sie sind bald in Rotterdam. So lange halten Sie es dann schon aus.«
Nun gab er mir ein kleines Paketchen, in dem allem Anschein nach Butterbrote waren. Dann bekam ich noch ein Paket Zigaretten und eine Schachtel Zündhölzer.
Was soll man von diesen Leuten sagen? Sie sind hinausgeschickt, um mich zu henken, und geben mir Geld und Butterbrote, damit ich mich aus dem Staube machen kann. Sie haben ein zu gutes Herz, mich so kalt umzubringen. Da soll man nun die Menschen nicht lieben, wenn man so gute Kerle selbst unter den Polizisten findet, deren Herz durch das ewige Menschenjagen durch und durch verhärtet ist. Ich schüttelte den beiden so sehr die Hände, dass sie Angst bekamen, ich wollte die Hände mitnehmen.
»Machen Sie nicht solchen Spektakel, einer von drüben kann Sie vielleicht gar hören, und dann ist alles im Dreck. Und das wäre nicht gut, dann könnten wir wieder von vorn anfangen.« Der Mann hatte recht. »Und nun hören Sie gut zu, was ich Ihnen jetzt sage.«
Er sprach halblaut, bemühte sich aber, mir alles deutlich zu machen dadurch, dass er das Gesagte mehrfach wiederholte.
»Kommen Sie ja nicht noch mal nach Belgien zurück, das kann ich Ihnen nur sagen. Wenn wir Sie noch mal innerhalb unsrer Grenzen finden, Sie können sich darauf verlassen, wir sperren Sie ein auf Lebenszeit. Auf Lebenszeit ins Gefängnis. Lieber Freund, das ist allerlei. Also ich warne Sie ausdrücklich. Wir wissen ja nicht, wohin mit Ihnen. Sie haben ja keine Seemannskarte.«
»Aber vielleicht hätte ich zum Konsul –«
»Gehen Sie mir mit Ihrem Konsul. Haben Sie eine Seemannskarte? Nein. Na also. Da pfeffert Sie ihr Konsul raus, vierkant, und wir haben Sie auf dem Halse. Sie wissen jetzt Bescheid. Auf Lebenszeit Gefängnis.«
»Ganz bestimmt, meine Herren, ich schwöre es Ihnen. Ich werde nicht mehr Ihr Land betreten.«
Warum sollte ich auch? Ich hatte ja in Belgien nichts verloren. Ich war eigentlich froh, dass ich rauskam. Holland ist viel besser. Die versteht man schon zur Hälfte, während man hier kein Wort versteht, was die Leute reden und was sie wollen.
»Gut also. Sie sind nun verwarnt. Nun hüpfen Sie los, und seien Sie vorsichtig. Wenn Sie Tritte hören, legen Sie sich flach hin, bis die Schritte vorübergegangen sind. Lassen Sie sich nur nicht kriegen, sonst kriegen wir Sie, und dann geht es Ihnen schlecht. Viel Glück auf die Reise.«
Sie schoben ab und ließen mich allein.
Dann, kreuzvergnügt, wanderte ich los. Immer in jener Richtung, die mir gezeigt worden war.
5
Rotterdam ist eine hübsche Stadt. Wenn man Geld hat. Ich hatte keins, nicht einmal eine Börse, wo ich es hätte hineinstecken können, wenn ich welches gehabt hätte.
Da war auch nicht ein einziges Schiff im Hafen, das einen Deckarbeiter oder einen Ersten Ingenieur gebraucht hätte. Zu jener Zeit war mir das ganz gleich. Wenn auf einem Schiff ein Erster Ingenieur verlangt worden wäre, ich hätte den Posten angenommen. Glatt. Ohne mit der Wimper zu zucken. Der Krach kommt ja erst, wenn das Schiff draußen ist, auf hoher Fahrt. Und dann können sie einen doch nicht so einfach über Bord feuern. Anzustreichen gibt es immer etwas, da findet sich dann also schon die rechte Arbeit. Man ist ja schließlich auch nicht so, dass man nun mit Mord und Tod auf das Gehalt des Ersten Ingenieurs pocht. Man kann ja etwas nachlassen. Gosh, in welchem Laden wird nicht auch einmal vom Preise heruntergehandelt, wenn das Plakat ›Feste Preise‹ auch noch so groß gemalt ist?
Krach hätte es sicher gegeben; denn damals konnte ich eine Kurbel nicht von einem Ventil und eine Pleuelstange nicht von einer Welle unterscheiden. Das wäre ja beim ersten Signal herausgekommen, wenn der Skipper hinuntergeklingelt hätte ›Todlangsam‹, und gleich darauf wäre der Eimer losgeschossen, als ob er auf Tod und Leben verpflichtet sei, ›The Blue Ribbon‹ zu gewinnen. Ein Spaß wäre es ja doch. Aber es lag nicht an mir, dass ich den Spaß nicht ausprobieren konnte, denn niemand suchte einen Ersten Ingenieur. Es wurde überhaupt niemand gesucht, auf keinem Schiff. Ich hätte alles angenommen, was zwischen Kapitän und Küchenjungen ist. Aber nicht einmal ein Kapitän wurde vermisst. Nun trieben sich auch schon so viele Seeleute dort herum, die alle auf ein Schiff warteten. Und nun gar noch eins erwischen, das rübergeht nach den States, das ist schon ganz hoffnungslos. Alle wollen sie auf einen Kasten, der rübergeht, weil sie dort alle absacken wollen, achteraus seilen. Denn alle denken, drüben werden die Leute mit Rosinen gefüttert, sie brauchen den Schnabel nur hinzuhalten. Schiet. Und dann liegen sie dort zu Tausenden in den Häfen rum und warten auf ein Schiff, das sie wieder heimbringt, weil eben alles ganz anders ist, als sie sich gedacht haben. Die goldnen Zeiten sind vorüber, sonst würde mich niemand als Deckarbeiter auf der Tuscaloosa gefunden haben.
Aber die beiden netten belgischen Cops gaben mir einen Tipp: mein Konsul. Mein! Die beiden Cops schienen meinen Konsul besser zu kennen als ich. Merkwürdig. Es ist doch meine Pflicht, ihn besser zu kennen, denn er ist doch meiner. Er ist ja meinetwegen auf der Welt, wird ja meinetwegen bezahlt.
Der Konsul klariert Dutzende von Schiffen aus, da wird er ja auch etwas wissen über verlangte Deckarbeiter, besonders wenn ich kein Geld habe.
»Wo haben Sie Ihre Seemannskarte?«
»Die habe ich verloren.«
»Haben Sie einen Pass?«
»Nein.«
»Bürgerpapier?«
»Nie gehabt.«
»Ja was wollen Sie denn dann hier?«
»Ich habe gedacht, da Sie mein Konsul sind, Sie würden mir helfen.«
Er griente. Sonderbar, dass die Menschen immer grienen, wenn sie einem den Hieb versetzen wollen.
Und mit diesem Grienen auf den Lippen sagte er: »Ihr Konsul? Das müssen Sie mir beweisen, lieber Mann, dass ich Ihr Konsul bin.«
»Ich bin doch aber Amerikaner, und Sie sind ein amerikanischer Konsul.«
Das war richtig.
Aber es schien nicht richtig zu sein, denn er sagte: »Amerikanischer Konsul, wenn auch augenblicklich noch nicht Erster, bin ich allerdings. Aber ob Sie Amerikaner sind, das müssen Sie mir erst beweisen. Wo haben Sie denn Ihre Papiere?«
»Ich habe Ihnen doch bereits gesagt, die habe ich verloren.«
»Verloren. Wie kann man seine Papiere verlieren? Die trägt man doch stets bei sich, besonders wenn man in einem fremden Lande ist. Sie können ja nicht einmal beweisen, ob Sie überhaupt auf der Tuscaloosa waren. Können Sie das beweisen?«
»Nein.«
»Also. Was wollen Sie da hier? Wenn Sie auch auf der Tuscaloosa waren, selbst wenn es bewiesen werden könnte, dass Sie wirklich drauf waren, so wäre das noch nicht der geringste Beweis, dass Sie Bürger, citizen meine ich, sind. Auf einem amerikanischen Schiff können auch Hottentotten arbeiten. Also, was wollen Sie hier? Wie kommen Sie überhaupt von Antwerpen ohne Papiere hierher nach Rotterdam? Das ist doch merkwürdig.«
»Die Polizei hat mich doch –«
»Kommen Sie mir gefälligst nicht noch mal mit einer solchen Erzählung. Wo ist denn das erhört, dass Staatsbeamte jemand auf diesem ungesetzlichen Wege über die Grenze in ein fremdes Land schicken? Ohne Papiere. Sie können mich nicht damit aufziehen, lieber Mann.«
Und das alles sagt er grienend und ewig lächelnd; denn ein amerikanischer Beamter hat immer zu lächeln, selbst wenn er ein Todesurteil verkündet. Das ist seine republikanische Pflicht. Was mich aber am meisten ärgerte, war, dass er während seiner Rede stets und ständig mit dem Bleistift spielte. Bald kritzelte er damit auf der Tischplatte herum, bald kratzte er sich damit im Haar, bald trommelte er damit ›My Old Kentucky Home‹, und bald tippte er mit dem Bleistift so auf den Tisch, als ob er mit jedem Tippen ein Wort festnageln wollte. Ich hätte ihm am liebsten das Tintenfass ins Gesicht geworfen. Aber ich musste Geduld üben, und so sagte ich: »Vielleicht können Sie mir wieder ein Schiff verschaffen, damit ich heimkomme. Es kann ja sein, dass ein Skipper um einen Mann zu kurz ist oder dass einer erkrankt.«
»Ein Schiff? Ohne Papiere ein Schiff? Von mir nicht, da brauchen Sie gar nicht erst wiederzukommen.«
»Aber wo soll ich denn Papiere herbekommen, wenn Sie mir keine geben?«, fragte ich.
»Was geht mich denn das an, wo Sie Ihre Papiere herkriegen! Ich habe sie Ihnen doch nicht abgenommen. Oder? Da könnte ja jeder Herumtreiber, der auf seine Papiere nicht besser achtgibt, kommen und von mir Papiere verlangen.«
»Well, Sir«, sagte ich darauf, »ich glaube, es haben auch schon andre Leute, die nicht Arbeiter sind, ihre Papiere verloren.«
»Richtig. Aber diese Leute haben Geld.«
»Ach so!«, schrie ich. »Jetzt verstehe ich.«
»Nichts verstehen Sie«, griente er, »ich meine, dann sind das Leute, die noch andre Ausweise haben, Leute, bei denen kein Zweifel zulässig ist, Leute, die ein Zuhause, die eine Adresse haben.«
»Was kann ich denn dafür, dass ich keine Villa habe, kein Zuhause und keine andre Adresse als meinen Arbeitsplatz!«
»Das geht mich nichts an. Sie haben die Papiere verloren. Sehen Sie zu, wo Sie andre herbekommen. Ich habe mich an meine Bestimmungen zu halten. Nicht meine Schuld. Haben Sie schon gegessen?«
»Ich habe doch kein Geld, und gebettelt habe ich noch nicht.«
»Warten Sie einen Augenblick.«
Er stand auf und ging in ein andres Zimmer. Nach einigen Minuten kam er zurück und brachte mir eine Karte.
»Hier haben Sie eine Verpflegungskarte für drei volle Tage im Seemannshause. Wenn sie abgelaufen ist, können Sie ruhig noch mal wiederkommen. Versuchen Sie es, vielleicht bekommen Sie ein andres Schiff, von einer andern Nationalität. Manche nehmen es nicht so genau. Ich darf Ihnen keine Andeutungen machen. Sie müssen das selbst herausfinden. Ich bin hier ganz und gar machtlos. Bin lediglich ein Diener des Staates. ’m sorry, old man. Can’t help it. Goodbye and g’d luck!«
Möglich, der Mann hat recht. Vielleicht ist er gar nicht so ein Biest. Warum sollen Menschen denn Biester sein? Ich glaube beinahe, der Staat ist das Biest. Der Staat, der den Müttern die Söhne nimmt, um sie den Götzen vorzuwerfen. Dieser Mann ist der Diener des Biestes, wie der Henker der Diener des Biestes ist. Alles, was der Mann sagte, war auswendig gelernt. Das hatte er jedenfalls lernen müssen, als er seine Prüfung ablegte, um Konsul zu werden. Das ging klipp-klapp. Auf jede meiner Aussagen hatte er eine passende Antwort, die mir sofort das Maul stopfte. Als er jedoch fragte: »Haben Sie Hunger? Haben Sie schon gegessen?«, da wurde er plötzlich Mensch und hörte auf, Biestdiener zu sein. Hunger haben ist etwas Menschliches. Papiere haben ist etwas Unmenschliches, etwas Unnatürliches. Darum der Unterschied. Und das ist die Ursache, warum Menschen immer mehr aufhören, Menschen zu sein, und anfangen, Figuren aus Papiermaschee zu werden. Das Biest kann keine Menschen brauchen; die machen zu viel Arbeit, Figuren aus Papiermaschee lassen sich besser in Reih und Glied stellen und uniformieren, damit die Diener des Biestes ein bequemeres Leben führen können. Yesser, yes, Sir.
6
Drei Tage sind nicht immer drei Tage. Es gibt sehr lange drei Tage, und es gibt sehr kurze. Dass drei Tage so kurz sein könnten wie die drei Tage, wo ich gut zu essen hatte und ein Bett, würde ich nicht geglaubt haben. Ich wollte mich gerade das erste Mal richtig zum Frühstück hinsetzen, da waren die drei Tage schon um. Aber selbst wenn sie zehnmal länger gedauert hätten, zum Konsul gehe ich nicht mehr. Sollte ich mir vielleicht abermals seine auswendig gelernten Prüfungsantworten anhören? Etwas Besseres würde er jetzt so wenig wissen wie vorher. Ein Schiff konnte er mir nicht besorgen. Also was hätte es für Zweck gehabt, seine Reden über mich ergehen zu lassen? Möglich, dass er mir wieder eine Karte gegeben hätte. Diesmal aber sicher schon mit einer Geste und einer Miene, die mir das Essen in der Kehle hätte festwürgen lassen, ehe ich überhaupt den Löffel in die Suppe steckte. Die drei Tage wären noch viel kürzer geworden als die vorigen. Der wichtigste Grund freilich war: Ich wollte die Kleinigkeit Mensch, die er bei meinem ersten Besuche gewesen war in dem Augenblick, als er sich um mein Wohlergehen kümmerte, nicht aus meiner Erinnerung verlieren. Bestimmt hätte er mir nun die Karte in seiner vollen Überlegenheit als Biestdiener verabreicht und mit moralverbrämten Reden, dass es diesmal das letzte Mal sein müsse, dass zu viele kämen und dass man sich nicht darauf ausruhen könne, sondern dass man auch selbst etwas dazu tun müsse, um weiterzukommen. Lieber verrecken, als noch mal zu ihm gehen.
Oh, du geliebte Schneiderseele, was war ich hungrig! So gottserbärmlich hungrig. Und so müde infolge des Schlafens in Torwegen und Winkeln, immer gejagt im Halbschlaf von der Nachtpolizei, die in die Torwege und Winkel mit Taschenlampen hineinleuchtete. Ständig auf der Hut sein, im Schlafe die Patrouille auf fünfzig Schritte hören müssen, um sich noch rechtzeitig aus dem Staube zu machen. Denn wenn sie einen erwischen, das heißt Arbeitshaus.
Und im Hafen kein Schiff, das jemand brauchen könnte. Da sind so viele Hundert Seeleute des eignen Landes auf den Beinen, die ein Schiff suchen und die gute Papiere haben. Und keine Arbeit in den Fabriken, keine Arbeit in irgendeinem Geschäft. Selbst wenn da Arbeit wäre, der Mann dürfte sie einem gar nicht geben. Haben Sie Papiere? Nein? Schade, dürfen wir Sie nicht einstellen. Sie sind Ausländer.
Gegen wen sind die Pässe und die Einreisevisen gerichtet? Gegen die Arbeiter. Gegen wen ist die Beschränkung der Einwanderung in Amerika und in andern Ländern gerichtet? Gegen die Arbeiter. Und auf wessen Veranlassung und mit wessen machtvoller Unterstützung sind häufig diese Gesetze, die die Freiheit des Menschen vernichten, ihn zwingen, dort zu leben, wo er nicht leben will, ihn verhindern, nach jenem Teil der Erde zu gehen, wo er gern leben möchte, geschaffen worden? Auf Veranlassung und mit Unterstützung der Arbeiterverbände. Ein Biest im Bieste: Ich schütze meine Sippe; wer nicht zu meiner Sippe gehört, der mag zugrunde gehen; geht er zugrunde, umso besser, dann bin ich einen Konkurrenten los. Yes, Sir.
So hungrig und so müde! Dann kommt die Zeit, wo man nicht mehr darüber nachdenkt, ob es einen Unterschied macht, die Börse eines andern, der nicht hungert, mit der eignen Börse, die man nicht hat, zu verwechseln. Man braucht sie nicht zu verwechseln, man fängt damit an, ohne es zu wollen, an die Börse eines nicht Hungernden zu denken.
Ein Herr und eine Dame standen vor einem Schaufenster, als ich vorüberging.
Die Dame sagte: »Sag doch bloß mal, Fibby, sind denn diese hübschen Handtäschchen nicht wirklich ganz reizend?«
Fibby nuschelte etwas, was ebenso gut eine Zustimmung wie eine gegenteilige Meinung sein konnte, es konnte aber auch ganz gut bedeuten: Lass mich doch in Ruh mit deinem Quark!
Die Dame: »Nein, wirklich, die sind zu entzückend, echte altholländische Kleinkunst.«
»Stimmt«, sagte Fibby nun trocken, »echt altholländisch, copyright letzte Woche.«
Ich war nun sehr rasch und verlor keine Sekunde weiter. Da lag ja das blanke Gold vor mir mitten auf der Straße.
Aber dem Teufel sei es geklagt, Fibby schnappte mich. Und wie! Er musste wohl das Geschäft ebenfalls zuweilen ausgeübt haben, wenn es ihm dreckig ging.
Es schien mir, dass Fibby sich über das, was ich ihm erzählte, viel mehr amüsierte, als was ihm seine Frau oder seine Freundin oder seine – well, Sir, das geht mich nichts an, in welchem Verwandtschaftsverhältnis die beiden zueinander standen – ja, jedenfalls amüsierte er sich köstlich über meine Geschichte. Er lächelte, dann lachte er, und endlich brüllte er, dass die Leute stehen blieben. Wenn ich es nicht an seinem »Zat so!«, gleich beim ersten Tonfall gehört hätte, wo er herkam, dann hätte es mir sein unbändiges Lachen verraten. So können eben nur die lachen, die in Manhattan, Downtown, ihre Büros und Warenhäuser haben. Jawohl, die können lachen.
»Also, Boy, Sie haben Ihre Geschichte großartig erzählt.« Da lachte er auch schon wieder. Ich hatte gedacht, er würde zu weinen anfangen über meine traurige Geschichte. Na ja, er steckte ja nicht in meiner Haut. Er sah das alles von der komischen Seite.
»Nun sag doch, Flory«, wandte er sich an seine Begleiterin, »hat denn das Vöglein, das da aus dem Nest gefallen ist, seine Geschichte nicht ganz großartig erzählt?«
»Wirklich sehr nett. Wo sind Sie her? Von New Orleans? Das ist ja ganz entzückend. Da habe ich sogar noch eine Tante wohnen, Fibby. Habe ich dir nicht von Tante Kitty aus New Orleans schon erzählt, Fibby? Ich glaube doch. Du weißt doch, die immer jeden Satz anfängt: Als Gra’pa noch in South Carolina wohnte …«
Fibby hörte gar nicht hin, was seine Flory sagte; er ließ sie reden, als ob sie ein Wasserfall sei, an den er sich gewöhnt hatte. Er kramte in seinen Taschen herum und brachte einen Dollarschein hervor: »Es ist nicht für Ihre Geschichte selbst, old man, sondern es ist dafür, dass Sie die Geschichte so meisterhaft erzählt haben. Eine Geschichte, die nicht wahr ist, gut erzählen zu können, ist eine Gabe, my boy. Sie sind ein Künstler, wissen Sie das? Es ist eigentlich schade um Sie, dass Sie sich so in der Welt herumtreiben. Sie könnten viel Geld machen, lieber Freund. Wissen Sie das? Ist er nicht in der Tat ein Künstler, Flory?«, wandte er sich nun wieder an seine – na, meinetwegen Frau, was geht’s mich an, die werden ihren Pass schon so haben, wie sie ihn brauchen.
»Aber ja, freilich, Fibby«, antwortete Flory in Ekstase, »freilich ist er ein großer Künstler. Weißt du, Fibby, frage ihn doch gleich mal, ob wir ihn nicht für unsere Party haben können. Sicher, da könnten wir die Penningtons übertrumpfen, diese schäbige Bande.«
Also es ist doch seine Frau.