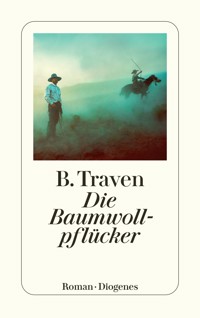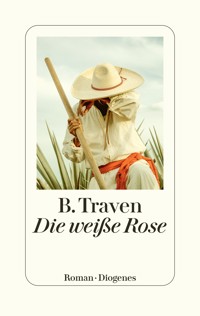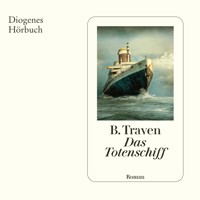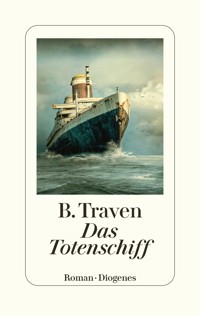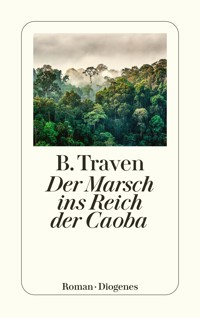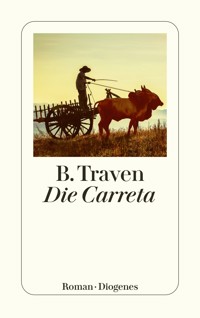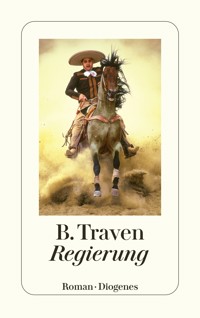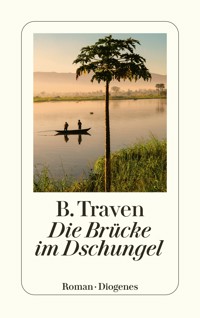
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf der Jagd nach Alligatoren gerät der amerikanische Abenteurer Gales in eine indigene Siedlung im mexikanischen Dschungel. Sie liegt an einem Fluss mit einer maroden Brücke, die zwei Welten verbindet: auf der einen Seite die moderne Technik der weißen Siedler, auf der anderen das einfache, traditionelle Leben der Indigenen. Gales wird eingeladen zu einem nächtlichen Fest, das in eine Tragödie umschlägt, als ein Kind verschwindet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
B. Traven
Die Brücke im Dschungel
roman
Diogenes
Editorische Notiz
Der 1882 geborene B. Traven verfasste sein Werk in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, und seine Sprache und Begrifflichkeit sind aus diesem historischen Kontext heraus zu verstehen. Dieser Autor, der wie kein anderer mit den Indigenen lebte und ihre Unterdrückung, Ausbeutung und Versklavung beschrieb, verwendet die damals üblichen Beschreibungen, und würde man hier nach heutigen Kriterien in die Wortwahl eingreifen, würde man auch der beschriebenen Unterdrückung die Spitze nehmen beziehungsweise sie nicht mehr nachvollziehbar machen.
Der Verlag vertraut auf das Vermögen der Leserinnen und Leser, diese heute umstrittenen Bezeichnungen und Zuschreibungen als Ausdruck der sprachlichen Gepflogenheiten einer historischen Epoche zu erkennen beziehungsweise als Figurenrede einzuordnen, die nicht mit der Haltung des Autors verwechselt werden darf.
Den Müttern
jeden Volkes
jeden Landes
jeder Sprache
jeder Rasse
jeder Farbe
jeder Kreatur
die lebt
1
»Hände hoch, alter Knabe!«
»?«
»Kannst du nicht hören, blöder Kerl? Hoch die Flossen! Und ein bisschen schnell bitte!«
Durch mein verschwitztes Hemd fühlte ich deutlich, dass es keineswegs ein Zeigefinger war oder ein Bleistift, was mir da von hinten in die Rippen drang. Es war ein Schießeisen. Ich konnte sogar ungefähr das Kaliber raten: 9,7 mm oder so, und ein ziemlich schweres Ding noch dazu.
Wenn ich der ersten Aufforderung nicht gleich gefolgt war, so einfach deshalb, weil ich glaubte, Halluzinationen zu haben. Zwei Tage lang hatte ich auf meinem Marsch durch den dichten Dschungel mit meinen beiden Tragtieren, zwei Mules, nicht eine Menschenseele getroffen, keinen Weißen, keinen Indianer und keinen Mestizen. Zur nächsten Rancheria war es noch weit, das wusste ich. Am anderen Tag, zu Mittag, wollte ich erst dort sein. Wer also sollte mich hier aufhalten?
Ein Einheimischer war es nicht; das schloss ich aus seiner Art zu reden. Jetzt machte der Kerl sich an meinem Gürtel zu schaffen und riss daran herum. Es war ein ganz schönes Stück Arbeit, die Pistole aus der Tasche zu zerren. Das Leder war steif und trocken wie Holz. Aber endlich hatte er es doch geschafft. Ich hörte ihn ein Stück zurücktreten.
Er schleifte die Füße über den Boden, und ich dachte, dass es ein ziemlich langer Kerl sein musste und dass er entweder schon hübsch bei Jahren oder sehr müde war.
»So, jetzt können Sie sich umdrehen, wenn es Euer Gnaden beliebt!«
Zwanzig Meter rechts vom Dschungelpfad, auf dem ich gekommen war, lag ein kleiner Teich mit halbwegs trinkbarem, nicht allzu schmutzigem Wasser. Ich hatte ihn durch das Laubwerk blitzen sehen und an den Maultier- und Pferdespuren, die zu dem Wasserloch führten, außerdem erkannt, dass hier ein Paraje sein musste, ein Rast- oder Nächtigungsplatz für Karawanen, und so hatte ich meine müden Maultiere hingetrieben, um sie zu tränken. Ich wollte mich ein bisschen ausruhen, und Durst hatte ich auch. Ich hatte niemanden gesehen und nichts gehört. So wunderte ich mich deshalb nicht schlecht, als mir die Kanone da, wie von der Hand eines Dschungelgeistes, in den Rücken gestoßen wurde.
Nun sah ich mir den Burschen an. Er war, wie ganz richtig vermutet, größer als ich und auch ein bisschen stärker. Er mochte fünfzig oder fünfundfünfzig sein, ein alter Hase, nach der Kleidung zu urteilen, die sich von der meinigen nicht wesentlich unterschied: Lange Baumwollhosen und Schaftstiefel, dazu ein schmutziges, verschwitztes Hemd und ein breitkrempiger Hut von der billigen Sorte, wie sie in der Republik gemacht werden.
Der Fremde grinste mich an. Unwillkürlich musste auch ich grinsen. Wir gaben uns nicht die Hand und nannten auch unsere Namen nicht. Es ist ja auch töricht, sich anderen vorzustellen, ohne nach seinem Namen gefragt zu sein.
Er sagte, er sei Verwalter auf einer Zuckerpflanzung, ungefähr fünfzig Kilometer entfernt, setzte aber hinzu, dass er viel lieber auf einer Kakaoplantage wäre, wenn er nur eine entsprechende Stelle bekommen könnte. Ich erzählte, dass ich auf eigene Faust Forschungsreisen unternehme und außerdem Präsident, Kassenverwalter und Sekretär einer Ein-Mann-Expedition sei, die kommerziell verwertbare seltene Pflanzen für Medizin und Industrie suche; dass ich aber jede Arbeit annehme, die mir unterwegs geboten werde, und dabei immer hoffe, einmal Gold oder Edelsteine zu entdecken.
»Ich wüsste bestimmt davon, Bruderherz, wenn es hier dergleichen gäbe. Bin lange genug in der Gegend, kenne jeden Fleck, jeden Gummistrauch und jeden einzelnen Ebenholzbaum. Aber immerhin, dieser gottverdammte und doch so schöne Dschungel ist ja so groß und so reich … und überhaupt, es gibt ja so viele Dinge, mit denen man Geld verdienen kann, sofern man es nur versteht, sie richtig zu verwerten und was daraus zu machen, wenns ans Verkaufen geht. Außerdem finden Sie vielleicht wirklich noch einmal Gold oder Diamanten. Sie dürfen nur nicht lockerlassen.«
Ich merkte die Ironie, die aus den Worten nicht herauszuhören war. Sie saß in den Winkeln der fast zugekniffenen Augen des Fremden.
Nachdem er sein Pferd getränkt, seinen Wassersack gefüllt und mit einem verbeulten Aluminiumbecher einen letzten Trunk aus dem Teich geschöpft hatte, zog er den Sattelgurt an, den er gelockert hatte, um dem Pferd das Saufen zu erleichtern, bestieg seine Mähre und sagte: »Zweihundert Meter weiter können Sie sich Ihre Kanone wieder holen. Ich bin nämlich kein Bandit.
Aber kenne ich Sie, Bruderherz? Wer weiß, von welcher Bande Sie sind. Sie sind wohl neu in diesem Erdenwinkel? An Stellen wie der hier, wo wir das Vergnügen hatten, einander kennenzulernen, da lässt sich einer, der die Verhältnisse kennt, auf keine unsicheren Sachen ein. Sie verstehen wohl, was ich meine. Darum habe ich Ihnen für ein Weilchen das Schießeisen weggenommen, nur damit Sie nicht am Ende damit herumspielen. Sie hätten mich womöglich für einen Strolch gehalten, der es auf Ihr Gepäck und Ihre Biester abgesehen hat, und dann hätten Sie mich niedergeknallt, nur aus Angst. Ich kenne Greenhorns. Schnappen über, besonders wenn sie allein durch den Dschungel zotteln und ’ne Woche lang keine Menschenseele, nicht mal ’nen Maulwurf zu Gesicht bekommen. Die sehen und hören dann oft so allerlei, führen Selbstgespräche und reden mit Geistern. Sie wissen bestimmt, was ich sagen will. Wer in solchen Fällen als Erster das Eisen heraus hat, der ist obenauf, wissen Sie? Ich bin immer heilfroh, wenn ich bei Begegnungen mit Leuten Ihrer Sorte der Schnellere bin; denn vor Greenhorns habe ich zehnmal mehr Angst als vor einem hungrigen Tiger. Wenn ich so ’ne Katze treffe, weiß ich wenigstens, was sie will. Kann ihr vielleicht sogar ein Schnippchen schlagen; aber bei einem Kerl, der allein im Dschungel unterwegs ist, weiß man nie, was er tut, wenn er plötzlich einen vor sich stehen sieht.
Also dann hasta la vista, Bruderherz. Viel Glück! Vielleicht finden Sie wirklich noch mal ’ne neue Gummibaumsorte.«
Ich ging hinter ihm her und sah, wie er meine Pistole fallen ließ. Gleich darauf gab er seinem Pferd die Sporen, und zwei Sekunden später hatte der Dschungel ihn verschluckt.
Als ich wieder mit meinen Mules allein war, kam mir das Vorgefallene mit einem Mal irgendwie komisch vor, so als hätte ich nur geträumt. Ich versuchte, im Geiste noch einmal alles vor mir ablaufen zu lassen, und da wurde mir klar, dass jedes Wort, das ich vernommen – mochte es nun meiner Fantasie entsprungen oder gesprochen worden sein –, voll und ganz den Tatsachen entsprach. Man kann wirklich sehr leicht das Opfer von Halluzinationen werden, wenn man so allein durch den Dschungel zieht. Ich beschloss, mich vor der Dschungelkrankheit in Acht zu nehmen, von der der andere geredet hatte. Ich beschloss ferner, das nächste Mal, wenn ich wieder jemand im Dschungel traf, selbst der Schnellere zu sein, und zwar mit genau derselben Methode, die der Fremde an mir praktiziert hatte.
Drei Monate später ritt ich in einer ganz anderen Gegend über die aufgeweichte Plaza eines Indianerdorfes. Da sah ich unter dem Portico eines palmgedeckten Adobenhauses einen Weißen stehen. »Hallo Sie! Guten Tag!«, rief er mich an.
»Guten Tag. Wie geht’s?«
Es war Sleigh. Er führte mich ins Haus und stellte mich seiner Familie vor. Seine Frau war Indianerin, eine sehr hübsche Person mit weicher, cremeartig gelblicher Haut, braunen Augen und kräftigen, schönen Zähnen. Sleigh hatte drei Kinder, lauter Buben, die man ohne Weiteres für Jungen aus dem Süden der Vereinigten Staaten halten konnte. Die Frau war mindestens fünfundzwanzig Jahre jünger als er. Das älteste Kind war vielleicht acht, das jüngste drei.
Sleighs Frau schlug mir sechs Eier in die Pfanne, die ich mit Tortillas und gebackenen Bohnen verzehrte. Dazu gab es Kaffee, nach indianischer Art gekocht und mit braunem Kandiszucker gesüßt.
Die Frau hatte mich mit »Buenas tardes, Señor!« begrüßt und dazu beinahe unmerklich mit dem Kopf genickt. Sie trug eine aus zwei dicken schwarzen Zöpfen gelegte Haarkrone. Nach der kurzen, mehr argwöhnischen als freundlichen Begrüßung sah ich sie nicht wieder. Auch die Kinder kamen nicht mehr zum Vorschein. Ich konnte sie nur draußen spielen und kreischen hören.
Im Haus sah es armselig aus. Armseliger ging es schon nicht mehr. Möbel gab es so gut wie gar keine. Ein Feldbett, ein primitiver Tisch, drei ebenso primitive Stühle und eine Hängematte – das war alles. Außerdem waren noch zwei altmodische, mit Lehm verputzte Truhen da. Das Haus hatte zwei Türen. Eine ging nach vorn, und die andere führte nach hinten auf einen aufgeweichten, verwahrlosten Hof. Fenster gab es keine, und der Fußboden war aus getrocknetem Lehm.
Sleigh, dessen Vornamen ich nie erfahren habe, lud mich nicht ein, über Nacht zu bleiben; nicht weil er sich schämte, mir kein Bett anbieten zu können. Einfach nach der Regel, dass ein Mann, der zu Pferd oder mit einem Maultier durch das Land reitet, selber am besten wissen muss, wann und wo er über Nacht bleiben will. Man drängt niemanden, seine Pläne zu ändern. Etwas anderes ist es, wenn der Fremde selbst um Nachtquartier bittet. Dann kann er mit unbeschränkter Gastfreundschaft rechnen.
Ich fragte Sleigh nicht, was er hier treibe und wovon er lebe. Auch er machte keinerlei Anstalten, durch Worte oder Gesten aus mir herauszubekommen, was mich durch das abgelegene Eingeborenendorf führte.
2
Ein Jahr später unternahm ich zu Pferd einen ziemlich schwierigen Ritt nach den Dschungelgebieten am Huayalexzo-Strom. Ich wollte Alligatoren fangen, deren Häute damals gerade recht hoch im Kurs standen. Die Sache war weit mühsamer, als ich angenommen hatte. Stellenweise war der Dschungel an den Flussufern so dicht, dass man tagelang mit einheimischen Arbeitskräften hätte roden müssen. Andere Gegenden waren wieder so versumpft, dass man überhaupt nicht ans Ufer heran konnte. So beschloss ich, weiter stromabwärts zu reiten; denn ich hoffte, doch noch ein gutes Jagdgebiet zu finden. Die Indianer hatten mir von Nebenflüssen erzählt, in denen es zu jener Zeit des Jahres von Alligatoren wimmele.
Auf diesem Ritt kam ich eines Tages an eine Pumpstation; sie war Eigentum der Bahn. Man pumpte das Wasser aus dem Strom nach einer zweiten, viele Meilen entfernten Pumpstation, und von dort aus wurde es zur nächsten Bahnstation weitergeleitet. An der Bahnstrecke gab es auf einem ungefähr hundertsechzig Kilometer langen Stück kein Wasser. Folglich musste welches zur Bahnstation hinaufgepumpt werden. Zum Teil wurde es für die Lokomotiven gebraucht; das meiste jedoch wurde mit Spezialtankwagen zu den anderen Bahnstationen und Siedlungen an der Strecke gebracht; denn die Leute, die dort wohnten, hätten die Stationen und ihre kleinen Dörfer einfach verlassen müssen, wenn sie in der trockenen Jahreszeit kein Wasser bekommen konnten.
Der Pumpmeister oder, wie er sich gern titulieren ließ, el Maestro maquinista war Indianer. Bei der Arbeit half ihm ein Indianerjunge, sein Ayudante. Der Kessel wurde mit Holz geheizt, das indianische Holzhacker auf dem Rücken ihrer Burros aus dem Dschungel herbeischafften. Das übrige Heizmaterial – altes, unbrauchbar gewordenes Bauholz und vermoderte Bahnschwellen – stammte von der Bahnstation.
Der Kessel sah aus, als wolle er jeden Augenblick bersten. Die Pumpe erweckte den Eindruck, als sei sie schon über hundert Jahre in Gebrauch; man konnte sie kilometerweit hören. Sie quietschte, heulte, zischte, fauchte, blubberte und ratterte an allen Ecken und Enden. Jede Schraube, jeder Bolzen, jedes Gelenk machte Lärm. In den ersten Tagen hielt ich mich in sicherer Entfernung, weil ich fürchtete, diese ausgeleierte, malträtierte Sklavenmühle könne jeden Augenblick in die Luft fliegen.
Die Bahn wusste natürlich sehr gut, warum sie diese alte Pumpe noch immer arbeiten ließ, bis sie eines Tages tatsächlich auseinanderfiel. Hätte man sie abmontieren, zur Bahnstation und dann weiter zum nächsten Montage- und Schrottplatz schaffen wollen, so hätte das fast so viel gekostet wie eine neue Pumpe. Da war es billiger, das Ding stehen zu lassen, wo es stand. Angesichts der Transport- und Montageschwierigkeiten wäre es für die Eisenbahn auch sehr unwirtschaftlich gewesen, zum damaligen Zeitpunkt eine neue Pumpe anzuschaffen. Rechnete man doch damit, dass die amerikanische Gesellschaft, die in der Gegend arbeitete, über kurz oder lang Öl finden und dann bestimmt die Wasserversorgung der Bahnstrecke und des angrenzenden Gebietes selbst übernehmen würde.
Ungefähr siebzig Meter oberhalb der Pumpe führte eine Brücke aus roh behauenen, schweren Balken über den Fluss. Sie gehörte der Ölgesellschaft, und die hatte sie auch gebaut. Sie war breit genug für Lastkraftwagen, doch hatte sie kein Geländer. Das war der Ölgesellschaft als unnötige Ausgabe erschienen. Hätte die Brücke ein Geländer gehabt, wäre diese Geschichte vielleicht niemals geschrieben worden.
»Alligatoren gibt es hier im Fluss genug, montones de lagartos, Señor, darauf können Sie sich verlassen«, berichtete der Pumpmeister. »Natürlich werden Sie begreifen, dass sie nicht direkt hier bei der Pumpe sind.«
Das konnte ich allerdings sehr gut begreifen. Kein anständiger Alligator, der etwas auf sich hält, könnte jemals in der Nähe dieser lärmenden Pumpe leben und dabei mobil genug bleiben, um mit den Tücken des Lebens fertig zu werden.
»Sehen Sie, Señor, ich würde die Biester ja hier herum auch gar nicht dulden, nie im Leben. Sie würden mir meine Schweine und Hühner wegholen, und ob Sie es nun glauben oder nicht: Wahr ist es jedenfalls, dass sie sogar kleine Kinder schnappen, wenn man sie zu lange allein lässt.
Nein, nein, hier herum gibt es sehr wenige, vielleicht gar keine, und auch die wenigen sind nur sehr klein, viel zu jung, als dass sich die Kugel lohnte. Weiter unten und auch stromaufwärts, so fünf, sechs Kilometer von hier – da werden Sie sie zu Hunderten finden, ganze Rudel, und Bullen dabei, mein lieber Mann, ich glaube, die müssen dreihundert Jahre alt sein, so groß sind die Biester.«
Ich deutete mit einer Kopfbewegung zum anderen Ufer hinüber. »Wer lebt dort? Ich meine, gleich da drüben, wo die Hütten vorgucken.«
»Ach dort meinen Sie. Da ist Prärie, mucha pastura. Es ist eigentlich eine Art Viehranch. Ohne Zaun. Alles offen. Sie gehört einem Americano. Hinter der Prärie kommt gleich wieder dichter Dschungel. Reiten Sie noch weiter, immer durch den Dschungel, so ungefähr zehn bis dreizehn Kilometer, dann kommen Sie an ein Ölcamp. Dort wird gebohrt. Versuchsbohrungen. Die Leute probieren, ob sie irgendwo Öl finden. Bisher haben sie noch keines, und wenn Sie mich fragen, nun, ich glaube, sie werden auch keines finden. Es sind die Leute, die die Brücke hier gebaut haben. Um nach Öl bohren zu können, müssen sie nämlich die ganzen Maschinen von der Bahnstation herunterbringen. Ohne Brücke kämen sie mit schweren Lasten gar nicht über den Fluss. In der Trockenzeit haben sie es ein paarmal versucht, aber die Laster blieben stecken. Es dauerte fast eine Woche, bis sie die wieder flott hatten. Die Brücke hat eine Menge Geld gekostet, weil das Holz zweitausendvierhundert Kilometer weit herangeschafft werden musste, und das kostet keine Kleinigkeit, das können Sie mir glauben, Señor.«
»Wer lebt auf dem Rancho da drüben?«
»Ein Gringo wie Sie.«
»Das habe ich schon gehört. Ich meine, wer nach dem Vieh sieht.«
»Habe ich es nicht gerade gesagt? Ein Gringo.«
»Wo wohnt der?«
»Gleich hinter dem Gebüsch dort.«
Ich ritt über die Brücke und zog mein Tragtier hinter mir her. Hinter einer dichten Wand von tropischen Sträuchern und Bäumen stieß ich auf ungefähr zehn indianische Chozas oder Jacales der üblichen Bauart; mit Palmblättern gedeckte Hütten.
Wo ich hinsah, hockten Frauen mit dicken Zigarren im Mund auf dem blanken Erdboden, auch bronzebraune, zumeist unbekleidete Kinder. Ein paar hatten auch Hemden oder zerrissene Hosen an. Von den kleinen Mädchen war allerdings keines nackt, aber auch sie waren nur dürftig mit fadenscheinigen Röckchen bekleidet.
Von hier aus konnte ich das Weideland übersehen, das der Pumpmeister als Prärie bezeichnet hatte.
Die Fläche war ungefähr fünfzehnhundert Meter lang und zwölfhundert Meter breit, auf allen Seiten vom Dschungel eingefasst. Man konnte noch die Spuren der Lastwagen sehen, die über die Prärie gefahren waren.
Kein Wunder, dass hier eine Indianersiedlung lag. Die Weide war gut, Wasser gab es das ganze Jahr, und mehr braucht der Indianer nicht. Die Weide gehörte zwar nicht ihm, aber das störte ihn nicht. Jede Familie hatte zwei bis drei Ziegen, ebenso viele magere Schweine, ein bis zwei Burros und ein Dutzend Hühner. Der Strom versorgte sie mit Fischen und Krebsen.
Die Männer hatten bis vor einiger Zeit den Boden um ihre Hütten bestellt, wo sie Mais, Bohnen und Paprika zogen. Seit die Ölgesellschaft angefangen hatte zu bohren, hatten viele Männer in den Camps Arbeit gefunden. Die Männer, die diese Arbeit nicht mochten oder auch keine bekommen konnten, brannten im Busch Holzkohle. Sie stopften ihre Ware in alte Säcke und transportierten sie mit Burros zur Bahnstation, wo die Holzkohle an Agenten verkauft wurde, die einmal wöchentlich alle Stationen abklapperten.
Weder die Frauen, denen ich begegnete, noch die Kinder beachteten mich sonderlich. Sie hatten sich im Laufe der letzten zwei Jahre an die Fremden gewöhnt; denn alle, die mit Last- oder Personenautos oder zu Pferd nach den Ölcamps unterwegs waren, machten in diesem Nest oder an der Pumpstation Halt; manchmal nur für ein bis zwei Stunden, doch blieben sie auch häufig länger, wenn sie erst am späten Nachmittag an der Brücke ankamen. Oft sogar über Nacht. Selbst die abgebrühtesten Lastwagenfahrer vermieden es nach Möglichkeit, den Dschungel bei Nacht zu durchqueren.
Eine der Hütten war, wenn auch nach indianischer Art gebaut, so doch höher und geräumiger als die übrigen. Sie lag am Ende der Siedlung und hatte einen primitiv angelegten Korral.
Ich ritt heran und zügelte, wie es der Landesbrauch erheischt, mein Pferd in respektvoller Entfernung. Dann wartete ich, bis einer der Bewohner von mir Notiz nehmen würde.
Wie all die anderen Jacales auch, hatte diese Hütte keine Tür, nur einen offenen Eingang, der bei Nacht mit einer Art Gitter aus Zweigen und Knüppeln verrammelt wurde, das man an den Pfosten verankerte. Die Wände bestanden aus Stangen, die mit Bast und Lianen zusammengebunden waren. Wenn der Neuankömmling also nicht ein Stückchen vom Hause weg wartete, bis man ihn hereinbat, konnte es passieren, dass er die Bewohner gerade in recht peinlichen Situationen überraschte.
Ich hatte kaum eine Minute gewartet, da trat eine Indianerfrau heraus.
Sie musterte mich von oben bis unten.
»Buenas tardes, Señor!«, und dann: »Pase, Señor, unser bescheidenes Haus ist das Ihre.«
Ich saß ab, band Pferd und Maultier an einen Baum und trat in die Hütte. Jetzt erst merkte ich, dass ich bei meinem alten Bekannten Sleigh war. Als auch die Frau mich erkannt hatte, begrüßte sie mich nochmals, nun etwas herzlicher. Ich musste mich in einen ächzenden alten Korbstuhl setzen, offensichtlich der Stolz des Hauses. Der Mann müsse jeden Augenblick kommen. Er sei draußen auf der Prärie und versuche, einen jungen Stier einzufangen, der von einem älteren Bullen angefallen worden war und schwärende Wunden davongetragen hatte.
Es dauerte nicht lange, so hörte ich Sleighs Stimme. Er rief einem Knaben zu, das Gatter aufzuhalten und den Stier in den Korral zu treiben. Dann kam er selbst ins Haus. Ohne die geringste Überraschung zu zeigen, schüttelte er mir die Hand und ließ sich auf einen sehr niedrigen, primitiven Stuhl fallen.
»Haben Sie keine Zeitung mit? Ich habe bei Gott schon acht Monate keine Zeitung mehr gelesen oder auch nur zu Gesicht bekommen, und Sie können mir glauben, Mensch, dass ich gern einmal wieder wissen möchte, was so in der Welt vorgeht.«
»Ich habe den ›Express‹ von San Antonio mit. Schweißdurchtränkt und zerknittert allerdings, und er ist schon fünf Wochen alt.«
»Fünf Wochen? Hombre, das ist für meine Begriffe direkt noch druckfeucht. Geben Sie her!«
Er schickte seine Frau um die Brille, die sie zwischen den Palmblättern des Daches hervorzog. Er setzte sich das Ding umständlich, beinahe andächtig auf, und während er die Bügel über die Ohren schob, sagte er: »Aurelia, gib dem Caballero was zu essen. Er hat Hunger.«
Sleigh las auf jeder Seite nur zwei Zeilen. Dann nickte er beifällig, als wolle er gutheißen, was in der Zeitung stand, faltete das Blatt nachdenklich zusammen, als verarbeite er das Gelesene angestrengt, nahm die Brille ab, stand auf, steckte die Gläser wieder irgendwo zwischen die Palmblätter im Dach und klemmte die Zeitung schließlich, ohne ein Wort gesagt zu haben, hinter eine Stange an der Wand.
Er ging zu seinem Stuhl zurück und sagte: »Gottverdammich, es ist wirklich ein Fest, einmal wieder eine Zeitung zu lesen und zu wissen, was in der Welt vorgeht.«
Sein Verlangen nach einer Zeitung war durch den bloßen Anblick scheinbar vollauf befriedigt.
Jetzt wusste er wenigstens, dass die Leute zu Hause immer noch welche druckten. Wenn er gelesen hätte, dass die halben USA und ganz Kanada von der Erdoberfläche verschwunden wären, hätte er sich sicherlich gefragt: ›Ach Gott, was soll man dazu sagen? Ich habe hier gar nichts davon gemerkt. Na, ist ja egal, so was kommt eben vor. Stimmt’s?‹
Höchstwahrscheinlich hätte er sich kein bisschen gewundert. Er war eben so ein Mensch.
»Ich will hier Alligatoren fangen.«
»Alligatoren, sagen Sie? Prachtvoll. Es gibt Tausende hier. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die alle kriegen. Ich kann sie gar nicht von meinen Kälbern und Jungtieren abhalten. Sie machen mir verdammt viel Scherereien. Aber das Schlimmste ist, dass der Alte mir die Schuld gibt. Er erzählt jedem, ich verkaufe seine Kälber und stecke das Geld selbst ein. Ich kann Ihnen sagen, der Alte, dem die Klitsche hier gehört, das ist ein gemeiner Kerl. Wie kann ich eine Kuh verkaufen, wenn sie auch noch so jung ist, oder sonst irgendetwas, ohne dass es die ganze Gegend weiß? Wollen Sie mir das vielleicht sagen? Aber der ist ja so niederträchtig, der Alte, der hat eine so schwarze Seele; das kann sich kein Mensch vorstellen. Wenn ich mich nicht um seinen Besitz kümmern würde, ich schwöre Ihnen, er hätte keine einzige Kuh mehr. Er selbst aber hat Angst vor dem Leben hier in der Wildnis, einfach weil er ein Feigling ist, der Kerl.«
»Hat wohl Geld, der Mann, was?«
»Geld? Ach du mein Gott! Wer redet von Geld? Geld wird er nicht allzu viel haben. Nur Land und Vieh. Das Dumme ist nur, wissen Sie, dass hier nichts mehr sicher ist, kein Grundbesitz und das Vieh schon gar nicht. Alles wegen dieser Gauner von Agraristas, verstehen Sie? Na, ist ja egal, jedenfalls bin ich ganz Ihrer Meinung, dass man hier ohne Weiteres Hunderte von Alligatoren schießen kann. Ganze Herden kann man schießen, wenn man nur ein bisschen hinterher ist. Es sind alte Bullen dabei, die sind stärker als der schwerste Stier, und es sind gefährliche Burschen. Wenn Sie so einer erwischt, mein lieber Mann, da bleibt nichts von Ihnen über; da können Sie nichts mehr von Alligatoren erzählen. Aber da fällt mir gerade ein: Warum versuchen wir es nicht erst einmal mit einer leckeren Antilope?«
»Gibt es hier denn auch so viele Antilopen?«, fragte ich.
»Viele ist gar kein Ausdruck. Da können Sie jeden alten Hasen aus der Gegend fragen. Sie gehen einfach in den Busch, und wenn Sie so hundert Meter drin sind, dann nehmen Sie Ihr Gewehr herunter und schießen irgendwo in das Dickicht hinein. Dann gehen Sie noch einmal dreißig Meter oder so und finden vor sich auf dem Boden Ihre Antilope, mausetot. Meistens liegen sogar gleich zwei da. Sie brauchen Sie nur wegzutragen. So ist das hier. Ich sage Ihnen, was wir machen. Bleiben Sie ein paar Tage bei mir. Ihre Alligatoren laufen schon nicht weg. Die werden mit Vergnügen noch ein paar Tage warten, bis Sie kommen und sie wegholen. Was haben wir heute? Donnerstag, fein. Sie hätten sich keinen besseren Tag aussuchen können. Meine Frau macht morgen mit den Kindern einen Besuch bei ihren Leuten. Ich bringe sie an die Bahn. Am anderen Tag bin ich wieder hier. Von da an sind wir ganz allein und können tun und lassen, was wir wollen. Die ganze Klitsche, das ganze Haus gehört uns. Ein Mädchen aus der Nachbarschaft kommt herüber, kocht und besorgt den Haushalt.«
3
Samstag früh kam Sleigh zurück. In der Zwischenzeit war ich fischen gegangen, hatte aber nicht viel gefangen.
»Heute Abend ist Tanz«, sagte Sleigh. »Die Geschichte steigt am anderen Flussufer, auf dem Platz drüben bei der Pumpe. Die Musik hat der Pumpmeister bestellt.«
»Aus seiner Tasche?«
»Natürlich. Sehen Sie, das ist so: Er hat zwei Kisten Flaschenbier und vier Kisten Zitronensprudel aus dem Kaufladen bei der Bahnstation kommen lassen. So kriegt er das Geld für die Musik wieder herein.«
»Wie viel Mann hat die Kapelle?«
»Einen Geiger und einen mit einer Gitarre.«
»Das kann ja nicht viel kosten.«
»Freilich nicht. Aber er wird von dem Bier und dem Sprudel ja auch nicht reich, wenn er auch ein bisschen dabei verdient. Aber das kommt ihm auch zu; schließlich trägt er das Risiko, wenn er die Musik hierher holt.«
Das Indianermädchen, das Sleigh angekündigt hatte, war schon da und machte sich im Haus zu schaffen. Obwohl sie kaum den Kinderschuhen entwachsen war, hatte sie schon selbst ein Baby.
»Der Kerl, der ihr das Wurm angehängt hat, hat sich aus dem Staub gemacht«, sagte Sleigh. Das Mädchen war alles andere als hübsch, eigentlich sogar ausgesprochen hässlich.
»Mir kommt es so vor«, sagte ich, »als könne der Mann sie nur bei Nacht gesehen haben. Oder er war betrunken. Als er sie dann bei Tageslicht erblickte oder wieder nüchtern war, wird er einen solchen Schreck bekommen haben, dass er unwillkürlich rannte, so weit ihn seine Füße trugen. Eigentlich müsste das Mädchen ewig mit Dankbarkeit an die Nacht denken, in der es geschah. Ohne die Nacht mit ihrer Dunkelheit wäre sie vielleicht nie im Leben zu einem Kind gekommen. Jetzt, wo sie eins hat, kann sich durchaus noch einmal einer für sie interessieren, bloß weil er vielleicht glaubt, sie müsse irgendwelche verborgenen Reize haben.«
Sleigh sah mich eine Weile fragend an, als müsse er meine Worte erst verdauen. Sobald er den Sinn begriffen hatte oder zumindest glaubte, ihn erfasst zu haben, nickte er und meinte: »Es ist schon was Wahres dran. Sie hat bestimmt ihren Spaß dabei gehabt. Und wenn Sie mich fragen, nun, ich bin überzeugt, dass sie nicht die Spur traurig darüber ist, dass der Kerl fort ist. Das ist es bestimmt nicht. Nur dass sie sich nicht jede Nacht auf diese Art amüsieren kann, das verdrießt sie.«
Wir setzten uns und aßen Tortillas und Frijoles, während das Mädchen die paar Fische buk, die ich am frühen Morgen gefangen hatte. Sie legte sie einfach über das offene Feuer und passte dann bloß auf, dass sie nicht anbrannten. Der Herd war eine simple Angelegenheit. Nur eine alte Holzkiste, hundert mal sechzig Zentimeter, die mit Erde angefüllt war und auf vier Pflöcken stand. Am Nachmittag ritt ich mit Sleigh über die Prärie, um nach dem Vieh zu sehen. Wir hielten auch gleich nach frischen Antilopenfährten Ausschau. Wie ich erwartet hatte, waren gar keine Fährten da.
»Sie müssen weggezogen sein«, meinte Sleigh. »Das tun sie nämlich manchmal. Dann findet man natürlich keine einzige Fährte.«
Als wir Abendbrot aßen, fragte ich Sleigh, ob nur die Leute aus dem Dorf zum Tanz kommen würden. Er sagte, dass mindestens achtzig, vielleicht sogar hundert Personen kommen würden. Sie kämen aus allen Richtungen, aus Niederlassungen, Weilern und Hütten tief drinnen im Dschungel, von kleinen Höfen an den Flussufern, an Teichen und Bächen im Busch. Viele müssten acht bis dreizehn Kilometer reiten, zu Pferd, auf Maultieren oder Burros, manche sogar noch weiter.
»Wie benachrichtigt der Pumpmeister denn die Leute?«
»Ganz einfach«, sagte Sleigh. »Er erzählt jedem Einheimischen, der hier vorbeikommt, dass an dem und dem Samstag bei der Pumpstation getanzt wird und dass die Musik schon bestellt ist. Auf die Art verbreitet sich die Kunde schnell. Und die Leute, die davon hören, geben es wieder ihren Nachbarn und Bekannten und allen denen weiter, die bei ihnen vorbeikommen. Es ist erstaunlich, sage ich Ihnen, wie schnell so eine Nachricht sich in einem Umkreis von dreißig Kilometern verbreitet.«
4
Inzwischen war es Nacht geworden, und wir machten uns auf den Weg zur Pumpstation.
Als wir bei Sleighs Nachbarn vorüberkamen, sahen wir, dass am Pfosten des Portico einer der Hütten eine Laterne hing, die den sandigen Platz vor der Hütte hell erleuchtete. Als wir näher kamen, sah ich einen Indianer auf einer Bank sitzen. Er spielte Geige. Er war ungefähr fünfundvierzig Jahre alt. Ein paar seidige schwarze Haare, so wenige, dass man sie unschwer zählen konnte, rahmten sein braunes Kinn ein. Ich war überzeugt, dass seine Freunde ihn schon wegen dieser paar Haare den Bärtigen nannten. Er spielte elend schlecht, gab sich aber große Mühe, Takt zu halten, und das gelang ihm sogar halbwegs.
»Was ist los?«, fragte ich Sleigh. »Sie sagten doch, wenn ich nicht irre, der Tanz fände bei der Pumpstation statt.«
»Freilich. Ich weiß selber nicht, was das bedeutet. Auf keinen Fall glaube ich, dass der Tanz hier sein soll.«
»Warum haben die Leute hier den ganzen Vorhof sauber gemacht? Und dann die elegante Laterne. Sieht mir nicht so aus, als ob sie’s so reichlich hätten, dass sie einfach so zum Spaß Laternen aufhängen könnten.«
»Gleich werden wir erfahren, was das bedeutet. Der Pumpmeister wird es wissen. Warum sollen sie schließlich nicht ihren eigenen Tanz veranstalten, wenn sie Lust dazu haben? Hier herum wird immer an zwei, drei Stellen gefeiert. Vielleicht hat er Krach mit dem Pumpmeister gehabt und will nun seinen eigenen Abend machen.«
Inzwischen waren wir am anderen Ufer angelangt. Am Portico der Pumpmeisterhütte hing gleichfalls eine Laterne. Sie leuchtete nicht so hell wie die, die wir gerade bei dem Geiger gesehen hatten. Diese hier qualmte, und das Glas war nicht geputzt. Der Platz vor der Hütte war freilich tadellos gekehrt.
Sechs Indianermädchen, die fortwährend über nichts und wieder nichts kicherten, versuchten, auf einer grob zusammengezimmerten Bank zu sitzen, die nicht einmal für drei lang genug war. Sie waren schon für den Tanz herausgeputzt, hatten ihr schönes, dichtes schwarzes Haar glatt gekämmt und gebürstet. Es fiel ihnen locker über den Rücken hinab und reichte beinahe bis zu den Hüften. Auf dem Kopf trugen die Mädchen Kränze aus feuerroten Feldblumen. Die grellbunten Musselinkleider waren sauber gewaschen und schön gebügelt. Ein intensiver Geruch billiger, stark parfümierter Seife strömte von ihnen aus. Als sie uns kommen sahen, steckten sie die Köpfe zusammen, verbargen die Gesichter hinter ihren Schals und schnatterten und kicherten noch lebhafter als zuvor, so als wisse jede Einzelne von Sleigh oder mir ein nettes Histörchen zu erzählen.
Der Pumpmeister stand gegen den Pfosten gelehnt, an dem die Laterne hing.
»Na, was ist los?«, fragte Sleigh. »Wird jetzt getanzt oder nicht? Wenn nicht, dann sagen Sie es gleich. Dann gehe ich nämlich zu Bett.«
Der Pumpmeister kratzte sich den Kopf, hustete und spuckte ein paarmal und entgegnete dann: »Wenn ich das nur selber wüsste. Um die Wahrheit zu sagen: Die Kapelle ist nämlich noch nicht da. Offen gestanden, glaube ich auch nicht, dass sie überhaupt noch kommt. Sie fürchten sich, nach dem Dunkelwerden durch den Dschungel zu reiten. Es ist schon zu dunkel jetzt. Ich kann es den Leuten nicht einmal übel nehmen. Por Jesuchristo, ich fürchte mich ja selbst, bei Nacht durch den gottverdammten Dschungel zu reiten, und dabei kenne ich jeden Weg und Steg und jede Vereda, jeden Pfad, im Umkreis von dreißig Kilometern. Die beiden Kerle haben bei allen Heiligen versprochen, bis fünf Uhr nachmittags hier zu sein. Sicherlich sind sie bei der Bahnstation von einer anderen Tanzgesellschaft abgefangen worden, die ihnen mehr Geld geboten hat. Da haben sich die Faulpelze bestimmt gesagt: Warum sollen wir in der Sonnenglut stundenlang durch den scheußlichen Dschungel reiten, wenn wir gleich hier an der Bahnstation sogar noch mehr verdienen? Sie hätten es bestimmt genauso gemacht, Señor, oder vielleicht nicht?«
»Wenn Sie mich fragen, Don Augustin, ich kann da nicht mitreden. Ich kann nicht einmal ›Dixie‹ auf dem Kamm blasen und noch viel weniger Mundharmonika spielen. Herrgott, bin ich müde. Am liebsten ginge ich zu Bett.« Sleigh gähnte und riss den Mund weit auf wie ein Scheunentor.
»Zigarette?« Der Pumpmeister hielt Sleigh seinen kleinen Tabaksbeutel hin. Sleigh zog ein Maisblatt heraus, brachte es in die richtige Form, klemmte es zwischen Daumen und Zeigefinger, schüttete den schwarzen Tabak darauf, machte es nass und rollte es zusammen.
»Ihnen werden unsere Zigaretten ja nicht schmecken«, sagte der Pumpmeister zu mir, während er sich selber bediente. »Nehmen Sie eine von diesen hier. Die werden Ihnen mehr zusagen. Ihr Gringos wisst ja nicht, was wirklich guter Tabak ist.« Aus einer anderen Hemdtasche zog er eine Schachtel Zigaretten, eine der bekanntesten Marken aus den Vereinigten Staaten. »Ich rauche das labbrige Zeug niemals«, sagte er. »Ich führe die Dinger nur wegen der Ölleute, die hier vorbeikommen; damit die sich wie zu Hause fühlen und ein paar Flaschen Bier bei mir kaufen.«
»Was ist da drüben bei García los?«, fragte Sleigh. »Will er Ihrer Abendunterhaltung Konkurrenz machen oder von sich aus auch einen Tanzabend steigen lassen?«
»Schon möglich. Woher soll ich das wissen. Jedenfalls ist sein Ältester über das Wochenende auf Besuch. Er ist von Texas herübergekommen, wo er irgendwo zwischen San Antonio und Corpus Christi in den Ölfeldern arbeitet, wie er mir erzählte. Er verdient gut dort. Sieht aus wie ein Fürst, der Junge. Vielleicht feiert der Alte seinen Besuch. Er wartet ja immer auf eine Gelegenheit zu zeigen, was er auf der Geige kann.«
Nach diesem Gespräch gingen wir wieder zu Sleighs Hütte zurück, denn es war klar, dass das Fest so bald nicht beginnen würde. Wie Sleigh mir auf dem Rückweg erzählte, machte er sich Sorgen wegen einer Kuh, die nicht nach Hause gekommen war.
García saß noch immer unter dem Vorbau seines Jacalito und entlockte seiner Geige mit größter Hingabe winselnde Töne.
Jetzt sah ich auch ›den großen Jungen aus Texas‹ neben seinem Vater sitzen. Er war ungefähr zwanzig, für einen Indianer ziemlich hoch gewachsen, sauber gewaschen und anständig gekämmt. Das Hemd, das er trug, musste nagelneu sein; das sah man an den Kniffen, die noch im Stoff waren. Irgendwie saß er da wie ein reicher Onkel, der bei armen Verwandten zu Besuch ist. Sein Gesicht verriet deutlich, wie sehr es ihm behagte, von der ganzen Familie verwöhnt zu werden. Auf dem linken Knie hielt er einen Emailbecher. Es war schwarzer Kaffee drin, wie ich einen Moment später sah, als er einen Teil davon ausschüttete. Auf das rechte Knie stützte er den Ellbogen auf, und in der rechten Hand hielt er eine Enchilada, eine mit Käse, Zwiebeln, Hühnerfleisch und Paprika gefüllte Tortilla. Durch lange Übung hatte er gelernt zu essen, ohne Arme und Hände mehr als absolut notwendig zu bewegen. Hätte er nicht ab und zu gelacht und ein so freundliches Gesicht gemacht, hätte man glauben können, dass da ein Roboter Abendbrot aß und nicht ein Mensch. Er hatte einen zehnstündigen Tanz vor sich, so war er darauf bedacht, keine Kraft unnötig zu vergeuden. Ihm war es bestimmt egal, ob die Musik kam oder nicht. Sofern nur eine Geige da war und ein paar gut aussehende Mädchen, würde es bestimmt ein netter Abend werden.
Gerade als wir direkt vor dem García-Haus waren, hörten wir die laute, aufgeregte Stimme eines Kindes: »Ay alloh, Manuelito, was ist los mit dir? Noch immer nicht fertig?« Und als sei er von einem Katapult abgeschnellt, stürzte ein kleiner Junge hinter der Hütte hervor durch den Portico. Mit der Behändigkeit eines jungen Leoparden sprang er seinem großen Bruder direkt an den Hals, sodass Kaffee und Enchilada, oder was davon noch übrig war, im Sand landeten.
Kaum hatte der kleine Junge den Hals seines Bruders fest umklammert, fing er an, ihm mit aller Gewalt die Haare zu verwühlen, die der Große sich für den Tanz schon so schön eingefettet und gekämmt hatte. Als die Frisur schließlich der eines Wilden glich, hämmerte der Kleine mit den Fäusten so rabiat auf Nacken, Kopf und Schultern seines Bruders los, dass das bedauernswerte Opfer des rasenden Angriffs schließlich aufstehen musste. Mit klangvollem, gutmütigem Lachen versuchte der Große, den kleinen Bengel von seinem Nacken abzuschütteln. Carlosito, so hieß der Kleine, konnte sich nun nicht mehr halten und ließ sich am Rücken seines Bruders hinabgleiten. Kaum hatte er festen Boden unter den Füßen, ging er in Boxerstellung und forderte den anderen zum Kampf heraus. Manuelito ging darauf ein und sagte, nun werde er dem Kleinen einmal zeigen, wie ein richtiger Preisboxer boxt.
Carlosito war nicht richtig in Form. Seit seiner frühesten Kindheit daran gewöhnt, auf bloßen Füßen zu stehen, barfuß zu gehen und zu laufen, war er heute unsicher auf den Füßen. Wenn er die Füße heben wollte, hatte er das Gefühl, als seien sie am Boden festgenagelt, als trage er eiserne Klammern, die ihm jede Bewegungsfreiheit raubten. Die ganze Behändigkeit seiner Bewegungen, seine Leichtfüßigkeit, der einer jungen Antilope ähnlich – all das war plötzlich dahin, ohne dass er wusste, wieso, und als er nun boxen wollte, geriet der kleine Kerl ins Wanken und konnte sich kaum auf den Beinen halten.
Manuel hatte seinem kleinen Bruder ein paar