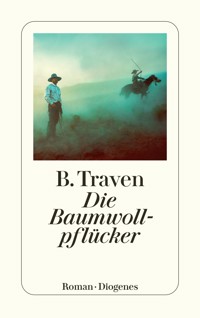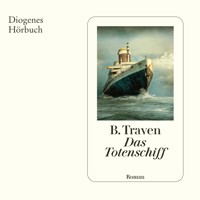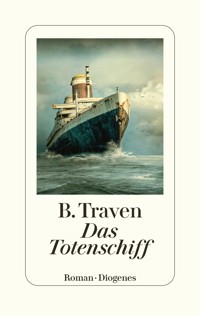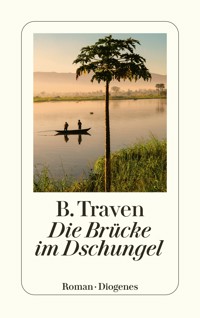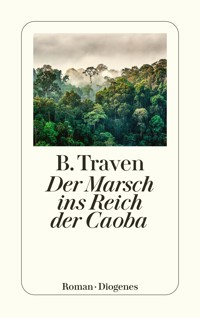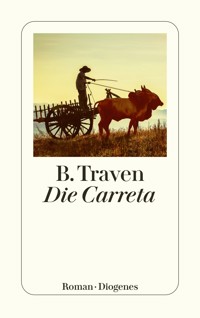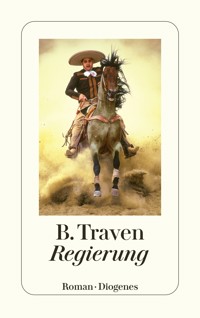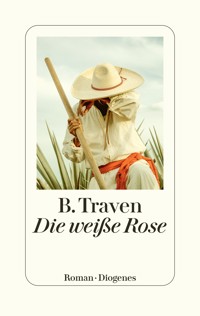
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rings um die Hacienda Rosa Blanca von Hacinto Yañez in Mexiko wird nach Öl gebohrt, was aber die Farm, die ganz im Einklang mit der Natur bewirtschaftet wird, bisher wenig beeinträchtigt hat. Ihre Bewohner führen ein gutes und bescheidenes Leben, die Farm ist ihnen Heimat und Leben. Doch alles ändert sich, als ihr Besitzer ermordet wird und sich Chaney C. Collins, Präsident der Condor Oil Company, die Farm widerrechtlich aneignet, denn die Ölgesellschaft ist eine Firma mit gewaltigem Appetit…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
B. Traven
Die weiße Rose
Roman
Mit einem Nachwort von Jan Brandt
Diogenes
1
Die Condor Oil Company war unter den amerikanischen Ölkompanien, die ihre Unternehmungen auf Mexiko ausgedehnt hatten, durchaus nicht die mächtigste.
Aber sie hatte den stärksten Appetit.
Für die Entwicklung eines Individuums wie für die Entwicklung eines ganzen Volkes ist der Appetit bestimmend. Erst recht und ganz besonders ist ein guter Appetit bestimmend für die Entwicklung eines großkapitalistischen Unternehmens. Der Appetit entscheidet das Tempo der Machtentfaltung, und der Appetit entscheidet darum auch die Wahl der Mittel, die angewandt werden, um das Ziel zu erreichen: eine einflussreiche und gebietende Macht im internationalen Wirtschaftsleben zu sein. In seinem Aufbau, in seinem Wesen, in seinen Zielen und in seinen Arbeitsmethoden wie auch in seinen Problemen unterscheidet sich ein modernes großkapitalistisches Unternehmen wenig von einem Staat. Der einzige sichtbare Unterschied ist wohl nur der, dass ein großkapitalistisches Unternehmen gewöhnlich besser organisiert ist und vernünftiger und geschickter geleitet wird als ein Staat.
Die Condor Oil Company war die jüngste der Kompanien, die hier miteinander und gegeneinander im Felde standen, wo um die Vorherrschaft auf dem Markt gekämpft wurde. Da sie die jüngste war, so war sie die gefräßigste. In der Auswahl und in der Anwendung der Mittel, einen einflussreichen Platz im Wettbewerb mit den alten und mächtigen Kompanien zu gewinnen, kannte sie weder Hemmungen noch Rücksichten. Wenn sie überhaupt einen Grundsatz hatte in Bezug auf die Art des Kampfes, so war es der: Der Krieg, der am brutalsten geführt wird, dauert am kürzesten und ist darum der humanste. Hierin fand sie gleichzeitig eine moralische Entschuldigung ihrer Handlungen, sodass sie, vor sich selbst gerechtfertigt, sagen konnte, sie führe den humansten Kampf und dass sofort wieder Friede sein werde, sobald sie den Kampf gewonnen habe.
Die Macht einer Ölkompanie hängt nicht allein von der Zahl der Öl produzierenden Brunnen ab, die eine Kompanie besitzt. Die Macht hängt vielmehr davon ab, wie viel Land sie besitzt oder unter Kontrolle hält. Und hier sind es drei Arten von Land, die infrage kommen: Land, das bestimmt Öl trägt; Land, das nach dem Gutachten der Geologen Öl tragen muss; und Land, das nach dem Instinkt der Ölleute Öl haben sollte. Die dritte Gattung Land ist es, die Spekulationen ermöglicht und die Millionen Dollar verdienen lässt, ohne dass auch nur ein einziges Fass Öl produziert zu werden braucht.
So ging der Kampf der Kompanien darum, Land und immer mehr Land zu erwerben. Es wurde mit größerem Eifer und mit größerer Geschicklichkeit daran gearbeitet, alles Land, das Öl haben könnte, zu erobern, als daran, das Land, das eine Kompanie bereits hatte, mit allen technischen und wissenschaftlichen Mitteln bis auf den letzten Hektar auszubeuten.
Da die Condor Oil Company nicht durch ihr Kapital und nicht durch die Zahl und den Reichtum ihrer produzierenden Brunnen in die vorderste Reihe der gigantischen Ölkompanien treten konnte, so musste sie den zweiten Weg einschlagen: mehr ölverdächtiges Land zu gewinnen, als irgendeine andere große Kompanie besaß. Im Besitz einer gewaltigen Menge Land, das Öl hatte oder Öl haben konnte und das darum notwendig war, den Ölbedarf des Marktes zu befriedigen, konnte sie Preise bestimmen, und sie konnte eine gewisse Kontrolle über Ölkompanien ausüben, die infolge ihrer gewaltigen Kapitalkraft unüberwindlich und unkontrollierbar schienen.
So lässt sich wohl leicht erklären, dass es keine Untat gab und kein Verbrechen, das die Agenten, die im Auftrag der Kompanie das Land heranschaffen sollten, nicht verübt hätten, um, wenn es der Kompanie notwendig erschien, das gewünschte Land zu erhalten. Die Condor Oil Company hatte achtzehn Brunnen laufen. Wo sie Land auch nur roch, das Ölland sein konnte oder Land, das irgendeine andere Kompanie zu erwerben gedachte, war sie sofort auf dem Plan.
In den erbarmungslosen Landabtreibungsgeschäften wirkte natürlich nie einer der Direktoren mit, nie einer ihrer obersten Beamten, und nur ganz selten ließ sie einen Amerikaner in diesem Zweige arbeiten. Die Direktoren kamen erst in Sicht, wenn das Land, das die Kompanie haben wollte, bereits in jenen Händen war, die es für die Kompanie bereitzuhalten hatten. Die Kompanie war immer nur der zweite Käufer. Die schäbigen Geschäfte wurden von mexikanischen oder spanischen, zuweilen von deutschen oder französischen Unteragenten abgewickelt.
Die Condor Co. hatte ihr Hauptquartier in San Francisco in Kalifornien. Das mexikanische Hauptquartier befand sich in Tampico, Mexiko. Sie besaß Zweigquartiere in Panuco, in Tuxpam und in Ebano; und sie bereitete sich vor, noch zwei weitere Büros einzurichten, eins am Isthmus, das andere in Campeche.
Vortreffliche amerikanische, englische und schwedische Geologen ließ sie für sich arbeiten, die gut bezahlt wurden. Sie beschäftigte einen verhältnismäßig großen Stab von Topografen, die das Gelände aufzunehmen und zu vermessen hatten. Die Topografen waren schon weniger gut bezahlt als die Geologen, denn ihre Arbeit wurde weniger hoch bewertet. Darum liefen die Topografen oft genug armselig und zerrissen umher wie Vagabunden. Die Geologen standen den Direktoren schon ein wenig näher, wirtschaftlich und gesellschaftlich; denn sie konnten gute Tipps über reiches Ölland in die Ohren flüstern. Die Topografen dagegen standen dem Proletariat näher, und da sie das freiwillig nicht eingestehen wollten, weil sie studiert hatten, mussten sie mehr und härter arbeiten als die Arbeiter, denen es Suppe wie Brühe war, ob man sie als Proletarier betrachtete oder nicht. Die Topografen wurden viel rascher rausgefeuert als kräftige Rigbauer; Topografen gab es reichlich, während die Rigbauer frech waren wie Banditen, denn sie schämten sich nicht, gelegentlich sogar Tomaten einzukonservieren, wenn sie keine Rigs aufbauen konnten oder rausgeschmissen waren, weil sie den Foreman verprügelt hatten.
In der Region der Condor Co., beinahe völlig umgrenzt von reich ölhaltigen Ländereien, die alle im Besitz oder in Lease, Vorpacht, der Kompanie waren, lag die Hacienda Rosa Blanca.
Die Hacienda Rosa Blanca hatte eine Größe von etwa achthundert Hektar. Sie gehörte dem Indianer Jacinto Yañez.
Ihre Produkte waren: Mais, Bohnen, Chili, Pferde, Rindvieh, Schweine, ferner Zuckerrohr, und damit auch Zucker, und Orangen, Zitronen, Papayas, Tomaten, Ananas.
Die Hacienda machte ihren Besitzer nicht reich, wohl nicht einmal wohlhabend. Denn alles und jedes wurde in althergebrachter Weise kultiviert und bewirtschaftet. Es ging auf der Hacienda gemächlich und gemütlich zu. Niemand regte sich auf. Es wurde nicht gehetzt, nicht getrieben, und wenn wirklich einmal geschimpft wurde, so geschah das nur der Abwechslung wegen und weil das Leben ja so eintönig verlaufen würde, wenn nicht gelegentlich einmal die Ventile geöffnet würden.
Die helfenden Hände auf der Hacienda waren Totonaca-Indianer wie der Besitzer. Sie bekamen keine hohen Löhne. Gewiss nicht. Aber jede Familie hatte ihre Hütte mit einem geräumigen Hof. Die Familie konnte Vieh halten nach Belieben und auf dem Land, das ihr entsprechend ihrer Kopfzahl zugewiesen war, anbauen, was ihr für ihren Unterhalt nötig schien.
Alle Familien, die hier wohnten, lebten seit Generationen auf der Hacienda. Beinahe alle waren mit dem Besitzer versippt und verschwägert. Einige der Familien verdankten ihre Entstehung der großen Zeugungsfähigkeit eines der Vorfahren des Jacinto. Jacinto war der Pate wohl so ziemlich aller Kinder, die auf der Hacienda geboren wurden, und Señora Yañez war die Patin.
Der Pate, el padrino, und die Patin, la madrina, nehmen in Mexiko eine ungemein wichtige Stellung innerhalb der Familiengemeinschaft ein. Das rührt von uralten Zeiten der Indianer her. Trotz der häufigen Verheiratung der Spanier mit indianischen Frauen haben sich in den Sitten des mexikanischen Volkes zahlreiche Gewohnheiten, Gebräuche, Worte, Redewendungen der Indianer erhalten, besonders wo es sich um Küche, Haus und Familienbeziehungen handelt, also in jenen Dingen, wo der Mann gewöhnlich passiv und neutral ist, weil sie das Urgebiet der Frau betreffen. Der Pate galt im alten indianischen Mexiko – und gilt im heutigen Mexiko – ebenso viel für das Kind wie der eigene Vater. In zahlreichen Fällen, wenn der Vater stirbt oder sich, gleichviel aus welchen Gründen, unfähig erweist, Erzieher des Kindes zu sein, tritt der Pate in die vollen Rechte und Pflichten des Vaters ein. Der Pate hat sich um das Wohlergehen des Kindes, dessen Pate er ist, zu kümmern. Wenn ihn auch das öffentliche Gesetz nicht zwingt, seine Pflicht gegenüber dem Kinde, das der Hilfe bedarf, zu erfüllen, so wird er sich dieser Pflicht nicht so ohne Weiteres entziehen; denn er würde dadurch Achtung und Ansehen verlieren, genauso gut, als wenn er irgendeine sonstige schäbige Handlung beginge, die vielleicht vom Gesetz, nicht aber von dem Gesellschaftskreis, dem er angehört, verziehen wird.
Der Vater des Kindes nennt den Paten des Kindes Compadre, das heißt Mit-Vater, und die Patin nennt er Comadre, das ist Mit-Mutter. Beide, Pate und Vater, reden sich mit Compadre an, und die Patin und die Mutter nennen sich gegenseitig Comadre.
Aus diesen Gründen betrachten sich der Vater sowie der Pate des Kindes als Brüder, und das Verhältnis zwischen beiden ist oft herzlicher als das zwischen Blutsverwandten, weil die Wahl eine freiwillige ist und von der Sympathie abhängt, die jene zwei Leute füreinander empfinden.
Wenn sich der indianische Farmarbeiter den Patron, den Herrn der Hacienda, zum Paten für sein Kind aussucht, dann kommt der Herr. Er ist nie zu stolz dazu; denn er betrachtet es als eine Ehre, dass er zum Paten erwählt wurde. Das liegt im indianischen Blute. Und von dem Augenblick an, wo der Herr Pate des Kindes jenes Farmarbeiters geworden ist, sagt der Farmarbeiter nun nicht mehr »Patron« zum Herrn, sondern Compadre. Und der Herr sagt nicht mehr »He, Juan!« zu dem Arbeiter, sondern er sagt gleichfalls Compadre zu ihm, obgleich sich die rein wirtschaftliche Stellung der beiden zueinander nicht verändert. Sie sind von nun an Brüder und behandeln sich wie Brüder.
Dieses Verhältnis besteht auf allen Haciendas in Mexiko, wo der Besitzer und die Haciendaleute indianischen Blutes sind. Ein solches Verhältnis bringt Zustände hervor, die anderswo auf Erden wohl nicht gefunden werden.
Dem Patron gehört die Hacienda. Sie gehörte seiner Familie schon, ehe Kolumbus geboren wurde. Denn der Vorfahr, der Gründer der Familie, war ein indianischer Fürst, der Häuptling eines Stammes der Totonaken, der in jenem Bereich seinen Sitz hatte. Aber der Patron betrachtet sich nur als Nutznießer der Hacienda. Er fühlt sich verantwortlich für das Wohlergehen aller, die auf der Hacienda leben; denn er ist ja der Compadre aller, und alle sind seine Compadres. Er kleidet sich nicht reicher als die, die auf der Hacienda arbeiten. Er trägt die Tilma wie sie, und wie sie trägt er Sandalen. Er isst Tortillas und Frijoles wie alle Übrigen. Aber dennoch ist das Verhältnis ganz anders als das patriarchalische Verhältnis auf den alten europäischen Bauernhöfen, wo alle Knechte und Mägde am selben Tisch mit dem Bauern und der Bäuerin sitzen. Hier sind alle selbstständig, alle haben ihre eigenen Familien, ihren eigenen Haushalt. Der Patron ist der Richter in allen ihren Angelegenheiten, ihr Ratgeber, ihr Briefschreiber – wenn er schreiben kann –, ihr Arzt, ihr Rechtsanwalt, ihr Verteidiger gegen Behörden, die Unmögliches verlangen, ihr Versorger nach schlechten Ernten und der Versorger ihrer Witwen und Waisen. Jedoch ist er niemals der Herr. Er bereichert sich nie an seinen Leuten. Er hat mehr Vieh als die Übrigen, hat mehr Mais, mehr Bohnen und hat ein wenig mehr Geld. Ein wenig mehr. Nicht viel. Denn es leben viel zu viele Familien auf der Hacienda. Die Familien vermehren sich. Sie vermehren sich reichlich. Und alle jungen Paare, die eine neue Familie gründen, wollen in ihrer Heimat bleiben, also auf der Hacienda. Und für alle muss Land und Rat geschafft werden. Und wird geschafft. Der Patron muss ja ein wenig mehr haben als die Übrigen, denn er hat zwanzigmal mehr Verpflichtungen als alle Übrigen.
Wo der Patron ein Mexikaner nicht indianischen Blutes ist, liegen die Dinge völlig anders. Da gibt es Herren und Knechte; denn da muss Geld verdient, da muss die Hacienda ertragreich gemacht werden, damit sie mit tausend Prozent Gewinn verkauft werden kann an einen, der ebenfalls tausend Prozent an ihr gewinnen möchte. Und da gibt es natürlich auch keine Compadres und keine Comadres. Jacinto Yañez jedoch, der Patron der Hacienda Rosa Blanca, war Indianer. Und weil er Indianer war und alten indianischen Gesetzen folgte, ohne ihren Wortlaut zu kennen, da er sie im Blut trug, darum musste ein Zusammenstoß einer amerikanischen Ölkompanie mit ihm zu einer Tragödie führen. Denn die Waffen, die er zu führen verstand und die zu führen er gewohnt war, versagten gegenüber einem amerikanischen großkapitalistischen Unternehmen, das Millionen verdienen musste, um seinen Aktionären den Besitz einer Luxusjacht und Einkäufe auf den Boulevards in Paris zu gewährleisten.
Die übrigen Haciendas, Farmen und Ranchos der Gegend hatte die Condor Oil Co. in der üblichen Weise gewonnen. Wie man so Land gewinnen kann. Diese Ländereien waren aufgeteilt worden in Lotes, in Lote Nr. 1, Lote Nr. 2 und so fort bis Lote 78. Lote ist ungefähr dasselbe wie Parzelle oder Terreno.
Aber im Krönungsschmuck der Condor Co. fehlte eine Perle. Die schönste Perle unter allen, die Hacienda Rosa Blanca, die Weiße Rose.
Rundherum war Ölland. Die reichsten Brunnen, die das schwarze Gold in dicken Strahlen hervorsprudelten, in Strahlen, so mächtig, dass sie beim ersten Einblasen fünfhundert Meter hoch in die Wolken schossen mit dem ohrenbetäubenden Gebrüll eines gigantischen Wasserfalls oder mit dem Geschnaube von fünfzig vereinigten Expresslokomotiven, die gleichzeitig ihre Ventile öffnen. Diese reichsten Brunnen lagen an den Grenzen der Hacienda.
Die Condor Co. musste in den Besitz der Rosa Blanca gelangen, auch wenn sie darum einen Krieg der USA mit Mexiko hätte heraufbeschwören müssen. Ihre Direktoren und Aktionäre zogen ja auf keinen Fall mit in den Krieg. Sie waren aus dem Alter heraus, und wären sie nicht aus dem Alter heraus gewesen, so hätten die Ärzte sie herzkrank, zuckerkrank oder lungenschwach geschrieben.
Es wurde dem Señor Jacinto Yañez eine Lease, eine Vorpacht, angeboten mit fünf Dollar den Hektar jährlich für zwanzig Jahre und acht Prozent Beteiligung am Gewinn.
Jacinto aber sagte zu den Agenten: »Das kann ich nicht. Ich kann die Hacienda nicht verpachten. Ich habe kein Recht dazu. Mein Vater hat sie auch nicht verpachtet. Auch nicht mein Abuelo, mein Großvater. Auch nicht dessen Vater. Ich muss sie behalten für die, die nach mir kommen werden. Die wollen auch essen. Und die müssen sie behalten für jene, die wieder nach ihnen kommen werden. So war das immer. Ich habe ja die Orangenbäume und die Nussbäume auch von meinem Vater bekommen. Hätte er keine gepflanzt, dann würde ich keine Orangen und keine Zitronen und keine Nüsse haben. Darum muss ich wieder junge Bäume pflanzen, damit auch die, die nach mir leben wollen, Orangen und Zitronen und Nüsse haben. Das ist nun eben so mit der Hacienda. Das können Sie doch verstehen, Señor Pallares?«
Señor Pallares, der Agent, der Aufkäufer für die Condor Co., konnte das natürlich nicht verstehen, weil er nie Land besessen und weil sein Vater nie Land gehabt hatte. Er war nur Licenciado, ein Rechtsanwalt, wie sein Vater auch gewesen war.
Er kam zur Kompanie und sagte dort, dass Jacinto verrückt sei. Darauf sagte der Direktor, wenn Jacinto verrückt sei, dann könnte man ihn ja ins Irrenhaus schicken.
Jacinto wäre nicht der Erste gewesen, der ins Irrenhaus geschickt wurde und dort verkam und starb, weil eine Ölkompanie seinen Besitz auf keine andere Weise bekommen konnte. Dutzende waren ins Irrenhaus geschickt worden, denn irre ist jeder, der es ablehnt, einen Kaufpreis für ein Stück Land anzunehmen, der tausendmal höher ist, als der Kaufpreis für das Land war, ehe Öl in der Nähe gefunden wurde.
Es kam ein anderer Agent. Wieder ein Mexikaner. Und wieder ein Licenciado. Señor Perez.
Er kam mit einem großen Geldsack, brachte das blinkende Gold gleich mit. Nicht alles. Aber doch einen erheblichen Teil. Er hoffte, dass der Anblick des schönen gemünzten Goldes Jacinto nachgiebig machen würde.
Licenciado Perez bot keine Lease an. Er wollte die Hacienda kaufen. Das gab mehr Geld und war darum eine größere Versuchung. »Aber ich kann doch die Hacienda nicht verkaufen, Señor Licenciado«, sagte Jacinto in seiner ruhigen, stoischen Weise. Zeit war für ihn kein bestimmter Begriff, darum ließ er sich auch beim Sprechen nicht zur Eile drängen. »Ich kann die Hacienda wirklich nicht verkaufen. Sie gehört doch gar nicht mir.«
»Wie?«, fragte Señor Perez. »Gehört nicht Ihnen? Das ist ja neu. Steht doch in den Registern als Ihr Eigentum.«
Jacinto lachte: »Sie gehört mir natürlich, die Rosa Blanca. Wie sie einstmals meinem Vater gehört hat. Aber sie gehört auch meinem Vater nicht mehr. Ich meine, die Hacienda gehört mir nicht so, dass ich damit machen kann, was ich will. Sie gehört doch auch denen, die nach mir leben wollen. Für die bin ich verantwortlich. Ich bin nur der Verwalter für die, die später leben wollen und leben werden. Wie mein Vater nur der Verwalter war und dessen Vater und dessen Vater und so immer weiter zurück und so immer weiter voran.«
»Das ist ja Unsinn, Señor Yañez. Lassen Sie nur die andern für sich sorgen. Sie können ja Ihren Kindern das Geld geben oder hinterlassen. Die können Doktor werden in Mexico oder Licenciado, oder sie mögen sich einen schönen Laden kaufen, wo sie tüchtig verdienen, und sie können sich Automobile kaufen.«
»Aber sie haben doch kein Land«, sagte Jacinto eigensinnig. »Sie müssen doch essen. Wie wollen sie denn essen, wenn sie keinen Mais bauen?«
»Seien Sie doch nicht so begriffsstutzig«, sagte Señor Perez. »Ihre Nachkommen können sich doch den Mais für die Tortillas kaufen. Sie haben doch dann Geld genug.«
»Aber der Mais muss doch angebaut werden. Es muss doch jemand Mais pflanzen. Dazu braucht man doch Land. Ein Automobil ist ja vielleicht ganz schön, aber es ist doch kein Mais. Und Fleisch ist auch nicht da. Und auch keine Bohnen und kein Chili.«
Señor Perez gab es auf, in dieser Weise mit dem blöden Indianer weiterzuverhandeln. Er griff von einer neuen Seite an.
»Sie werden doch einmal alt, nicht wahr?«
»Nein«, antwortete Jacinto. »Ich werde nicht alt. Wenn ich alt werde, dann bin ich tot. Dann sterbe ich. Alt werde ich nicht. Mein Vater ist auch nicht alt geworden. Er war gleich tot, als er glaubte, nicht mehr arbeiten zu können. Er war nicht alt. Er hat bis zum letzten Tage gearbeitet. Und ich wiederhole, ich kann das Land nicht verkaufen, weil die, die nachkommen, auch Land haben müssen.«
Er begann nun, alles das wieder aufzuzählen, was er früher schon dem Licenciado Pallares gesagt hatte, in Bezug auf die Orangenbäume und Nussbäume und über die späteren Geschlechter, die ihm vorwerfen würden, dass er übel für sie gesorgt hätte und dass sie verhungern müssten, weil er das Land weggegeben habe.
Aber als er sich plötzlich erinnerte, dass er das alles schon einmal jemand erzählt hatte, und als er sah, dass seine Worte auch nicht den geringsten Eindruck auf Señor Perez machten, als er erkannte, dass Señor Perez, obgleich ein gelehrter Licenciado, gar nichts verstand von Land und von Pflichten und von all den Sachen, die Jacinto so wichtig erschienen, da fiel ihm etwas Neues ein.
Bisher hatte er, wenn er von denen sprach, die nach ihm kommen würden und essen wollten, nur an seine eigenen Kinder und Nachfahren gedacht und nur an Nachkommen im Allgemeinen.
Jetzt aber, als ob ihn jemand auf dem reinen Weg der Gedankenübertragung daran erinnert hätte, kam ihm zum Bewusstsein, dass er ja noch viel größere Pflichten habe. Höhere Pflichten als die für seine eigenen Nachkommen. Was sollte denn aus seinen Compadres, aus seinen Comadres werden? Was aus den sechzig Familien, die auf seiner Hacienda lebten? Sie wurden alle enterbt, entlandet, entwurzelt, wenn er die Hacienda verkaufte. Sie alle waren seine Kinder, seine Schützlinge, seine Mündel, seine Pflegebefohlenen. Wie konnte er sie verlassen und ihnen das Land nehmen? Sie waren sein Blut und seine Seele gleich seinen leiblichen Kindern. Und alle werden doch eines Tages begraben werden von denen, die auch ihnen nachkommen werden und Land benötigen, um in der Welt sein zu können.
»Nein, ich kann die Hacienda nicht verkaufen, Licenciado.« Er sagte es jetzt noch bestimmter als vorher. »Die Hacienda gehört nicht mir, sie gehört ja auch meinen Compadres. Was sollen die denn tun?«
Señor Perez zündete sich eine Zigarette an und spielte eine Weile mit dem Wachsfädchen, als ob er nach der besten Antwort suche, um Jacinto mit einem Satze zu schlagen.
Als er das Fädchen ganz zerkrümelt hatte, sagte er: »Die Leute? Die können alle in den Camps arbeiten. Verdienen viel mehr als hier auf der Hacienda. Was haben sie denn hier? Fünfzig Centavos den Tag. Vielleicht achtzig. In den Camps verdienen sie fünf Pesos und arbeiten nur acht Stunden. Haben es viel leichter. Können sich Stiefel kaufen und ihren Frauen seidene Kleider und Lackschuhe und parfümierte Seife. Wenn sie sparen und nicht alles vertrinken, können sie sich bald einen Laden kaufen.«
Jacinto verstand das nicht. Er wusste gar nicht, wovon geredet wurde. In seinem Kopfe war immer nur ein Gedanke, ein einziger Gedanke. Aber dieser eine Gedanke war so stark, dass er für ihn die ganze Welt und alle ihre Probleme umfasste und erklärte. Alle Fragen wurden in diesem einen Gedanken für ihn endgültig gelöst. Er konnte diesen Gedanken nicht mit den schönen Worten eines Dichters ausdrücken, auch nicht mit den verschnörkelten Sätzen eines Gelehrten und auch nicht mit dem Zahlengewirr eines Volkswirtschaftlers. Er konnte ihn immer wieder nur in einem kurzen, schlichten Satze hersagen: »Aber sie haben doch dann kein Land mehr, und sie können doch keinen Mais anbauen.«
Das Wort Mais hatte für ihn, den Indianer, denselben Ideengehalt wie für den Europäer das Wort ›Unser täglich Brot gib uns heute‹. Heute, heute, lieber Gott; denn wir können nicht bis morgen warten, wir haben heute Hunger, und wenn wir das Brot nicht heute haben, so sind wir morgen tot.
Für den Licenciado war aber das ewige Wiederholen desselben Satzes, den Jacinto wusste, langweilig. Jacinto wusste in der Tat keinen anderen Satz, weil in dem Satz ja alle seine Weisheit beschlossen lag, wie die Weisheit aller Menschen von jeher wurzelte in dem Worte ›Land ist Brot, und Brot ist Leben‹. Was brauchte es mehr!
Aber der Licenciado Perez wusste, dass man Mais überall kaufen könne. Man brauchte ja nur das Geld. Und das Geld kann man verdienen. Leicht verdienen. Für das Geld, das ihm die Kompanie versprochen hatte, falls er den Kauf der Rosa Blanca durchsetzte, konnte er sich eine ganze Schiffsladung Mais kaufen. Mais, Mais und noch einmal Mais. An etwas anderes dachten alle die stupiden Indianer nicht.
Dennoch: In all seiner Klugheit und in all seiner Rechtsgelehrsamkeit dachte der Licenciado Perez nicht daran, dass der Mais aber doch gebaut werden müsse, wenn man ihn haben oder kaufen wolle. Irgendwo musste der Mais doch gebaut werden. Aber der Licenciado lebte ja in einer andern Welt, wo man Mais und Land trennen konnte, ohne dass man daraus Probleme sich entwickeln sah. In seiner Welt war die Beziehung Mais und Land, Mensch und Land völlig getrennt. In seiner Welt dachte man schon nicht mehr Mais, sondern man dachte nur Produkt. In seiner Welt sagte man: »Was gehen uns die an, die nachkommen? Nach uns der Weltuntergang mit drahtloser Filmvorführung im Schlafzimmer. Land, Land, Land. Was ist Land? Wir brauchen das Land für die Ölgewinnung, damit wir unsere Automobile füttern können. Mais? Land für Mais? Zur Hölle mit diesem verblödeten Indianer! Wenn wir Mais brauchen, weil wir alles Land verölt haben, dann machen wir ihn mit der Maschine und kaufen ihn in Konservenbüchsen.«
»Jacinto«, sagte nun Perez vertraulich. Und er sprach eindringlich wie ein Mann, der auf seinen Bruder, der von zu Hause fortgelaufen ist, einreden mag, um ihn zur Heimkehr zu überreden, weil sich die Mutter die Augen ausweint. »Jacinto, nun seien Sie doch einmal vernünftig. Ich will Sie ja nicht betrügen.«
»Das glaube ich auch nicht, dass Sie das wollen«, antwortete Jacinto.
»Ich will das Land ehrlich kaufen von Ihnen, für einen guten Preis.«
»Aber Licenciado, ich kann doch das Land nicht –«
»Halt, halt«, unterbrach ihn Perez mit einem Ton, wie man zu einem Kranken redet, den man nicht aufregen darf. »Doch, Jacinto, Sie können verkaufen.«
»Nein, ich kann nicht«, sagte der Indianer eigensinniger als vorher. »Ich habe kein Recht dazu. Das Land gehört nicht mir.«
»Kommen Sie nun nicht abermals mit diesem Unsinn. Ich habe die Register durchgesehen und gefunden, das Land gehört Ihnen. Die Titel sind in der besten Ordnung. Habe nie so gute und reine Rechtstitel gesehen. Das Land gehört Ihnen, und Sie können damit machen, was Sie wollen. Verkaufen oder verschenken oder verpachten.«
»Aber meine Compadres und die, die nachkom–«
Perez, geübt in den Kniffen des geschickten Anwalts, ließ dem Indianer keine Zeit, sich wieder in den alten hartnäckigen Gedanken zu verbeißen. Er wusste schon, was wieder folgen würde, und er griff darum gleich an: »Alle die Männer der Familien, die Sie hier auf der Hacienda haben, bekommen Arbeit in den Camps der Condor Co. Das verspreche ich Ihnen. Ich bringe das mit als Kaufbedingung in den Kontrakt. Die Leute sollen keiner weniger als drei Pesos den Tag verdienen, und wenn sie anstellig sind und sich eingearbeitet haben, vier und fünf Pesos.«
»Ja, das glaube ich«, meinte Jacinto, »so viel verdienen die Peons in den Camps. Der Muchacho, der Junge vom José hier, arbeitet in einem Camp und bekommt vier Pesos. Der Junge vom Pedro arbeitet auch in einem Camp, er möchte Geld verdienen, weil er heiraten will und der Schwiegervater eine Kuh als Gabe für das Mädchen verlangt. Aber der Marcos, der auch in den Camps gearbeitet hat, ist wieder hier. Er sagt, er will nie wieder in das Camp gehen, und wenn man ihm zehn Pesos gibt. Er will lieber hierbleiben auf dem Land. Er sagt, er war immer traurig im Camp, und hier lacht er immer.«
»Er ist eben ein Esel, der Bursche. Man muss sich gewöhnen können, wenn man Geld verdienen will«, sagte der Licenciado. Und er hatte recht. Wie alle seines Berufs.
Er lenkte nun zur Abwechslung das Gespräch auf eine andere Bahn: »Wenn Sie hier das viele Geld haben, Jacinto, dann können Sie sich ein Automobil kaufen.«
»Ich brauche kein Automobil«, sagte Jacinto gleichgültig.
»Aber, Mann, hombre, dann können Sie doch in einer halben Stunde in Tuxpam sein.«
»Ich will ja aber gar nicht in einer halben Stunde in Tuxpam sein. Ich will ja mit den Leuten am Wege sprechen und sehen, wie ihr Mais steht und was die Kleinen machen, die ich alle kenne, und ich will sehen, ob die blauen Buschblumen schon heraus sind und ob die großen Schildkröten an der Laguna Eier in den Sand gelegt haben und ob der schwere Mahagonibaum, der vor vier Jahren abbrach und sich quer über den Weg legte, noch immer nicht verfaulen will. Ich habe schon zwei Mal Feuer untergelegt, damit er durchbrennen soll. Aber er brennt nicht durch, und wir müssen nun immer herumreiten.«
»Estupido, stupid, stupid«, sagte Perez halblaut, und dann laut: »Aber sehen Sie, in einem Automobil –«
»Wenn ich nach Tuxpam will, um Schweine zu verkaufen oder um einen neuen Hut für Nazario mitzubringen, dann nehme ich den gelben Macho und reite früh um halb vier fort und bin um neun in Tuxpam. Das ist mir dann gerade Zeit genug. Und ich habe alles auf dem Wege gesehen, und ich habe mit Rafael gesprochen, der sich ein neues Palmdach auf den Jacal, auf sein Haus, gelegt hat, weil das andere zu alt war und es durchregnete. Dann bin ich immer noch zeitig genug in Tuxpam. Ich brauche kein Automobil. Wirklich nicht, Licenciado.«
Perez sah sich wieder einmal in seinen Hoffnungen getäuscht, und es kostete ihn ersichtlich große Mühe, eine neue Idee zu finden, um Jacinto den Besitz vielen Geldes verlockend zu machen.
Ehe er sich aber etwas Neues ausdenken konnte, das Jacinto der Welt der Geldmacher vielleicht hätte näherbringen können, hatte der Indianer endlich eine Antwort gefunden auf das Angebot, alle Compadres als Arbeiter in den Ölcamps unterzubringen. Er konnte im Kopf nicht so schnell arbeiten wie ein Licenciado, der darin geübt war. Bei ihm dauerte es länger. Aber obgleich es länger dauerte, so traf er dennoch den Punkt. Und er traf ihn genauer, als Perez erwartet hatte.
»Das ist recht gut, wenn hier die Männer Arbeit in den Camps bekommen. Es mag wirklich sein, dass sie dort arbeiten können und Geld verdienen. Aber wenn der Brunnen gebohrt ist, dann ist keine Arbeit mehr für die Leute. Dann bekommen sie auch kein Geld mehr.«
»Die Kompanie bohrt nicht nur hier Brunnen, sie hat sehr viel Land. Da werden dann die Leute von hier hingeschickt.«
Jacinto war aber nun durchaus auf dem richtigen Wege: »Dort aber, wo die Leute hingeschickt werden, sind dann doch die Leute von jenem Land, die Arbeit haben wollen. Was tun dann die?«
Perez fühlte, dass er überrumpelt war. Er fand hier nicht heraus. Ohne viel darüber nachzudenken, platzte er heraus: »Jene Leute müssen dann eben weitergehen und sehen, wo sie Arbeit finden.«
»Aber man hat ihnen doch das Land weggekauft, wie können sie denn nun leben, wenn die Männer von hier ankommen. Sie haben doch kein Land mehr. Die müssen doch alle sterben, wenn die Männer von hier kommen. Es wird auch nicht ewig gebohrt. Einmal ist es doch alle, das Öl. Dann haben alle Männer vergessen, wie man Mais baut.«
So einfach, wie alle Probleme waren, wenn Land genug da war und die Leute verstanden, es zu bebauen, so verwickelt wurden plötzlich die einfachsten Fragen, sobald die Leute aus ihrer Erde herausgerissen wurden. Das sah jetzt selbst Señor Perez ein. Der Indianer hatte ihn völlig aus seiner sicheren Stellung innerhalb der menschlichen Gesellschaft geworfen, hatte ihn selbst aus all den Weisheiten hinausgeschleudert, die sich Señor Perez in Schule und Leben erworben hatte. Hätte er einem andern Licenciado, einem andern gebildeten Mann, ja hätte er sich nur einem Kaufmann aus einer größeren Stadt gegenübergesehen, dann wäre er mit diesen Problemen irgendwie fertiggeworden. Mit einem andern Manne, der in der Stadt und in städtischen Erwerbsmöglichkeiten lebte, hätte er diese Fragen besprechen können. Sie wären sicher zu einer Lösung gelangt, die beide befriedigt hätte, weil sie beide die gleiche Sprache redeten. Sie hätten sprechen können von Gesetzen, die dann nötig wurden, von Parlamentsbeschlüssen, von Dekreten des Präsidenten, von besseren Transportmöglichkeiten, von Massenproduktion notwendiger landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Massenproduktion infolge weitgehender Anwendung leistungsfähiger Maschinen und wissenschaftlicher Lehren. Freilich blieb die Frage immer offen: Wo nehmen wir das Land her? Denn dass man Mais aus den Abfallprodukten des Öls oder aus der Schlacke der Steinkohle machen könnte, das schien ja selbst einem Licenciado ein wenig zu weit gegriffen.
Wie dem auch immer war, gegenüber der verblüffenden Einfachheit, in der Jacinto die Probleme der menschlichen Gesellschaft und des menschlichen Daseins sah, kam sich Perez sehr hilflos vor. Er konnte den Indianer nicht erreichen. Es war so, als ob der Indianer auf einem andern Planeten stünde, zu dem man von dem Planeten, auf dem der Licenciado stand, niemals und mit keinem Mittel hinüberreisen kann.
Der Indianer fühlte nicht, dass er den Licenciado geschlagen hatte, weil er nicht begriff, dass jemand anders denken könne als er, der Indianer, der in der Erde und mit der Erde lebte. Als ein Erzeugnis der Erde. Gleich einem Baume.
Darum konnte er auch mit der letzten Waffe, die der Licenciado für die stärkste Waffe hielt und bis zuletzt aufbewahrt hatte, nicht besiegt werden.
2
Señor Perez nahm den dicken Leinensack zur Hand. Er wog ihn eine Weile bedächtig, und dann schüttete er mit einer raschen Bewegung den ganzen Inhalt aus, goldene Zehn-Peso-Stücke. Hidalgos. Weil sie das Bild des mexikanischen Befreiungskämpfers Hidalgo aufgeprägt trugen.
Perez begann, das Geld abzuzählen, als ob der Kauf bereits abgeschlossen sei.
Er häufte das Geld in kleinen Säulchen auf, je fünfzig Hidalgos übereinandergelegt. Es sah sehr hübsch aus.
Er hatte endlich vierhundert solcher Säulchen aufgestellt in Reihe und Glied wie Soldaten.
Wohlgefällig, beinahe andächtig, überblickte er das Regiment und sagte: »Die Kompanie zahlt Ihnen für den Hektar fünfhundert Pesos Oro Nacional. Achthundert Hektar sind vierhunderttausend Pesos in Gold. Das hier sind nur zweihunderttausend. Sie bekommen also noch einmal den gleichen Haufen. Morgen schon, wenn Sie wollen.«
Der Eindruck, den Perez zu erwecken gehofft hatte, blieb aus. Der Indianer hatte durchaus kein Verständnis für diese Menge Gold. Hätte man ihm einen Berg Mais hingelegt oder fünfhundert Schweine, das hätte er verstanden. Freilich hätte er auch dafür Rosa Blanca nicht verkauft. Der Mais war eines Tages aufgegessen, und die Schweine waren eines Tages aufgegessen. Und was dann? Hunger für die, die nachkommen. Verlässlich war nur die Erde. Sie erzeugte ewig und ewig, in nimmermüder Freigebigkeit, ewig und ewig sich wiederholend in Jungfräulichkeit, in bebender Liebe, in heißem Empfangen, in jubelndem Gebären, in zufriedenem Dahinwelken, und dann kam wieder das stille und heilige Neuaufkeimen rührender Jungfräulichkeit, bebender Liebe und so fort ewig und ewig – wie die Sonne, wie der Mond, wie Tag und Nacht.
Aber das Geld, der Mais, die Schweine, so viel es auch war, das alles war nur einmal und niemals wieder.
Jacinto kannte auch recht gut den Wert eines Hidalgos. Das waren hundert oder hundertfünfzig oder auch nur achtzig Kilo Mais, je nach dem Marktpreis. Es war ein ausgewachsenes Schwein mittelmäßiger Güte. Ein Hidalgo, zehn Pesos, war viel Geld. Sehr viel Geld. Aber dieses Regiment Goldstücke, die hier auf dem Tisch aufmarschiert waren, machte keinen Eindruck auf ihn. Deren Wert fasste er nicht. Es war eine Gaukelei. Einen solchen Wert gab es nicht.
»Das sieht sehr schön aus, Licenciado«, sagte er endlich, um der Spielerei des Licenciado eine höfliche Anerkennung zu widmen.
»Gehört alles dir, Jacinto.« Perez duzte ihn plötzlich, um recht brüderlich zu erscheinen. »Das gehört alles dir und noch einmal so viel, denn das ist nur die Hälfte. Für die Rosa Blanca.«
Der Licenciado hätte Jacinto auch ganz gut das Geld anbieten können für das Recht, ihm das Herz aus der lebenden Brust zu schneiden.
So geschah es, dass jenes Regiment Gold für Jacinto kein Leben annahm. Es erweckte keine Träume in ihm. Regte keine Hoffnungen an. Diese Säulchen hatten keine Macht über ihn und konnten keine Macht über ihn gewinnen, weil vor seinen Augen etwas Größeres stand, etwas Höheres, etwas Heiliges.
Was er besaß, das hatte er von seinen Vätern übernommen, nicht um es als Eigentum zu besitzen, sondern um es zu erhalten und es dereinst weiterzugeben an die Nachfolgenden. Was er besaß, war ihm nur geborgt worden, war nur sein, um es für die kommenden Geschlechter zu verwalten. Seine hohe Pflicht war, das geborgte Gut ungeschmälert weiterzugeben, wenn seine Stunde kam. Was hätte er sagen können, wenn er dereinst in den Jagdgründen der Ewigkeit seine Väter antraf und sie ihn fragen würden: »Was tatest du mit unserem Gut? Was tatest du mit dem Gut unserer Enkel und Urenkel?« Er hätte sich vor Scham verkriechen müssen in die fernsten und dunkelsten Winkel der Gebüsche, wo nie die Sonne hinscheint und nie der Mond sein sanftes Silber hineingleiten lässt. Und was gar, wenn alle die Väter seiner Compadres kamen und ihn fragten: »Was tatest du mit unsern Söhnen und Töchtern?« Und das würde so fortgehen bis in die urewigen fernsten Zeiten hinein. Alle dreißig oder vierzig oder fünfzig Jahre würden neue Männer heraufkommen in die grünen Jagdgefilde und würden ihn fragen: »Wo ist das Gut, das dir deine Väter anvertrauten für uns?« Sie würden ihn herauszerren aus seinem dunklen Winkel und dann wieder zurückschleudern, wenn er nicht antworten könnte. So würde das fortgehen ewig und ewig. Und niemals Ruhe. Niemals Ruhe.
Und so wie das Gold vor ihm kein Leben bekam, so bekam die Rosa Blanca in diesem Augenblick, als um sie gekämpft wurde, alles Leben. Sie nahm Gestalt an. Sie sprach zu ihm. Sie lachte ihn an. Sie wurde Person. Er hörte sie singen. Er konnte es nicht mehr ertragen. Er stand auf und trat in die offene Tür.
Dort stand er und überblickte den Hof. Der Hof sah, wie meistens, auch heute nicht aufgeräumt aus. Jenes hatte er schon hundertmal ändern wollen und dieses. Immer wenn er es sah, wollte er es ändern, und immer gleich darauf war es vergessen und blieb.
Da in der Ecke, dicht bei dem Zaun, lag das alte zerbrochene Karrenrad eines Maultierkarrens, an dessen Existenz sich niemand mehr auf der Hacienda erinnern konnte.
Jenes Karrenrad verwitterte langsam, denn es war aus gutem, eisenhartem Holz. Jeden Sonnabend sollte es fortgeräumt werden, und am Sonntagmorgen, wenn er in den Portico trat, lag das Karrenrad noch immer in seiner Ecke.
Er erinnerte sich, dass es schon dagelegen hatte, als er fünf Jahre alt war. Da hatte sein Vater gesagt: »Das alte Karrenrad kann auch verbrannt werden, der Manuel mag es heute Abend zerhacken und das Holz zu den Frauen in die Küche bringen.«
Der Auftrag wurde vergessen, und das Rad wurde nicht zerhackt. Dann sagte der Vater wieder einmal, als er es sah: »Das Rad könnte man vielleicht zu etwas gebrauchen, ich werde mit Manuel reden, was er denkt, was man damit machen könnte.«
Jacinto war dann, als er etwa acht Jahre alt war, in den Speichen herumgeklettert mit der Absicht, seinen Körper geschmeidig zu machen gleich dem einer Schlange.
Eine Zeit lang diente es dazu, einen jungen Kojoten, den er mit anderen Jungen gefangen hatte, daran festzubinden. Sie wollten den Kojoten zähmen, um ihn als Hund zu verwenden. Aber eines Nachts hatte sich der Kojote von dem Strick losgebissen und war entwischt.
Dann sollte das Rad wieder einmal verbrannt werden. Dann sollte es wieder einmal mithilfe Manuels zu etwas anderem gebraucht werden. Dann, als Jüngling, hatte Jacinto des Abends auf dem Rad gesessen und – es war in seiner Liebeszeit – von seinem Mädchen, das jetzt seine Frau war, geträumt. Hatte, darauf sitzend, süße Rancholieder vor sich hin gesummt. Und hatte manche Nacht darauf gehockt und still vor sich hin geweint, als er glaubte, dass sie ihn nicht mochte.
Hatte dann, ein wenig später, mit ihr des Nachts zusammen darauf gehockt und an zehn oder mehr Stellen Kerben eingeschnitten für die Umarmungen, die sie ihm gab oder was es sonst sein mochte. Er wusste gut, was es war, wofür er die Kerben einschnitt. Dann starb der Vater.
Aber das alte, zerbrochene Karrenrad lag noch immer da. Und noch immer an derselben Stelle.
Dann starb auch der alte Mayordomo, der Manuel, der so oft den Auftrag erhalten hatte, das Rad zu zerhacken oder es zu etwas anderem zu gebrauchen.
Jedoch das Rad ließ sich durch den Tod der beiden Männer nicht stören. Es lag da und lag da.
Und nun seit Jahren, jeden Sonnabend, wenn der Hof aufgeräumt wurde, gab Jacinto den Befehl, dass das Rad endlich einmal beseitigt würde. Und jeden Sonntagmorgen, wenn er in den Portico trat und nach dem Wetter sah, lag das Karrenrad noch immer da. Bis zum nächsten Sabado. Aber am Sonntag würde sicher etwas auf dem großen Hof gefehlt haben, hätte das Karrenrad nicht noch immer dagelegen.
Und so lag es auch jetzt da, friedlich, gemütlich, unverfroren, ausdauernd und selbstbewusst, und wartete auf das endliche Verfaulen.
Sein ältester Junge, Domingo, saß jetzt oft, allein und weltverloren, auf dem Rade und schnitt gelegentlich Kerben ein, wie er, der Vater, wohl bemerkt hatte.
Er wusste auch, wer das Mädchen war.
Was er jedoch am besten wusste, war, dass jenes Karrenrad immer noch daliegen würde, wenn er eines Tages abgerufen wurde. Denn das Rad war kein lebloses Stück alten verwitternden Mahagoniholzes. Das Rad war ein Symbol. Ein Symbol der Rasse. Das Karrenrad war zeitlos geworden.
Jacinto blickte zur Seite, und dort hockte Emilio, der Junge der Cocinera, der Köchin. Er hockte da auf dem Erdboden, hatte vor sich einen Schilfkorb stehen und körnte die Maiskörner aus den Kolben mithilfe eines schon entkörnten Kolbens. So, genau so, wurde der Mais hier schon entkörnt vor fünftausend Jahren, mehr, vor zwanzigtausend Jahren. Eine Entkörnungsmaschine, die in fünf Minuten mehr auskörnte als der Junge in zwei Stunden, kostete sechzig Pesos oder gar nur fünfundvierzig. Sie sollte schon gekauft werden, als der Vater noch lebte. Jacinto hatte sie schon hundertmal kaufen wollen. Aber vielleicht geht es noch eine Weile ohne. Es ist ja fünftausend Jahre so gegangen. Warum denn nun mit einem Male so plötzlich? Der Emilio hat ja sonst sowieso auch weiter nichts zu tun und geht doch immer nur Kaninchen jagen. Kann er auch gut Mais auskörnen. Bekommt er kräftige Hände und Finger davon. Kann ihm nur nützlich sein im Leben.
Drüben, in der Nähe des Zaunes, der den weiten Hof umfriedet, doktert Margarito, der Mayordomo der Hacienda, an zwei Mules, die sich infolge ihrer Trägerarbeit den Rücken durchgescheuert haben. Er wäscht die Wunden mit schwarzer Seife und heißem Wasser sorgfältig aus und singt dabei.
Er singt das uralte Rancholied von dem schönen Indianermädchen, das einen Indianerburschen liebte, ach so sehr, so sehr liebte. Aber dann kam der Mexikaner mit großem rotem Hut und schweren silbernen Sporen herangesprengt, ach so sehr stolz, so sehr stolz, herangesprengt auf einem weißen Ross, ach so sehr, so sehr weißem Ross herangesprengt. Und der stolze, ach so sehr stolze Mexikaner auf weißem Ross und mit schweren silbernen Sporen sprach viel honigsüße Worte, ach so sehr süße, so sehr süße Palabras. Und er verführte das Indianermägdelein, das ach so sehr, so sehr in Furcht war vor dem stolzen Mexikaner in dem großen roten, ach so sehr großen roten, so sehr großen roten Hut. Und so bekam das Indianermägdelein ein kleines Kindelein, ach so ein ganz kleines, so sehr kleines Kindelein; und das Mägdelein, la Mamacita tan morena, starb mit ihrem kleinen Kindelein heimlich im tiefen, ach so sehr tiefen, so sehr tiefen Busch, und eine blaue Blume, ach so sehr blaue, so sehr blaue Blume fiel auf ihr Grab, das die Ameisen, ach so sehr geschäftig, so sehr geschäftig, über das tote Mägdelein erbauet hatten.
Während nun Margarito die hundertzwanzig Strophen, oder wie viele es sein mögen, singt – Jacinto hört in seiner Seele das ganze lange Lied in einer halben Minute, denn auch er kennt es und sang es in seiner Liebeszeit und stets mit Tränen im Gesicht – und während Margarito singt und mit Andacht und Inbrunst die Reime schmelzend wiederholt, unterbricht er sich zuweilen und schreit auf die Mules ein: »Caramba, zum Donnerwetter, du Cabron, du himmelgottverfluchter und verfuckter Hurensohn, steh endlich still, oder ich trete dich wahrhaftig, bei der heiligen allerreinsten Himmelsjungfrau, por la Santa Purisima, doch noch in den verfluchten Arsch, du stinkiger Sohn einer alten Hure.«
Aber dieses gelegentliche Zurückfallen in die brutale nackte Wirklichkeit des harten arbeitsreichen Lebens tut dem gefühlvollen Gesang des Margarito keinen Abbruch. Er singt nach dieser irdischen Entgleisung ohne erschütternde Dissonanz sofort wieder in rührend schmelzender Weise von dem schönen Indianermädchen, das von einem stolzen Mexikaner in rotem Hut und auf feurigem weißem Ross verführt und entführt wurde. Dissonanzen sind Margarito fremd. Alles reimt sich, und alles ist in Harmonie. Jacinto ist Compadre des Margarito, er ist Pate von allen seinen Kindern; und der Vater des Margarito ist Pate von zwei Kindern des Jacinto, von den beiden ältesten, von Domingo, dem Jungen, und von Juana, dem ältesten Mädchen. Die Abkunft des Margarito ist nicht ganz klar. So wird wenigstens getan. Aber auf der ganzen Hacienda weiß man und jedem, der es wissen will, wird es erzählt, dass der Vater des Jacinto auch der Vater des Margarito ist. Margarito selbst hält diese Tatsache für wahrscheinlich. Jedenfalls streitet er sie nie ab. Und seine Mutter, die noch lebt, auf der Hacienda die Hühner versorgt und im Haus mithilft, sagt weder Ja noch Nein. Sie ist weder stolz darauf noch beschämt. Wenn ihr Gott die große Gnade erwies, sie mit Kindern zu segnen, so ist es an sich gleichgültig, wer der Vater ist. Der Vater wird von Gott geschickt als Mittel zum Zweck. Alimentationsfragen entstehen nicht, denn es wächst Mais, und es wachsen Bohnen auf der Hacienda in Fülle; und jeder, der da lebt, hat ein Anrecht auf den Mais und auf die Bohnen und auf die Hühner und auf die Schweine. Ob da zwanzig Kinder mehr essen oder fünfzig, Kinder, die sich auf die Familien verteilen und deren Vater es als Ehre und Gnade des Himmels betrachtet, wenn er Vater sein darf, auch wenn er es gar nicht ist, das sind unwichtige Dinge. Der Patron der Hacienda sieht gar nicht hin. Die Kinder, alle Kinder, sind vom Himmel gesandt, und darum haben sie ein Recht zu leben. Wäre da kein Vater, dann ist immer der Patron der Hacienda noch da, der die Kinder ernährt, ernähren muss nach indianischem Gesetz und auch freudig ernährt, ob Gesetz oder nicht Gesetz. Gesetze, die nicht im Blut sind, haben ja sowieso keinen Wert.
Und Jacinto sieht hinüber zu den verstreuten Hütten und schiefen Adobehäusern, wo sie alle wohnen, die Nachkommen sind jener, die mit seinen Vätern hier lebten. Ein kleines Volk, aber ein echtes Volk mit echtem König. Wo der König nicht Herrscher ist, wo der König nicht in Luxus lebt von dem, was sein Volk für ihn errackert, wo der König nichts ist als Verwalter, als Ratgeber, wo seine ganzen Rechte als König darin bestehen, für das Wohlergehen derer verantwortlich zu sein, die ihm von seinen Vätern anvertraut wurden. Anvertraut nicht als Untertanen, sondern als Gleichberechtigte, die sich in Jahrtausenden von Erfahrungen darauf geeinigt haben, dass eine Familie das Land des Volkes verwaltet, um zu vermeiden, dass nach dem Tode des Oberhauptes der Familie die Männer des Stammes in einen blutigen Krieg eintreten, um das Recht zu erkämpfen, wer Verwalter und Führer für die nächste Generation sein soll. Für solche Kämpfe haben die Leute keine Zeit, und sie haben keine Zeit, den Hass zu besänftigen, der nach solchen Kämpfen im Volke zurückbleibt. Solche kleinen Völker werden immer nur dann in ihrer Ordnung und in ihrem uns primitiv erscheinenden Aufbau und Zusammenhalt gestört, wenn eine Sippe oder ein Stamm von Städtern, von Städteerbauern auf den Plan tritt.
Städte müssen Menschen in Massen aufsaugen, um bestehen und sich entwickeln zu können. Und da diese Massen viel weniger Land bewohnen, als nötig ist, sie zu ernähren, brechen sie in die Völker ein, die mit der Erde unmittelbar verwachsen sind, und bauen eine Ordnung auf, in der der Städter zum Tyrannen und der Bauer zum Heloten wird.
Aus den Hütten qualmte der Rauch der Herde durch die immer offene Tür und durch die Ritzen der Wände. Vor einigen Hütten knieten die Frauen vor dem Metate und rieben den Mais. Die Schweine, die Hühner, die Truthühner, die Esel, die Vögel und Tiere des Buschs und des Dschungels, die gezähmt waren und sich an das Haus gewöhnt hatten: Kleine Rehe, Waschbären, Hunde und Katzen liefen auf den Höfen umher, drängten sich dicht an die Frau, die vor dem Metate hockte. Wenn sie sich ein wenig aufrichtete, um sich den Schweiß aus der Stirn zu wischen, so warf sie vielleicht einen Brocken des Maisteigs zwischen die hungrigen Gäste des Hofes, die einen wilden Kampf darum begannen. Dann lachte die Frau und ging wieder mit frischen Kräften an ihre Arbeit. An die Arbeit, die eine Handmühle in drei Minuten schafft und an der die Indianerin eine Stunde sitzt und alle Kräfte daranwendet, die sie in sich hat. Aber die Handmühle kostete fünfzehn Pesos, und was hätte man mit der übrigen Zeit anfangen sollen, wenn man die Maza in drei Minuten fertig hat? Es war ein viel größeres Vergnügen, all die Tiere um sich zu haben und all die Kinder dazwischen. In den drei Minuten an der Handmühle konnten die Tiere sich nicht versammeln, konnten die Kinder nicht mit den Tieren herumjagen und herumkreischen, konnte man nicht so viel sehen und nicht so viel erleben. Wenn man sah, wie der Waschbär auf die Katze losging oder der Hund vom Truthahn verdroschen wurde, das war Leben. Die Handmühle war kein Leben, kein Lachen; und man konnte dem Manne, wenn er vom Felde hereinkam, nichts erzählen, dass auch er lachen musste.
In einem alten aufgehängten Fassreifen bei einer anderen Hütte saß ein Papagei. Er war nicht angebunden und verübte die tollsten Streiche gegen die Kinder, gegen die Katze, gegen den Hund, gegen die Schweine. Wenn er während des Essens dann auf seinem Brett saß und seine zwei Tortillas bekam, so aß er nur wenig von den Tortillas. Er ließ die meisten Stückchen herunterfallen für ein bestimmtes Schwein, das er bevorzugte. Es war ein kleines, wildgraues, hässliches Schwein. Aber Loro, der Papagei, liebte es. Er ließ die Stückchen nur fallen, wenn jenes Schwein unter dem Brett stand. War ein anderes dort oder liefen Hühner umher, um etwas aufzuschnappen, so ließ er nichts herunterfallen. Das Schwein, das vom Papagei so geliebt wurde, sah auf zu ihm wie zu einem Gott, der Welten verschenkt. Die Familie, die in dieser Hütte wohnte, hatte das tausendmal gesehen; aber jeden Tag zu Mittag kamen die Kinder heraus, um es immer wieder zu sehen. Sie konnten es nicht oft genug sehen. Wenn ein anderes Schwein den Brocken erwischte, den der Papagei für seinen Günstling hatte fallen lassen, dann schrie der Papagei wie besessen: »Cochino! Cochino! Schwein! Schwein!« Es war das Einzige, was er neben ›Como estas? Wie geht’s?‹ sprechen konnte. Jacinto hörte, während er auf der Veranda stand, das Kreischen »Cochino, cochino«. Er kannte es, kannte den Papagei, kannte die Familie, kannte alles, alles. Das kreischende Geschrei des schimpfenden Papageis kam zu ihm nicht als ein einzelner Laut, es kam zu ihm als ein Ton, als eine Note in den tausend Tönen des ewig gleichen, vertrauten und heimatlichen Singens der Rosa Blanca. Alle Geräusche, alles Lärmen, das Brüllen der Kühe, das Grunzen der Schweine, das Gackern der Hühner, das Krähen des Hahnes, das glucksende Belfern des Truthahnes, das Juchzen der Kinder, das winselnde Wimmern der Säuglinge, das gelegentliche Bellen der Hunde, das Klatschen von Tortillas in den Hütten, das Summen der Fliegen, das Geschwätz und Geschnatter der Frauen in der Küche seines Hauses, das Fluchen und Sichverschwören des Margarito, der an den