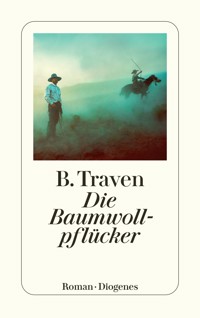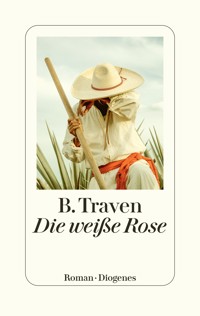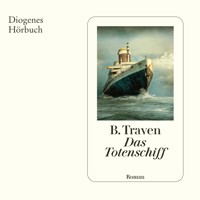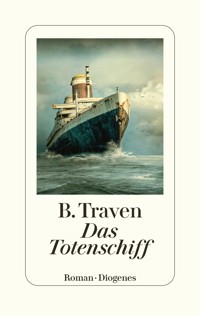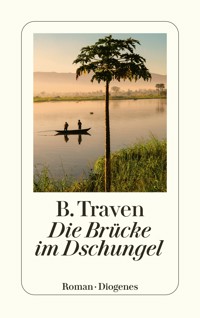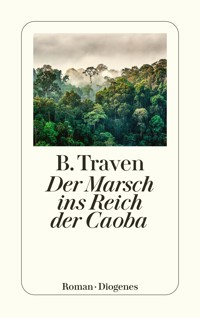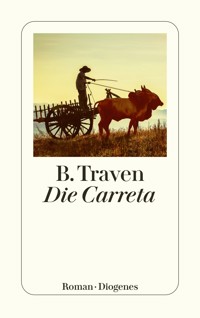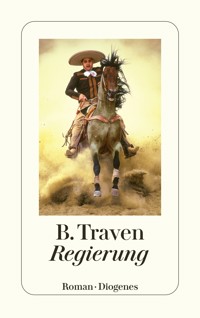11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die beiden Amerikaner Dobbs und Curtin sind mittellos an der mexikanischen Ostküste gestrandet. Mit ihren letzten Peseten kaufen sie eine Goldgräberausrüstung und machen sich mit dem kundigen alten Howard auf in die Sierra Madre, um dort nach Gold zu suchen. Nach einer gefährlichen Plackerei scheint ihr Ziel erreicht. Nun heißt es, ihren Fund an einen sicheren Ort zu bringen. Das Abenteuer nimmt eine neue Wendung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
B. Traven
Der Schatz der Sierra Madre
roman
Diogenes
Editorische Notiz
Der 1882 geborene B. Traven verfasste sein Werk in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, und seine Sprache und Begrifflichkeit sind aus diesem historischen Kontext heraus zu verstehen. Dieser Autor, der wie kein anderer Rassismus, Ausbeutung und Gewalt in der kapitalistischen Welt beschrieb, verwendet die damals üblichen Beschreibungen, und würde man hier nach heutigen Kriterien in die Wortwahl eingreifen, würde man auch die Mechanismen dieser Unterdrückung nicht mehr nachvollziehbar machen.
Der Verlag vertraut auf das Vermögen der Leserinnen und Leser, diese heute umstrittenen Bezeichnungen und Zuschreibungen als Ausdruck der sprachlichen Gepflogenheiten einer historischen Epoche zu erkennen beziehungsweise als Figurenrede einzuordnen, die nicht mit der Haltung des Autors verwechselt werden darf.
DER SCHATZ, DEN ZU FINDEN DU DIE MÜHEN
EINER REISE NICHT FÜR WERT HÄLTST,
DAS IST DER ECHTE SCHATZ, DEN ZU SUCHEN
DIR DEIN LEBEN ZU KURZ ERSCHEINT.
DER FUNKELNDE SCHATZ, DEN DU MEINST,
DER LIEGT AUF DER ANDERN SEITE
1
Die Bank, auf der Dobbs saß, war keineswegs gut. Die eine Latte war herausgebrochen, und eine zweite Latte bog sich nach unten durch, darum konnte man recht gut das Sitzen auf dieser Bank als Strafe empfinden. Ob er diese Strafe verdient habe oder ob sie ungerecht über ihn verhängt worden sei, wie die Mehrzahl der Strafen, die verhängt werden, darüber dachte Dobbs in diesem Augenblick gerade nicht nach. Dass er unbequem saß, würde er wahrscheinlich erst erfahren haben, wenn ihn jemand gefragt hätte, ob er auf der Bank gut sitze. Die Gedanken, die Dobbs beschäftigten, waren dieselben, die so viele Menschen beschäftigten. Es war die Frage: Wie komme ich zu Geld? Wenn man schon etwas Geld hat, dann ist es leichter, zu Geld zu kommen, weil man etwas anlegen kann. Wenn man aber gar nichts besitzt, dann hat es seine Schwierigkeiten, diese Frage zur Zufriedenheit zu lösen.
Dobbs hatte nichts. Man darf ruhig sagen, er hatte weniger als nichts, weil er nicht einmal ganze und vollständige Kleidung hatte, die unter beschränkten Verhältnissen als ein bescheidenes Anfangskapital angesehen werden darf.
Aber wer arbeiten will, der findet Arbeit. Nur darf man nicht gerade zu dem kommen, der diesen Satz spricht; denn der hat keine Arbeit zu vergeben, und der weiß auch niemand zu nennen, der einen Arbeiter sucht. Darum gebraucht er ja gerade diesen Satz, um zu beweisen, wie wenig er von der Welt kennt.
Dobbs würde Steine gekarrt haben, wenn er solche Arbeit bekommen hätte. Aber selbst diese Arbeit bekam er nicht, weil zu viele da waren, die auf diese Arbeit warteten, und die Eingeborenen immer mehr Aussicht hatten, sie zu bekommen, als ein Fremder.
An der Ecke der Plaza hatte ein Schuhputzer seinen hohen Eisenstuhl stehen. Die übrigen Schuhputzer, die sich keinen Stuhl leisten konnten, liefen mit ihren kleinen Kästchen und Klappbänkchen wie die Wiesel rund um die Plaza und ließen niemand in Ruhe, dessen Schuhe nicht spiegelblank waren. Er mochte auf einer der zahlreichen Bänke sitzen oder spazieren gehen, er wurde immerwährend belästigt. Also selbst die Schuhputzer hatten es nicht leicht, Arbeit zu finden, und gegenüber Dobbs waren sie Kapitalisten, denn sie besaßen eine Ausrüstung, die wenigstens drei Pesos kosten mochte.
Selbst wenn Dobbs die drei Pesos gehabt hätte, Schuhputzer hätte er nicht werden können. Nicht hier zwischen den Eingeborenen. Es hat noch nie ein Weißer versucht, Schuhe auf der Straße zu putzen, hier nicht. Der Weiße, der zerlumpt und verhungernd auf der Bank auf der Plaza sitzt, der Weiße, der andere anbettelt, der Weiße, der einen Einbruch verübt, wird von den übrigen Weißen nicht verachtet. Wenn er aber Stiefel auf der Straße putzt oder bei Indianern bettelt oder Eiswasser in Eimern herumschleppt und verkauft, sinkt er tief unter den schmutzigsten Eingeborenen hinab und verhungert doch. Denn kein Weißer würde seine Arbeit in Anspruch nehmen, und die Nichtweißen würden ihn als unlauteren Konkurrenten betrachten.
Auf den hohen Eisenstuhl an der Ecke hatte sich ein Herr in weißem Anzug hingesetzt, und der Putzer machte sich über dessen braune Schuhe her. Dobbs stand auf, schlenderte langsam hinüber zu dem Stuhl und sagte ein paar leise Worte zu dem Herrn. Der Herr sah kaum auf, griff in die Hosentasche, brachte einen Peso hervor und gab ihn Dobbs. Einen Augenblick stand Dobbs ganz verblüfft, dann ging er zurück zu seiner Bank. Er hatte auf nichts gerechnet oder auf zehn Centavos vielleicht. Er hielt die Hand in der Tasche und fühlte den Peso. Was sollte er damit tun? Ein Mittagessen und ein Abendessen, oder zwei Mittagessen, oder zehn Pakete Zigaretten Artistas, oder fünfmal ein Glas Milchkaffee mit einem Pan francés, das ein gewöhnliches Brötchen ist.
Nach einer kurzen Weile verließ er die Bank und wanderte die paar Straßen hinunter zum Hotel ›Oso Negro‹. Das Hotel war eigentlich nur eine Casa de huéspedes, ein Logierhaus. In der Vorderfront war auf der einen Seite ein Laden mit Schuhen, Hemden, Seifen, Damenwäsche und Musikinstrumenten; auf der andern Seite war ein Laden mit Drahtmatratzen, Liegestühlen und fotografischen Apparaten. Zwischen diesen beiden Läden war der breite Hausdurchgang, der zum Hofe führte. In diesem Hof befanden sich die morschen und fauligen Holzbaracken, die das Hotel bildeten. Alle diese Baracken hatten kleine, enge, dunkle, fensterlose Kammern. In jeder Kammer standen vier bis acht Schlafgestelle. Auf jedem Gestell lagen ein schmutziges Kissen und eine alte verschlissene Wolldecke. Licht und Luft für die Kammern kamen durch die Türen, die immer offen standen. Trotzdem waren die Kammern stets dumpfig, weil sie alle zu ebener Erde lagen und die Sonne nur ein Stück weit in jeden Raum eindringen konnte. Luftzug war auch nicht, weil die Luft in dem Hofe stillstand. Diese Luft wurde durch die Abortanlagen, die keine Wasserspülung hatten, noch mehr verschlechtert. Außerdem brannte mitten auf dem Hofe Tag und Nacht ein Holzfeuer, auf dem große Konservenbüchsen standen, in denen Wäsche gekocht wurde. Denn in dem Hotel befand sich auch noch die Wäscherei eines Chinesen.
Links in dem Hausdurchgang, ehe man zu dem Hofe kam, war ein kleiner Raum, in dem der Hausmeister saß. Ein zweiter Raum, gleich neben diesem Empfangsraum, war bis oben hin mit Drahtnetz vergittert.
Hier wurden auf Regalen die Koffer, Kisten, Pakete und Pappschachteln der Hotelgäste aufbewahrt. Es lagen da Koffer von Leuten, die hier vielleicht nur eine Nacht geschlafen hatten; denn manche der Koffer und Kisten waren dick mit Staub bedeckt. Es hatte gerade für eine Nacht gereicht, das Geld, das der Gast hatte. Am nächsten Tage hatte der Mann dann irgendwo draußen geschlafen und auch die folgenden Nächte. Eines Tages kam er dann, nahm ein Hemd oder eine Hose oder sonst einen Gebrauchsgegenstand aus dem Koffer, schloss ihn ab und gab ihn wieder zurück zum Weiteraufbewahren. Und eines Tages machte sich der Mann auf die Reise. Da er kein Bahngeld oder Schiffsgeld hatte, musste er zu Fuß wandern, und dabei konnte er seinen Koffer nicht gebrauchen. Heute war der Mann vielleicht in Brasilien, oder er war längst irgendwo in einer Wüste verdurstet oder auf einem Buschwege verhungert oder erschlagen.
Nach einem Jahr, wenn der Aufbewahrungsraum für die Koffer zugepackt wurde, sodass nicht einmal mehr die Sachen der Neuankömmlinge untergebracht werden konnten, dann machte der Hotelbesitzer ein Aufräumen. An den Sachen befand sich manchmal ein Zettel mit dem Namen des Besitzers jener Kiste oder der Pappschachtel. Es kam vor, dass der Mann vergaß, welchen Namen er angegeben hatte und, weil er inzwischen seinen Namen geändert hatte, nun seinen Koffer nicht zurückverlangen konnte, weil er sich auf seinen damaligen Namen nicht besinnen konnte. Er vermochte den Koffer wohl zu bezeichnen. Dann fragte der Hausmeister nach dem Namen, und weil der Name mit dem Zettel, der mit einer Stecknadel auf den Koffer gepickt war, nicht übereinstimmte, so wurde ihm der Koffer nicht ausgehändigt.
Oft war der Zettel mit dem Namen auch abgefallen. Manchmal war er nur mit Kreide angeschrieben, die sich ausgewischt hatte. Zuweilen hatte der Hausmeister in der Eile vergessen, nach dem Namen zu fragen, und er hatte nur die Bettnummer mit Blaustift auf die Pappschachtel geschrieben. Die Bettnummer aber hatte der Besitzer der Pappschachtel nie gewusst, und hätte er sie gewusst, würde er sie wohl kaum behalten haben. Ein Datum war nie mit angegeben.
Es war also nie festzustellen, wie lange eine Kiste oder ein Koffer hier in dem Aufbewahrungsraum lag. Die Dauer der Aufbewahrungszeit wurde nach der Dicke der Staubschicht beurteilt, die auf den Sachen lag. Und nach dieser Dicke vermochte der Hotelbesitzer ziemlich genau zu sagen, wie viel Wochen jener Koffer oder dieser Zuckersack hier lag. Berechnet wurde für die Aufbewahrung nichts. Wenn aber der Raum zu eng wurde, dann kamen die Sachen, die den dicksten Staub aufwiesen, heraus. Der Besitzer durchsuchte den Inhalt und sortierte ihn. Meist waren es Lumpen. Es kam ganz selten vor, dass irgendein Gegenstand von Wert in den Koffern gefunden wurde; denn wer noch Wertgegenstände besaß, ging nicht in den ›Oso Negro‹ übernachten, oder er verbrachte dort nur eine Nacht. Diese Lumpen verschenkte der Logierhausbesitzer dann an zerlumpte Hotelgäste, die darum bettelten, oder an andere zerlumpte Leute, die gerade vorbeikamen. Es ist ja nun einmal so in der Welt, dass keine Hose so zerlumpt, kein Hemd so zerschlissen, kein Stiefel so abgetreten sein kann, als dass sich nicht jemand fände, der jene Hose oder dieses Hemd noch als sehr gut bezeichnen würde; denn kein Mensch auf Erden kann so arm sein, dass nicht ein andrer sich noch ärmer glaubte.
Dobbs hatte keinen Koffer, den er zum Aufbewahren hätte geben können, nicht einmal eine Pappschachtel oder einen Papiersack. Er hätte nicht gewusst, was er hätte hineinstecken sollen; denn alles, was er besaß, trug er in seinen Hosentaschen. Eine Jacke hatte er seit Monaten nicht mehr.
Er trat in den kleinen Raum des Hausmeisters. Dieser Raum hatte zwar in der Vorderwand, die im Haupteingang lag, ein Schalterbrett, aber niemand benutzte es, nicht einmal der Hausmeister selbst. Auf diesem Schalterbrett, dicht vor dem Schiebefenster, standen eine Wasserflasche und ein kleines Krügchen aus Steingut. Das war die gemeinschaftliche Wasserflasche für alle Hotelgäste. In den Schlafräumen selbst war kein Wasser und keine Wasserflasche. Wer Durst hatte, musste hier zu dem Schalterfensterchen kommen, um zu trinken. Einige erfahrene Gäste, besonders solche, die nachts häufig Durst bekamen, nahmen eine leere Tequilaflasche, mit Wasser gefüllt, in die Schlafräume.
Der Hausmeister war noch ein ganz junger Mann, kaum fünfundzwanzig Jahre alt. Er war klein und mager und hatte eine lange, spitze Nase. Er hatte Dienst von morgens um fünf bis abends um sechs. Abends um sechs trat der Hausmeister für die Nacht seinen Dienst an. Denn das Hotel war Tag und Nacht ununterbrochen geöffnet, nicht so sehr wegen der Eisenbahnzüge, die nur dann nachts einliefen, wenn sie Verspätung hatten, als vielmehr derjenigen Arbeiter wegen, die hier im Hotel schliefen und die in Restaurants oder in andern Geschäftszweigen tätig waren, wo die Arbeitszeit sehr spät in der Nacht, manchmal erst gegen Morgen, zu Ende war.
Tag und Nacht wurde in dem Hotel geweckt, weil immer welche da waren, die zu irgendeiner Zeit aufstehen mussten, weil sie zu ihrer Arbeit zu gehen hatten. Da schliefen Privatnachtwächter, Bäcker, Asphaltierer, Straßenpflasterer, Zeitungsverkäufer, Brotausträger und Angehörige von Berufen, die sich mit einem Worte gar nicht beschreiben lassen. Viele dieser Leute hätten sich ein Privatlogis mieten können, wo sie besser geschlafen hätten und sauberer und nicht in Gemeinschaft mit Unbekannten, Fremden und Strolchen. Aber des Weckens wegen, ihres pünktlichen Arbeitsbeginns wegen, wohnten sie hier im Hotel, wo sie sich darauf verlassen konnten, dass sie genau zu der Minute geweckt wurden, die sie angaben. Beide Hausmeister waren sehr tüchtige Leute. Es kamen täglich neue Gäste und alte verschwanden. Es wechselte jeden Tag. Alle Nationalitäten waren vertreten, es kamen weiße, gelbe, schwarze, braune, rotbraune Gesichter am Schalter vorüber. Aber der Hausmeister, der Dienst hatte, wusste stets, ob der Mann bezahlt hatte oder nicht. Wenn er im Zweifel war, sah er sofort im Buch nach und verfolgte den Mann vom Fenster aus, das nach dem Hofe zu ging, in welchen Raum er lief.
Es waren einige ganz kleine Räume noch vorhanden, in denen nur ein Bett stand, ein verhältnismäßig breites und mit einer Matratze. Die Matratze war zwar sehr hart, aber die Gäste waren nicht verwöhnt. Diese Räume waren für zwei Personen bestimmt und kosteten für jede Person einen Peso. Es waren die Räume, die von denen genommen wurden, die mit einer Frau kamen. Für einzelne Frauen und Mädchen waren auch einige Baracken vorhanden mit mehreren Schlafgestellen für fünfzig Centavos. Diese Räume hatten zwei Türen, aber die Türen schlossen nicht und hingen so schief in den Angeln, dass man sie nicht einmal richtig zumachen konnte. Die Schlafgestelle der weiblichen Einzelgäste hatten aber Moskitonetze, unter denen sich die Mädchen verbergen und auskleiden konnten. Besonders die Mädchen einfacher Herkunft und die indianischen Mädchen besitzen eine erstaunliche Geschicklichkeit, sich unter diesen Netzen aus- und anzukleiden und darunter die Nacht so ungesehen zu verbringen, als wären sie innerhalb der gemauerten vier Wände eines Hauses. Meist waren es Küchenmädchen und Spülmädchen aus den Restaurants, die hier wohnten. Die Männer hatten alle viel zu viel mit ihren eigenen Angelegenheiten zu tun, als dass sie sich um die Mädchen bekümmert hätten. Und die Mädchen schliefen in diesem Hotel, wo alles so offen und unabgeschlossen war, wie es sich nicht vorstellen lässt, sicherer als an manchen andern Plätzen, die unter dem Namen ›Gutes Familienhotel‹ laufen. Die zerlumpten männlichen Schlafgäste des ›Oso Negro‹ würden den Mann totgeschlagen haben, der es gewagt haben würde, sich zu den Mädchen hineinzuschleichen und dort einen Unfug zu verüben.
Es waren Gäste in dem Hotel, die hier schon zwei, drei, ja sogar fünf Jahre wohnten. Da sie immer dasselbe Schlafgestell innehatten, dieselbe Ecke bewohnten, so wohnten sie eigentlich ebenso sauber wie in einem Privathause. Nur ihre Schlafgenossen wechselten natürlich meist jede Nacht. Aber es kam vor, dass sich genügend Dauergäste zusammenfanden, die einen ganzen Raum für sich füllten. Das Leben für die Männer war viel freier als in einem Privathause. Sie konnten kommen, wann sie wollten, ohne die Wirtin wütend zu machen, sie durften gehen, wann sie wollten, ohne dass sich jemand um sie bekümmerte, und wenn sie schwer geladen heimkamen, so kümmerte sich erst recht niemand um sie. Schränke gab es nicht in den Räumen. Die Sachen hängte man an Nägeln auf, die in die Holzwände getrieben waren. Manche Gäste, die schon länger hier wohnten und in Arbeit standen, packten ihre Sonntagssachen in eine große Holzkiste, die sie mit einem Vorhängeschloss verschließen konnten. Andre machten einen Überhang aus Sackleinen, um ihre Sachen vor Staub zu schützen. Wieder andere zogen kreuz und quer dicke Schnur über ihre aufgehängten Sachen, so fest, dass sich eine einzelne Hose nur sehr schwer hervorstehlen ließ. Es wurde selten gestohlen; denn wenn jemand etwas im Arm trug, wurde er von dem Hausmeister misstrauisch betrachtet, und wenn der Hausmeister gar die Hose kannte, dass sie einem andern gehörte, dann kam der Spitzbube schon gar nicht damit durch. Und die Hausmeister kannten die Jacken und Hosen ihrer Dauergäste recht gut. Der Hausmeister saß ziemlich eng in seinem Raum, denn der Raum war vollgepackt mit allen möglichen Gegenständen. Kleine Pakete, kleine Schachteln, ganz kleine Handtaschen und solche Sachen, die sich kaum lohnten, dass man ihretwegen den Drahtkäfig aufschloss, weil sie nur auf kurze Zeit hier abgegeben waren. Sie sollten in einer halben Stunde oder so abgeholt werden. Meist wurden sie auch in der verabredeten Zeit abgerufen, manchmal aber lagen sie auch Wochen hier und waren von dem Besitzer vergessen worden, der plötzlich abgereist war, vielleicht als Seemann bis an das entgegengesetzte Ende der Welt. Denn wenn ein Schiff gerade rausfuhr und es fehlten Leute, so wurde der mitgenommen, der am schnellsten bereit war zu gehen und alles hinter sich im Stich ließ, gerade ging, wie er dastand. Dann war in dem engen Raum noch ein hohes Regal mit Handtüchern, Seife und Seiflappen aus Bast für die Badegäste. Es gab nur Brausebäder. Jedes kostete 25 Centavos. Das Wasser war kalt und sehr knapp.
Es gab außerdem da noch ein Regal für Briefe und allerlei Papiere. Es war alles verstaubt.
Endlich stand da noch ein Geldschrank. Hier wurden die Wertsachen aufbewahrt, die von den Schlafgästen abgegeben wurden: Geld, Uhren, Ringe und Apparate, die Wert hatten. Unter solchen Apparaten waren Kompasse, Feldmessinstrumente und ähnliche Sachen, die Geologen oder Gold- und Silbersucher brauchten. Denn auch Leute, die solche Apparate hatten, kamen oft tief herunter und landeten hier als Schlafgänger. Gewehre, Revolver, Angelgeräte hingen auch herum.
Vor sich auf der kleinen Ecke des Tisches, die noch frei geblieben war von Papieren, Paketen und Schachteln, lag das dicke Fremdenbuch. Hier wurde jeder Hotelgast eingeschrieben. Nur der Familienname und die Bettnummer sowie die bezahlte Summe. Wie der Gast sonst noch hieß, welche Nationalität er besaß, welchen Beruf, welches Ziel er hatte und woher er kam, das interessierte den Hotelbesitzer gar nicht. Noch weniger interessierte sich die Polizei dafür, die sich das Buch nie ansehen kam. Das Buch interessierte bestenfalls nur noch die Steuerbehörde, wenn der Hotelbesitzer nachweisen wollte, dass man seine Einnahmen zu hoch festgesetzt hatte. Nur da, wo viel überflüssige Beamte herumlaufen und vom Staate bezahlt werden, kümmert sich die Polizei um jeden Dreck und will bis auf die Farbe des einzelnen Haares einer Warze wissen, wer der Hotelgast ist, woher er kommt, was er hier tun will und wohin er zu gehen beabsichtigt. Die Beamten wüssten ja sonst nicht, womit sie sich beschäftigen sollten, und die Steuerzahler würden bald herausfinden, dass man sie nicht nötig hat.
Dobbs kam herein zu dem Hausmeister, legte seinen Peso auf den Tisch und sagte: »Lobbs, für zwei Nächte.«
Der Hausmeister blätterte in dem Buche herum, bis er ein leeres Bett fand, schrieb ›Jobbs‹, weil er nicht richtig verstanden hatte und zu höflich war, noch einmal zu fragen, und fügte dann hinzu: »Raum sieben, Bett zwei.«
»Gut«, sagte Dobbs und ging seiner Wege. Er hätte sich gleich hinlegen dürfen, den Rest des Nachmittags, die ganze Nacht, den ganzen folgenden Tag, die darauf folgende Nacht und den ganzen nächsten Vormittag bis zwölf Uhr durchschlafen dürfen, wenn er gewollt hätte. Aber er hatte Hunger und musste auf die Jagd gehen oder auf den Fischfang.
Die Fische bissen aber nicht so leicht an. Es gab ihm niemand etwas. Dann sah er vor sich einen Herrn im weißen Anzug gehen. Er holte ihn ein, murmelte etwas, und der Herr gab ihm fünfzig Centavos.
Mit diesen fünfzig Centavos ging Dobbs erst einmal zu einem Chinesen, um zu Mittag zu essen. Mittag war zwar längst vorbei. Aber es gibt immer Mittagessen beim Chinesen, und wenn es schon zu spät ist, dass man es noch Comida corrida nennen könnte, dann nennt man dasselbe Essen eben einfach Cena, und das ist dann Abendessen, wenn es auch kaum vier Uhr von der Kathedrale geschlagen hat.
Dann ruhte sich Dobbs ein wenig auf der Bank aus, und endlich dachte er an Kaffee. Er pirschte wieder eine Weile vergebens, bis er einen Herrn im weißen Anzug sah. Und der Herr gab ihm fünfzig Centavos. Ein Silberstück.
»Ich habe Glück mit Herren im weißen Anzug heute«, sagte Dobbs und ging zu dem runden Kaffeestand an der Seite der Plaza de la Libertad, die dem Zoll- und Passagierhafen am nächsten lag.
Er setzte sich auf den hohen Barstuhl und bestellte ein Glas Kaffee mit zwei Hörnchen. Das Glas wurde zu drei Viertel mit heißer Milch gefüllt und dann schwarzer heißer Kaffee draufgegossen, bis das Glas bis an den Rand gefüllt war. Dann wurde ihm die Zuckerdose hingestellt, die zwei schönen braunen Kreuzhörnchen und ein Glas Eiswasser.
»Warum habt ihr Banditen denn den Kaffee schon wieder um fünf Centavos erhöht?«, fragte Dobbs, dabei verrührte er den Berg Zucker, den er sich in das Glas geschüttet hatte.
»Die Unkosten sind zu hoch«, sagte der Kellner, während er sich mit einem Zahnstocher im Munde herumfuhrwerkte und sich dann gelangweilt gegen die Bar lehnte. Dobbs hatte die Frage nur gestellt, um etwas zu sagen. Für ihn und seinesgleichen machte es zwar sehr viel aus, ob der Kaffee fünfzehn oder zwanzig Centavos kostete. Aber er regte sich über die Preiserhöhung nicht auf. Wenn er fünfzehn Centavos aufbringen konnte, dann konnte er auch zwanzig aufbringen, und wenn er keine zwanzig machen konnte, dann fehlten ihm auch die fünfzehn. Im Grunde genommen war es also ganz gleich.
»Ich kaufe keine Lose, verflucht noch mal, lass mich endlich zufrieden«, rief er dem Indianerjungen zu, der ihm schon seit fünf Minuten die langen dünnen Fahnen der Lotterielose vor der Nase herumschwenkte.
Aber der Junge ließ sich so leicht nicht abweisen.
»Ist die Lotterie des Staates Michoacan. Sechzigtausend Pesos der Hauptgewinn.«
»Mach endlich, dass du fortkommst, du Räuber, ich kaufe kein Los.«
Dobbs tauchte sein Hörnchen in den Kaffee und schob es in den Mund.
»Das ganze Los ist nur zehn Pesos.«
»Hundesohn, ich habe keine zehn Pesos.« Dobbs wollte einen Schluck Kaffee trinken, aber das Glas war zu heiß, er konnte es nicht anfassen.
»Dann nehmen Sie doch nur ein Viertel, das ist zwei Pesos fünfzig.«
Dobbs hatte sehr geschickt das Glas an den Mund gebracht. Aber als er jetzt gerade trinken wollte, verbrannte er sich die Lippen, sodass er das Glas rasch wieder hinsetzen musste, weil es ihm durch das lange Halten auch in den Fingern zu heiß geworden war.
»Wenn du jetzt nicht sofort machst, dass du mit deinen gestohlenen Losen zum Teufel gehst, dann gieße ich dir das Wasser ins Gesicht.«
Dobbs sagte es diesmal wütend. Nicht aus Wut über den geschäftstüchtigen Jungen als vielmehr aus Wut, dass er sich die Zungenspitze verbrüht hatte. An seiner Zunge konnte er seine Wut nicht auslassen, auch nicht an dem Kaffee, den zu vergießen er sich wohl hütete.
Darum ließ er seine Wut an dem Jungen aus.
Der Junge machte sich nicht viel daraus. Er war solche Wutausbrüche gewöhnt. Auch war er ein guter Kaufmann, der seine Leute kannte. Wer hier um diese Zeit Kaffee trinken und zwei Hörnchen dazu essen konnte, der war auch imstande, ein Lotterielos zum Besten des Staates Michoacan zu kaufen.
»Dann nehmen Sie doch nur ein Zehntel, Señor. Kostet nur einen Peso.«
Dobbs nahm das Glas mit dem Eiswasser auf und schielte dabei zu dem Jungen hin.
Der Junge sah es, ging aber nicht vom Fleck.
Dobbs trank einen Schluck von dem Wasser. Der Junge schwenkte ihm dabei seine Fahnen mit den Losen vor der Nase herum. Mit einem Schwups hatte ihm Dobbs das Wasser ins Gesicht geschüttet, und die Lose trieften vom Wasser.
Der Junge war aber nicht wütend darüber. Er lachte nur, schüttelte das Wasser aus den Losen und strich sich mit dem halben Handrücken das Wasser von seinem zerlumpten Hemd herunter. Diesen Wasserguss betrachtete er mehr als einen Ausdruck freundschaftlicher Geschäftsanbahnung denn als ein Zeichen unversöhnlicher Feindschaft. In seinem kleinen Kopf hatte sich einmal die Meinung festgesetzt, dass derjenige, der ein Glas Milchkaffee trinken und zwei Hörnchen dazu essen konnte, auch ein Los kaufen müsse, um durch einen Lotteriegewinn diese Ausgabe wieder hereinzubekommen.
Das größte Glas Kaffee geht einmal mit seinem Inhalt zu Ende. Dobbs drückte den letzten Tropfen heraus, der nur herauszuholen war, ohne das Glas zerbrechen zu müssen. Endlich war auch die letzte Krume der schönen Hörnchen aufgepickt, und Dobbs gab seinen Fünfziger hin, um zu zahlen. Er bekam zwanzig Centavos heraus, in einem kleinen Silberstück. Darauf schien der Junge gewartet zu haben.
»Kaufen Sie doch ein Zwanzigstel von der Monterreylotterie, Señor. Kostet nur zwanzig Centavos. Hauptgewinn zwanzigtausend Pesos. Da nehmen Sie das. Das ist eine gute Nummer.«
Dobbs wiegte das Silbermünzchen in der Hand. Was sollte er damit machen? Zigaretten kaufen. Er hatte gerade jetzt nach dem Kaffee keinen Geschmack auf Zigaretten. Lotterielos war weggeworfen. Immerhin, weg ist weg. Und man konnte ein paar Tage hoffen. Es dauerte ja nicht viele Monate, sondern immer nur ein paar Tage, bis die Ziehung war.
»Na, gib her dein Los, du Hundesohn. Nur damit ich dich endlich nicht mehr mit deinen Losen sehe.«
Eilfertig riss der kleine Kaufmann das Zwanzigstel von der langen Fahne herunter. Es war ganz hauchdünnes Papier. So dünn, dass der Druck auf der rückwärtigen Seite ebenso stark war wie auf der Vorderseite.
»Das ist eine sehr gute Nummer, Señor.«
»Warum spielst du sie denn da nicht selbst?«
»Ich habe nicht das Geld dazu. Da ist das Los. Vielen Dank, Señor. Beehren Sie mich beim nächsten Mal.«
Dobbs schob sein Los ein, ohne sich die Nummer anzusehen. Dann ging er baden. Das war ein weiter Weg. Raus, weit hinter dem Cementerio. Dann den Berg hinunter zum Fluss. Ehe man herankam, musste man über Kanäle und Pfützen springen und durch sumpfige Stellen waten.
Im Wasser tummelten sich schon Dutzende von Indianern sowie von Weißen, die auf der gleichen gesellschaftlichen Stufe standen wie Dobbs und von dem lebten, was andre abfallen ließen. Badehosen hatte niemand. Aber es war auch niemand da, der sich darum bekümmert hätte. Es gingen sogar Frauen und Mädchen an diesen Badestellen vorüber, die nichts Besonderes darin sahen, dass die Männer hier ganz unbekleidet badeten, und auch mit keinem Gedanken daran dachten, Ärgernis oder Anstoß daran zu nehmen. Freilich, die feinen amerikanischen oder europäischen Frauen hätten es unter ihrer Würde gefunden, hier vorbeizugehen. Die standen oben auf der Höhe, auf den Balkonen und in den Fenstern ihrer Häuser mit guten Prismengläsern und sahen den Badenden zu. Die Damen, die nicht hier wohnten, sondern auf der anderen Seite der Avenida Hidalgo, in der Colonia Guadalupe und in den andern Kolonien, die ließen sich von Damen, die hier wohnten, zum Tee einladen. Jede Dame brachte ihr Prismenglas mit, um – um sich die weite Landschaft von der Höhe aus zu betrachten. Denn die Aussicht war sehenswert. Darum hieß die Kolonie hier auch Colonia Buena Vista.
Das Baden war erfrischend, und Dobbs sparte fünfundzwanzig Centavos, die er für das Brausebad im Hotel hätte bezahlen müssen. Aber das Baden hatte auch wieder seine Schattenseiten. Da waren die Riesentaschenkrebse, die im Schlamm saßen. Und diese Krebse dachten zuweilen, die Zehen der Badenden seien gutes Fleisch, das man nicht verachten dürfe. Es zwickte ganz verteufelt, wenn so ein guter alter ausgewachsener Krebs ordentlich zupackte und mit der Zehe abrücken wollte.
Der Fluss teilte sich hier in viele Arme. An einzelnen Ufern saßen die Krebsfischer. Es war ein mühseliges Geschäft, und es konnte nur ausgeführt werden von jemand, der unerhört viel Geduld hatte.
Die Krebsfischer waren meist Indianer oder sehr armes Halbblut. Der Köder war altes stinkiges Fleisch. Je mehr es stank, desto besser war es. Ein großer Brocken des Fleisches wurde auf einen Angelhaken gespießt, der an einer sehr langen Schnur befestigt war. Dann wurde der Brocken sehr weit in den Flussarm hinausgeworfen.
Hier blieb er eine gute Weile liegen. Nun begann der Fischer die Schnur ganz, ganz langsam einzuziehen, so langsam, dass man es kaum sah. Es dauerte eine Ewigkeit, bis der Haken mit dem Brocken wieder am Ufer war. Dann wurde die Schnur weiter langsam herausgezogen auf das flach ansteigende schlammige Ufer. Sechs- bis zehnmal war es vergebens. Der Haken musste wieder hinausgeworfen werden, oft mit einem neuen Brocken, weil der alte abgefressen war, dann wieder mit unendlicher Geduld langsam herangeholt werden.
Die Krebse packten mit der Schere den Brocken Fleisch fest, und sie hielten so krampfhaft den Brocken fest, dass sie sich damit herausziehen ließen, weil sie den Brocken nicht mehr hergeben wollten. Wurde zu rasch gezogen, dann konnte der Krebs so schnell nicht mit, oder es kam ihm verdächtig vor, und er ließ los. Oft packte er auch den Brocken so kräftig, dass er ihn vom Haken abkniff, und dann hatte der Krebs gewonnen.
Geduldige Fischer machten ein gutes Tagesgeschäft, denn manche der Krebse wogen ein halbes oder gar dreiviertel Kilo, und die Restaurants zahlten gute Preise, weil das Fleisch von Liebhabern sehr begehrt ist.
Als Dobbs den Fischern so zusah, fand er, dass es kein Geschäft für ihn sei. Er hätte die nötige Geduld nicht gehabt. Ein kleiner, unbedachter hastiger Ruck ließ die Beute gehen. Dieses Fischen erforderte eine Ruhe der Nerven, die Dobbs, der im Tumult einer amerikanischen Großstadt aufgewachsen war, nicht hätte aufbringen können, selbst wenn er für jeden Krebs fünf Pesos bekommen hätte.
Er torkelte wieder zurück zur Stadt. Das Baden und die Wanderung hatten ihn hungrig gemacht, und er musste zusehen, wie er zu seinem Abendessen kam. Wieder war es eine Zeit lang vergebens, und er musste manche peinliche Bemerkung einstecken und runterschlucken. Aber man wird abgebrüht, wenn man Hunger hat und wenn man keinen andern Weg sieht, um zu einem Abendessen zu kommen.
Endlich sah er einen Herrn in einem weißen Anzug. Er dachte, mit Herren im weißen Anzug habe ich heute Glück, wir werden es wieder einmal versuchen. Und er hatte richtig geraten. Es waren fünfzig Centavos, die für das Abendessen reichten.
Nach dem Abendessen und nach einer angemessenen Ruhe auf einer Bank dachte er, es wäre doch recht gut, wenn ich etwas Kleingeld in der Tasche hätte, weil man ja nie weiß, was vorkommen kann. An dieses Kleingeld dachte er nicht aus sich selbst heraus, sondern der Gedanke kam ihm, als er einen Herrn in einem weißen Anzug drüben auf der andern Seite der Plaza vorübergehen sah. Er ging gleich auf ihn los.
Der Herr griff auch richtig in die Tasche und brachte einen Fünfziger hervor. Dobbs wollte zulangen, aber der Herr hielt seinen Fünfziger fest. Dann sagte er ganz trocken: »Hören Sie mal, mein Junge, eine so unerhörte Frechheit ist mir doch noch nie in meinem Leben vorgekommen, und wenn mir das jemand erzählen würde, so würde ich es nicht glauben.«
Dobbs stand ganz verdattert da. So etwas war ihm auch noch nicht vorgekommen, dass jemand eine so lange Ansprache an ihn hielt. Er wusste nicht recht, ob er stehen bleiben oder fortlaufen sollte. Aber da er den Fünfziger immer noch in der Hand des Herrn sah, hatte er das Gefühl, dass dieser Fünfziger früher oder später doch für ihn bestimmt sei und dass der Herr eben nur das Vergnügen haben wolle, eine Predigt dabei anzubringen. Die Predigt kann ich mir für den Fünfziger ja ruhig mit anhören, ich habe ja weiter nichts zu tun, sagte sich Dobbs. Und so blieb er ruhig stehen.
»Heute Nachmittag erzählten Sie mir«, fuhr der Herr jetzt fort, »Sie hätten noch nicht gegessen. Daraufhin gab ich Ihnen einen Peso. Dann traf ich Sie wieder, und Sie sagten, Sie hätten kein Schlafgeld, daraufhin gab ich Ihnen fünfzig Centavos. Wieder später kamen Sie und sagten, Sie hätten noch nicht zu Abend gegessen, und ich gab Ihnen abermals einen Fünfziger. Nun sagen Sie mir das eine, wozu wollen Sie denn jetzt noch Geld?«
»Für morgen früh zum Frühstück«, sagte Dobbs geistesgegenwärtig. Der Herr lachte, gab ihm den Fünfziger und sagte: »Das ist das letzte Mal, dass ich Ihnen etwas gebe. Nun gehen Sie auch einmal zu einem andern und nicht gerade immer zu mir. Es fängt an, mir langweilig zu werden.«
»Entschuldigen Sie nur«, sagte Dobbs, »ich habe nicht gewusst, dass Sie immer derselbe sind. Ihr Gesicht habe ich mir nie angesehen, das sehe ich jetzt zum ersten Male. Aber ich werde nun nicht wiederkommen.«
»Damit Sie auch Ihr Wort bestimmt halten und mich nicht mehr belästigen, will ich Ihnen noch einen Fünfziger geben, damit Sie auch noch morgen das Mittagessen haben. Aber von dann an wollen Sie gefälligst für Ihren Lebensunterhalt ohne meine Mitwirkung sorgen.«
»Dann wäre diese Quelle ja auch erschöpft«, sagte Dobbs zu sich. Und er kam zu der Erkenntnis, dass es besser sei, einmal über Land zu gehen und zu sehen, wie es da ausschaut.
2
Es traf sich so, dass Dobbs in seinem Schlafraum einen Mann fand, der einem andern Schlafkameraden erzählte, dass er nach Tuxpam gehen wolle, aber keinen Weggenossen hätte. Kaum hatte Dobbs das gehört, als er auch gleich sagte: »Mensch, ich gehe mit nach Tuxpam.«
»Sind Sie Driller?«, fragte der Mann vom Bett aus. »Nein, Pumpmann.« – »Gut«, sagte der Mann darauf, »warum nicht, wir können ganz gut zusammen gehen.«
Am nächsten Morgen machten sich die beiden auf, die zahlreichen Ölfelder auf der Strecke nach Tuxpam nach Arbeit abzusuchen. Sie frühstückten erst ihr Glas Kaffee und ihre beiden Brötchen in einem Kaffeestand, und dann zogen sie beide ab.
So direkt kann man ja nun nicht nach Tuxpam gehen. Da gibt es keine Bahn. Nur Flugzeuge. Und da kostet eine Fahrt fünfzig Pesos. Aber da fahren viele Lastautos hinunter zu den Feldern. Das eine oder andre nimmt einen vielleicht mit. Den ganzen Weg zu laufen, ist nicht so einfach. Es sind mehr als hundert Meilen, und immer in glühender Tropensonne und wenig Schatten.
»Das ist das allerwenigste«, sagte Barber, »wenn wir nur erst rüber sind über den Fluss.«
Das Übersetzen über den Fluss kostete fünfundzwanzig Centavos, und diese fünfundzwanzig Centavos wollten sie nicht ausgeben. »Ja, da bleibt uns nichts weiter übrig«, sagte Barber, »da müssen wir auf die Huasteca-Frachtfähren warten. Die nehmen uns umsonst mit hinüber. Das kann aber bis um elf Uhr dauern, ehe wieder eine kommt, die fahren ja nicht nach der Zeit, sondern nach der Fracht, die sie haben.«
»Dann setzen wir uns nur hier in Geduld auf die Mauer«, erwiderte Dobbs. Er hatte sich von dem Überschuss des Frühstücksgeldes ein Päckchen mit vierzehn Zigaretten gekauft für zehn Centavos. Er hatte Glück. In dem Päckchen war ein Bon für fünfzig Centavos, den er gleich beim Zigarettenhändler gegen Bargeld eintauschte. Nun besaß er die große Summe von einem Peso und zehn Centavos in barer Münze.
Barber hatte auch etwa einen Peso und fünfzig Centavos als Reisekapital. Sie hätten das Fährgeld ja bezahlen können; aber da sie reichlich Zeit hatten und nichts versäumten, so konnten sie auch ganz gut auf die Frachtfähre warten und das Geld sparen.
Hier an der Fähre war ein reger Verkehr. Dutzende von großen und kleinen Motorbooten warteten auf Fahrgäste. Spezialboote, die über der Taxe fuhren, brachten die Kapitäne und die Manager der Ölkompanien hinüber, die es zu eilig hatten, um auf die Taxenboote zu warten, die immer erst ihre vier oder sechs Fahrgäste voll haben wollten, ehe sie losratterten. Und da hier immer Aufenthalt war und besonders die Arbeiter, die drüben arbeiteten und hier wohnten, in den Morgen- und in den Nachmittagsstunden hier zu Hunderten und oft zu Tausenden schwärmten, ging es an der Fähre zu wie auf einem Jahrmarkt. Da waren Tische, wo es Mittagessen gab, oder Kaffee oder geröstete Bananen oder Früchte oder Enchiladas oder heiße Tamales oder Zigaretten oder Süßigkeiten. Alles lebte von der Fähre und durch die Fähre. Autos und Straßenbahnen brachten die Fahrgäste aus dem Stadtinnern in ununterbrochener Folge. Das ging den ganzen Tag und die ganze Nacht ohne Aufhören. Drüben waren die Hände, hier auf dieser Seite, in der Stadt, war das Hirn, waren die Zentralbüros, die Banken. Drüben auf der andern Seite des Flusses war die Arbeit, hier war die Erholung, die Rast, das Vergnügen. Drüben war der Reichtum, das Gold des Landes, das Öl. Drüben war es wertlos. Hier erst, auf dieser Seite, in der Stadt, in den steilen Bürohäusern, in den Banken, in den Konferenzräumen, in der All America Cable Service bekam das Öl, das drüben völlig wertlos war, seinen Wert. Denn Öl wie Gold sind wertlos an sich, ihr Wert wird erst durch viele andre Handlungen und Vorgänge bestimmt.
An dieser Fähre wanderten Milliarden an Dollars vorüber. Nicht in Banknoten, nicht in gemünztem Golde, ja nicht einmal in Schecks. Diese Milliarden wanderten hier vorüber in kurzen Notizen, die jene Leute, die meist, aber nicht immer in Spezialbooten außer Taxe fuhren, in ihren kleinen Taschenbüchern, manchmal nur auf einem Stückchen Papier trugen. Reichtümer und Werte in unserm Jahrhundert lassen sich in Notizen ausdrücken und in Notizen herumtragen.
Um halb elf kam dann endlich die Frachtfähre, angefüllt mit Fässern, Kisten und Säcken. Dutzende von indianischen Männern und Frauen kamen herüber, schwer bepackt mit Körben, in denen sie Feldfrüchte zur Stadt brachten oder Matten, Taschen aus Bast, Hühner, Fische, Eier, Käse, Blumen oder kleine Ziegen.
Barber und Dobbs stiegen ein, aber es dauerte doch noch eine Stunde, ehe die Fähre wieder hinüberfuhr. Die Fahrt war lang, ging den Fluss weit hinunter, ehe die Anlegestelle erreicht wurde. Weit den Fluss hinauf lag ein Tankschiff neben dem andern, um das Öl aufzunehmen und über den Ozean zu tragen.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses war der Verkehr ebenso rege, und es war ein ebensolcher Jahrmarktsverkehr wie auf der Stadtseite. Nicht nur den Fluss hinauf, sondern noch viel weiter den Fluss hinunter, bald bis zur Mündung, lagen die großen Tankschiffe.
Weiter zurück vom Ufer, auf den Höhen, lagen die Riesentanks, vollgefüllt mit dem wertvollen Öl. Zahlreiche Rohre führten das Öl aus den Tanks hinunter zum Flussufer. Hier wurde es durch Metalldrahtschläuche in die gewaltigen Tanks der Schiffe gepumpt. Wenn das Öl einkam oder das Schiff vollgefüllt war, hisste es die rote Gefahrenflagge. Denn das Rohöl gaste, und eine unvorsichtige Behandlung mit offenem Feuer konnte das Schiff ausbrennen bis auf das Wasser.
Scharen von Händlern mit Früchten, Papageien, Tigerkatzen, Tiger- und Löwenfellen, Affen, Büffelhörnern, mit kleinen Palästen und Kathedralen, aus Muscheln kunstvoll gebaut, trieben sich hier herum und boten den Seeleuten ihre Waren an. Wenn sie kein Geld kriegen konnten, nahmen sie auch andre Dinge, Anzüge, Regenmäntel, Lederkoffer oder was sie sonst an wertvollen Sachen eintauschen konnten.
Die Raffinerien bliesen Wolken von Rauch und Gas aus. Das abgeblasene Gas setzte sich in den Lungen und Luftröhren fest, wo es wie dünne Nadeln stach. Dann hüstelten die Leute, und wenn der Wind diese Gase hinübertrieb in die große Stadt, dann fühlte sich die ganze Bevölkerung wie in einem Giftofen. Die Ungewohnten, die Neuankömmlinge, bekamen ein unsicheres, ängstliches Gefühl. Sie fassten sich immerwährend an die Kehle oder versuchten zu niesen oder zu schnauben und wussten meist nicht, was los war. Viele der Neuen hatten ein Empfinden, als müssten sie sterben, so giftig war das stechende Gefühl in der Kehle und in der Lunge.
Aber die Altgewohnten nahmen es leicht. Solange dieses stechende giftige Gas durch die Stadt schwelte, rann das Gold durch die Gassen, und das Leben sah rosig aus, von welcher Seite aus man es auch betrachtete.
Hier waren die Saloons, einer neben dem andern. Alle lebten sie von den Seeleuten. Die besten Kunden waren die amerikanischen Seeleute. Denn die bekamen in ihrer Heimat weder Bier noch Wein noch Branntwein. Die holten hier alles nach, was sie daheim versäumten, und tranken so viel Vorrat, dass sie es gut eine Weile in ihrem trocknen, stumpfen Lande wieder aushalten konnten. Sie waren an hohe Preise für geschmuggelten Branntwein gewöhnt. Und hier, wo die Preise normal waren, erschien es ihnen, als ob der Whisky und das Bier überhaupt nichts kosteten, als ob sie alles geschenkt erhielten. So wanderte ein Dollar nach dem andern in die Cantinas und in die Bars. Und wenige Häuser weiter waren die schönen Damen, die ihnen den Rest des Geldes abnahmen. Aber die Seeleute fühlten sich nie übervorteilt. Sie waren glücklich, und sie würden den, der ihnen durch Verbote und Gesetze das Trinken und die schönen Damen genommen hätte, mit tausend Flüchen belastet haben. Sie brauchten keinen Vormund. Und die Seemannsmission, die sich nur darum bekümmert, dass die Seeleute ein sauberes Bett bekommen und einen trocknen warmen Raum, wo sie Zeitungen lesen können, wird von den Seeleuten am höchsten geachtet. Wer Sehnsucht hat, in die Kirche zu gehen, findet immer eine Kirche; man braucht sie dem Seemann nicht an den Mittagstisch oder in den Schlafsaal zu tragen und das wenige an Religion, was ihm die Schule gelassen hat, hier auch noch zu verekeln. Seeleute und Gefängnisgäste sind die beiden Volksklassen, die man als die wehrloseste Beute ansieht, die man mit Religion bis zum Überdruss des Erbrechens vollpacken darf. Aber Überfütterung hat noch nie gutgetan. Und weil sie nie guttut und das Gegenteil erzeugt von dem, was beabsichtigt ist, wird dem Verbrecher und wird dem Seemann immer noch mehr Religion aufgepackt.
Der Verbrecher im Gefängnis und der Seemann an Land, nachdem er sein ganzes Geld ausgegeben hat, bilden die beste Betgemeinde. Sie würden beide eine kräftige Kinovorführung vorziehen, aber die können sie nicht umsonst haben.
Barber sagte: »Es ist gerade Mittag, wir könnten eigentlich zu einem Tanker raufklettern. Vielleicht fällt ein Mittagessen ab.«
»Das ist nicht so übel«, erwiderte Dobbs. »Wir können nur wieder runtergepfeffert werden, das ist alles.«
Sie sahen zwei Männer mit nackten Armen bei einem Fruchthändler stehen. Barber ging gleich drauflos und sagte: »Von welchem seid ihr denn?«
»Von der Norman Bridge. Warum?«
»Habt ihr schon gegessen?«, fragte Barber.
»Nein, wir sind gerade auf dem Wege dazu.«
»Wie ist es denn mit einem Mittagessen für uns beide?«, fragte Barber.
»Kommt nur gleich mit rauf. Die sind alle rübergegangen in die Stadt. Masse übrig.«
Als Dobbs und Barber eine Stunde später das Schiff verließen, konnten sie kaum gehen, so voll hatten sie sich gegessen. Sie setzten sich an eine Wand, um erst eine Weile zu verdauen. Aber dann wurden sie unruhig, weil sie ja noch weiterwollten und für die Nacht ein Unterkommen haben mussten.
»Wir können auf zwei Wegen gehen«, sagte Barber. »Wir können hier auf dem Hauptweg gehen, immer in der Nähe der Lagune bleibend. Aber ich denke, der Weg ist nicht gut. Der wird von allen abgelaufen. Da gibt es nichts in den Camps, die sind alle überlaufen von den Strolchen. Arbeit gibt es hier auch nicht, weil da genug Leute kommen.«
»Dann brauchten wir doch überhaupt gar nicht erst rüber, wenn das aussichtslos ist«, sagte Dobbs unwillig.
»Aussichtslos? Das habe ich nicht gesagt«, verteidigte sich Barber. »Nur hier auf diesem Hauptverkehrswege, da ist nicht viel los, weil zu viele da laufen. Ich denke, wir gehen besser auf dem inneren Wege. Da treffen wir mehr Felder, die ganz unbekannt sind, die mehr abseits der großen Wege liegen. Da stoßen wir auch auf Camps, die gerade anfangen zu bauen. Da gibt es immer etwas zu tun. Wir gehen jetzt mal hier den Fluss rauf und gehen dann links ab, und in einer halben Stunde sind wir schon in Villa Cuauhtemoc.«
»Dann los, wenn Sie glauben, dass jener Weg besser ist«, sagte Dobbs.
Der ganze Weg war Öl und nichts als Öl. Links auf den Höhen standen die Tanks wie Soldaten aufmarschiert. Rechts war der Fluss. Bald hörten die Schiffe auf, und das Flussufer wurde frei. Aber das Wasser war dick mit Öl überzogen, die Ufer waren dick mit Öl bedeckt, und alle Gegenstände, die der Fluss oder die einkommende Flut auf die Ufer geworfen hatte, waren mit zähem schwarzem Öl überzogen. Der Weg, auf dem die beiden gingen, war an vielen Stellen sumpfig von dickem Öl, das aus geborstenen Röhren quoll oder aus der Erde sickerte, Öl und nichts als Öl, wohin auch immer man sah. Selbst der Himmel war mit Öl bedeckt. Dicke schwarze Wolken, die von den Raffinerien herüberwehten, trugen Ölgase mit sich davon.
Es kamen dann Anhöhen, die freundlicher aussahen. Dort waren die hölzernen Wohnhäuser der Ingenieure und der Bürobeamten. Sie wohnten hier schön und luftig, und was sie am Stadtleben einbüßten, das mussten sie hier durch Grammofone und Radioapparate ersetzen. Denn abends aus der Stadt hierher zurückzukommen, war ziemlich umständlich und auch nicht sicher. Es trieb sich genug Gesindel herum, das auf leichte Gelegenheiten wartete und das Leben eines andern nicht hoch einschätzte.
Villa Cuauthemoc ist die eigentliche alte Stadt, eine uralte Indianerstadt, die schon hier war, ehe die Spanier kamen. Sie liegt gesünder als die neue Stadt, und sie liegt am Ufer eines großen Sees, der Fische, Enten und Gänse in unübersehbarer Menge spendet. Das natürliche Trinkwasser in der alten Stadt ist besser als das in der neuen Stadt. Aber die neue Stadt wusste die alte weit und schnell zu überholen. Denn die neue Stadt liegt dicht am Ozean und an einem Flusse, auf dem die größten Ozeanriesen bis zum Hauptbahnhof fahren können und hier so sicher gegen die wildesten Orkane ruhen, als ob sie in einer Badewanne lägen. Von der alten Stadt wird in der neuen kaum noch gesprochen. Tausende, Zehntausende von Bewohnern der neuen Stadt wissen gar nichts davon, dass auf der anderen Seite des Flusses und eine halbe Stunde weiter ins Land hinein die eigentliche ursprüngliche Stadt liegt. Aber diese beiden Städte, Mutter und Tochter, entfernen sich immer mehr. Die neue Stadt, gerade hundert Jahre alt, die zweihunderttausend Einwohner hat, mit ständiger Wohnungsnot, liegt im Staate Tamaulipas, während die alte Stadt im Staate Vera Cruz liegt. Die alte Stadt wird immer bäuerlicher, die neue Stadt wird immer mehr und mehr Weltstadt, die ihren Namen in die fernsten Winkel der Erde sendet.
Kaum hatten die beiden Wanderer, die nun sehr eilig waren, um voranzukommen, am Ende der Stadt, gegenüber der Lagune, den Höhenweg erreicht, als sie einen Indianer am Wege hocken sahen. Der Indianer hatte gute Hosen an, ein sauberes blaues Hemd, einen hohen spitzen Strohhut und Sandalen. Eine große Basttasche, gefüllt mit einigen Habseligkeiten, lag vor ihm auf dem Boden.
Sie beachteten den Mann nicht und gingen rasch weiter. Nach einer Weile drehte sich Dobbs um und sagte: »Sie, was will denn der Indianer, der kommt immer hinter uns her?«
Barber wandte sich um und sagte: »Es scheint so. Jetzt bleibt er stehen und tut, als ob er etwas da im Busch sucht.«
Zu beiden Seiten war der dicke undurchdringliche Busch. Sie gingen weiter, aber als sie sich umdrehten, sahen sie, dass der Indianer ihnen folgte. Er schien sogar rascher zu gehen, um näher heranzukommen.
Barber fragte: »Hatte der Bursche einen Revolver?«
»Ich habe keinen gesehen«, meinte Dobbs.
»Ich auch nicht. Ich fragte Sie nur, um zu erfahren, ob Sie vielleicht etwas gesehen haben. Scheint also kein Bandit zu sein.«
»So sicher ist das nicht«, sagte Dobbs nach einer Weile, nachdem er sich wieder umgedreht hatte und den Indianer folgen sah. »Er kann ja ein Spion der Banditen sein, der uns im Auge zu behalten hat. Wenn wir dann Lager machen, überfällt er uns, oder seine Spießgesellen kommen.«
»Unangenehm«, erwiderte Barber. »Am besten wäre es, wenn wir umkehrten. Man weiß nicht, was diese Burschen im Sinne haben.«
»Was will man uns denn nehmen?« Dobbs suchte nach Sicherheiten.
»Nehmen?«, wiederholte Barber. »Aber wir tragen doch kein Schild an uns, dass wir nur jeder etwa einen Peso haben. Und wenn wir ein solches Schild trügen, würden sie es nicht glauben, sondern uns erst recht überfallen, weil sie denken, wir haben eine Menge Geld. Zwei Pesos sind für diese Leute überhaupt eine Masse Geld. Wir haben ja auch Schuhe, Hosen und jeder ein Hemd und einen Hut. Das alles sind Wertsachen.«
Sie gingen aber weiter. Immer, wenn sie sich umdrehten, sahen sie, dass der Indianer hinter ihnen war, jetzt kaum noch fünfzehn Schritte entfernt. Wenn sie stehen blieben, blieb der Indianer auch stehen. Sie fingen an, nervös zu werden. Der Schweiß brach ihnen aus. Dobbs atmete schwer. Endlich sagte er: »Wenn ich jetzt einen Revolver hätte oder ein Gewehr, ich würde den Burschen ohne Weiteres erschießen, dann hätte man Ruhe. Das halte ich nicht mehr aus. Wie wäre es, Barber, wenn wir ihn fangen und irgendwo festbinden an einen Baum oder ihm eins über den Kopf hauen, dass er nicht mehr hinter uns herlaufen kann?«