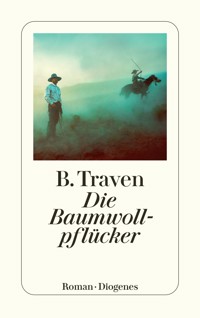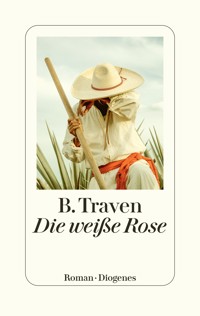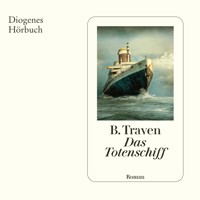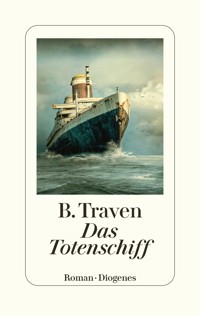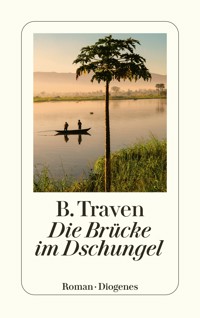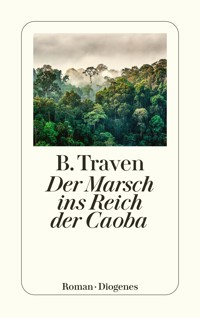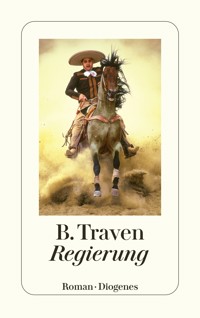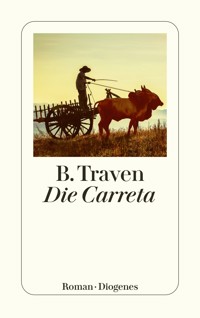
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit elf Jahren wird der Indianerjunge Andres von dem Landgut fortgeschickt, auf dem sein Vater als Knecht arbeitet. Im südmexikanischen Ort Joveltó lernt ihn der Kaufmann Don Leonardo in seinem Laden an. Bis Don Leonardo eines Tages sein gesamtes Geld – einschließlich seines nun 15-jährigen Burschen Andres– an seinen Mitspieler verliert. Andres’ neuer Herr, der Handelsagent Don Laureano, schickt ihn als Fuhrknecht in die Lehre, damit er seine Waren transportieren kann. Doch die damit scheinbar erworbene Freiheit ist trügerisch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
B. Traven
Die Carreta
Roman
Diogenes
Hinweis des Verlags
Der 1883 geborene B. Traven verfasste sein Werk in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, und seine Sprache und Begrifflichkeit sind aus diesem historischen Kontext heraus zu verstehen. Dieser Autor, der wie kein anderer mit den Indigenen lebte und ihre Unterdrückung, Ausbeutung und Versklavung beschrieb, verwendet die damals üblichen Beschreibungen, und würde man hier nach heutigen Kriterien in die Wortwahl eingreifen, würde man auch der beschriebenen Unterdrückung die Spitze nehmen beziehungsweise sie nicht mehr nachvollziehbar machen.
Der Verlag vertraut auf das Vermögen der Leserinnen und Leser, diese heute umstrittenen Bezeichnungen und Zuschreibungen als Ausdruck der sprachlichen Gepflogenheiten einer historischen Epoche zu erkennen beziehungsweise als Figurenrede einzuordnen, die nicht mit der Haltung des Autors verwechselt werden darf.
ERSTES KAPITEL
1
Andres Ugaldo war reinen indianischen Blutes. Zugehörig der großen Nation der Tseltales.
Er stammte von Lumbojvil, einer Finca im Distrikt von Tsimajovel. Der volle Name jener Finca war Santa Maria Dolorosa Lumbojvil.
Lumbojvil war der uralte indianische Name einer indianischen Kommune oder Wirtschaftsgemeinschaft, und er bedeutete soviel wie kultiviertes Land.
Nach der Eroberung durch die Spanier wurde diese Kommune den Indianern weggenommen, und das Land wurde von dem Generalgouverneur, der hier zu befehlen hatte, einem spanischen Landsknecht verkauft oder geschenkt, der die Kommune zu einer Finca, einer Domäne, umformte. Die ursprünglichen Besitzer, die Indianer, blieben in ihrem Dorf, das inmitten ihres Gemeindelandes lag, wohnen, weil sie nirgend anderswo hätten hingehen können. Teils blieben sie hier aus sentimentaler Anhänglichkeit an die Erde, auf der sie geboren waren, und teils aus der sich rasch verbreitenden Kenntnis, daß, wohin sie auch immer gehen würden, sie ein genau gleiches Schicksal erwartete. Sie waren nun nicht länger mehr unabhängige Bauern auf ihrer eigenen Erde, sondern der Finquero, der neue Herr ihres Landes, wies ihnen nach seinem Ermessen und Gutdünken Äcker zu, auf denen sie die Früchte anbauten, die sie für ihren Lebensunterhalt und den ihrer Familien gebrauchten. Dies war der Lohn für die Arbeit, die sie dem neuen Herrn zu leisten hatten, dessen Leibeigene sie wurden.
Die Spanier, wenn sie ein solches Kommuneland erwarben, ließen den alten indianischen Namen bestehen, weil das die einzige Möglichkeit war, daß sich die indianische Bevölkerung, die durch Jahrhunderte an den Namen gewöhnt war, auskennen konnte und wußte, wo sie hingehörte. Aber die Spanier, um des Schutzes ihrer eigenen Gottheiten in dem neuerworbenen Lande sicher zu sein, setzten dem indianischen Namen einen guten frommen Namen vor. In diesem Falle: Heilige Schmerzensreiche Maria.
Im Laufe der Zeit war die Finca durch Erbschaften und Verkäufe in zahlreiche Hände übergegangen. Was aber bei diesen Käufen und Verkäufen nie wechselte, war das Land selbst und seine Urbewohner. Auf der Finca wohnten heute noch dieselben Familien, die dort gewohnt hatten, ehe die Spanier kamen. Sie blieben ihrem Lande und ihrer Erde treu, ruhig und geduldig auf den Tag wartend, der es ihnen wieder zum Eigentum geben würde.
Der jetzige Besitzer war Don Arnulfo Partida, ein Mexikaner spanischer Herkunft. Auf seine spanische Herkunft war er sehr stolz, obgleich er wohl schon mehr mexikanisches und indianisches Blut in sich trug als spanisches.
2
Es war eine Seltenheit, daß ein Angehöriger der Peones einer Finca von der Finca fortkam. Der Väter Peon, der Sohn Peon und die Tochter Frau eines Peons. Das war so gut wie Gesetz. Und wenn ein Peon davonlief, um sein eigenes Leben zu führen, so bezahlte der Finquero fünf Pesos dem Präsidenten der Municipalidad seines Distriktes, und der Präsident ließ den entlaufenen Peon durch die Polizei einfangen und auf die Finca zurückbringen, wo der Peon die fünf Pesos abverdienen mußte, nachdem er seine besondere Strafe für sein Entlaufen erlitten hatte. Aber die innigen Bande, die einen Indianer mit seiner Familie und mit seinen Blutsgenossen und Freunden verknüpfen, ließen sehr selten in einem Peon den Gedanken aufkommen, von der Finca, zu der er gehörte, fortzulaufen.
Andres Ugaldo war von der Finca fortgekommen, ohne fortlaufen zu müssen. Ob von seiner angestammten Finca, auch wenn sie eine gewisse Leibeigenschaft bedeutet, fortzukommen, immerein Glück für den Peon ist, kann nicht gesagt werden. Es ist ebensooft zu seinem persönlichen Schaden, wie es häufig zu seinem Vorteil sein mag. Das vorher zu wissen oder gar sein Leben geschickt und erfolgreich einer neuen Umgebung anzupassen, dazu fehlt dem Peon die Intelligenz, die zu entwickeln der Finquero ängstlich vermeidet. Und wenn diese Entwicklung der Intelligenz des Peons gar von Staats wegen geschieht, dann wird der Finquero unangenehm, und er wird höchst unbequem für den Staat. Er wird Monarchist oder Bolschewik, oder Rebellenführer ganz gleich was, wenn er nur diese gefährliche Staatsfürsorge für seine Peones dadurch verhindern kann.
3
Eine Tochter des Don Arnulfo hatte sich nach Joveltó verheiratet. Joveltó ist ein schönes reinliches Städtchen, mit zur Hälfte mexikanischer Bevölkerung, sogenannten Ladinos, und zur anderen Hälfte mit rein indianischer Bevölkerung. Die Indianer wohnen für sich in ihrem Stadtviertel, und die Ladinos wohnen für sich in einem andern Stadtviertel. Aber auf dem Markte und in allen Geschäften mischen sich Indianer und Mexikaner, wie auch sonst sich die Bevölkerung einer Stadt überall auf Erden mischt. Die Mexikaner haben ihren eigenen Bürgermeister, und die Indianer haben ihren eigenen Chef oder Jefe oder Häuptling oder Cacique, oder wie sie es nennen mögen.
Doña Emilia konnte in ihrem neuen Wohnort nicht die rechten Mädchen finden, oder sie konnte sich an die indianischen Mädchen von Joveltó nicht gewöhnen, oder sie wollte vertraute Gesichter um sich haben oder was auch immer der Grund sein mochte, jedenfalls schickte sie einen indianischen Burschen mit einem Briefe an ihren Vater ab. Sie bat ihren Vater, ihr zwei Mädchen von der heimatlichen Ranch zu schicken, und sie nannte auch gleich die Namen der Mädchen, die sie wünschte, Ofelia und Paulina. Beide Mädchen hatten daheim schon im Hause des Vaters gedient, und Doña Emilia hatte sie in der Küche und in den Wohnräumen lange um sich gehabt. Um gleich alles in einem Streich zu tun, erbat sie von ihrem Vater, daß er ihr auch noch einen Jungen schicken möge, der anstellig sei und den ihr junger Ehemann in seinem Geschäft notwendig gebrauche.
Don Arnulfo konnte seiner Tochter nichts abschlagen, um so weniger, als sie mit umschriebenen Worten andeutete, daß sie ihn, innerhalb der vorgeschriebenen Frist, zum Großvater machen werde, welche Tatsache ihr vergangene Woche bewußt geworden sei. Der Vater beeilte sich daraufhin, die beiden gewünschten Mädchen zu schicken, und er bestimmte auch gleich den Jungen, der mitzugehen hatte.
Dieser Junge war Andres. Eines der beiden Mädchen, die Ofelia, war seine Tante. Und weil er mit seiner Tante gehen konnte, so fiel es ihm weniger schwer, von seinem väterlichen Jacalito, der Lehmhütte, in der er geboren war, fortzugehen.
Es war das erstemal in seinem jungen Leben, daß er von Hause ging. Die Mutter weinte, als sie ihm seinen Posol zurechtknetete. Aber sein Vater war stoisch und ließ von seinem wahren Gefühl nichts merken. Der Junge jedoch empfand in seinem männlichen Instinkt die tiefe Liebe und den Schmerz der Trennung, die seinen Vater durchschüttelten, obgleich der Vater auch nicht durch die geringste Bewegung in seinen Gesichtszügen verriet, was es für ihn bedeutete, sich von seinem Jungen zu trennen. Es war ein schwaches Blinken in den schwarzbraunen Augen des Vaters, ein merkwürdiges Funkeln, wie es der Junge vorher nie bei seinem Vater gesehen hatte. Aber es offenbarte ihm eine so tiefe Liebe, wie er niemals geglaubt hätte, daß sein Vater einer solchen Liebe ihm gegenüber fähig gewesen wäre. Denn Criserio war ein schlichter Mann, der nicht mehr von der Welt und dem Leben wußte, als was sein Stückchen Maisfeld, seine Milpa, sein Bohnenfeld, seine paar Schafe, die Felder und die Viehherden seines Patrons ihn lehrten und lehren konnten. Er konnte seinen Empfindungen weder in Worten noch in Gesten Ausdruck geben. Es kam ihm auch gar nicht der Gedanke, ihnen Ausdruck zu geben.
Dieses Blinken in den Augen seines Vaters beim Abschied von der Heimat war es, was das fernere Leben des Jungen bestimmen sollte. Es war der Wendepunkt in der Forderung seines Charakters und der Anfang im Aufbau seines Schicksals.
Andres war damals elf Jahre alt.
4
Die beiden Mädchen wurden auf Pferde gesetzt, ihre paar Lümpchen und ihre Schlafdecken wurden in Schilfmatten gepackt und auf ein Mule geladen.
Andres und der Bursche, der zur Begleitung mitgeschickt wurde, um die Tiere wieder zurückzubringen, gingen zu Fuß.
Es war eine Reise von drei Tagen.
Das Heimweh, sowohl das der beiden Mädchen als auch das des Jungen, wurde gemildert, als sie das bekannte Gesicht der Doña Emilia in Joveltó wiedersahen. Doña Emilia war ja auf derselben Erde geboren wie sie, wenn auch im Hause des Patrons. Sie war nur ein Jahr älter als Ofelia und nur drei älter als Paulina. Sie waren miteinander aufgewachsen, denn die beiden indianischen Mädchen waren sehr frühzeitig zu Diensten ins Haus gekommen. Und im Hause hatten sie zusammen in der Küche und in den Wohnräumen gewirtschaftet, zusammen gelacht, zusammen geheult, zusammen getanzt, zusammen vor den Heiligenbildern der Kapelle der Finca gekniet und zusammen ihre kleinen Geheimnisse gehabt. Doña Emilia sprach die indianische Sprache ebenso geläufig wie die Mädchen, und die Mädchen wußten genug Spanisch, um sich unter Mexikanern zurechtzufinden.
Doña Emilia war sehr beliebt bei allen Familien der Peones ihres Vaters gewesen, wenn auch freilich oft mit der Einschränkung, daß sie beliebt war in der Art, wie in einem Königreiche der Kronprinz beliebter ist als der König. Aber sie hatte stets Hilfe bereit für kranke Leute, und wo immer sie konnte, versuchte sie da recht zu machen, wo nach ihrer Meinung oder nach Meinung der Peones von ihrem Vater oder von dem Mayordomo ein Unrecht getan worden war. Und so, in der Nähe der ihnen vertrauten jungen Frau bleibend, vergaßen die beiden Mädchen und der Junge schon nach wenigen Tagen, daß sie sich in einer neuen Umgebung befanden.
Don Leonardo, der Ehemann der Doña Emilia, war ein freundlicher Mann, der niemand etwas zuleide tun zu können schien. Er kümmerte sich auch nicht um das Dienstpersonal seiner Frau. Den Mädchen schien es, daß er ein besserer und gütigerer Patron sei als Don Arnulfo, der oft sehr grimmig werden konnte.
5
Don Leonardo war ein Kaufmann. Er unterhielt in Joveltó eine Tienda de Abarrotes, einen Laden und Lager für alle Art von Waren, wie Zucker, Kaffee, Mais, Bohnen, Seife, Mehl, Branntwein, Konserven, Schuhe, Laternen, Beile, fertige Kleider, Hemden, Baumwollstoffe, Seidenbänder, Phonographen, Medizin, Tabak, Heiligenbilder, Tinte, Flaschenbier, Parfüm, Sättel, Patronen. Ein Warenhaus in dem winzigen Format, wie es für Joveltó, eine halb indianische, eine halb mexikanische Stadt von etwa tausend Einwohnern, als großzügig und weltstädtisch angesehen werden muß.
Don Leonardo konnte dieses umfangreiche Geschäft durchaus allein besorgen. Im Notfalle, wenn der Andrang zu groß wurde, wenn etwa eine Frau eine Kerze für drei Centavos wünschte und zu gleicher Zeit eine Indianerin für zwei Centavos Rizinusöl haben wollte, dann kam es vor, daß Doña Emilia zur Aushilfe hinzusprang. Aber daß zwei Leute gleichzeitig im Laden waren, um etwas zu kaufen, das geschah nur selten, und wenn es wirklich geschah, dann war es nur an Markttagen. Der gewöhnliche Verlauf des Geschäftes ging so vor sich, daß frühmorgens um halb sechs ein Indianer vor der Tür kauerte, der im selben Augenblick, wenn geöffnet wurde, eintrat und für einen Quinto, fünf Centavos, Tabakblätter verlangte. Zwei Stunden später kam ein Kind und verlangte für einen Medio, sechs Centavos, gemahlenen Kaffee. Um zehn Uhr schickte eine Näherin nach Maschinennadeln Größe sieben. Der Ladeninhaber ließ sagen, daß er Größe sieben nicht habe. Das Kind lief nach Hause und kam zurück, es dürfte auch Größe acht sein. Don Leonardo sagte, daß er Größe acht leider auch nicht habe, er habe nur Größe neun. Das Kind kam wieder und kaufte für drei Centavos eine Nadel Größe neun. Dann wurde die Nadel im Laufe des Tages viermal umgetauscht, bis sich die Parteien endlich gegen Abend auf Größe fünf endgültig einigten und der Verkauf damit abgeschlossen war, unter dem Vorbehalt, daß die Näherin das Recht habe, die Nadel im Laufe der Woche umzutauschen, falls die Größe sich doch nicht eignen sollte.
Zuweilen wurden freilich auch ein Paar Stiefel verkauft oder sechs Meter Crêpestoff oder fünfundzwanzig Quininapillen oder gar ein ganzes blaues Kleid für dreiundzwanzig Pesos. Das will sagen, dreiundzwanzig Pesos verlangte Don Leonardo, weil das Kleid von New York importiert sei. Nach vier Stunden wurde das Kleid dann für vierzehn Pesos verkauft, wobei sowohl Don Leonardo als auch die Käuferin weinten oder wenigstens so taten, als ob sie weinten. Er darum, weil er das Kleid unter dem Einkaufspreis habe hergeben müssen und er das nur könne und nur tue, weil sie seine Nachbarin sei und zu einer Hochzeit wolle, und er hoffe, daß sie seine treue Kundin bis ans Ende ihrer Tage bleibe, während sie zu weinen vorgab darum, weil sie nur ein Kleid für acht Pesos habe kaufen wollen und nun alle ihre Ersparnisse hergeben müsse, um diesen sündhaften Preis bezahlen zu können. Als alles vorüber war, erzählte Don Leonardo seiner jungen Frau, daß er sechs Pesos an dem Kleide verdient habe, und die Käuferin erzählte in der ganzen Stadt herum, daß sie Don Leonardo diesmal aber schön hereingelegt habe, daß sie ein Kleid, das wenigstens dreißig Pesos wert sei, für den lächerlich geringen Preis von vierzehn Pesos erwischt habe und daß sie niemals, in ihrem ganzen Leben nicht, ein so schönes und so gutes und so modernes Kleid für so wenig Geld gekauft habe.
Diese Tienda würde Don Leonardo nicht reich, kaum wohlhabend gemacht haben. Die Konkurrenz war zu groß. Es gab in dem Städtchen so viele Läden, daß auf je drei Häuser ein Laden kam. Freilich waren die übrigen Läden nicht so groß und in ihren Waren nicht so reichhaltig wie der des Don Leonardo. Die meisten Läden waren eigentlich nur Winkelchen, und in der Hälfte aller Läden konnte man die ganze vorhandene Ware in einem Ramsch für zehn Pesos kaufen und dabei noch Geld verlieren können.
Don Leonardo hatte andere Geschäfte nebenbei laufen, die ihm mehr eintrugen. Er kaufte Mais von den indianischen Bauern, die in unabhängigen Gemeinden wohnten, in großen Mengen auf und verkaufte ihn dann mit gutem Gewinn in den größeren Städten Jovel, Tuxtla, Yalanchen, Balun Canan. Er kaufte in dem Distrikt Tsimajovel Kaffee auf und in dem Distrikt Pichucalco Kakao und verkaufte diese Waren an der Bahnstation an die größeren amerikanischen Kaffee- und Kakao-Einkäufer. Er kaufte in Hucutsin Tabak auf in Tausenden von Puppen und verkaufte ihn an die Händler in den Städten. Er betrieb diese Geschäfte nicht in sehr großem Maßstabe. Natürlich nicht. Dazu fehlte ihm genügend Kapital, und es waren auch zu viele andere Aufkäufer herum, die sich gegenseitig Leben und Existenz erschwerten. Auch war die Produktion nicht groß und nicht beständig genug, um dabei reich zu werden. Aber diese Nebengeschäfte halfen ihm dabei, zu einem behäbigen Wohlstand zu gelangen. Er durfte sich mit Recht für wohlhabender betrachten als sein Schwiegervater Don Arnulfo.
6
Bisher hatte ihm seine Tante im Geschäft geholfen. Seit seiner Heirat jedoch war die Tante mit ihm verfeindet. Mütter und Tanten haben es an sich, bösartig und sogar bissig zu werden, wenn ihre Schützlinge heiraten und sie nicht freudig und mit weitausgestreckten Armen in die Ehe mit aufgenommen werden. Und Tanten, besonders gar, wenn es übriggebliebene Tanten sind, sind zuweilen blutdürstiger als Schwiegermütter. Die Schwiegermutter, selbst die gute, selbst die Ausnahme, ist ein Überbleibsel aus der Zeit der Höhlenmenschen. Das wird so häufig vergessen, und darum sind Witze über die Schwiegermutter meist so langweilig. Don Leonardo hatte keine Lust, seine junge Frau ständig im Geschäft zu haben, wenngleich das die Regel in den kleinen Städten in Mexiko ist und besonders in den kleinen Geschäften des unteren Mittelstandes. Die mexikanische Frau ist im Geschäft dem Manne weit überlegen. Sie ist arbeitsamer als er, gewandter und rascher im Erfassen von Situationen. Die mexikanische Frau hat etwas, was dem mexikanischen Manne völlig fehlt: Vorausberechnung, und die Ruhe, das Vorausberechnete geduldig abzuwarten. Und weil Don Leonardo seine Frau nicht im Laden arbeiten sehen wollte, wenigstens nicht als Notwendigkeit, so hatte er an einen Jungen gedacht, den er im Geschäft heranbilden konnte, um ihn zu vertreten, wenn er seiner Einkäufe wegen nicht daheim sein konnte. Doña Emilia hatte ihm Andres beschrieben und ihm diesen Jungen empfohlen. Andres war im Alter von etwa neun Jahren ins Haus, in das Herrschaftshaus des Don Arnulfo, gekommen, um bei Tisch zu bedienen. In den Ranchos und Haciendas in Mexiko sind es meist Jungen, die am Tische bedienen, sehr selten Mädchen. Es sind Jungen eines oder einiger Peones der Hacienda, also indianische Jungen. Oft sind es freilich Kinder, die den Liebesverhältnissen des Patrons der Finca, oder seiner erwachsenen Söhne, mit einem oder mit mehreren indianischen Mädchen der Finca entspringen.
Die Arbeit des Jungen eines Peons im Herrschaftshaus des Patrons gilt als Pflichtarbeit, die seinem Vater gutgerechnet wird. Der Vater des Jungen erhält dafür vielleicht etwas mehr Land zugewiesen, oder es werden ihm von den zwei Wochen Pflichtarbeit, die er im Monat für den Patron zu leisten hat, ein oder zwei Tage abgelassen, oder er bekommt das Recht, sich mehrere Ziegen oder gar eine Kuh zu halten, die auf die Weiden des Patrons gehen dürfen, oder der Junge arbeitet eine Schuld herunter, die sein Vater bei dem Patron gemacht hat, vielleicht als er Hemdenstoff brauchte oder Ferkel oder ein Hündchen von dem Herrn erwarb. Andres bediente nicht nur bei Tisch, er half beim Geschirrwaschen, half beim Reinigen der Stuben, wässerte die Blumen im Garten, putzte das Reitzeug des Patrons, half beim Baden der Reitpferde, half Wasser vom Fluß herbeischleppen, und wenn so gar nichts anderes zu tun schien, so rief ihn der Mayordomo, und dann mußte er beim Drehen von Seilen helfen. Aber in nichts, was er auch tat, brauchte er sich totzuarbeiten. Wie sich wohl niemand, kein einziger Peon, auch wenn sie sich alle in gewisser Form von Leibeigenschaft befanden, zu Tode zu rackern brauchte. Denn es wurde nichts in überhastender Eile getan. Weder hier noch auf irgendeiner anderen Finca, die im Besitz eines Mexikaners oder eines Halbspaniers war. Wenn Andres vielleicht von irgendwem im Hause gerufen wurde und er war nicht zur Stelle, weil er sich mit anderen Jungen des Dorfes herumbalgte, so wurde er, wenn er endlich erschien, gründlich angebüffelt, und gelegentlich bekam er vielleicht eins hinter die Ohren gelangt; aber damit war der Vorfall auch schon wieder vergessen. Immerhin war der Dienst im Hause für Andres von Vorteil. Er schnappte Spanisch auf; und er lernte es so gut, daß er zu jener Zeit, als er nach Joveltó kam, sich im Sprechen von den mexikanischen Jungen dort kaum unterschied. Und weil er gleichzeitig auch seine Muttersprache Tseltal sprach und es dieselbe Sprache war, die in Joveltó und in dessen weiter Umgebung von den Indianern gesprochen wird, wenn auch mit Abweichungen von dem Dialekt, den Andres sprach, so war der Junge von großem Wert für Don Leonardo. Denn Don Leonardo hatte, besonders an Markttagen, eine größere Kundschaft unter den Indianern als unter den Mexikanern.
7
Don Leonardo konnte den Jungen bald recht gut leiden. Andres war willig, zu lernen, er war intelligent und anstellig. Er lernte rasch die Waren zu unterscheiden und richtig zu benennen, lernte ihren Wert und ihre Haltbarkeit kennen, lernte ihren Preis und lernte auch bald, wieviel er bei der einen Ware vorschlagen und wie weit er mit dem Preise zuletzt heruntergehen konnte, um seinem Herrn immer noch einen Nutzen zu lassen.
Jedoch wohl nicht aus allzu großer Liebe für den Jungen und weniger wohl noch aus einer Fürsorge für die Zukunft des Jungen, sondern zweifellos aus rein egoistischen und für ihn selbst sehr nützlichen Gründen heraus schickte Don Leonardoden Jungen in die Abendschule, damit er lesen, schreiben und rechnen lernen möge. Rechnen konnte der Junge sehr wenig. Wenn ihm jemand einen Peso gab und die verkauften Waren kosteten sechsundachtzig Centavos, so mußte er erst Don Leonardo oder Doña Emilia fragen oder gar aufsuchen, um die Summe zusammenrechnen zu lassen und ihm zu sagen, wieviel er herausgeben müsse. Das war umständlich und häufig, wenn Don Leonardo gerade bei Tische war oder die Zeitung lesen wollte, sehr belästigend. Und es war belästigend, daß der Junge die Aufschriften auf den Kisten und Packen nicht lesen konnte und darum oft die falschen Kisten aufmachte oder oft nahe daran war, die Ziffern der Preise zu verwechseln und Waren unter dem Preis zu verkaufen.
Don Leonardo dachte darüber nach, und er rechnete aus, daß der Junge für ihn wertvoller würde, wenn er lesen, schreiben und rechnen könne. Es war hier im kleinen, wie es überall in der Welt im großen ist. Der Fabrikant, der Großkapitalist, der Großlandbesitzer ist im Grunde seines Wesens der Bildung der Proletarier abgeneigt. Er fühlt mit gutem Recht, daß der gebildete Prolet seiner bevorzugten Stellung in der Welt gefährlich werden kann. Aber das Wirtschaftsleben ist so kompliziert und so verwickelt geworden, daß ein Fabrikant, der ungebildete Arbeiter beschäftigt, von jenen Fabrikanten, die gebildete und hochintelligente Arbeiter um sich sammeln, zugrunde gerichtet wird. Ein Eisendreher, der nicht berechnen kann, welche Übertragungsräder er einstellen muß, wenn er ein Gewinde von zehn Gängen auf einen Zoll Länge bringen soll, ist heute durchaus wertlos für den Fabrikanten. Die Maschinen, die ein Arbeiter heute zu bedienen hat, sind in den meisten Fällen so kompliziert, daß der Arbeiter, der alle die vielen Aufschriften an den unzähligen Hebeln, Rädern und Armen an seiner Maschine nicht blitzschnell zu lesen vermag, dem Fabrikanten in zwei Sekunden einen Schaden von zehntausend Dollar verursachen kann. Ein Arbeiter, der vorgelegte Zeichnungen nicht lesen, verstehen und nach ihnen arbeiten kann, ist unbrauchbar für den Fabrikanten von heute. Der Kapitalist von heute muß, um Kapitalist sein und bleiben zu können, den Staat unterstützen und sogar anspornen, den Kindern des Proletariats, die er ja eines Tages als Arbeiter benötigt, eine so gute Schulbildung zu geben, wie sie vor hundert Jahren nur selten die Kinder von Fabrikanten erhielten. Der Kapitalist muß mit seinen Steuern diese Bildung des Proletariats unterstützen. Er tut es mit bitterem Grimm im Herzen, aber er hat keinen anderen Ausweg. Heute, und mehr noch in Zukunft, steht nicht das Land an erster Stelle in der Welt, das die gebildetste Oberschicht hat, sondern jenes Land bestimmt den Wert des Geldes, das innerhalb seiner Grenzen das gebildetste Proletariat auferzieht.
So waren es reine Erwägungen von Nützlichkeit und von eigenem Vorteil, die Don Leonardo bewogen, dem Jungen eine notdürftige Schulbildung zu geben. Aber man darf ruhig schon jetzt sagen, daß, wenn der Junge eines Tages von seiner Schulbildung einen individuellen Gebrauch machen würde von einer Art, die Don Leonardo nicht behagt, Don Leonardo von einer undankbaren Kreatur sprechen wird, von einem Jungen, den er zu dem gemacht habe, was er sei, und der die große Güte seines Herrn mit schwarzer Undankbarkeit vergelte, und wenn er, Don Leonardo, das nur früher gewußt hätte, so würde er ihn, den Jungen, in seinem verlausten Indianerdorf gelassen haben, und er würde sich wohl gehütet haben, sein gutes Geld dafür auszugeben, daß der Junge etwas lerne.
8
Das gute Geld, das Don Leonardo für die Schulbildung des Jungen ausgab, war nicht viel. Sechzig Centavos den Monat. Aber Don Leonardo machte viel Aufhebens von dieser Ausgabe.
Er hatte eigentlich ein Recht dazu, viel darüber zu sprechen. Denn er war wohl der einzige in der ganzen Stadt, der einen kleinen Indianerjungen, der in Diensten stand, in die Schule schickte und noch dafür bezahlte. Andere Mexikaner, die in Joveltó wohnten und indianische Bedienstete hatten, dachten mit keinem Gedanken daran, ihren Bediensteten eine Möglichkeit zu geben, sich eine geringe Bildung anzueignen. Der Bedienstete, ob Bursche oder Mädchen, arbeitete von fünf Uhr morgens bis abends um zehn. Es war nicht immer schwere Arbeit, aber er mußte stets auf den Beinen und zur Stelle sein, wenn er gerufen wurde. Der Bedienstete konnte keine Stunde entbehrt werden. Das bildeten sich wenigstens sein Herr und seine Herrin ein. Und ihn gar in die Schule zu schicken, war einmal Unsinn und zum andern Sünde. Unsinn war es darum, weil es ja geschehen mochte, daß der indianische Junge nach einer Zeit mehr konnte und mehr wußte als der leibliche Sohn des Herrn. Denn die leiblichen Kinder des Herrn wurden hinsichtlich ihrer Schulbildung sehr lässig behandelt. Es galt meist schon allerlei, wenn sie notdürftig lesen und schreiben konnten. Und Sünde war es, einen Indianerjungen etwas Schreiben und Lesen lernen zu lassen, weil die Kirche einer Schulbildung der Indianer nicht sehr freundlich gesinnt war. Die Kirche wollte die Indianer in ihrer Unschuld und Unwissenheit belassen, weil den unschuldigen Kindlein das Himmelreich gewiß sei, während man von einem gebildeten Indianer nie wisse, wohin ihn seine Bildung führen möchte. Das Beispiel des Indianers Benito Juarez war noch sehr frisch und ist bis heute frisch geblieben. Dieser Indianer aus Oaxaca, der bis zu seinem fünfzehnten Jahre in paradiesischer Unwissenheit dahingelebt hatte, erhielt die Möglichkeit, sich etwas Bildung zu erwerben. Und als er nach vielen Mühen endlich eine gute Bildung gewonnen hatte, konfiszierte er alles Kircheneigentum für das mexikanische Volk und räumte so gewaltig unter den ewigen und von Gott persönlich an die Kirche verliehenen Rechten auf, wie das vorher niemals jemand gegen die katholische Kirche gewagt hatte. Kein Wunder, daß die Kirche mit schiefen Augen die Schulbildung der Indianer betrachtete.
Die sechzig Centavos, die Don Leonardo für die Schulbildung des Andres ausgab, waren in Wirklichkeit viel weniger Geld, als es schien. Denn: Andres bekam keinen Lohn.
Wer wird denn auch einem Indianerjungen Lohn bezahlen! Der Indianerjunge darf froh sein, daß er die Ehre hat, arbeiten zu dürfen. Das ist des Lohnes genug. Der Patron hat ein Recht darauf, von dem Indianer Dankbarkeit zu erwarten dafür, daß er ihn beschäftigt.
Andres bekam das Essen. Es war reichlich. Das muß gesagt werden. Aber sein Essen war sehr selten etwas anderes als Maisfladen, schwarze Bohnen und Chili, oder, um es genauer zu bestimmen, Tortillas, Frijoles und grüner Pfeffer. Wenn der Junge nicht gleich zur Stelle war, sobald er gerufen wurde, oder wenn er etwas versah in seiner Arbeit, so wurde ihm ständig gesagt, daß er nicht einmal sein Essen verdiene und daß sein Herr an ihm täglich verliere.
Außer dem Essen erhielt er auch die Kleidung von seinem Patron. Die Kleidung war eine weiße Baumwollhose und eine weiße hemdartige Jacke aus Baumwollstoff und ein Hut aus Bast. Schuhe oder Stiefel bekam der Junge nicht. Nicht einmal Sandalen. Er ging immer barfuß und hatte nie in seinem Leben etwas an den Füßen gehabt. Der Junge war daran gewöhnt und wußte es nicht besser.
Wenn dann die Fiesta des Ortes war, das Fest des heiligen Schutzpatrons von Joveltó, dann bekam der Junge vielleicht fünf Centavos, oder wenn sein Herr sehr freigebiger Laune war, zwei Reales, fünfundzwanzig Centavos, damit er sich Dulces, Bonbons, kaufen möge. Das kam einmal im Jahr vor, weil die Fiesta nur einmal im Jahre war. Damit aber nicht genug. Wenn der Junge seinen Dia de Santo, den Tag seines Schutzheiligen, hatte, dann bekam er wieder einmal zehn Centavos und vielleicht einen neuen Cintaron de lana, ein rotes Wollband, das ihm zum Festhalten seiner Baumwollhose um die Hüften diente.
Ein Bett hatte er nicht. Er war auch nicht daran gewöhnt. Er schlief auf einem Petate, einer Matte aus Bast, die er in einem Winkel der Küche oder in einer Ecke des Portico ausbreitete. Diese Matte hatte er von Hause mitgebracht.
Weil der Junge auch während seines Dienstes im Herrschaftshause der Finca niemals Lohn bekommen hatte und dort nicht einmal einen Centavo in die Hand bekam, so wußte er auch gar nicht, was Lohn war. Und darum, wenn er jetzt zweimal im Jahre ein paar Centavos von seinem Herrn erhielt, so fühlte er sich in seiner wirtschaftlichen Lage erheblich gebessert. Ein System, das einen Kapitalisten vor Neid bersten lassen könnte und das gesetzlich überall auf Erden einzuführen der mollige Traum eines jeden Arbeitgebers ist.
9
Der Lehrer konnte es leicht für sechzig Centavos im Monat tun, dem Jungen Bildung beizubringen. Er hatte fünfundzwanzig Pesos Gehalt im Monat.
Der Jefe Politico, der Distriktschef, hatte sechshundert Pesos im Monat, die Einnahmen, die er aus Erpressungen und Bestechungen schöpfte, nicht gerechnet. Das war mehr als sein Gehalt.
Unter allen Staatsangestellten hatte der Lehrer das geringste Einkommen.
Staatsanwälte und Polizeidirektoren werden zwanzigmal besser bezahlt. Und sie werden darum zwanzigmal besser bezahlt und hundertfach höher geachtet, weil es ihre Aufgabe ist, die Defekte der Menschheit zu beknabbern. Eine Aufgabe, die notwendig ist, um den Staat zu erhalten und den Menschen beizubringen, daß die Anerkennung des Privateigentums ein Zeichen von Zivilisation ist.
Der Lehrer konnte keine Erpressungen ausüben, weil er dazu weder ein Recht noch die Macht hatte. Und ihn zu bestechen, machte sich niemand die Mühe; denn ob jemand in seiner Schule ein Examen bestand oder nicht, das war sowohl für die Schüler als für deren Eltern ohne jeglichen Belang.
Er konnte seine Einkünfte allein nur dadurch verbessern, daß er eine Abendschule einrichtete für die Leute und für die Kinder, die während des Tages nicht zur Schule kommen konnten. Die Mehrzahl der Kinder des Städtchens, die Kinder der Indianer alle, mußten während des Tages arbeiten. Die einen auf den Feldern, die anderen irgendwie in der Hausindustrie, wo Kerzen gegossen, Zigaretten gedreht, Tongeschirr geformt, Wolldecken gewebt, Leder bearbeitet, Bonbons gekocht, Hüte geflochten wurden.
Der Lehrer berechnete für jeden Schüler, ob erwachsen oder nicht, einen Peso im Monat. Zahlreiche Familien konnten diesen Peso nicht aufbringen, und darum blieben die Kinder ohne Schulbildung.
Don Leonardo, guter Kaufmann, der er war, verstand es, von dem Peso, den er dem Lehrer für Andres zu bezahlen hatte, noch vierzig Centavos abzuhandeln.
Andres sollte eigentlich jeden Abend zur Schule kommen, die von sieben bis neun oder halb zehn gehalten wurde. Er wollte auch jeden Abend kommen, denn er fand Freude am Lernen. Aber wenn ihn sein Patron im Geschäft brauchte, dann konnte er nicht gehen. Das Geschäft ging vor, und Lernen war nichts als Zeitvergeudung.
Don Leonardo kaufte dem Jungen auch keine Bücher. Wenn er ihm wirklich einmal ein beschmutztes Schreibheft aus dem Laden gab oder einen halbaufgebrochenen Bleistift oder ein schal gewordenes Fläschchen Tinte, so tat er das mit vielen Worten und mit saurer Miene. Aber der Junge konnte ja altes Einpackpapier, das zum Einwickeln nicht mehr zu gebrauchen war, haben, und er mochte auf seinen Gängen in den Straßen achtgeben, ob er nicht ein Bleistiftstümmelchen, das jemand verloren oder weggeworfen hatte, auflesen könnte.
Unvollkommen, wie diese Art des Unterrichts auch war, Andres lernte dennoch eine gute Menge.
Das Wichtigste, was er wohl lernte, war, zu erkennen, welchen Wert Bildung hatte. Denn selbst den Wert, lesen und schreiben zu können, weiß nur der zu schätzen, der lesen und schreiben kann.
ZWEITES KAPITEL
1
Andres war inzwischen fünfzehn Jahre alt geworden. Er ging noch immer barfuß. Und er schlief noch immer auf einem Petate, den er in einem Winkel der Küche oder in einer trockenen Ecke des Porticos ausbreitete und am Morgen, wenn er aufstand, wieder zusammenrollte und irgendwo unter einen Sparren schob. Der Petate, die Matte aus Bast, war nicht mehr derselbe, den er von Hause mitgebracht hatte. Auch die Wolldecke, mit der er sich zudeckte, war nicht mehr die gleiche. Der Petate war doch endlich durchgelegen worden. Aber Don Leonardo hatte ihm keinen neuen gegeben; denn ein Petate kostete einen Peso zwanzig Centavos.
Doña Emilia hatte zweimal in dieser Zeit ihren Vater in der Finca besucht, um ihre beiden Kinder, die sie inzwischen zur Welt gebracht hatte, zu Hause zeigen zu können und bewundern zu lassen.
Auf diesen Reisen hatte sie Andres begleitet. Er war ja nun ein großer Junge schon, dem Don Leonardo seine Frau und seine Kinder ruhig anvertrauen durfte.
So hatte Andres seinen Vater und seine Mutter und seine Geschwister und die ganze Sippe wiedergesehen. Und sein Vater hatte ihm einen neuen Petate und eine neue Wolldecke gegeben, als er sah, wie armselig die Sachen des Jungen aussahen.
Die Wolldecke hatte der Vater aus der Bodega des Patrons kaufen müssen. Sie kostete neun Pesos, denn sie war eine gute Wolldecke, gefertigt von den Indianern in Chamula. Auch den Petate hatte der Vater von seinem Patron kaufen müssen, und diese Matte kostete einen Peso fünfundsiebzig. In der Bodega des Finqueros waren alle Dinge um fünfzig und hundert Prozent teurer als in einem Laden in der Stadt.
Vater Criserio konnte natürlich die Wolldecke und den Petate nicht bezahlen, denn er bekam ja nie Lohn. Er mußte infolgedessen die Dinge von dem Patron borgen und auf sein Konto anschreiben lassen.
Don Arnulfo sagte: »Die Decke kostet neun Pesos.«
»Das ist sehr teuer, Patron«, antwortete Criserio, »in Simojovel kann ich eine Decke für fünf Pesos kaufen.«
»Das kannst du, Criserio, wenn du Geld hast.«
»Ich habe aber kein Geld, Patroncito, mein Herrchen«, sagte darauf Criserio.
»Du brauchst die Decke nicht zu kaufen, Criserio, wenn sie dir zu teuer ist«, sagte Don Arnulfo, und er schob die Decke wieder zurück in das Regal.
»Ich muß aber doch die Decke haben für meinen Hijito, für mein Jungchen, der friert sich ja doch zu Tode«, sagte Criserio, ohne dabei eine Miene seines Gesichtes zu verziehen.
»Die Decke kostet neun Pesos, Criserio. Billiger kann ich sie nicht lassen. Wenn sie dir zu teuer ist und du anderswo eine Decke billiger kaufen kannst, das steht dir frei. Du bist nicht gezwungen, die Decke bei mir zu kaufen. Glaubst du vielleicht, ich will, daß du Schulden machst? Das will ich gewiß nicht. Ich habe es lieber, wenn meine Muchachos, hier meine Arbeiter auf der Finca, keine Schulden haben. Dann habe ich keinen Ärger, und meine Muchachos sind frei und können gehen, wann sie wollen. Hier gibt es keine Sklaverei.«
»Das weiß ich wohl, Herrchen«, sagte Criserio. »Wir sind keine Esclavos, wir sind frei und können gehen, wann wir wollen und wohin wir wollen.«
»Wenn ihr keine Schulden bei mir habt, nicht wahr, das weißt du doch?«
»Das weiß ich wohl, Patron. Wenn wir keine Schulden beim Patron haben.« Criserio sprach das dahin wie auswendig gelernt. Über den Sinn dachte er nicht nach. Der Sinn lag ihm zu fern. Don Arnulfo aber machte kurze Sache. Er hatte keine Zeit, mit einem seiner Peones zu handeln und sich mit ihm in Gespräche über Fragen von Schuldabhängigkeit oder Freizügigkeit einzulassen. Solche Fragen waren weder für ihn noch für irgendeinen andern Finquero Probleme. Es war kalte trockene Sachlichkeit. Staat, Regierung, Soldaten und Polizei schützten seine Rechte als Gläubiger.
»Willst du nun die Decke haben oder nicht? Sage, was du willst, und wenn du nichts willst, gehe deiner Wege. Die Decke kostet neun Pesos. Brauchst sie nicht zu nehmen, wenn du keine Schulden machen willst.«
»Ich nehme die Decke und den Petate«, sagte Criserio.
»Gut«, meinte Don Arnulfo, »also dann schreibe ich es in das Buch auf dein Konto.«
»Ja, Herrchen, schreibe es auf mein Konto, ich brauche die Decke und den Petate für mein Jungchen, der ja jetzt so weit fort ist.« Don Arnulfo klappte das Buch auf, blätterte nach dem Konto Criserio Ugaldo, und während er in das Buch schrieb, sagte er: »Warte, bis wir das hier richtig in Ordnung haben.«
»Ja, Patroncito, ich warte.« Criserio packte die Sachen zusammen und schob sie unter den Arm.
Don Arnulfo kratzte an der Feder herum, weil sie nicht schreiben wollte, und rechnete laut: »Die Decke ist neun Pesos. Ist das richtig, Criserio?«
»Ja, das ist richtig, Patron. Neun Pesos.«
Don Arnulfo schrieb und sagte dann: »Der Petate ist ein Peso fünfundsiebzig Centavos.«
»Patron«, unterbrach ihn Criserio, »der Petate ist aber sehr teuer. In Yajalon kostet ein guter Petate nur sieben Reales.«
»Por Diablo, zum Teufel noch mal, willst du den Petate haben oder nicht. Mache deinen Kopf klar, was du willst und was du nicht willst. Ich habe hier keine Zeit mehr.« Don Arnulfo wurde sehr unwillig. Und um ihn nicht noch mehr ungehalten zu machen, sagte Criserio: »Ja, aber natürlich, Patron, will ich den Petate haben, für meinen Jungen, den Andres.«
»Bueno, das sind ein Peso fünfundsiebzig. Richtig, Criserio?«
»Das ist richtig, Patron.«
»Muy bien – sehr gut«, sagte Don Arnulfo schreibend. »Das ist dann rund gerechnet elf Pesos. Ist das richtig, Criserio?«
»Das ist richtig, Patron.«
»Das sind also elf Pesos. Und weil du mir elf Pesos schuldig bleibst und nicht bezahlst, macht das elf Pesos, und das sind zweiundzwanzig Pesos. Elf Pesos für die Decke und für den Petate und elf Pesos, weil du das nicht bezahlst und mir schuldig bleibst. Ist das richtig, Criserio?« Criserio konnte nicht rechnen. Auf keinen Fall konnte er so schnell summieren. Und die Zahlen machten ihn verwirrt, weil er nicht so schnell mitkonnte, und er wollte auch seinen Patron nicht unwillig machen, und der Patron sagte die Zahlen auch alle in Spanisch, die Criserio in Spanisch wohl verstand, sie aber in seinem Hirn nicht auffassen konnte.
So war es durchaus natürlich, daß Criserio sagte: »Das ist richtig, Patron.«
Weil es der Patron sagte, so mußte es richtig sein. Denn der Patron, ein so stolzer und reicher Herr, bereichert sich nicht auf unredlichem Wege an einem armen Indianer.
»Bestätigt, Criserio?« fragte Don Arnulfo.
»Bestätigt, Patron«, antwortete Criserio.
Don Arnulfo ließ Criserio das Konto nicht mit einem hingeschmierten Kreuzchen bestätigen. Criserio hätte das schöne saubere Kontobuch, das ›Mit Gott!‹ eröffnet war, ja doch nur mit Tinte dick bekleckst. Es war auch nicht notwendig, daß da Kreuzchen der Bestätigung standen. Wenn es zu einer Auseinandersetzung kommen sollte, was nie geschah, hätte kein Beamter nach den Kreuzchen gefragt. Die Kreuzchen wären auch überhaupt wertlos gewesen; denn weder Criserio noch irgendein anderer Peon der Finca konnte lesen, was er mit Kreuzchen bestätigen sollte. So war es völlig gleich, ob da Kreuzchen standen oder nicht. Don Arnulfo hatte gefragt: »Ist das richtig?«, und Criserio hatte geantwortet: »Ja, Patron, das ist richtig.« In einem Rechtsverfahren zwischen einem Finquero und einem Peon erkannte jeder Richter in Mexiko diese wörtliche Bestätigung als rechtsgültig an. Der Peon hatte bestätigt, und er war damit für die Schuld, die er gemacht und bestätigt hatte, verantwortlich.
Don Arnulfo war ein anständiger und ehrenhafter Herr. Er behandelte seine Peones besser als viele andere Finqueros, die erkannte. Andere Landherren waren weniger weichherzig zu ihren Peones. »Das Hemd kostet fünf Pesos. Richtig, ja? Gut. Und weil du das Hemd nicht bezahlst, so sind das fünf Pesos. Und weil du mir die fünf Pesos schuldig bleibst, so sind das fünf Pesos. Und weil ich von dir nie das bare Geld bekommen kann, so sind das fünf Pesos. Macht also fünf und fünf und fünf und fünf, das sind zwanzig Pesos. Bestätigt?« – »Ja, Patron, bestätigt.« Der Peon kann ja nirgend anderswo ein Hemd kaufen, wenn er eins braucht; denn er hat ja nirgends Kredit in der Welt, nur bei seinem Herrn, bei dem er arbeitet und den er nicht verlassen darf, wenn er auch nur einen Centavo Schulden bei ihm hat.
Sie sind keine Sklaven, die Peones. Die Sklaverei wurde in Mexiko bei der Unabhängigkeitserklärung von Spanien abgeschafft. Das Nichtbestehen der Sklaverei in Mexiko ist durch die Konstitution bestätigt.
In einer Abteilung der göttlichen Weltordnung macht es sich bezahlt, wenn die Proletarier lesen, schreiben und rasend schnell rechnen können; in einer andern Abteilung dieser klugen Weltordnung macht es sich besser bezahlt, wenn die Proletarier nicht rechnen können und kein Spanisch lernen. Wer Geld verdienen will, braucht sich nur zu entscheiden, welche Abteilung er auszunutzen wünscht. Beide Abteilungen enthalten Goldminen.
2
Criserio machte sich keine Gedanken darüber, ob hier alles mit Recht zugegangen war oder nicht. Soweit, um derartige Geschäfte erfassen und verstehen zu können, vermochte er nicht zu denken. Es hätte jemand stundenlang mit ihm darüber reden können, um ihm klarzumachen, daß er hier schmählich übervorteilt worden sei, er würde das nicht eingesehen haben. Er hätte zugehört und zugehört, und wenn es zum Ende gekommen wäre, würde er gesagt haben: »Der Patron hat recht; denn der Patron ist ein vornehmer Mann, und der betrügt keinen armen Indianer. Und es ist ganz richtig gerechnet worden, denn ich bleibe die elf Pesos ja schuldig, und dann sind es eben zweiundzwanzig Pesos. Das ist ganz richtig.«
Don Arnulfo hätte das freilich anders machen können, um ebenfalls auf zweiundzwanzig Pesos zu kommen. Er hätte einfach sagen können, Decke und Petate kosten zusammen zweiundzwanzig Pesos, kaufe sie oder kaufe sie nicht. Aber das hätte der Indianer verstanden, daß dies ein Wucherpreis gewesen wäre. Dann hätte er nicht gekauft und sich mit einem Ersatz, den er sich selbst beschaffen konnte, etwa mit Fellen von erjagten Tieren, ausgeholfen. Denn Preise für Dinge verstand er. Er verstand auch, daß auf der Finca alle Waren etwas teurer sein mußten als auf dem Markte in der Stadt, denn der Finquero hatte ja Transportkosten, und er wußte ja auch nicht, zu welchem Preise der Finquero eingekauft hatte. Die schlichten Preise begriff der Peon; was er nicht begriff und was er nicht verfolgen konnte, waren die schnellen Manipulationen, die der Finquero mit Zahlen und mit Verrechnungen vornahm. Wenn nun gar eine Rechnung mit Zahlen über fünf hinausging, dann hörte für den Peon jegliches Begreifen auf. Ob es dann fünfzehn oder zweiundzwanzig oder siebenundsechzig Pesos waren, das bedeutete für ihn alles das gleiche. Er wurde bei solchen Zahlen so verwirrt, daß er in eine Art von Hypnose verfiel. Und diese Hypnose würde sich noch vertieft haben, wenn es etwa wirklich dazu gekommen wäre, daß Richter oder andere Beamte die Konten des Finqueros nachgeprüft hätten, um festzustellen, ob den indianischen Landarbeitern unrecht getan wurde oder nicht. Sie kannten in der ganzen Welt ja auch nur einen einzigen Menschen, an den sie sich mit einer Beschwerde wenden konnten, und das war ihr eigener Patron.
Aber armer Indianer oder nicht armer Indianer. In hochzivilisierten Ländern besteht das gleiche göttliche System: Der Soldat, der von seinem Hauptmann geprügelt wurde, darf sich nur bei seinem Hauptmann beschweren, und dieser Hauptmann entscheidet, ob die Beschwerde zu Recht besteht und weitergeleitet wird oder nicht. Darum hat der Soldat in einem zivilisierten Lande durchaus kein Recht, von einer stolzen Höhe auf den armen unwissenden Peon, der sich alles geduldig gefallen lassen muß, mit Grienen herabzublicken.
Es gibt auf Erden zahlreiche Systeme der Versklavung und der Ausraubung von Menschen, die, wenn sie nicht wirklich existierten, von keinem vernünftigen und normalen Menschen erfunden werden könnten.
3
Criserio war glücklich, daß er seinem Jungen die Decke und den Petate geben konnte. Er sagte ihm, daß die Sachen elf Pesos gekostet hätten. Aber er sagte ihm nicht, daß er dadurch eine Schuldpflicht von zweiundzwanzig Pesos übernommen hatte.
In seinem Kopfe baute sich das Bild anders auf. Die Waren kosteten elf Pesos. Das war richtig. Daß er aber in Wahrheit zweiundzwanzig Pesos schuldete, hatte nichts mit der Decke zu tun, sondern das war deshalb, weil er die elf Pesos nicht in bar bezahlen konnte. Aus diesem Grunde hielt er es nicht für nötig, darüber mit seinem Sohne zu sprechen.
Andres hätte daran nichts ändern können, auch wenn er es gewußt hätte. Aber es war ihm wohl bekannt, was für eine unerhört hohe Summe elf Pesos für seinen Vater bedeutete. Denn er kannte ja die wirtschaftlichen Verhältnisse der Peones einer Finca. Er hatte sie vielleicht nicht gekannt oder nicht erfaßt, als er von Hause fortkam.
Aber er war nun reifer geworden, und während seiner zwei Besuche auf der Finca war ja in der Hütte seiner Eltern wie in den Hütten anderer Peones über alle Dinge gesprochen worden. Wenn in den Hütten der Peones über solche Verhältnisse geredet wurde, so geschah es nicht in einer kritischen Weise. Die Dinge wurden hingenommen, wie sie waren. Sie wurden betrachtet wie eine ewige Fügung des Schicksals, woran man nichts ändern könne, so wie der Mensch nichts daran ändern kann, daß das Wasser eines Flusses abwärts und nicht aufwärts fließt. Der Patron war der Patron, und der Peon war der Peon. So war es, und so wird es bleiben. Der Sohn des Peons wird wieder Peon. Und wenn der Patron die Finca seinem Sohne übergibt oder die Finca verkauft, so ändert sich der Name des Patrons, aber an den Verhältnissen ändert sich nichts. Wenn wirklich etwas kritisiert wurde, so war es nur, daß das Land, das dem einen oder dem andern vom Patron zugewiesen war, zu mager sei, zu viele Steine habe, zu bergig sei oder daß man gern ein kleines Stückchen Land mehr haben möchte oder daß der Preis für die Schweine, die von den Händlern aufgekauft wurden, um fünfundzwanzig oder fünfzig Centavos höher sein sollten, denn zwei Pesos achtzig Centavos für ein gutes ausgewachsenes Schwein sei wirklich zuwenig.
Daß der Patron ein Vorkaufsrecht an allen Schweinen, Ziegen oder Schafen hatte, die seine Peones verkauften, und daß er den Preis selbst bestimmte für die Schweine, die er von seinen Peones kaufen wollte, um sie weiterverkäufen zu können, und daß die Peones von ihm erst Erlaubnis erbitten mußten, wenn sie ihr kleines Vieh an vorbeiziehende Händler verkaufen wollten, und daß sie von jedem Stückchen, das sie an die Händler verkauften, dem Patron fünfzig oder fünfundsiebzig Centavos oder gar einen Peso abgeben mußten, das wurde nicht kritisiert. Denn das war altes gutes Recht des Patrons. Die Schweine, Schafe und Ziegen waren auf seiner Finca groß geworden, aber die Peones hatten die Ferkelchen und die Zickelchen mit eigenem Gelde kaufen müssen, und es war der von ihnen gebaute Mais, den die Tiere zu fressen bekamen.
Die Peones konnten auch keinen überschüssigen Mais oder keine überschüssigen Bohnen von ihren Feldern beliebig an herumziehende Händler oder auf dem Markte des nächsten Ortes verkaufen. Auch hier hatte der Patron Vorkaufsrecht, und auch hier mußte um seine Erlaubnis, verkaufen zu dürfen, gebeten werden, und sie mußten einen Teil des erhaltenen Geldes an ihn abgeben. Wenn sie Schulden bei ihm hatten, und sie alle hatten Schulden bei ihm, so durften sie überhaupt nichts verkaufen, sondern mußten alles ihm geben. Und der Patron rechnete von der Schuld so viel ab, wie er den Preis bestimmte.
Das war gerecht, es war Gesetz und Fügung des Himmels, und es war alles von der Kirche bestätigt. Die Götter waren ja Blutsverwandte des Patrons, und sie waren in keiner Weise verwandt oder verschwägert mit den Indianern.
Das war so, und daran ließ sich nichts ändern. Das war immer so gewesen und wird immer so bleiben. Die Peones wußten das nicht besser. Sie wußten nur das eine, daß es überall auf der Welt so sei; denn wohin sie auch immer kommen, wohin sie auch immer gehen, auf allen Fincas der Nachbarschaft war es genauso. Also mußte es auf der ganzen Erde so sein. Ihre Erde oder, genauer gesagt, was sie als Erde und als Welt kannten, warder Bereich, wo die Indianer wohnten, die die gleiche Sprache redeten. Wo ihre Sprache nicht geredet wurde, war eine Welt, die ihnen fremd und unbekannt war. Und was dort für Verhältnisse herrschten, wußten sie nicht und konnten es auch nicht erfahren.
Es lagen in ihrem Distrikt viele Dörfer, die unabhängig waren. Dies waren zumeist Dörfer, wo Indianer wohnten, die nie zu Peones einer Finca gepreßt worden waren. Entweder war das Land so dürftig, daß sich kein Spanier danach gesehnt hatte, es zu besitzen, oder die Indianer waren stets so aufsässig, so störrisch, so mörderisch gewesen, daß sich kein Spanier hier halten konnte. So war das in Bachajon gewesen und in vielen anderen Dörfern. Aber wenn die Peones hinsahen, fanden sie, daß jene unabhängigen Indianer noch viel armseliger lebten als sie.
Diese unabhängigen Indianer lebten zuweilen so dürftig, daß sie freiwillig ihr unabhängiges Dorf verließen und freiwillig auf eine Finca als Peones zogen.
Der Gründe waren unzählige. Die Mehrzahl jener Gründe wurzelten in den Charaktereigenschaften, den Gewohnheiten und den Sitten jener Menschen. Aber der Hauptgrund war ihre verzweifelte Unwissenheit und die Geschicklichkeit der großen Landherren und der mit ihnen verbundenen Kirche, sie in jener Unwissenheit zu erhalten.
4
Der Vater des Andres war nun keineswegs verpflichtet, seinem Sohne eine neue Decke und einen neuen Petate zu kaufen. Er tat es, weil er seinen Sohn liebte und weil er es nicht ertragen konnte, seinen Sohn leiden zu sehen.
Der Mann, der verpflichtet war, dem Andres diese Sachen zu kaufen, war sein Herr, Don Leonardo. Aber dem war es völlig gleich, ob Andres fror oder ob er auf der nackten Erde schlief oder ob er sich eine schwere Erkältung zuzog und erkrankte oder ob der Junge gesund und lebenskräftig blieb. Was kümmerte er sich schon um das Wohlergehen eines Indianerjungen! Wenn der Junge Lungenentzündung oder Fieber bekommen und sterben sollte, was war es ihm? Es gab Tausende von Indianerjungen. Er hätte seine Frau ersucht, an ihren Vater zu schreiben und einen neuen Jungen zu fordern. Wohin hätte das führen sollen, wenn er sich mit der Sorge für einen barfüßigen Indianer jungen hätte abgeben wollen?
Elf Pesos war der Junge nicht wert. Zudem schadet es einem Indianerjungen gar nicht, auf der nackten Erde zu schlafen. Die sind daran gewöhnt, und die sind so zäh wie ihre Hunde. Die elf Pesos brauchte er in seinem Geschäft.
Lohn bekam Andres noch immer nicht, und Don Leonardo dachte nie daran, dem Jungen jemals irgendwelchen Lohn zu geben. Er würde ihm auch keinen Lohn gegeben haben, wenn er zwanzig oder dreißig Jahre alt geworden wäre und das Geschäft ebensogut besorgt hätte wie ein junger Mann aus Jovel, der die Arbeit nicht unter zwanzig Pesos im Monat und das Essen getan hätte.
Der einzige Unterschied, den er mit dem Jungen in den letzten zwei Jahren gemacht hatte, war, daß Andres jetzt, wenn eine Fiesta in Joveltó war, nicht fünf oder zehn Centavos bekam, sondern einen Tos ton, fünfzig Centavos.
»Kaufe dir keinen Unsinn dafür, und besonders keinen Aguardiente, keinen Branntwein«, ermahnte ihn Don Leonardo, wenn er ihm die fünfzig Centavos verabreichte mit einer Miene, als gäbe er ihm ein goldenes Zwanzig-Peso-Stück.
5
Don Leonardo vertraute dem Andres zuweilen jetzt schon sehr verantwortungsvolle Aufgaben an.
Er schickte ihn mit größeren Geldsummen nach Jovel, der nächsten größeren Stadt, wo Andres Waren einzukaufen hatte, wo er mit Arrieros, den Muletreibern, die jene gekauften Waren nach Joveltó zu bringen hatten, verhandelte, die Waren begleitete und darauf sehen mußte, daß sie vollzählig waren und unbeschädigt in Joveltó ankamen.
Diese Arbeiten erweiterten den Erfahrungskreis des Jungen in erheblicher Weise. Er lernte eine richtige größere Stadt kennen, sah die Fülle und die Verschiedenartigkeit von Waren aus aller Welt und hörte von Städten, die tausendmal größer seien, als Jovel war, das ihm, als er zum erstenmal hierhergekommen war, erschien, als könne es keine größere und schönere Stadt auf Erden geben. Sie hatte kilometerlange Straßen, Haus dicht an Haus gesetzt, alle Häuser aus Stein und viele Häuser mit Fenstern. Daß es Häuser mit Fenstern gab, hatte er vorher nicht gewußt, denn er hatte vorher ein solches Haus nicht gesehen. In Joveltó gab es einige, aber die Fenster waren nur vergitterte Luken. Und hier sah er Fenster mit Glasscheiben, und er sah sogar Ladenfenster mit riesengroßen Glasscheiben, hinter denen die Waren aufgebaut waren und es aussah, als ob man die Waren gleich so angreifen könnte.
Er sah hier Ochsenkarren, die Carretas, zum ersten Male. Bisher hatte er nie gewußt, daß es Karren oder Wagen gab und daß diese Karren von Tieren gezogen werden könnten. Denn Zugtiere hatte er vorher auch nicht gekannt. Auf den Feldern der Finca, wie auch auf den Feldern in Joveltó, wurde nicht gepflügt, sondern es wurden nur mit einem Stabe in die Erde Löcher gestoßen, in die man die Maiskörner oder die Bohnen legte. Wenn wirklich leicht gepflügt werden mußte, etwa für Tomaten oder für Chili, so geschah das mit einem Pfluge, der nur ein Holzknüppel war und von einem Peon gezogen wurde. Wo hätte also Andres die Kenntnis von Zugtieren her haben sollen? Wege, auf denen Wagen oder auch nur Karren fahren konnten, gab es in dem ganzen großen weiten Distrikt nicht einen einzigen. Alle Wege waren nur schmale Pfade, die oft so schmal, so steinig, so zerlöchert, so bröcklig waren, daß es selbst für Mules mit Traglasten schwierig war, auf ihnen gefahrlos zu gehen. Andres hörte von einem Carretero, daß die Carretas Reisen machten, fünfzehnmal so weit, wie die Entfernung von Joveltó nach Jovel war. Und von Joveltó nach Jovel war für Packmules ein guter Tagesmarsch.
Der Junge sah den Carretero, der ihm das erzählte, ungläubig an. Aber andere Carreteros sagten dasselbe. Und einen indianischen Salzhändler, der seine Ware auf der Straße verkaufte und den er fragte, sagte ihm, das sei richtig, und er wisse es, weil er einmal eine Ladung Salz mit einer Carreta nach Arriaga begleitet habe.
So bekam Andres den ersten Begriff von der Größe der Erde, auf der er lebte.
Bisher hatte er sich von der Größe der Erde nie eine Vorstellung gemacht. Um die Wahrheit zu sagen, er hatte nie darüber nachgedacht. Wenn in dem Hause oder in dem Laden des Don Leonardo von Tullum, von Tonalja, von Tapachula, von San Gerónimo, von Veracruz, von Mexico City gesprochen wurde, so stellte er sich diese Städte so vor, wie Joveltó war, die einzige Stadt, die er kannte. Und wenn davon gesprochen wurde, daß diese Städte sehr entfernt waren, so rechnete er sich das so aus, daß sie wohl zweimal oder dreimal oder viermal soweit entfernt sein mochten, als seine heimatliche Finca Lumbojvil von Joveltó entfernt war. Dennoch war er sicher, daß die Städte auf jeden Fall noch innerhalb des Horizontes liegen müßten, denn dort war, wie jeder wußte, die Welt überhaupt zu Ende.
Ein anderer Carretero, den er im Portico des Cabildo, des Rathauses, traf und mit dem er gemeinschaftlich bei einer Indianerin, die hier auf einem kleinen öfchen aus Blech Tortillas und Frijoles wärmte, zu Abend aß, sagte ihm, daß am Ende der Reise der Carretas Arriaga liege und daß Arriaga die Eisenbahnstation sei. Und als Andres fragte, was das bedeute, da erklärte ihm der Carretero, daß da riesengroße Wagen die Waren aus fernen Ländern heranbringen, um auf die Carretas geladen und in das Innere des Landes geschafft zu werden. Er sagte ihm mehr. Er sagte ihm, daß diese Wagen viel größer seien als eine Carreta, daß ein Wagen so groß sei wie ein steinernes Haus und daß ein einziger Wagen so viel Güter enthalte, daß man damit vierzig oder gar fünfzig Carretas bis an den Rand volladen könne. Diese Wagen laufen auf Wegen, die aus Eisen gemacht sind, und vierzig solcher Wagen und noch viel, viel mehr werden von einem andern großen Wagen gezogen, der viel Rauch macht und mächtig stöhnt und schwitzt wie ein großes Tier. Und das heiße Ferrocarril, die Eisenbahn.
Das Wort Ferrocarril kannte Andres, er hatte es bei dem Lehrer schreiben gelernt. Aber der Lehrer konnte ihm die Sache nicht erklären, denn der Lehrer selbst hatte nie eine Eisenbahn gesehen, auch kein Bild von ihr, und er konnte sich keine Vorstellung von dem Dinge machen. Er mußte sich damit begnügen, daß die Schüler das Wort lernten und fehlerfrei zu schreiben wußten. Das Wort war in der Lesefibel. Aber weil Andres das Wort kannte und richtig schreiben konnte, so fühlte er sich mit dem Dinge in einer merkwürdigen Weise verwandt. Als ihm der Carretero die Eisenbahn, ihr Aussehen und ihr Stöhnen, Schwitzen, Husten, Bellen und Schnaufen beschrieb, kam es dem Jungen beinahe so vor, als ob er eine Ferrocarril wirklich schon einmal irgendwo gesehen hätte. Sie schien ihm nichts Fremdes, nichts Neues, nichts Unerwartetes, weil er ihren Namen, mit dem sie gerufen und bezeichnet wurde, kannte und sogar zu schreiben verstand. Trotz des Stöhnens und Brüllens des Ungeheuers erregte es in ihm keine Furcht. Ganz im Gegenteil, er wünschte, das Ungeheuer dicht vor sich zu sehen. Und er machte die Entdeckung, ohne sich des Vorganges bewußt zu werden, daß ein ungewöhnliches Ding zu kennen und seinen Namen zu wissen diesem ungewöhnlichen Dinge die Macht raubt, Schrecken zu verbreiten. Und daß er nicht nur den Namen wußte, sondern daß er diesen Namen sogar schreiben konnte, flößte ihm ein starkes Gefühl der Sicherheit ein und gab ihm ein Selbstbewußtsein, wie er es vorher nie in sich gekannt hatte.
Durch dieses an sich so unscheinbare innere Erlebnis, das er in diesen wenigen Minuten gehabt hatte, daß ein fürchterliches Ungeheuer, das der Carretero, um zu prahlen, viel fürchterlicher und schreckenerregender schilderte, als es in Wirklichkeit war, zu einem nüchternen Dinge zusammenschrumpft nur darum, weil man seinen Namen kennt und diesen Namen sich durch Schriftzeichen verständlich und sichtbar machen kann, überkam den Jungen wie mit einem Schlage das völlige Verständnis für den Wert, den Bildung hatte. Er hätte das niemand klarmachen können, was in ihm vorging. Er konnte es nur fühlen.
Und je mehr er darüber nachdachte, um so klarer wurde es für ihn, um so klarer wurde es um ihn, und um so klarer wurde mit einem Male die ganze Welt. Das Wort, das er kannte, erklärte und zergliederte ja das ganze Ding so völlig, daß nichts Geheimnisvolles mehr damit verknüpft war. Ferrocarril. Sehr deutlich. Ferro heißt Eisen, Carro heißt Wagen, Riel heißt Schiene; also ein Wägen aus Eisen, der auf Schienen läuft. Das alles war in dem Wort nur ein wenig verdunkelt, jedes Wort war gekürzt worden, um das ganze Wort nicht zu lang werden zu lassen.
Er kam dadurch auf den Gedanken, daß es wohl so mit allen Wörtern sei, daß jedes Wort jedes Ding und jeden Vorgang genau erklärt und die Geheimnisse der Dinge und Vorgänge sehr nüchtern auflöst. Er suchte in seinem Hirn nach einigen anderen Wörtern. Und richtig, es war, nach seiner rasch aufblitzenden Meinung, bei allen Wörtern so.