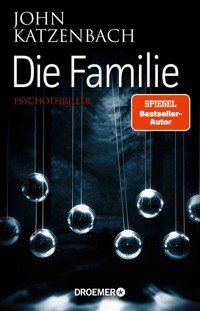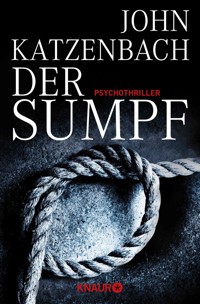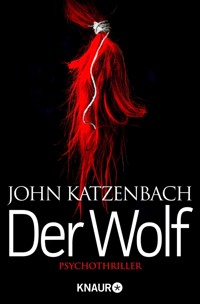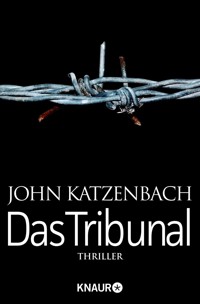
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Zweiter Weltkrieg, 1942: Der junge amerikanische Leutnant Thomas Hart wird mit seinem Flugzeug über Sizilien abgeschossen. Als Einziger überlebt er den Absturz und kommt in ein deutsches Kriegsgefangenenlager in Bayern. Als dort ein Mitgefangener ermordet wird, fällt der Verdacht auf den schwarzen Piloten Lincoln Scott. Hart, der vor seiner Einberufung Jura studiert hat, wird von einem Kriegsgericht im Lager zu dessen Verteidiger ernannt. Nun muss er sich nicht nur gegen seine Nazi-Bewacher behaupten, sondern auch gegen die weißen Rassisten in der eigenen Truppe zur Wehr setzen ... »Dieses berührende, kunstvoll gezeichnete Kriegsepos wird die Leser bis zum dramatischen Ende nicht loslassen.« Publishers Weekly
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 931
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
John Katzenbach
Das Tribunal
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Anke und Eberhard Kreutzer
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Zweiter Weltkrieg, 1942: Der junge amerikanische Leutnant Thomas Hart wird mit seinem Flugzeug über Sizilien abgeschossen. Als Einziger überlebt er den Absturz und kommt in ein deutsches Kriegsgefangenenlager in Bayern. Als dort ein Mitgefangener ermordet wird, fällt der Verdacht auf den schwarzen Piloten Lincoln Scott. Hart, der vor seiner Einberufung Jura studiert hat, wird von einem Kriegsgericht im Lager zu dessen Verteidiger ernannt. Nun muss er sich nicht nur gegen seine Nazi-Bewacher behaupten, sondern auch gegen die weißen Rassisten in der eigenen Truppe zur Wehr setzen …
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Epilog
Anmerkung des Autors
Für Nick, Justine, Cotty, Phoebe, Hugh und Avery
Prolog
Der Nachthimmel
Er war alt, doch noch immer reizte ihn das Risiko.
Am Horizont zählte er drei Wasserhosen, die aus der glatten blauen Meeresfläche am Rande des Golfstroms in die bleigrauen Wolken ragten – Vorhut der abendlichen Gewitterstürme auf ihrem Weg nach Westen. Die schmalen, dunklen Kegel wirbelten mit der gleichen Wucht wie die Tornados zu Lande. Nur an Heimtücke konnten sie sich nicht mit ihren Verwandten messen, die gespenstisch schnell wie aus dem Nichts auftauchten. Über dem Meer entstanden diese Gebilde, wenn sich Hitze, Wind und Wasser zusammenbrauten und von der Wolkenmasse angezogen wurden. Dem alten Mann schienen sie gemächlich über die Wellen zu wandern. Da sie weithin sichtbar waren, konnte man sich rechtzeitig vor ihnen in Sicherheit bringen – das hatten die anderen Fischer im Randgebiet des Stroms aus wärmeren karibischen Gewässern längst getan und ihre Boote vertäut. So schaukelte am Ende nur noch der alte Mann draußen auf See im Takt der Wellen auf und nieder. Der Motor war abgeschaltet; die beiden Schwimmer an der ausgeworfenen Angelrute lagen reglos auf dem tintenblauen Wasser.
Die drei Trichter waren vielleicht fünf Meilen entfernt, doch der Wind, der in ihrem Innern mit über zweihundert Meilen tobte, konnte diese Distanz mühelos überwinden. Je länger er die grauen Schläuche zwischen Himmel und Meer beobachtete, desto schwereloser, schneller und agiler schienen sie ihm – wie zwei Tänzer, die im Wettstreit um eine schöne junge Frau in immer rasanteren Figuren und Schritten einander auszustechen versuchten. Hielt einer plötzlich an, während die anderen beiden langsam ihre Kreise zogen, preschte der Wartende Sekunden später ohne Vorwarnung voran, so dass der zweite mit einem Satz zur Seite sprang. Wie ein Menuett an einem Fürstenhof der Barockzeit, dachte der alte Mann. Er schüttelte den Kopf. Das traf es nicht ganz. Er betrachtete das Schauspiel genauer. Eher ein Squaredance in einer Scheune, zu fröhlicher Fiedelmusik? Ein Wimpel an einem der Ausleger knatterte in einer kräftigen Böe und war ebenso schnell verstummt, als habe er wie die anderen Boote aus Furcht vor dem tosenden Wind, der unaufhaltsam näher kam, die Flucht ergriffen.
Der alte Mann zog scharf die Luft ein.
Keine fünf Meilen, eher drei.
Trieb sie der Übermut in seine Richtung, waren die Zyklone in wenigen Minuten da. Selbst wenn sein offener Kutter mit zweihundert PS und fünfunddreißig Knoten über den Ozean schoss, wäre es schon zu spät. Hatten die tosenden Wirbel es auf ihn abgesehen, war er leichte Beute.
Mit ihrem Rhythmus und ihren Synkopen wirkte die Tanzformation elegant, aber auch ausgelassen. Einen Moment lang horchte er angestrengt in die Stille, als müsse der Wind ferne Musik herübertragen, die wilden Klänge von Posaunen und Trompeten, von Drums und treibenden Bässen, von fetzigen Gitarrenriffs. Er legte den Kopf in den Nacken. Der blaue Himmel hatte sich verdüstert; geballte schwarze Gewitterwolken fegten auf ihn zu. Big-Band-Musik, Jimmy Dorsey und Glenn Miller, dass er nicht eher darauf gekommen war. Die Musik seiner Jugend. Von Lebenshunger strotzender Jazz, schmachtende Bläserklänge.
Ein Donnerschlag riss ihn aus den Erinnerungen. Er fuhr mit dem Kopf herum und sah den Blitz, der über dem Ozean zuckte. Zugleich spürte er, wie der Wind langsam, aber stetig zunahm, hörte das Knattern der Takelage und der Wimpel. Wieder wandte er den Blick zu den Zyklonen. Zwei Meilen, stellte er fest.
Wenn er blieb, war er fällig. Wollte er seine Haut retten, wurde es allerhöchste Zeit.
Er schmunzelte. Deine Zeit ist noch nicht gekommen.
Blitzschnell drehte er den Zündschlüssel an der Konsole. Als sei er über den Leichtsinn empört, mit dem der alte Mann sein Leben im letzten Moment den Launen der Technik überließ, sprang der Johnson-Motor mit dumpfem Grollen an.
Er wendete in einem Halbkreis und kehrte dem Gewitter den Rücken. Die ersten Tropfen prasselten auf ihn nieder und hinterließen auf seinem blauen Jeanshemd dunkle Flecken, während er den Regen auf den Lippen schmeckte. Mit wenigen Sätzen war er im Heck des Bootes und holte die beiden Angelschnüre mit den Ködern ein. Einen letzten Moment lang zögerte er und warf einen prüfenden Blick auf die Wasserhosen. Jetzt reckten sich die Riesen, nur noch eine Meile entfernt, bedrohlich in die Höhe, als hielten sie beim Anblick des Winzlings zu ihren Füßen, der sich ihnen dreist widersetzte, vor Staunen an. Das Meer hatte von Blau zu Bleigrau gewechselt, das mit der düsteren Wolkenmasse verschmolz.
Als der nächste Donnerschlag explodierte, diesmal näher und laut wie ein Kanonenschuss, lachte er nur.
»Fang mich doch, wenn du kannst!«, brüllte er lachend in den Wind. »Ein andermal vielleicht.«
Dann gab er Vollgas. Der Motor machte ein Geräusch wie ein schallendes, höhnisches Gelächter, in rasender Fahrt hob sich der Bug, und das Boot hüpfte über die Wellentäler, um nach wenigen Meilen die stilleren Gewässer unter klarerem Himmel dicht an der Küste zu erreichen, bevor der lange Sommertag im letzten Licht der Abendsonne zur Neige ging.
Wie gewohnt blieb er noch bis lange nach Einbruch der Nacht draußen auf dem Wasser. Das Gewitter hatte sich aufs offene Meer verzogen und machte dort vielleicht dem einen oder anderen großen Containerschiff zu schaffen, das auf den Florida Straits seine Bahnen zog. An der Küste hatte es aufgeklart, am nächtlichen Himmel funkelten die ersten Sterne. Dabei spürte er selbst hier auf dem Wasser die schwüle Luft wie einen dünnen Film auf der Haut. Seit Stunden angelte er nicht mehr, sondern saß, eine halb leere Flasche gekühltes Bier in der Hand, auf einer Kühlbox. Nach seinem kleinen Abenteuer rief er sich ins Gedächtnis, dass sein Motor jederzeit den Geist aufgeben konnte oder er nicht mehr schnell genug an der Zündung war und ein solches Gewitter ihm eine letzte Lektion erteilen würde. Doch er zuckte nur mit den Achseln. Das Leben hatte es überaus gut mit ihm gemeint, ihn mit Erfolg und allem anderen, was der Mensch sich nur wünschen konnte, reichlich gesegnet – noch dazu durch ein schier unglaubliches Zusammenfallen von Ereignissen.
Wenn man nach allen Regeln der Wahrscheinlichkeit hätte tot sein müssen, war das Leben von da an leicht.
Der alte Mann drehte sich um und blickte Richtung Norden, wo er – in einer Entfernung von fünfzig Meilen – gerade noch die schimmernden Lichter von Miami erkennen konnte. Dabei herrschte in seiner Umgebung eine Dunkelheit, die dank der Hitze und Luftfeuchtigkeit in Florida wie Tinte zu zerfließen schien. Zuweilen sehnte er sich nach den klaren, strengen Nächten in seinem Heimatstaat Vermont. Dort spannte sich die Nacht straff über den Himmel.
Für diesen Moment harrte er draußen auf dem Wasser aus, für diesen Blick in die unendliche Weite über ihm, fernab der Lichter und des Lärms der Stadt: der Polarstern, die Sternenkonstellationen, die ihm so vertraut waren wie der Atem seiner schlafenden Frau. Er blickte von einem zum anderen und fand in ihrer Beständigkeit Trost. Orion und Kassiopeia, das Sternbild des Widders. Den Helden Herkules und Pegasus, das geflügelte Pferd. Die beiden Himmelswagen – am einfachsten zu erkennen, sie waren die ersten Sternbilder, die er sich als Kind vor über siebzig Jahren eingeprägt hatte.
Er atmete den nächtlichen Dunst tief ein und sagte laut mit tiefer, kehliger Stimme und schleppendem Südstaatenakzent, mit der Stimme eines Mannes, den er vor langer Zeit gut, wenn auch nicht lange gekannt hatte:
»Bring uns nach Hause, Tommy, okay?«
Das war fünfzig Jahre her, doch den melodischen Tonfall, das Schmunzeln, das selbst über die Bordsprechanlage und bei dem ohrenbetäubenden Dröhnen der Turbinen und dem Geknatter des Flakfeuers zu hören war, hatte er immer noch im Ohr.
Und so wie damals Dutzende Male antwortete er laut: »Nur keine Bange! Zur Basis finde ich im Schlaf zurück.«
Er schüttelte den Kopf. Bis auf das letzte Mal. Da hatte ihnen sein ganzes Arsenal, von Funkmess- und Radarwarngeräten über Koppelnavigation bis hin zur Positionsbestimmung mit Oktant, nichts genützt. Wieder hörte er die Stimme. »Bring uns nach Hause, Tommy, okay?«
Tut mir leid, sagte er zu den Toten. Statt nach Hause habe ich euch ins Grab gebracht.
Er nahm noch einen Schluck Bier, dann hielt er sich das kühle Glas der Flasche an die Stirn. Mit der freien Hand griff er sich in die Hemdtasche, um eine gefaltete Seite aus der neuesten Ausgabe der New York Times hervorzuziehen. Als er das Papier an den Fingern spürte, zuckte er zurück. Er brauchte es nicht noch einmal zu lesen, die Überschrift würde er nie vergessen: BERÜHMTERPÄDAGOGE, EINFLUSSREICHERBERATERDEMOKRATISCHERPRÄSIDENTEN, MITSIEBENUNDSIEBZIGJAHRENGESTORBEN.
Somit bin ich der Letzte, der weiß, was wirklich passiert ist.
Er holte tief Luft. Plötzlich kam ihm eine Unterhaltung mit seinem Enkel in den Sinn. Dieser war kaum älter als elf und war mit einem Foto zu ihm gekommen. Es gehörte zu den wenigen Aufnahmen aus seiner eigenen Jugend, als er nur wenige Jahre älter als der Junge war. Auf dem Bild saß er an einem Gusseisenofen in ein Buch vertieft. Im Hintergrund war seine Holzpritsche zu erkennen. An einem Strick, der als Wäscheleine diente, hingen ein paar einfache wollene Kleidungsstücke. Auf dem Tisch neben ihm stand eine Kerze, die nicht brannte. Er war spindeldürr, sein Haar sehr kurz geschnitten. Er lächelte ein wenig, als läse er gerade etwas Amüsantes.
»Von wann stammt das Bild, Großvater?«
»Aus dem Krieg. Als ich Soldat war.«
»Als was?«
»Ich war Navigator. An Bord eines Bombers. Jedenfalls eine Weile. Danach war ich nur noch Gefangener und hab darauf gewartet, dass der Krieg zu Ende geht.«
»Hast du als Soldat jemanden getötet, Großvater?«
»Also, ich hab dabei geholfen, die Bomben abzuwerfen. Die haben wahrscheinlich Menschen getötet.«
»Aber du weißt es nicht?«
»Nein. Mit Sicherheit weiß ich es nicht.«
Doch das war natürlich gelogen.
Stumm wiederholte er die Frage seines Enkels: »Hast du jemanden getötet, Großvater?«
Und dann die ehrliche Antwort: Ja. Ich habe einen Mann getötet. Und zwar nicht bei einem Bombenabwurf aus der Luft. Doch das war eine lange Geschichte.
Durch den Stoff seiner Hemdtasche fühlte er den Zeitungsausschnitt mit dem Nachruf.
Und jetzt kann ich sie erzählen, dachte er.
Mit einem tiefen Seufzer starrte der alte Mann erneut in den Himmel. Dann suchte er in der nächtlichen Dunkelheit nach der schmalen Einfahrt zum Jachthafen Whale Harbor. Die Navigationsbojen kannte er ebenso im Schlaf wie sämtliche Lichter, die wie eine Kette die Küste Floridas markierten. Hier war er mit den Strömungen ebenso vertraut wie mit den Gezeiten, und an der Art, wie das Boot durchs Wasser glitt, merkte er, ob es auch nur geringfügig vom Kurs abkam. Langsam, doch mit schlafwandlerischer Sicherheit wie in seinem eigenen Haus fand er im Dunkeln den Weg.
1
Der Alptraum des Navigators
Genau in dem Moment, als der Tunnel unter Baracke 109 einbrach, wachte er auf. Der Morgen graute, und seit Mitternacht waren heftige Schauer niedergeprasselt. Es war immer derselbe Traum, immer wieder durchlebte er darin, was vor zwei Jahren geschehen war – von Anfang bis Ende täuschend real.
Im Traum sah er den Konvoi nicht.
Im Traum riet er den anderen nicht, umzukehren und anzugreifen.
Im Traum wurde niemand erschossen, niemand starb in seinem Traum.
Raymund Thomas Hart, ein spindeldürrer, stiller, unscheinbarer Mann, nach seinem Großvater und Vater der Dritte in der Familie, der – mit derselben ungewöhnlichen Schreibung – den Namen des Heiligen trug, lag mit angewinkelten Beinen im Dunkeln auf seiner Pritsche. Er spürte den Schweiß an Hals und Schultern, obwohl es auch nach Frühlingsanbruch in den Nächten empfindlich kalt war. Wenige Sekunden, bevor die Holzstützen in zweieinhalb Metern Tiefe unter dem Gewicht der regengetränkten Erde einbrachen und plötzlich von allen Seiten die Pfiffe und Rufe der Wachen ertönten, horchte er auf den schweren Atem und das Schnarchen der Männer in den Betten neben ihm. Er teilte die Stube mit sieben Kameraden. Jeden erkannte er an den Geräuschen, die sie nachts von sich gaben. Einer von ihnen redete im Schlaf und erteilte den längst toten Soldaten unter seinem Kommando Befehle; ein anderer wimmerte oder weinte. Ein dritter hatte bei feuchter Witterung Asthma und quälte sich keuchend bis zu den Morgenstunden. Tommy Hart zitterte und zog sich die dünne Decke unters Kinn.
Wie bei einem Kinofilm ließ er jeden Moment des Traums noch einmal Revue passieren. Im Traum flogen sie vollkommen geräuschlos, ohne den Lärm der Turbinen, wie unter Wasser, bis über Bordfunk der sonore Singsang des Captains erklang: »Zum Teufel, Jungs, worauf sollen wir da draußen schießen? Schade um die Munition. Bring uns nach Hause, Tommy, okay?«
Im Traum blickte er dann geübt auf seine Karten, Messschieber und Windrichtungsanzeiger und sah, wie mit einem dicken roten Tintenstrich quer über die blauen Wellen des Mittelmeers gezeichnet, die Route zum Fliegerhorst. Den Weg aus der Gefahr.
Wieder zitterte Tommy Hart.
Auch wenn er mit offenen Augen in die Dunkelheit starrte, sah er, wie sich die Sonne in den weißen Schaumkronen unter ihnen brach. Einen Moment lang wünschte er sich, seinen Traum wahr machen und die Realität in den Traum verbannen zu können – ein glatter Tausch. War das vielleicht zu viel verlangt? Er musste sich nur an den Dienstweg, die Hierarchie der Armeeverwaltung halten. Dann die Hacken zusammenschlagen und dem Kommandeur das Ersuchen zur Unterschrift vorlegen. Versetzung, Sir, eines Traums in die Realität, einer Realität in den Traum.
In Wahrheit war er, als er den Befehl des Captains hörte, in die Plexiglasnase der B-25 gekrochen, um ein letztes Mal zu sehen, ob er vor der sizilianischen Küste einen Orientierungspunkt entdecken konnte, den letzten Beweis für seine Positionsbestimmung. Im Tiefflug rasten sie mit zweihundert Meilen pro Stunde gerade mal sechzig Meter über dem Meer und damit außer Reichweite jedes deutschen Radars. Sechs junge Männer hätten mit einem Feuerstuhl unter dem Hintern auf einer kurvenreichen Landstraße einen Mordsspaß haben und jede Hemmung wie das Gummi, das von ihren quietschenden Reifen fetzte, hinter sich lassen sollen. Doch so war es nicht. Es war vielmehr riskant wie Schlittschuhlaufen auf der dünnen Eisdecke eines zugefrorenen Teichs, die mit jedem Schritt unter ihnen einbrechen konnte.
Er hatte sich neben dem Bombenvisier bis zur Bugbewaffnung mit den Zwillingsmaschinengewehren Kaliber fünfzig in die Nase gezwängt. Einen Moment lang fühlte es sich so an, als jagte er mit Höchstgeschwindigkeit allein über die endlose Weite der blauen Wellen, losgelöst vom Rest der Welt. Er suchte den Horizont nach irgendetwas ab, das er wiedererkannte und auf seiner Karte als Anhaltspunkt markieren konnte, um ihre Position zu bestimmen und den Weg zur Basis zurückzufinden. In den meisten Fällen verließen sie sich auf Koppelnavigation.
Doch statt der Gebirgsformation oder dergleichen entdeckte er im äußersten Augenwinkel die Umrisse eines Handelsschiffs im Geleitschutz zweier Zerstörer, die es im Zickzackkurs bewachten wie Hütehunde eine Herde.
Für einen kurzen Augenblick hatte er geschwiegen und blitzschnell ein paar Berechnungen angestellt. Sie waren seit über vier Stunden in der Luft und die Zeit für ihren Einsatz fast vorbei. Die Besatzung war müde und hatte nur den einen Wunsch, zum Stützpunkt zurückzukehren. Selbst für drei Jagdbomber, die Flügel an Flügel in der Mittagssonne dahinflogen, waren die beiden Zerstörer ernstzunehmende Gegner. Er sagte sich: Sieh einfach weg, halte den Mund, und in wenigen Sekunden sind die drei Schiffe außer Sicht. Niemand wird je davon erfahren.
Doch stattdessen tat er, was man ihm beigebracht hatte, während seine innere Stimme ihm wie die eines Fremden klang.
»Captain, feindliche Ziele etwa fünf Meilen vor Steuerbordflügel.«
Es herrschte kurzes Schweigen, dann kam die Antwort. »Ich fress ’n Besen, Tommy, was bist du doch für ein schlaues Bürschlein. Du kommst mit mir nach Westtexas, und ich nehm dich mit auf die Jagd. Hast Augen im Kopf wie ein Luchs, Tommy. Deinem scharfen Blick entkommt kein Hase zehn Meilen gegen den Wind. Und dann schlagen wir uns den Bauch mit frischem Hasengulasch voll. Gibt nichts Köstlicheres als texanischen Hasen, Jungs …«
Was der Captain sonst noch sagte, ging in der Hektik unter, als Tommy Hart durch den schmalen Durchgang wieder nach hinten kroch und der Bombenschütze seine Stelle in der Nase einnahm. Er merkte, wie die Lovely Lydia leicht nach rechts in Schräglage ging, und wusste, dass The Randy Duck zu ihrer Linken und die Green Eyes an ihrem Steuerbordflügel genau dasselbe taten. In der Kanzel kehrte er auf seinen kleinen Stahlstuhl hinter dem Piloten und dem Kopiloten zurück und betrachtete wieder seine Karten. Er würde nie vergessen, wie er in diesem Moment dachte: Das ist der schlimmste Moment in meinem Leben. Er hätte liebend gerne mit dem Bombenschützen getauscht, doch sie waren der Schwarmführer und hatten deshalb für diesen Lufteinsatz ein Besatzungsmitglied mehr. Wenn er aufstand, konnte er zwischen den beiden Männern bis nach vorne schauen, doch er wusste, dass er damit bis zum letzten Moment warten würde. Manchen Fliegern gefiel es, wenn sie das feindliche Ziel näher kommen sahen. Für ihn war es immer so gewesen, als starrte er dem Tod ins Auge.
»Bombenschütze? Alles klar?« Die Stimme des Captains war jetzt ein wenig lauter, doch immer noch ungerührt. »Zeigen wir’s den Jungs da unten. Ein einziger sauberer Treffer genügt, und unsere kleine Spritztour hat sich gelohnt.« Sein Lachen hallte in der Sprechanlage. Der Captain war beliebt; in den brenzligsten Situationen behielt der Mann seinen Galgenhumor. Mit seinem behäbigen texanischen Singsang, der nie die leiseste Spur von Erregung oder Angst zu erkennen gab, machte er auch den anderen Mut, selbst wenn ihnen die Flak Zunder gab und rotglühende Metallsplitter gegen den Stahlrumpf der Mitchell krachten wie die Fäuste eines wütenden Nachbarn an die Tür. Die weniger offensichtlichen Ängste, so viel hatte Tommy längst begriffen, waren nicht zu besiegen.
Tommy Hart kniff die Augen zusammen, als könnte er so die Erinnerungen verbannen. Es ging nicht. Es ging nie.
Jetzt hörte er wieder die Stimme des Captains: »Also, Jungs, dann mal los. Wie sagen unsere englischen Freunde noch so schön? ›Tally-ho!‹ Kann mir einer von euch verraten, was in Teufels Namen das heißen soll?«
Im selben Moment fuhr der Pilot die beiden Vierzehn-Zylinder-Wright-Cyclone-Doppelsternmotoren so weit hoch, dass sie aufheulten und die Tachonadel weit über die rote Linie schnellte. Die Höchstgeschwindigkeit der Maschine lag eigentlich bei zweihundertvierundachtzig Meilen pro Stunde, doch Tommy Hart wusste, dass sie die weit überschritten hatten. So gut sie konnten, flogen sie mit der Sonne im Rücken, aber so tief am Horizont, dass sie, fürchtete er, jedem Geschütz im Konvoi eine deutliche Zielscheibe boten.
Das erste Mal zitterte die Lovely Lydia, als sich die Bombenluken öffneten; das zweite Mal bebte sie unter dem Feuersturm der gegnerischen Waffen. Schwarze Schwaden hüllten sie ein, und die Motoren kreischten trotzig auf. Auf dem rasanten Sturzflug brüllte der Kopilot ihnen etwas Unverständliches zu. Tommy sprang vom Sitz auf, klammerte sich an einen Stahlgriff und starrte aus dem Cockpitfenster, wo er für den Bruchteil einer Sekunde einen der deutschen Zerstörer erblickte, der bei seiner scharfen Wende einen weißschäumenden Strudel hinter sich ließ.
Der erste Treffer. Der zweite Treffer: Die Lovely Lydia schoss in Schräglage durch die Luft. Tommy Hart beobachtete, wie die Schiffsformation alles daransetzte, aus der Ziellinie der Jagdbomber zu kommen. Seine Kehle wurde staubtrocken, doch tief aus seinem Innern stieg ein Laut auf, halb Stöhnen, halb Schrei.
»Lasst sie abhauen!«, brüllte er, doch im Getöse der Motoren und im Knallen der Flakgeschosse gingen seine Worte unter. Sie hatten sechs Fünfzentnerbomben an Bord. Die Angriffsstrategie auf einen Schiffskonvoi erinnerte entfernt an eine Kirmesschießbude, wo hintereinander weg auf eine Reihe Blechenten geballert wurde, nur dass die Enten das Feuer nicht erwiderten. Der Schütze ignorierte das Norden-Bombenzielgerät, das ohnehin nicht zuverlässig funktionierte, nahm stattdessen jedes Ziel mit bloßem Auge ins Visier, warf eine Bombe ab, riss das Buggeschütz mit der tödlichen Ladung zum nächsten Objekt herum. Es ging furchterregend schnell.
Machte er seine Sache gut, sprangen die Bomben beim Aufprall auf der Wasserfläche einmal in die Höhe und donnerten dann wie eine Bowlingkugel ins Zielobjekt. Der Schütze war gerade einmal zweiundzwanzig, mit einem frischen rotwangigen Gesicht. Auf der Farm in Pennsylvania, auf der er groß geworden war, hatte er in den dichten Wäldern von klein auf Rotwild gejagt, und so war er wirklich gut, sehr kühl und konzentriert, ohne zu merken, dass sie jede Sekunde, in der sie ihre todbringende Mission erfüllten, dem eigenen Tod entgegenrasten.
»Einer getroffen!«, meldete die Stimme aus der Plexiglasnase über die knisternde Sprechanlage wie von ferne. »Zwei versenkt! Drei!« Die Lovely Lydia rappelte jetzt unter dem heftigen Beschuss, unter dem Abwurf der eigenen Bomben und dem Flugwind, der an den Tragflächen zerrte, vom Bug bis zum Heck. »Alle versenkt! Bringen Sie uns hier raus, Captain!«
Der Captain zog den Steuerknüppel zurück und riss die Maschine hoch. »Heckschützenstand! Wie sieht’s aus?«
»O mein Gott, Captain! Mein Gott! Sie haben die Duck erwischt! Mein Gott, nein! Die Green Eyes auch!«
»Keine Bange, Jungs«, erwiderte der Captain. »Zum Abendessen sind wir zu Hause. Tommy, schau mal nach. Sag mir, was du dahinten siehst!«
Die Lovely Lydia hatte an der Decke eine kleine Plexiglaskuppel als Spähposten für den Navigator, auch wenn Tommy lieber in die Bugnase kroch. Auf einer kleinen Stahlleiter stieg er in die Kuppel und sah die gewaltigen schwarzen Rauchsäulen, die aus einem halben Dutzend Schiffen im Konvoi aufstiegen, und einen gewaltigen roten Glutball, als ein Öltanker explodierte. Doch ihm blieb nur ein flüchtiger Moment, um den Erfolg ihrer Attacke zu begutachten, denn was er als Erstes sah, versetzte ihn in größere Panik als alles, was er während des Bombardements durchgemacht hatte. Die orangeroten Flammen, die er sah, schlugen eindeutig aus dem Backbordmotor und züngelten quer über den Flügel.
»Backbord! Backbord! Feuer!«, brüllte er.
Worauf der Captain in aller Ruhe antwortete: »Ich weiß, dass sie brennen, guter Job, Schütze …«
»Nein, verdammt! Wir brennen, Captain!«
Aus der Motorhaube schlugen immer mehr Flammen und bildeten graue Schwaden am blauen Himmel. Das war’s dann wohl, dachte Tommy. In ein, zwei Sekunden, vielleicht auch fünf oder zehn, erreichen die Flammen die Treibstoffleitung, prasseln in den Tragflächentank, und wir explodieren.
Und im selben Moment wich die Angst. Was für ein Gefühl, etwas unmittelbar vor Augen zu haben, gegen das man machtlos ist, und dabei klar zu sehen, was es bedeutet – den eigenen Tod. Ein kurzer Anflug von Frustration, dass er nicht das Geringste machen konnte, dann fügte er sich in sein Schicksal. Zugleich erfasste ihn eine seltsame, vage Einsamkeit; er hatte Mitleid mit seiner Mutter, seinem Bruder, der irgendwo im Pazifik war, mit seiner Schwester und ihrer besten Freundin, die daheim in Manchester in derselben Straße wohnte und die er so inbrünstig liebte, dass es weh tat; er dachte daran, wie sie alle viel schlimmer und ungleich länger leiden würden als er, denn für ihn und die übrige Besatzung wäre es gleich mit einem einzigen Knall für immer vorbei. Mitten in seine Gedanken hinein hörte er ein letztes Mal die ruhige Stimme des Captains: »Gut festhalten, Jungs, wir versuchen zu wassern!« Im selben Moment raste das Flugzeug im Sturzflug auf die Wellen zu, ihre letzte Überlebenschance: ins Wasser tauchen und die Flammen löschen, bevor die Maschine explodierte.
Dann folgte dieses ohrenbetäubende Kreischen, er konnte sich an kein einziges Wort erinnern, auch an kein Geräusch von dieser Welt, sondern nur an diesen gnadenlos schrillen Laut wie aus einem Höllenkreis. Für den Fall einer Notwasserung hatte er sich immer wieder ausgemalt, wie er sich hinter der stahlverstärkten Rückenlehne des Kopilotensitzes verschanzen würde, doch er kam nicht mehr so weit. Vielmehr umklammerte er verzweifelt ein Rohr an der Decke, während er – wie ein gewöhnlicher Pendler in einem Waggon der New Yorker Subway an der Halteschlaufe – mit fast dreihundert Meilen pro Stunde auf die blaue Wasserfläche des Mittelmeers zuraste.
Bei diesen Bildern durchfuhr ihn auf seiner Pritsche unter der dünnen Decke wieder ein Schauder.
Als wäre es eben erst passiert, hörte Tommy den Hilfeschrei des Sergeant vorne in der Plexiglasnase. Tommy machte einen taumelnden Schritt in seine Richtung, denn er wusste, dass er in seinem Sitz feststeckte, da durch den heftigen Aufprall seine Gurtschnalle klemmte. Doch im selben Moment brüllte ihm der Captain zu: »Raus hier, Tommy! Nichts wie raus! Ich helfe dem Jungen!« Kein Laut von den anderen Männern. Der Befehl des Captains war das Letzte, was er von den Besatzungsmitgliedern der Lovely Lydia hörte. Zu seinem Staunen ging die Seitenluke tatsächlich auf, und seine Schwimmweste füllte sich prall mit Luft, so dass er wenig später wie ein Korken auf dem Wasser schwamm. Er hatte sich mit den Händen von der Maschine abgestoßen und dann zu den anderen umgedreht, die wie er aus dem Flugzeug klettern mussten. Doch niemand kam.
»Kommt raus!«, rief er ihnen zu, »Kommt da raus! Bitte kommt raus!«
Und dann hatte er sich auf den Wellen treiben lassen und gewartet.
Wenige Sekunden später war die Lovely Lydia, mit der Nase zuerst, vornüber gekippt und lautlos untergegangen. Er war in der Weite des Meers allein.
Er hatte das nie begriffen: Der Captain, der Kopilot, der Bombenschütze und die beiden Bordschützen waren ihm immer viel schneller und aufgeweckter erschienen als er. Sie waren alle jung und sportlich, ein bestens ausgebildetes, eingespieltes Team. Nicht nur an den Maschinengewehren landeten sie ihre Treffer, sondern auch daheim auf dem Basketballplatz hängten sie jeden Gegner ab. In seinen Augen waren sie die echten Krieger an Bord der Lovely Lydia gewesen, er selbst dagegen nur der erbärmliche Bücherwurm, der dünne, linkische Student, der weniger aus patriotischer Gesinnung zum Navigator geworden war, sondern weil er gut mit Zahlen und dem Rechenschieber umgehen konnte und weil er als Kind zu Hause in Vermont stundenlang in den sternklaren Nachthimmel gestarrt hatte. Bestenfalls sah er sich als Teil der Ausrüstung, als Zubehör, während die anderen echte Flieger, echte Todesschützen, kampferprobte Männer waren.
So war es ihm ein Rätsel, dass ausgerechnet er überlebt und die viel stärkeren Männer umgekommen waren.
Fast vierundzwanzig Stunden lang trieb er allein auf See, bis ihn, verzweifelt und am Rande des Deliriums, ein italienisches Fischerboot entdeckte und aus dem Wasser zog. Zu seiner Verwunderung waren die rauhbeinigen Männer sehr behutsam mit ihm umgegangen, hatten ihn in eine Decke gehüllt und ihm ein Glas Rotwein zu trinken gegeben. Er würde nie vergessen, wie ihm der Alkohol heiß die Kehle hinunterrann. An Land hatten sie ihn pflichtgemäß den Deutschen übergeben.
So war es wirklich gewesen, doch in seinem Traum wich die Realität einem glücklicheren Ausgang: Sie hielten sich alle unter einem Flügel der Lovely Lydia über Wasser, vertrieben sich das Warten mit Witzen über die arabischen Kaufleute in der Umgebung ihres nordafrikanischen Stützpunktes und überboten sich mit Zukunftsplänen für die Zeit nach ihrer Rückkehr in die Staaten. Als sie noch am Leben gewesen waren, hatte er manches Mal gedacht, dass er vielleicht nie wieder so enge Freunde haben würde wie die Männer an Bord ihres Fliegers und wie traurig es wäre, wenn sie sich, nachdem der Krieg vorbei war, nie wiedersehen würden. Kein einziges Mal war ihm die Möglichkeit in den Sinn gekommen, sie könnten sich vielleicht nie wiedersehen, weil sie alle tot waren und er als Einziger überlebte – ein Ding der Unmöglichkeit.
Auf seiner Pritsche dachte er: Sie werden für immer bei mir sein.
Als ein anderer Gefangener im Schlaf die Stellung wechselte, knarrten die Holzlatten unter ihm, so dass die Worte, die er murmelte, darin untergingen und nur Laute wie von Klageweibern zu ihm herüberdrangen.
Ich habe es überlebt, und sie sind tot.
Wie oft hatte er seitdem seine Augen verflucht, die in dem Moment, als sie diesen Konvoi erspähten, den Tod seiner Kameraden besiegelten. Er wurde die Zwangsvorstellung nicht los, dass sie alle noch lebten, wäre er nur statt mit diesem Adlerblick blind auf die Welt gekommen. Natürlich wusste er, dass solche Gedanken sie nicht wieder lebendig machten. Stattdessen leistete er im Stillen einen feierlichen Eid: Sollte er den Krieg überleben, dann würde er mit einem Jagdgewehr quer durch Amerika bis nach Westtexas fahren, um dort tief im Buschland und in den trockenen Schluchten texanische Hasen abzuschießen. Jeden Hasen, so weit das Auge reichte; in einem meilenweiten Umkreis jeden Hasen. Er stellte sich vor, wie er Dutzende, Hunderte, Tausende erlegte, das große Hasenschlachten – wie die Tiere so lange rings um ihn krepierten, bis er keine Munition mehr hatte und er zu Boden ging. So viele tote Texashasen, dass sein Captain in alle Ewigkeit genug davon hatte.
An Schlaf war nicht mehr zu denken.
Er legte sich auf den Rücken und horchte auf den Regen, der wie Gewehrsalven auf das Blechdach prasselte – und mitten in dieses Geräusch hinein ein fernes, dumpfes Rumpeln. Kurz darauf schrilles Pfeifen, dann hektisches Gebrüll von wütenden deutschen Wachposten des Gefangenenlagers. Er saß schon auf der Pritschenkante und schlüpfte in seine Stiefel, als es an die Barackentür donnerte und einer der Wachen schrie: »Raus! Raus! Schnell!« Auf dem Appellplatz war es zweifellos kalt, und so griff Tommy Hart nach seiner ledernen Fliegerjacke. Die anderen Männer zogen sich hastig die wollene Unterwäsche an und schnürten die rissigen, abgetragenen Stiefel zu, während das allererste Morgengrauen durch die schmutzigen Barackenfenster sickerte. In seiner Hast, zum Appell bereit zu sein, verlor er die Lovely Lydia und ihre Crew aus dem Auge. Sie glitten zurück in seine Erinnerung, während er sich den Männern anschloss, die aus den Baracken des Stalag Luft 13 in die nasskalte Morgenluft strömten.
Second Lieutenant Tommy Hart verlagerte im aufgeweichten Lehm des Appellplatzes unruhig sein Gewicht von einem Bein aufs andere. Die Missstimmung war aufgekommen, kurz nachdem sie angetreten waren. Jetzt empfingen die Gefangenen jeden Aufseher, der an ihnen vorbeikam, mit Buhrufen und Beschwerden.
Die meisten Deutschen schenkten ihnen keine Beachtung. Hier und da drehte sich ein Hundeführer um und tat so, als wolle er das zähnefletschende Tier an seiner Seite auf die Meute der murrenden Soldaten hetzen, was die erhoffte Wirkung nicht verfehlte und die Männer zum Schweigen brachte, jedenfalls für ein paar Minuten. Der Lagerkommandant, Luftwaffenoberst Eduard von Reiter, hatte die Formationen bereits Stunden zuvor in höchster Eile abgeschritten und war nur ein einziges Mal stehen geblieben, als ihn der Oberbefehlshaber der Amerikaner, Colonel Lewis MacNamara ansprach und wie im Schnellfeuer mit Protesten bombardierte. Von Reiter hörte MacNamara vielleicht dreißig Sekunden an, bevor er mit einem flüchtigen Salut – die Reitgerte tippte an den Schirm seiner Mütze – dem Colonel Weisung gab, vor den Reihen seiner Männer wieder Aufstellung zu nehmen. Ohne die Reihe der Luftwaffenoffiziere eines einzigen Blickes zu würdigen, war von Reiter zu Baracke 109 geeilt.
So standen die Kriegsgefangenen immer noch unter Gemurmel und Füßestampfen auf dem Platz, als es längst taghell war. Das Warten war so öde wie ermüdend, so vertraut wie verhasst. Im Lager waren fast zehntausend Kriegsgefangene – oder »Kriegies«, wie sich sich nannten – untergebracht, fast zu gleichen Teilen auf das südliche und das nördliche Gelände verteilt; sämtliche Gefangene der US-Luftwaffe – ausnahmslos Offiziere – lebten im Südlager, ihre britischen und anderen alliierten Verbündeten etwa vierhundert Meter nördlich. Kontakte und Besuche zwischen den beiden Lagern fanden statt, auch wenn die Deutschen den Kontakt durch eine Reihe von Auflagen erschwerten: Nur mit einer Eskorte, einem bewaffneten Aufseher und einem gewichtigen Grund kam man hinüber. Am überzeugendsten war, wenn man einem der »Frettchen«, wie die Lagerinsassen die Wärter nannten, die auf Patrouille mit ihren Eisenstangen im Boden stocherten, unauffällig ein paar Zigaretten zusteckte. Für die Wachleute mit den Hunden hatten sie keinen Spitznamen, denn ihre Hunde waren allgemein gefürchtet.
Die Lager waren nicht durch Mauern, sondern durch einen drei Meter hohen Maschendrahtzaun mit je zwei Reihen Stacheldraht außen und innen gesichert. Alle fünfzig Meter befand sich ein klobiger Wachturm aus Holz, der rund um die Uhr mit grobschlächtigen und unbestechlichen Männern besetzt war, die keinen Spaß kannten und nicht nur ein Maschinengewehr über der Schulter, sondern zusätzlich eine Schmeisser-Maschinenpistole um den Hals hängen hatten. Auf der Lagerseite hatten die Deutschen einen weiteren Zaun aus Holzpfosten und Draht errichtet – die Todeslinie. Das Überschreiten dieser Grenzmarkierung galt als Fluchtversuch und führte unweigerlich zur Erschießung. Zumindest erzählte das der Lagerkommandant jedem neuen Kriegsgefangenen bei seiner Ankunft im Stalag 13. In Wahrheit ließen die Wachen einen Internierten, der sich einen weißen Kittel mit einem deutlich sichtbaren roten Kreuz darauf überzog, bis zum äußeren Zaun durch, wenn sich beispielsweise ein Baseball oder Football dorthin verirrte, auch wenn sie zu ihrem Vergnügen schon einmal jemanden durchwinkten und kurz darauf eine Salve über seinem Kopf oder dicht neben seinen Füßen in den Boden feuerten. Entlang der Todeslinie endlose Runden zu drehen und die Grenze ihres Gefängnisses auszutesten gehörte zu den Lieblingsbeschäftigungen der Lagerinsassen.
Im Lauf des Vormittags wurde es wärmer, und die Männer auf dem Appellplatz hielten die Gesichter in die Frühlingssonne. Nach Tommy Harts Schätzung standen sie bereits seit vier Stunden stramm, während ganze Heerscharen deutscher Offiziere und gemeiner Soldaten an ihnen vorbei zum eingestürzten Tunnel eilten. Die einfachen Soldaten hatten Schaufeln und Spitzhacken in der Hand, die Offiziere Furchen auf der Stirn.
»Es ist das verfluchte Holz«, sagte jemand in den Reihen der Gefangenen. »Wenn es sich mit Wasser vollsaugt, fault das Zeug und knickt wie Streichhölzer weg.«
Tommy Hart drehte sich um und stellte fest, dass die Bemerkung von einem kernigen Mann aus West Virginia kam, Kopilot einer B-17, dessen Vater noch in den Kohlenbergwerken unter Tage geschuftet hatte. Er nahm an, dass der Haudegen, der die bittere Wahrheit mit Todesverachtung beim Namen nannte, am Fluchtplan maßgeblich beteiligt gewesen war. Männer, die sich mit Erde auskannten – Farmer, Bergleute, Erdarbeiter, ja selbst der Bestattungsunternehmer, der nach seinem Abschuss über Frankreich in der Baracke nebenan gelandet war –, solche Leute wurden schon wenige Stunden nach ihrer Ankunft in Stalag 13 für das Unternehmen rekrutiert.
Er selbst hatte keinerlei Anstalten gemacht, um aus dem Lager zu fliehen, und hegte im Unterschied zu vielen anderen auch nicht den Wunsch. Natürlich sehnte er sich nach der Befreiung, doch er wusste nur zu gut, dass er bei einer Flucht in einen unterirdischen Tunnel steigen musste.
Und das konnte er nicht.
Er schob seine Angst vor dem Eingeschlossensein auf eine Episode in seiner Kindheit, als er sich mit drei oder vier Jahren versehentlich in einem dunklen Kellerverschlag eingesperrt hatte. In der Hitze und unter Tränen hörte er von ferne, wie seine Mutter nach ihm rief, brachte aber in seiner Panik selbst keinen Laut heraus. Wahrscheinlich hätte er die Angst, die ihn seitdem verfolgte, nicht als Klaustrophobie bezeichnet, obwohl es sich genau darum handelte. Seine Entscheidung, zum Fliegerkorps zu gehen, hatte damit zu tun, denn selbst in der Enge eines Bombers war er draußen im Freien. Die Vorstellung, in einem Panzer oder einem U-Boot zu stecken, war für ihn viel furchterregender als die Angst vor feindlichem Beschuss.
Deshalb stand für Tommy Hart in der ungewissen Welt des Internierungslagers eines fest: Sollte es ihm je vergönnt sein, es lebend zu verlassen, dann durchs Haupttor, denn niemand würde ihn dazu bringen, freiwillig in den Tunnel hinunterzusteigen.
Aus diesem Grund gab er sich damit zufrieden – fügte er sich dem Unvermeidlichen, hätte es wohl besser getroffen –, die Härten der Gefangenschaft in Stalag 13 bis zum Kriegsende hinzunehmen. Ab und zu zogen sie ihn zu kleinen Hilfsdiensten heran, etwa als heimlichen Beobachter eines Frettchens. Jeder Deutsche, der sich auf dem Lagergelände aufhielt, stand unter Beobachtung einer Wachpostenstaffel, die untereinander mit einer ausgeklügelten Zeichensprache kommunizierte. Natürlich blieb den Frettchen nicht verborgen, dass sie unter »Bewachung« standen, und so taten sie ihr Bestes, dies zu unterlaufen, indem sie ständig ihre Routen änderten.
»He, Fritz Nummer eins! Wie denkt ihr euch das eigentlich? Sollen wir hier Wurzeln schlagen, oder was?«
Die Fragen kamen laut und mit selbstbewusstem Nachdruck – von einem Kampfpiloten aus New York im Rang eines Captains. Sein lauter Protest richtete sich an einen Deutschen, der im grauen Overall und mit in die Stirn gezogener, weicher Mütze, der Uniform der Frettchen, gerade allein auf dem Platz stand. Da es drei Frettchen mit Vornamen Fritz gab, sprach man sie immer durch Zusatz der Nummer an, was sie jedes Mal erboste.
Der Mann drehte sich um und sah dem Captain ins Gesicht. Dann trat er an den Offizier, der in bequemer Haltung in der ersten Reihe stand, heran. Um das Abzählen zu erleichtern, mussten sie in Fünferreihen antreten.
»Wenn Sie nicht gegraben hätten, Captain, bräuchten Sie jetzt nicht hier zu stehen«, erklärte er in ausgezeichnetem Englisch.
»Ach, kommen Sie, Fritz Eins«, entgegnete der Captain. »Wir haben nicht gegraben. Wahrscheinlich ist mal wieder ein Teil von Ihrer lausigen Kanalisation eingebrochen.«
Der Deutsche schüttelte den Kopf.
»Nein, Kapitän, das war ein Tunnel. Solche Fluchtversuche sind irrwitzig, der hier hat nun zwei Menschenleben gekostet.«
Betroffen schwiegen die Luftwaffenoffiziere.
»Zwei Männer?«, fragte der Captain schließlich. »Wie denn?«
Das Frettchen zuckte mit den Achseln. »Sie waren dabei zu graben. Da bricht die Erde über ihnen ein, sie sitzen in der Falle. Begraben. Ein Verlust.«
Die Reihen der feindlichen Kriegsgefangenen fest im Blick, fügte der Mann ein wenig lauter hinzu:
»Das ist ziemlich dämlich. Dummköpfe.« Dann bückte er sich und kratzte mit der bloßen Hand etwas Erde vom Boden und zerbröselte sie zwischen den langen, fast mädchenhaften Fingern.
»Diese Erde ist gut zum Pflanzen. Als Ackerboden, dafür ist sie gut. Und für Ihre Spiele. Auch dafür ist sie gut …« Er deutete auf den Sportplatz des Lagers. »Für Tunnel ist sie zu weich.«
Fritz Eins wandte sich wieder dem Captain zu. »Sie werden nicht wieder fliegen, bis der Krieg zu Ende ist. Falls Sie dann noch leben.«
Der Mann aus New York erwiderte schweigend den Blick des Deutschen. Schließlich antwortete er: »Schauen wir mal.«
Das Frettchen beendete das Gespräch mit einem flüchtigen Salut und machte kehrt. Am Ende der Reihen blieb er noch einmal zu einem kurzen Wortwechsel mit einem anderen Offizier stehen. Als Tommy Hart sich ein wenig vorneigte, sah er, wie Fritz Eins die Hand ausstreckte und unauffällig ein paar Zigaretten in Empfang nahm. Trader Vic – in Anlehnung an den berühmten Gastronomen – war der großzügige Spender. Eigentlich hieß der kleine, drahtige, stets lächelnde Bombercaptain aus Greenville, Mississippi, Vincent Bedford; den Spitznamen hatte er sich als begnadeter Verhandlungsführer und Schieber der Formation erworben.
Bedford sprach irritierend langsam und behäbig mit starkem Südstaatenakzent. Er war ein ausgezeichneter Pokerspieler und beim Baseball dank seiner aktiven Zeit in den unteren Ligen ein beachtlicher Shortstop. Vor dem Krieg hatte er Autos verkauft, was zu ihm passte. Doch sein wahres Genie entfaltete er im Tauschhandel im Stalag Luft 13, wo er Zigaretten, Schokolade und Dosen mit echtem Bohnenkaffee, die das Rote Kreuz in kleineren oder größeren Päckchen aus Amerika schickte, gegen Kleidung und andere Güter anbot. Oder er schlug zusätzliche Kleidung heraus, um sie gegen Nahrungsmittel zu tauschen. Vincent kam an alles heran, und selten zog er bei einem Geschäft den Kürzeren. Kam es doch einmal dazu, machte er den Verlust mit seinem Spielerinstinkt wieder wett; war gerade kein Päckchen von zu Hause in Sicht, füllte er seine Bestände mit einer Pokerrunde auf. Dabei beschränkten sich seine Tauschgeschäfte offenbar nicht auf materielle Waren, sondern schlossen auch Informationen ein. Die neuesten Gerüchte und Nachrichten kannte er grundsätzlich als Erster. Tommy Hart vermutete, dass er im Zuge seiner florierenden Geschäfte an ein Radio herangekommen war, auch wenn er es nicht beschwören konnte. Fest stand, dass Vincent Bedford in Baracke 101 der wichtigste Mann war. In der kargen Welt des Internierungslagers hatte Vincent Bedford im Vergleich zu seinen Mitgefangenen ein wahres Vermögen an Kaffee, Nahrungsmitteln, Wollsocken, langen Unterhosen und anderen Dingen angehäuft, die das Leben hinter Stacheldraht etwas erträglicher machten.
War Trader Vic ausnahmsweise einmal nicht in seine Geschäfte verwickelt, erging er sich in endlosen Schilderungen seiner kleinen Heimatstadt, deren grandiose und zugleich idyllische Schönheit offenbar auf der Welt ihresgleichen suchte. Es dauerte nie allzu lange, bis seine Zuhörer ihm beteuerten, nach dem Krieg geschlossen nach Greenville zu ziehen, nur um den Lobeshymnen in ihrem wehmütig getragenen Ton ein Ende zu setzen, denn wenn sie an zu Hause denken mussten, nagte das Heimweh an ihnen. Alle Männer im Lager kämpften mit der Verzweiflung, und so verdrängten sie lieber jeden Gedanken an die Vereinigten Staaten, auch wenn es das Einzige war, an das sie Tag und Nacht denken mussten.
Als das Frettchen weiterging, sah Bedford ihm hinterher, bevor er sich an seinen Nebenmann in der Reihe wandte und ihm etwas zuflüsterte. Wie ein Lauffeuer ging die Neuigkeit durch die eigene Gruppe und machte Sekunden später in der nächsten Formation die Runde.
Bei den Verschütteten handelte es sich um Wilson und O’Hara, zwei der unermüdlichsten Tunnelratten. O’Hara hatte Tommy flüchtig gekannt, da er eine Zeitlang in ihrer Baracke untergebracht gewesen war, wenn auch in einem anderen Raum, so dass er nur eines von vielen Gesichtern war, denn in jeder Baracke waren zweihundert Männer zusammengepfercht. Der Flüsterpost zufolge waren die beiden Männer letzte Nacht zu später Stunde in den Tunnel hinabgestiegen und hatten mit aller Macht versucht, die Stützpfosten zu verstärken, die unter der Last der regendurchtränkten Erde nachzugeben drohten. Sie waren lebendig begraben worden.
Laut Bedfords Informationen hatten die Deutschen beschlossen, die verschütteten Leichen dort unten liegen zu lassen.
Nicht lange, und aus dem Flüstern wurde quer durch die Reihen der Lagerinsassen laut vernehmliches Murren. Wie eine Woge ging die Empörung durch die Fünferreihen und griff auf die anderen Formationen über, bis alle Kriegsgefangenen auf dem Platz mit gestrafften Schultern Haltung annahmen. Ohne einen Befehl standen sie stramm.
Auch Tommy Hart drückte die Knie durch und die Brust heraus, nachdem er einen letzten Blick auf Trader Vic geworfen hatte. Seine Beobachtung vorhin hatte ihn irritiert, er konnte nicht sagen, warum, doch die kurze Szene weckte bei ihm ein Unbehagen, das er nicht benennen konnte.
Doch bevor er darüber nachdenken und dahinterkommen konnte, hallte der Ruf des Captains aus New York über den Platz: »Mörder! Verdammte Mörder! Ihr Barbaren!« Im nächsten Moment kam dieselbe Botschaft wie ein Echo von anderen Männern in anderen Reihen, bis die Wut über das Los der Kameraden das ganze Lager erfüllte.
In diesem Moment trat der ranghöchste amerikanische Offizier vor, drehte sich zu den Formationen der Männer um und strafte sie mit einem vielsagenden, funkelnden Blick, der sie augenblicklich zur Ordnung rief, auch wenn derselbe eisige Blick seiner blauen Augen und die schmalen Lippen ahnen ließen, wie sehr er die Wut der anderen teilte. Lewis MacNamara war ein Soldat von altem Schrot und Korn, ein hochdekorierter Colonel mit zwanzigjähriger Diensterfahrung, ein Mann, der nicht einmal die Stimme zu erheben brauchte, um seiner Autorität Nachdruck zu verschaffen. Für diesen unbeugsamen Mann schien die Gefangenschaft nur eine von vielen Pflichten in seiner ereignisreichen Offizierslaufbahn zu sein. MacNamara wechselte mit leicht gegrätschten Beinen, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, in eine bequeme Haltung und hielt seine Männer in Schach. Mit einem metallischen Klicken, das auch in den hintersten Reihen zu hören war, entsicherten zwei Aufseher ihre Waffen – zweifellos eine leere Drohgebärde, doch mit der gewünschten Wirkung: Es trat augenblicklich Ruhe ein.
Schließlich rief der Vorfall Lagerkommandant von Reiter auf den Plan und in seinem Gefolge mit vorsichtigen Schritten, um sich im Matsch nicht die hochglanzpolierten Stiefel zu ruinieren, zwei Adjutanten. Ohne von MacNamara Notiz zu nehmen, wandte sich der Kommandant an die versammelten Kriegsgefangenen.
»Zählappell! Danach abtreten!«
Er legte eine Pause ein und fügte hinzu: »Bei der Zählung werden zwei Männer fehlen. Was für eine Idiotie!«
Schweigend standen die Flieger stramm.
»Das ist bereits der dritte Tunnel innerhalb eines Jahres, aber der erste, der Menschenleben gekostet hat«, fuhr der Kommandeur lautstark und sichtlich verärgert fort. »Weitere Fluchtversuche werden unter keinen Umständen toleriert!«
Er verstummte und ließ den Blick über die Reihen der Gefangenen schweifen. Wie ein verknitterter alter Lehrer vor einer ungezogenen Klasse reckte er einen knochendürren Finger in die Höhe.
»Noch nie hat es in meinem Lager einen erfolgreichen Fluchtversuch gegeben. Noch nie! Und das wird auch so bleiben!«
Pause. Ein bedächtig langer Blick über die Menge.
»Ich habe Sie gewarnt.«
Es herrschte Stille auf dem Platz. In diesem Augenblick trat Colonel MacNamara vor. Kerzengerade aufgerichtet, mit einer Autorität, die der des Kommandanten in keiner Weise nachstand und die von seiner verschlissenen Uniform noch unterstrichen wurde, bemerkte er:
»Ich möchte die Gelegenheit ergreifen und dem Oberst in Erinnerung rufen, dass jeder Offizier unter Eid verpflichtet ist, alles zu unternehmen, um dem Feind zu entkommen.«
Von Reiter hob die Hand, um den Colonel zum Schweigen zu bringen.
»Kommen Sie mir nicht mit Pflichten. Fluchtversuche sind verboten!«
»Diese Pflicht – dieses Gebot – gilt umgekehrt genauso für Ihre Luftwaffenoffiziere, die bei uns in Gefangenschaft geraten«, fuhr MacNamara laut vernehmlich fort. »Und wenn ein Flieger Ihrer Luftwaffe bei seinem Fluchtversuch ums Leben kommt, wird er von seinen Kameraden mit vollen militärischen Ehren beigesetzt!«
Von Reiters Gesicht verdüsterte sich. Er wollte etwas entgegnen, behielt es aber für sich. Kaum merklich nickte der Kommandeur. Die beiden Männer starrten einander an, als trügen sie mit bloßer Willenskraft einen stummen Kampf miteinander aus.
Dann machte von Reiter MacNamara ein Zeichen, ihn zu begleiten, und kehrte den versammelten Männern den Rücken. Die beiden ranghohen Offiziere begaben sich gemessenen Schrittes Richtung Haupttor, das zu den Gebäuden der Lagerverwaltung führte. Im selben Moment postierte sich vor jeder Formation der Internierten ein Frettchen, um mit dem sattsam vertrauten, langwierigen Abzählen zu beginnen. Mitten im Zählappell hörten die Lagerinsassen die erste dumpfe Explosion der Sprengladungen, die die Deutschen den ganzen eingestürzten Tunnel entlang detonieren ließen, um ihn mit derselben hellbraunen Erde aufzufüllen, an der die beiden Männer erstickt waren. Es war nicht fair, dachte Tommy Hart, dass sich jemand als Flieger in freier, klarer Luft zum Militärdienst meldete, egal wie gefährlich die Bombereinsätze auch sein mochten, und dann einsam und allein zwei, drei Meter unter der Erde erstickte. Doch den Gedanken behielt er für sich.
Der Eingang zum Tunnel hatte versteckt unter einem Waschbecken der Baracke 109 gelegen und in einer scharfen Rechtskurve Richtung Maschendrahtzaun geführt. Von den vierzig Baracken auf dem Gelände war 109 die zweitnächste zum Zaun. Um es bis zum dunklen Rand des dichten Bayerischen Waldes zu schaffen, mussten die Männer über hundert Meter graben. Nicht einmal ein Drittel der Strecke hatten sie geschafft, dabei waren sie weitergekommen als bei den zwei vorherigen Versuchen in diesem Jahr und hatten sich die größten Hoffnungen gemacht.
Wie fast jeder andere Insasse des Lagers war Tommy Hart im Lauf des Vormittags einmal zum Todesstreifen hinübergegangen und hatte auf die Überreste des Tunnels gestarrt, während er daran denken musste, was die beiden Männer, die dort in der Falle gesessen hatten, in ihren letzten Sekunden durchgemacht hatten. Von den Sprengungen war die Erde aufgewühlt, das Gras lehmverschmiert und an den Stellen, wo unter den Explosionen die Tunneldecke eingestürzt war, von Kratern durchzogen. In der Baracke 109 war der Eingang mit Beton zugegossen worden.
Er seufzte. Nicht weit von ihm standen zwei weitere Gefangene, B-17-Piloten, trotz der milden Temperaturen in ihre schweren Schafslederjacken gehüllt, und konnten den Fehlschlag nicht fassen.
»Dabei sieht es so aus, als wäre es gar nicht mal so weit«, sagte einer der beiden seufzend.
»Nah«, murmelte der andere zur Bestätigung.
»Richtig nah«, spann der erste den Gedanken weiter, »in den Wald, dann irgendwo zwischen den Bäumen die Straße bis zur Stadt finden, und du hast es fast geschafft. Dann musst du nur noch irgendwie zum Bahnhof kommen und mit dem Zug nach Süden. Am besten springt man auf irgendeinen alten Güterzug, der in die Schweiz fährt, und schon ist man in Sicherheit. Verflucht. Wirklich nicht weit.«
»Unendlich weit«, entgegnete Tommy Hart. »Und allzu gut vom Nordturm aus zu sehen.«
Die beiden Männer schwiegen einen Moment, bevor sie nickten, da sie natürlich wussten, dass der erste Anschein trog. Der Krieg spielt einem diese Streiche und lässt Entfernungen je nach den Gefahren, die bei ihrer Überwindung drohten, entweder viel kürzer oder weiter erscheinen. Die richtige Einschätzung fällt schwer, dachte Tommy, besonders, wenn man sein Leben riskiert.
»Trotzdem wünschte ich mir nichts sehnlicher als eine einzige Chance«, sagte einer der Männer. Er war vielleicht ein wenig älter als Tommy und um einiges kräftiger gebaut. Er war unrasiert und hatte seinen Stetson tief über die Augenbrauen gezogen. »Eine einzige Chance. Verflucht, wenn ich auch nur auf die andere Seite von diesem blöden Stacheldraht käme, würde mich nichts aufhalten –«
»Außer vielleicht ein paar Millionen Krauts«, fiel sein Freund ein. »Außerdem kannst du kein Deutsch, und wo willst du überhaupt hin?«
»In die Schweiz. Schönes Land. Überall Kühe und Berge und diese verspielten kleinen Häuser …«
»Chalets«, half ihm der andere aus. »Die heißen Chalets.«
»Richtig. Ein paar Wochen lang lass ich mich, wenn Mommy und Daddy gerade weg sind, von einem hübschen Blondzöpfchen auf der Alm mit dieser Milchschokolade mästen, und dann nichts wie heim in die Staaten, wo mir ein Mädchen einen ganz besonderen Heldenempfang bereitet, darauf kannst du einen lassen.«
Sein Kamerad gab ihm einen Klaps auf den Arm, den die Lederjacke dämpfte.
»Träumer«, sagte er und drehte sich zu Tommy Hart um. »Schon lange hier eingebuchtet?«, fragte er.
»Seit November 42«, erwiderte Tommy.
Die beiden anderen pfiffen durch die Zähne.
»Oh, Mann! Das ist ja eine Ewigkeit. Und in der Zeit irgendwann mal rausgekommen?«
»Kein einziges Mal«, antwortete Tommy. »Nicht eine Minute, nicht eine Sekunde.«
»Mann«, wiederholte der B-17-Pilot. »Ich bin erst seit fünf Wochen hier und kurz davor, durchzudrehen. Als ob es mich ständig juckt, im Rücken, da, wo man mit den Fingern nicht drankommt.«
»Am besten gewöhnst du dich dran«, antwortete Tommy. »Wer versucht, hier auszubüxen, schafft es höchstens mit den Füßen zuerst.«
»Werd mich nie dran gewöhnen«, erwiderte der Mann.
Tommy nickte. Ich mich auch nicht, dachte er, während er die Augen schloss, die Lippen zusammenbiss und einmal tief Luft holte.
»Manchmal«, sagte Tommy leise, »muss man seine Freiheit hier oben finden …« Er tippte sich an die Stirn.
Einer der Piloten nickte, der andere kehrte ihnen den Rücken. Und blickte zum Hauptlager hinüber.
»He«, sagte er. »Was haben wir denn da?«
Tommy fuhr herum und erblickte ein Dutzend Männer, die in dichter Formation über den weitläufigen Appellplatz marschierten. Die Männer hatten sich mit Schlips und frischem Hemd zur »Ausgehuniform« des Stalag, an der besonders die rasierklingenscharfen Bügelfalten ins Auge stachen, in Schale geworfen.
Jeder Mann in der Gruppe hatte ein Musikinstrument dabei. In der Maisonne blitzte das Messing einer Posaune auf. Ein Schlagzeuger hatte sich eine kleine Trommel vor den Bauch geschnallt und begleitete ihren Weg durchs Lager mit einem metallischen Beat.
Der Anführer des Trupps ging ein Stückchen voraus. Sein starrer Blick war durch den Draht auf den Wald in der Ferne gerichtet. Er hatte zwei Instrumente dabei, eine Klarinette, die er in der Rechten hielt, und eine Trompete, die in einem bräunlich goldenen Ton schimmerte. Der Trupp bewegte sich im Eilmarsch, jedoch in unverändert strenger Formation im Gleichschritt durch das Lager, während der Anführer mit einem gelegentlichen Befehl in den Trommelrhythmus einfiel.
In wenigen Sekunden hatte die seltsame Schar die Aufmerksamkeit sämtlicher anderer Internierten auf sich gezogen. Die Männer strömten aus den Baracken, um zu sehen, was der Lärm zu bedeuten hatte. In den kleinen Gemüsegärten vor den Baracken im zweiten Glied ließen die Offiziere ihre behelfsmäßigen Geräte fallen, um sich der Marschkapelle anzuschließen. Ein Baseballspiel, das im Hof gerade in Gang kam, wurde jäh unterbrochen. Handschuhe, Schläger und Bälle blieben achtlos auf dem Boden liegen, als die Spieler sich dem seltsamen Umzug anschlossen.
Der Anführer der Kapelle war klein und dünn, doch drahtig und muskulös wie ein Federgewichtsboxer, mit schütterem Haar. Auf seinem unbeirrbaren Marsch, den Blick geradeaus, schien er nicht zu merken, wie sich Hunderte Kameraden dem Zug anschlossen. Zwischendurch brüllte er ein Kommando: »Links-um …«, woraufhin die Marschkapelle mit einer Präzision, die der Eliteschule West Point alle Ehre gemacht hätte, zur Todeslinie schwenkte. Auf den lauten Ruf ihres Kommandeurs: »Alle Mann – halt!« stoppten sie etwa einen Meter vor dem Draht.
Die deutschen Maschinengewehrschützen im nächstgelegenen Turm richteten die Waffen auf die Männer. Sie wirkten nervös und angespannt, als sie den Gefangenentrupp unter ihren Stahlhelmen ins Visier nahmen.
Während er die Szene beobachtete, hörte Tommy Hart, wie einer der B-17-Piloten, die immer noch neben ihm standen, in mitfühlendem Ton flüsterte: »O’Hara. Der kleine irische Katholik, der diese Nacht im Tunnel gestorben ist. Der kam wie der Bandleader da vorne aus New Orleans. Sie sind zusammen eingerückt. Zusammen geflogen. Haben zusammen musiziert. Ich glaube, ihm gehörte die Klarinette …«
Jetzt drehte sich der Anführer zu seinen Männern um und rief: »Stalag-Luft-13-Internierten-Jazzband … Habt … acht!«
Die Männer schlugen die Hacken zusammen.
»Positionen einnehmen!«, befahl er.
Der Trupp formierte sich nun mit wenigen Schritten zu einem Halbkreis, dem Stacheldrahtzaun und dem letzten Stück der Narbe im Boden zugewendet, dem Grab der verschütteten Toten. Die Musiker setzten die Instrumente an die Lippen und warteten auf das Zeichen des Anführers. Saxofone, Posaunen, Hörner und Kornette in Spielhaltung; ebenso die Trommelstöcke über dem Fell. Ein Gitarrist hatte die Rechte am Griffbrett, ein Plektron in der Linken.
Der Bandleader warf einen letzten prüfenden Blick auf jeden Musiker, dann machte er eine abrupte Kehrtwendung, trat, mit dem Rücken zur Band, drei Schritt bis an die Sperrlinie vor und lehnte die Klarinette gegen den Draht. Er salutierte vor dem Instrument und schwenkte erneut zu den Musikern um. Als er langsam seine Trompete hob, schienen seine Lippen zu zittern. Dem Spieler des Tenorsaxofons wie auch einem der Posaunisten liefen Tränen die Wangen hinunter. Alle Männer waren wie erstarrt, und auf dem Platz herrschte vollkommene Stille. Der Bandleader nickte, befeuchtete seine Lippen und hob die linke Hand, um den Einsatz zu geben.
»Auf den ersten Schlag nach unten«, sagte er. »Den ›Chattanooga Choo-choo‹. Und ich will eine heiße Nummer hören, eine richtig heiße Nummer. Eins, zwei, drei, vier …«
Die Musik brach los und explodierte wie eine Leuchtkugel, die sich über den Lagerzaun und den Wachturm in den klaren, blauen Himmel erhob; im schwerelosen Flug verflüchtigte sie sich über den Baumwipfeln der umliegenden Wälder und ihrer trügerischen Freiheit.
Die Männer spielten wild und ungezügelt. Schon bald standen ihnen die Schweißperlen auf der Stirn, während die Instrumente im Rhythmus der Musik hin und her schwangen. Alle paar Augenblicke trat einer der Musiker in die Mitte des Halbkreises, um mit seinem Solo den Rhythmus zu beeinflussen und mit einer wehmütigen Klangfolge oder einem feurigen Gitarrenriff dem Stück eine neue Wendung zu geben. Dazu bedurften die Männer keiner Zeichen ihres Dirigenten, da sie sich von ihrer Musik tragen ließen und einen Einklang fanden, als klopfte ihnen eine unsichtbare Hand von oben sacht auf die Schulter. Auf »Chattanooga Choo-choo« folgte im gleitenden Wechsel »That Old Black Magic« und »Boogie Woogie Bugle Boy of Company B« – ein Stück, bei dem der Bandleader in die Mitte trat und im Rhythmus mit den anderen Instrumenten kurze Trompetensoli blies. So legten sie alles, was sie an diesem Morgen, in der letzten Nacht, in den letzten Monaten und Jahren ertragen hatten, mal eindringlich laut, mal zartfühlend leise, in ihre Musik.
Die Kriegsgefangenen hörten wie gebannt zu.
Fast eine halbe Stunde lang spielte die Kapelle, bis die Musiker mit roten Gesichtern verschwitzt keuchten wie Sprinter nach einem Kurzstreckenlauf. Als sie zum furiosen Finale von »Take the A Train« kamen, nahm der Dirigent die linke Hand von der Trompete, reckte sie hoch und ließ sie mit einer schneidenden Bewegung nach unten schnellen. Auf sein Zeichen verstummte die Musik.
Es gab keinen Applaus. Unter den Zuhörern, Hunderten, Schulter an Schulter gedrängten Männern, herrschte Stille.
Der Bandleader musterte noch einmal jeden seiner Musiker und nickte schließlich scheu. Auch ihm rannen Tränen die Wangen hinunter, doch zugleich huschte ein zaghaftes, schiefes Lächeln über sein Gesicht – die stille Genugtuung darüber, dass sie zusammen ausgesprochen hatten, wofür es keine Worte gab. Tommy Hart konnte kein Kommando sehen oder hören, doch die Jazzband wechselte von einem Moment zum anderen in Abmarsch-Ruhehaltung, die Instrumente wie Gewehre an die Brust gedrückt. Der Bandleader ging zu einem Posaunisten, reichte ihm seine Trompete und kehrte in einem geübten Schwenk im Eilmarsch zum Draht zurück, wo er die einsame Klarinette aufhob. Immer noch mit dem Gesicht zum Wald und der Welt dahinter hob der Dirigent das Instrument an die Lippen und ließ eine langsame Trillerfolge ertönen. Tommy wusste nicht, ob der Mann improvisierte, doch er lauschte hingebungsvoll auf die klaren Klarinettenklänge, die weich ineinander übergingen und schwerelos über den Lagerinsassen schwangen. Sie erinnerten Tommy an die Vögel, die er daheim in Vermont über die windzerzausten Felder fliegen sah, wenn sie sich im Herbst für den Zug nach Süden sammelten. Wurden sie aufgescheucht, flatterten sie alle auf, schwebten eine Weile dicht über dem Boden, um sich wie auf Kommando in die Luft zu erheben und in einem riesigen, wogenden Schwarm der Sonne entgegenzufliegen. So verhielt es sich mit den Klarinettenklängen – zögerlich stiegen sie auf und nahmen melodische Gestalt an, bis am Ende ihres Höhenflugs ein einziger, letzter Ton verhallte.
Der Bandleader ließ das Instrument sinken und drückte es einen Moment an die Brust. Dann wandte er sich in einem Schwenk wieder seinen Musikern zu und rief das Kommando: »Stalag-Luft-13-Internierten-Jazzband … habt acht!«
Es ging ein Ruck durch die Band, als sei sie aus einem Guss.
»In Zweierreihen … kehrt euch! Trommler bitte … Ab-marsch!«
Die Jazzband setzte sich in Bewegung. Zum langsamen, klagenden Trommelschlag kehrte sie im gesetzten Trauermarsch, bei dem der rechte Fuß erst nach kurzem Innehalten aufsetzt, vom Zaun in die Mitte des Lagers zurück.
Die Zuhörer traten beiseite, um die Band durchzulassen, hinter ihr schlossen sich die Reihen wieder. Erst nach und nach lichtete sich der Platz, und jeder kehrte zu der einen oder anderen Beschäftigung zurück, die ihm über die nächsten Minuten, Stunden und Tage seiner Gefangenschaft hinweghalf.
Tommy Harts Blick ging nach oben. Die beiden deutschen Wachposten im Turm zielten immer noch mit ihren Maschinengewehren auf die Männer. Sie grinsten. Die haben keine Ahnung, dachte er, aber für ein paar Minuten waren wir alle vor ihren Augen und den Mündungen ihrer Gewehre wieder freie Männer.
Da ihm bis zum Zählappell am Nachmittag noch ein bisschen Zeit blieb, kehrte Tommy in seine Stube zurück, um sich ein Buch zu holen. Jede Baracke im Stalag Luft 13 war aus vorgefertigten Bauteilen aus Holzpfosten und Hartfaserplatten errichtet, somit im Winter zugig kalt und im Sommer stickig heiß. Suchten die Männer bei anhaltendem Regen Schutz in ihren Behausungen, roch es drinnen schon bald nach Moder, Schweiß und abgestandener Luft. Jede Baracke war in vierzehn Stuben mit je acht Pritschen eingeteilt. Die Kriegsgefangenen hatten schnell herausgefunden, dass sie zwischen den Wänden Hohlräume schaffen konnten, wenn sie nur eine der Hartfaserplatten ein Stück verschoben; in diesen Verstecken horteten sie alles, was ihnen bei Fluchtversuchen nützen konnte, von Uniformen, die sie in Straßenanzüge umgeschneidert hatten, bis hin zu Pickäxten fürs Tunnelgraben.
Jede Baracke verfügte über einen kleinen Waschraum mit Becken, während die Duschen in einem eigenen Bau zwischen dem Nord- und dem Südlager untergebracht waren; die Gefangenen durften nur unter Bewachung dorthin. Sie machten keinen regelmäßigen Gebrauch davon. Außerdem gab es in jeder Baracke eine einzige funktionstüchtige Toilette, die aber nur nachts, nach dem Abschalten des Lichts benutzt wurde. Bei Tage hatte man die Außenklosetts, sechs an der Zahl, mit Holzplatten zwischen den blank gescheuerten Sitzen. Die Deutschen stellten ausreichend Kalk zur Verfügung, und Einsatzkommandos schrubbten den Sanitärbereich mit stark desinfizierender Seife aus GI-Beständen. Die Aborte lagen jeweils zwischen den zwei Baracken, die sich die Klosetts teilten.
Jede Baracke war mit einer primitiven Küche mit einem Holzofen ausgestattet. Die Deutschen teilten ihnen nur magere Rationen zu, vorwiegend Kartoffeln, ungenießbare Blutwurst, Rüben und Kriegsbrot – das harte, dunkle Vollkornbrot, an dem die ganze Nation zu kauen schien. Die Lagerinsassen waren einfallsreiche Köche, die denselben Zutaten durch wechselnde Kombinationen und Zubereitungen unterschiedliche Geschmacksrichtungen entlocken konnten. Die eigentliche Grundlage für ihre Mahlzeiten bildeten die Essenspakete von Angehörigen daheim und vom Roten Kreuz. Die Männer wurden nie satt, ohne regelrecht zu hungern, auch wenn in ihren Augen die Grenzen fließend waren.
Stalag Luft 13