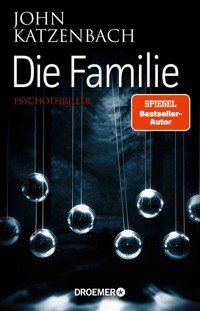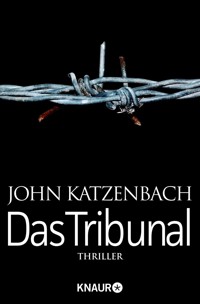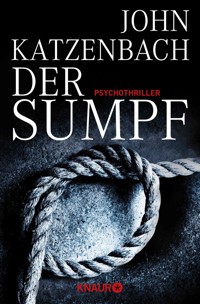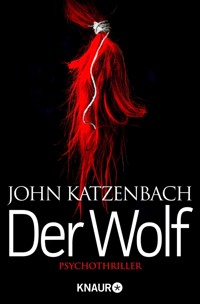9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der erste Ermittler-Krimi von US-Bestseller-Autor John Katzenbach: genial geschrieben, abgründig, packend! Eigentlich sollte es nur ein kurzer Weg sein. Wie immer. Unzählige Male schon ist die dreizehnjährige Tessa Gibson in dem noblen Vorort, in dem sie lebt, von ihrer besten Freundin nach Hause gelaufen. Doch in dieser Herbstnacht kommt sie dort nicht an, verschwindet spurlos, wie vom Erdboden verschluckt. Die Stadt ist schockiert, Angst breitet sich aus, Tessas Familie zerbricht – der Fall wird nie aufgeklärt. Zwanzig Jahre später werden zwei abgehalfterte Ermittler auf den Fall angesetzt. Gabriel ("Gabe") ist Alkoholiker, traumatisiert von einer Familientragödie. Marta, eine ehemalige Drogenfahnderin, hat bei der Verfolgung eines Dealers versehentlich ihren Partner erschossen. Die beiden stoßen auf eine bislang unentdeckte Spur: Kurz nach Tessas Verschwinden ereigneten sich vier brutale Morde an jungen Männern, und offenbar besteht eine Verbindung zwischen diesen Verbrechen. Bei ihren Nachforschungen wird schnell klar, dass die Polizeiführung keinerlei Interesse an der Wahrheit hat. Wer nachbohrt, spielt mit seinem Leben. Und das gilt nicht zuletzt für Gabe and Marta ... "Katzenbach ist einer der fesselndsten Autoren, die die Krimi-Branche derzeit zu bieten hat." Hannoversche Allgemeine Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 644
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
John Katzenbach
Die Grausamen
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Anke und Eberhard Kreutzer
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Unzählige Male schon ist die dreizehnjährige Tessa Gibson in dem noblen Vorort, in dem sie lebt, von ihrer besten Freundin aus nach Hause gelaufen. Doch in dieser Herbstnacht kommt sie dort nicht an, verschwindet spurlos, wie vom Erdboden verschluckt. Die Stadt ist schockiert, Angst breitet sich aus, Tessas Familie zerbricht – der Fall wird nie aufgeklärt. Zwanzig Jahre später werden zwei abgehalfterte Ermittler auf den Fall angesetzt. Gabriel ist Alkoholiker, traumatisiert von einer Familientragödie. Marta, eine ehemalige Drogenfahnderin, hat bei der Verfolgung eines Dealers versehentlich ihren Partner erschossen. Die beiden stoßen auf eine bislang unentdeckte Spur: Kurz nach Tessas Verschwinden ereigneten sich vier brutale Morde an jungen Männern, und offenbar besteht eine Verbindung zwischen diesen Verbrechen. Bei ihren Nachforschungen wird schnell klar, dass die Polizeiführung keinerlei Interesse an der Wahrheit hat. Wer nachbohrt, spielt mit seinem Leben.
Inhaltsübersicht
Motto
Prolog
9. Oktober 1996, 20:12 [...]
Erster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Zweiter Teil
9. Oktober 1996, kurz [...]
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
Dritter Teil
6. August 1997 Neun [...]
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
Fünf Unterhaltungen in der Vergangenheit
54. Kapitel
55. Kapitel
»Nun gut, wer bist du denn?«
»Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.«
Goethe, Faust I
Prolog
Eine furchterregende Nacht
»Sag mal, ist Tessa noch nicht da?«
»Nein.«
»Und wo ist sie?«
»Wird wohl noch bei Tom Lister sein. Müsste jeden Moment kommen.«
»Eigentlich sollte sie schon zu Hause sein.«
»Ist bestimmt jeden Moment da.«
»Es ist aber schon dunkel, und sie ist erst dreizehn.«
»Sicher, aber sie hält sich gerne für älter. Willst du sie etwa behandeln, als wäre sie erst sechs?«
»Sagt ja keiner. Trotzdem: Dreizehn ist dreizehn, sie kennt die Regeln, und Regeln sind wichtig. Willst du nicht einfach rasch zu den Listers rüberfahren und sie abholen? Ich hab ihr schon tausend Mal gesagt, sie soll pünktlich zu Hause sein.«
Ein kurzer Blick aus dem Fenster: pechschwarze Nacht. So dunkel wie die Weite des Atlantischen Ozeans in den frühen Morgenstunden.
Eine Dunkelheit, in der man kaum die Hand vor Augen sieht, hat sich in den frühen Abendstunden über die friedliche Vorstadtidylle gesenkt.
»Ich ruf lieber vorher an.«
»Gut. Aber tu’s bitte. Jetzt gleich.«
Eher eine Forderung als eine Bitte, mit einem gestressten Unterton.
Die vertraute Nummer, beim dritten Klingelton nimmt jemand ab. Ah, hallo, wie geht’s? Das übliche freundliche Geplänkel.
Dann:
»Hat sich Tessa schon auf den Weg gemacht? Sie hätte eigentlich längst da sein sollen …«
»Ja, sie ist vor einer halben Stunde gegangen, mindestens. Ist sie denn noch nicht zu Hause?«
»Nein … bis jetzt noch nicht …«
Unterbrechung:
»Lass mich mal ran! Lass mich mit ihr reden!«
Der Hörer wird weitergereicht.
»Hallo Courtney. Hör mal, sie müsste längst hier sein!«
»Ja, stimmt. Bei dem kurzen Weg zu euch … warte einen Moment, ich frag Sarah noch mal, wann sie los ist …«
Stille, gefolgt von einem lauten Ruf die Treppe hinauf zu einem Zimmer auf der Rückseite des Hauses:
»Sarah! Tessas Mom ist am Telefon. Wollte Tessa direkt nach Hause oder noch woanders vorbei?«
»Sie wollte direkt nach Hause. Sie müsste schon da sein.«
Wieder Pause, dann eine angespannte Stimme in der Leitung, die diese Auskunft wiederholte.
»Sarah sagt, sie wollte direkt heim.«
Darauf Schweigen. Beschleunigter Puls. Der erste Schweiß unter den Achseln und auf der Stirn. Das erste Unbehagen als Vorbote der Angst. Nervöses Treten von einem Bein aufs andere. Der nächste Wortwechsel, nun schon mit besorgtem, angespanntem Unterton, mit etwas erhobener Stimme:
»Wir machen uns auf und suchen nach ihr.«
»Ja, gebt uns bitte kurz Bescheid, wenn ihr sie gefunden habt, damit wir beruhigt sind. Soll Tom euch helfen?«
»Nein, vielen Dank, sie kann ja nicht weit sein.«
»Gut. Aber meldet euch auf jeden Fall gleich noch mal, wenn ihr sie gefunden habt.«
Wenn ihr sie gefunden habt. Wie eine Selbstverständlichkeit. Eine Gewissheit.
Eine Lüge.
Aufgelegt. Ein anderer Ausdruck auf dem Gesicht der Mutter. Ein plötzlicher Umschwung der Gefühle – von milder Verärgerung über nervöse Verwunderung zu Besorgnis, die der hellen Panik und schließlich dem unaussprechlichen Grauen weichen wird.
»Notrufzentrale.«
»Sie ist verschwunden, sie ist verschwunden, sie ist nicht nach Hause gekommen, und jetzt ist sie verschwunden … wir haben überall gesucht, aber sie ist nirgends zu finden …«
»Beruhigen Sie sich, bitte! Wer ist verschwunden?«
»Tessa! Meine Tochter! Sie war auf dem Heimweg vom Haus einer Freundin, und sie ist nicht bei uns eingetroffen, wir haben draußen alles nach ihr abgesucht, aber wir können sie nicht finden …«
»Wie alt ist Tessa?«
»Dreizehn! Bitte helfen Sie uns! Sie ist verschwunden!«
»Nennen Sie mir Ihren Namen und Ihre Anschrift. Ich gebe dann eine Meldung an die entsprechenden Einsatzfahrzeuge raus.«
Mit Mühe und Not konnte sie sich ihren Namen und ihre Adresse in Erinnerung rufen. Vor Angst konnte sie keinen klaren Gedanken fassen, jedes Wort kostete sie ein Äußerstes an Selbstkontrolle. Ihre Hand bebte so heftig, dass ihr fast der Hörer entglitt. An der Tür gegenüber stand keuchend, mit wild zerzaustem Haar, im verschwitzten Anorak, in lehmverschmierten Schuhen und Kletten an den Jeans wie angewurzelt ihr Mann und horchte in der sehnlichen Hoffnung auf nahende Sirenen nach draußen. Er wusste nicht, ob er, wenn endlich Hilfe kam, ein vernünftiges Wort herausbringen würde.
Erster Teil
Ein paar Versager auf der Spur anderer Versager
»Oh welch verworren Netz wir weben, wenn wir nach Trug und Täuschung streben.«
Sir Walter Scott, Marmion, 1808
Bei flammenden Plädoyers in Strafprozessen fälschlicherweise oftmals William Shakespeare zugeschrieben.
1
Er war nicht tot, er wusste nur, dass sein Leben vorbei war.
An einem prächtigen Spätnachmittag. Im Nachhinein eine furchtbare Ironie. Ein ausgesprochen heiterer, warmer Septembermorgen, der auf einen strahlenden Mittag zuging. Ein makellos blauer Himmel. Die erste von zwei Urlaubswochen im ansehnlichen Ferienhaus am See, das seinen wohlhabenden Schwiegereltern gehörte, war für Gabriel Dickinson schon um. Der Tagesausflug war die Idee seiner Frau gewesen – eine ideale Gelegenheit, wie sie sagte. »Rede mit ihm. Wenn du ihm den einen oder anderen Ratschlag gibst, wird er auf dich hören. Er hat Hochachtung vor dir.« Es bedurfte keiner Überredungskünste. Er mochte seinen stets zur Witzelei aufgelegten jüngeren Schwager von Herzen gern, auch wenn dieser ein bisschen exzentrisch war und vielleicht ein wenig aus der Spur: abgebrochenes Medizinstudium; mehrere gescheiterte Geschäftsgründungen in Folge; zwei vielversprechende Liebesbeziehungen, die abrupt geendet hatten – die eine vor dem Scheidungsrichter, die andere in bitteren Tränen. Nach jedem Rückschlag erschien ihm der Bruder seiner Frau noch verletzlicher und noch liebenswürdiger. Insgeheim beneidete er seinen Schwager um seinen unbekümmerten Lebensstil – von der Hand in den Mund –, während er selbst immer häufiger das Gefühl bekam, dass seine Situation im Polizeiapparat der eines Kartenspielers glich, der zwangsläufig sein Blatt ausspielt. Seine Kollegen mochten in ihm den Senkrechtstarter sehen, doch wenn er ehrlich war, bot sein Leben wenig Abenteuer. Dafür jede Menge Papierkram.
An diesem prächtigen Morgen hatte er einige Sixpacks Bier sowie ein paar hastig geschmierte Schinken- und Käsestullen in eine alte rote Kühlbox gepackt und dann das Catboot aufgeriggt. Nichts sprach dagegen, mit der kleinen Jolle loszugondeln und unter einer leichten Brise die einsame Küste entlang in unbekannte Buchten zu segeln. Sie glitten unter hohen grünen Pinien hindurch, umschifften zerklüftete Felsenvorsprünge, auf denen sich unberührte Wälder bis tief in die Adirondack Mountains im Norden des Bundesstaates New York erstreckten. Die grauen Gipfel reckten sich in den blauen Himmel empor, als gelte es, urzeitlichen Tribut einzufordern. Später sollten sie in seiner Erinnerung zu den kolossalen Grabsteinen eines gigantischen Friedhofs werden.
Eigentlich war nur ein kleiner, unbeschwerter Ausflug geplant, nichts weiter als ein geruhsamer Tag, ein bisschen Spaß und eine zwanglose Plauderei über Zukunftspläne. Sie hatten das familiäre Feriendomizil rasch hinter sich gelassen, waren an ein paar abgelegenen Häusern vorbeigekommen, die hier und da das Seeufer säumten, hatten ein paar anderen Seglern zugewinkt, sich miteinander über Football und Baseball unterhalten, über Mädchen, die sie beide aus jungen Jahren kannten, mit Erfolgsgeschichten geprahlt, von denen sie beide wussten, dass sie zu dick aufgetragen waren, sich über den Job, über nervige Vorgesetzte und inkompetente Kollegen ausgelassen. In der Mittagszeit waren sie abwechselnd über die Reling in den See getaucht und im kühlen schwarzen Wasser geschwommen, bevor sie sich zitternd wieder hochhievten, in der Sonne aufwärmten und zum nächsten Bier die mitgebrachten Stullen verschlangen.
Er hatte sich so jung und unbeschwert gefühlt wie in alten College-Zeiten.
Das erste Warnzeichen, dass etwas nicht stimmte, war eine plötzliche Brise aus nördlicher Richtung, als der Nachmittag zur Neige ging und er gerade vorschlagen wollte, zurückzusegeln. Die Kälte setzte so unvermittelt ein, dass er eine Gänsehaut bekam. »Du meine Güte«, murmelte er und blickte besorgt zu den dunklen Gewitterwolken hoch, die sich in der Senke zwischen zwei hohen, zerklüfteten Bergen zusammenbrauten. Die unheilvolle schwarzgraue Wetterfront schien sich unaufhaltsam in ihre Richtung zu wälzen, noch dazu so schnell, als sei sie über die Klippen gestürzt und rolle nun ungebremst genau auf sie zu.
»Oha!«, sagte sein Schwager, als auch er die Warnzeichen entdeckte.
»Bloß weg hier, da kommt gleich was runter.«
»Ree!«, hatte Gabe erwidert, während er die Pinne wegdrückte, um eine Wende einzuleiten. »Vergesst die Torpedos! Volle Kraft voraus! Obwohl – nass werden wir so oder so.« Er meinte den Regen, doch da irrte er. Er holte das Großschot dicht, doch das einzige Segel des Catboots blähte sich schon so heftig im Wind, dass es an den Kanten knatterte und sich stärker spannte, als es verkraftete.
Sie kamen nicht weit.
In starker Seitenlage jagte das Boot hart am Wind, und jedes Tau, jede Talje ächzte und knarrte, ein beängstigendes, unheilvolles Getöse. In rasender Fahrt, in bedenklich flachem Winkel hüpften sie über die aufgepeitschten Wellen. Binnen Sekunden brodelte der eben noch spiegelglatte See, und die sommerliche Temperatur war empfindlich gesunken. Über dem bleigrauen Wasser und an den Steilhängen der Berge folgte das Stakkato der Donnerschläge auf die zuckenden Blitze.
Als kurz darauf der Regen niederprasselte, beschränkte sich ihre Sicht auf nur noch wenige Meter. Er hörte das nervöse Lachen seines Schwagers. Sie wussten beide, dass die Lage ernst war, doch wie ernst, war nur schwer abzuschätzen. Der Regen stach wie tausend Nadelstiche auf sie nieder, drang ihnen in die Augen und irritierte sie so sehr, dass keiner von ihnen mit der plötzlichen seitlichen Böe rechnete, die mit dreißig, vierzig Meilen pro Stunde auf sie zujagte. Es fühlte sich an wie ein mächtiger Stoß – vielleicht auch schlimmer, dachte er im Nachhinein, wie ein Schuss aus dem Hinterhalt. Jedenfalls war das kleine Boot in ihren unerfahrenen Händen gegen diese Wucht machtlos.
Es blieb nicht einmal Zeit für einen Warnruf. Die Pinne schlug aus, er konnte sie ebenso wenig halten wie die Hauptstagleine, das Boot schlingerte heftig vom Bug bis zum Heck, und schon tauchte das Segel ins Wasser. Kaum ging die erste Welle über das Tuch hinweg, drehte sich der Rumpf in die Höhe – als richtete sich der See plötzlich senkrecht auf und packte das Boot an der Kehle.
Er erinnerte sich genau: zwei Schreie, als sie beide aus dem Boot ins Wasser geschleudert wurden, dann nur noch gurgelnde Laute; unmittelbar darauf das wütende Bersten, Kreischen und Heulen, als das Boot kenterte. Er konnte nicht sagen, ob dieses Heulen von ihm oder von dem Scherwind kam, der ihnen zum Verhängnis wurde. Das eisige Wasser war ein Schock, die Strudel rings um das umgekippte Boot schienen ihn in die Tiefe zu reißen. Zumindest war ihm instinktiv klar, dass er mit aller Kraft schwimmen musste, um nicht unter das Segel zu geraten und zu ertrinken. Als er auftauchte, sah er ringsum nur ein bleigraues Einerlei, hörte das ohrenbetäubende Brausen des Windes, das Wüten der Wellen gegen den Bootsrumpf. Das Wasser brannte ihm in den Augen, er schnappte nach Luft und kämpfte sich mit aller Macht zum Boot zurück. Noch war er am Leben, doch er wusste, dass der Tod auf ihn lauerte.
Unerbittlich.
Er rief nach seinem Schwager:
Teddy! Teddy! Wo bist du?
Hier, Gabe. Auf der anderen Seite.
Erste Reaktion: Gott sei Dank! Aber die schwache Stimme … Vor Angst? Nein. Nur durcheinander.
Alles klar bei dir?
Der Mast hat mich am Kopf erwischt, als wir uns überschlagen haben. Aber ich bin okay. Ein bisschen benommen. Es blutet, glaube ich.
Ich komm rüber.
Nein, geht schon. Bleib da drüben. Besser fürs Gleichgewicht. Ich halt mich am Dollbord fest.
Bleib am Boot.
Sicher. Immer am Boot bleiben. Regel Nummer eins. Das weiß sogar ich.
Sein Schwager versuchte zu lachen, als sei das Ganze ein Scherz.
Meine Schwester bringt dich um, wenn wir nach Hause kommen.
Es klang nicht überzeugend, als er über seinen eigenen Witz zu lachen versuchte.
Ich meine, was bist du denn für ein Kapitän? Im Segelhandbuch hab ich von so was hier jedenfalls nichts gelesen.
Sein erneutes Lachen kam kaum gegen den peitschenden Wind an.
Teddy, nur nicht loslassen! Rede weiter!
Auch wenn es nicht lustig ist?
Nur festhalten!
Okay.
Nur ein Wort, in angespanntem Ton.
Zwanzig Minuten:
Teddy? Wie geht’s?
Halte mich, so gut ich kann. Buchstäblich.
Was macht dein Kopf?
Tut höllisch weh. Meinst du, die suchen nach uns?
Klar, sobald sich das Unwetter ein bisschen legt.
Ja. Fragt sich nur, wann.
Dreißig Minuten: Der Himmel über ihnen war so schwarz wie das Wasser, als verhöhnte er ihre Hoffnung.
Gabe? Gabe!
Ich bin noch da, Teddy. Nur nicht loslassen.
Mir wird verdammt kalt. Die Körpertemperatur sinkt. Hypothermie. Weiß ich noch vom Medizinstudium.
Halte dich nur weiter fest.
Siehst du das Ufer, Gabe? Was meinst du? Hundert Meter? Nicht mal, eher um die fünfzig. Schaffen wir locker.
Bleib beim Boot, Teddy.
Ich weiß, ich kann das schaffen. An der Highschool war ich ein guter Schwimmer. Der beste. Mein Gott, das ist ein Klacks.
Gabe appellierte an die Vernunft seines Schwagers.
Teddy, du bist verletzt, deine nassen Sachen sind tonnenschwer. Es ist immer weiter, als man denkt. Bleib beim Boot. Sie werden uns finden.
Mir ist kalt, Gabe. Ich weiß nicht, ob ich länger durchhalten kann. Wenn ich schwimme, kommt die Durchblutung zurück, den Rest besorgt das Adrenalin, verflucht noch mal. Ich bin sicher, dass ich es schaffen kann. Und sobald ich das Ufer erreicht habe, hole ich Hilfe.
Bleib beim Boot, Teddy, bitte! Die finden uns!
Siehst du hier irgendjemanden? Ich nicht, und es ist wirklich nicht weit.
Teddy, bleib beim Boot!
Bleib du hier. Ich schwimme rüber. Also, bis dann!
Und das war’s.
Es dauerte zwei Tage, bis die Taucher die Leiche seines Schwagers fanden. Zwanzig Meter von der Küste entfernt war Teddy ertrunken. Fast geschafft, sagten sie, aber eben nur fast.
Bei der amtlichen Untersuchung eine Woche später fragten sie Gabe:
Haben Sie das Unwetter nicht kommen sehen?
Wieso hatten Sie keine Schwimmwesten an?
Hatten Sie getrunken?
Nein. Ich weiß nicht. Ja.
Letztlich konnte er es seiner Frau nicht verübeln, als sie fünf Monate danach ihren Sohn nahm und ihn verließ. Sie hatte ihren Zwillingsbruder abgöttisch geliebt. Er war nur wenige Sekunden nach ihr auf die Welt gekommen. Hatten sie sich schon in der Kindheit und Jugend unglaublich nahegestanden, so wuchsen sie als Erwachsene noch enger zusammen. Wie heißt es noch gleich: Zwillinge sind unzertrennlich. Und so kam es nicht wirklich überraschend, als sie eines Morgens ihre Koffer packte und ihm die Visitenkarte des Scheidungsanwalts überreichte. Sie hatten sich nicht einmal gestritten. Seit jenem schicksalhaften Tag hatte er sie kein einziges Mal um Verzeihung gebeten, da er wusste, dass es vergeblich war, sich Hoffnung zu machen. Im Grunde hatte er in dem Moment, als sich Teddy vom Boot abstieß, um gegen alle Vernunft ans unerreichbar ferne Ufer zu schwimmen, gewusst, dass die Trennung von seiner Frau damit besiegelt war. Wahrscheinlich hatte er alles schon geahnt, bevor er das Rettungsboot sichtete, wie wild mit den Armen winkte und nach den kräftigen Händen griff, die ihn auf wundersame Weise aus dem tintenschwarzen Wasser hievten, bevor er sich abtrocknete und aufhörte zu zittern. In jenem einsamen Moment hatte er es begriffen: Wie sehr er sie auch liebte, wie unvorhersehbar dieses entsetzliche Unglück war, sie würde ihm nie mehr ins Gesicht blicken können, ohne dass ihr toter Bruder wie ein vorwurfsvoller Geist neben ihm stand.
2
Cold Cases. Kaltes Herz.
»Legen Sie es darauf an, Ihren Job zu verlieren …«
Gabriel Dickinson war ein Mann, den im Grunde nichts mehr mit dem Leben verband. Ein einziger Moment hatte das Gebäude der Normalität zum Einsturz gebracht. Es war schon spät, als er mit einigem Unbehagen dem Polizeichef gegenübersaß. Durchs Fenster blickte er in einen grauen Abendhimmel, während das sterile Neonlicht an der Decke eine keimfreie Atmosphäre verbreitete, die alle anderen anwesenden Personen vor Ansteckung bewahrte. Die Deputy Chief, eine stämmige Frau mit grauen Strähnen im Haar und von beinahe schroffer Strenge, hielt sich im Hintergrund; gleichwohl entging Gabe nicht, wie oft sie unwillig den Kopf schüttelte oder düster in die Runde blickte. Der Leiter der Personalabteilung – die höfliche Umschreibung für den Job, korrupte Cops loszuwerden, die strafrechtlich nicht zu belangen waren, sowie Rentenansprüche zu kürzen – lehnte an einer Wand neben einer Reihe Fotos, auf denen der Chief, fortlaufend von links nach rechts, dem Bürgermeister, dem Gouverneur und dem Präsidenten die Hand schüttelte. Der Personalleiter hatte ein Notizbuch dabei und schrieb gelegentlich etwas hinein.
»… oder einfach nur sich umzubringen?«
Gute Frage, dachte er. Nicht beantworten, schärfte er sich ein.
Gabe – eigentlich, benannt nach dem gleichnamigen Erzengel, Gabriel – hatte von Kindheit an in New England gelebt. Aufgewachsen war er in einer Kleinstadt unweit der City, in der er jetzt arbeitete, einem idyllischen Ort, berühmt für seine weißen Schindelhäuser und seinen weitläufigen, saftig grünen Anger.
Derlei pittoreske Postkartenmotive gingen der Großstadt, in der er seine Brötchen verdiente, ab. Sein Herz schlug für die Red Sox, die Patriots, Bruins und Celtics, er hielt sich ansonsten eher bedeckt, beklagte sich nicht über den Winter und genoss Frühling und Sommer. Bei aller Zurückhaltung ging ab und zu sein Galgenhumor mit ihm durch, und er platzte mit einer trockenen, ironischen Bemerkung heraus, die nicht immer auf Nachsicht stieß. Seinen Stammbaum konnte er bis zum entfernten Cousin eines berühmten Dichters zurückverfolgen, von dem er zu seiner Beschämung nie eine Zeile gelesen hatte. Als Kind hatte er die Abenteuer von Jules Verne und Der kleine Hobbit verschlungen, als Erwachsener interessierte er sich für Geschichte, insbesondere für den Bürgerkrieg, da einige seiner bedauernswerten Ahnen an Stätten wie Gettysburg oder Antietam ihr Leben gelassen hatten. Dabei faszinierte ihn die Logik der Schlachtführung ebenso wie der Einsatz der Generäle für die Sache, egal, ob richtig oder falsch. Mit einem Masterabschluss in Politikwissenschaft und einem Bachelor in Psychologie, einer ungewöhnlichen Fächerwahl für einen Polizisten, war er ein gebildeter Mann. Seine siebzehn Dienstjahre hatten ihm ein hübsches Vorstadthaus eingebracht. Geheiratet hatte er weit über seinem Stand – im Vergleich zu den Feriendomizilen seiner reichen Schwiegereltern und deren ausgedehnten Reisen nach Europa wirkte sein eigenes Elternhaus – der Vater unterrichtete Mathematik, die Mutter Kunst – beinahe spießig. Sein Jahr als Streifenpolizist – mit fünfundzwanzig – war lange her und weckte keine guten Erinnerungen. Längst kam er in Anzug und Krawatte zum Dienst und brütete am Schreibtisch über Zahlen. Er war Mitglied im Lion’s Club und trat, um sich fit zu halten, samstags am örtlichen College gegen Anwälte, Dozenten und Immobilienmakler beim Basketball an. In den Jahren, in denen sein Sohn in der Little League spielte, war er ehrenamtlich als Trainer tätig gewesen.
Ob sein Sohn jetzt in seinem neuen Heim, in seiner neuen Stadt mit dem Typ, der bald sein neuer Dad ist, trainiert?
Noch vor kurzem hatte es das Leben gut mit ihm gemeint, war sein Leben in geordneten Bahnen verlaufen. Solide – das brachte es wohl auf den Punkt. Verloren: eine Frau, der er treu ergeben war; ein Sohn, den er von ganzem Herzen liebte; einen erfüllenden Beruf. Alles verloren. Von einem Windstoß weggefegt, musste er unwillkürlich denken, einem Windstoß und der fatalen Entscheidung, ans Ufer zu schwimmen. Dabei war es nicht einmal meine Entscheidung.
Gabe wechselte auf seinem Stuhl die Stellung und wappnete sich für den Moment, da das Fallbeil niederging.
Am besten nicht auf die Fragen antworten. Du wirst ohnehin gefeuert. Mach es also nicht noch schlimmer. Andererseits: Wie viel schlimmer kann es noch kommen?
Nachdem ihn seine Frau und sein Sohn verlassen hatten, war er in viele der Verhaltensmuster abgeglitten, die er aus dem Psychologiestudium für einen solchen Fall kannte. Es war mit ihm rapide und steil bergab gegangen, er befand sich im freien Fall. Und wenn sich ihm ab und zu hartnäckig die naheliegende Frage stellte, wieso, ignorierte er sie geflissentlich und überließ sich der Schwerkraft, ohne Widerstand zu leisten.
Er erkannte sich selbst kaum wieder.
Er trank viel zu viel, erschien in denselben Sachen zur Arbeit, in denen er geschlafen hatte, und kündigte sich schon von weitem mit einer Fahne an. Und er war nicht mehr bei der Sache, saß lustlos seine Stunden ab, verpasste Besprechungen mit Präsenzpflicht und wichtige Planungssitzungen. Dank seiner mangelhaften Arbeitsmoral verlegte er – scheinbar unauffindbar – die Antragspapiere für einen Bundeszuschuss zur Anschaffung eines gepanzerten Einsatzfahrzeugs, was ihm einige wütende Wortgefechte mit Kollegen bescherte, die besagte Papiere in wochenlanger Kleinarbeit vorbereitet hatten. Da war es wenig hilfreich, dass ebendiese Verschlusssache wenig später fast hundert Meilen entfernt in der Herrentoilette eines Kasinos entdeckt und vorbeigebracht wurde vom Kartengeber des Blackjack-Tischs, der bei dieser Gelegenheit durchblicken ließ, dass ein deutlich angeheiterter Gabriel am fraglichen Abend über tausend Dollar verzockt hatte. Gegen die Beschimpfungen, die der Vorfall nach sich zog, schoss Gabe mit scharfer Munition zurück, und zwar auf Untergebene, mit Kraftausdrücken, die gewöhnlich Mobbing-Beschwerden oder sogar gerichtliche Beleidigungsklagen nach sich zogen und deshalb von einem Polizeichef, der sich in einer politisch korrekten Welt um sein Image sorgte, in unzähligen internen Memos strikt untersagt worden waren. Bastard. Zicke. Scheißkerl. Fotze. Wichser. Worte, die ihm sonst fremd waren und ihm nun so zwanghaft über die Lippen kamen, als spräche er in Zungen.
Was ist aus mir geworden?, fragte er sich.
Als sei das alles nicht schlimm genug, setzte er zwei Tage später noch einen drauf und ließ sich bei einer Verkehrskontrolle betrunken am Steuer erwischen, mit beachtlichen zwei Promille, die er ins Röhrchen blies. Dabei beschimpfte er die Beamten, die ihn herangewinkt hatten, wehrte sich gegen die Handschellen, die sie ihm anlegten, und drohte ihnen wiederholt, er werde ihre »scheiß Jobs kassieren«, als sie ihn in die Zelle komplimentierten. Jedes Wort war gelallt – leere Drohungen ohne Sinn und Verstand, vom Geist des Alkohols beseelt. Es dauerte ein, zwei Stunden, bis die diensthabenden Beamten merkten, wen sie vor sich hatten – genug Zeit, um knapp eine Unze Marihuana in seiner Jackentasche zu finden, nebst Zigarettenpapier sowie ein Rezept für Valium, ausgestellt auf einen anderen Namen. Dieses nächtliche Desaster hatte damit begonnen, dass ihn die Streifenpolizisten, die vor einem schäbigen Striplokal am Stadtrand parkten, dabei beobachteten, wie er aus der Bar kam und zu seinem Wagen hinübertorkelte und dort die Schlüssel drei Mal fallen ließ, bevor er die Tür aufbekam und sich in Schlangenlinien in den Verkehr einfädelte. Zu einem großen Teil waren seine Verstöße im körnigen Schwarzweiß eines Überwachungsvideos festgehalten, darunter die in der Zelle, auf der er nach wüsten Beschimpfungen plötzlich verstummte, sich krümmte und hemmungslos auf den Boden erbrach.
Er war, so die vorherrschende Meinung im Präsidium, kurz davor, sich völlig zugrunde zu richten, und hatte so viele Leute gegen sich aufgebracht, dass ernsthaft diskutiert wurde, ob man den Vorfall diskret behandeln sollte oder nicht. Einigen Leuten in der Führungsetage juckte es in den Fingern, das brisante Material an die Lokalpresse durchsickern zu lassen und zu sehen, wie es Gabe wohl gefiel, wenn ihm eine Nachrichtencrew die Kamera vors Gesicht hielt und ihm in den Abendnachrichten ein paar spitze Fragen zu dem Video stellte. Wollen doch mal sehen, wie du dich da rausreden willst, Mistkerl. Zu seinem Glück hatte der Chief selbst einmal eine schwierige Scheidung durchgemacht, und solange die Presse nicht Wind von der Verhaftung und Entlassung bekam, schien er vorerst nicht bereit zu sein, seinen Assistant Deputy hängenzulassen – vorerst, wohlgemerkt.
Andererseits hegte der Chief auch nicht die Absicht, die Dinge auf sich beruhen zu lassen, und so wiederholte er seine Frage:
»Gabe, noch einmal: Legen Sie es darauf an, sich umzubringen, oder nur, gefeuert zu werden?«
Gabriel konnte nicht mit Sicherheit sagen, welche der beiden Möglichkeiten der Wahrheit am nächsten kam. Gefeuert traf es wohl eher. Selbstmord hatte er noch nicht erwogen, doch wenn er darüber nachdachte, kam auch das in Betracht – wieso auch nicht? Am liebsten hätte er geantwortet: Wie wär’s mit einer Kombination von beidem?
Er konnte sagen, was er wollte, es würde wie die lahme Ausrede eines flennenden Fünftklässlers klingen, der vorgibt, er habe seine Hausaufgaben im Bus liegengelassen, nachdem sie der Hund gefressen habe. Und so schüttelte er nur stumm den Kopf.
Woraufhin sich der Chief über seinen großen Eichentisch zu ihm vorbeugte und ein verständnisvolles, beschwichtigendes Gesicht aufsetzte – für Gabe die klare Botschaft, dass er so oder so im Arsch war und es nicht besser verdiente. Im Lauf seiner Dienstzeit hatte er genügend Kriseninterventionen gesehen, um zu wissen, worauf diese hinauslief.
»Hören Sie, wir wissen alle, was Sie durchmachen – aber es wird Zeit, sich zusammenzureißen.«
»Ja«, sagte Gabe. Was soll ich auch sonst sagen, verdammt noch mal?
»Dann wollen Sie Ihren Job behalten? Sehe ich das richtig?«
»Ja«, sagte er wieder. Wirklich? Will ich das? Würde ich mich nicht lieber in ein Loch verkriechen, wo mich niemand sieht?
»Also, wir haben uns einen Fahrplan für Sie überlegt.«
Na super! Was könnte demütigender sein?
»Es sei denn, Sie zögen es vor, uns Ihre Waffe und Dienstmarke auszuhändigen …«
»Nein.« Die Marke ist nutzlos, aber ich könnte die Waffe brauchen, um mich zu erschießen.
»Nun, das freut mich zu hören.«
Nicht wirklich, dachte Gabe, ohne es zu sagen.
»Ich werde tun, was Sie wünschen«, erwiderte er stattdessen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. »Was sieht Ihr Plan vor?«, fragte er.
»Wöchentliche Therapiesitzungen bei unserem Polizeipsychologen …«
Komm schon, das war abzusehen.
»Regelmäßiges Erscheinen bei einer Alkoholiker-Selbsthilfegruppe.«
Das ist die übliche Vorgehensweise. Damit kommst du klar. Vielleicht hilft es sogar. Selbstverständlich hilft es. Wenn du es willst. Was nicht der Fall ist.
»Wir nehmen Sie aus den Planungs- und Strategieausschüssen raus …«
Keine große Überraschung. Ich kann nicht mal eine Strategie entwickeln, um morgens aus dem Bett zu kommen.
»Und wir ändern Ihre Zuständigkeiten. Bis Sie wieder auf die Reihe kommen, werden Sie für so gut wie gar nichts zuständig sein.«
Na schön, was soll’s. Ich würde genau dasselbe mit mir machen, wenn ich über mich zu entscheiden hätte.
»Und was soll ich stattdessen tun?«, fragte er gefasst und wunderte sich für einen flüchtigen Moment, wo der alte Gabe, der selbstbewusste, dynamische Senkrechtstarter, geblieben war. Der Gabe, erkannte er wehmütig, klammerte sich immer noch verzweifelt an ein Boot im Sturm.
»Wir richten eigens eine neue Stelle für Sie ein, Gabe. Sie behalten Ihren Rang und Ihre Besoldungsklasse als Assistant Deputy Chief. Aber de facto wechseln Sie in das Ressort Cold Cases. Zumindest auf dem Papier werden Sie die Abteilung leiten. Bislang existiert sie noch nicht, weil diese alten ungelösten Fälle den Betrieb aufhalten. Sie wissen schon …«
Und ob.
»Also, im Klartext erwarten wir gute, solide Polizeiarbeit von Ihnen. Sie nehmen sich alte, ungelöste Verbrechen vor und sehen zu, ob Sie neue Erkenntnisse gewinnen können. Sie hängen sich ans Telefon, sichten die Akten, setzen sich vielleicht mit dem einen oder anderen Zeugen in Verbindung. Bringen uns fortlaufend auf den Stand der Dinge. Und wenn Sie auf etwas Neues stoßen, das weiterverfolgt werden sollte, übergeben Sie die Sache an einen Detective vom Morddezernat.«
Perfekt, war sein erster sarkastischer Gedanke, gefolgt von der nicht weniger ironischen Überlegung: Ich war ein lausiger Streifenpolizist und als Ermittler ein hoffnungsloser Fall. Als Bürohengst kann mir so schnell keiner das Wasser reichen, ich bin der geborene Sesselfurzer. Also, wie’s aussieht, ist mir dieser Job auf den Leib zugeschnitten. Doch er behielt seine Gedanken für sich.
»Demnach nehme ich mir alte Fälle vor, sehe, ob ich etwas auftun kann, und wenn ja …«
»Kümmern sich die Kollegen vom Morddezernat darum.«
Beschränke dich auf das öde Kleinklein, und falls du dann tatsächlich etwas findest, das auch nur vage von Interesse sein könnte, reiche es an andere weiter. Die Lorbeeren natürlich auch. Eindeutig ein Job, bei dem ich nichts Wichtiges vermasseln und niemandem auf die Zehen treten kann.
Gabe nickte – auf einer Eisscholle ausgesetzt, um in arktischen Gewässern dahinzutreiben, oder ohne Essen und Wasser auf einer gottverlassenen Insel. Beschäftigungstherapie, um dem widerspenstigen Gabe die Flausen auszutreiben. Schon verstanden. Von jetzt an bin ich hier in der Behörde Robinson Crusoe. Und ganz nebenbei würde es sich für den Chief ganz gut machen, wenn Gabe was ausgrübe und sein Boss sich vor ein paar befreundete Reporter hinstellen und verkünden könnte: Seht her, wir haben einen unserer besten Verwaltungsbeamten abgestellt, sich diese alten Fälle noch einmal vorzunehmen. Unsere Behörde vergisst nie. Noch ein wichtiger Dienst, den wir den Bürgern unserer Stadt erweisen. Und diese Reporter wird er zusammentrommeln, kurz bevor er beim Stadtrat seinen neuen Etat durchboxen will.
»Alle wollen, dass Sie sich wieder in den Griff bekommen, Gabe. Kriegen Sie das hin!«, schloss der Chief und signalisierte mit einer wischenden Handbewegung, dass die Unterredung beendet war. Klar, die können’s kaum erwarten, so viel steht fest.
Dann wurde ihm klar, dass sie ihm in Wirklichkeit eine Gnadenfrist von einem halben Jahr gewährt hatten. Sie wollen, dass ich mich zusammenreiße, mich wieder wie ein normales, umgängliches menschliches Wesen benehme. Da können sie lange warten. Am Ende feuern sie mich ja doch. Ich kann mir in diesem Pseudojob mit den kalten Fällen den Arsch aufreißen, wie ich will, es wird ihnen nie genügen, entweder weil ihnen die Fälle nicht wichtig genug sind, oder ich mich nicht genug ins Zeug gelegt habe, und dann fliege ich hochkant raus. Du bist angezählt, Kumpel.
Man konnte ihm einiges nachsagen, aber nicht einen Mangel an Realismus.
Darauf könnte ich einen Drink vertragen. Oder auch zwei. Oder drei?
»Arbeite ich bei diesem Job allein?«, fragte er.
Zu seiner Verwunderung schüttelte der Chief den Kopf. Der Personalleiter reichte dem Boss eine Akte, die der Chief umdrehte und über den Schreibtisch Gabe entgegenschob. »Wir haben da jemanden als Ihre Partnerin im Auge.«
3
Den Kopf des Dokuments, das sie in Händen hielt, zierte ein Stempel mit dem Schriftzug: Fall geschlossen. Kein weiterer Handlungsbedarf. Die Worte waren in feuerroten, fetten Druckbuchstaben aufgestempelt, als sollten sie signalisieren, damit sei alles gesagt.
Geschlossen ist eine interessante Wortwahl, dachte Marta Rodriguez-Johnson. Eigentlich müsste es bedeuten, dass etwas vorbei ist. Abgeschlossen. Fertiggestellt. In trockenen Tüchern.
Zeit, sich neuen Aufgaben zuzuwenden.
Das hielt sie für eher unwahrscheinlich.
Neuanfang.
Wohl kaum.
Nach vorne sehen.
Kannst du vergessen.
Sie holte tief Luft und schüttelte in einer hilflosen Geste mehrmals den Kopf.
Das ist eine schamlose Lüge. Und ob es Handlungsbedarf gibt! Es gibt jede Menge Handlungsbedarf, heute, morgen, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr und vielleicht für den Rest meines Lebens.
Sie faltete das Dokument sorgfältig zusammen und steckte es in den großen Lederbeutel, der ihr zugleich als Hand- und Aktentasche diente und neben dem Papierkram Platz für ihre nagelneue Reservewaffe bot, einen kleinen Revolver, Kaliber .38, den sie mit Hohlspitzgeschossen lud – wegen ihres Dumdum-Effekts von ihren Vorgesetzten ausdrücklich verboten. Aber darum scherte sie sich längst nicht mehr. Eine Nahkampfwaffe, so ihr Kalkül. Nützlich für den Notfall.
Eine Nahkampfwaffe. In ihrer Wirkung nicht zu unterschätzen, wie sie aus eigener Erfahrung wusste.
»He, Marta, schön, Sie zu sehen. Geht’s einigermaßen?«
»Wird schon, es war …« Sie wollte sagen, hart oder schwer oder sogar unerträglich. »… nicht so schlimm.«
Nicht so schlimm. Was für ein Witz!
Der Eigentümer des Waffengeschäfts nickte. Mit dem langen grauen Pferdeschwanz im Alt-Hippie-Stil hob er sich von seiner Klientel mit Bürstenschnitt ab – überwiegend Polizisten, sowohl örtliche Cops als auch Staatspolizei. Der Hausfrau aus der Vorstadt auf der Suche nach einem rosafarbenen Pistölchen zur Selbstverteidigung bei einem nächtlichen Einbruch begegnete man in diesem Laden ebenso selten wie dem übergewichtigen taffen Typ mit Stiernacken und rotem Gesicht, der sein Arsenal um die neueste gefechtstaugliche Halbautomatik bereichern möchte, weil er nicht tatenlos zusehen will, wie ihm eines Tages die Liberalen, die Schwarzen, die Anwälte oder die Regierung alles, was er sich hart erarbeitet hat, unter dem Hintern wegziehen. Nirgends standen die T-Shirts der National Rifle Association mit dem Slogan Meine Waffe kriegt ihr nur über meine Leiche zum Verkauf. Zur Abschreckung von Gangstern, die nicht kapierten, dass es in dem Laden von Polizisten in Freizeitkleidung wimmelte, trug der Ladenbesitzer deutlich sichtbar eine Neun-Millimeter an der Hüfte und hielt eine kurzläufige Mossberg-Flinte unter der Theke bereit. Der Mann war eine Institution, eine Art Vertrauensmann, ein Stimmungsbarometer für die Befindlichkeit der Volksseele, jemand, bei dem man etwas loswerden konnte – etwa so wie beim Barkeeper in einer Kneipe. Die Cops kamen auf einen Plausch herein, erzählten ihm, wie der Tag für sie gelaufen war, und fühlten sich danach ein wenig besser. Der Mann hörte zu, die Leute mochten ihn. Man brauchte nicht einmal etwas zu erwerben – auch wenn es die meisten taten, erst recht, nachdem sie ihm ihr Herz ausgeschüttet hatten.
»Womit kann ich Ihnen dienen, Detective?«
Sie hatte bereits die Hand in ihrer Tasche und zog behutsam eine versilberte Neun-Millimeter Smith and Wesson hervor – dieselbe Waffe, die sie im Dienst an der Hüfte getragen hatte und die immer noch in einer Plastiktüte mit der Aufschrift Beweismittel steckte.
»Die habe ich heute von der Ballistik zurückgekriegt«, kam sie gleich zur Sache.
Der Ladenbesitzer nickte.
»Man hat sie beschlagnahmt, ich meine, nach dem …«
Wieder suchte Marta nach dem richtigen Wort. Unfall? Tragischen Vorfall? Mord?
Der Besitzer half ihr aus der Klemme: »Schon klar, das übliche Verfahren. Ist schließlich Vorschrift nach einer Schießerei unter Beteiligung eines Polizisten.«
Mühsam brachte sie ihr Anliegen heraus: »Ich kann sie nicht behalten.«
Womit sie eigentlich meinte: Ich kann sie nicht einmal anrühren.
Für einen Moment trat zwischen ihnen Schweigen ein – es tat gut, ohne umschweifige Erklärungen verstanden zu werden. Er griff über die Theke und nahm die Waffe entgegen. Erleichtert sah Marta zu, wie sie aus ihrer Reichweite verschwand.
»Dieselbe?«, fragte er. »Oder was anderes?«
»Nein«, erwiderte sie auf die erste Frage, die er ihr stellte. »Aber ich brauche trotzdem etwas Schweres …«
»Eine Beretta Kaliber .40«, sagte er prompt und mit dem nötigen Nachdruck, um sie aus ihren Gedanken zu reißen. Er holte ein Schlüsselbund aus der Hosentasche, öffnete eine Vitrine und nahm eine mattschwarze Halb-Automatik von der Auslage. »Funktioniert im Prinzip so wie die Neuner. Ein wenig schwerer, aber genauso zielgenau und mit ein bisschen mehr Durchschlagskraft.«
Martas Hand schwebte über der Waffe. Es kostete sie ungeheure Willenskraft, danach zu greifen.
Andere Farbe, anderes Gewicht, anders in der Hand. »Gut«, sagte sie nach einem flüchtigen Blick. »Ich nehm sie.«
»Wollen Sie sie vielleicht für ein paar Tage auf Probe haben, Detective? Erst mal auf dem Schießstand ausprobieren? Wieder in Übung kommen? Ein paar Schachteln Munition abfeuern?«, schlug ihr der Ladenbesitzer vor. »Ein Gefühl dafür entwickeln. Rate ich vielen Cops, die zu einer anderen Waffe wechseln wollen. Und wenn Sie sich ganz sicher sind, dass die Pistole für Sie das Richtige ist, erledigen wir den Papierkram. Sie müssen mit der neuen richtig vertraut sein, das ist wichtig, Detective.«
»Nein, ich bin damit zufrieden«, antwortete sie hastig. Es ist unumgänglich, so lange zu üben, bis die Waffe dein verlängerter Arm ist, sagte die Stimme der langjährigen Polizistin in ihr, während eine andere umso beharrlicher drängte: Steck sie ein und rühr sie niemals an.
Marta machte sich nichts vor: Einerseits zuckte sie vor der Berührung einer Handfeuerwaffe zurück wie vor einer giftigen Schlange, andererseits wusste sie genau, dass ihre Zukunft daran hing, souverän mit einer Schusswaffe umzugehen, wenn sie den Karriereknick überwinden wollte.
Der Mann hinter der Theke drehte sich um und holte aus einem Regal an der Rückwand eine graue Stahlkassette mit einem Zahlenschloss hervor. Mit wenigen Drehungen stellte er die Kombination ein und öffnete den Deckel. In dem Kasten steckten Hunderte Karteikarten in alphabetischer Reihenfolge. »Ich kann mir einfach nicht merken, ob ich Sie unter R oder J habe«, sagte er lachend. Nach kurzem Blättern zog er eine Karte hervor, die ihren Namen enthielt, samt Dienstmarkennummer, Rang, Abteilung, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Unter den Informationen zur Person sah sie ihre alte Waffe aufgeführt. Der Ladenbesitzer strich die Zeile mit der Bezeichnung »S/W 9mm« und der entsprechenden Seriennummer sowie anderen Merkmalen durch und notierte die Daten der Beretta darunter. Dann versah er die Neun-Millimeter mit einem Datum und schrieb zurückgegeben daneben.
»Soll ich Ihre alte Waffe, ähm, entsorgen?«, fragte er, als das erledigt war.
»Ja, bitte, ich meine, bitte verkaufen Sie sie nicht weiter. Vernichten Sie das Ding.«
»Geht klar, Detective. Eine Unglücksknarre.«
Er nahm die Asservatentüte mit der Neun-Millimeter und verstaute sie außerhalb ihres Blickfelds. Wieder fiel eine Last von ihr ab.
Als er sich anschickte, ihre Karteikarte wieder in den Kasten zu stecken, platzte sie heraus: »Ich brauche auch noch eine Reservewaffe. Etwas Kleines, Zuverlässiges.« Als es heraus war, wunderte sie sich selbst, woher dieser plötzliche Impuls kam, doch er war stark, übermächtig. Eine Waffe war nicht annähernd genug – auch wenn sie nicht hätte sagen können, warum. Sie ließ den Blick über die Schaukästen vor ihr und das Arsenal an den Wänden schweifen. Revolver und Automatikwaffen; halbautomatische Gewehre; Schrotflinten, Präzisionswaffen für Heckenschützen – ein stolzes Aufgebot an tödlicher Kraft. Gewehre, die aus einer Meile Entfernung töteten, Pistolen für kurze Distanzen. War sie eben noch vor der Beretta zurückgeschreckt, fühlte sie sich im nächsten Moment von dem gesamten Angebot magisch angezogen. Am liebsten hätte sie dem Mann den ganzen Laden ausgeräumt. Sie wollte sich schützen, sicher fühlen, auch wenn sie es, wie ihr eine nagende Stimme ins Gedächtnis rief, nicht verdiente. Ihr Zwiespalt war gefährlich, doch sie sah sich außerstande, in die widerstreitenden Gefühle Ordnung zu bringen oder sie wenigstens zu verdrängen und unter Kontrolle zu halten.
Er sah sie erstaunt an. »Sicher? Ich dachte, die Polizei gestattet ihren Detectives keine zusätzliche Feuerkraft.«
»Ja, sicher«, log sie.
»Sie wollen demnach etwas Kleines, das Sie verstecken können?«
»Ja, genau.« Dabei wurde ihr in diesem Moment klar, dass sie aus den reichhaltigen Auslagen jede Knarre genommen hätte, egal, welche Größe, Leistung, Form und Funktion. Hätte er ihr ein Maschinengewehr angeboten, hätte sie geantwortet, klar, genau daran habe ich gedacht. Wieso nicht ein Raketenwerfer? Eine Haubitze oder gleich eine Kanone? Die Reproduktion einer Vorderladermuskete aus dem Unabhängigkeitskrieg wäre auch nicht ohne.
Er griff unter die Theke und holte einen Revolver Kaliber .38 aus der Vitrine, eine kurzläufige Version der alten Policeman’s Special aus den zwanziger Jahren, und schob sie ihr hin. Im Vergleich zu der Beretta, die sie gerade kaufte, und der Neun-Millimeter, die sie zurückgegeben hatte, lag sie federleicht in der Hand.
»Allerdings richten Sie damit nicht viel aus, es sei denn, Sie laden sie mit etwas Substanziellem, mit Magnum-Patronen zum Beispiel«, erklärte er. »Aber sie hat Handtaschenformat oder passt in ein Knöchelholster. Oder ins Handschuhfach, für den Notfall. Und für die Zuverlässigkeit verbürge ich mich. Das Ding ist unverwüstlich, ob Sie es in den Dreck fallen lassen oder damit schwimmen gehen. Was sag ich – nageln Sie damit ein Bild an die Wand, wenn gerade kein Hammer zur Hand ist, und auf kurze Distanz trifft die Kleine immer noch präzise. Die hier ist ein Qualitätsfabrikat, hatte noch nie Reklamationen, auch wenn es nicht mehr viele Cops gibt, die so eine benutzen.«
»Gut«, sagte sie, »ich nehme sie.« In meiner Handtasche, zusammen mit Make-up und Lippenstift, Brieftasche und Kreditkarten, Dienstmarke und Wagenschlüsseln, neben meinem Notizbuch und Stift einfach nur weiterer Schnickschnack für alle Lebenslagen.
»Es ist eine gute Nahkampfwaffe«, fasste der Verkäufer seine Empfehlung zusammen.
Eine Waffe, dachte sie, für den Moment, da ich den Atem eines Mörders an der Wange spüre.
An diesem Abend brachte sie wie immer ihre siebenjährige Tochter zu Bett und vergewisserte sich, dass ihre Mutter anderweitig beschäftigt war, bevor sie vor dem Bodenspiegel im Schlafzimmer in Stellung ging und eine Stunde lang übte, ihre neue Waffe zu ziehen. Die Beretta lag auf ihrem Nachttisch, der Revolver Kaliber .38 blieb in ihrer Handtasche versteckt. Zu Probezwecken hielt ein Schraubenschlüssel her, der zwar ganz anders geformt war, aber zumindest in etwa so viel wog wie die Beretta. Ihr ging es darum, Ziehen und Laden der Waffe sowie beidhändiges Zielen wieder in einer fließenden Bewegung zu beherrschen, bis es ihr – so wie früher – zur zweiten Natur geworden war. Als müsste ich von neuem laufen lernen, dachte sie frustriert. Muskelgedächtnistraining. Sie stellte sogar ein Metronom auf, um die Taktschläge zu zählen: Eins: Beide Hände schwingen an die Seite. Die Rechte löst die Sicherungslasche, während die Linke das Holster hält. Zwei: Die Rechte zieht die Waffe heraus, wobei sich der Zeigefinger um den Abzug legt, die linke Hand gleitet zum Schlitten. Drei: Die linke Hand führt das Magazin ein und fasst die Waffe anschließend seitlich, um ihr Halt zu geben, die rechte hebt sie genau in Schulterhöhe. Dann mit den Knien in eine leichte Beuge, den Lauf entlang zielen. Abdrücken.
Schießen.
Ich kann das.
Ich muss es können.
Sie zielte den Schraubenschlüssel entlang. Ihre Spielzeugwaffe.
Einundzwanzig – zweiundzwanzig – dreiundzwanzig. Peng.
Mehr Zeit habe ich nicht.
Das Metronom machte klick – klick – klick.
Dann bleibt mein Partner vielleicht am Leben.
Und ich auch.
Der Nachmittag ging zur Neige; durchs Fenster fiel ein letzter Sonnenstrahl auf das gerahmte Diplom von der Yale University, blendete sie und lenkte sie ab. Die Frage kam wie von ferne, wie ein schwacher Widerhall, in einer ihr unverständlichen Sprache.
»Also, Marta, haben Sie immer noch Alpträume?«
Sie schwieg. Als hätte jemand den Ton auf volle Lautstärke gedreht, schien ihr jemand die Frage plötzlich ins Ohr zu brüllen.
»Marta? Alpträume?«
»Ja.«
»Oft?«
»Ja.«
»Wie oft?«
Sie nahm sich die Zeit, das schwarze Haar zurückzustreichen, das ihr ins Gesicht gefallen war. Jede verfluchte Nacht.
»Können Sie mir diese Träume beschreiben?«
»Ich weiß nicht, ob ich das möchte.«
Schweigen. Eine stumme Aufforderung.
»Meinetwegen, ich versuch’s.«
Sie überlegte einen Moment.
Der Polizeipsychologe wartete scheinbar ungerührt, was Marta auf die Palme brachte.
»Eins ist jedes Mal gleich«, sagte sie schließlich.
»Ja?«
»Ich bekomme keine Luft. Entweder unter Wasser oder in einem luftleeren Raum; oder mir wird etwas in den Rachen gestopft. Und egal, wie ich würge, bekomme ich es nicht heraus. Ich kann auch die Hände nicht zu Hilfe nehmen. Sie sind gefesselt, mit Stricken oder Ketten. Davon wache ich dann auf. Manchmal mit einem Schrei.«
»Stricke und Ketten?«
»Ja.«
»Oder vielleicht Handschellen wie bei Ihrer Dienstausrüstung?«
Sie antwortete nicht. Sie hätte schreien können, genauso wie beim Erwachen aus einem Alptraum.
Es trat eine Gesprächspause ein. Der Psychologe nickte. Er hatte die Ellbogen aufgestützt und die Fingerspitzen so zusammengelegt, als wolle er beten, brächte es aber doch nicht über sich, eine höhere Macht anzurufen. »Und wie erklären Sie sich diese …«, fing er an, doch Marta schnitt ihm das Wort ab.
»Ziemlich offensichtlich, finden Sie nicht?«
Es tat gut, den Mann mit ihrer rüden Unterbrechung aus dem Konzept zu bringen. Sie beobachtete gespannt, ob sich in seinem Pokerface etwas rührte. Fehlanzeige.
Ohne mit der Wimper zu zucken, schwieg er sie weiter an.
»Wie gesagt, ich hab das Gefühl zu ersticken, als ob mir das, was passiert ist, die Kehle zuschnürt.«
Marta schnappte nach Luft. Sie hätte gleichzeitig heulen und vor Wut schreien können. Es juckte ihr in den Fingern, die Lampe des Seelenklempners zu nehmen und mit voller Kraft auf den Schreibtisch zu knallen – oder noch besser dem Psychologen über den Schädel. Sie malte sich das Geräusch und die Konfusion aus. Sie schwankte zwischen zwei Polen hin und her: Rotz und Wasser zu heulen oder vor Wut zu platzen.
Ja nicht ausflippen!, ermahnte sie sich. Immer schön mit der Ruhe! Tief durchatmen. All das, was du in dieser verfluchten Nacht nicht konntest.
»Denken Sie noch an das, was im Keller passiert ist?«, fragte er.
Jede Minute. Nein, jede Sekunde.
»Natürlich, immer mal wieder«, sagte sie. »Ist doch wohl normal, oder? Aber ich weiß natürlich, dass es ein Unfall war.«
Sie rechnete nicht damit, dass er ihr die Lüge abkaufte.
Für einen Moment fühlte sie sich versucht, in ihre Tasche zu greifen und unter ihrer Nahkampfwaffe die mitgebrachten Bescheinigungen hervorzukramen; sie dem Seelenklempner unter die blasierte Nase zu halten und zu sagen: »Hier. Ich bin von jeder Schuld freigesprochen. Hundert Prozent. Alles ist gut. Dann mach ich mich mal vom Acker.«
»Ich wollte ihn nicht töten«, sagte sie stattdessen.
Sie bemühte sich um einen sachlichen, verbindlichen Ton, um wieder arbeitstauglich geschrieben zu werden. Sie konnte nur hoffen, dass der Psychologe nicht hörte, wie sie bei ihrer Antwort einen Schluchzer unterdrückte.
Erneutes Schweigen. Die Stille im Raum dröhnte ihr wie Presslufthämmer in den Ohren. Nach einer quälenden Funkstille von gefühlten zehn Minuten, tatsächlich wohl eher zehn Sekunden, brach der Arzt sein Schweigen mit einer schlichten, stichhaltigen Bemerkung.
»Natürlich wollten Sie es nicht. Aber Sie haben es getan.«
Das Stimmengewirr in ihrem Kopf brach wie das Heulen von Sirenen los: Er war mein Partner. Mein Freund. Alles, was ich im Rauschgiftdezernat gelernt habe, verdanke ich Detective Tompkins. Wir waren echte Kumpel. Es war ein Unfall. Es war dunkel. Pechschwarze Nacht. Als ob sich ein Loch in der Erde aufgetan hätte. Wir wussten, dass der Dealer bewaffnet war. Er hatte bereits zwei Mal auf uns geschossen. Vorschriftsmäßig haben wir Verstärkung angefordert. Wahrscheinlich hätten wir besser auf die Kollegen gewartet. Und wir hätten niemals in diesen Keller gehen sollen. Aber der Kerl war drauf und dran, uns zu entwischen, und uns pochte das Adrenalin in den Adern. Wir arbeiteten schon seit Wochen an dem Fall und wollten nicht, dass er sich einfach so in Wohlgefallen auflöst. Wir hätten uns wohl auch nicht trennen sollen, aber wir wussten nicht, wo er war. Auf jeden Fall da drinnen. In irgendeinem dunklen Winkel.
Gut versteckt. Mit der Waffe im Anschlag und dem Risiko, selbst draufzugehen. Schon mal in einem Crackhouse gewesen, Doktor? Schon mal jemanden auf PCP erlebt? Ich hatte keine Zeit zu überlegen. Ich hörte, wie jemand ein Magazin einschob. Das müssen Sie selbst gehört haben, wenn Sie wissen wollen, was für eine scheiß Angst dieses Geräusch einem einjagt, ganz allein und im Dunkeln. Ich dachte, das war’s für mich. Erst nachdem ich den Schuss abgefeuert hatte, erkannte ich, dass es Detective Tompkins war. So hat es auch der Untersuchungsausschuss gesehen. Scheiße! Hätte sich dieser Drecksack ergeben, als wir ihn dazu aufgefordert haben, wäre das alles nicht passiert.
Wäre das alles nicht passiert.
Wäre das alles nicht passiert.
Diese Lüge hallte von den Kraterwänden in ihrem Innern wider.
Nein, es ist keine Lüge. Es ist die Wahrheit.
In der beklemmenden Stille der psychologischen Praxis konnte sie beides nicht mehr auseinanderhalten. Die Erinnerung drückte ihr die Kehle zu. Sie merkte, wie ihr Tränen in die Augen traten und die Wangen herunterliefen. Sie war verwirrt, konnte nicht glauben, dass es ihre eigenen Tränen waren. Aber wer hätte sonst in diesem Praxiszimmer flennen sollen? Zwei Martas: eine hartgesotten, eine schwach. Eine bereit, sich jedem Problem zu stellen, die andere versucht, sich davonzustehlen und zu verkriechen. Ihr war bewusst, dass sie sich für eine der beiden entscheiden musste, fragte sich nur, für welche.
Der Arzt reichte ihr ein Papiertaschentuch und warf zugleich einen dezenten Blick auf seine Schreibtischuhr.
»Ich denke, wir sollten noch einmal darüber sprechen. Aber für heute ist unsere Zeit leider um. Der nächste Patient wartet schon.«
Marta nickte und griff nach ihrer Tasche. Wie blöd kann man sein!, dachte sie. Hast du wirklich geglaubt, du brauchst dem Seelenklempner nur diese Papiere hinzuknallen, die dir schwarz auf weiß bescheinigen, dass du juristisch gesehen aus dem Schneider bist?
Sie stand auf. Der Psychologe deutete zur Tür.
»Freitag, um zehn«, sagte er. »Bis dahin.«
»Ja.«
Marta trat in ein kleines Wartezimmer, wo auf einem durchgesessenen, abgewetzten Sofa mit trauriger Miene ein Mann in mittlerem Alter saß. Er kam ihr irgendwie bekannt vor, auch wenn sie nicht auf Anhieb wusste, woher. Sie musterte ihn: hochgewachsen, drahtig, athletisch, mit einem Anzug über den breiten Schultern, der mal in die Reinigung gehörte, leuchtend bunte Krawatte, dunkelbraunes Haar, um einiges länger, als es der Dienstetikette entsprach, und einem bekümmerten Blick.
»Sind Sie Detective Rodriguez-Johnson?«, fragte er, als er sie sah.
»Ja«, sagte sie. »Und Sie sind …?«
»Assistant Deputy Chief Gabriel Dickinson«, antwortete er. »Aber de facto zum Detective degradiert.« Als er ein schiefes Grinsen aufsetzte, hellte sich sein Gesicht für einen Moment auf. Er hielt ihr die Hand hin. »Wir werden zusammenarbeiten.«
Etwas verblüfft erwiderte sie den Gruß.
»Zusammenarbeiten?«, wiederholte sie. »Ich dachte, ich wäre noch suspendiert.«
»Offenbar nicht«, erwiderte er nur. Bevor sie eine weitere Frage stammeln konnte, reichte er ihr eine amtliche Stellenzuweisung, ihr Name deutlich sichtbar in der obersten Zeile. Sie überflog den Text darunter.
»Ich dachte, ich kehre ins Rauschgiftdezernat zurück«, sagte sie.
Der Tag nach der Schießerei. Auf ihrem Weg zum Dezernat für interne Ermittlungen, wo sie eine Erklärung abgeben musste, hatte sie kurz an ihrem Schreibtisch haltgemacht – eine Weile gebraucht, bis sie registrierte, dass sie von sämtlichen Kollegen im Raum angestarrt wurde. Und dass es bei ihrem Erscheinen mucksmäuschenstill geworden war.
Niemand hatte auch nur ein Wort zu ihr gesagt.
Ich konnte nichts dafür!, hätte sie schreien können.
Doch als sie das Büro wieder verließ, hatte sie die Lippen zusammengepresst und gewusst, dass ihr jeder Blick das Gegenteil sagen sollte: Und ob!
»Nein, Ihnen wurde ein neuer Aufgabenbereich zugewiesen«, sagte der große Mann.
Aber ich will zurück, auch wenn mich alle hassen und mir nie wieder jemand vertraut, redete sie sich ein.
»Cold Cases?«, las sie laut.
»Ja«, bestätigte er.
In ihrem Kopf jagten sich die Gedanken. Was zum Teufel soll ich da? Und was ist das für ein Job? Ich gehöre ins Drogendezernat! Doch nachdem sich der erste Aufruhr in ihrem Kopf gelegt hatte, dämmerte ihr: Wahrscheinlich denken sie, dass ich dort niemanden umbringen kann. Oder sie hoffen es zumindest.
Ihr lag schon eine scharfe Bemerkung auf der Zunge, als hinter ihr der Psychologe in der Tür erschien. »Chief Dickinson«, sagte er, »ich wäre dann für Sie da.«
Mit einem Achselzucken lächelte Gabe Marta noch einmal zu. »Ich bin dran«, sagte er, trat an ihr vorbei und zog die Tür hinter sich zu. Für einen Moment glaubte sie, er hinke, doch dann begriff sie, dass sein unsicherer Gang nicht auf eine Behinderung zurückzuführen war.
4
Ein kleiner Raum. Eher eine Abstellkammer. Zwei verdreckte Fenster mit Blick auf einen windgepeitschten Parkplatz. Zwei verkratzte Schreibtische aus Stahl. Zwei unbequeme Stühle. Zwei veraltete Computer. Ein Faxgerät. Ein Drucker. Telefone. Ein paar leere Aktenschränke, passend zu den verkratzten Tischen. Eine fleckige Kaffeemaschine, die beim Aufbrühen asthmatisch röchelte. Auf einem wackeligen Holztisch, in dessen Platte jemand penibel eine Obszönität geschnitzt hatte, lagen, wahllos durcheinander, braune Pappordner mit dem charakteristischen Geruch nach einem staubigen Keller, in dem sie sehr lange vor sich hingemodert haben mussten. Einige davon waren offensichtlich in grauer Vorzeit so oft geöffnet und gesichtet worden, dass sie fleckig und zerknittert und an den Ecken ausgefranst waren.
»Nicht viel Glanz in dieser Hütte«, sagte Gabe beim Anblick ihrer neuen Arbeitsstätte, während er seiner Kollegin die Tür aufhielt.
Marta lag schon die Bemerkung auf der Zunge: Passend zu unseren Glanznummern in letzter Zeit, doch sie schluckte sie herunter.
Mit finsterer Entschlossenheit erwiderte sie vielmehr: »Ist ein Anfang. Legen wir los.«
Statt jedoch den Worten die Tat folgen zu lassen, trat sie an eins der schmutzigen Fenster und starrte hinaus. Sie spuckte auf einen Finger, wischte ein handtellergroßes Stück der Scheibe frei und machte Inventur: »Sechs Bäume. Vielleicht drei Büsche. Ein paar Laternen, Stromleitungen und ein Müllcontainer in der Ecke. Nicht gerade eine berückende Aussicht, aber immerhin können wir von hier aus sehen, wer kommt und geht. Falls uns das mal von Nutzen sein sollte.«
»Beim Drogendezernat …«, fing Gabe an.
»Da haben sie eine Menge Geld reingesteckt. Neueste Technik, alles vom Feinsten«, antwortete Marta mit einem Achselzucken. Aber in dem Kellerdrecksloch gegen einen Dealer, der vollgedröhnt war mit PCP, hat mir das ganze Hightech-Zeug herzlich wenig genützt.
Gabe ging zu dem Tisch mit den Akten. Zweihundert, rechnete er überschlägig. Vielleicht auch ein paar mehr. Von mir aus dürfen es auch tausend sein, dachte er. Er tippte mit dem Finger auf den obersten Ordner und fragte mit aufgesetztem Optimismus: »Sollten all diese Fälle nicht in dem neuen Computersystem gespeichert sein?« Niemand hätte die Frage besser beantworten können als er, denn er hatte dem Team angehört, das drei Jahre zuvor die Hightech-Ausrüstung angeschafft und die Digitalisierung der aktuellen Verhaftungs- und Ermittlungsberichte zu wohlgeordneten, leicht abrufbaren Computerdateien beaufsichtigt hatte. Dabei hatten sie ältere Ermittlungsverfahren, besonders solche, die im Sande verlaufen waren, in Anbetracht der Personalkosten unberücksichtigt gelassen.
Allein schon der Anblick des Stapels legte sich Gabe wie eine dunkle Wolke aufs Gemüt.
»Alte Fälle«, erwiderte Marta. Auch sie kannte die Antwort. »Gute, alte Handarbeit.« Sie wedelte mit einem Bleistift in der Luft.
So viel schon mal, resümierte er, zu Rasterfahndung, digitalem Abgleich von Namen, Daten, Örtlichkeiten, Übereinstimmungen mit anderen Verbrechen, Abruf von Ballistikberichten, Zugriff auf die nationalen Cold-Case-Datenbanken und moderne Algorithmen, um Spuren nachzugehen.
»Himmel.«
»Sie sagen es, ohne die Hilfe von oben werden wir wohl nicht weit kommen. Was meinen Sie? Sollen wir beten?«
»Wahrscheinlich keine schlechte Idee«, sagte Gabe und verzog das Gesicht zu einem gequälten Grinsen.
Sie brauchten ein wenig Zeit, um sich an ihren Schreibtischen einzurichten und ihre Computer hochzufahren. Als das erledigt war und sonst nichts weiter anstand, schnappte sich jeder von ihnen eine Akte. »Wir müssen uns auf eine Systematik verständigen, um die alle durchzuarbeiten«, bemerkte Marta. »Ich meine, so was wie gemeinsame Suchkriterien.«
Mehr sagte sie nicht.
Beim Anblick des staubigen Haufens hatte sie nur einen Gedanken: Einen einzigen! Finde einen einzigen kalten Fall und löse ihn. Heimse ein paar Schlagzeilen ein, vielleicht ein Schulterklopfen vom Chief und ab die Post zurück ins Drogendezernat mit einem richtigen Job als Cop.
»Ich lass mir was einfallen«, versicherte Gabe – und dachte gar nicht daran, als er sich auf seinen Stuhl niederließ. »Ich glaube, bei diesem Posten geht es weniger darum, in die Tasten zu hämmern, als sich ans Telefon zu hängen, Berichte zu schreiben und irgendwie seine Zeit abzusitzen.« Bis sie mich feuern, fügte er in Gedanken hinzu.
Auch wenn ihm eigentlich nicht danach war, musste er lachen. Manchmal, dachte er, muss man sich eben einfach damit abfinden, dass das ganze Leben, die ganze berufliche Laufbahn unwiderruflich den Bach runtergeht. Doch auch diesen Gedanken behielt er für sich. Er vermutete, dass seine neue Partnerin viel mehr über ihn wusste als er über sie. Sein Niedergang hatte sich im Department vor aller Augen abgespielt, ihr Fehltritt dagegen unterirdisch – ein verhängnisvolles Geräusch, eine nervliche Zerreißprobe, die Dunkelheit der Nacht und eine entsetzliche Laune des Schicksals hatten mit einem einzigen Schuss ein Leben gefordert und möglicherweise ein anderes ruiniert. Was ihr passiert war, hätte jedem anderen Polizisten passieren können. Er dagegen hatte es nach allen Regeln der Kunst vergeigt. Ihre Situation war zweifellos schlimmer und ihre Narben, wie er vermutete, nur besser kaschiert. Es muss entsetzlich sein zu spüren, dass niemand einem mehr traut. Um wie viel entsetzlicher, sich selbst nicht mehr zu trauen.
Genau das, wurde ihm in der nächsten Sekunde bewusst, hatten sie beide gemein. Unterschiedliche Ausgangssituation. Gleiche Endstation.
Zwei Wochen ödes Aktenstudium, nutzlose Notizen, immer auf der Suche nach einem Anknüpfungspunkt. Kurze vielversprechende Momente, gefolgt von Stunden bleierner Realität. Inzwischen sprachen sie von ihrem Büro nur noch als dem Verlies. Gabe hatte damit angefangen, nach einem Videospiel, das sein Sohn sehr geliebt hatte. Diese Spiele gab es für ihn jetzt nur noch in der Erinnerung.
Die ersten Ideen, die sich formierten:
Zufallsprinzip.
Wie wär’s, wenn wir wie bei den Lottozahlen einfach blind in den Pool greifen und uns einen Fall herausangeln? Entweder wir landen einen Treffer oder ziehen eine Niete.
Alphabetisch.
Was würde das bringen? … A wie aussichtslos; B wie beliebig, C wie … keine Chance.
Chronologisch.
Auf diese Weise könnten sie ihre Fehlschläge wenigstens nach Jahrgängen abhaken. 1995: ungelöste Fälle: sieben; neue Anhaltspunkte: null. 1996: ungelöste Fälle: elf; neu entdeckte Ansätze: null. Und so weiter und so fort, bis zum Anfang der Digitalisierung, an dem ihre Aufgabe endete. Sie konnten ihre Misserfolge in einer Excel-Tabelle anschaulich dokumentieren – das wäre ein bürokratischer Fehler, wie Gabe seiner Partnerin verdrießlich erklärte: Sie sollten irgend so einem Besserwisser-Sesselfurzer nicht auch noch dabei behilflich sein, ihre Nieten auf einen Blick zu präsentieren und sich Versagen auf der ganzen Linie bescheinigen zu lassen.
Oder aber eine Einteilung nach der Art des Verbrechens.
Gewaltverbrechen – Körperverletzung; Sexualdelikte; Körperverletzung in Verbindung mit Raubüberfällen; Totschlag, Mord.
Ein Haufen ungelöster Fälle und, zumindest auf den ersten Blick, kein einziger erfolgversprechender darunter.
Vermisste Personen.
Nach Aktenlage immer noch nicht wieder aufgetaucht.
Tötungsdelikte.
Einen davon aufzuklären, stellte die größte Herausforderung dar – es gab triftige Gründe dafür, dass diese Fälle im Archiv verstaubt waren. Wenn sie andererseits zu einem einzigen davon ein paar Antworten, genügend stichhaltige Argumente fanden, die ein Gericht dazu zwangen, den Fall neu aufzurollen, wären ihnen die Schlagzeilen sicher – aber, wie sie beide sehr wohl wussten, zu schön, um wahr zu sein.
Wie sich Gabe zähneknirschend eingestand, trotzten die aufgestapelten Fälle jedem Ordnungssystem. Vielleicht, überlegte er, sind mir zusammen mit meiner Familie auch meine Talente abhandengekommen. Wie sehr er sich auch das Hirn zermarterte, er fand keine Kategorien, die ihnen ihre Aufgabe erleichtert hätten – da konnten sie auch gleich den Zufall walten lassen, sich einen oder auch zwei, drei Fälle herauspicken, die einzelnen Ermittlungsschritte der einstigen Kollegen zurückverfolgen, ein paar Anrufe machen und schauen, ob sich in der Zwischenzeit auf wundersame Weise etwas Neues ergeben hatte. Und wenn das alles in der unvermeidlichen Sackgasse endete, einen Bericht darüber schreiben, was sie in der Sache unternommen hatten.
Und trotzdem gefeuert werden.
Sobald ihm dieser Ausgang glasklar vor Augen stand, hatte er einfach nur an seinem Schreibtisch gesessen und mit seinem Stuhl gekippelt. Doch statt mit der vernichtenden Erkenntnis herauszuplatzen, hatte er sich nach dem ersten Schock dabei ertappt, in die Vergangenheit abzuschweifen, und zwar zu den Momenten in seinem Leben, in denen er eine Chance ungenutzt hatte verstreichen lassen. Da gab es vage sexuelle Erinnerungen: an seine Highschool-Eroberung, die ihm erlaubt hatte, erst ihre Brüste zu berühren, dann ihr Geschlecht, und die offenbar zu mehr bereit gewesen wäre, doch an diesem Punkt verließ ihn aus irgendeinem unerfindlichen Grund der Mut. Oder an Sportereignisse wie auf dem Basketballplatz, als es kurz vor Abpfiff unentschieden stand und er den Ball an einen Kameraden abspielte, der prompt den entscheidenden Treffer landete und auf den Schultern der anderen vom Feld getragen wurde. Ich hätte diesen Wurf machen sollen. Oder an die Situation, als sein Sohn zu ihm kam, um mit ihm zu reden. Später, hatte Gabe ihn vertröstet, wenn ich mit der Arbeit hier fertig bin.
Ich hatte immer Papierkram zu erledigen.
Der geborene Bürohengst.
Ich werde nie etwas anderes sein.