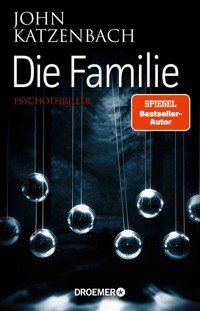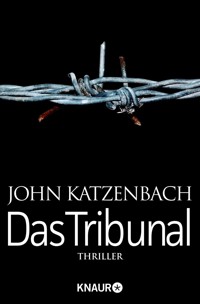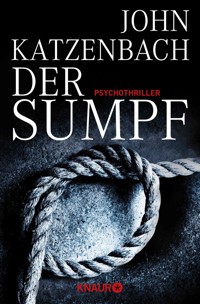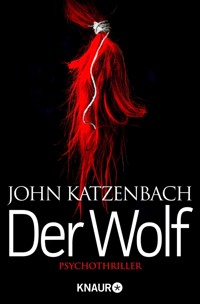9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Was hätte Jack the Ripper im Darknet angerichtet? Im Thriller »Die Komplizen. Fünf Männer, fünf Mörder, ein perfider Plan« von Bestseller-Autor John Katzenbach wagt sich ein junger Mann in die dunkelsten Gassen des Internets – und kommt einem Serienkiller-Club in die Quere. Eigentlich sucht Collegestudent Connor Mitchell im Darknet nach Spuren des Mannes, der vor Jahren den Tod seiner Eltern verursacht hat – stattdessen stößt er auf den Chatroom einer Gruppe von Serienkillern, die sich »Jack's Boys« nennen. Im Glauben, in den digitalen Untiefen des Darknet unsichtbar zu sein, planen »Jack's Boys« ihre Taten nach dem Vorbild ihres Idols Jack the Ripper und schicken anschließend Fotos ihrer verstümmelten Opfer an willkürlich ausgewählte Polizei-Stationen weltweit, ohne dass auch nur die geringste Spur zu ihnen führen würde. Bis Conner in ihr Allerheiligstes eindringt. Ein Affront, der ihn prompt zum nächsten Zielobjekt der perfektionistischen Psychopathen macht. Doch die Serienkiller haben weder mit Großvater Ross gerechnet, einem Ex-Marine, noch mit Connors bester Freundin Niki … Der 17. Thriller des amerikanischen Bestseller-Autors John Katzenbach bietet wieder atemraubend genialen Nervenkitzel bis zur letzten Seite – mit einem der besten Showdowns aller Zeiten!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 816
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
John Katzenbach
Die Komplizen
Fünf Männer, fünf Mörder, ein perfider Plan.Psychothriller
Aus dem amerikanischen Englisch von Anke Kreutzer und Eberhard Kreutzer
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
ALPHA, BRAVO, CHARLIE, DELTA, EASY.
Das Alphabet des Todes.
Eine Bande von fünf größenwahnsinnigen Psychopathen, die sich »Jack’s Boys« nennen und deren Vorbild der berüchtigte Londoner Serienmörder Jack the Ripper aus dem neunzehnten Jahrhundert ist, verabredet sich im Darknet zu grausamen, anonymen Morden. Die Männer kennen sich nicht persönlich, wissen sonst nichts voneinander. Aber sie treibt eine fixe Idee um: Jack the Ripper soll wiedererstehen. Durch ihre Taten wollen sie sich unsterblich machen. Doch wie sie schmerzhaft am eigenen Leib erfahren müssen, sind auch sie nichts weiter als Sterbliche …
Inhaltsübersicht
TEIL EINS
An einem Montag, 12:47 Uhr, [...]
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
TEIL ZWEI
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
TEIL DREI
ERSTER PROLOG
ZWEITER PROLOG
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
KAPITEL 40
KAPITEL 41
KAPITEL 42
KAPITEL 43
KAPITEL 44
KAPITEL 45
KAPITEL 46
KAPITEL 47
KAPITEL 48
KAPITEL 49
KAPITEL 50
KAPITEL 51
KAPITEL 52
KAPITEL 53
KAPITEL 54
KAPITEL 55
DANKSAGUNG
TEIL EINS
DORT HAST DU NICHTS ZU SUCHEN
»Die Vergangenheit ist doch die Gegenwart, nicht wahr? Und auch die Zukunft. Daran wollen wir uns alle vorbeimogeln, aber das lässt das Leben nicht zu …«
Eugene O’Neill, Eines langen Tages Reise in die Nacht
Der junge Polizist, der in der französischen Kleinstadt Cressy-sur-Marne für die Rekonstruktion von Verkehrsunfällen zuständig war, hasste seine Arbeit mit einer Inbrunst, die man ihm bei seiner unaufgeregten Art nicht zugetraut hätte. Es war die erste Aufgabe, mit der er seit seinem Dienstantritt vor siebzehn Monaten betraut worden war. Er hatte darin ein Sprungbrett für ein anderes, interessanteres und spektakuläreres Ressort gesehen. Waffen. Verfolgungsjagden. Festnahmen und beinharte Verhöre von abgebrühten Kriminellen. Fehlanzeige. Der Job war ein Rohrkrepierer und bot ihm Tag für Tag nichts weiter als Dieses Fahrzeug war auf der Fahrbahn in nördlicher Richtung unterwegs, als es auf der Schnellstraße ein Vorfahrtsschild missachtete und mit dem in östlicher Richtung überholenden Lkw zusammenprallte. Den Abmessungen der Bremsspuren sowie Zeugenaussagen zufolge fuhr das Unfall verursachende Fahrzeug bei deutlicher Überschreitung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit … und so weiter und so fort, bis zum Abwinken.
Ein Unfall wie der andere. Und wenn ein Zusammenstoß zu schweren Verletzungen oder sogar zu Toten führte, wenn es also endlich interessant wurde, übernahm jedes Mal ein dienstälterer Kollege die Nachuntersuchung.
Was ihn mächtig frustrierte.
Den ganzen Vormittag hatte er, mit einem Bandmaß bewaffnet, am letzten Unfallort zugebracht und Fotos geschossen, dabei, so gut es ging, die wütenden Schuldzuweisungen, das übliche Hintergrundrauschen eines jeden Unfalls ignoriert – »Das geht ja wohl eindeutig auf Ihr Konto!« »Von wegen! Hätten Sie auf die Straße geachtet …« – und sich die ganze Zeit nur gefragt, wann er endlich von der Verkehrsabteilung zu etwas Aufregenderem wechseln könne. Zum Beispiel zum Mord-, zum Drogen- oder notfalls auch nur zum Einbruchsdezernat oder zur Sitte – alles. Hauptsache, er brauchte sich nicht länger die Lügen über rote und grüne Ampeln, über Stoppschilder oder darüber anzuhören, wer Vorfahrt hatte und wer zuerst im Kreisverkehr gewesen war. Wenn er dann endlich sämtliche Aussagen, Messungen und Fotos im Kasten hatte und an seinen Schreibtisch zurückkehren konnte, war der Tag schon halb vorbei. Die anderen Kollegen seiner Einheit machten Mittagspause, und so war er in dem kleinen Gehege aus Schreibtischen und Aktenschränken allein.
Er loggte sich in seinen Computer ein.
Er hatte vor, seine Fotos hochzuladen und mit seinen Grafiken anzufangen, dem ersten Teil des Berichts, der an die Versicherung weitergeleitet würde.
Stattdessen prangte als Vollbild ein Foto auf seinem Bildschirm.
Er wäre fast vom Stuhl gekippt.
Eine Leiche.
In Farbe.
Er hielt sich an der Schreibtischkante fest und beugte sich vor.
Eine junge Frau. Ungefähr in seinem Alter.
Mit aufgeschlitzter Kehle.
Die geöffneten Augen starrten in den Himmel. Mit leerem Blick. Kalt. Die Angst war in ihrem Gesicht dem gewaltsamen Tod gewichen.
Die Frau war jung.
Dunkles Haar. Schwarze Augen. Rotbraunes Blut rings um ihren Kopf, das im sandigen Boden versickerte.
Nackt. Die Kleider hatte ihr jemand vom Leib geschnitten und neben ihr auf einen Haufen geworfen.
Allem Anschein nach lag sie auf einem Feld. Er konnte nicht sagen, wo. Da gab es nichts, was ihm irgendwie bekannt vorkam.
Am unteren Bildrand war ein Schriftzug.
Er versuchte, sich einen Reim darauf zu machen.
Arabisch. Kyrillisch. Sanskrit. Und einige japanische oder chinesische Schriftzeichen. Alles kunterbunt durcheinander, in einem nicht zu entziffernden Kauderwelsch. Kein Französisch. Nicht einmal etwas auf Deutsch oder Spanisch, das er sich mit seinen bescheidenen Fremdsprachenkenntnissen aus der Schulzeit hätte zusammenreimen können.
Der junge Verkehrspolizist starrte auf das Bild.
Sein erster Gedanke: Das muss eine Fälschung sein.
Jemand spielt dir einen Streich, nur dass heute nicht der 1. April ist.
Er sah sich das Foto noch genauer an.
Es wirkte real.
Sein Instinkt empfahl ihm, es in den Papierkorb zu legen. Es von seiner Festplatte zu löschen und sich wieder an die Arbeit zu machen.
Tat er aber nicht. Ohne das Bild aus den Augen zu lassen, öffnete er ein neues Fenster und ging zu einem Übersetzungsprogramm. Er wechselte auf seiner Tastatur zu Arabisch und tippte mühsam die Zeichen ein. Heraus kam:
Möchtest du nicht …
Er wechselte zu Kyrillisch, nicht ganz einfach bei seiner Tastatur, und er war sich auch nicht sicher, ob er es richtig machte. Die Übersetzung ergab:
Gerne wissen, wer …
Nun wechselte er schnell zu Sanskrit.
Die junge Frau getötet hat …
Es kostete ihn ein paar Minuten, herauszufinden, dass die letzten Worte Mandarin waren und die Frage ergaben:
Und wo sie gestorben ist?
Der junge Polizist hatte auf einmal einen trockenen Mund. Er atmete flach. Bis dato hatte er in seinem Dienst noch kein einziges Mal Angst gehabt und streng genommen auch jetzt nicht; ernsthaft beunruhigt war er allerdings schon.
Er vertiefte sich erneut in das Bild. Auch wenn er kein IT-Experte war, kannte sich der junge Polizist mit dem Internet recht gut aus und fand daher ziemlich schnell die IP-Adresse, von der das Foto kam. Was ihn zum zweiten Mal auf den Gedanken brachte, dass ihn hier jemand zur Zielscheibe eines ziemlich raffinierten Streichs gemacht hatte. Das Foto war nämlich durch die Leserspalte einer hochleistungsfähigen italienischen PR-Firma generiert worden, die sich um die fragwürdigen Belange illustrer Klienten kümmerte, von gestürzten afrikanischen Politikern bis hin zu ruchlosen Konzernen, die sich um die finanzielle Haftung für Ölkatastrophen drücken wollten.
Das ergab für ihn keinen Sinn.
Er sah sich das Foto noch einmal an, war kurz davor, die ganze Sache in den Papierkorb zu verschieben, und zog schon den Cursor darüber, als er plötzlich stutzte. Langsam ließ er die Hand sinken. Spinnst du?, dachte er. Irgendjemand da draußen muss von der Sache hier erfahren. Also griff er zum Telefon auf seinem Schreibtisch und rief auf der internen Leitung einen Ermittler im Morddezernat an. Er war ihm erst ein, zwei Mal über den Weg gelaufen und konnte nur hoffen, dass er sich an ihn erinnerte.
»Sergeant«, sagte er, als der Mann sich meldete. Er gab sich Mühe, sich seine Zweifel und Nervosität nicht anmerken zu lassen. »Ich hab da, glaube ich, etwas, das Sie sehen sollten.«
KAPITEL1
Delta schrieb:
Wie versprochen, Auftrag ausgeführt. Und ich hätte auch schon eine Schlagzeile für uns alle: Französische Flics flippen wegen fantastischem Foto aus.
Bravo und Easy würdigten den Vorschlag umgehend mit Daumen-hoch-Emojis. Flics, wussten sie, war Umgangssprache für die französische Polizei.
Delta schrieb weiter:
Hätte da mal eine Frage an alle.
Hat zufällig einer von euch Erfahrung mit den neuesten Methoden zur Erkennung von Fingerabdrücken, insbesondere mit der Musterentnahme von totem Fleisch? Ist die Gestapo dazu überhaupt in der Lage?
Nach wenigen Sekunden meldete sich Charlie:
Möglich, aber nicht wahrscheinlich. Ist für die Techniker immer noch Glückssache. Selbst für die Experten beim FBI, bei Interpol oder Scotland Yard. Wenn das Opfer offensichtlich an einer Stelle angefasst wurde, an der die Identifizierung leichtfällt, ist es ihnen einen Versuch wert. Über die Jahre allerdings nur selten Treffer … Aber hin und wieder geben sie zumindest ihr Bestes. Seht euch dazu mal Festnahme und Anklage in Madrid gegen Juan Carlos Ramirez vor sechs Jahren an. Der Blödmann hat seine getrennt lebende Frau umgebracht und ihren Lover angeschwärzt, was nur leider seinen Zeigefingerabdruck an ihrer Kehle nicht erklären konnte. Ich meine, gibt es einen eindeutigeren Beweis?
Die anderen wussten Charlie als Historiker auf ihrem Fachgebiet zu schätzen.
Kurz darauf meldete sich auch Bravo:
’n Abend, Delta, Leute. Charlie hat absolut recht. Da zeigt sich mal wieder, wie falsch diejenigen liegen, die meinen, die Zauberkunststückchen, die sie in Fernsehserien vollführen, seien aus dem Leben gegriffen. Man denke nur an Crime Scene Investigation: Den Tätern auf der Spur oder was auch immer sich so ein Schreiberling aus den Fingern gesogen hat, um die Gestapo wie Experten dastehen zu lassen. Träumt weiter! Trotzdem würde ich dazu raten, die richtigen Handschuhe zu tragen, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber Vorsicht: Selbst die hochwertigsten OP-Handschuhe können schon mal Teilabdrücke hinterlassen, weil sie so dünn sind und Körperfette oder Schweiß sogar durch Latex nach außen dringen. Daher vorsichtshalber zwei Paar übereinanderziehen! Oder Latex unter einem zweiten Paar in Leder. Und nach Gebrauch fachmännisch entsorgen. Verbrennen ist immer gut. Beide, die in Latex und die in Leder. Das ist wichtig. Siehe Journal of Forensic Research, Artikel in Band 23, Nummer 8, März letzten Jahres.
Bravo war von ihnen allen der Beste darin, Forschungsberichte zu lesen und zu erklären. Ihnen war nicht entgangen, dass er sich bei seinem Gruß mit »Guten Abend« gemeldet hatte, aber sehr wohl klar, dass es da, wo sich Bravo aufhielt, vielleicht gar nicht Abend war.
Easy schrieb prompt:
Kein Problem. Mach. Dir. Keinen. Kopf.
Easy war der Witzbold in der Gruppe.
Und Delta antwortete sofort:
LOL. Wie wahr. Dank an alle. Sehr cool. Der Artikel ist mir entgangen. So wie, zugegeben, so ziemlich jeder andere Artikel auch. Selbst schuld. Was wären wir alle ohne Bravo und seinen unersättlichen Lesehunger? Jedenfalls, wie gesagt, echt krasser Rat.
Möglicherweise war Delta jünger als der Rest – obwohl das mehrere der anderen insgeheim bezweifelten. Diesen Artikel übersehen zu haben, war vielleicht auch gelogen, da Delta oft ziemlich gelehrt daherkam. Er hatte einfach eine Schwäche für einen etwas hippen, im Großen und Ganzen klischeehaften Umgangston, wobei mehr als ein Mitglied der Chatgruppe vermutete, dass er sich diese Sprache entweder aus dem Internet oder aus Dialogen in Jugendromanen angeeignet hatte. Der eine oder andere von ihnen spekulierte insgeheim, dass er vielleicht Lehrer an einer Highschool war. Wie auch immer, sie erkannten, dass er ziemlich wahllos Teenager-Sprech einfließen ließ, um sein wahres Alter zu verbergen, und sie gingen davon aus, dass ihm seine Ausdrucksweise zur Tarnung diente. Sie alle hüteten sich, ihn darauf anzusprechen.
Es gab auch keinen triftigen Grund dafür. Abgesehen davon hatte jeder von ihnen ganz ähnliche Vorkehrungen getroffen, um seine jeweilige Identität zu schützen, was jeder vom anderen auch wusste – es glich sich also aus. Davon abgesehen schätzten sie Delta für das, was er beitrug, wenn er nicht gerade omg oder wtf schrieb. Er legte in ihrem gemeinsamen Betätigungsfeld die Messlatte hoch, und es bereitete ihnen allen das größte Vergnügen, sich daran zu erproben.
Easy schrieb:
Das Wort gefällt mir: Unersättlich. Passt zu uns, oder?
Delta sendete ein Händeklatsch-Emoji.
Dann verabschiedete er sich mit dem Eintrag:
Bis neulich, Leute. Muss dann mal. Das nächste Projekt auschecken.
Bravo riet:
Denk dran, Delta, was Leute wie uns zu Fall bringt, ist weniger die Planung und die Ausführung als das Spurenverwischen danach.
Easy bekräftigte:
Genau.
Und Alpha, der Moderator der Gruppe, sprach für alle, als er tippte:
Auf die Ergebnisse gespannt.
Das verstand sich eigentlich von selbst. Genauso wie die Tatsache, dass sie alle mit ihren eigenen Projekten beschäftigt und gleichermaßen erpicht darauf waren, sie den anderen vorzustellen.
Delta antwortete:
Gemach. Gemach. Ihr sagt mir doch immer, nur ja nichts überstürzen. Ich übe mich in Geduld.
Dem hätte keiner von ihnen widersprechen können, auch wenn sie insgeheim fanden, dass es Delta gewöhnlich ein bisschen zu eilig mit allem hatte und sich mit dem Befriedigungsaufschub etwas schwertat.
Alpha fuhr fort:
Gut. Ausgezeichnet. Treffen wir uns am besten alle in zwei Tagen wieder online. Selbe Uhrzeit, selber Ort. Und Delta, vielleicht kannst du dann ja schon ein paar Einzelheiten loswerden.
Es hagelte Okays.
Doch bevor sie sich alle von ihrem Chat abmelden konnten, hatten sie plötzlich eine neue und unerwartete Nachricht auf ihrem Bildschirm.
Socgoal02 ist dem Chatroom beigetreten.
Diese Identifizierung war ihnen allen unbekannt. Seit Bestehen der Gruppe war niemand in ihren geschlossenen Chatroom eingedrungen. Zu viele Verschlüsselungsebenen. Bis zu diesem Moment war ihr Austausch in diesem geschützten Raum vollkommen ungestört verlaufen. Dieser neue Auftritt beunruhigte sie alle. Die bloße Vorstellung, entdeckt zu werden, jagte ihnen einen Schrecken ein. Sie waren zu fünft, und keiner von ihnen neigte zur Panik, aber jeder fing sofort an, sich elektronisch rauszuklicken. Vorher lasen sie allerdings noch:
Socgoal02:
Wer seid ihr? Seid ihr echt? Was für Spinner! Perverse! Krank krank krank …
Zwei Jahre zuvor hatte Alpha sich gefreut, als Bravo – der erste Neuzugang der späteren Gruppe – sich zu seiner Überraschung auf sein erstes Posting meldete. So schnell hatte er kein Feedback erwartet, vor allem angesichts der Firewalls, die er eingerichtet hatte, um dafür zu sorgen, dass alles, was auf dem Portal besprochen wurde, streng anonym blieb. Anfänglich hatte Alpha geplant, einen persönlichen Blog zu schreiben und fortlaufend zu ergänzen. Da nun aber jeder Austausch naturgemäß geschützt verlaufen musste, hatte er es sich rasch anders überlegt. Und so hatte Alpha den privaten Chatroom erstellt und Bravo zum Beitritt eingeladen. Bravo waren im Lauf der nächsten Monate Charlie, Delta und Easy gefolgt – nachdem auch sie einen Kommentar auf jenes denkwürdige erste Posting hinterlassen hatten. Keine Gangster. Keine Schaumschläger. Vielmehr klug, gebildet, artikuliert. Und für Mörder jung. Alpha war in der Gruppe die graue Eminenz.
Und bei fünf war das Limit. Jeder darüber hinaus hätte nach Alphas Überzeugung den Chat erschwert und sie einem unnötigen Risiko ausgesetzt. Alpha hatte darauf bestanden, außer diesen fünf keine weiteren Beitritte zuzulassen, nachdem er sich im Zuge ihrer ersten Wortwechsel von ihrer Glaubwürdigkeit überzeugt hatte und ausschließen konnte, dass sich hinter ihren Chatnamen nicht ein übereifriger, cleverer Ermittler irgendwo auf dem Globus oder gar einer von nebenan verbarg. Die fünf Männer hatten sich schnell auf diese Obergrenze festgelegt. Fünf, eine ungerade Zahl, hatte sich irgendwie richtig angefühlt, der Teamgeist einer Basketballmannschaft. Auch wenn sie sich nie persönlich begegnet waren, verband sie ihre besondere Leidenschaft und machte sie füreinander überlebenswichtig. Wie eine Unterstützergruppe für Drogensüchtige oder Alkoholiker nach dem Entzug oder für Opfer von Gewaltverbrechen bei der Verarbeitung ihres Traumas schien jeder von ihnen über Kernkompetenzen zu verfügen, mit denen er den anderen half. Nicht lange, und sie betrachteten sich als einen speziellen Freundeskreis, in dem sie – neben ihren anderen sozialen Kontakten – spezifische Interessen und Neigungen pflegten. Die echten Namen, ihr Alter und ihren Standort hielten sie voreinander geheim, obschon sie im Laufe der Zeit aus Fragen, die einer von ihnen etwa zu reißerischen Schlagzeilen oder Fernsehnachrichten aufbrachte, gewisse Rückschlüsse zogen. Dabei war keiner von ihnen so taktlos, solche Vermutungen zu äußern oder gar nachzuhaken. Darüber hinaus war Englisch die bevorzugte Sprache, und der Vorschlag, ob nicht vielleicht Schwedisch oder Finnisch oder Japanisch angenehmer wäre, kam nicht auf. Insgeheim hatten sie längst begriffen, dass sie alle Amerikaner waren. Wenn sie nämlich über ihren Alltag plauderten, kamen darin Apple Pie, der vierte Juli oder der Superbowl vor. Abgesehen von Mord.
Alpha, der Umsichtigste und Intellektuellste in der Runde, bestand auf dieser Verschwiegenheit, die nicht zuletzt seinem obsessiven Bedürfnis nach Privatsphäre entsprang. Tatsächlich hatte Alpha, als in seinem Kopf Jack’s Special Place erste Gestalt annahm, eher spielerisch seine eigene Expertise in Informatik austesten wollen. Abgesehen vom Nervenkitzel, den das Projekt versprach, befriedigte es sein überwältigendes Bedürfnis, auf Schritt und Tritt die Cops an der Nase herumzuführen. Um jeden Preis wollte er beweisen, dass die Schlaumeier der Polizei nichts, was er schrieb oder sagte oder hochlud, zu ihm zurückverfolgen konnten. Zu viele verschachtelte falsche Identitäten. Zu viele mathematische Möglichkeiten.
Alpha liebte das Netz.
Und er liebte Jack.
Jack wie in Jack the Ripper.
Daher hatte die Gruppe ihren Namen.
Sie nannten sich Jack’s Boys. Und sie trafen sich in Jack’s Special Place.
Für Alpha war Jack immer noch das strahlende Vorbild für die Kunst, die Ordnungshüter zu täuschen und ihnen ein ums andere Mal zu entwischen. Diese beiden Fähigkeiten hatte Jack in so überragender Weise an den Tag gelegt, dass hundert Jahre später immer noch darüber gerätselt wurde, wer hinter diesem Namen steckte. London hatte eine geführte Stadttour eigens zum Ripper im Angebot. Amateurwissenschaftler und -detektive nannten sich Ripperologen und ergingen sich in endlosen Spekulationen, Theorien und Wortklaubereien zu der umfangreichen Ripper-Akte bei Scotland Yard. Eine berühmte amerikanische Krimiautorin hatte ein ganzes Buch über Jacks angeblich wahre Identität verfasst – um sie sich sogleich von ebenjenen Amateurdetektiven in der Luft zerreißen zu lassen, deren Kandidaten sie vom Sockel gestoßen hatte.
Alpha wusste, dass die anderen vier Mitglieder dieses Gefühl der Seelenverwandtschaft mit Jack teilten.
Womit er richtiglag. So wie der berühmte Jack waren Bravo, Charlie, Delta und Easy in einer Arena, in der andere aufgrund ihrer besonderen Neigungen Anonymität schätzten und sich bemühten, wenig oder, wenn möglich, nichts dem Zufall zu überlassen, ausgesprochen risikofreudig. Alle fünf liebten den Zufall und die damit verbundene Gefahr.
Damit hoben sie sich vom klassischen Typus ihrer Sparte ab und hätten wohl die Analytiker beim FBI verwirrt.
Bei Alphas erstem Posting, das überhaupt erst den Bedarf an einem Chatroom geschaffen hatte, handelte es sich um ein bescheidenes Manifest mit dem Titel:
Warum ich tue, was ich tue.
Er hatte es kurz gehalten. Sorgfältig formuliert. Drei handgeschriebene Entwürfe, dann erst eingestellt. Keine weitschweifige Abhandlung à la Ted Kaczynski über Gott und die Natur und die Entschlüsselung der Welt. Alpha hatte nicht vergessen, dass der Una-Bomber, der Killer mit Harvard-Abschluss, letztlich aufgeflogen war, weil er in seinen viel zu unverwechselbaren, persönlichen und deshalb verräterischen schriftlichen Zeugnissen die Semikola korrekt gesetzt hatte.
Bravo hatte die Kommentarspalte am Ende des Manifests gesehen und geantwortet:
Genauso geht es mir auch.
Dieser schlichte Austausch hatte sie zusammengebracht. Im Gefolge führte er zu einem lebhaften Hin und Her und mündete zuletzt in den Chatroom.
In seiner Darlegung hatte Alpha statt töten den Euphemismus beseitigen verwendet.
Wie zum Beispiel in: Und schlussendlich akzeptierte ich, was ich tun wollte – nein, was ich absolut hundertprozentig tun musste, was meine absolute Bestimmung im Leben war, nämlich Molly zu beseitigen … oder Sally … das heißt … sie voll und ganz zu meinem Eigentum zu machen. Und erst als sie dann mir gehörten, hatte ich meine Bestimmung gefunden.
Bravo hatte dies aus eigener Erfahrung bekräftigt:
Ich weiß. Du spürst auf einmal diese totale Größe in dir. Du wartest nur darauf, dass sie sich entfalten kann. Du musst nur herausfinden, wie du sie freisetzt.
Beseitigen war der erste Euphemismus, den sie sich im Chatroom zu eigen machten. Als sich im Verlauf der nächsten Wochen Charlie, Delta und Easy hinzugesellten, einigten sie sich vorsichtig auf weitere. Übernehmen statt entführen, aneignen statt unter ihre Kontrolle bringen. Für foltern stand ärgern. Und die Polizei – von den kleinsten Einheiten auf dem Land bis zu den qualifiziertesten in New York, Rom, Tokio oder Los Angeles – firmierte als die Gestapo. Über ihre Methoden ließen sie sich in umschreibender Sprache aus und verstanden auf Anhieb, was gemeint war, weil sie, bei allen individuellen Unterschieden, aus demselben Holz geschnitzt waren. Dabei war keiner der fünf so naiv zu glauben, die Verhaltenspsychologen vom FBI oder beim Special Branch des Scotland Yard oder den entsprechenden Stellen in Paris, Berlin, Madrid, Buenos Aires, Rotterdam oder Mexico City würden nicht auf Anhieb verstehen, worum es ging. Doch die Bälle, die sie sich zuwarfen, waren so geschickt abgefälscht, dass sie den meisten lasch und harmlos erscheinen mussten.
Die Fotos, die sie von Zeit zu Zeit einstellten und an denen sie sich alle weideten, waren alles andere als das. Gemeinsam machten sie sich ein Vergnügen daraus, ihre Versuche auf ihrem fotografischen Spezialgebiet nach dem Zufallsprinzip auf die Websites ausgesuchter Polizeiwachen hochzuladen. Cop Shops nannten sie die. Vom Polarkreis in Alaska bis zur wilden Pampa Patagoniens. Von Christchurch bis nach Guangzhou in Südchina. So wie der Verkehrspolizist in Cressy-sur-Marne fuhr dann irgendein armer Tropf in irgendeiner Wache an einem stinknormalen Morgen seinen Computer hoch und hatte statt alltäglicher Schadensberichte eine blutüberströmte Leiche oder ein abgetrenntes Körperteil vor sich, mit einer Überschrift wie:
Na, erkennst du das?
Oder:
Noch besser. Wüsstest du nicht gerne, wer das war?
Die Überschriften verfassten sie in unterschiedlichen Sprachen. Einmal auf Japanisch. Dann Suaheli. Arabisch. Englisch eher selten. Dabei achteten sie peinlich darauf, dass auf den Bildern keine verräterischen Besonderheiten zu erkennen waren. Alpha sah es gerne, wenn fünf Augenpaare jedes derartige Foto auf solche Merkmale untersuchten, bevor er es rausschickte. Gemeinsame Verantwortung. Fünffache Genauigkeit. Mehr als einmal hatten sie gegen ein Bild ihr Veto eingelegt, weil einer von Jack’s Boys etwas entdeckt hatte, das möglicherweise wiedererkennbar war. Zum Beispiel eine Pflanzenart im Hintergrund. Ein spezifisches Kleidungsstück. Die Körperstelle, an der sich eine Wunde befand. Außerdem wechselten sie sich beim Posten ab. Nie stellte es der Täter ein. Die Aufgabe fiel, nach reiflicher Diskussion, immer einem der anderen zu, auch wenn sie in dem Moment alle ihre Freude daran hatten und sich über den Zaubertrick, mit dem sie die Fotos hochluden, die Hände rieben. Einmal hatte sich Easy den Spaß gemacht und zu einem von Charlies Leichenfotos die GPS-Koordinaten angeführt. Das Ganze ging allerdings an einen Cop Shop auf einem anderen Kontinent, Tausende Meilen entfernt und politisches Feindesland. So als würden sie Informationen über einen Toten im Umfeld von Denver an Polizisten in Teheran schicken.
Wenn sie sich dann wieder online trafen, lachten sie und malten sich den Schock und die Bestürzung in dem betreffenden Cop Shop aus, und den Ärger, wenn die dortigen Beamten versuchten, sich mit dem Cop Shop zu verständigen, der in der Nähe des Leichenfundorts lag.
Anschließend lösten sich Jack’s Boys im Internet in Luft auf und zogen sich in ihr jeweiliges eigenes, geheimes Leben zurück.
Auch wenn diese Bilder auf Jack’s Special Place gelöscht wurden, nachdem sie sie miteinander geteilt und quer durch die Welt des Internets gejagt hatten, waren sie Jack’s Boys da schon unauslöschlich ins Gedächtnis gebrannt. Und auch hierin war keiner von ihnen naiv: Sie wussten alle sehr wohl, dass in der Welt des Internets nichts gänzlich und für immer verschwindet. Was für sie alle, weil sie die Gefahr liebten, ein Nervenkitzel, ja, geradezu berauschend war, schlug allerdings in Ernüchterung um, als sie die nächste Nachricht des Eindringlings sahen.
Socgoal02 schrieb:
Also, was seid ihr eigentlich, Leute? Ein paar alte, abgetakelte Schlappschwänze, die sich für besonders schlau halten? Sich als echte Killer ausgeben? Ein Club von Perversen, die sich an kranken Mordfantasien aufgeilen?
Kaum hatte Alpha die höhnische Bemerkung gelesen, flogen seine Finger über die Tastatur. Er hatte in dem, was er sein Büro nannte, einem ehemals muffigen, nunmehr für seine besonderen Zwecke aufgemöbelten Kellerloch vier Computerbildschirme stehen. Der Algorithmus zur Rückverfolgung, den er vor Jahren installiert hatte, war auf Jack’s Special Place noch nie zum Einsatz gekommen, weil sich die Notwendigkeit nie ergeben hatte. Die Ganovenehre ließ es nicht zu, ihn gegen Bravo, Charlie, Delta oder Easy einzusetzen. Außerdem hatten sie wahrscheinlich sowieso ihrerseits entsprechende Schritte unternommen, um ihn mithilfe von quer über den ganzen Globus verteilten Servern abzuschmettern. Der Eindringling dagegen wohl eher nicht. Für einen Moment verfluchte er sich dafür, den Algorithmus nicht laufend weitergetestet zu haben.
Er wusste nur, dass er Socgoal02 ein paar Minuten lang auf ihrem Portal festhalten musste, damit das Programm, falls es denn funktionierte, seine Aufgabe erledigen konnte.
Und so tippte Alpha:
Das hier ist ein geschlossener Chatroom. Du verletzt unsere Privatsphäre und einige US-Gesetze sowie internationale Abkommen, indem du hier eindringst. Du solltest dich auf der Stelle entschuldigen und verschwinden.
Ihm war natürlich klar, dass es wenig, wenn überhaupt, Gesetze gab, welche die unerwünschte Anwesenheit von Socgoal02 betrafen, ob nun in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Westeuropa oder Lateinamerika. Und er wusste auch, dass er mit der Forderung nach einer Entschuldigung höchstwahrscheinlich eine weitere Antwort herausforderte.
Was auch die anderen sahen, die auf der Plattform ausharrten.
Die vier begriffen sofort, dass Alpha diesen Eindringling noch so lange brauchte, bis er ihn unschädlich gemacht hatte.
Bravo schrieb:
Hör mal zu, Kumpel, du begehst gerade einen kapitalen Fehler. Hau ab!
Wollte man jemanden in einem dummen Fehler bestärken, so sein Kalkül, sagte man ihm am besten, er solle sich verziehen.
Das sah Delta genauso.
Er schrieb:
Du ahnst nicht, in welche Schwierigkeiten du dich gerade bringst.
Socgoal02 fraß den Köder und schrieb:
Vielleicht ein Kränzchen von alten Damen? Hab ich euch auf dem falschen Fuß erwischt? Wisst ihr was? Ihr mögt euch bei dem, was ihr da treibt, ja vielleicht für tolle Hechte halten, aber ich würde mich als Mörder jederzeit besser anstellen. Ihr seid ein Haufen Amateure.
Easy reagierte prompt:
Kleiner, du klingst wie ein Zwölfjähriger. Das hier ist für Erwachsene.
Eine Antwort von Socgoal02 blieb aus.
Jetzt schaltete sich Charlie ein:
Hör zu, egal, wer du bist, du legst dich besser nicht mit uns an.
Hierauf meldete sich Socgoal02 zurück:
Hab ich bereits. Man sieht sich, Loser.
Dann für alle sichtbar die Meldung:
Socgoal02 hat den Chat verlassen.
Die Männer verharrten, jeder für sich, vor ihrer Tastatur, jeder musste erst einmal mit einer Woge der Angst und Wut fertigwerden.
Es war an Alpha, zur Geschäftsordnung zu rufen.
Bei der Erstellung von Jack’s Special Place hatte er für unvorhergesehene Ereignisse Notfallprogramme installiert. Im Lauf der Jahre, in denen das Portal bereits existierte, war er allerdings nachlässig geworden und hatte sich in Sicherheit gewiegt, hielt seine Vorkehrungen für mehr als ausreichend.
Alpha schrieb:
Dank euch allen. Er war lange genug drin. Ich glaube, ich hab ihn.
Er ließ den Satz erst einmal so stehen, damit die anderen die gute Nachricht sacken lassen konnten.
Nach einer Weile stellte Delta die Frage, die ihnen allen unter den Nägeln brannte:
Cop?
Alpha antwortete:
Nein. Diesen Anschein hat er sich gegeben. Ein dummer kleiner Grünschnabel irgendwo in den USA, der mit seiner Zeit nichts Besseres anzufangen weiß. Ostküste. Neuengland. Man beachte: Socgoal02. Wäre er in Europa, hätte er sich Footgoal02genannt, oder?
Easy antwortete prompt:
Siehst du richtig. Guter Punkt.
Sie alle schalteten einen Gang herunter und zähmten ihre Wut. Binnen Sekunden hatten sie sich beruhigt und einen normalen Puls.
Bravo tippte:
Wie ist das passiert? Hatten wir noch nie.
Alpha nahm sich einen Moment Bedenkzeit, bevor er antwortete:
Bin mir nicht sicher. Verlasst euch drauf, ich krieg’s raus.
Easy fügte hinzu:
Wie blöd er auch sein mag, er hat uns gefunden.
Delta schrieb:
Wahrscheinlich reiner Zufall.
Worauf Bravo erwiderte:
Nur dass wir noch nie so einen Zufall hatten.
Was natürlich auch Alpha sah. Ihm schwirrte der Kopf. Er holte einmal tief Luft und tippte:
Wir müssen auf der Hut sein. Und uns was einfallen lassen. Schätze, Notfallplan MANSON wäre angebracht.
Jeder dachte eine Sekunde nach, dann handelten Jack’s Boys schnell und entschieden und meldeten sich ohne ein weiteres Wort aus Jack’s Special Place ab.
KAPITEL2
Wie immer um diese Jahreszeit kreisten die Gedanken von GP fast nur noch um eines: Selbstmord – wenn er nach einer unruhigen, von Albträumen gequälten Nacht erwachte. Selbstmord – wenn er Mittagspause machte. Selbstmord – zur Sitcom am Abend. Selbstmord – bevor er nachts die Augen schloss. Seit 1968 holten ihn diese Gedanken jeden Oktober ein. War der Monat vorbei, lichtete sich auch diese Wolke, aber im Oktober, fürchtete er, würde ihn diese fixe Idee, diese Besessenheit begleiten, bis er entweder im eigenen Bett an Altersschwäche oder, an Maschinen angeschlossen, im Krankenhaus an irgendeiner schlimmen Krankheit starb. Oder wenn er am Ende doch noch der Versuchung erliegen sollte, das hartnäckige Verlangen in die Tat umzusetzen. Jeden Oktober malte er sich aus, wie er einen Suizid so bewerkstelligen könnte, dass es nach einem Unfall aussah. Oft reinigte er seine Handfeuerwaffe spätabends auf seinem Schreibtisch und stellte sich vor, wie sie versehentlich losging. Oder er spielte mit der Idee, zu spät in der Saison zum Fliegenfischen zu gehen, in eine starke, eisige Strömung zu geraten und sich davon unter Wasser ziehen zu lassen. Oder er dachte darüber nach, an einem verregneten Abend gegen einen Baum zu krachen, als habe er auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren.
Das Problem mit seinen Fantasien:
Ein Schuss wäre die schnellste Lösung – nur leider für die Menschen, die ihm etwas bedeuteten, eine emotionale Zumutung und eine blutige Schweinerei.
Ertrinken – unangenehm, mit Panik verbunden. Er hegte den starken Verdacht, dass er gegen die Strömung ankämpfen würde. Außerdem würde er seinen Liebsten die Mühe machen, im Fluss meilenweit nach seiner Leiche zu suchen.
Ein Autounfall – eine äußerst unsichere Angelegenheit. Keine Garantie, durch eine Laune des Schicksals nicht doch zu überleben und als Krüppel oder als Dahinvegetierender eine Last für seine Hinterbliebenen zu sein.
Und so tat er nichts dergleichen.
Noch nicht. Er wollte ja. Aber er fand immer einen Grund, die Entscheidung ein weiteres Jahr aufzuschieben. Manchmal kamen ihm diese Entschuldigungen ziemlich fadenscheinig vor, was ihn nicht daran hinderte, sie in einem Zwiegespräch mit sich selbst ins Feld zu führen.
Ich kann nicht. Jedenfalls dieses Jahr noch nicht. Ich werde noch gebraucht.
Aber vielleicht ja nicht mehr viel länger.
Dann wäre es nur noch eine fadenscheinige Entschuldigung.
Und jedes Mal, wenn er gerade beschlossen hatte, sich diesen Oktober noch einmal zu verschonen, entschuldigte er sich dafür laut: gegenüber dem Badezimmerspiegel; wenn er allein mit dem Auto fuhr oder eine Straße entlanglief; sogar wenn er spätabends fernsah und eigens den laufenden Kommentar zu einem Football-Spiel stumm schalten musste, das ihn nicht die Bohne interessierte, um wieder einmal zu sagen: »Tut mir leid, Freddy. Nicht dieses Jahr. Aber eines Tages ist es so weit. Versprochen.«
Es versetzte Ross Mitchell jedes Mal einen Stich, den Namen seines Freundes laut auszusprechen. Frederick Douglas Larkin, benannt nach dem großen Redner, ein schlaksiger, schwarzer junger Mann von unwiderstehlicher Freundlichkeit, der Ross über die unausgesprochene Rassenkluft hinweg die Hand gereicht und in einem Krieg, mit dem sie beide eigentlich nichts zu tun haben wollten, sein Kumpel geworden war. Sie waren im selben Alter damals, 1968, gerade mal achtzehn. Freddy war Funker und Ross Grenadier, und man hatte sie am selben Tag demselben Zug zugeordnet. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Funkers im Feuergefecht, erklärte Freddy seinem Freund Ross, belaufe sich auf fünf Sekunden. Das Funkgerät, das Freddy mitschleppte, wog ungefähr fünfundzwanzig Kilo und hatte an der Oberseite eine lange Antenne – ein erstklassiges Ziel für den Feind. Außerdem hatte der Funker neben dem Leutnant zu laufen, und die nordvietnamesische Volksarmee wie auch der Vietkong hatten schnell den Bogen heraus, wie sie mit einer einzigen gut platzierten Mörsergranate einen Zug enthaupten konnten. Freddy wusste, dass er im Dschungel sterben würde. Bei der Ausbildung hatte ein Captain gesagt: »Das Schadensrisiko ist hoch«, und dabei die Zahl 5 an die Tafel geschrieben. Jeder im Unterricht wusste, was mit Schaden gemeint war. Bei ihrer Ankunft auf feindlichem Boden hatte ein angegrauter, kampfmüder Sergeant Freddy erklärt: »Wenn du Idiot ins Gras beißt, gehen wir alle drauf.« Damit bekräftigte er, was der Ausbilder gesagt hatte, nur ein wenig unmissverständlicher.
Ross war entschlossen, seinen Freund am Leben zu halten.
Er wusste insgeheim, dass das seine Aufgabe war. Er wusste nur nicht, wie.
Es war Oktober. Ein langer Gewaltmarsch durch den Dschungel. Erschöpft hatten sie sich an einen Baum gelehnt und eine Zigarette geraucht.
»Wie weit noch?«, fragte Ross.
»Nicht mehr weit«, antwortete Freddy, während er das Funkgerät wieder schulterte. »Nur noch ein paar Kilometer bis zur Basis. Das schafft selbst dein müder weißer Arsch, und wenn ich dich die letzten hundert Meter tragen muss.«
Damit hatte er Ross zum Lachen gebracht.
Als der Sergeant brüllte: »Aufgesattelt. Bewegt euch!«, hatte sich Freddy neben dem Leutnant eingereiht und Ross hinten, neben dem Sergeant.
Keine Stunde später traf ein Scharfschütze Freddy in den Bauch, verpasste dem Leutnant einen Schuss in den Kopf und dem Späher einen Treffer in die Brust, bevor er mit einer Schnellfeuerwaffe den restlichen Zug niedermähte.
»Ross! Ross, ich sterbe! Bitte hilf mir …«
Diese flehentliche Bitte hörte Ross seither jeden Oktober.
In Wahrheit hatte Freddy diese Worte natürlich nie gesprochen. Er hatte nur – vielleicht zwanzig Meter vom übrigen Zug entfernt – vor Panik und vor Qual geschrien. Nah genug, um von den Kameraden gehört zu werden. So weit weg, dass es so gut wie unmöglich war, ihm zu Hilfe zu eilen.
Ross war durch dichtes Unterholz und Schlamm gekrochen, während über ihm Schüsse durch die Luft zischten und der Sergeant ihn zweimal zurückpfiff. »Runter, Mitchell! Verflucht! Runter mit Ihnen!!«
Und wieder stieß Freddy einen Schrei aus. Von seinem Versteck aus konnte Ross sowohl den Leutnant als auch den Späher reglos am Boden liegen sehen. Doch er hörte nur Freddy. Sein Freund war hinter einer kleinen Böschung zusammengesackt und presste sich beide Hände auf die Wunde.
»Ross. Ross …«
Es hielt ihn nicht länger.
»Scheiß drauf, ich muss da rüber«, hatte er gebrüllt. Der Sergeant hatte ihn ein drittes Mal gepackt, Ross sich losgerissen, auf die Knie hochgerappelt, sein M-16 angelegt und in der Hoffnung, den Scharfschützen in Deckung zu zwingen, ein Dauerfeuer eröffnet. Dann war er losgerannt, geduckt, wie die Beute in panischer Flucht vor einem Raubtier. Der Kugelhagel schlug ins Laub ein, prallte von Baumstämmen ab und ließ den Schlamm aufspritzen. Auch die übrigen Mitglieder des Zugs schossen wild um sich. Im Getöse der Schreie und der Geschütze rannte Ross weiter. Alles schien sich in Zeitlupe abzuspielen. Selbst fünfzig Jahre danach sah er es vor sich, jeden einzelnen Moment, bis auf diesen Tag.
Sein Freund lag ihm wie ein Federgewicht in den Armen. Ross trug ihn dorthin zurück, wo der Zug ihm aus allen Rohren Feuerschutz gab. Jeder strauchelnde Schritt schien eine Ewigkeit zu dauern, während er die Anstrengung in allen Gliedern spürte.
Der Tod macht einen leicht, glaubte Ross zu wissen.
Auf seinen Schultern war sein Freund gestorben.
In den Wochen und Monaten danach hatte Ross kein Risiko gescheut, bis sein Kriegseinsatz zu Ende war.
Und er hatte getötet.
So oft und so brutal wie möglich.
Er hatte darum gebeten, das Maschinengewehr M-16 zu übernehmen, und der neue Leutnant wusste, wieso. Ross hatte eine Vorliebe für das schwere Geschütz entwickelt. Möglichst leicht möglichst viele Tote. Die Tage in Feindesland gingen fließend ineinander über, er warf Granaten, er zückte sein Seitengewehr, und hätte er gekonnt, hätte er auch mit seinem Allzweckmesser oder mit bloßen Händen getötet. Er hatte seine Opfer nie gezählt. Nie darüber gesprochen, weshalb er so süchtig danach war, es ihnen zu zeigen. Die anderen im Zug wussten Bescheid. Aber egal, wie viele feindliche Soldaten er liquidierte, das Loch in seinem Innern blieb. Und nach all den Jahren glaubte Ross, wenn wieder Oktober war, manchmal spät in der Nacht Freddy zu hören:
»Ich hatte noch so viel vor. Ich wollte noch nicht sterben.«
So etwas hätte Freddy nie gesagt, es hätte ihm kein bisschen ähnlich gesehen. Aber Ross wusste, dass es so war. Und er hörte noch immer jedes Wort so, als stünde sein Freund neben ihm.
Das versuchte er auch, einem Psychotherapeuten im nächstgelegenen Krankenhaus für Veteranen zu erklären. Er machte das jeden Oktober; ließ sich einen Termin geben, ging hin, absolvierte widerwillig eine Stunde und verabschiedete sich. Die Woche darauf dasselbe. Er meldete sich immer wieder an, ohne über den Grund für seine Depression zu sprechen, bis der Oktober in den frostigen November überging und die Feiertage vor der Tür standen.
Vor einigen Jahren hatte Ross, wie so viele andere längst ergraute Veteranen, eine Reise zum Vietnam-Memorial in Washington, D. C., unternommen, aber eine Tafel vor derjenigen aufgehört, auf der Freddys Name in den schwarzen Marmor eingraviert war. Er war schluchzend auf die Knie gesackt, unfähig, sich zu rühren. Seine Frau hatte den Blumenstrauß und Ross’ Navy-Cross-Medaille genommen und, so wie Ross es gewollt hatte, vor Freddys Namen abgelegt. Er hatte die Auszeichnung für die vergebliche Bergung seines Freundes immer gehasst. Ich hatte gar keine andere Wahl. Ich hatte nie eine Wahl. Ich musste hin. Er war mein Freund. Was blieb mir anderes übrig? Was wäre denn jedem anderen an meiner Stelle übrig geblieben? Es war eine Medaille für eine Mischung aus Tapferkeit und Dummheit, für eine halsbrecherische Aktion, die von vornherein zum Scheitern verurteilt war. An jenem Tag ließ seine Frau ihn so lange weinen, wie er musste, bevor er irgendwann wieder auf die Beine kam, weiterstolperte und auf Freddys Namen starrte. Ross zog die Gravur mit dem Finger nach.
Dann hatte er salutiert und war, obwohl er sich nicht verletzt, ja nicht einmal den Knöchel verstaucht hatte, davongehinkt. Beim Verlassen des Denkmals stützte er sich auf den Arm seiner Frau. Sie fürchtete, er könnte umfallen und nie wieder aufstehen.
Dies war sein einziger Besuch der Gedenkstätte.
Ross war davon überzeugt, dass sich seit jenem Tag im Dschungel von Vietnam sein eigenes Leben unwiderruflich geändert hatte. Bis auf diesen Tag glaubte er, nicht das Leben geführt zu haben, das ihm bestimmt gewesen war – auch wenn er nicht mit dem Finger darauf zeigen konnte, inwiefern es anders gelaufen war.
Er wusste es einfach.
In den Jahren seit dem Krieg hatte Ross Menschen kennengelernt, in denen er Freunde sah. Zum Beispiel Menschen, mit denen er bis zu seiner Pensionierung, inklusive Geschenkgutschein und billiger Armbanduhr mit Golddoublé, im letzten Frühjahr bei der Zulassungsstelle am College gearbeitet hatte. Oder bei seinem mittäglichen Basketballspiel mit der Altherrenriege im Fitnessclub, die sich gerne mit wahrscheinlich erfundenen sportlichen Heldentaten aus Urzeiten brüstete. Oder Nachbarn, mit denen er sich zum Barbecue getroffen hatte. Leute, mit denen er im Kirchenchor gesungen hatte. Ein feste Burg ist unser Gott. Auch wenn er nicht eine Sekunde daran glaubte und überhaupt herzlich wenig für Religion übrighatte, liebte er das Singen im Chor. Keiner dieser Menschen lag ihm wirklich am Herzen – zumindest nicht so wie damals sein Kamerad bei den Marines. Und mit niemandem hatte er je über seinen Kriegsdienst gesprochen. Er wollte kein Schulterklopfen und keine leeren Sprüche. An seinem rechten Unterarm hatte er das berühmte Marine-Corps-Symbol – Erdkugel, Adler und Anker – eintätowiert. Immer wenn er kurze Ärmel trug, klebte er es mit einem Pflaster zu; nicht etwa, weil er sich für seine Zeit bei der Eliteeinheit schämte, sondern weil er nicht darüber reden wollte. Mehr als fünfzig Jahre später war das in der liberalen Welt akademischer Birkenstock-Träger, in der er Jahrzehnte zugebracht hatte, immer noch ein wunder Punkt. Und so behielt er seine Krieger-Killer-Vergangenheit für sich, selbst als der elfte September und die militärischen Abenteuer im Irak und in Afghanistan in seiner kleinen Stadt in New England Dauerthema waren.
Er wusste, was diesen Soldaten bevorstand.
Der Tod.
Die Leute in seiner Umgebung, die vehement, leidenschaftlich und mit guten Argumenten über das Pro und Kontra debattierten, wussten es nicht.
Jedenfalls glaubte er an diesem Oktobernachmittag so wie sonst, seine suizidalen Gedanken und Depressionen erfolgreich vor den beiden Menschen verborgen zu haben, die ihm mehr als jeder andere am Herzen lagen. Sie warteten auf ihn: Connor und GM.
GM war seine Frau Kate.
Connor war sein Enkelsohn, der, ein Waisenkind, bei ihnen lebte.
Vor vielen Jahren hatte Connor ihnen an einem trostlosen Tag, kurz nachdem sie ihm in ihrem bescheidenen Vorstadthaus sein neues Zimmer gezeigt hatten, diese Spitznamen gegeben. Mom und Dad kamen nicht infrage. Ebenso wenig wie Grandma und Grandpa. Und so hatte sich das Kind etwas anderes einfallen lassen, die Abkürzung. GP und GM, wie er es damals aussprach, Jeep und Jim.
Die Namen blieben haften.
Im Lauf der Jahre hatte es Connor nicht leicht mit sich gehabt. Tränen. Wutanfälle. Bettnässen. Nachtangst. Zuweilen tagelanges Schweigen. Später dann war er zum Einzelgänger geworden. Wenig Freunde. Wenig Umgang. In sich gekehrt. Einsilbig gegenüber seinen Großeltern. Ein Kind, das die Wut in sich hineinfraß.
Die Psychologin, bei der Ross und Kate damals immer wieder Rat suchten, hatte ihnen erklärt, dass Connor seine Probleme ausagiere. Das sei die unvermeidliche Reaktion auf einen so plötzlichen Verlust und das kindliche Verlassenheitsgefühl in Verbindung mit dem Trauma.
Was Sie nicht sagen!, hatte Ross geantwortet.
Sie hatte ihnen auch prophezeit: Aus vielen dieser Verhaltensweisen wird er herauswachsen.
Ross war sich da nicht so sicher.
Manches wird wohl für immer bleiben.
Darin war Ross sich sicher.
Mit derlei Schwierigkeiten hatten Kate und Ross von Anfang an gerechnet, als sie Connor in ihre Obhut nahmen. Von dem Moment an, da er mit fünf Jahren beide Eltern verlor, war sein Schicksal besiegelt. Verlor war nicht das richtige Wort. Ein betrunkener Fahrer hatte sie getötet, als er mit irrwitziger Geschwindigkeit den Mittelstreifen überfuhr. An einem späten Nachmittag. An einem ganz gewöhnlichen Frühlingstag, an dem im Garten schon die ersten Blumen blühten, bei milden Temperaturen und strahlendem Sonnenschein, kurz nach fünf, als seine sehr junge, sehr schwangere Mutter, Grundschullehrerin von Beruf, seinen Vater, einen Versicherungsvertreter, in ihrem Kleinwagen abholte, weil sein SUV in der Werkstatt stand und neue Bremsen bekommen sollte. Sie waren unterwegs, um Connor vom Kindergarten abzuholen.
Ihre Tochter. Das einzige Kind. Ein uneheliches Kind, in einer leidenschaftlichen Nacht im College gezeugt, kurz nachdem er aus Vietnam zurückgekehrt war und Kate mit gerade mal achtzehn Jahren ihr Studium angefangen hatte – die große Befreiung aus dem streng konservativen katholischen Elternhaus mit seinen starren Regeln: kein Sex, einteiliger Badeanzug und immer schön die Arme bedeckt. Kate und Ross hatten ihr unerwartetes Baby Hope genannt, denn als sie zu ihrem eigenen Erstaunen feststellten, dass sie sich liebten, hatte ihnen das Kind Hoffnung gemacht. Und genau so hatten Ross und Kate ihren Schwiegersohn ins Herz geschlossen, weil er ihre Tochter aufrichtig liebte.
Ross und Kate blieb keine Zeit zum Trauern. Hope war tot und mit ihr der hoffnungsvolle Blick in die Zukunft. Das Loch, das der betrunkene Fahrer in ihr Leben gerissen hatte, klaffte in einem wenig beachteten Winkel ihres Bewusstseins weiter. Sie mussten Connor zu sich nehmen, ihm erklären, was passiert war, obwohl es keine irgendwie sinnvolle Erklärung gab. Sie mussten Vorkehrungen für die Beerdigung treffen, das Kind in einen zu engen marineblauen Blazer, passend zur Clip-Krawatte, zwängen und ihm bei der Trauerfeier die Hand halten, während allzu viel davon die Rede war, dass hier zwei Menschen zu jung, in der Blüte des Lebens, von uns gegangen seien. Sie hatten ihre eigene Trauer unterdrückt, weil Connors Leben eindeutig die oberste Priorität zukam.
Wie können wir ihm so etwas wie Normalität vermitteln?
Wer weiß das schon?
Der betrunkene Fahrer überlebte den Frontalzusammenstoß mit einem gebrochenen Bein. Er verlor seinen Führerschein und wurde zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe und anschließendem Entzug sowie regelmäßigem Besuch der Anonymen Alkoholiker verurteilt. Zum dritten Mal. Eine dürftige Strafe für das, was er angerichtet hatte. Als sich der Unfall zum ersten Mal jährte, beschloss Connor im Alter von sechs Jahren, den Fahrer umzubringen. Jeep und Jim sagte er nichts, behielt seine Entscheidung für sich, auch wenn er ziemlich sicher war, dass Jeep bereit gewesen wäre, ihm zu helfen. Und er wusste auch, dass er erst erwachsen werden, seine Ausbildung abschließen musste. Mit sechs ging er von ungefähr zwanzig Jahren aus, bevor er sein Vorhaben in die Tat umsetzen konnte. Sechsundzwanzig erschien ihm zwar unfassbar alt, andererseits aber auch vernünftig. Er konnte die Jahre an den Fingern abzählen, rechte Hand, linke Hand, rechte Hand, linke Hand, und da war er nun. Er hatte die Jahre vorüberziehen lassen, war größer und kräftiger geworden, hatte den Stimmbruch hinter sich gebracht. Nun, nach zwölf Jahren, etwas mehr als der Hälfte seines Kill-Countdowns, brachte er gerade die Highschool zu Ende.
Er war kein Kind mehr.
Aber an dem kindlichen Beschluss, diesen Mann zu töten, hatte sich nichts geändert.
Und an Tagen, in denen ihn die Trauer wie ein unbezwingbares Ungeheuer überwältigte und sich eine düstere Leere in ihm ausbreitete, half er sich mit dem Gedanken darüber hinweg, dass die Tage dieses Trinkers mehr denn je gezählt waren.
Connor verfolgte den Fahrer von damals heimlich über Facebook und andere soziale Netzwerke. Es war wie eine Hausaufgabe mit offenem Ende. Er machte heimlich Fotos vom Täter und brachte seine Sammlung laufend auf den neuesten Stand. Kannte seine Adresse. Kannte seine Familie, die sich von ihm getrennt hatte. Wusste, wo sie arbeiteten. Wo sie zur Schule gingen. Wo er arbeitete, wenn er nicht gerade wieder gefeuert worden war. Wusste, wo er sich am liebsten betrank und wo er hinging und die anderen Alkoholiker bei den AA-Treffen belog. Die wahllose Frage: »Was treibt er donnerstagnachmittags um 15.30 Uhr?« hätte Connor mit fast hundertprozentiger Zuverlässigkeit beantworten können. Manchmal folgte er dem Mann bis nach Hause, lungerte draußen im Dunkeln herum und starrte durch die Fenster hinein. Sosehr er den Mann, den er umzubringen gedachte, hasste, so sehr wollte er ihn immer besser kennenlernen, mehr als irgendeinen anderen Menschen auf dem Planeten.
Er hielt alles, was er an Informationen über den Mörder seiner Eltern zusammentrug, auf seinem Laptop fest. In einer umfangreichen Datei.
In seiner Freizeit widmete sich Connor dem Studium des Tötens.
Sein Ziel war es, mit der Ermordung des betrunkenen Fahrers ungestraft davonzukommen. Für ihn war es eine einfache Gleichung: Er hat mir meine Mom und meinen Dad genommen, also darf ich ihm das Leben nehmen. Aber das sollte mich nicht meine Zukunft kosten. Es ist nur fair, schlicht und ergreifend. Ausgleichende Gerechtigkeit. Und so sah er sich im Fernsehen Sendungen an wie How to Get Away with Murder, Mind Hunter oder Broadchurch. Er las Sachbücher über wahre Verbrechen. Kaltblütig und Mord im Auftrag Gottes und The Stranger Beside Me. Machte sich Notizen. Kam zu dem Schluss, dass er für seinen Plan wohl Strafrecht als Hauptfach belegen musste, wenn er ans College ging. Danach wäre ein reguläres Jurastudium mit Schwerpunkt Strafrecht von Nutzen oder ein Abschluss an der John Jay School of Criminal Justice der City University von New York. Er würde im Fach Mord seinen Doktor machen.
Stunden um Stunden durchforstete Connor das Dark Web nach Anregungen. Die Enthauptungen von ISIS und Fotos von Leichen nach Angriffen mit Nervengas. Facetten des Bösen, krass und doch alltäglich. Immer wenn das, was er sah, ihn zu erdrücken oder krank zu machen drohte, wendete er sich wieder seinen normalen schulischen Aufgaben zu. Mathematik. Gemeinschaftskunde und Geschichte.
Connor hatte ehrgeizige Ziele für seine Ausbildung. Nicht minder ehrgeizige Ziele in puncto Töten.
Er wusste, dass GP in dem Raum, der ihm als Arbeitszimmer diente, in einem stählernen Safe ein 30–06-Jagdgewehr sowie eine Handfeuerwaffe Kaliber .357 unter Verschluss hielt. Die Kombination des Sicherheitsschlosses war der Geburtstag von GM. Somit standen sie Connor, wenn der Tag dereinst gekommen war, zur Verfügung.
Er hegte die Absicht, gut ausgerüstet zu sein.
Doch in diesem Moment, an diesem strahlenden, frühherbstlichen Morgen – das Laub an den Bäumen nahm schon leuchtende Farben an, und die Kälte bei der Fahrt zur Schule kündete bereits vom Winter –, rückten seine toten Eltern, seine akademische Zukunft und seine Rachepläne erst einmal in den Hintergrund.
Er hatte es mit einem Elfmeter zu tun.
Connor war Torwart.
Rechts. Links. Mitte. Hoch. Runter.
Entscheide dich. Komm schon, entscheide dich.
Der Schiedsrichter belehrte ihn darüber, mit den Fersen auf der Torlinie zu bleiben und sich nicht zu rühren, bis der Ball berührt wurde, keine neue Erkenntnis für Connor. Er beäugte den Schützen und versuchte, den Winkel, in dem der Ball ins Tor käme, abzuschätzen. Letztlich erwartet keiner von dir, einen Elfmeter zu halten. Auch das wusste er. Trotzdem konzentrierte er sich mit aller Macht und versetzte sich in die Lage des Schützen. Du willst nicht übers Tor schießen, richtig? Nein. Den Ball auch nicht gegen die Latte setzen oder danebenschießen, sodass es an dir hängen bleibt und dich für das restliche Spiel lähmt. Er wird den Ball leicht von oben nehmen, um ihn flach in die Ecke zu bringen. Welche Ecke? Immer schwierig, den Ball diagonal mit dem rechten Fuß in die linke Ecke zu bringen. Falls er das aber doch vorhat, wird er mit kurzem Anlauf etwas antäuschen. Die sicherere Option: ein möglichst harter Schuss in die rechte Ecke. Okay. Also nach rechts. Zwar geraten, aber …
Der Schiedsrichter pfiff, der Schütze nahm Anlauf. Nicht schnell. Kontrolliert. Fast graziös.
Nach rechts, schrie alles in ihm.
Er warf sich in voller Körperlänge parallel zum Boden und mit ausgestreckten Armen in diese Richtung.
Er hörte die Jubelrufe der Menge.
Gottverdammt.
Für einen Moment ließ er sich das Gesicht von der feuchten kühlen Erde massieren. Als er aufstand, sah er, wie die gegnerische Mannschaft den Schützen umarmte.
Links.
Mist.
Er klopfte sich den Dreck vom Trikot und holte den Ball aus dem Netz, um ihn in die Mitte des Spielfelds zu werfen. Einen Moment lang ließ er den Blick über die Seitenlinie schweifen, wo er GP und GM unter den Zuschauern entdeckte. Er zuckte mit den Achseln und freute sich, als GP das Faustzeichen machte, um ihn aufzumuntern.
Es half. In einer anderen Zuschauergruppe erspähte er Niki. Sie winkte unauffällig, und Connor dachte: Sie liebt mich, egal wie viele Tore ich reinlasse. Ich glaube, sie liebt mich auch noch, wenn ich diesen betrunkenen Fahrer umgebracht habe. Wir haben oft genug darüber geredet, und sie hat ganz offensichtlich überhaupt kein Problem damit. Und ich werde sie für immer lieben. Dasselbe galt, wie er glaubte, für GP und GM, wenn auch anders. Er hatte ihnen nie von seinen Plänen erzählt. Sie werden mich immer lieben, egal, was ich tue. Er beschloss, in diesem Spiel kein weiteres Tor zu kassieren, egal, wie löchrig die Verteidigung vor dem Torraum war. Ginge es nach ihm, würde er überhaupt nie mehr ein Tor reinlassen, nicht an diesem, nicht am nächsten oder an irgendeinem anderen Tag in der Zukunft. Auch wenn das, wie er wusste, rein physisch unmöglich war, fühlte es sich gut an, sich dieses Ziel zu stecken.
Nach dem Spiel ging Connor zu seinem Sportbeutel und packte die stinkenden, gefütterten Torwarthandschuhe in eine dafür vorgesehene Hülle. Verdreckt und verschwitzt, wie er war, hatte er nichts dagegen, sich von Niki umarmen zu lassen – es schien ihr nichts auszumachen, sie hatte ihn schon oft umarmt, wenn er aus anderen Gründen schweißgebadet war. GM würde ihn ebenfalls in die Arme nehmen, GP ihm auf den Rücken klopfen.
Er schulterte den Beutel und lief quer über das Spielfeld zu den dreien hinüber.
Niki trug noch ihren blaugrünen Trainingsanzug. Sie kam ihm im Laufschritt entgegen und schlang ihm, drei Meter von GP und GM entfernt, die Arme um den Hals.
»Du warst toll«, flüsterte sie.
Er schüttelte den Kopf, liebte es aber, sich von ihr etwas ins Ohr flüstern zu lassen.
»Sollen wir nachher zusammen pauken?«, fragte sie.
»Klar. Muss nur erst aus diesen Klamotten und unter die Dusche und vielleicht was essen.«
»Ich muss mich auf eine Klassenarbeit vorbereiten. Aber danach ist bestimmt noch Zeit für …« Niki warf einen Blick über die Schulter und sah, wie GP und GM sie einholten. »… für andere Fächer.«
Sie grinste. Er wusste, was sie meinte.
GM nahm Connor in die Arme. »Du hast das Spiel gerettet«, sagte sie. GM – früher einmal Kapitänin ihrer College-Volleyballmannschaft – verstand die Dynamik beim Fußball.
»Unentschieden«, erwiderte Connor finster.
GP schüttelte ihm kräftig die Hand.
»Eins zu eins ist nicht übel. Die waren viel besser als wir.«
»Trotzdem …«, fing Connor an.
»Ein Unentschieden ist so, wie deine Schwester zu küssen«, sagte GP.
»Blödes Klischee, GP«, antwortete Connor grinsend. »Ich habe keine Schwester und weiß folglich nicht, wie es sich anfühlt, eine zu küssen.«
Ross lachte.
»Na ja, es ist ein bisschen so, wie deine Großmutter zu küssen. Für sie ist ein Kuss von ihrem Enkel etwas Besonderes. Für dich vielleicht weniger.«
Darüber mussten sie alle lachen.
»Ich muss zurück in die Turnhalle«, sagte Connor. »Mich umziehen.«
»Lass dich nicht aufhalten«, erwiderte GP. »Wir warten auf dem Parkplatz.«
»Niki und ich treffen uns nachher zum Lernen. Ich soll ihr bei einem Aufsatz helfen.«
Niki nickte.
»Worüber denn?«, fragte Kate.
»Tim O’Briens Buch Was sie trugen«, antwortete sie.
GP dachte nur: Ich weiß alles über das Buch. Ich weiß alles über das, was er geschrieben hat. Besonders im Oktober.
»Ich geh direkt nach dem Essen rüber«, sagte Connor.
Niki wohnte zwei Häuser weiter.
»Bleib nicht zu lange«, mahnte GM. »Und Niki, grüß deine Eltern herzlich von uns.«
»Mache ich«, sagte sie, auch wenn sie es bezweifelte, da sie nicht zu Hause sein würden.
Auf dem Parkplatz sagte Kate zu Ross: »Tut mir leid, Liebling, aber ich muss noch mal für ein paar Stunden ins Krankenhaus. Ich setz Connor und dich zu Hause ab. Kannst die restliche Lasagne für dich und den Jungen aufwärmen. Ich komme nicht allzu spät zurück, aber ich muss hin.«
Ross nickte. »Kein Problem.«
»Sicher? Es macht dir auch wirklich nichts aus?«
»Nein, natürlich nicht.«
Er stellte ihr keine Fragen. Er wusste, weshalb sie noch mal zur Intensivstation wollte. Natürlich nichts Genaues. Aber es gab nur einen Grund für sie, nach Schichtende am Abend nochmals hinzufahren. Er fand, dass es für sie an der Zeit wäre, in Rente zu gehen. Sie hatte jahrzehntelang als leitende Intensivschwester gearbeitet und würde eine stattliche Rente beziehen, aber ihm war klar, dass sie es nie tun würde. Zumindest nicht bis zu dem Tag, an dem ihr die richtige Dosis für ein Medikament nicht mehr einfiele oder wie man die Herzmonitoren anschließt oder einen Katheter legt. Wenn es so weit war, würde sie gehen und nicht zurückblicken. Jetzt war es noch nicht so, doch er glaubte, dass dieser Tag nicht in allzu weiter Ferne lag.
Kate Mitchell sah, obwohl fast Mitte sechzig, nicht wie eine Großmutter aus. Sie hatte immer noch kräftiges, dunkelblondes Haar mit vornehmen grauen Strähnen und fand es nicht der Mühe wert, es sich zu färben. Mit Sport, Yogakursen und Pilates hielt sie sich in Form. An vielen Tagen schlug sie auch noch vor dem Dienst im Krankenhaus ein wenig Zeit heraus, um ein paar Meilen zu joggen. Wenn ihr dabei gelegentlich das Knie wehtat oder der Rücken, oder wenn sie morgens im Spiegel ein neues Fältchen entdeckte, konnte sie damit leben. Es gefiel ihr, dem Alter ein Schnippchen zu schlagen und dagegen anzukämpfen.
Als sie einparkte, war es schon dunkel, auch wenn das Licht am Eingang zum Krankenhaus einen hellen Lichtkegel über die Zufahrt für Krankenwagen warf.
Sie lief zügig über den geteerten Platz, nickte der Nachtschwester in der Notaufnahme zu und fuhr mit dem Fahrstuhl zur Intensivstation im ersten Stock.
Doch statt in die sterile, hell erleuchtete, mechanisierte Welt der Intensivmedizin strebte Kate zum Ende des Flurs, in eine kleine überkonfessionelle Kapelle.
Drinnen war es dunkel und geradezu unheimlich still. Ein Dutzend leere braune Bänke standen vor einem Altar mit einem kleinen Kreuz, einem goldenen Davidstern und einem silbernen Halbmond mit Stern. Vor den religiösen Symbolen flackerten Kerzen auf einem Tisch. Die Halter waren durchsichtig rot gefärbt, sodass sie wie die letzten Momente eines Sonnenuntergangs schimmerten. Daneben lagen frische Kerzen bereit, dazu ein paar Streichholzpackungen.
Hier fanden sich, wusste Kate, Menschen in der Hoffnung ein, dass der Gott ihrer Wahl ihre Gebete erhörte. Die Kapelle ließ ihnen jedenfalls die Wahl: Jesus, Jahwe oder Allah. Oder vielleicht auch alle drei.
Die neueste Patientin auf der Intensivstation ein Stück den Flur hinunter war ein neunjähriges Kind. Krebs. Ein Hirntumor. Drei Operationen und Chemotherapie, und es war nicht so gelaufen, wie es sich die Onkologen erhofft hatten. Das Kind hatte immer noch eine Chance – aber nur noch eine halbe. 50–50. Kate betete nicht.
Sie ging zu dem Tisch mit den Kerzen, steckte eine neue an und flüsterte dazu den Namen des Kindes.
Dann trat sie zurück und erhob die Stimme:
»Das also gehört zu deinem großen Plan, ja? Zu deinem ach so tollen Plan für uns? Du plagst ein Kind mit unablässigen Qualen, das keiner Fliege etwas zuleide getan und jedes Recht hat, jedes verfluchte Recht, aufzuwachsen und etwas aus seinem Leben zu machen? Was meinst du? Was könnte aus ihr werden? Eine Ärztin? Eine Lehrerin? Etwas Gutes, wetten! Und was ist mit all der Angst und Hilflosigkeit, die du ihren armen Eltern bescherst? Haben sie das wirklich verdient? Womit haben sie dir so ans Bein gepinkelt? Was für ein göttlicher Wille soll das sein, verflucht noch mal? Soll ich darin irgendeine Logik erkennen?«
Jedes ihrer Worte knisterte vor Wut.
»Du kannst mich mal: Du kannst mich mal, wenn du es mit deinem himmlischen Herzen nicht über dich bringst, dieses Kind zu retten. Wenn du das nicht fertigbringst – ich meine, wie schwer kann das sein? Immerhin bist du ein Gott! –, wenn du also nicht mal dazu imstande bist, dann kannst du mir gestohlen bleiben, dann kannst du dir jedes Gebet und jede Hoffnung und alles andere sonst wohin stecken. Liegt ganz bei dir. Zeig mal ein bisschen Gnade, verdammt noch mal. Und wenn nicht, dann geb ich einen Scheißdreck auf dich.«
Sie trat zurück.
Sie fühlte sich besser.
Auch wenn sie nicht wusste, ob dieses Kind die Nacht überleben würde, hatte sie diesem Gott, welcher auch immer gerade zuhörte, gesteckt, was hier auf dem Spiel stand. Kein Ach, bitte, bitte, lieber Gott, rette mein Kind-Gebet, hielt Kate fürs Protokoll fest. Das hat noch nie etwas gebracht, genauso wenig wie Nimm stattdessen mich, nicht mein Kind. Vielleicht dann zur Abwechslung mal blanke Wut. Sie machte auf dem Absatz kehrt und marschierte aus der Kapelle zur Intensivstation, um alles Nötige zu unternehmen, damit das Kind am Leben blieb. Sie glaubte, dass aus einer Nacht zwei und aus zwei Nächten drei und mehr werden konnten. Im Lauf ihrer Jahre auf der Intensivstation hatte sie viele sterben sehen und mehr als nur gelegentlich ein Leben, das gerettet werden konnte. Manchmal erschien ihr die Linie dazwischen hauchdünn.
Niki Templetons Alt-Hippie-Eltern führten ein überaus beliebtes Naturkostrestaurant in ihrer Stadt, behaglich mit Zimmerpflanzen und schlichten Holzstühlen im Shaker-Stil eingerichtet, in dem sich Studenten, Ex-Flower-Power-Kinder oder einstige Linksradikale, Elfenbeinturm-Akademiker, farbbespritzte Künstler und selbst ernannte New-Age-Heiler tummelten. Einer dieser illustren Gäste hatte draußen vor seiner Praxis ein mit bunten Blumen verziertes Schild angebracht, an dem Niki auf dem Schulweg täglich vorbeikam, mit der Aufschrift: »Sanfte Partnertherapie«. Niki war eine solche Anmaßung verhasst. Sollte das etwa heißen, dass die Paare, die sich hier beraten ließen, niemals Streit miteinander hatten? Kein gezielter Schlag, nicht einmal mit der Faust auf den Tisch? Keine gekonnten Handkantenhiebe? Keine blauen Augen, sonstige Blutergüsse und Notrufe bei der Polizei? Wenn sie sich das alles nicht antaten, wieso kamen sie dann her?
Außerdem hasste sie Naturreis.
Grünkohl. Tofu.
Gedünstetes Blattgemüse.
Sie liebte Cheeseburger, blutig. Mit Fritten, egal ob McDonald’s oder Burger King. Was Herzhaftes, zum Arterienverstopfen, etwas, das es bei ihnen zu Hause niemals gab und vor dem es ihre Eltern grauste.
Dem Klischee zum Trotz war Niki gertenschlank und schnell, mit durchtrainierten, langen Beinen. Querfeldeinläuferin, mit einer Liebe zu Tempo und einem Trainingspensum, das jedes Stück Schokoladenkuchen, dem sie nicht widerstand, wegschmolz.
Zum Leidwesen ihrer Eltern, die Mühe höher einschätzten als Erfolg, liebte sie es, bei jedem Rennen ihre Gegnerinnen zu schlagen und die anderen Mädchen dies von Zeit zu Zeit auch wissen zu lassen.
Wenn sie dafür angefeindet wurde, nahm sie es in Kauf.
Insgeheim oder auch offen nutzte sie jede Gelegenheit zu einem kleinen Akt der Rebellion. Sie hatte eine Schwäche dafür. Sie las Bücher wie Outsiders. Fahrenheit 451.