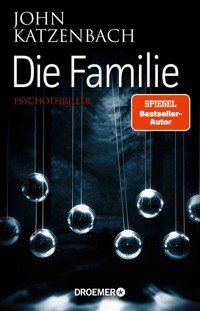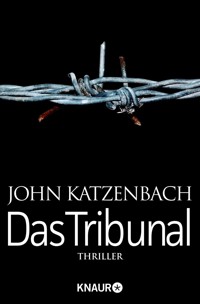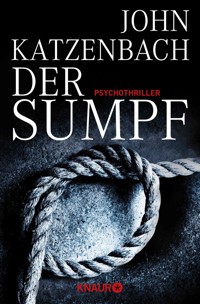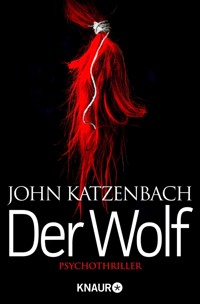9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Miami 1995. Als seine Nachbarin Sophie Millstein erdrosselt aufgefunden wird, ist Detective Simon Winter klar, dass ihre Angst berechtigt war: Tags zuvor hatte die Holocaustüberlebende ihm verzweifelt berichtet, ihr sei der Schattenmann begegnet – jener Nazi-Scherge, der damals untergetauchte Juden ans Messer lieferte. Ist er zurückgekehrt, um die letzten Zeugen seiner Taten zu beseitigen? Der Täter von John Katzenbach: Spannung pur im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 749
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
John Katzenbach
Der Täter
Psychothriller
Aus dem Amerikanischen von Anke und Eberhard Kreutzer
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Miami Beach 1995: Die Holocaust-Überlebende Sophie Millstein wird ermordet aufgefunden. Tags zuvor hatte sie ihrem Nachbarn, dem pensionierten Detective Simon Winter, angsterfüllt berichtet, dass ihr der Schattenmann begegnet sei – jener Nazi-Scherge, der in den vierziger Jahren untergetauchte Juden ans Messer lieferte. Offenbar ist er zurückgekehrt, um die letzten Zeugen seiner Taten zu beseitigen. Detective Winter begibt sich auf eine lebensgefährliche Jagd ...
Inhaltsübersicht
Wie immer schulde ich [...]
Die Geschichte, sagte Stephen,ist [...]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
Nachwort zur deutschen Erstausgabe
Dank
Wie immer schulde ich meiner Familieden größten Dank, und so ist dieses BuchJustine, Nick und Maddy gewidmet.
Die Geschichte, sagte Stephen,ist ein Alptraum, aus dem ich zu erwachen versuche …
James Joyce, Ulysses
1
Ein verhinderter Tod
In den frühen Abendstunden einer drückend schwülen Hochsommernacht in Miami Beach beschloss Simon Winter, ein alter Mann, der sich über viele Jahre beruflich mit dem Tod beschäftigt hatte, seinem Leben ein Ende zu setzen. Auch wenn es ihm leidtat, anderen einige Drecksarbeit zu hinterlassen, begab er sich langsam zu einem Wandschrank im Schlafzimmer und zog eine verkratzte, kurzläufige Detective Special aus einem ausgeblichenen, schweißverfleckten Lederholster. Mit Mühe klappte er die Trommel auf, holte fünf der sechs Kugeln heraus und steckte sie sich in die Hosentasche. Auf diese Weise, hoffte er, wäre jeder Zweifel an seinen Absichten ausgeräumt.
Ohne den Revolver aus der Hand zu legen, begann er, nach Stift und Papier zu kramen, um einen Abschiedsbrief zu schreiben. Zu seinem Ärger nahm das einige Minuten in Anspruch, und erst nachdem er in der Schublade seiner Kommode einige weiße, gebügelte Taschentücher, Krawattennadeln und Manschettenknöpfe zur Seite geschoben hatte, entdeckte er ein einziges, unbeschriebenes Blatt blauliniertes Notizpapier und einen billigen Kugelschreiber. Nun denn, dachte er, dann fass dich eben kurz.
Während er überlegte, ob er noch etwas vergessen hatte, machte er vor dem Spiegel halt und betrachtete sich. Recht passabel. Sein kariertes Freizeithemd war ebenso wie seine khakifarbene Hose, die Socken und Unterwäsche sauber. Vielleicht sollte er sich rasieren, überlegte er, als er mit dem Rücken der Hand, in der er die Waffe hielt, über die Stoppeln strich, doch dann fand er es übertrieben. Ein Haarschnitt hätte nicht geschadet, doch stattdessen strich er sich nur einmal mit der Hand durch den weißen Schopf. Keine Zeit, dachte er. Plötzlich fiel ihm wieder ein, dass er als Junge einmal gehört hatte, die Haare würden auch nach dem Tod noch weiterwachsen.
Haare und Nägel. Er wünschte sich, dass es stimmte. So etwas gehörte zu den Geschichten, die unter Kindern in heiligem Ernst als Flüsterpost die Runde machten und in dunklen Zimmern unweigerlich zu Gespenstergeschichten überleiteten. Zu den Widernissen des Älterwerdens, dachte Simon Winter, gehörte der Verlust der Mythen.
Er wandte sich vom Spiegel ab und warf einen flüchtigen Blick durchs Zimmer – das Bett war gemacht, in der Ecke lag kein Haufen schmutziger Wäsche. Seine Einschlaflektüre – Taschenbuchausgaben von Krimis und Abenteuergeschichten – war auf dem Nachttisch gestapelt und wenn auch nicht eben ordentlich, so doch einigermaßen vorzeigbar, etwa so wie er selbst. Jedenfalls ging das Maß an Durcheinander nicht über das hinaus, was man von einem alten Junggesellen oder, nebenbei gesagt, auch von einem Kind erwarten durfte. Die Parallele beschäftigte ihn eine Weile und gab ihm am Ende das unverhoffte Gefühl, irgendwie werde alles gut.
Durch den Türspalt ins Badezimmer fiel sein Blick auf das Fläschchen Schlaftabletten, und er spielte mit dem Gedanken, statt seines alten Dienstrevolvers diese zu verwenden, fand es dann aber feige, sich auf solche Weise umzubringen. Innerlich redete er sich gut zu: Du solltest so viel Schneid aufbringen, in den Lauf deiner Waffe zu blicken, und dir nicht einfach einen Haufen Pillen reinwerfen, um sanft, doch unwiderruflich hinüberzudämmern. Er ging in die Küche. Im Ausguss stand der Abwasch eines Tages. Während er darauf starrte, krabbelte eine riesige Schabe auf den Rand eines Tellers und rührte sich nicht mehr vom Fleck, als verfolgte sie gespannt, was Simon Winter als Nächstes vorhatte.
»Widerliche Biester«, knurrte er laut, »verfluchte Kakerlake.«
Er hob den Revolver und zielte. »Peng«, sagte er. »Ein einziger Schuss. Hast du übrigens gewusst, Viech, dass ich immer die besten Trefferquoten erreicht habe?«
Bei dem Gedanken seufzte er, bevor er mit einem Lächeln die Waffe und das Blatt Papier auf die Arbeitsplatte aus billigem, weißem Linoleum legte, sich das Geschirrspülmittel griff und zügig mit dem Abwasch begann. »Sauberkeit ist das halbe Leben.«
Zwar kam es ihm ein wenig albern vor, als letzten Akt auf Erden Teller zu spülen, andererseits war ihm klar, dass es an jemand anderem hängenbleiben würde, falls er es unterließ. Das wiederum war nicht seine Art: Er machte keine halben Sachen, die andere zu Ende führen mussten.
Die Kakerlake roch wohl die Seifenlauge, spürte, dass sie sich in tödlicher Gefahr befand, ergriff quer über die Platte die Flucht und entkam seinem halbherzigen Schlag mit dem Schwamm.
»Na ja, du magst davonlaufen, aber entkommen wirst du mir nicht.«
Er griff unter den Ausguss und fand eine Dose Insektenspray. Er schüttelte sie energisch, dann richtete er einen Strahl in die ungefähre Richtung, in die das Insekt sich verkrochen hatte.
»Wir werden wohl zusammen das Zeitliche segnen, Ungeziefer«, stellte er fest. Die Wikinger, fiel ihm wieder ein, töteten einen Hund und legten ihn einem Mann zu Füßen, bevor sie ihn bestatteten, damit ihm das Tier auf dem Weg nach Walhall Gesellschaft leistete. Konnte man sich einen besseren Gefährten denken als einen Hund, der wahrscheinlich darüber hinwegsehen würde, dass die barbarische Sitte seinem eigenen Leben ein vorzeitiges Ende setzte? Wenn ich einen Hund besäße, dachte Simon Winter, dann könnte ich ihn zuerst erschießen, doch ich habe keinen, und außerdem würde ich es nicht tun, also muss ich als Weggefährtin zu meinem Walhall mit einer Kakerlake vorliebnehmen.
Er schmunzelte bei der Frage, worüber er und das Ungeziefer sich wohl unterhalten würden; bei Lichte betrachtet gab es durchaus Gemeinsamkeiten, denn sie hatten beide in den weniger appetitlichen Ritzen und Winkeln des alltäglichen Lebens herumgewühlt. Mit einer schwungvollen Geste wischte er den Ausguss sauber, legte den Schwamm in die Ecke und kehrte mit dem Blatt Papier sowie dem alten Revolver in sein bescheidenes Wohnzimmer zurück. Er setzte sich auf das fadenscheinige Sofa und legte die Waffe vor sich auf den Tisch. Dann nahm er das Blatt sowie den Kugelschreiber, dachte einen Moment nach und schrieb:
Erklärung
Ich bin von eigener Hand gestorben.
Ich bin alt, müde und einsam und habe schon seit Jahren nichts Nützliches mehr geleistet.
Tja, das stimmt alles, dachte er, aber die Welt scheint mit jedem Toten ganz gut zurechtzukommen, demnach besagt das hier nicht viel. Er tippte sich ein paarmal mit der Kugelschreiberspitze an die Zähne. Sag, was du wirklich meinst, mahnte sich Simon Winter in schulmeisterlicher Manier. Zügig schrieb er weiter:
Ich fühle mich wie jemand, der allzu spät bemerkt, dass es an der Zeit ist, abzutreten.
Schon besser, dachte er mit einem trockenen Lächeln. Und nun zum geschäftlichen Teil.
Ich habe etwas über fünftausend Dollar auf einem Sparkonto bei der First Federal. Ein Teil davon soll darauf verwendet werden, diese alten Knochen zu verbrennen. Falls jemand die Freundlichkeit besäße, meine Asche am Government Cut ins Wasser zu streuen, wüsste ich das zu schätzen.
Simon Winter hielt im Schreiben inne. Es wäre schön, überlegte er, wenn in dem Moment ein Schwarm Tarpune, die sich dort tummelten, an die Oberfläche käme, um nach Luft zu schnappen und sich auf die Meerbrassen oder die kleinen Makrelen zu stürzen. Das sind prächtige Tiere. Mit ihren riesigen Silberschuppen und den mächtigen, sensenförmigen Flossen erinnern sie an fahrende Ritter im Panzerhemd. Sie gehören zu einem urzeitlichen Stamm, der die Jahrhunderte unverändert überdauert hat, und einige von denen sind wahrscheinlich so alt wie ich. Ihm kam die Frage in den Sinn, ob ein Tarpun jemals des Schwimmens müde wurde, und wenn ja, was er dann tat. Vielleicht drosselte er nur das Tempo und hatte es nicht so eilig, wenn ein Hammerhai den Schwarm verfolgte. Wäre nicht das Schlechteste, als Tarpun wiedergeboren zu werden. Er schrieb weiter:
Das verbleibende Geld sollte an den Witwenfonds der Polizeidienststelle Miami Beach gehen, oder wie auch immer das heute heißt. Es sind keine Angehörigen zu benachrichtigen. Ich hatte einen Bruder, der jedoch gestorben ist, und von seinen Kindern habe ich seit Jahren nichts gehört.
Ich habe das Leben genossen und das eine oder andere zuwege gebracht. Falls jemand interessiert ist: Im Schlafzimmer ist ein Album mit ein paar Zeitungsausschnitten zu meinen alten Fällen.
Zuletzt gestattete er sich ein kleines Eigenlob, bevor er mit einer Entschuldigung schloss:
Es gab einmal eine Zeit, da konnte ich es mit jedem aufnehmen.
Tut mir leid, solche Umstände zu machen.
Er überlegte, las die Nachricht noch einmal durch und unterzeichnete mit einem eleganten Namenszug:
Simon Winter. Detective a.D.
Er holte einmal tief Luft und hob die Hand in Augenhöhe. Sie war ruhig. Er betrachtete seine Zeilen. Auch in seiner Schrift war kein Zittern zu erkennen. Dann wollen wir mal, dachte er. Du hast schon Schlimmeres durchgemacht. Worauf wartest du also noch?
Er packte die Waffe und legte den Finger an den Abzug. Jede Phase im Bewegungsablauf spürte er bis ins kleinste Detail. Die Spannung in seinem Finger am Abzug aktivierte die Sehne an seinem Handrücken. Als er die Waffe hob und das Handgelenk ausrichtete, um sie ruhig zu halten, fühlte er die Muskeln im Unterarm. Sein Herzschlag beschleunigte sich. Im Kopf stieg ihm eine Flut von Erinnerungen auf. Er befahl seinen Augenlidern, sich zusammenzukneifen, um keinen Funken Zweifel zuzulassen. Also, dachte er. Los. Es ist so weit.
Simon Winter drückte sich den Lauf seines Revolvers gegen den Gaumen und fragte sich, ob er den tödlichen Schuss noch spüren würde. Und in dieser Sekunde des Zauderns, dieser winzigen Verzögerung wurde die Stille, die er um sich legte, durch ein lautes, energisches Klopfen an der Wohnungstür erschüttert.
Das Geräusch krachte in seine selbstmörderische Konzentration und ließ ihn heftig zusammenzucken.
Im selben Moment wurden ihm Dutzende kleiner Empfindungen bewusst, als forderte die Welt mit einem Schlag seine Aufmerksamkeit. Vom Druck, den er mit seinem Finger am Abzug ausübte, schien ihm jeden Moment die Haut zu platzen; wo er mit einem glühenden Schmerz und rascher Umnachtung gerechnet hatte, schmeckte er jetzt das beißende Metall des Revolverlaufs und würgte vom stechenden Geruch der öligen Reinigungsmittel, mit denen er die Waffe gesäubert hatte. Seine Zungenspitze stieß an den eisigen Stahl des Abzugbügels, und er hörte seinen pfeifenden Atem.
In der Ferne dröhnte der Dieselmotor eines Busses vorbei. Er überlegte, ob es der A-30 Richtung Ocean Drive oder der A-42 auf dem Weg zur Collins Avenue war. An der Fensterscheibe summte in Panik ein Insekt, und ihm fiel ein, dass an einem der Fliegengitter ein Riss zu flicken war. Er öffnete die Augen und ließ die Waffe sinken.
Es klopfte ein zweites Mal und noch energischer an der Tür. Die Eindringlichkeit setzte seine Entschlusskraft außer Gefecht. Er legte seinen Revolver auf den Abschiedsbrief und stand auf.
Draußen hörte er jemanden rufen: »Mr.Winter, bitte …«
Die Stimme klang schrill und verängstigt. Die Stimme klang vertraut.
Es ist schon dunkel, dachte er. Seit zwanzig Jahren hat nach Sonnenuntergang niemand mehr an meine Tür geklopft. Für einen Moment vergaß er, dass ihm das Alter in den Knochen saß, und eilte zur Tür. »Ich komm ja schon, ich komm ja schon …«, rief er laut, bevor er mit der vagen Hoffnung öffnete, etwas Bedeutsames hereinzubitten.
Die ältere Frau, die vor der Wohnung stand, versprühte Angst wie einen Funkenregen. Ihr Gesicht war blass und starr, aufs äußerste angespannt, und sie sah Simon Winter derart hilflos an, dass er wie unter einer starken Böe einen Schritt zurücktrat und einen Moment brauchte, bis er seine Nachbarin, die seit nunmehr zehn Jahren ihm gegenüber wohnte, wiedererkannte.
»Mrs.Millstein, was ist denn passiert?«
Die Frau streckte die Hand aus und packte ihn am Arm, während sie immer wieder den Kopf schüttelte, als wollte sie ihm mitteilen, dass ihr vor Angst jedes Wort im Halse stecken bleibe.
»Fehlt Ihnen etwas?«
»Mr.Winter«, brachte die Frau schließlich langsam zwischen kaum geöffneten Lippen heraus, »Gott sei Dank sind Sie zu Hause. Ich bin so allein, und ich wusste mir nicht zu helfen …«
»Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Was ist passiert?«
Sophie Millstein trat schwankend näher. Wie ein Bergsteiger, der in den Abgrund zu stürzen droht, grub sie Simon Winter die Nägel in den Arm.
»Ich hab’s zuerst nicht geglaubt, Mr.Winter«, fing Sophie Millstein leise an, doch dann gewann sie an Fahrt, bis sich ihre Worte förmlich überschlugen. »Ich glaube, keiner von uns konnte es glauben. Es schien alles so lange her. Wie konnte er hier sein? Ausgerechnet hier? Nein, das schien einfach zu absurd, also hat es keiner von uns geglaubt. Weder der Rabbi noch Mr.Silver, noch Frieda Kroner. Aber wir haben uns geirrt, Mr.Winter. Er ist hier. Ich habe ihn heute selbst gesehen. Heute Abend vor der Eisdiele in der Lincoln Road Mall. Ich kam raus, und da stand er. Er hat mich nur angeblickt, Mr.Winter, und da wusste ich es. Er hat Augen wie Rasierklingen, Mr.Winter. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Leo hätte es gewusst. ›Sophie‹, hätte er gesagt, ›wir müssen jemanden anrufen‹, und er hätte die Nummer gleich parat gehabt. Aber Leo lebt nicht mehr, ich bin ganz allein, und jetzt ist er hier.«
Sie sah Simon Winter hilflos an.
»Er wird auch mich umbringen«, erklärte sie und schnappte nach Luft.
Simon Winter geleitete Sophie Millstein in sein Wohnzimmer und verfrachtete sie auf sein durchgesessenes Sofa.
»Niemand bringt irgendwen um, Mrs.Millstein. Jetzt hol ich Ihnen erst mal was Kaltes zu trinken, und dann können Sie mir erklären, was Sie so in Panik versetzt.«
Sie sah ihn mit einem gehetzten Blick an. »Ich muss die anderen warnen!«
»Ja, schon gut. Ich werde Ihnen helfen, aber jetzt trinken Sie erst was und erzählen mir dann der Reihe nach, was los ist.«
Sie machte den Mund auf, um etwas zu erwidern, doch dann fehlten ihr die Worte. Als wollte sie überprüfen, ob sie Fieber habe, legte sie die Hand an die Stirn und sagte: »Ja, ja. Eistee, falls Sie welchen haben. Es ist so heiß. Manchmal kommt es mir im Sommer so vor, als verbrauchte die Hitze sämtlichen Sauerstoff.«
Simon Winter nahm hastig seinen Abschiedsbrief und den Revolver vom Sofatisch und eilte in die Küche. Er fand ein sauberes Glas, goss Wasser, Eiswürfel und eine Mischung Instant-Tee hinein. Seinen Brief ließ er auf der Arbeitsplatte liegen, doch bevor er Sophie Millstein ihr Glas zurückbrachte, blieb er stehen, lud seinen Revolver wieder mit den fünf Kugeln aus seiner Hosentasche. Er hob den Kopf und sah, wie die alte Frau ins Leere starrte, als nähmen vor ihrem geistigen Auge Erinnerungen Gestalt an. Er spürte, wie ihn eine seltsame Erregung und ein Gefühl der Dringlichkeit packte. Sophie Millsteins Angst schien ihr die Kehle zuzuschnüren und wie dichter Rauch über dem Raum zu liegen. Er atmete tief durch und eilte an ihre Seite.
»Jetzt trinken Sie das erst mal«, sagte er wie zu einem kranken Kind. »Und dann schildern Sie in Ruhe, was los ist.«
Sophie Millstein nickte und nahm ihr Glas in beide Hände, um die schaumige braune Flüssigkeit mit gierigen Schlucken hinunterzuspülen. Sie holte tief Luft und drückte sich das kühle Glas an die Stirn. Simon Winter sah, wie ihr die Tränen in die Augen traten.
»Er bringt mich um«, beteuerte sie wieder. »Und ich will nicht sterben.«
»Mrs.Millstein, bitte«, erwiderte Simon Winter. »Wer?«
Sophie Millstein lief ein Schauer über den ganzen Körper, dann flüsterte sie auf Deutsch: »Der Schattenmann.«
»Wer? Ist das ein Name?«
Sie funkelte ihn an. »Niemand kannte seinen Namen, Mr.Winter, jedenfalls niemand, der überlebt hat.«
»Aber wer …«
»Er war ein Gespenst.«
»Ich verstehe nicht …«
»Ein Dämon.«
»Wer?«
»Er war teuflisch, Mr.Winter, so teuflisch, dass es Ihre Vorstellungskraft übersteigt. Und jetzt ist er hier. Wir wollten es nicht glauben, aber da lagen wir falsch. Mr. Stein hat uns gewarnt, aber wir kannten ihn nicht, wieso sollten wir ihm also glauben?«
Sophie Millstein zitterte sichtlich.
»Ich bin alt«, flüsterte sie. »Ich bin alt, aber ich will nicht sterben.«
Simon Winter hob die Hand. »Mrs.Millstein, bitte, Sie müssen das erklären. Lassen Sie sich Zeit und sagen Sie mir, um wen es geht und wieso Sie solche Angst haben.«
Sie nahm noch einen ausgiebigen Schluck von ihrem Eistee und stellte das Glas vorsichtig ab. Dann nickte sie langsam und versuchte, sich ein wenig zu fassen. Als sie die Hand erneut an die Stirn hob, strich sie sich mit den Fingern sachte über die Brauen, als könne sie auf diese Weise eine verhärtete Erinnerung lösen, und dann wischte sie die Tränen weg, die in ihren Augen standen. Sie holte tief Luft und blickte zu ihm auf. Er sah, wie sie die Hand bis zum Hals sinken ließ, wo sie für einen kurzen Moment die Halskette berührte, die sie trug. Sie war auffällig; ein dünnes Goldkettchen mit einem Schildchen daran, in das ihr Vorname eingraviert war, doch was dieses Halsband von denen unterschied, die jeder zweite Teenager trug, war ein Paar kleine Diamanten an den beiden Enden des S in Sophie. Simon Winter wusste, dass ihr verstorbener Mann dafür zu ihrem Geburtstag tief in seine bescheidene Pensionskasse gegriffen hatte, bevor er an Herzversagen starb, und genauso wie den Ehering an ihrem Finger legte sie es niemals ab.
»Es ist so schwer, das zu erzählen, wissen Sie. Seitdem sind so viele Jahre vergangen, dass es mir manchmal vorkommt wie ein böser Alptraum. Doch der Alptraum ist wirklich passiert, Mr.Winter, nur ist es fünfzig Jahre her.«
»Erzählen Sie weiter, Mrs.Millstein.«
»1943 waren wir, meine Familie – Mama, Papa, mein Bruder Hansi –, immer noch in Berlin. Versteckt …«
»Fahren Sie fort.«
»Es war ein entsetzliches Leben. Nicht eine Sekunde, nicht einen einzigen Herzschlag lang konnten wir uns sicher fühlen. Es gab nicht viel zu essen, und wir froren die ganze Zeit, und jeden Morgen dachten wir beim Erwachen, das wäre unsere letzte gemeinsame Nacht gewesen. Mit jeder Sekunde, so kam es uns vor, wuchs die Gefahr. Ein Nachbar konnte neugierig werden. Ein Polizist verlangte vielleicht nach den Papieren. Stieg man in den Straßenbahnwaggon, begegnete man womöglich jemandem, der einen aus den Vorkriegsjahren, der Zeit vor den gelben Sternen kannte. Vielleicht rutschte einem auch irgendetwas heraus, Mr.Winter, eine Belanglosigkeit. Oder es genügte eine Geste, eine Tonlage, das geringste Anzeichen von Nervosität, irgendetwas, das einen verriet. Auf der ganzen Welt finden Sie keine misstrauischeren Menschen als die Deutschen. Ich muss es wissen. Ich war mal eine von ihnen. Das genügte – das geringste Zögern oder ein ängstlicher Blick, irgendetwas konnte verraten, dass man nicht dazugehörte. Und dann war es aus. 1943 wussten wir Bescheid. Verhaftung bedeutete den Tod. So einfach war das. Manchmal lag ich nachts wach und betete, dass irgendein britischer Bomber danebentreffen und seine Ladung direkt über uns abwerfen würde, so dass wir alle zusammen gehen würden und die Angst endlich ein Ende hätte. Zitternd lag ich dann da und betete darum, zu sterben. Dann kam mein Bruder Hansi oft herüber und hielt mir die Hand, bis ich einschlief. Er war so stark. Und einfallsreich. Wenn wir nichts zu essen hatten, trieb er irgendwo Kartoffeln auf. Wenn wir keinen Unterschlupf hatten, fand er für uns irgendwo eine neue Wohnung oder einen Keller, wo wir keine Fragen zu fürchten hatten und wieder eine Woche oder länger bleiben konnten – immer noch zusammen, immer noch am Leben.«
»Was ist mit Ihrem …«
»Er ist umgekommen. Sie sind alle umgekommen.«
Sophie Millstein holte tief Luft.
»Wie gesagt, er hat sie ermordet. Er hat uns gefunden, und sie sind gestorben.«
Simon Winter wollte eine weitere Frage einwerfen, doch sie wehrte mit zitternder Hand ab.
»Lassen Sie mich das zu Ende bringen, solange ich noch die Kraft dazu habe. Es gab so vieles, das einem Angst und Schrecken einjagte, doch das Schlimmste waren vermutlich die Greifer.«
»Die Greifer?«
»Juden wie wir. Juden, die für die Gestapo arbeiteten. Da gab es dieses Haus in der Iranischen Straße. Eins von diesen schrecklichen grauen Gebäuden, wie sie die Deutschen so lieben. Der jüdische Fahndungsdienst, wie sie das nannten. Da hat er gearbeitet, wie all die anderen auch. Ihre eigene Freiheit hing davon ab, uns aus unseren Löchern zu holen.«
»Und Sie glauben, dass Sie heute diesen Mann gesehen haben …«
»Einige waren berühmt-berüchtigt, Mr.Winter. Rolf Isaaksohn, der war jung und arrogant, und dann die schöne Stella Kübler. Sie sah wie eines ihrer nordischen Mädel aus. Sie hat ihren eigenen Mann ausgeliefert. Und es gab andere. Sie nahmen sich die Sterne ab und zogen wie Raubvögel durch die Stadt.«
»Der Mann heute …«
»Der Schattenmann. Er suchte uns alle in unseren Alpträumen heim. Es ging das Gerücht, er würde einen Juden in einer Menschenmenge ausmachen, weil ihm auch nicht das zarteste Flackern in den Augen oder der leiseste Hauch von Nervosität entging. Vielleicht erkannte er einen sogar am Gang oder am Geruch. Wir hatten keine Ahnung. Wir wussten nur, wenn er kam, klopfte der Tod an die Tür. Man erzählte sich, er stünde dort in der Dunkelheit, wenn sie einen holten, und er sähe dabei zu, wenn sie seine Beute im frühen Morgengrauen auf die Güterzüge nach Auschwitz verfrachteten. Aber, wissen Sie, man konnte nicht sicher sein, denn niemand sah sein Gesicht und keiner kannte seinen Namen. Falls man sein Gesicht zu sehen bekam, so hieß es, dann brachten sie einen in den Keller des Gefängnisses Plötzensee; dort herrschte ewige Nacht, und niemand kam je wieder heraus. Und er war dort, um einen sterben zu sehen, und seine Augen waren das Letzte, was die Opfer in ihrer letzten Stunde sahen. Er war der Schlimmste, bei weitem, denn es hieß, er weidete sich an dem, was er tat, und daran, wie gekonnt er es tat …«
»Und heute …«
»Hier, hier in Miami Beach. Das kann nicht sein, Mr.Winter, das ist einfach unmöglich, aber ich glaube es trotzdem. Ich glaube wirklich, dass ich ihn heute gesehen habe.«
»Aber …«
»Nur für wenige Sekunden. Damals hatten sie eine Tür offen gelassen, als sie uns durch die Büroräume schleusten, um die Formalitäten zu erledigen. Formalitäten! Selbst beim Morden kamen die Deutschen nicht ohne diesen Papierkram aus! Also füllte der Büroangestellte der Gestapo die Formulare aus, und sie brachten uns in die Zellen, wo wir auf unseren Abtransport warten sollten. Rein zufällig sah ich für den Bruchteil einer Sekunde durch diese Tür, Mr.Winter, aber er stand da, zwischen zwei Offizieren in diesen schrecklichen schwarzen Uniformen. Sie lachten alle über einen Witz, und ich wusste, das war er. Er hatte den Hut aus der Stirn geschoben; er sah auf und rief etwas, und sie schlugen die Tür zu, und ich dachte, jetzt komme ich mit absoluter Sicherheit in den Keller, doch stattdessen verfrachteten sie mich noch am selben Tag auf einen Zug ins KZ. Wahrscheinlich ging er davon aus, dass ich dort sterben würde. Ich war noch so klein – zwar sechzehn, aber kaum größer als ein Kind –, und doch habe ich sie alle in Staunen versetzt, indem ich überlebte.«
Sie hielt inne und schnappte nach Luft.
»Ich wollte nicht sterben. Damals nicht. Heute nicht. Noch nicht.«
Sophie Millstein war selbst mit den Einlegesohlen, die sie in ihren orthopädischen Schuhen trug, eine kleine Frau, kaum einen Meter fünfzig, und ein wenig übergewichtig. Neben Simon Winter, der auch im Alter noch fast eins fünfundneunzig maß, wirkte sie wie ein Zwerg. Sie hatte ihr weißes Haar zu einem Dutt gebunden, um noch ein paar Zentimeter herauszuschinden, was normalerweise eher lächerlich wirkte, besonders wenn sie in dreiviertellangen, leuchtend bunten Polyesterhosen und geblümten Blusen aus ihrer Wohnungstür trat und auf dem Weg zum Supermarkt einen Einkaufsroller hinter sich herzog. Simon Winters Bekanntschaft mit ihr beschränkte sich im Wesentlichen auf kurze Begegnungen im Flur, bei denen er ihr höflich zunickte und ansonsten versuchte, einer längeren Unterhaltung aus dem Weg zu gehen, die sich unweigerlich um die eine oder andere Klage über die Stadt, über die Hitze, über Teenager und laute Musik, über ihren Sohn, der sich nicht oft genug meldete, über das Älterwerden, ihr Witwendasein oder um ähnliche Themen drehte, die er allesamt lieber mied. Er war seiner Nachbarin, mit der ihn wenig zu verbinden schien, bis zu diesem Tag mit distanzierter, förmlicher Höflichkeit begegnet. Doch die Angst in ihren Augen sprengte nun den Rahmen des gewohnten Umgangs und knüpfte zwischen ihnen eine neuartige Beziehung.
Der eingefleischte Kriminalist in ihm wusste nicht recht, was er glauben sollte; nur was er aus eigener Anschauung bestätigen konnte, hatte für ihn Gewicht.
Und das Einzige, um das er bis dahin aus eigener Anschauung wusste, war Sophie Millsteins Angst.
Während er sie musterte, bemerkte er, wie sie ein Schauder überlief. Sie sah mit einem fragenden Blick zu ihm auf.
»Fünfzig Jahre. Und ich habe ihn nur diesen einen Moment gesehen. Könnte ich mich vielleicht irren, Mr.Winter?«
Er hielt es für besser, diese Frage nicht zu beantworten, da die Möglichkeit, dass sie richtig lag, gegen null ging. Dieser Mensch – dieser Schattenmann – musste vor fünfzig Jahren jung gewesen sein, nicht älter als Anfang zwanzig. Und jetzt wäre er ein alter Mann. Sein Haar, seine Hautfarbe mussten sich verändert haben; seine Züge waren zweifellos erschlafft. Sein Gang war gewiss ganz anders. Selbst seine Stimme konnte nicht die gleiche sein. Nichts war noch wie damals.
»Hat der Mann heute etwas zu Ihnen gesagt?«
»Nein. Er hat mich nur angestarrt. Unsere Blicke trafen sich, es war spät am Nachmittag, und die Sonne hinter ihm blendete mich. Im nächsten Moment war er verschwunden, einfach so, als hätte ihn das gleißende Licht verschluckt – und ich bin gerannt, Mr.Winter, ich bin gerannt. Na ja, nicht so schnell wie damals, aber ich hatte dasselbe Gefühl, Mr.Winter, ich war so froh, als ich sah, dass bei Ihnen noch Licht brannte, weil ich solche Angst hatte, allein zu sein.«
»Er hat nichts gesagt?«
»Nein.«
»Hat er Sie bedroht oder irgendeine Geste gemacht?«
»Nein. Er hat mich nur angestarrt. Augen wie Rasierklingen, wie gesagt.«
»Und wie sah er aus?«
»Er war groß – wenn auch nicht so groß wie Sie, Mr.Winter, dafür kräftig gebaut, eher stämmig. Schultern und Arme wie ein junger Mann.«
Simon Winter nickte. Seine Skepsis nahm zu. Ein ehemaliger Kommissar des Morddezernats steckte den Rahmen des Möglichen schon ziemlich weit, doch nach fünfzig Jahren einen Mann wiederzuerkennen, den man nur für Sekunden gesehen hatte, gehörte in den Bereich der Fiktion. Seine Vermutungen gingen eher in diese Richtung: Sophie Millstein, die sich seit dem Tod ihres Mannes immer schwerer in der Welt zurechtfand, hatte an einem sehr heißen Tag sehr unter der prallen Sonne gelitten, und als sie in allzu schmerzlichen Erinnerungen versunken war, erregte jemand in der Menge ihre Aufmerksamkeit, den sie mit der Vergangenheit vermengte, und so war sie desorientiert und hatte Angst, weil sie alt und einsam war. Außerdem räumte er seufzend ein: Würde es mir so viel anders ergehen?
Doch stattdessen sagte er mit fester Stimme: »Ich glaube, Mrs.Millstein, dass Sie sich von dem Schock bald wieder erholen. Sie brauchen jetzt ein bisschen Ruhe …«
»Ich muss die anderen warnen«, entgegnete sie in gehetztem Ton. »Sie müssen es erfahren. Mr.Stein hatte also doch recht. Ach, Mr.Winter, wir hätten ihm glauben sollen, aber was will man machen? Wir sind alt. Wir wussten es nicht besser. Wen würden Sie anrufen? Wem würden Sie es sagen? Ich wünschte, Leo wäre noch da.«
»Welche anderen? Und wer ist Mr.Stein?«
»Er hat ihn auch gesehen, und jetzt ist er tot.«
Bei diesen Worten gerieten Simon Winters Zweifel augenblicklich ins Wanken. »Mrs.Millstein«, sagte er langsam und betont. »Ich verstehe nicht ganz. Können Sie mir das bitte erklären?«
Stattdessen sah sie ihn mit aufgerissenen Augen an. »Ist das da Ihre Waffe? Ist sie geladen?«
»Ja.«
»Gott sei Dank. Hatten Sie all die Jahre bei der Polizei dieselbe Waffe?«
»Ja.«
»Die sollten Sie immer in der Nähe haben, Mr.Winter. Mein Leo, der wollte sich auch immer eine Pistole zulegen, weil die Neger – in Wahrheit hat er ein anderes Wort benutzt, er hatte keine Vorurteile, aber er hatte Angst, und deshalb hat er das schreckliche Wort benutzt –, er meinte, die kommen gerne nach Miami Beach und rauben all die alten Juden aus, die hier leben. Sind wir wohl auch, einfach nur alte Juden, und wenn ich ein Verbrecher wäre, würde ich wahrscheinlich genauso denken. Aber ich war strikt dagegen, ich hatte zu große Angst, eine Waffe im Haus zu haben, Leo war nämlich kein umsichtiger Mensch. Er war ein guter Mensch, aber – wie soll ich sagen? Auch ein bisschen unbesonnen, und das ist nicht gut, wenn eine Pistole in der Nähe ist; ich hatte Angst, er könnte zu Schaden kommen, also habe ich ihn nicht gelassen, und jetzt bereue ich es, denn sonst hätte ich selbst eine und könnte mich schützen. Ich darf nicht länger warten, Mr.Winter. Ich werde die anderen anrufen und ihnen sagen, dass er da ist und dass wir uns überlegen müssen, was wir unternehmen wollen.«
»Mrs.Millstein, bitte beruhigen Sie sich. Wer ist Mr.Stein?«
»Ich muss anrufen.«
»Gleich, nur noch einen Moment.«
Sie antwortete nicht.
Sophie Millstein saß jetzt kerzengerade und starrte angespannt vor sich hin. Unvermutet fiel Simon Winter eine Schießerei wieder ein, in die er vor Jahren bei einem Banküberfall geraten war, ihnen waren die Kugeln um die Ohren geflogen. Dabei war der ganze Spuk in dreißig Sekunden vorbei gewesen. Nicht sein Schuss hatte den Räuber zur Strecke gebracht, doch er war als Erster bei ihm gewesen, hatte ihm die Pistole aus der ausgestreckten Hand getreten und gesehen, wie der Mann an sich hinunterschaute und mit aufgerissenen Augen erkannte, dass ihm das Leben aus einer Brustwunde quoll. Der Bankräuber war noch jung gewesen, Anfang zwanzig, und Simon Winter nicht viel älter. Er erinnerte sich, wie der Verwundete ihn angesehen und aus diesem Blick tausend verzweifelte Fragen gesprochen hatten, vor allem aber die eine: Werde ich überleben? Noch bevor Simon Winter antworten konnte, beobachtete er, wie die Augen des Mannes brachen und er starb. Diesen Moment der Fassungslosigkeit glaubte Simon Winter in Sophie Millsteins Gesicht zu erkennen, und er konnte nichts dagegen unternehmen, dass sich ein Teil ihrer Panik auf ihn übertrug.
»Er wird mich umbringen«, stellte sie in resigniertem, ausdruckslosem Ton fest. »Ich muss die anderen warnen.« Ihre Worte klangen so trocken wie bis zum Zerreißen gespanntes Leder.
»Mrs.Millstein, bitte, niemand wird Sie töten. Das lasse ich nicht zu.«
Sophie Millsteins Blick richtete sich unverwandt geradeaus, als sei Simon Winter nicht mehr im Raum. Nach einer Weile fing sie an zu zittern, als habe sie eine Erinnerung ins Mark getroffen. Langsam wandte sie sich dem alten Detective zu und nickte.
»Ich war so jung und hatte solche Angst. Und natürlich nicht nur ich. Es war eine so furchtbare Zeit. Immer im Untergrund und immer mit der Furcht, die nächsten Minuten nicht zu überleben. Es ist entsetzlich, Mr.Winter, wenn man jung ist und der Tod einen auf Schritt und Tritt verfolgt …«
Simon Winter nickte. In der Hoffnung, dass sie früher oder später von selbst wieder in die Gegenwart zurückfand, musste er sie reden lassen. »Bitte fahren Sie fort.«
»Vor einem Jahr«, erzählte Sophie Millstein bedächtig, »beging ein Mann namens Herman Stein, der in Surfside wohnte, Selbstmord.« Wieder klangen ihre Worte monoton. »Das zumindest erfuhren wir von der Polizei, denn er hatte sich mit einer Pistole erschossen …«
So wie um ein Haar ich, dachte Winter. »Und?«
»Nach seinem Tod, nachdem die Polizei da gewesen war, nachdem sie ihn ins Bestattungsinstitut gebracht und nachdem seine Angehörigen Schiwa gesessen hatten, da traf, kurz vor der Beerdigung, bei Rabbi Rubinstein ein Brief ein. Kennen Sie den Rabbi, Mr.Winter?«
»Nein.«
»Er ist alt, wie ich. Im Ruhestand. Und er bekam einen Brief von einem Toten, der ein paar Tage zuvor abgeschickt worden war. Und dieser Mr. Herman Stein, den ich nicht kannte … ich meine, wieso auch? Immerhin wohnte er in Surfside, also wie viele Häuserblocks von hier? Siebzig? Achtzig? Jedenfalls am anderen Ende der Welt. Diesem Rabbi also, den er nur flüchtig kennt, von dem er nur weiß, dass er auch aus Berlin stammt und – so unglaublich es ist – dass er das KZ überlebt hat, diesem Rabbi schreibt er einen Brief, und darin sagt Mr.Stein: Ich habe den Schattenmann gesehen. Und der Rabbi, der kennt den Namen natürlich, er findet mich und ein paar andere, Mrs.Kroner und Mr.Silver, auch ehemalige Berliner, mehr findet er nicht, schließlich werden wir immer älter, Mr.Winter, es sind nur noch so wenige von uns übrig, nachdem sowieso nur so wenige von uns überlebt haben … er bringt uns also zusammen, wir lesen den Brief, aber wer weiß schon, was wir machen sollen? Man kann ihn nicht der Polizei melden. Niemand kann uns helfen, und außerdem wissen wir ja selbst nicht, was wir von der Sache halten sollen. Wer kommt denn auf die Idee, dass er hier sein könnte, Mr.Winter? Ausgerechnet hier. Also gehen Monate ins Land. Ab und zu besuche ich den Rabbi, und wir sitzen alle zusammen und reden, allerdings nicht über diese Dinge, das vergessen die Leute lieber. Bis heute, weil ich ihn wie dieser arme Mr.Herman Stein aus Surfside, den ich nicht kannte und der jetzt tot ist, nun auch gesehen habe, und jetzt wird er mich auch umbringen.«
Sophie Millsteins Wangen waren tränennass und die letzten Worte nur noch gehaucht.
»Wo ist Leo?«, fragte die alte Frau. »Ich wünschte, Leo wäre da.«
»Dieser Mann, dieser Mr. Herman Stein, hat Selbstmord begangen?«
»Ja, das heißt, nein. Das sagt die Polizei, Mr.Winter. Aber jetzt, seit heute Abend, kann ich nicht mehr daran glauben.«
»Und die anderen, der Rabbi …«
»Die muss ich anrufen.«
Sophie Millstein sah sich plötzlich wild im Zimmer um.
»Mein Notizbuch. Mein Büchlein mit all meinen Nummern. Es ist in meiner Wohnung …«
»Ich komme mit. Es wird schon nichts passieren.«
Sophie Millstein nickte und trank den Rest von ihrem Eistee.
»Könnte ich mich irren, Mr.Winter? Sie waren bei der Polizei. Es sind fünfzig Jahre her, und ich hab ihn damals nur diesen winzigen Moment gesehen, bevor sie die Tür zuschlugen. Fünfzig Jahre, und die Menschen verändern sich so stark. Könnte ich mich irren?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Ich möchte mich täuschen. Ich bete, dass ich mich täusche.«
Er wusste nicht, was er sagen sollte, und so schwieg er. Er dachte: Wahrscheinlich irrt sie sich. Andererseits war die Geschichte, die sie erzählt hatte, ziemlich verstörend, und er wusste nicht, was er von Mr. Herman Steins Selbstmord halten sollte. Wieso sollte sich ein alter Mann das Leben nehmen, nachdem er einen Brief aufgegeben hat? Vielleicht hat er sich einfach nur alt und nutzlos gefühlt, so wie ich. Vielleicht war er verrückt. Vielleicht auch krank. Vielleicht einfach nur lebensmüde. Es gab hundert Gründe; wenn der Kummer zu groß wird, vergießt man mehr als eine Träne. Er konnte es nicht sagen, doch plötzlich wollte er es wissen. Winter hatte auf einmal ein Gefühl, das er schon lange nicht mehr für möglich gehalten hätte, weil es im Lauf des Ruhestands mit der Zeit einfach verschwunden war. Er spürte eine innere Erregung, das Erwachen eines alten Instinkts. Die Worte seiner Nachbarin und die Panik in ihren Augen setzten sich zu einer Gleichung zusammen, und wie ein Taschenrechner, in den man Faktoren eingab, musste er die Lösung finden.
»Mrs.Millstein, es geht nicht darum, ob Sie sich getäuscht haben oder nicht. Entscheidend ist, dass Sie in Angst und Schrecken versetzt worden sind und mit Ihren Freunden reden müssen. Danach sollten Sie eine Nacht darüber schlafen, und wenn wir morgen früh alle ausgeruht und gestärkt sind, gehen wir am besten der Sache auf den Grund.«
»Dann werden Sie mir helfen?«
»Selbstverständlich. Wozu hat man schließlich Nachbarn?«
Sophie Millstein nickte dankbar und berührte seine Hand. Er senkte den Blick, und zum ersten Mal in all den Jahren, die er sie kannte, bemerkte er die verblasste blaue Tätowierung an ihrem Unterarm. A1742. Die Sieben war die deutsche Variante, geschwungen und mit einem Querstrich.
Die Dunkelheit war mit Macht hereingebrochen.
Simon Winter und Sophie Millstein liefen über den nächtlichen Hof, in dessen Mitte die Statue eines halbnackten Posaunenengels prangte. Früher einmal hatte der Putto einen kleinen Springbrunnen geziert, der jedoch seit Jahren ausgetrocknet war. Die kleine Wohnanlage bestand aus zwei identischen hellbraunen Gipsputzgebäuden, die einander gegenüberlagen. Sie waren in den zwanziger Jahren erbaut worden, in denen Miami Beach eine Blütezeit erlebte, und so hatten sich einige Jugendstilelemente erhalten – ein Torbogen hier, gerundete Fenster dort, eine fast sinnliche Wölbung der Fassade –, die den Bauten einen nostalgischen, femininen Reiz verliehen, wie die Umarmung einer längst verflossenen Geliebten.
Das Alter und die erbarmungslose Sonne hatten den Wohnungen zugesetzt: Von den Wänden blätterte Farbe, die Klimaanlagen ratterten eher, als dass sie surrten, Türen knarrten und klemmten in den Pfosten und Rahmen, die sich aufgrund der tropischen Luftfeuchtigkeit verzogen hatten. Draußen an der Straße verkündete ein verblasstes Schild: THE SUNSHINE ARMS. Simon Winter hatte die seltsam kryptische Metapher stets gemocht und sich in der heruntergekommenen Umgebung heimisch gefühlt.
Sophie Millstein blieb vor der Eingangstür stehen.
»Gehen Sie vor?«, fragte sie.
Winter nahm ihr den Schlüssel aus der Hand und steckte ihn ins Riegelschloss.
»Wollen Sie nicht Ihre Waffe ziehen?«
Er schüttelte den Kopf. Sie hatte darauf bestanden, dass er sie mitnahm, doch er wäre sich ein wenig albern vorgekommen, hätte er damit herumgefuchtelt. Seine Berufserfahrung sagte ihm unmissverständlich, dass er sich von Sophie Millsteins Angst hatte anstecken lassen und selbst nervös war. Hatte er die Waffe erst in der Hand, erschoss er am Ende noch Mr. und Mrs.Kadosh oder den alten Harry Finkel, die Nachbarn im Stockwerk über ihr.
»Nein«, antwortete er, schloss auf und trat ein.
»Der Lichtschalter ist da an der Wand«, erklärte sie, was er wusste, da ihre Wohnung spiegelverkehrt genau denselben Grundriss hatte wie seine. Er streckte die Hand aus und schaltete die Lampen ein.
»Gott!«, schrie Simon Winter erschrocken auf.
Eine grauweiße Gestalt huschte ihm zwischen den Beinen hindurch nach draußen.
»Was zum Teufel …«
»Mr.Boots, du Frechdachs!«
Simon Winter drehte sich um und sah, wie Sophie Millstein eine große, dicke Katze ermahnte, die ihrerseits den Kopf am Bein der alten Dame rieb. »Tut mir leid, wenn er Sie erschreckt hat, Mr.Winter.«
Sie hob den Kater hoch. Er beäugte Winter mit irritierender katzenhafter Selbstgefälligkeit.
»Nein, schon gut«, erwiderte er, auch wenn ihm das Herz bis zum Halse schlug.
Sophie Millstein verharrte auf der Schwelle und streichelte das Tier im Arm, während Simon Winter ihre Wohnung inspizierte. Ein rascher Blick sagte ihm, dass – außer einem Sittich im Wohnzimmer, der irritierende schabende Geräusche in seinem Käfig machte – niemand da war. »Die Luft ist rein, Mrs.Millstein!«, rief er.
»Haben Sie im Wandschrank nachgesehen? Und unter dem Bett?«, antwortete sie aus der Diele.
Simon Winter seufzte und erklärte: »Mach ich noch.« Er trat in ihr kleines Schlafzimmer und schaute sich um. Es berührte ihn peinlich, den Raum zu betreten, den Sophie Millstein mit ihrem Mann geteilt hatte. Er sah, dass sie eine ordnungsliebende Frau war; ein cremeweißes Nachthemd und ein Morgenmantel lagen am Fuß des Bettes. Die Oberseite ihrer Kommode war sauber. Er entdeckte ein schwarzgerahmtes Bild von Leo Millstein und ein Familienfoto, auf dem ohne Zweifel Mrs.Millsteins Sohn und seine Familie zu sehen waren. Es handelte sich um eine Atelieraufnahme; alle trugen Schlips und Jackett beziehungsweise ihre besten Sonntagskleider. Außerdem fiel ihm ein Schmuckkästchen ins Auge, ein fein ziselierter Messingbehälter, auf den ein Kunsthandwerker einige Zeit verwendet haben musste. Ein Familienerbstück? Vermutlich.
Winter ging zum Schrank und öffnete die Tür, hinter der sich kein Eindringling verbarg, sondern nur Leos gesammelte dunkelbraunen und marineblauen Anzüge, die sich wie ein Ei dem anderen ähnelten, und daneben ein beachtlicher Vorrat an geblümten Kleidern. Außerdem hing ein seidig brauner Nerzmantel in der Ecke, für den sich in Miami Beach zweifellos selten Anlässe boten, der aber, vermutete er, einen hohen Erinnerungswert besaß.
Simon Winter drehte sich um und entschuldigte sich vor dem Bild von Leo Millstein. »Tut mir leid, wollte nicht aufdringlich sein, aber sie hat darum gebeten …« Zuletzt bückte er sich unter dem entschiedenen Protest eines arthritischen Knies und vergewisserte sich, dass niemand unter dem Bett lauerte. Ebenso stellte er fest, dass dort – anders als in seiner eigenen Wohnung – keine kleinen Staubballen lagen und auch keine uralten Zeitschriften gestapelt waren. Sophie Millstein hatte für ein Staubflöckchen oder einen Dreckfleck höchst wahrscheinlich dieselbe Verachtung übrig wie ein Feldwebel für einen ungepflegten Soldaten.
Wieder rief er: »Alles in Ordnung, Mrs.Millstein …«, und ging anschließend in die Küche. Direkt gegenüber dem Ausguss befand sich eine Glasschiebetür, die zu einem kleinen gefliesten Sitzplatz führte.
Diese Terrasse befand sich vielleicht zehn Meter von einem Zaun und einer schmalen Gasse entfernt, an der die Mülleimer aufgereiht standen. Er rüttelte an den Türen, um sich davon zu überzeugen, dass sie abgeschlossen waren, dann begab er sich ins Wohnzimmer.
Dort kam ihm Sophie Millstein, immer noch den Kater auf dem Arm, entgegen. Sie hatte wieder Farbe im Gesicht, und aus ihren Worten war die Erleichterung herauszuhören.
»Mr.Winter, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich das zu schätzen weiß.«
»Keine Ursache, Mrs.Millstein.«
»Ich sollte dann mal die anderen anrufen.«
»Ich denke, das wäre das Beste.«
Als er die alte Frau in ihrem eigenen Wohnzimmer, inmitten ihrer Habseligkeiten und Fotos, mit dem Kater und den Rüschenkissen auf dem Sofa, in ihrer vertrauten Umgebung vor sich sah, vermutete er, dass sich ihre Angst bald legen würde.
»Ich hab meine Telefonnummern immer hier zur Hand«, erklärte sie, während sie in einen großen Sessel sank. Auf einem Beistelltisch daneben befand sich ein gelbes Telefon. Sie öffnete die einzige Schublade des Möbels und zog ein billiges, in rotes Leder gebundenes Adressbuch heraus.
Augenblicklich fühlte er sich wieder als Eindringling.
»Soll ich besser gehen?«, fragte Simon Winter. »Während Sie Ihre Anrufe machen?«
Sie schüttelte den Kopf und wählte die erste Nummer. Nach kurzem Schweigen verzog sie das Gesicht. »Es ist der Anrufbeantworter des Rabbi«, flüsterte sie. Eine Sekunde später dann sagte sie mit lauter, fester Stimme: »Rabbi? Sophie hier. Bitte rufen Sie mich so bald wie möglich zurück.«
Diese Worte schienen ihr die Dringlichkeit der Lage wieder ins Bewusstsein zu rücken. Als sie auflegte, atmete sie schwer. Sie drehte sich um und sah zu Simon Winter hoch, der weiter unbehaglich neben ihr verharrte. »Wo steckt er nur? Es ist schon dunkel. Er müsste eigentlich zu Hause sein.«
»Vielleicht ist er auf einen Happen rausgegangen.«
»Ja, das muss es wohl sein.«
»Oder ins Kino.«
»Möglich. Oder zu einem Treffen in der Synagoge. Er nimmt immer noch manchmal an den Spendenaktionen teil.«
»Sehen Sie!«
All diese harmlosen Erklärungsmöglichkeiten schienen ihr die Sorge nicht nehmen zu können.
»Wollen Sie jetzt noch die anderen anrufen?«, erkundigte sich Simon Winter.
»Ich muss warten«, antwortete Sophie Millstein nervös. »Wir haben Dienstag, da geht Mr. Silver immer mit Mrs. Kroner zum Bridge-Club drüben im Seniorenzentrum. Das tut er schon, seit wir uns regelmäßig mit dem Rabbi treffen.«
»Vielleicht wollen Sie noch jemanden anrufen?«
»Wen denn?«
»Ihren Sohn? Vielleicht würden Sie sich ein bisschen besser fühlen, nachdem Sie mit ihm geredet haben.«
»Das ist sehr aufmerksam von Ihnen, Mr.Winter, ich werde Ihren Rat gleich befolgen.«
»Haben Sie was zum Schlafen im Haus? Sie hatten einen bösen Schock, und vielleicht haben Sie Schwierigkeiten …«
»O ja, ich habe diese kleinen Pillen, keine Sorge.«
»Und wie steht’s mit Lebensmitteln? Sind Sie gut versorgt?«
»Mr.Winter, Sie sind zu liebenswürdig. Ja. Ich habe alles, was ich brauche. Hier bei mir daheim fühle ich mich schon viel besser.«
»Das hatte ich gehofft.«
»Und morgen werden Sie mir helfen? Und den anderen? Der ganzen Sache …«
»… auf den Grund zu gehen. Selbstverständlich.«
»Was haben Sie vor?«
Gute Frage, auf die er keine klare Antwort wusste. »Na ja, Mrs. Millstein, als Erstes sollte ich mal die Umstände von Mr. Steins Tod unter die Lupe nehmen. Gleichzeitig können wir alle zusammen überlegen, was Sie unternehmen möchten. Vielleicht kann ich mich mit Ihren Freunden zusammensetzen, und wir entwerfen einen Schlachtplan.«
Diese Aussicht schien Mrs.Millstein aufzumuntern. Sie nickte nachdrücklich.
»Leo«, erzählte sie, »Leo war wie Sie. Er traf Entscheidungen. Sicher, er war Herrenausstatter, kein Detective wie Sie, wie sollte er demnach wissen, wie dieses Rätsel zu lösen ist, nicht wahr, Mr.Winter?«
»Dann gehe ich jetzt mal. Schließen Sie hinter mir gut ab. Und falls Sie immer noch Angst haben, zögern Sie nicht, mich anzurufen. Aber ich denke, dass Ihnen ausreichend Schlaf am besten tut, und morgen früh fangen wir mit klarem Kopf an.«
»Mr.Winter, Sie sind ein vollendeter Gentleman. Sobald Sie gegangen sind, nehme ich eine Tablette.«
Sie stand auf und begleitete ihn zur Tür. Er sah, wie der Kater auf ihren Sessel sprang und sich an der Stelle einrollte, an der er ihre Körperwärme spürte.
»Schließen Sie ab«, erinnerte er sie.
»Ich könnte mich getäuscht haben«, sagte sie zögerlich. »Es wäre immerhin möglich. Es könnte doch wirklich ein Irrtum sein, oder?«
»Alles ist möglich, Mrs.Millstein. Hauptsache, wir finden es heraus.«
»Dann bis morgen«, erwiderte sie und nickte dankbar.
Er trat in den Flur und drehte sich noch einmal kurz zu seiner Nachbarin um, die mit einem schwachen Lächeln die Tür hinter ihm zuschob. Er wartete, bis er das Riegelschloss mit einem lauten Klicken einschnappen hörte.
Simon Winter trat in den Hof des Sunshine Arms und ließ die stickige Luft in seine Poren dringen. Eine Straßenlaterne hinter dem Gebäudeeingang warf einen schwachen Lichtstrahl auf den Engel, so dass er glitzerte, als wäre er nass. Die Dunkelheit, die ihn umgab, erinnerte Winter an starken, schwarzen Kaffee. Ihm kam ein seltsamer, schrulliger Gedanke: Also, wenn du dich schon nicht umbringst, kannst du dir genauso gut was zu essen besorgen. Wenn du dir schon nicht die Kugel gibst, gönn dir wenigstens ein Hühnchen.
Da er seine eigene Gesellschaft nicht allzu unterhaltsam fand, beschloss er, im Restaurant zu essen, und ging im Kopf die Möglichkeiten durch. Er machte einen Schritt, dann einen zweiten, dann blieb er stehen. Er drehte sich um und warf einen letzten Blick auf Sophie Millsteins Apartment. Die Gardinen waren zugezogen. Aus einer anderen Wohnung dröhnte der Fernseher, und ein Stück die Straße hinunter mischte sich Gelächter in den Lärm. Einige Häuserblocks entfernt heulte ein Motorrad auf – alles in bester Ordnung. Nicht perfekt, aber vertraut. Es ist eine Nacht wie jede andere. Es ist heiß. Es weht eine Brise, die keine Kühlung bringt. Am Tropenhimmel funkeln die Sterne.
Er bestand darauf, abgesehen von den traumatischen Erinnerungen einer alten Frau sei an diesem Abend alles ganz normal. Und die haben wir schließlich mehr oder weniger alle, fügte er hinzu. Er versuchte, sich mit der Alltäglichkeit seiner Umgebung zu beschwichtigen, was ihm jedoch nur teilweise gelang. Er ertappte sich dabei, wie er in schattige Winkel spähte, nach Gestalten Ausschau hielt, auf verräterische Geräusche achtete und sich plötzlich wie jemand benahm, der sich verfolgt fühlte. Er schüttelte den Kopf, um die Beklemmung loszuwerden, warf sich vor, mit zunehmendem Alter schreckhaft zu werden, und schritt entschlossen an dem Engel im trockenen Brunnen vorbei. Er hatte auf einmal ein unbändiges Verlangen zu laufen und die Furcht seiner Nachbarin weit hinter sich zu lassen.
Er lief zügig voran und fragte sich nur einen Augenblick lang, ob der Tod, wenn er kam, wie die Nacht war.
2
Schlaf
Sophie Millstein spähte durch einen Gardinenspalt hinaus und blickte Simon Winter in der Dunkelheit des Hofs hinterher. Dann drehte sie sich um und sackte auf ihren Sessel. Fast im selben Moment sprang der grau-weiß gefleckte Kater auf ihren Schoß.
»Mr.Boots, hast du mich vermisst?«
Während das Tier sich einrollte, kraulte sie das weiche Fell in seinem Nacken.
»Mach’s dir nicht allzu bequem«, warnte sie. »Ich hab noch einiges zu erledigen.«
Der Kater überhörte das nach Katzenart und fing an zu schnurren.
Sophie Millstein legte dem Tier die Hand aufs Fell und fühlte sich mit einem Mal erschöpft. Sie sagte sich, es sei nichts dabei, wenn sie nur einen Moment die Augen schloss, doch als sie es tat, merkte sie, wie sie sich in einem nervösen Gedankenwirrwarr verlor, als ob ihre geschlossenen Lider nur die Ängste stauten, statt sie zu beruhigen. Sie legte die Hand an die Stirn und fragte sich, ob sie vielleicht einen Infekt ausbrütete. Sie hatte das Gefühl zu fiebern und räusperte sich mehrmals kräftig, um zu sehen, ob sie verschleimt war.
Sie holte tief Luft.
»Du hast immer ein einfaches Leben gehabt, Mr. Boots«, wandte sie sich an den Kater. »Es war immer für dich gesorgt. Du hattest ein warmes, trockenes Zuhause. Reichlich zu fressen. Unterhaltung. Zuneigung. Alles, was ein Katzenherz begehrt.«
Mit einer abrupten Bewegung legte sie die Hand unter das Tier und schob es vom Schoß. Sie zwang sich, aufzustehen.
Sie betrachtete den Kater, der ihr trotz seiner unerwarteten Vertreibung um die Beine strich.
»Ich hab dich gerettet«, sagte sie bitter und war von der aufwallenden Wut selbst überrascht. »Dieser Mann hatte dich und den übrigen Wurf in einen Beutel gestopft, um euch ins Wasser zu werfen. Niemand wollte kleine Kätzchen. Es gab einfach zu viele, alle Welt hasste Katzenjunge, und keiner mochte sie haben, also wollte er euch alle töten, doch ich habe ihn daran gehindert und dich aus der Tüte geholt. Ich hätte eins der anderen nehmen können. Ich hatte schon die Hand um eins gelegt, doch es hat mich gekratzt, ich habe losgelassen und dich gepackt. Also hast du ein angenehmes Leben gehabt, während alle anderen in dem Beutel blieben und der Beutel ins Wasser geworfen wurde, so dass sie alle ertranken.«
Sie schob Mr.Boots mit dem Fuß weg.
»Glück gehabt, Kater«, flüsterte sie zischelnd. »Du bist ein richtiger Glückspilz.«
Sophie Millstein ging in die Küche und machte sich daran, aufzuräumen. Sie richtete jede Dose auf den Regalen mit dem Etikett nach vorne aus, ordnete sie nach Größe und nach Sorte, so dass die Oliven nicht neben der Tomatensuppe standen. Nachdem das erledigt war, unterzog sie die verderblichen Lebensmittel im Kühlschrank einer ähnlichen Prozedur und stapelte sie in Reih und Glied. Als Letztes inspizierte sie ein Flunderfilet, das sie sich eigentlich zum Abendessen hatte grillen wollen, doch der Hunger war ihr vergangen. Einen Moment lang zögerte sie, weil der Fisch sich vielleicht nicht bis zum nächsten Tag halten würde. Sie beschloss, ihn am Morgen zuzubereiten und mittags zu essen.
Der Kater war ihr miauend gefolgt. Das Geräusch irritierte sie.
»Schon gut. Schon unterwegs.«
Sie machte eine Dose Katzenfutter auf. Der Dosenöffner bereitete ihr Mühe, und ihre Hand fühlte sich wund an. Morgen früh sollte sie zum Eisenwarenhändler gehen und einen elektrischen kaufen. Sie setzte dem Kater den vollen Napf vor und sah ihm beim Fressen zu.
Im Schlafzimmer starrte sie auf das Bild ihres verstorbenen Mannes.
»Du müsstest bei mir sein«, erklärte sie vorwurfsvoll. »Du hattest kein Recht, mich allein zu lassen.«
Sophie Millstein marschierte in das kleine Wohnzimmer zurück und nahm erneut auf ihrem Sessel Platz. Mit einem Mal fühlte sie sich, als wäre sie auf der Straße und es ginge ein Unwetter hernieder, als brächen die Böen wie meterhohe Wellen in die feuchte Stille und schlügen von allen Seiten über ihr zusammen.
»Ich bin müde«, sagte sie laut. »Ich sollte eine Tablette nehmen und mich schlafen legen.«
Doch stattdessen stand sie auf, stapfte in die Küche, griff nach dem Telefon und wählte die Nummer ihres Sohnes auf Long Island. Sie ließ es einmal klingeln, doch als ihr augenblicklich klar wurde, dass sie mit ihrem einzigen Kind nicht reden wollte, legte sie gleich wieder auf. Er wird nur wieder darauf herumreiten, dass ich in eins von diesen Altenheimen ziehen soll, wo ich keine Menschenseele kenne, sagte sie sich. Das hier ist mein Zuhause.
Sophie Millstein ging zum Wasserhahn, goss sich ein Glas ein und nahm einen großen Schluck. Es schmeckte brackig, metallisch. Sie verzog das Gesicht. »Miami Beach spezial«, murmelte sie. Sie wünschte sich, sie hätte daran gedacht, im Supermarkt Wasser in Flaschen zu kaufen. Sie schüttete einen Teil in den Ausguss zurück, nahm den Rest mit und füllte den Behälter im Vogelkäfig auf. Der Sittich zwitscherte ein, zwei Mal. Einen Augenblick lang wunderte sie sich, weshalb sie dem Vogel nie einen Namen gegeben hatte, so wie ihrem Kater. Sie überlegte, ob das irgendwie unfair war, bezweifelte es aber und kehrte in die Küche zurück, um ihr Glas abzuspülen und zum Trocknen auf die Ablage zu stellen. Oberhalb des Spülsteins befand sich ein kleines Fenster, und sie blickte in die Nacht.
Sie redete sich gut zu, dass sie mit jedem Gegenstand, mit jedem Schatten, den sie dort sehen konnte, vertraut sei; alles war genauso wie die Nächte davor, und alles war genau dort, wo es hingehörte, und das seit zehn Jahren. Dennoch suchte sie wie ein Wachsoldat jeden dunklen Winkel im Garten ab, um zu sehen, ob sich irgendwo etwas bewegte.
Sie drehte den Wasserhahn zu und horchte.
Es gab ein paar ferne Verkehrsgeräusche. Oben schlurfte Finkel durch die Wohnung. Ein Fernseher lief zu laut; das waren vermutlich die Kadoshs, dachte sie, sie sind zu eigensinnig, um ihre Hörgeräte einzuschalten.
Sie schaute weiter aus dem Fenster. Ihre Augen glitten über jeden Lichtstrahl, jeden dunklen Fleck. Sie staunte, wie viele Stellen es gab, an denen sich jemand verstecken konnte, ohne gesehen zu werden: die Ecke, an der der Orangenbaum neben dem alten Maschendrahtzaun stand; die Schatten, welche die Mülltonnen warfen.
Nein, sagte sie sich, es ist alles so wie immer.
Nichts ist anders als sonst.
Nichts fällt aus dem gewohnten Rahmen.
Sie holte tief Luft und kehrte ins Wohnzimmer zurück. Fernsehen, sagte sie sich. Sie schaltete ihren Apparat ein und sank in einen Sessel. Es lief eine Sitcom; ein paar Minuten lang versuchte sie, den Witzen zu folgen, zwang sich, in das Gelächter aus der Konserve einzustimmen. Sie ließ den Kopf in die Hände sinken, und während die Sendung weiterlief, zitterte sie, als ob sie fröre, doch sie wusste, das war nicht der Grund.
Er ist tot, hämmerte sie sich ein. Er ist nicht hier.
Einen Moment lang kamen ihr sogar Zweifel, ob er überhaupt je existiert hatte: Wer war das, den ich damals gesehen habe? Es konnte irgendein Fremder gewesen sein, besonders mit diesem Hut und dem dunklen Mantel. Und nachdem er gebrüllt hatte, haben sie damals die Tür so schnell zugemacht, ich konnte ihn ja kaum sehen.
Doch sie wusste, das stimmte nicht. Er war es.
Sie spürte, wie in ihr die blanke Wut hochstieg. Von jeher war er es. Tag für Tag, Stunde um Stunde. Er war selbst dann da gewesen, wenn sie sich relativ sicher gefühlt hatten – ein Trugschluss, wie sie jetzt wusste. Er hatte sich wie ein besonders geduldiger, kaltblütiger Jäger angeschlichen und auf den rechten Moment gewartet. Dann hatte er ihnen zuerst ihr Geld genommen, dann ihre Freiheit und damit ihr Leben.
Sophie Millstein fühlte, wie in ihr der Hass aufstieg.
»Ich hätte ihn damals töten sollen«, stellte sie laut fest, »hätte ich doch nur gewusst …«
Sie brachte den Satz nicht zu Ende, denn sie erkannte, es hatte damals keine Chance gegeben. Sie sagte sich: Du warst doch noch ein Kind – was wusstest du denn vom Töten?
Die bittere Antwort lag auf der Hand: damals noch nicht viel. Aber du hast es früh genug erfahren, nicht wahr?
Im Fernseher lief ein Werbespot für Bier, und eine Weile lang betrachtete sie die muskulösen jungen Männer und attraktiven jungen Frauen, die sich um einen Swimmingpool tummelten. So sieht in Wahrheit niemand aus, dachte sie. Als sie im selben Alter wie diese Models gewesen war, wurde ihr bewusst, wog sie unter siebzig Pfund und sah eher tot als lebendig aus.
Doch ich bin nicht gestorben, dachte sie trotzig.
Er muss geglaubt haben, wir würden alle sterben, aber ich habe überlebt.
Wieder stützte sie den Kopf in die Hände.
Wieso ist er eigentlich nicht gestorben?, fragte sie sich.
Wie hatte er den Krieg überleben können?
Wer hätte denn ihn gerettet? Jedenfalls nicht die Deutschen, für die er gearbeitet hat. Als er nicht mehr nützlich war, lag es für sie nahe, ihn wie alle anderen nach Auschwitz zu schicken. Auch nicht die Alliierten oder die Russen, die ihn als Kriegsverbrecher verfolgt hätten. Und gewiss nicht die Juden, die er so eifrig auf den Weg in den sicheren Tod geschickt hatte. Wie hatte er also überleben können?
Bei diesen unlösbaren Fragen, die sie bestürmten, schüttelte sie den Kopf.
Er musste, wie all die anderen auch, gestorben sein. Etwas anderes war undenkbar.
Sie sagte sich den Satz immer wieder. Er muss gestorben sein. Er muss gestorben sein. Dann verkürzte sie ihn im Geist und dachte nur noch: Er ist tot. Er ist tot. Er kann nicht am Leben sein. Nicht hier. Nicht in Miami Beach. Nicht inmitten der wenigen Überlebenden.
Einen Augenblick lang hatte sie das Gefühl, ihr würde schlecht.
Sophie Millstein, der die Furcht wie ein monströses Geschöpf im Leib rumorte, stand auf. Die Figuren der Fernsehkomödie lachten alle, und die Zuschauer lachten über sie.
»Leo«, sagte sie laut. Sie ging zum Telefon und wählte hastig die Nummer des Rabbi. Als sie die Ansage des Anrufbeantworters hörte, legte sie auf. Sie sah auf die Armbanduhr und dachte: Noch zu früh für Mr. Silver und Frieda Kroner. Die sind nicht vor Mitternacht zurück. Ihr Finger schwebte über der Tastatur, dann tippte sie Simon Winters Nummer ein. Sie rechnete damit, dass er sofort abnehmen würde, und versuchte, sich zurechtzulegen, was sie sagen sollte, außer dass sie immer noch Angst hätte, doch der einzige Gedanke, den sie fassen konnte, war Simon Winters Revolver, der sie beschützen würde.
Das Telefon klingelte weiter, ohne dass sich jemand meldete. Nach einer Weile schaltete sich das Band ein: »Dies ist der Anschluss von Simon Winter. Nach dem Signalton können Sie eine Nachricht hinterlassen.«
Sie wartete, und sagte nach dem elektronischen Signal:
»Mr.Winter? Sophie Millstein. Ich wollte nur … ach, ich wollte Ihnen nur noch einmal danken. Alles Weitere dann morgen früh.«
Ein wenig erleichtert legte sie auf. Er hat bestimmt ein paar gute Ratschläge, dachte sie. Er ist ein sehr netter Mann, mit einem kühlen Kopf und einer Menge Grips. Vielleicht nicht so viel wie Leo, aber er wird wissen, was zu tun ist.
Sie fragte sich, wo er stecken mochte. Wahrscheinlich war er nur noch ausgegangen, um irgendwo eine Kleinigkeit zu essen. Er wird bald zurück sein. Genau wie Rabbi Rubinstein ist er einfach nur noch mal ausgegangen. Alles ist heute Abend ganz normal. Genau wie an jedem anderen Abend.
Plötzlich musste sie denken: Mr. Herman Stein, wer waren Sie? Wieso haben Sie diesen Brief geschrieben? Wen haben Sie gesehen?
Sie holte tief Luft, doch in einer Woge der Panik kam ihr die unabweisliche Erkenntnis: Ich bin ganz allein.
Im nächsten Moment hielt sie dagegen und schärfte sich ein, dass sie irrte. Schließlich waren die Kadoshs und der alte Finkel über ihr und bald käme sicher auch Simon Winter vom Essen zurück; sie wäre von ihnen allen umgeben, und alles wäre gut.
Sie nickte still, um sich von der Richtigkeit der Feststellung zu überzeugen. Sie trat einen Schritt näher an den Fernseher heran. Nach der Comedy lief nunmehr ein düstereres Drama.
Wer könnte das sonst gewesen sein?, fragte sie sich plötzlich.
Wieder schnappte sie nach Luft. Der Gedanke versetzte ihr einen Stich, und sie versuchte rasch, die dunklen Ahnungen und Ängste mit fadenscheinigen Argumenten zu betäuben.
Ach was, es kann ein Wildfremder gewesen sein. Ein x-beliebiger alter Mann in Miami Beach – immerhin wimmelt es hier nur so von alten Leuten. Und die sehen auch noch alle gleich aus. Vielleicht hat er dich auch mit jemandem verwechselt, den er kannte, und hat dich deshalb so angestarrt und sich noch einmal aufmerksam umgesehen. Und als er merkte, dass er sich getäuscht hatte, na ja, um einer peinlichen Situation aus dem Weg zu gehen, hat er sich weggeschlichen. So was passiert ständig. Im Laufe seines Lebens begegnete man immerhin Hunderten von Leuten, also ist es nur natürlich, dass man ab und zu für jemand anderen gehalten wird.
Doch sie hatte nicht das Gefühl, dass der Mann sie für jemand anderen gehalten hatte.