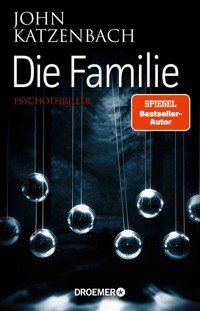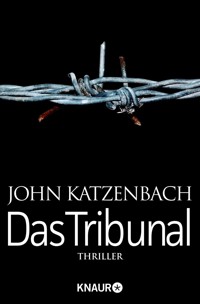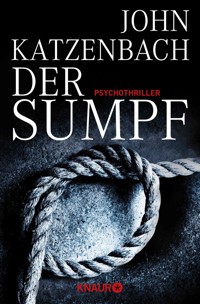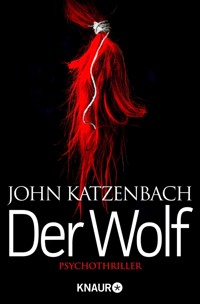9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
DER FLUCH DIE VERGANGENHEIT DIE RACHE Megan und Duncan Richards haben Karriere gemacht und sich in ihrem bürgerlichen Wohlstand bequem eingerichtet – aber das war nicht immer so: Als naive Weltverbesserer hatten sie sich in ihrer Studentenzeit einer radikalen Gruppe angeschlossen und bei dem Überfall auf einen Geldtransporter mitgemacht. Doch nur Olivia Barrow, die Rädelsführerin, war dafür ins Gefängnis gewandert. Nun wird sie aus der Haft entlassen und hat sich geschworen, an den Verrätern von damals erbarmungslos Rache zu nehmen ... Die Rache von John S. M. Katzenbach: Spannung pur im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
John Katzenbach
Die Rache
Aus dem Amerikanischen von Anke und Eberhard Kreutzer
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Megan und Duncan Richards haben Karriere gemacht und sich in ihrem bürgerlichen Wohlstand bequem eingerichtet, aber das war nicht immer so: Als naive Weltverbesserer hatten sie sich in ihrer Studentenzeit einer radikalen Gruppe angeschlossen und bei dem Überfall auf einen Geldtransporter mitgemacht. Doch nur Olivia Barrow, die Rädelsführerin, war dafür ins Gefängnis gewandert. Nun wird sie aus der Haft entlassen und hat sich geschworen, an den Verrätern von damals erbarmungslos Rache zu nehmen ...
Inhaltsübersicht
Widmung
Eins
Dienstagnachmittag – 1986
Eins: Megan
Zwei: Die beiden Tommys
Drei: Duncan
Vier: Megan
Zwei
Lodi, KalifornienSeptember 1968
Drei
Dienstagabend – 1986
Vier
Mittwochmorgen:Karen und Lauren
Fünf
Mittwochmittag
Sechs
MittwochnachmittagMittwochnacht
Sieben
Donnerstag
Acht
Freitag
Neun
Samstag
Zehn
Sonntag
Elf
Sonntagabend
Zwölf
Die Hintertür
Für die beiden Nicks
Eins
Dienstagnachmittag – 1986
Eins: Megan
Sie war, fand sie, ein Glückspilz. Noch vor wenigen Wochen schien klar, dass sie den Wrights nicht helfen konnte und die Bostoner Börsenmakler all ihr schönes Geld nach Hamden oder Duchess County tragen würden, um dort mit Hilfe eines anderen Maklers nach ihrer Bauernhofidylle zu suchen. Doch als sie sich ein letztes Mal das Hirn zermarterte, war ihr das alte Haus der Hallidays an der North Road eingefallen. Seit Jahren, genauer gesagt seit dem Tod der steinalten Mrs. Halliday, war es unbewohnt, und die Erbengemeinschaft – Nichten und Neffen, die in Los Angeles und Tucson lebten – hatte ihre Firma mit dem Verkauf beauftragt. Sämtliche Makler von Country Estates Realty hatten die obligatorische Pilgerfahrt über die ausgedehnten Landstraßen unternommen, um das Angebot zu inspizieren und ihre Kommentare über das undichte Dach, die maroden Rohrleitungen und die feuchten Wände abzugeben. Sie alle kamen zu dem Schluss, dass das Haus – besonders an einem Ort, der einen wahren Bauboom erlebte – nie einen Käufer finden würde. So war es auf ihrer Liste immer weiter nach hinten gerutscht und schließlich wie ein Brachfeld, das die Natur langsam, aber sicher zurückerobert, in Vergessenheit geraten.
Sie war mit den Wrights die halbe Meile durch den Wald auf einer kaum befestigten Straße bis vor die Haustür geholpert. Das letzte Herbstlicht fiel mit einer besonderen Klarheit durch die schattigen Bäume und verlieh jedem verwelkten Blatt mit seinen gezackten, eingerollten Rändern scharfe Konturen. Die große Masse der regenschwarzen Bäume fing die Sonne ein, die im Unterholz auf und ab zu hüpfen schien. »Sie sind sich natürlich im Klaren, dass Sie umfangreiche Renovierungsarbeiten vornehmen müssen …«, hatte sie gesagt, doch zu ihrer unendlichen Freude hatte das Ehepaar sie ignoriert und nur den letzten goldenen Herbst statt des nahen Winters gesehen. Kaum waren sie da, schmiedeten die beiden Pläne: »Da kommt ein Gewächshaus hin und an die Rückseite eine Veranda. Das Wohnzimmer ist kein Problem, bestimmt kann diese Zwischenwand raus …«
Als sie später bei ihr im Büro das Angebotsformular unterzeichneten, hatten sie immer noch lebhaft ihre Umbaupläne diskutiert. Megan hatte sich daran beteiligt und ihnen Architekten, Baufirmen und Dekorateure genannt, während sie ihren Scheck entgegennahm. Sie hatte nicht daran gezweifelt, dass die Verkäufer das Angebot akzeptieren und die Wrights das Haus in ein Schmuckstück verwandeln würden. Sie verfügten über das nötige Kleingeld wie auch über Zeit und Phantasie.
Heute Morgen hatte sich Megans Zuversicht in Form eines unterzeichneten Kaufvertrags, der auf ihrem Schreibtisch landete, bestätigt.
»Also«, sagte sie laut zu sich selbst, als sie in ihre Einfahrt schwenkte. »Nicht schlecht, meine Liebe.«
Wie gewöhnlich hatten die Zwillinge ihren roten Sportwagen so geparkt, dass er teilweise den Weg zum Haus versperrte. Kaum waren sie aus der Highschool zurück, hingen sie wahrscheinlich schon am Telefon – Lauren an einem, Karen nebenan am zweiten, allerdings mit dem Stuhl in der offenen Tür, so dass sie sich, während sie endlos in ihrem Jargon plapperten, gegenseitig sehen konnten. Als Zugeständnis an die Teenagerbedürfnisse hatte jede jetzt eine eigene Leitung – ein bescheidener Preis dafür, nicht mehr alle fünf Minuten ans Telefon springen zu müssen.
Sie schmunzelte und sah auf die Uhr. Duncan würde erst in einer Stunde von der Bank zurückkommen. Falls er keine Überstunden machen musste. Sie nahm sich vor, mit ihm darüber zu reden, dass diese Zeit vor allem Tommy abging. Die Mädchen lebten in ihrer eigenen Welt, und solange kein Alkohol, Drogen und die falsche Art von Jungen im Spiel waren, war das gut so. Falls sie mit ihm reden wollten, wussten sie, wo sie ihn fanden. Sie musste an das besondere Verhältnis zwischen Vätern und Töchtern denken. Sie hatte es vor Augen gehabt, als die Zwillinge klein waren und Duncan sich mit ihnen auf dem Boden wälzte, sie kitzelte und pikste; sie kannte es auch von ihrem eigenen Vater. Bei Söhnen und ihren Vätern war das anders. Dort herrschten ein lebenslanger Wettbewerb, ein Kräftemessen, das Erobern neuer Terrains, die Rückzugsgefechte – der ganz normale Lebenskampf. So zumindest sollte es sein.
Ihr Blick fiel auf Tommys rotes Fahrrad, das er achtlos in die Büsche geworfen hatte.
Nicht bei meinem Sohn. Allein von dem Gedanken wurden ihr die Wangen heiß. Es schnürte ihr die Kehle zu. Bei ihm war nichts ganz normal.
Wie immer merkte sie auch diesmal, wie es ihr in den Augen brannte, bevor sie sich in gespielt strengem Ton innerlich zur Ordnung rief: Megan, du hast sämtliche Tränen geweint, die du hattest. Und außerdem wird alles schon besser mit ihm. Viel besser sogar. Nahezu normal.
Plötzlich sah sie das Kind an ihrer Brust. Schon im Kreißsaal hatte sie gewusst, dass ihr Sohn nicht wie die Zwillinge sein würde, die mit ihren regelmäßigen Essens- und Schlafenszeiten, Schule und Pubertät problemlos in jedes Schema passten, in einen klugen, nachvollziehbaren Plan. Sie hatte seine winzige, strampelnde Gestalt betrachtet, die in einer Mischung aus Instinkt und Staunen versuchte, ihre Brustwarze zu finden, und gewusst, dass er ihr hundertmal das Herz brechen, dann einmal kurz Luft holen und von vorn anfangen würde.
Sie stieg aus und stapfte zur feuchten Hecke, zog das Fahrrad heraus und unterdrückte ein Schimpfwort, das ihr auf der Zunge lag, als Regenwasser auf ihren Rock spritzte. Sie hielt das Lenkrad vorsichtig und versuchte, den Ständer herunterzuklappen, ohne sich die Schuhspitzen aufzuschaben. Sie ließ das Rad auf dem Gehweg stehen.
Und so habe ich ihn, dachte sie, einfach umso mehr geliebt.
Sie lächelte. Ich habe immer gewusst, dass es keine bessere Therapie gibt. Ihn einfach nur noch mehr lieben.
Sie starrte auf das Rad. Und ich hatte recht.
Die Ärzte hatten ihre Diagnose ein paar Dutzend Male revidiert, von geistiger Behinderung zu Autismus zu Kindheitsschizophrenie zu Lernschwäche zu – mal sehen, was als Nächstes kam.
Irgendwie war sie stolz darauf, dass er in kein medizinisches Schubfach passte, dass sich jede Expertenmeinung bisher als falsch, verzerrt oder ungenau erwiesen hatte. Es war, als hätte er einfach gesagt, »Rutscht mir alle den Buckel runter«, und wäre auf eigene Faust ins Leben losgelaufen, indem er den einen mitzog und den anderen bremste, um grundsätzlich nicht selbst aus dem Tritt zu kommen.
So hart das auch sein mochte, war sie trotzdem stolz darauf.
Sie drehte sich um und betrachtete ihr Heim. Es war ein Haus im Kolonialstil, wenn auch neu, im besten Viertel von Greenfield, etwa fünfunddreißig Meter von der Straße zurückgesetzt. Es war weder das größte noch das kleinste Haus in der Straße. Mitten auf dem Rasen stand eine mächtige Eiche, und sie erinnerte sich, wie die Zwillinge vor ungefähr fünf, sechs Jahren einen Autoreifen daran aufgehängt hatten, teils, um selbst zu schaukeln, vor allem aber auch, um die Nachbarskinder und ihre Spielkameraden anzulocken. Sie waren immer einen Schritt voraus. Der Reifen hing jetzt reglos in der Abenddämmerung. Wieder dachte sie an Tommy, der dort Stunde um Stunde endlos geschaukelt hatte: Ohne die anderen Kinder oder auch Wind und Regen, Schnee oder sonst irgendetwas zu registrieren, hatte er die Füße in die Luft geschwungen und mit weit geöffneten, wilden Augen in den Himmel gestarrt.
Solche Dinge machen mir keine Angst mehr, dachte sie. Und sie weinte auch nicht mehr über sein exzentrisches Verhalten. Wie damals, als er sich zwei Stunden lang die Zähne putzte. Oder drei Tage lang nichts aß. Als er ein andermal eine Woche lang kein Wort sprach, und dann wieder nicht schlafen konnte, weil er zu viel mitzuteilen hatte, aber nicht über das Vokabular verfügte, um sich auszudrücken. Sie sah auf die Armbanduhr. Er würde bald nach Hause kommen, und sie würde ihm Gerstensuppe mit Fleischklößchen und frische Pizza machen, sein Lieblingsessen. Sie konnten den Verkauf des Halliday-Hauses auch mit Pfirsicheiscreme feiern. Während sie ihr Menü plante, überschlug sie im Kopf ihre Maklercourtage. Genug für eine Woche Disneyland im Winter. Tommy würde es gefallen, die Zwillinge würden sich beklagen, das sei was für kleine Kinder, und sich dann trotzdem prächtig amüsieren. Duncan würde die Achterbahnfahrten insgeheim genießen, und sie konnte am Pool sitzen und ein bisschen Sonne tanken. Wieso also nicht, verdammt?
Megan warf einen Blick die Straße hinunter, um nach dem Wagen ihres Vaters Ausschau zu halten. Dreimal die Woche holte er Tommy von der neuen Schule ab. Sie war dem Himmel dankbar, dass der Junge nur zweimal pro Woche mit dem Bus fahren musste, und sie wusste es zu schätzen, dass ihr Vater trotz seiner grauen Haare und seines faltigen Gesichts seinem Namensvetter so viel Spaß bereitete. Sie stürmten mit wilden Plänen ins Haus und überschlugen sich, wenn sie darüber redeten, was der Schultag Neues gebracht hatte. Die beiden Tommys, dachte sie. Die beiden sind sich ähnlicher, als sie ahnen.
Sie öffnete die Haustür und rief: »Mädels, ich bin zu Hause!«
Unüberhörbar murmelten zwei Teenagerstimmen in Telefone.
Für einen Moment überkam Megan die altvertraute Unruhe. Ich wünschte, Tommy wäre schon da, dachte sie. Ich hasse es, wenn er irgendwo unterwegs ist und ich ihn nicht in die Arme nehmen kann, bis er sich beklagt, dass ich ihn erdrücke. Als sie auf der Straße einen Wagen kommen hörte, atmete sie langsam aus. Das sind sie wahrscheinlich, dachte sie erleichtert und ärgerte sich augenblicklich darüber, erleichtert zu sein.
Sie hängte ihren Regenmantel auf und schlüpfte aus den Schuhen. Nein, dachte sie, ich würde nichts ändern. Nicht ein bisschen. Nicht einmal all die Probleme mit Tommy. Ich habe einfach gewaltiges Glück.
Zwei: Die beiden Tommys
Richter Thomas Pearson schritt genau in dem Moment den Flur entlang, als die Schulglocke das Ende des Unterrichts einläutete. Zu beiden Seiten wurden Türen aufgerissen, und der Korridor füllte sich mit Kindern. Ihm schlug eine Woge Kinderstimmen entgegen, und die fröhliche Schar, die ihre Büchertaschen und Regenjacken einsammelte, öffnete sich, um ihn durchzulassen, und schloss sich hinter ihm. Als eine Gruppe Jungen an ihm vorbeistürmte und die Jacken wie die Umhänge von Musketieren schwang, wich er den Kindern tänzelnd aus. Er stieß gegen ein kleines rothaariges Mädchen, dessen Haar in Schleifchen und Zöpfchen um den Kopf flog. »Entschuldigung«, sagte es in wohlerzogener Kindermanier. Er trat beiseite und verneigte sich übertrieben höflich. Er fühlte sich, als stünde er im Meeresschaum am Strand und ließe sich das gurgelnde Wasser der letzten Welle um die Beine spülen.
Er winkte einigen Gesichtern zu, die er wiedererkannte, und lächelte die anderen in der Hoffnung an, sich trotz seiner Körpergröße und seiner Altersfalten leicht unter das fröhliche junge Treiben des Schulflurs mischen zu können. Er entdeckte Tommys Klassenzimmer und manövrierte sich durch das Gedränge der Kinder in dessen Richtung. An der Außenseite der Tür war ein bunter Ballon aufgemalt, und auf einem Schild daneben stand: Sonderabteilung A.
Er beugte sich nach unten und dachte, als er den Türknauf drehte, wie viel Freude es ihm machte, seinen Enkel abzuholen, und wie jung er sich dabei fühlte.
Plötzlich flog die Tür von innen auf. Er blieb stehen, und vor ihm tauchte ein brauner Haarschopf auf, danach eine Stirn, und zuletzt spähte ein Paar blaue Augen um die Ecke.
Für Sekunden starrte er in diese Augen und erkannte darin seine verstorbene Frau, dann seine Tochter und schließlich seinen Enkel wieder.
»Hallo, Großvater, ich wusste, dass du’s bist.«
»Hallo, Tommy, ich umgekehrt auch.«
»Ich komm gleich. Kann ich noch mein Bild fertigzeichnen?«
»Wenn du möchtest.«
»Kommst du rein und siehst mir dabei zu?«
»Warum nicht.«
Als er den festen Griff seines Enkels spürte, musste er daran denken, wie hartnäckig Kinder an etwas festhalten konnten. Wie sie das Leben mit beiden Händen packten. Die Erwachsenen verkannten das vielfach. Er ließ sich ins Klassenzimmer ziehen. Dort nickte er Tommys Lehrerin zu, die seinen Gruß mit einem Lächeln erwiderte.
»Er will seine Zeichnung fertigmachen«, sagte Richter Pearson.
»Gut. Und es macht Ihnen nichts aus, zu warten?«
»Ganz und gar nicht.«
Tommy ließ seine Hand los und setzte sich auf einen Stuhl an einem langen Tisch. Ein paar andere Kinder zeichneten ebenfalls noch. Alle schienen in ihre Arbeit vertieft. Während Tommy einen roten Kreidestift nahm und emsig malte, blieb sein Großvater stehen und sah zu.
»Was zeichnest du?«
»Brennende Blätter. Und das Feuer breitet sich im Wald aus.«
»Ah.« Er wusste nicht, was er sagen sollte.
»Manchmal ist es irritierend.«
Er drehte sich um und sah Tommys Lehrerin neben sich stehen. »Wie bitte?«
»Es ist irritierend. Wir setzen die Kinder zum Zeichnen oder Malen an den Tisch, und ehe wir’s merken, haben sie eine Schlachtszene zu Papier gebracht oder ein Haus, das niederbrennt, oder ein Erdbeben, unter dem eine ganze Stadt verschüttet wird. Eins der anderen Kinder hat das letzte Woche gezeichnet. Ziemlich drastisch. In allen Einzelheiten. Bis hin zu den Menschen, die in die Spalten stürzen.«
»Ein wenig …« Er sprach den Satz nicht weiter.
»Makaber? Kann man wohl sagen. Aber die meisten Kinder in diesem Zweig hier haben derartige Probleme mit ihren Gefühlen, dass wir sie zu solchen Phantasien ermuntern, wenn es ihnen dabei hilft, sich mit tiefer sitzenden Ängsten auseinanderzusetzen. Eigentlich eine einfache Methode.«
Richter Pearson nickte. »Trotzdem«, meinte er. »Ich wette, Blumen wären Ihnen lieber.«
Die Lehrerin grinste. »Wär mal was anderes.«
Dann fügte sie hinzu: »Würden Sie bitte Mr. und Mrs. Richards sagen, sie möchten mich anrufen, um einen Termin mit mir zu vereinbaren?«
Der Richter sah zu Tommy herunter, der mit seinem Bild beschäftigt war. »Gibt es Probleme?«
Die Lehrerin lächelte. »Liegt wahrscheinlich in der menschlichen Natur, immer das Schlimmste anzunehmen. Im Gegenteil, er hat den ganzen Herbst hindurch große Fortschritte gemacht, wie auch schon im Sommer. Ich möchte, dass er nach den Weihnachtsferien in ein paar Fächern ins reguläre dritte Schuljahr wechselt.«
Sie machte eine kurze Pause. »Oh, das hier wird nach wie vor seine Hauptklasse bleiben, und wahrscheinlich gibt es den einen oder anderen Rückschlag, aber wir denken, wir können ihn ein wenig mehr fordern. Er ist eigentlich sehr intelligent, nur wenn er frustriert ist …«
»… dann gerät er außer Kontrolle«, führte der Richter ihren Satz zu Ende.
»Ja. Daran hat sich nichts geändert. Er kann immer noch ziemlich wild werden. Andererseits hat er seit Wochen nicht mehr diese apathischen Phasen gehabt.«
»Ich weiß«, sagte der Richter. Er musste daran denken, welche Angst er gehabt hatte, als er zum ersten Mal gesehen hatte, wie sein Enkel als kleines Kind einfach nur ins Leere starrte und die Welt um sich herum vergaß.
Der Junge blieb stundenlang in diesem Zustand, ohne zu schlafen, ohne zu sprechen, zu weinen, ja beinahe, ohne zu atmen, als befände er sich an einem anderen Ort. Dann kehrte er ebenso plötzlich zurück und tat, als wäre nichts gewesen.
Er sah aufs Neue Tommy dabei zu, wie er seine Zeichnung mit energischen Strichen in Orange quer über dem Himmel fertigstellte. Was für Angst du uns eingejagt hast. Wo bist du in diesen Momenten?
Wahrscheinlich an einem besseren Ort als hier, dachte er.
»Ich richte es ihnen aus«, versprach er. »Sie werden sich umgehend bei Ihnen melden. Klingt nach einer guten Nachricht.«
»Drücken wir uns die Daumen.«
Sie traten aus dem Schulportal, und einen Moment lang war der Richter darüber erstaunt, wie schnell die Freude über den Schulschluss verflogen war. Auf dem Parkplatz standen nur noch wenige Autos. Ihm schlug eine kalte Brise entgegen, die ihm unter die Jacke, durch den Pullover und das Hemd bis auf die Haut kroch. Er zitterte und machte die Knöpfe zu.
»Schließ den Anorak, Tommy. Meine alten Knochen sagen mir, dass es Winter wird.«
»Was sind alte Knochen, Großvater?«
»Also, du hast junge Knochen, deine Knochen wachsen noch, sie werden größer und kräftiger. Meine Knochen dagegen, die sind alt und müde, weil sie eben schon eine ganze Weile da sind.«
»Gar nicht so lange.«
»Doch, schon fast einundsiebzig Jahre.«
Tommy überlegte einen Moment.
»Das ist wirklich lang. Werden meine so lange wachsen?«
»Wahrscheinlich länger.«
»Und wieso kannst du was mit deinen Knochen spüren? Ich kann den Wind im Gesicht und an den Händen spüren, aber nicht mit meinen Knochen. Wie macht man das?«
Der Richter lachte. »Das merkst du selbst, wenn du älter wirst, wart’s ab.«
»Ich hasse das.«
»Was?«
»Wenn mir jemand sagt, ›wart’s ab‹. Ich will es jetzt gleich wissen.«
Der Richter beugte sich herunter und nahm seinen Enkel bei der Hand. »Du hast absolut recht. Wenn du etwas lernen willst, lass dir nie von jemandem sagen: ›Wart’s ab.‹ Lern’s einfach sofort.«
»Knochen?«
»Na ja, das ist so eine Redensart. Du weißt doch, was das heißt?«
Tommy nickte.
»Aber tatsächlich werden die Knochen mit zunehmendem Alter spröde – steckt nicht mehr so viel Leben drin. Wenn ein kalter Wind bläst, dann friere ich, bis ins Mark. Das tut nicht weh, ich merke es nur stärker, verstehst du?«
»Glaub schon.«
Der Junge ging ein paar Schritte stumm neben seinem Großvater her. Dann sagte er, mehr zu sich selbst: »Gibt eine Menge zu lernen«, und seufzte.
Sein Großvater hätte über diese außergewöhnliche Einsicht beinahe schallend gelacht, doch stattdessen drückte er seinem Enkel nur die Hand ein wenig fester, und durch den grauen Nachmittag liefen sie weiter zum Wagen. Richter Pearson registrierte die moderne Limousine, die neben seinem eigenen Fahrzeug parkte. Als er und Tommy näher kamen, stieg eine Frau aus dem Fond. Sie war groß und drahtig; unter der breiten Krempe ihres Huts quoll leuchtend rotes Haar hervor, und sie trug eine große dunkle Sonnenbrille. Einen Augenblick hatte der Richter ein unbehagliches Gefühl. Wie konnte sie damit sehen? Zögernd ging er der Frau entgegen, die mit forschen Schritten auf ihn und Tommy zukam.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragte der Richter.
Die Frau knöpfte ihre hellbraune Regenjacke auf und griff hinein. Sie lächelte.
»Richter Pearson«, grüßte sie. »Hallo.« Ihr Blick fiel auf seinen Enkel. »Das muss Tommy sein. Also wirklich, deinem Vater und deiner Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Ich sehe sie buchstäblich vor mir.«
»Verzeihen Sie«, fragte der Richter. »Kennen wir uns?«
»Sie waren Strafrichter, nicht wahr?«, sagte die Frau und ignorierte seine Frage. Sie lächelte weiter.
»Ja, aber …«
»Viele Jahre lang.«
»Ja, aber würden Sie mir bitte …«
»Dann sind Sie zweifellos mit so etwas bestens vertraut.«
Langsam zog sie die Rechte aus der Jacke. Sie hielt einen großen Revolver in der Hand, den sie auf seine Magengegend richtete.
Verwirrt starrte der Richter auf die Waffe.
»Das ist übrigens eine Magnum.357«, fuhr die Frau fort. Dem Richter fiel die monotone Sprechweise auf, hinter der er mühsam beherrschte, blanke Wut vermutete. »Ein Schuss damit, und Sie haben ein großes Loch im Bauch. Bei Klein Tommy wäre es riesig. Und ihn würde ich mir als Ersten vornehmen, so dass Sie in Ihren letzten Sekunden begreifen würden, dass Sie für seinen Tod verantwortlich sind. Sorgen Sie also dafür, dass nicht alles zu Ende ist, bevor es richtig angefangen hat. Steigen Sie einfach ruhig in meinen Wagen.«
»Nehmen Sie meinetwegen mich, aber lassen Sie …«, setzte der Richter an. Unwillkürlich stiegen in seinem Kopf endlos viele Fälle auf, die er bearbeitet hatte, Urteile, die er gefällt, Schuldsprüche, die er verkündet hatte, und er fragte sich, bei welchem dieser Verfahren der normale Hass des Angeklagten aus dem Ruder gelaufen und eskaliert war. Er sah die Gesichter von hundert wütenden Männern vor sich, Augen, die Alter und Verbrechen gezeichnet hatten. Doch er konnte sich an keine Frau erinnern, schon gar nicht an die Frau, die ihm den Lauf des Revolvers in die Rippen drückte.
»O nein, nein, nein«, sagte sie, »auf den Jungen können wir nicht verzichten, er ist der Schlüssel zu dem Ganzen.«
Sie gestikulierte mit der Waffe.
»Hübsch langsam. Bleiben Sie so ruhig wie ich. Keine plötzlichen Bewegungen, Richter Pearson. Denken Sie daran, wie dumm es wäre, wenn Sie beide hier sterben würden. Denken Sie nur, was Sie Ihrem Enkel antäten. Sie würden ihm das Leben stehlen. Natürlich sind Sie so etwas gewöhnt. Sie haben den Leuten Jahre gestohlen, ohne mit der Wimper zu zucken, Sie Schwein! Aber hier – lassen Sie es einfach bleiben.«
Er sah, dass jemand die Wagentür aufgestoßen hatte und dass drinnen Leute saßen.
Tausend Gedanken wirbelten ihm durch den Kopf. Schrei! Ruf um Hilfe! Wehr dich!
Er tat nichts dergleichen.
»Tu, was sie sagt, Tommy«, forderte er seinen Enkel auf. »Keine Angst, ich bin bei dir.«
Zwei kräftige Hände packten den Richter und warfen ihn mit einem Ruck auf den Boden des Wagens.
Einen Moment lang roch er Schuhcreme und Schmutz, vermischt mit dem beißenden Geruch von Angstschweiß. Er sah Jeans und Stiefel, dann zwängte ihm jemand einen schwarzen Stoffsack über den Kopf, in dem er nur schwer Luft bekam. Er musste an die Kapuze denken, die ein Henker seinen Opfern überstülpt, und er fing an, sich zu wehren, doch ein paar Hände drückten ihn augenblicklich zu Boden. Er spürte, wie Tommys leichter Körper auf ihm landete, und er ächzte. Er versuchte, ihm etwas zu sagen, doch statt der beruhigenden Worte – ›hab keine Angst, ich bin bei dir‹ – brachte er nur ein Stöhnen heraus.
Er hörte eine ruhige, doch bissige Männerstimme: »Willkommen bei der Revolution. Und jetzt gute Nacht, alter Mann.«
Etwas Schweres traf ihn an der Schläfe, es wurde schwarz um ihn, und er verlor das Bewusstsein.
Drei: Duncan
Seine Sekretärin klopfte zart an die Glastür zu seinem Büro und streckte den Kopf herein. »Mr. Richards, werden Sie heute voraussichtlich wieder länger bleiben? Ich meine, ich kann auch noch ein bisschen Zeit dranhängen, aber ich müsste meine Mitbewohnerin bitten, für mich mit einzukaufen …«
Duncan Richards sah von seinem Arbeitsblatt auf und lächelte. »Noch ein Weilchen, Doris, aber Sie können ruhig gehen. Ich will nur den Papierkram zum Antrag der Harris Company abschließen.«
»Bestimmt, Mr. Richards? Ich meine, es macht mir nichts aus …«
Er schüttelte den Kopf. »Ich mach zu oft Überstunden«, sagte er. »Wir sind Geschäftsleute, wir sollten uns an die Geschäftszeiten halten.«
Sie schmunzelte. »Also, bis fünf bin ich auf jeden Fall noch da.«
»Gut.«
Doch statt sich wieder in seine Papiere zu vertiefen, lehnte sich Duncan Richards zurück und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. Er drehte sich mit seinem Stuhl so weit um, dass er aus dem Fenster sehen konnte. Es war schon fast dunkel. Die Autos, die vom Parkplatz fuhren, hatten bereits die Scheinwerfer eingeschaltet und schnitten mit ihnen weiße Kegel in die Dunkelheit. Im letzten grauen Dämmerlicht konnte er nur noch vage die Baumreihe an der Main Street erkennen. Einen Moment lang wünschte er sich, er wäre noch im alten Bankgebäude ein paar Häuser weiter. Es war beengt gewesen, hatte nicht über genügend Büroraum verfügt, doch dafür stand es auf einer leichten Anhöhe ein Stück von der Straße zurückgesetzt und bot einen viel weiteren Blick. Das neue Gebäude dagegen war architektonisch so makel- wie seelenlos. Keine Aussicht außer auf den Verkehr. Modernes Mobiliar, Sicherheitsvorkehrungen auf dem allerneuesten Stand. Seit seinen Anfängen bei der Bank hatte sich eine Menge verändert. Greenfield war keine kleine College-Stadt mehr, sondern zog unablässig Geschäftsleute, Baulöwen, Betuchte aus New York und Boston an.
Die Stadt verliert ihre Anonymität, dachte er. Vielleicht wir alle.
Er betrachtete den Antrag auf seinem Tisch. Er unterschied sich in nichts von einem halben Dutzend ähnlicher Fälle, die er im Lauf des letzten halben Jahres bearbeitet hatte – eine kleine Baufirma, die ein Stück Grünfläche mit Blick über die Green Mountains kaufen wollte, um auf rund zehn Hektar Land sechs Spekulationsobjekte zu errichten. Die Häuser verkaufe man anschließend zu knapp dreihunderttausend Dollar pro Stück, und schon ist die Baufirma nicht mehr klein, sondern mittelgroß. An den Zahlen schien nichts auszusetzen zu sein; wir übernehmen das Darlehen für den Grundstückskauf, dann das für den Bau, und wahrscheinlich übernehmen wir auch noch die Hypotheken für die Käufer der Häuser. Er brauchte keinen Taschenrechner, um sich den beträchtlichen Profit für die Bank auszurechnen. Die Baufirma selbst allerdings gab ihm ein wenig zu denken. Er seufzte bei der Vorstellung, wie klamm sie sein würde. Fahre volles Risiko, beleihe alles und jedes, und du bist auf Gedeih und Verderb zum Erfolg verdonnert. Der American Way. Das war schon immer so.
Ein Banker dagegen musste die Vorsicht und Gelassenheit der Alten Welt an den Tag legen: nie in Eile, nie unter Druck.
Auch das wird anders. Kleine Häuser wie die First State Bank of Greenfield standen seitens der Großbanken unter erheblichem Konkurrenzdruck. Die Bostoner Baybanks hatte eben erst in der Prospect Street eine Filiale aufgemacht und Citicorp die Springfield National, die Konkurrenz, geschluckt.
Vielleicht trifft es auch uns. Wir sind ein attraktives Zielobjekt für eine Übernahme. Die nächsten Quartalszahlen werden einen deutlichen Gewinnsprung zeigen. Er nahm sich vor, Aktienoptionen wahrzunehmen, nur für alle Fälle. Aber bis jetzt gab es noch keine Gerüchte, und die gab es schließlich immer, wenn Gefahr im Verzuge war. Er überlegte, ob er den alten Phillips, den Bankdirektor, danach fragen sollte, kam jedoch zu dem Schluss, es besser bleiben zu lassen: Er hat es vom ersten Tag an auf mich abgesehen. Daran wird sich jetzt nichts ändern.
Er erinnerte sich, wie er vor achtzehn Jahren zum ersten Mal durch die Tür der Bank getreten war. Megans Vater hatte sie ihm, als er zögerte, aufgehalten. Seine neue Frisur war gewöhnungsbedürftig gewesen, und er hatte sich dauernd mit der Hand durchs Haar gestrichen, weil er sich wie ein Amputierter wenige Tage nach der Operation vorkam.
Bei der Erinnerung an seine Angst an diesem ersten langen Tag verkrampfte sich ihm der Magen.
Er sah wieder zum Fenster hinter seinem Schreibtisch hinaus, und obwohl er versuchte, die Erinnerung zu verbannen, schlich sie sich in seine Gedanken ein. Es war ein strahlender Morgen gewesen. In der Bank herrschte damals reger Kundenverkehr. Inmitten der Sonne, der Menschen und des geschäftigen Treibens war seine Nervosität nicht weiter aufgefallen. Ich war davon überzeugt, dachte er, dass ich nicht die Kraft aufbringen würde, je wieder eine Bank zu betreten. Phillips sagte, ich könnte an der Kasse anfangen, weil Richter Pearson sich für mich verbürgte. Sie spielten zusammen Golf. Als ich das erste Mal Geld zwischen den Fingern hatte, zitterte meine Hand, und jedes Mal, wenn die Eingangstür aufging, dachte ich, das war’s. Ich erwartete Herren mit düsterer Miene in unauffälligen Anzügen, die mich zu guter Letzt doch noch mitnahmen.
Er überlegte, wann er diese Angst verloren hatte. Nach einer Woche? Einem Monat? Einem Jahr?
Wieso denke ich an so etwas?
Es ist vorbei. Es ist achtzehn Jahre her und vorbei.
Er wusste nicht mehr, wann er das letzte Mal an die Anfänge seiner Banklaufbahn zurückgedacht hatte, jedenfalls seit Jahren nicht mehr, und so fragte er sich, wieso gerade jetzt; er rollte unwillkürlich die Zunge zurück, als müsste er einen bitteren Geschmack verdrängen. Schluss damit. Das ist vorbei. Er nahm den Kalkulationsbogen zur Hand und starrte auf die Zahlen. An Auflagen geknüpfte Bewilligung, dachte er. Soll der Vorstand erst mal seine Meinung dazu sagen. Anders als in den frühen Achtzigern machen die Baufirmen derzeit nicht so leicht Pleite. Andererseits hatte die Zentralbank genau an diesem Morgen den Leitzins um einen halben Prozentpunkt erhöht, und vielleicht sollten sie bei der nächsten Vorstandssitzung einmal ernsthaft darüber diskutieren. Die Analysten drauf ansetzen. Er machte sich eine Notiz im Terminkalender.
Das Telefon auf seinem Schreibtisch summte, und die Gegensprechanlage schaltete sich ein. Es war seine Sekretärin.
»Mr. Richards, Mrs. Richards ist am Apparat.«
»Danke.«
Er nahm den Hörer ab.
»Hör zu, Meg, ich komm heute nicht spät. Ich mach gerade Schluss …«
»Duncan, hat Dad gesagt, dass er mit Tommy noch irgendwo hinwill? Sie sind noch nicht zurück, und ich dachte, vielleicht hat er dir was gesagt.«
»Noch nicht zurück?«
Duncan Richards sah auf die Uhr. Fast eine Stunde über die Zeit. Er taxierte die Sorge in der Stimme seiner Frau. Minimal. Nicht ängstlich, nur beunruhigt.
»Nein.«
»Und? Hast du in der Schule angerufen?«
»Ja. Sie sagen, Dad war wie immer pünktlich da. Er ist ein Weilchen geblieben, weil Tommy noch etwas zu Ende bringen wollte, dann sind sie gegangen.«
»Also, ich denke, das ist kein Grund zur Sorge. Wahrscheinlich hat er ihn zu ein paar Videospielen ins Einkaufszentrum mitgenommen. Das haben sie seit ein paar Wochen nicht mehr gemacht, ich vermute, dass sie am ehesten da stecken.«
»Ich hab ihn allerdings gebeten, das nicht zu tun. Tommy ist davon immer zu aufgedreht.«
»Ach, komm schon. Sie haben so viel Spaß miteinander, und außerdem glaube ich sowieso, dass dein Alter Herr die Spiele am meisten genießt.«
Ihr war ein Hauch der Erleichterung anzuhören. »Aber ich hab was Besonderes zum Abendessen gemacht, und er spendiert ihm wahrscheinlich fetttriefende Cheeseburger.«
»Na ja, du kannst ja mit deinem Dad reden, auch wenn ich bezweifle, dass es was bringt. Er mag Fast Food. Man sollte meinen, dass er es nach einundsiebzig Jahren besser weiß.«
Sie lachte. »Wahrscheinlich hast du recht.«
Er legte auf, zog einen Schreibblock heraus und fing an, sich ein paar Notizen zu machen, wie er das Darlehen dem Vorstand präsentieren würde. Es klopfte an seine Glastür, und er sah, wie ihm seine Sekretärin noch einmal zuwinkte. Sie war schon im Mantel. Er winkte zurück und dachte: Ich mach das morgen fertig.
Das Telefon auf seinem Schreibtisch summte erneut, und er hob augenblicklich ab.
»Hör zu, Schatz, ich bin schon so gut wie draußen«, sagte er ohne Überleitung.
»Tatsächlich?«, erwiderte die Person am anderen Ende. »Das glaube ich nicht. Ich glaube, da kommst du nie mehr raus.«
Es war, als ob unter diesen wenigen Worten, diesen Lauten, die mit erschreckender Vertrautheit in sein Bewusstsein drangen, alles um ihn her wie ein Kartenhaus zusammenbrach. Er klammerte sich an die Kante seines Schreibtischs, merkte jedoch, dass sich ihm trotzdem alles vor den Augen drehte, und er wusste in derselben Sekunde: Jetzt ist alles vorbei.
Vier: Megan
Als Megan Richards auflegte, war sie eher irritiert als besorgt. Duncan hat immer verdammt rationale Erklärungen parat. Er ist so nüchtern, dass ich manchmal schreien könnte. Sie ging durchs Haus zum Wohnzimmer und zog die Gardinen zurück, um auf die Straße zu sehen: Sie blieb schwarz und leer. Sie starrte noch eine Weile hinaus, bis sie vor Enttäuschung vom Fenster treten musste. Nach einer Weile zog sie die Gardine wieder energisch zu und kehrte in die Küche zurück.
Sie dachte: Koch trotzdem was Vernünftiges. Vielleicht haben sie noch nichts gegessen. Sie sah auf die Uhr und schüttelte den Kopf. Nach der Schule ist Tommy immer wie ausgehungert.
Ein paar Minuten lang hantierte sie mit Töpfen und Pfannen und überprüfte die Temperatur im Ofen. Dann warf sie einen Blick auf den gedeckten Tisch im Speisezimmer. Ihr kam ein Gedanke, und sie kehrte mit energischen Schritten in die Küche zurück, öffnete eine Schublade und holte ein zusätzliches Besteck heraus. Sie nahm einen weiteren Teller und ein Glas vom Regal und zog ein zusätzliches Tischset aus einem der Schränke. So, dachte sie. Wenn Dad herkommt und das zusätzliche Gedeck für ihn sieht, tut es ihm vielleicht leid, Tommy mit Cheeseburgern vollzustopfen.
Sie betrachtete gerade noch einmal ihr Werk, als sie ein Auto kommen hörte. Mit einer Woge der Erleichterung kehrte sie wieder ins Wohnzimmer zurück und zog diesmal die Gardine behutsam nur ein Stück zur Seite, damit sich die beiden nicht von ihr beobachtet fühlten, während sie dachte: Zum hundertsten Mal werde ich Dad sagen müssen, er kann von Herzen gerne mit Tommy etwas unternehmen, nur muss er es mir vorher sagen.
Andererseits ist das hier nicht das erste Mal, und ich war noch nie so nervös. Sie schüttelte den Kopf, als könne sie ihre Gedanken mit purer Willenskraft wegschieben.
Sie starrte erneut hinaus und fluchte, als sie sah, wie die Scheinwerfer an ihrem Haus vorbeiglitten und ein Stück weiter in eine Einfahrt bogen.
Verdammt!
Wieder sah sie auf die Uhr.
Von oben war Gelächter zu hören, und ihr kam der Gedanke, dass vielleicht die Zwillinge eine Nachricht entgegengenommen und vergessen hatten, sie ihr auszurichten. Das war so naheliegend, dass sie sich wunderte, wieso sie erst jetzt darauf kam. Sie blickte noch einmal auf die leere Straße und lief mit energischen Schritten die Treppe hinauf.
»Hey, Lauren, Karen?«
»Hier drinnen, Mom.«
Sie öffnete die Tür und fand die Mädchen auf dem Boden zwischen Bergen von Blättern und Schulbüchern hingestreckt.
»Mom, musstest du an der Highschool Hausarbeiten machen?«
Sie lächelte. »Selbstverständlich. Wieso?«
»Ich meine, in der Oberstufe.«
»Ja, sicher, auch in der Oberstufe.«
»Ich find das einfach blöd, schließlich gehen wir nächstes Jahr ans College, und ich seh nicht ein, dass wir uns mit all diesem Kram von gestern abgeben sollen. Zehn Matheaufgaben. Ich hab das Gefühl, dass ich jeden Abend zehn Matheaufgaben gemacht habe, seit ich aus den Windeln bin.«
Karen kicherte los und ließ ihre Mutter nicht zu Wort kommen.
»Na ja, Lauren, wenn du zur Abwechslung mal versuchen würdest, die richtigen Lösungen zu finden, würde es vielleicht auch zu mehr als einer Drei reichen.«
»Zahlen sind nicht halb so wichtig wie Worte. Und was hattest du noch gleich in deiner letzten Englischarbeit?«
»Das ist unfair. Die war über Bleakhaus, und du weißt genau, dass ich es nicht zu Ende lesen konnte, weil du mir mein Buch weggenommen hattest!«
Lauren schnappte sich ein kleines Kissen und zielte damit auf ihre Schwester, die lachte und es zurückwarf. Beide trafen daneben.
Megan hielt die Hand hoch. »Frieden!«, mahnte sie.
Die Zwillinge drehten sich zu ihr um, und wie so oft durchzuckte es sie eigenartig, als sie in zwei gleiche Augenpaare blickte, ihr Haar und ihre Gesichter betrachtete, die mit dem gleichen Ausdruck zu ihr aufschauten. Sie sind das reinste Wunder, dachte Megan. Sie fühlen, was der andere gerade empfindet, sie denken, was der andere gerade denkt, und trösten sich gegenseitig so leicht über ihre Verletzungen hinweg. Sie sind nie allein.
»Hört mal«, begann Megan. »Hat eine von euch heute mit Großvater gesprochen? Er hat Tommy von der Schule abgeholt, und sie sind noch nicht zurück. Ich dachte nur, er hat euch vielleicht Bescheid gesagt, dass es heute später wird.«
Sie versuchte, nicht besorgt zu klingen.
Lauren und Karen schüttelten beide den Kopf.
»Nein«, antwortete Karen. Sie war neunzig Sekunden früher geboren und meldete sich grundsätzlich als Erste. »Machst du dir Sorgen?«
»Nein, nein, nein, es sieht eurem Großvater nur nicht ähnlich, keinem was zu sagen, wenn sie noch ins Einkaufszentrum gehen.«
»Na ja«, meinte Lauren, »das erste Mal wär’s aber auch nicht, wenn du ehrlich bist. Er glaubt wahrscheinlich immer noch, die ganze Welt ist sein Gerichtssaal, und er kann machen, was er will, weil er der Boss ist.«
Es lag keine Spur von Kritik in dieser sachlichen Feststellung.
Megan schmunzelte. »Könnte man tatsächlich manchmal meinen, oder?«
»Und er behandelt Tommy anders als uns«, fügte Karen hinzu.
»Tommy ist anders.«
»Ich weiß, aber …«
»Kein Aber. Er ist anders, Punkt.«
»Na ja, manchmal sieht es eben so aus, als würden wir für selbstverständlich genommen, und er bekommt immer eine Extrawurst.«
Das war ein alter, wenn auch berechtigter Vorwurf.
»Karen, du weißt, dass es nicht dasselbe ist. Jeder wird unterschiedlich behandelt, weil jeder unterschiedliche Bedürfnisse hat. Tommy braucht nun mal mehr als ihr beide, das hatten wir doch alles schon.«
»Ich weiß.«
»Hast du Angst, dass was passiert sein könnte?«, fragte Lauren.
»Nein, ich mache mir nur ein paar Sorgen, genauso wie bei euch, wenn ihr nicht pünktlich aus der Schule kommt. Das ist also nun tatsächlich dasselbe.«
Doch sie wusste genau, dass es gelogen war. Sie fragte sich, wieso sie sich in Bezug auf ihren Sohn verletzlicher fühlte als bei ihren Töchtern. Es hätte andersherum sein müssen. Alles war irgendwie andersherum.
»Sollen wir mal zum Einkaufszentrum rüberfahren und nach ihnen suchen? Ich wette, ich weiß, wo sie stecken.«
»Klar«, pflichtete Karen bei. »In der Passage, bei diesem Weltraumeroberer-Spiel. Wir ziehn dann mal los, Mom, sind gleich wieder da, okay?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, nein, sie müssen jeden Moment kommen. Außerdem sollt ihr eure Hausarbeiten fertigmachen. Vorher gibt’s kein Fernsehen.«
Die Zwillinge murrten, und sie zog die Tür zu.
Megan ging ins Schlafzimmer, schlüpfte aus Rock und Strumpfhose und zog sich eine verwaschene Jeans an. Ihre Bluse hängte sie in den Schrank und tauschte sie gegen einen Pullover, dann zog sie sich ein Paar Joggingschuhe an und trat ans Fenster. Selbst in der Dunkelheit konnte sie vom Obergeschoss aus weiter sehen. Die Straße blieb frustrierend leer. Von ihrem Aussichtsposten aus hatte sie Einblick in das Wohnzimmer der Wakefields gegenüber. Drinnen bewegten sich Schatten. Sie wandte sich zur Seite und sah, dass die beiden Wagen der Mayers auf ihrer Einfahrt standen. Noch einmal blickte sie die Straße hinunter und sah auf die Uhr. Spät, dachte sie. Sehr spät.
Sie spürte, wie sich in ihrem Innern etwas zusammenbraute. Spät, spät, spät, war der einzige Gedanke, den sie fassen konnte. Sie sank schwer aufs Bett.
Wo?
Sie hatte den Drang, etwas zu unternehmen, griff nach dem Telefon und wählte den Notruf.
»Polizei und Feuerwehr Greenfield.«
»Hallo, Mrs. Richards hier, Queensbury Road. Es geht um keinen Notfall oder so. Glaube ich zumindest nicht, aber ich frage mich … sehen Sie, mein Sohn und mein Vater hätten längst von der Schule zurück sein müssen. Er hat ihn heute abgeholt, und normalerweise kommen sie direkt nach Hause – auf der South Street, dann Route 116, und ich dachte, vielleicht hat es ja …«
Die Stimme unterbrach sie in routiniertem Ton. »Uns liegen heute Nachmittag keine Meldungen über Unfälle vor. In der genannten Gegend auch keine Verkehrsstörungen. Es wurden weder Krankenwagen noch Streifen gerufen. Von der State Police haben wir auch nichts durchbekommen, außer drei Streifen auf der Interstate Nähe Deerfield.«
»Nein, nein, das können sie nicht sein. Das ist die falsche Richtung. Danke.«
»Kein Problem.«
Es knackte in der Leitung, und als sie den Telefonhörer auflegte, kam sie sich ein wenig albern vor, wenn auch zugleich ein wenig erleichtert. Die Sorge wich jetzt wieder der Verärgerung, was wesentlich angenehmer war.
»Diesmal zieh ich ihm das Fell über die Ohren«, sagte sie laut vernehmlich. »Und dabei ist mir ganz egal, dass er einundsiebzig und ehemaliger Richter ist.«
Sie stand auf und strich an der Stelle, auf der sie gesessen hatte, die Tagesdecke auf dem Bett glatt. Erneut trat sie ans Fenster.
Wo steckt ihr?, dachte sie wieder. Es war, als hätte sie mit der bloßen Frage der Angst wieder Tür und Tor geöffnet.
Sie kehrte zum Telefon auf dem Nachttisch zurück und wählte die Nummer ihres Mannes. Er meldete sich nicht. Wenigstens ist er schon unterwegs, dachte sie, und das war beruhigend.
Sie lief im Zimmer auf und ab und überlegte, wo sie als Nächstes hingehen sollte. Runter, nach dem Abendessen sehen.
Doch als sie den Flur betrat, fiel ihr Blick auf den Türspalt zu Tommys Zimmer. Sie ging hinüber und sah einen Haufen rote Pullover und blaue Jeans, schmutzige Socken und Unterwäsche zu einem Bündel zusammengerollt in einer Ecke liegen. Er wird nie lernen, einen Wäschepuff zu benutzen. Das packt er einfach nicht. Einen Moment lang zögerte sie und machte sich bewusst: Wir haben mal gedacht, er schafft überhaupt nichts. Sie wehrte sich gegen die Erinnerung an all die Nächte der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Jetzt sind wir auf der Überholspur. Wir schaffen das.
Ihr wurde bewusst, dass sie zum ersten Mal einer der normalsten elterlichen Phantasien freien Lauf gelassen und sich vorgestellt hatte, was aus ihrem Kind wohl einmal werden würde. Er wird erwachsen werden, dachte sie. Er wird etwas aus sich machen. Sie ließ den Blick durchs Zimmer schweifen, über das kaum gemachte Bett, die Spielsachen und Bücher und den Krimskrams, der nach und nach jedes Kinderzimmer füllt – so viel wertloses Zeug, doch in den Augen des Besitzers kostbare Schätze. Sie suchte vergeblich nach irgendeinem Hinweis auf Tommys Probleme. Sie dachte: Lass dich davon nicht täuschen. Es gibt sie. Aber sie nehmen ab. Sie erinnerte sich, wie ihnen ein Arzt vor Jahren geraten hatte, für den Fall, dass er um sich schlug, die Wände in seinem Zimmer zu polstern. Gott sei Dank haben wir immer auf unsere eigene Stimme gehört.
Sie setzte sich auf sein Bett und hob gedankenverloren einen Spielzeugsoldaten auf. All die Untersuchungen, das Knuffen und Piksen, um seine Reflexe zu überprüfen, die EKGs und sensorischen Stimulationstests. Er hatte sie alle über sich ergehen lassen müssen. Für Duncan und mich war es leicht. Wir hatten nichts weiter zu tun, als uns Sorgen zu machen. Er musste tapfer sein.
Sie legte das Spielzeug weg.
Wo ist er?
Verdammt!
Sie sprang vom Bett auf, marschierte nach unten und zur Haustür. Sie riss sie auf, trat in die abendliche Kälte und blieb so lange stehen, bis sie ihr an Beinen und Armen in sämtliche Poren kroch.
Wo?
Sie ging wieder hinein und hielt sich am Dielentisch fest.
Sei nicht so theatralisch, forderte sie von sich. Wenn sie in wenigen Minuten zur Tür hereinplatzen und »Hunger!« schreien, schämst du dich.
Einen Augenblick lang half die Mahnung ihr, sich zu beruhigen. Dann schwappte die diffuse Angst wieder über sie hinweg.
Sie trat an den Treppenabsatz und rief nach oben: »Mädels!«
Karen und Lauren meldeten sich.
»Alles klar«, sagte sie. »Ich wollte euch nur Bescheid geben, dass wir bald essen können.«
Es war eine halbherzige Lüge. Sie hatte ihre Stimmen hören wollen, um sich zu vergewissern, dass wenigstens sie in Sicherheit waren.
Das ist einfach zu blöd, gestand sie sich ein.
Nein, ist es nicht. Sie sind sehr, sehr spät dran.
Sie ging ans Telefon in der Küche, wählte den Notruf und hielt inne. Ihr Finger schwebte über der letzten Ziffer. Das Telefon in der Hand, setzte sie sich auf einen Stuhl. In diesem Moment hörte sie, wie auf der Einfahrt ein Wagen bremste, und das Geräusch klang ihr wie Musik in den Ohren.
Sie spürte eine Woge der Erleichterung. Sie knallte den Hörer auf die Gabel und eilte zur Haustür, riss sie auf und sah – nicht ihr Kind, gefolgt von ihrem Vater, sondern ihren Mann, der mit großen Schritten auf sie zukam.
»Duncan!«, rief sie ihm entgegen.
Er war mit drei Sätzen bei ihr.
Selbst in dem schwachen Licht, das durch die offene Tür nach draußen drang, sah sie seine geröteten Augen.
»Duncan! O mein Gott! Es ist was passiert! Tommy! Was ist los? Geht es ihm gut? Wo ist Dad?«
»Ich glaube, es geht ihnen gut«, sagte Duncan. »Ich glaube es jedenfalls. Oh, Gott, Megan – sie sind verschwunden. Sie haben sie entführt. Es ist aus. Alles.«
»Wer hat sie entführt? Was redest du da?« Sie rang um Fassung.
»Wie konnte ich so naiv sein!«, stöhnte Duncan. Seine Worte richteten sich nicht an seine Frau, sondern an die Nacht und den Lauf der Jahre. »All die Jahre, und ich dachte, es wäre vorbei – nur eine böse Erinnerung oder ein Alptraum. Es ist nie passiert, habe ich mir immer eingeredet. Wie konnte ich nur so blöd sein!«
Megan riss ihre ganze Willenskraft zusammen, um nicht zu schreien.
»Sag schon!«, forderte sie ihn mit erhobener Stimme auf. »Wo ist Tommy? Wo ist mein Vater? Wo stecken sie?«
Duncan sah sie an. »Die Vergangenheit«, sagte er ruhig. Er ließ die Arme hängen und schob sich an ihr vorbei durch die Tür.
Er drehte sich zu ihr um.
»Neunzehnhundertachtundsechzig.«
Er schlug mit der Faust an die Wand. »Sagt dir das Jahr etwas? Weißt du noch, was damals passiert ist?«
Sie nickte und hatte das Gefühl, als käme in dieser Sekunde ihr ganzes Leben zum Stillstand. Hundert schreckliche Bilder bestürmten sie, und sie schloss die Augen, um sie abzuwehren. Benommen öffnete sie die Lider und starrte ihren Mann an.
Sie standen, ohne sich zu berühren, in einigem Abstand voneinander im Licht der Eingangstür, das gegen die Dunkelheit der Nacht ankämpfte. Sie begriffen, dass das Unheil, das sie weit hinter sich und vergessen gewähnt hatten, sie eingeholt hatte und fest in seinen Fängen hielt.
Zwei
Lodi, KalifornienSeptember 1968
Kurz nach Sonnenaufgang erwachte die Brigade.
Durch die schweren Gardinen an den Fenstern drang das erste schwache Morgenlicht bis in die Ecken des kleinen, einstöckigen Holzständerhauses, in dem die Bewohner noch steif von der Nacht ihren Verrichtungen nachgingen. In der Küche pfiff ein Wasserkessel. Mit einigem Ächzen wurden die Matratzen aus der Mitte des Wohnzimmers gezogen und an die Wände gelehnt, Schlafsäcke eingerollt, die Toilette wiederholt gespült. Jemand stolperte über eine halbvolle Bierflasche, deren Inhalt sich, unter leisen Flüchen, über den Boden ergoss. Von der Rückseite des Hauses war ein heiseres Lachen zu hören. Der schwere, abgestandene Geruch der Zigaretten und wütenden Worte der letzten Nacht hing noch in der stickigen Luft.
Olivia Barrow, die sich den Kriegernamen Tanya zugelegt hatte, trat an eines der vorderen Fenster und zog behutsam die Gardine ein Stück zur Seite. Sie ließ den Blick über die staubige Straße vor der Hausfront schweifen, um festzustellen, ob jemand sie heimlich observierte. Jeder, der ihr unter die Augen kam, wurde genau taxiert, jedes Fahrzeug, das vorbeifuhr, mit Argusaugen verfolgt. In erster Linie achtete sie auf alles Ungewöhnliche – den Zeitungslieferwagen, der stehenblieb, den Obdachlosen im Hauseingang, der eher wach als betrunken schien. Als Nächstes suchte sie nach Gegenständen, die allzu gewöhnlich schienen – den Wagen der Straßenreinigung, die Schlange an der Bushaltestelle. Sie ließ den Blick bei jedem Objekt verweilen und wartete auf irgendein verräterisches Zeichen. Als sie sich endlich davon überzeugt hatte, dass niemand sie beobachtete, schloss sie die Gardine und trat in die Mitte des Zimmers.
Sie schob einen Stapel aus alten Zeitungen und Unrat zur Seite und betrachtete einen Moment lang ihr Quartier. In einer Ecke, die sie als Bibliothek bezeichnete, türmten sich politische Traktate sowie militärische Handbücher über Sprengstoffe und Waffen; die Wände waren ein seltsames Pastiche aus handgeschriebenen revolutionären Slogans und Rock-and-Roll-Postern. Ihr Blick streifte das von The Jefferson Airplane.
Das Durcheinander und der Dreck, die unvermeidliche Folge des Zusammenlebens zu vieler Menschen auf zu knappem Raum, fochten Olivia kaum an. Im Grunde war ihr die drangvolle Enge des anonymen Hauses gerade recht – kein Ort, um voreinander Geheimnisse zu bewahren, dachte sie. Geheimnisse sind eine Schwachstelle. Wir sollten voreinander alle nackt sein. Das fördert die Disziplin, und Disziplin bedeutet Stärke. Sie zog den Schlitten der Halbautomatik Kaliber.45 bis zum Anschlag zurück, schob ein Magazin ein und ließ es mit einem markanten Klicken einrasten. Das Geräusch drang durch die Übermüdung nach einer zu langen Nacht und erregte augenblicklich die Aufmerksamkeit der sechs anderen Personen. Sie liebte das Geräusch des Hebels beim Entsichern. Das wirksamste Mittel, sich Gehör zu verschaffen. »Zeit fürs Morgengebet«, sagte sie mit lauter Stimme.
Geräuschvoll griffen alle anderen nach den ihnen zugeteilten Waffen und überprüften sie, bevor sie sich in der Mitte des Raums im Kreis aufstellten. Die Gruppe bestand aus zwei weiteren Frauen und vier Männern. Zwei der Männer trugen Bart und schulterlanges Haar; zwei waren Schwarze mit buschiger Afrofrisur. Ihre Kleidung stellte eine bunt zusammengewürfelte Mischung aus Jeans und Armeebeständen dar. Einer der Schwarzen schmückte sich mit einem leuchtenden Stirnband und entblößte beim Lächeln einen Goldzahn. Einer der Weißen hatte eine rote Narbe am Hals. Beide Frauen waren dunkelhaarig und blass. Alle legten ihre Waffen – mehrere Pistolen, zwei Schrotflinten, ein Browning Halbautomatikgewehr – in der Mitte des Kreises auf den Boden. Dann fassten sie sich an den Händen, und Olivia stimmte ihren Schlachtruf an.
»Wir sind das neue Amerika«, intonierte sie mit Betonung auf der letzten Silbe und erfreute sich an ihrer eigenen Rhetorik. »Schwarz oder braun, rot, weiß oder gelb, Frau oder Mann oder Kind – wir sind alle gleich. Wir sind aus der Asche des Alten entstiegen. Wir sind die Phönix-Brigade, die Fackelträger der neuen Gesellschaft. Wir erheben uns gegen die Faschisten-, Rassisten-, Sexistenschweine, unsere kriegs- und geldgeilen Väter, wir läuten das neue Zeitalter ein. Heute ist Tag eins der neuen Welt. Die Welt, die wir mit Waffen und Patronen aus dem korrupten Kadaver dieser stinkenden Gesellschaft erschaffen. Die Zukunft gehört uns, den Verfechtern wahrer Gerechtigkeit. Wir sind das neue Amerika!«
Die ganze Gruppe fiel in den Refrain ein: »Wir sind das neue Amerika!«
»Die Zukunft ist?«
»Unser.«
»Heute ist?«
»Tag eins!«
»Wir sind?«
»Die Phönix-Brigade!«
»Wir bringen?«
»Waffen und Patronen!«
»Die Zukunft gehört?«
»Uns!«
»Tod den Schweinen!«
»Tod den Schweinen!«
Olivia hielt ihre Pistole in die Höhe und schüttelte sie über dem Kopf in der Luft. »Gut so!«, rief sie. »Gut so!«
Einen Moment lang blickten alle schweigend zu Olivias hochgereckter Pistole auf. Dann ließ eine der Frauen die Hände sinken und murmelte ein leises »Entschuldigt mich!«. Die Frau trat eilig über den Haufen Waffen und drängte im Eilschritt auf der anderen Seite durch den Kreis. Auf ihrem hastigen Weg durch den Flur zur Toilette patschten die Sohlen ihrer Sportschuhe auf dem Linoleum, dann knallte eine Tür zu.
Die anderen starrten ihr aus dem Wohnzimmer hinterher.
Olivia ergriff als Erste das Wort: »Hey, Mathemann, du siehst wohl mal besser nach deiner Lady«, sagte sie in beißend spöttischem Ton.
Einer der bärtigen Männer trat aus dem Kreis und eilte den Flur entlang zur Toilettentür. »Meg«, flüsterte er. »Kannst du mich hören? Alles in Ordnung bei dir?«
Hinter ihm löste sich die Gruppe auf. Die Waffen wurden aufgehoben und sicher verstaut. Aus der Küche, in der das Frühstück gerichtet wurde, war Gelächter zu hören.
Der Bärtige hörte, wie sich die Frau übergab.
»Meg, komm schon! Alles klar?«, flüsterte er wieder.
Er hatte nicht gemerkt, dass jemand hinter ihm stand, und so zuckte er zusammen, als er die Stimme hörte.
»Vielleicht ist deine Lady noch nicht so weit, he, Mathemann?«
Der Bärtige wirbelte herum und erwiderte in äußerst angespanntem Ton: »Ich sagte bereits, sie schafft das! Du hast mich gefragt, du hast meine Antwort gehört! Sie steht genauso hinter unserer Sache wie jeder andere auch. Sie versteht sehr wohl, weshalb wir hier sind! Also gib endlich Ruhe, Tanya!«
»Ihr müsst euch innerlich reinigen«, fuhr Olivia in kühlem, doch unvermindert spöttischem Ton fort. »Ihr müsst eure sämtlichen alten bourgeoisen Ideen über Bord werfen und sie durch reines revolutionäres Feuer ersetzen.«
»Wie oft soll ich dir noch sagen, dass wir bereit sind!«
»Ich glaube, du bist das schwache Glied, Mathemann. Dir geistert immer noch all das im Kopf herum, was du an dieser Uni gelernt hast. Du hast immer noch was von dem kleinen College-Jungen an dir, der Revolution spielt.«
»Hör zu, Tanya, ich spiele gar nichts, und ich wünschte, du würdest mich endlich in Frieden lassen. Wir sind da, richtig? Ich bin nicht mehr der nette kleine Mathematikstudent. Das habe ich alles hinter mir gelassen. Du kannst es nicht lassen, mich daran zu erinnern. Wir haben das jetzt schon einige Male durchgespielt, und es geht mir allmählich mächtig auf den Geist. Das College war einmal. Ich bin damit fertig. Phönix ist für mich genauso real wie für dich. Schließlich bist du auch nicht als Revolutionärin auf die Welt gekommen, verflucht noch mal.«
»Nein«, erwiderte Olivia im selben ungerührten, bitteren Ton, »ich war mal ein Schwein, aber ich bin es nicht mehr, ich habe der Bewegung alles gegeben. Deshalb habe ich diesen Namen angenommen, deshalb würde ich, wenn es heute so weit wäre, glücklich sterben. Könntest du glücklich sterben, Mathemann? Was hast du aufgegeben? Sundiata und Kwanzi kennen die Schweine immer noch mit ihrem alten Gefängnisnamen, aber wir benutzen nur ihre Namen als Revolutionäre. Und die sind bereit, zu sterben. Sie haben den Kampf im Ghetto hinter sich, sie würden nicht zögern, ihr Leben in diesem Krieg zu lassen. Dasselbe gilt für die anderen beiden, Emily und Bill Lewis – hübsche, normale amerikanische Namen, nicht wahr? –, nur dass sie jetzt Emma und Ché sind. Die sind echte Soldaten. Keiner von denen spielt Theater. Aber ihr beide, über euch mache ich mir Sorgen.«
»Könntest du dir vielleicht die Rhetorik sparen?«
»Das sagt der Richtige. Denn was anderes haben wir von dir bis jetzt noch nicht gehört. Du redest immer nur – wie oft du schon Tränengas und Prügel abbekommen hast und festgenommen worden bist. Wo sind die Narben, Mathemann? Wir werden ja sehen. Jetzt hast du die Chance, zurückzuschlagen, frage mich nur, ob du den Mumm dazu hast. Schluss mit dem pazifistischen Gesülze, Schluss mit den Sonntagsreden und dem braven zivilen Ungehorsam! Es herrscht Krieg! Sie haben es nicht anders gewollt, sollen sie ihn haben.«
»Muss ich erst sterben, um mich zu beweisen?«
»Du wärst nicht der Erste.«
Er zögerte.
»Ich hab’s dir oft genug gesagt. Wir sind bereit. Wir werden tun, was nötig ist.«
»Wir werden ja sehen, und zwar bald.«
Olivia funkelte den Bärtigen an – so groß, wie sie war, fast auf Augenhöhe. Dann lachte sie verächtlich. Bevor der Bärtige etwas sagen konnte, machte sie auf dem Absatz kehrt und verschwand im Schlafzimmer an der Rückseite der Wohnung. Der Bärtige warf ihr einen ebenso wutentbrannten Blick hinterher. »Die glaubt, es dreht sich alles nur um sie«, murmelte er leise. Doch innerlich fügte er hinzu: Und sie hat recht.
Er drehte sich wieder zur Toilettentür um. »Meg, hey, alles klar?«
Er hörte die Klospülung, und wenig später öffnete sich die Tür.
Sie war bleich und zitterte.
»Tut mir leid, Duncan, mir ist schlecht geworden. Die Nerven vermutlich. Keine Angst, das wird schon. Sag mir einfach nur, was ich machen soll.« Sie starrte den Flur entlang, durch den Olivia eben verschwunden war. »Du weißt ja, wie ich dazu stehe. Aber ich tu, was du sagst.«
»Hör mal, wir sind alle nervös. Heute ist ein wichtiger Tag.«
»Ich schaff das schon.«
»Es gibt bestimmt keine Probleme. Weißt du, das ist im Grunde nicht mehr als eine symbolische Geste. Und außerdem kommt sowieso niemand zu Schaden, also sei nicht nervös.«
Doch sie wusste, dass es nicht die Nerven waren. Sie wusste, dass sich Leben in ihr regte, und für einen Augenblick hatte sie das Gefühl, dies sei der richtige Zeitpunkt, um es ihm zu sagen. Nein, dachte sie, nicht hier, nicht jetzt. Aber wann? Die Zeit wurde knapp.
Megan hob die Hand und streichelte ihm die Wange. »Bei dir alles in Ordnung?«
»Sicher, wieso nicht?«
»Nur so ein Gedanke.«
»Weshalb fragst du? Ich meine, was sollte denn nicht in Ordnung sein?«
Sie sah ihn einfach nur an.
»Gottverdammt«, flüsterte er wütend, »jetzt fang du nicht auch noch an. Wir ziehen das durch. Wir haben es ausdiskutiert, Punkt. Ich hab die Protestmärsche satt. Sie haben nicht das Geringste gebracht. Das hatten wir alles schon, immer und immer wieder. Die einzige Sprache, die die Machthabenden in dieser Gesellschaft verstehen, ist Gewalt – der Kampf mit ihren eigenen Waffen. Also triff sie ins Mark. Vielleicht ändern sie dann endlich was. Das ist der einzige Weg.«
Er schwieg einen Moment, dann fügte er hinzu: »Es ist das einzige Zeichen, das sie verstehen. Das sie nicht ignorieren können. Es ist ein notwendiges Übel.«
Es dauerte eine Weile, bis sie ruhig erwiderte: »Na schön. An Veränderungen zu glauben ist eine Sache. Aber wenn du wie Tanya klingst, habe ich ein Problem damit. Das bist nicht du.«
Er stöhnte frustriert.
»Das hatten wir doch schon.«
Sie nickte.
»Verdammt, nicht jetzt. Nur bitte nicht jetzt!«
Er packte sie bei der Schulter, nicht im Zorn, sondern nur, um sie auf Abstand zu halten. Sie legte die Arme um ihn. »Nicht jetzt«, flüsterte er. »Mein Gott«, fügte er hinzu. »Ich hätte dich nie hierher mitbringen dürfen. Das hier ist nicht deine Welt. Ich hab’s im Grunde gewusst.«
»Meine Welt ist da, wo du bist«, antwortete sie. Und lachte. »Junge, klingt das schmalzig.« Sie wusste, dass ihm der Witz dabei helfen würde, sich zu entspannen. Sie sah die Anspannung in seinen Augen. Sie hoffte, dass sie von Zweifeln herrührte. Ich muss hier irgendwie raus, dachte sie. Ich muss uns beide hier rausholen.
Nach einer Weile ließ er sie los. »Komm, essen wir was«, schlug er in normalem Ton vor. Er legte seine Hand unter ihr Kinn.
Sie schüttelte den Kopf. »Ich glaube, ich hab keinen Appetit.« Sie schwieg, als dächte sie nach. »Komisch«, fügte sie hinzu. »Wenn ich’s mir richtig überlege, könnte ich einen Ochsen vertilgen. Mit Schlagsahne, wenn’s geht.«
»Zum Frühstück?« Er lachte.
»Komm«, sagte sie und nahm ihn bei der Hand. Doch ihr Lächeln verdeckte nur die tiefe blanke Angst, die sie bedrängte: Sag es ihm. Jetzt ist alles anders. Es geht nicht mehr nur um uns.
Doch sie fand weder den richtigen Zeitpunkt noch die richtigen Worte.
Olivia Barrow stand vor der kleinen Frisierkommode im hintersten Schlafzimmer und betrachtete sich im Spiegel. Sie hatte sich das Haar kurz geschnitten, was ihrem Gesicht schärfere Konturen verlieh. Sie musterte ihre Züge, die gerade Nase, die hohen Wangenknochen und die breite Stirn, die ihre Mutter so unwiderstehlich gefunden hatte, dass sie ihr, wenn sie vor dem Spiegel in ihrem Rücken stand, immer wieder über den Kopf streicheln und ihr versichern musste, sie sei zweifellos einmal auf jeder Party, zu der sie gehen würde, das hübscheste Mädchen. Sie grinste: Gewiss hatte ihre Mutter dabei nicht an die Art von Party gedacht, die sie heute veranstalten würde. Ihr kam die Modelagentur in den Sinn, die in ihrem ersten Jahr am College versucht hatte, sie unter Vertrag zu nehmen, und sie schnaubte verächtlich. Ich brauche eine Narbe, dachte sie, irgendein entsetzliches, leuchtend rotes Markenzeichen, das sich mitten durch dieses hübsche Gesicht zieht wie ein Riss durch das vollendete Bild eines Malers. Ich wäre besser pummelig und unscheinbar. Aus mir wäre besser ein unförmiges Hippiemädchen mit strähnigem Haar, Hängebusen und schlaffem Hintern geworden, das seine Mantras über Frieden, Liebe und Blumen singt und so aussieht, als hätte sie nichts anderes im Sinn als den nächsten LSD-Rausch. Dann würde ich leichter durchs Raster rutschen.
Doch sie war sich ebenso der Stärke bewusst, die die Schönheit ihr verlieh. Sie beugte sich vor und berührte zuerst ihre Zehen, bevor sie in derselben Haltung die flachen Handflächen auf den Boden legte. Es war wichtig, physisch fit zu sein.
Ihre Mutter war Tänzerin gewesen. So oft hatte sie ihr dabei zugesehen, wie sie in ihrem Ballettstudio in die Höhe sprang, Pirouetten drehte und in der Luft weite Sätze machte. Sie war immer stark gewesen. Olivia merkte, wie in ihr eine Woge der Wut aufstieg. Wieso hatte sie nicht gekämpft? Wieso hatte sie diesen schleichenden Tod einfach hingenommen? Fassungslos hatte sie mit ansehen müssen, wie der Krebs ihre Mutter zunehmend schwächte und in ein armseliges Geschöpf verwandelte. Olivia hasste die Erinnerung. Sie hasste die Niederlage, das hilflose Gemurmel der Ärzte. Und sie hasste es, wie sich ihr Vater dem Schicksalsschlag tatenlos gefügt hatte.
Sie fragte sich, was er gerade tat. Wahrscheinlich hockte er in diesem muffigen Arbeitszimmer in der Wohnung am Washington Square und las in juristischen Wälzern und wappnete sich für das nächste Gefecht zugunsten einer weiteren hoffnungslosen Sache, bei der das Scheitern vorprogrammiert war. Mein Vater, dachte sie nicht ohne einen Anflug von Sympathie, führt die Lanze der Gerechtigkeit immer wieder gegen Windmühlenflügel. Falls keine würdige Sache zur Hand ist, für die es sich in seinen Augen zu streiten lohnt, dann zieht er aus und findet eine.
Auf eine eigentümliche Weise hasste und liebte sie ihn zugleich. Sie war sich dessen bewusst, wie viel sie von ihm gelernt hatte, wie nachhaltig sie sein Engagement beeinflusst hatte. Von ihm hatte sie gelernt, dass ein Leben ohne Leidenschaft und Überzeugung eine nichtssagende, kalte Existenz darstellte. Er hatte ihr klargemacht, dass man einen intelligenten Kopf an seiner Tatkraft, seinem sozialen Gewissen und der Kampfbereitschaft erkennt. Ihre Wohnung in Greenwich Village hatte ständig von Songs der einen oder anderen Bewegung widergehallt. In der Erinnerung kam es ihr so vor, als ob sie damals jede Nacht in den Armen ihres Vaters erwacht sei, der sie aus ihrem winzigen Zimmer auf ein Tagesbett im Schlafzimmer ihrer Eltern trug, um für irgendeinen wichtigen Besucher – gewöhnlich mit Bart und gewöhnlich mit einer Gitarre bewaffnet – Platz zu machen. Mein erstes Opfer für den Kampf.
Als die anderen in der dritten Klasse von Schweinchen Wilbur und seine Freunde und Der Wind in den Weiden