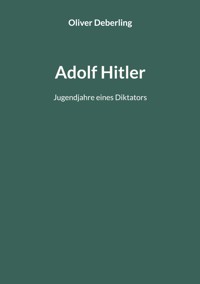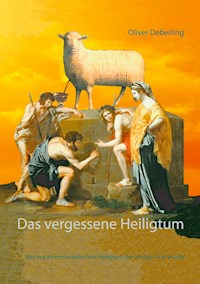
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Gibt es seriöse Belege dafür, dass die Erde vor vielen Jahrtausenden von einer außerirdischen Zivilisation besucht wurde? Warum finden sich in alten Mythen Schilderungen von himmlischen Städten und fliegenden Wagen, die sogar technische Einzelheiten enthalten? Warum wird der Heilige Gral mitunter wie ein technisches Relikt beschrieben, das bei unsachgemäßer Behandlung Unfälle und Verbrennungen verursachen kann? Weshalb erwähnt der Gralsdichter Wolfram von Eschenbach in seinem Parzival, dass der Gral einst von einer »Schar« von den Sternen zur Erde gebracht wurde? Warum wird der Gral auf zahlreichen uralten Bildern mit einem bestimmten Ort in Südwestfrankreich verknüpft? Oliver Deberling findet höchst erstaunliche Antworten auf diese Fragen. Er begibt sich auf die Spurensuche nach einem Gegenstand, der nicht von dieser Welt stammen soll, der seit Jahrtausenden als Heiligtum verehrt durch die Menschheitsgeschichte »geistert« und im Mittelalter zum später christlich umgedeuteten Heiligen Gral wurde. Was ans Licht kommt, ist eine Sensation.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 738
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Vorwort des Autors
Auftakt: Das Geheimnis des Genter Altars
I. Ein seltsamer Schatz
II. Das Vermächtnis der Tempelritter
III. Der Heilige Gral
IV. Der Ursprung der Gralssage
V. Das israelische Heiligtum
VI. Die heilige Maschine
VII. Rätselhafte Technologien
VIII. Bundeslade und OThIQ IMIM
IX. Rätselhafte Bilder
X. Das Idol der Tempelritter
XI. Das Versteck
Anhang
Google Earth Koordinaten
Bildnachweis
Quellennachweise
Quellen und zusätzlich verwendete Literatur
Vorwort des Autors
Mit meinem Buch »Das Gralsrätsel«, das im Jahre 2013 erschien, glaubte ich, das Endergebnis meiner langjähriger Studien zu den historischen Hintergründen der Sage vom Heiligen Gral vorgelegt zu haben. Doch selten hatte ich mich mehr getäuscht. In den Monaten nach meiner Buchveröffentlichung machte ich zahlreiche hochinteressante Entdeckungen und stieß auf neue Zusammenhänge und Quellenbelege, die viele der zuvor offengebliebenen Fragen überzeugend beantworteten.
Als die Rechte meines Werkes 2016 wieder an mich zurückfielen, nahm ich dies zum willkommenen Anlass dafür, unter einem neuen Titel eine überarbeitete und stark erweiterte Buchfassung herauszugeben, in die alle zusätzlichen Erkenntnisse einfließen konnten. Das Resultat ist eine umfangreiche Abhandlung, die ein neues Bild vom Ursprung der Gralssage vermittelt, das allen gängigen Ansichten vollkommen widerspricht; ein Gesamtbild, das ein uraltes Heiligtum betrifft, welches seit Jahrtausenden mit unterschiedlichen Namen und in verschiedenen Mythen durch die Menschheitsgeschichte »geistert« und unsere Vorstellungen von der menschlichen Vergangenheit in ein faszinierendes Licht taucht.
Ich habe mich darum bemüht, die erstaunlichen Fakten so systematisch und verständlich wie möglich darzustellen, jeweilige Gegenargumente zu beachten und alle verwendeten Quellen nach wissenschaftlichen Maßstäben sorgfältig aufzulisten. Wenngleich die vorgebrachten Forschungsergebnisse auch auf Kritik stoßen werden, bin ich aufgrund überwältigender Indizienbeweise von deren Richtigkeit zutiefst überzeugt.
Oliver Deberling
Für meine Mutter
Auftakt
Das Geheimnis des Genter Altars
Ein junger Mann schlich lautlos durch das nächtliche Gent. Er beabsichtigte, noch vor der Morgendämmerung einen Einbruch zu begehen, und war deshalb sehr erleichtert darüber, dass ihm niemand begegnete. Die schmalen Gassen der flämischen Stadt wirkten wie ausgestorben, nicht einmal hinter den Wohnungsfenstern des Kathedralenviertels brannte noch Licht. Nur die alte Kathedrale St. Bavo zeigte sich hell erleuchtet, obwohl sie seit Stunden geschlossen war und längst hätte abgedunkelt sein müssen. Beim Näherkommen sah er zwei Gestalten, die eifrig damit beschäftigt waren, eine große Holztafel in einem Chevrolet zu verstauen, den sie in der Kapittelstraat, einer Straße unweit des Gotteshauses, geparkt hatten. Die Männer schienen sich vor irgendetwas zu fürchten, denn sie drehten sich immer wieder um und musterten nervös ihre Umgebung. Als der heimliche Zuschauer sein Misstrauen überwunden hatte, auf die beiden Unbekannten zuging und ihnen seine Hilfe beim Anschieben des defekten Fahrzeugs anbieten wollte, benahmen sie sich plötzlich ziemlich seltsam, gaben ihm hastig ein viel zu großes Trinkgeld und scheuchten ihn unfreundlich fort.
Erst einige Jahre später, nachdem der nächtliche Beobachter wegen eines Diebstahls selbst ins Visier der Polizei geraten war und ihm die Behörden für sachdienliche Aussagen Strafmilderung und öffentliche Anonymität zugesichert hatten, gab er seine damaligen Erlebnisse zu Protokoll. Der junge Einbrecher war in den frühesten Morgenstunden des 11. April 1934 zum unfreiwilligen Kronzeugen des geheimnisvollsten Kunstraubs der belgischen Kriminalgeschichte geworden und hatte den Diebstahl zweier Bildtafeln des mehrteiligen Genter Altargemäldes der Gebrüder van Eyck aus unmittelbarer Nähe miterlebt.
Obgleich das dreiste Verbrechen ungeheures Aufsehen erregte und die belgischen Ermittlungsbehörden sogar Scotland Yard um Unterstützung baten, verliefen alle Nachforschungen zunächst völlig ergebnislos. Eine Wende des Falles zeichnete sich erst im Mai 1934 ab. Zu diesem Zeitpunkt erhielt der Genter Bischof einen mit »D.U.A.« unterzeichneten Brief, in dem ein Erpresser eine Million Belgische Franc für die Rückgabe der Altartafeln forderte. Unter der Voraussetzung, dass Bischof Coppieters mit einer Lösegeldzahlung einverstanden sei, sollte zuerst die Bildtafel mit Johannes dem Täufer zurückgegeben werden. Nachdem der Bischof seine Zustimmung durch ein abgesprochenes Zeitungsinserat signalisiert hatte, wurde ihm ein Beleg der Gepäckaufbewahrung des Brüsseler Nordbahnhofes zugesandt, wo das Bildnis mit Johannes dem Täufer tatsächlich aufgespürt werden konnte.1 Die belgischen Behörden deuteten die Rückgabe des Meisterwerkes jedoch vorschnell als Schwächeeingeständnis der Erpresser und gaben dem Genter Bischof den dringenden Rat, die Zahlung des vereinbarten Lösegeldes zu verweigern. Eine Übergabe der Gerechten Richter, des zweiten gestohlenen Bildes, war damit endgültig unmöglich geworden, wenngleich die Kunsträuber ihre Forderung mit 13 Briefen zu untermauern versucht hatten.
Die Gerechten Richter
Der Tod des in Wetteren bei Gent ansässigen Finanzagenten Arsène Goedertier brachte den Kriminalfall wieder ins Rollen und warf ein völlig neues Licht auf das Verbrechen. Der nach einem Herzinfarkt im Sterben liegende Goedertier hatte seinem Rechtsanwalt zu verstehen gegeben, er allein wisse, wohin die verschwundene Bildtafel des Genter Altars gebracht worden sei. Im Hinüberdämmern wies er auf seinen Schreibtisch, wo man neben den Kopien der 13 Erpresserbriefe auch ein Schriftstück entdeckte, in dem Goedertier erklärt, das gesuchte Gemälde sei nicht gestohlen, sondern an einen Ort umgehängt worden, von dem es nur der Bischof selbst ungesehen entfernen könne.2
Während die Beteiligten noch über die Bedeutung der eigenartigen Hinweise rätselten, erhärteten weitere Indizien den Tatverdacht gegen Goedertier. Die Schreibmaschine, mit der die sonderbare Botschaft und die 13 Erpresserbriefe geschrieben worden waren, hatte der Finanzagent unter dem Falschnamen »Arsène van Damme« gemietet, dessen umgedrehtes Kürzel »D.U.A.« wiederum als Signum für die Lösegeldforderungen verwendete wurde. Er war allerdings so umsichtig gewesen, das »V« nach seiner früheren lateinischen Verwendung mit einem »U« zu ersetzen und damit alle irgendwie denkbaren Verbindungen zu verwischen.
Anstatt die Polizei über die Sachlage zu informieren, trommelte Goedertiers Rechtsanwalt die vier höchsten Richter Belgiens zusammen, die nun ihrerseits monatelang auf eigene Faust ermittelten und dabei sämtliche Vorschriften und Dienstwege außer Acht ließen.3 Immerhin war es gelungen, Goedertiers Cousin Achille de Swaef und dessen Schwager Oscar Lievens als Mittäter zu identifizieren. Die Polizei hatte gleichwohl keine Gelegenheit mehr dazu gehabt, die beiden Männer über die Hintergründe des Diebstahls zu befragen, denn de Swaef starb am 29. November 1934, gerade einmal fünf Tage nach dem Ableben Goedertiers, an den Folgen eines angeblichen Schlaganfalls, während ihm sein Schwager Oscar Lievens bereits am 5. März 1935 in den Tod folgte. Lievens, der laut Totenschein einer starken Magenblutung erlegen war, wurde in einer blutverschmierten Wohnung unweit eines ausgehängten Telefons aufgefunden und vermittelte nicht unbedingt den Eindruck, das Opfer einer tragisch verlaufenen Erkrankung geworden zu sein.4
Das vorzeitige und reihenweise Ableben der mutmaßlichen Komplizen führte schnell zu weiteren Spekulationen und Verschwörungstheorien: Wurden die Beschuldigten ermordet, weil sie zu viel über die Hintermänner des Diebstahls wussten? Ist die Tat ein Coup gewesen, der von verborgenen Drahtziehern in Auftrag gegeben worden war? Hatten Goedertier und seine Mittäter vorgehabt, ihre Auftraggeber zu hintergehen, und waren deshalb ermordet worden? Einen derartigen Verdacht äußerten zumindest die Angehörigen der drei Tatbeteiligten gegenüber der Polizei. In der Absicht, ihren Mann zu entlasten, verstieg sich Goedertiers Witwe am Ende sogar zu der Behauptung, die Verdächtigen hätten bloß auf höhere Anweisung gehandelt.5
Die belgischen Behörden machten sich daran, den genauen Hergang des Verbrechens zu rekonstruieren. Es erwies sich, dass die Täter fundierte Kenntnisse über das Altarwerk besaßen. Sie mussten in Erfahrung gebracht haben, dass die wie Klappschultafeln drehbaren Flügelrahmen des Genter Altars nur zwei Bilder enthielten, die unbefestigt in den jeweiligen Rahmenhaltungen hingen, denn genau diese zwei Bildtafeln waren gestohlen worden, während man die übrigen Kunstwerke ignoriert und nicht einmal angerührt hatte. Merkwürdigerweise fand man lediglich Ausbruchsspuren und keinerlei Einbruchsspuren. Die Täter hatten sich also unerkannt einschließen lassen, um später mit jenem Bild auszubrechen, das sie in ihrem Chevrolet verstaut hatten und das danach in der Gepäckaufbewahrung des Brüsseler Nordbahnhofes hinterlegt worden war.
Alles war genauso vonstattengegangen, wie es der anonym gebliebene Kronzeuge, der junge Einbrecher, bei der Polizei zu Protokoll gegeben hatte. Wo aber hatte man die verschwundene Bildtafel mit den Gerechten Richter[n] versteckt? War das vermisste Gemälde, von dem Arsène Goedertiers behauptete, es sei nicht wirklich gestohlen worden, womöglich noch innerhalb der Kathedrale zu finden?
Die geöffnete Festtagsseite des Genter Altars, Gent, St. Bavo
Die Ermittler wollten sich nicht allein auf die Aussagen Arsène Goedertiers verlassen und ließen sein Wohnhaus in Wetteren buchstäblich auf den Kopf stellen und ergebnislos zerlegen. Die Polizei stand vor einem unlösbaren Rätsel. Das wertvolle Meisterwerk blieb trotz aller Suchanstrengungen unauffindbar und musste notwendigerweise durch eine aufwendig hergestellte Kopie ersetzt werden. Seit 1944 ist in der Taufkapelle der Kathedrale St. Bavo eine exakte Rekonstruktion der Malerei zu sehen, die mit Hilfe alter Fotos und Gemäldekopien angefertigt werden konnte.
Bereits um die Entstehungsgeschichte des Genter Altars ranken sich viele Rätsel und Legenden. So wurde vielfach angezweifelt, dass neben Jan van Eyck auch dessen Bruder Hubert an dem großartigen Werk mitgearbeitet hat. Eine am unteren Rahmen der Flügelaußenseiten angebrachte Inschrift, die Hubert van Eyck als Jans Bruder ausweist und darüber hinaus behauptet, Jan habe die von seinem Bruder begonnene Arbeit nur vollendet, wurde wahrscheinlich erst im Nachhinein hinzugefügt und ist daher von fragwürdiger Beweiskraft. Ausführliche Stilanalysen belegen allerdings glaubhaft, dass der Genter Altar von zwei Künstlern mit ähnlicher Stilführung geschaffen wurde. Eine Mitarbeit Hubert van Eycks wurde außerdem von Antonio de Beatis, dem Sekretär des Kardinals von Aragon, schon im Jahre 1517 bezeugt.6
Oben: Das Hauptbild des geöffneten Genter Altars. In der Bildmitte der Schrein mit dem verwundeten Lamm und den knienden Engeln im Vordergrund. Unten: Das Lamm mit dem Blutkelch (Bildausschnitt)
Auch hinsichtlich seiner Motive gilt der vom Genter Patrizier Jodocus Vijd in Auftrag gegebene Altar als eines der großen Geheimnisse der Kunst- und Religionsgeschichte. Tatsächlich verbirgt die aufgeklappte Festtagsseite des Flügelaltars viele merkwürdige Symbole, die bislang nicht hinreichend gedeutet werden konnten. Die obere Bildreihe des geöffneten Altars repräsentiert die gesamte Heilsgeschichte von Adam und Eva über Maria und Johannes den Täufer bis zu Christus, der als endzeitlicher Weltenrichter gemäß den Prophezeiungen der Offenbarung des Johannes, des letzten Buches der christlichen Bibel, ein blutrotes Gewand trägt.
Die Anbetung des mystischen Lamms, das Hauptbild des geöffneten Altars, widmet sich den Schlussszenen der Offenbarung des Johannes und dem Einzug der Gerechten aus allen Nationen. Im Zentrum der Anbetung des mystischen Lamms erhebt sich in freier Landschaft ein altarartiger Schrein, auf dem ein goldener Kelch steht, in den sich das Blut eines verwundeten Lammes ergießt. Christus, der als geopfertes Lamm auftritt, wird auf dem Bild von vier großen Personengruppen eingerahmt, während zwei im Vordergrund kniende Engel an langen Ketten gehaltene Weihrauchgefäße schwenken. Auffällig ist, dass sich die Gebrüder van Eyck lediglich bei der Darstellung des Lammes nicht an die Schilderungen der Offenbarung gehalten haben. Das Lamm erscheint nicht wie in Offenbarung 4.6 beschrieben im Zusammenhang mit einem göttlichen Thron; es steht auf einem Altarschrein und lässt sein Blut in einen deutlich hervorgehoben Kelch fließen, der im letzten Buch des Neuen Testaments gleichfalls unerwähnt bleibt. Jan und Hubert van Eyck haben den biblischen Rahmen dergestalt verändert, dass sie einen Kelch einfügten, der als Hinweis auf die Eucharistie, das christliche Abendmahl, zu verstehen war und zugleich als Andeutung auf den Heiligen Gral aufgefasst werden konnte, auf jenes Gefäß, das nach spätmittelalterlichen Vorstellungen das Blut Christi aufgefangen hat.
Viele Symbole des 1432 vollendeten Altarbildes haben einen versteckt antikirchlichen und nahezu »häretischen« Inhalt. Im Vordergrund des Hauptbildes der Festtagsseite erkennt man einige kirchliche Würdenträger, die sich seltsamerweise vom Lamm und damit von Christus abwenden. In der unteren Bilderreihe zeigt die zweite der links angebrachten Bildtafeln eine Gruppe von Rittern, die eine Inschrift auf der unteren Rahmung als »CHRISTI MILITES« (»Streiter Christi«) ausweist und die mit ihrem roten Kreuz auf weißem Grund und ihrer Tatzenkreuz-Fahne als eine Anspielung auf den Tempelritterorden gedacht sind.
Die Streiter Christi
Die Tatsache, dass auf der Altartafel genau neun Reiter zu sehen sind, scheint ebenfalls kein Zufall zu sein, denn der Tempelritterorden soll um das Jahre 1120 von genau neun Männern gegründet worden sein. Als zusätzlicher Hinweis auf den Tempelritterorden kann eine im 16. Jahrhundert angebrachte Inschrift dienen, die den Tag der Vollendung des Altarwerkes anscheinend mit Vorbedacht auf den 6. Mai 1432 verlegt, den 120. Jahrestag der Verkündigung der päpstlichen Bulle (Siegelurkunde) Considerantes dudum, mit der Papst Clemens V. die Mitglieder des Ordens verurteilt hatte und nur bei »aufrichtiger Reue« eine Absolution in Aussicht stellte.7
Bereits die Zeitgenossen Jan und Hubert van Eycks mögen sich gefragt haben, was die vorgeblich ketzerischen Ritter Christi auf einem Altarbild zu suchen haben, das angeblich genau 120 Jahre nach der Auflösung ihrer Gemeinschaft vollendet worden sein soll.8 Und so beflügelten die ungewöhnlichen Andeutungen auf dem Genter Altar über Jahrhunderte hinweg die Phantasie von Abenteurern und Schatzsuchern, zu denen auch führende deutsche Nationalsozialisten gehörten. Als Adolf Hitlers Truppen im Mai 1940 Belgien eroberten, versuchte eine deutsche Spezialeinheit, den Genter Altar handstreichartig zu okkupieren und seine Bildtafeln nach Deutschland abzutransportieren. Sie kam allerdings zu spät, denn das Meisterwerk war bereits auf dem Weg nach Südfrankreich, wo es aber bald von deutschen Soldaten entdeckt wurde. Der beschlagnahmte Genter Altar wurde zunächst im Schloss Neuschwanstein zwischengelagert, später ins Salzbergwerk Altaussee gebracht und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges den ursprünglichen Besitzern zurückerstattet.
Der naheliegende Verdacht, dass die Nationalsozialisten schon vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges darum bemüht waren, die Bilder des Genter Altars in ihren Besitz zu bringen, dass sie Arsène Goedertier bereits 1934 mit dem Diebstahl der beiden Bildtafeln beauftragten und ihn alsbald ermorden ließen, weil er und seine Freunde, anstatt die Kunstwerke auszuhändigen, den Genter Bischof zu erpressen versucht hatten, lässt sich trotz der geschilderten Zusammenhänge und mysteriösen Ereignisse weder schlüssig beweisen noch glaubwürdig widerlegen. Belegen lässt sich hingegen, dass das merkwürdige Interesse für den Genter Altar offensichtlich in Verbindung mit einer alten Legende stand, nach der das Altarbild den Schlüssel zum Verbleib des Heiligen Grals enthält. Schon in den 1930er Jahren begann das später in die SS eingegliederte Forschungsamt Ahnenerbe, sich mit dem Kunstwerk zu beschäftigen. Die 1935 offiziell gegründete Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe hatte es sich ursprünglich zur Aufgabe gemacht, wissenschaftliche Belege für die Überlegenheit der arischen Rasse zu finden. Recht schnell rückten dann aber eher okkulte Themen ins Zentrum der Aktivitäten. Unter der Leitung des Reichsgeschäftsführers Wolfram Sievers befassten sich verschiedene Forschungsabteilungen mit so ungewöhnlichen Dingen wie dem Atlantismythos und dem Verbleib des Heiligen Grals. Gerade im Zusammenhang mit dem Heiligen Gral begannen die Wissenschaftler des Ahnenerbe, sich intensiver mit dem Genter Altar zu beschäftigen.9 Bald expandierte die Forschungsgemeinschaft ganz erheblich. Sie verfügte über große Bibliotheken, mehrere Archive und sogar eigene Fotolabore. Man begann, systematisch mittelalterliche Dokumente und Handschriften nach Belegen für den Verbleib des Grals zu durchforschen, und sicherte sich die Mitarbeit des bekannten Gralsexperten Otto Rahn, der auf Befehl Himmlers zum SS-Obersturmbannführer befördert worden war. Rahn hatte zwei populäre Bücher über die Hintergründe der Gralslegende verfasst und vertrat vehement die Auffassung, dass die Katharer, eine christliche Sekte, die im 13. Jahrhundert von der römischen Kirche in Südfrankreich blutig verfolgt wurde, die wahren Hüter des Grals gewesen seien. Rahn unternahm ausgedehnte Reisen durch Südfrankreich und sammelte Indizien, die seine These zu unterstützen schienen. Akribisch beschrieb er die Stationen seiner Streifzüge und zeichnete alles auf, was ihm die Einheimischen über die Katharer und den Gral berichtet hatten.10 Rahn blieb jedoch nicht die Zeit, sein großes Lebenswerk, ein umfassendes Buch über die Geschichte des Grals, zu vollenden. In der Nacht des 14. März 1939 starb er unter mysteriösen Umständen in der Nähe des Gehöftes Rechau bei Kufstein. Weil seine sterblichen Überreste erst am 11. Mai 1939 gefunden wurden, war die genaue Todesursache nicht mehr zu ermitteln. Die Behörden gingen schließlich von einem Selbstmord aus, der aber nie zweifelsfrei bewiesen werden konnte. Da Rahns Mutter einen Großteil der Aufzeichnungen ihres Sohnes vernichtete, lassen sich nur noch Vermutungen darüber anstellen, was er letztendlich über die Hintergründe der Gralslegende herausgefunden hatte. Ob sich Rahn bei seinen Nachforschungen überhaupt mit dem Mysterium des Genter Altars beschäftigte, bleibt dabei mehr als fraglich.
Der Verdacht, dass der Gralsforscher mehr wusste, als er seinen Büchern anvertraute, ist immerhin nicht ganz unbegründet. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges durchstreiften archäologische Erkundungstrupps der SS systematisch große Teile Südwestfrankreichs. Eine vergebliche Suchaktion der SS im Gebiet der »Gorges de la frau« (»Schlucht des Schreckens«) erregte 1943 bei der Bevölkerung einiges Aufsehen, und selbst noch im Jahre 1944, kurz vor der Landung der Alliierten in Frankreich, ließ Himmler eine Sondereinheit im Languedoc ausgedehnte Grabungen durchführen. Es ist möglich, dass die Suchaktionen mit Rahns Gralsstudien im Zusammenhang standen. Viele Unterlagen des Ahnenerbes wurden kurz vor Kriegsende vernichtet, wichtige Protagonisten verweigerten jede Aussage oder waren ganz einfach geflohen. Wolfram Sievers, der Geschäftsführer des Ahnenerbes, trug seinerseits nur wenig zur weiteren Aufklärung der Ungereimtheiten bei und vermied es tunlichst, genauere Angaben hinsichtlich der Aktivitäten seiner Organisation zu machen. Wegen seiner Beteiligung an Menschenversuchen in den Konzentrationslagern Dachau und Natzweiler wurde er am 2. Juni 1948 in Landsberg am Lech hingerichtet.
Die Nationalsozialisten konnten das Mysterium um den Genter Altar trotz aller Anstrengungen nicht lösen, weil sie – wie alle übrigen Forscher – einen faszinierenden Hinweis übersehen haben, der in die Felslandschaft der Corbières führt, die in Südwestfrankreich ein Vorgebirge der Pyrenäen bilden. Hier, knapp 40 Kilometer südlich von Carcassonne, unweit des Weilers Les Pontils im Departement Aude, begegnet man einer auffälligen Felsformation, die in Wahrheit den Schlüssel zum Rätsel um den Genter Altar bereithält. Schon auf den ersten Blick ist erkennbar, dass der südlich von Les Pontils am Gebirgszug des Cardaussel gelegene Roc di Quiloutié dem Bergrücken auf dem 1934 verschwundenen Bild mit den Gerechten Richter[n] vollkommen entspricht. Die Gebrüder van Eyck gestalteten die felsige Abbruchkante sehr realistisch und mit nahezu fotografischer Präzision. Im Rücken der Gerechten Richter, der zehn abgebildeten Reiter, lassen sich noch kleinste und unverwechselbare Einzelheiten der Felsstrukturen des Roc di Quiloutié wiederfinden. Eine hervorstehende Felsnase und darunter sichtbare Felsausbuchtung wurden von den Gebrüdern van Eyck mit geradezu akribischer Genauigkeit festgehalten; lediglich ein Gebäude im Hintergrund des Berges entsprang offenbar der künstlerischen Phantasie der flämischen Maler. Selbst die Bergformationen von Les Toustounes am Bézis-Tal, die sich in südöstlicher Richtung gegenüber dem Roc di Quiloutié erheben, sind auf dem Genter Altar zu sehen.
Der neben einem fast waagerecht verlaufenden Bergkamm aufragende Felsturm von Les Toustounes gehört ausgerechnet zur Hintergrundszenerie der geheimnisvollen Bildtafel mit der Rahmeninschrift »CHRISTI MILITES« (»Streiter Christi«), auf der eine Gruppe von neun Rittern verewigt worden ist. Der Felsen der Malerei entspricht exakt der Perspektive eines Beobachters, der am Fuße der turmartigen Bergspitze steht und von dort direkt nach oben blickt. Der Umstand, dass die beiden Altartafeln trotz der exakten Darstellungsweise im Vergleich zur Landschaft um den Weiler Les Pontils in umgekehrter Reihenfolge in den Rahmen eingehängt worden sind, ist wahrscheinlich damit zu erklären, dass die Gebrüder van Eyck das Gebirgspanorama der Corbières aus eigener Anschauung überhaupt nicht kannten und sich auf ältere Detailskizzen einzelner Felspartien und Bergrücken verlassen mussten. Einige dieser erstaunlich realistisch dargestellten Berge sind wiederum im Rücken des verwundeten Lammes auf dem Hauptbild zu entdecken. Die Bergkuppen auf der rechten Seite erinnern an den flachen Gipfel des Pech Cardou und das Gelände um den Cardaussel, während der mattgraue Gebirgsrücken am linken Horizont ohne Zweifel mit dem Pech de Bugarach identisch ist, dem höchsten Berg der Corbières, der kaum zehn Kilometer südlich von Les Pontils in den Himmel ragt und mit seiner eben auslaufenden Spitze und seiner hutähnlichen Grundform eine charakteristische Gebirgsansicht bietet. Die präzise Arbeits van Eycks ermöglicht es sogar, ein Foto des Pech de Bugarach beinahe deckungsgleich über den gemalten Berggipfel zu legen und durch solche Vergleichsmethoden alle Zufallsdeutungen von vornherein auszuschließen.
Oben: Das Gebirge im Hintergrund des Lammes im Vergleich mit dem Pech de Bugarach (rechts). Die Nummern bezeichnen die Einzelübereinstimmungen. Unten: Die Umrisslinie des Pech de Bugarach (schwarz) ist nahezu deckungsgleich mit den Konturen des Gebirges im Hintergrund des Lammes (grau)
Andere Übereinstimmungen zwischen dem Altarbild und den besonderen Merkmalen der Gegend um Les Pontils sind ebenso erstaunlich und in mancher Hinsicht noch faszinierender. In unmittelbarer Nähe der beschriebenen Felsformationen, wenige Meter abseits der Departementsstraße D 613, war bis 1988 ein Grabmal zu sehen, das verblüffend an den rätselhaften Schrein mit dem Lamm und dem Gralskelch erinnerte. Das im April 1988 zerstörte Grabmonument bei Les Pontils kann den Gebrüdern van Eyck allerdings nicht als Modell gedient haben, denn es wurde erst 1933 im Auftrag des Amerikaners Louis Bertram Lawrence errichtet und bestand aus Steinen, die mit Zement verputzt wurden. Zuvor hatte sich an exakt gleicher Stelle ein einfaches Erdgrab befunden, in dem Jean Galibert, ein Besitzer des ehemaligen Mühlengeländes von Les Pontils, 1904 seine Großmutter Elisabeth bestatten ließ. Als Galibert das Anwesen 1921 veräußerte, wurde der Leichnam exhumiert und auf den Friedhof von Limoux überführt. Louis Bertram Lawrence, der neue Eigentümer der Liegenschaften, übernahm die geöffnete Grabstelle und beerdigte 1922 darin seine Großmutter. Erst im Sommer 1933, zwei Jahre nach dem Tod von Lawrences Mutter, wurde die ursprüngliche Begräbnisstätte umgestaltet und durch den erwähnten Steinschrein ersetzt. Hartnäckige Gerüchte, nach denen der Hügel bei Les Pontils immer wieder als Begräbnisstätte diente, sind insofern glaubwürdig, weil sich die ebene Anhöhe im Gegensatz zur wild zerklüfteten Umgebung für die Anlage von Gräbern besonders eignet, einen zusätzlichen Schutz vor Sturzbächen und Überschwemmungen bietet und Grabmäler auf Privatgrundstücken in Südfrankreich früher ohnehin keine Seltenheit waren. Da die im Mittelalter errichtete Wassermühle Moulin des Pontils jahrhundertelang bewohnt war und selbst auf der berühmten Cassini Karte aus dem frühen 18. Jahrhundert vermerkt wurde, ist davon auszugehen, dass in der Nähe des 1933 errichteten Schreins bereits vor langer Zeit Gräber existierten, die abgebrochen wurden, als die Grundstücksbesitzer ihren Wohnort wechselten. Eines dieser frühen Monumente könnte die Schöpfer des Genter Altars über die Vermittlung noch älterer Vorlagen zu ihrer Bildkomposition inspiriert haben.
Steinschrein bei Les Pontils. Der Pfeil markiert Les Toustounes.
Hatten die Gebrüder van Eyck in Wirklichkeit nicht nur idealisierte Szenen aus der christlichen Glaubensgeschichte dargestellt, sondern auch die gebirgige Landschaft um Les Pontils gemalt? War der beschriebene Ortshinweis das tatsächliche Geheimnis des Genter Altars? Das Altarbild bleibt uns keine Antwort schuldig. Es birgt einen regelrechten geographischen Schlüssel, dessen ganze Tragweite erst auf den zweiten Blick ersichtlich wird. Auf der äußeren rechten Altartafel der unteren Bilderreihe der Festtagsseite ist ein Symbol verborgen, das jeden Zweifel an der Bedeutung des Kunstwerkes beseitigt und dabei in einem engen Zusammenhang mit dem legendären Jakobsweg nach Santiago de Compostela steht. Die genannte Bildtafel zeigt eine vom heiligen Christophorus angeführte Pilgerschar, in deren Mitte ein älterer Mann eine Jakobsmuschel auf der Stirn trägt. Die Jakobsmuschel ist das Sinnbild der Jakobspilger und des Jakobsweges, der in vier getrennten Routen ebenfalls durch Frankreich führt. Die Voie Toulousaine (Via Tolosana), der südlichste der im »Le Guide du Pèlerin de Saint-Jacques-deCompostelle«, einem Pilgerführer des zwölften Jahrhunderts, verzeichneten französischen Jakobswege, beginnt in Arles, verläuft im Languedoc in geringer Entfernung zu Les Pontils und vereinigt sich im spanischen Puente la Reine mit den anderen Nebenstrecken zur eigentlichen Hauptpilgerstraße. Der Mann mit der Jakobsmuschel ist weniger eine Anspielung auf Jan van Eycks eigene Pilgerfahrt zum Jakobsgrab nach Santiago de Compostela, als vielmehr ein ganz konkreter Wegweiser, der in Verbindung mit dem Hauptgemälde zu betrachten ist.
Mit ihrer gegenständlichen Symbolsprache haben die Gebrüder van Eyck oder ihre Vorlagengeber darauf hinzudeuten versucht, dass die auf der Festtagsseite des Altars abgebildete Landschaft genau dort zu finden ist, wo sich die dargestellte Gebirgssilhouette mit dem Umland des Jakobsweges verbindet.
Viele künstlerische Elemente unterstreichen die thematische Einheit zwischen dem Hauptbild der Festtagsseite und den entsprechenden Seitentafeln und machen überdies deutlich, dass ihre scheinbar unterschiedlichen Motive eine landschaftliche Umrahmung des Lammes bilden und den weiteren Hintergrund der Altarszene wiedergeben. Die auf dem zentralen Bild angedeutete Landschaft erstreckt sich auch über die Seitentafeln und entspricht nur einem Ort auf Erden, der Gegend um Les Pontils in den Corbières; ein Landstrich in unmittelbarer Nähe des südlichsten französischen Jakobsweges, wo über Jahrhunderte Grabmonumente errichtet wurden und die benachbarten Felsformationen des Roc di Quiloutié, Les Toustounes und Pech de Bugarach in allen Einzelheiten den Bergrücken des Altargemäldes gleichen.
Detail der Bildtafel mit den Heiligen Pilgern. Ein Mann im Hintergrund trägt eine Jakobsmuschel auf der Stirn, das Symbol der Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela.
Die Erkenntnis, dass die Schöpfer des Genter Altars keine erfundene Kulisse verewigten, nicht das rein fiktive Abbild des himmlischen Paradieses im Blick hatten, sondern begleitet von religiösen Themen eine wirklich existierende Landschaft festhielten, kommt in jeder Hinsicht einer kunsthistorischen Sensation gleich. Die immense Bedeutung dieser neuen Entdeckung wird in keiner Weise dadurch geschmälert, dass das Kunstwerk auch Einzelheiten enthält, die der Phantasie der Maler entsprungen sind, die sich eher an der religiösen Symbolik des Mittelalters orientieren oder wie einige Gebäude im Hintergrund nur den damals üblichen Gegenwartsbezug widerspiegeln. Das Lamm und der christlich interpretierte Gral mussten notwendigerweise mit Sinnbildern aus der Lebensgeschichte Jesu verbunden werden, zu denen Personen wie Johannes der Täufer oder die Jungfrau Maria gehören. Das Hauptbildnis sollte vor allem christliche und alttestamentarische Grundmotive untermauern und Erinnerungen an den biblischen Garten Eden wecken, in dem Pinien, Lobelien und Palmen neben Pflanzen aus ganz unterschiedlichen Regionen gedeihen konnten.
Einige Anregungen zur Ausgestaltung des Genter Altars könnten aus dem Umfeld eines Ritterordens stammen, den Philipp III. von Burgund, der in Gent aufgewachsene Graf von Flandern, am 10. Januar 1430 unter der Bezeichnung Orden vom Goldenen Vlies gegründet hatte. Der als Philipp der Gute bekannt gewordene Graf von Flandern initiierte den Orden in Form einer Gemeinschaft, die grundverschiedene Vorstellungen miteinander verband, sich einerseits dem Schutz der katholischen Kirche verschrieben hatte und sich andererseits auf die griechische Sage vom Goldenen Vlies berief.11 Letzteres war mit dem mythologischen Fell des fliegenden Widders Chrysomallos identisch, welches angeblich in Kolchis am Schwarzen Meer aufbewahrt und später von Jason und seinen Argonauten gestohlen worden sein soll.
Die symbolischen Parallelen zwischen Jesus Christus, dem Lamm Gottes und Chrysomallos, dem fliegenden Widder der griechischen Sagenwelt, sind mehr als sonderbar. Chrysomallos war als Sohn des Meeresgottes Poseidon göttlicher Abkunft, rettete die Königskinder Helle und Phrixos aus der Knechtschaft des böotischen Königs Athamas und wurde in Kolchis auf eigenen Wunsch zu Ehren des Gottes Zeus geopfert.12 Aus christlichem Blickwinkel betrachtet kann der göttliche Widder also durchaus an das Christuslamm erinnern, das für die Erlösung der Menschheit geschlachtet wurde und in seiner künstlerischen Erscheinungsform ins Zentrum des Genter Altars rückte.
Jan van Eyck, der Kammerherr Philipps des Guten, könnte aber auch auf andere Weise durch den Orden vom Goldenen Vlies beeinflusst worden sein. Vielleicht gab es einen besonderen Grund dafür, dass die verschwundene Bildtafel mit dem Felsabhang des Roc di Quiloutié auf der entsprechenden Rahmeninschrift als »IVSTI IVDICES« (»Gerechte Richter«) bezeichnet wird. Eine zweite und nicht weniger populäre Herleitung des Ordens verweist nämlich auf den israelischen Richter Gideon und das alttestamentarische »Begnadungswunder«, das im Buch der Richter überliefert wird.13
Die biblische Geschichte handelt von einem gewöhnlichen Bündel Schafwolle, das in einer gänzlich trockenen Tenne von Tau benetzt ist, in einer feuchten Scheune hingegen auf unerklärliche Weise vollkommen trocken bleibt und vom Richter Gideon letztendlich als Tauwunder zu einem Zeichen Gottes erklärt wird.14 So wie das Tauwunder und der biblische Richter Gideon zur Entstehung der Rahmeninschrift »IVSTI IVDICES« beigetragen haben könnten, dürfte sich auch die Sage vom geschlachteten Widder Chrysomallos im Motiv des geopferten Christuslammes widerspiegeln, das natürlich in erster Linie den christlichen Traditionen vom Sühnetod Jesu entlehnt ist.
Die Feststellung, dass die Gebrüder van Eyck aus unterschiedlichen religiösen, mythologischen und künstlerischen Quellen schöpften, dass sie vielleicht ältere Darstellungen als Vorlagen benutzten und möglicherweise überhaupt nicht wussten, welche Landschaft sie gemalt hatten, ändert ohnedies nichts an der geschichtlichen Bedeutung des Kunstwerkes. Die Verknüpfung des christlichen Grals mit einem ganz bestimmten Ort inmitten einer ansonsten vollkommen bedeutungslosen Wildnis wurde jedenfalls sorgfältig inszeniert und dient dem aufmerksamen Betrachter als Wegweiser zu einem uralten Mysterium.
Die unbegreiflich genau wiedergegebene Wegbeschreibung zum Gralskelch ist die verborgene Botschaft des grandiosen Altarbildes; eine Botschaft, die allerdings weitere Rätsel aufgibt, denn nach Auslegung der meisten Theologen und Religionswissenschaftler ist das Heiligtum lediglich eine Erfindung mittelalterlicher Mystiker gewesen, die von frommer und irrationaler Reliquiengläubigkeit durchdrungen waren. Wenn der Gral wirklich eine reine Erfindung darstellt, dürfte es aber keine konkreten Hinweise auf seinen Verbleib geben. Kein Künstler wäre damals auf den Gedanken gekommen, eine fiktive Wegbeschreibung zu einem Gegenstand in Szene zu setzen, der nach eigener Auffassung nie existiert hat. Die Gebrüder van Eyck oder die Schöpfer der von ihnen verwendeten Vorlage müssen demgemäß zumindest selbst davon überzeugt gewesen sein, dass der Gral ein realer Gegenstand ist, der an dem von ihnen gemalten Ort aufbewahrt wurde.
Warum verband man den Verbleib des Grals ausgerechnet mit einer bestimmten Gebirgskulisse der Corbières? Steckt in der alten Legende vom Gral mehr historische Wahrheit als bislang geglaubt wurde? Gibt es Beweise dafür, dass der Gral ursprünglich gar nicht mit dem Blutgefäß Jesu Christi identisch war? Beruht die Sage von der Abendmahlsschale mit dem Blute Jesu womöglich auf der christlichen Umdeutung eines viel älteren Heiligtums?
Die Sage vom Heiligen Gral und die symbolische Botschaft des Genter Altars sind offenkundig Bestandteile eines umfassenden historischen Mysteriums, das sehr weit in die Vergangenheit zurückreicht. Um die hiermit verbundenen Fragen zu beantworten, muss man sich aber nicht mit vagen Vermutungen oder ausgefallenen Phantasien befassen, denn es gibt greifbare Anhaltspunkte zur Auflösung des Rätsels, die uns erneut in die südwestfranzösischen Corbières zurückführen, in jene Gebirgskulisse, die das nunmehr aufgedeckte Geheimnis des Genter Altars birgt. Dort, in Rennes-le-Château, in einer winzigen Gemeinde der Corbières, kam es gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu einer vermeintlichen Schatzentdeckung, die später für weltweite Aufmerksamkeit sorgte, schließlich als Grundlage eines groß angelegten Medienbetrugs diente, in Wahrheit jedoch in direkter Verbindung mit dem Rätsel des Genter Altars steht.
I. Ein seltsamer Schatz
Rätselhafte Schriften
Die längst notwendige Renovierung der Gemeindekirche von Rennes-le-Château war viele Jahre lang immer wieder verschoben worden, doch im Jahre 1886 hatte sich der Bauzustand des Gotteshauses so weit verschlechtert, dass unverzüglich etwas unternommen werden musste. François Bérenger Saunière, der Pfarrer des kleinen Dorfes in den Corbières, bat die bürgerliche Gemeinde um Hilfe, die sich unerwartet freigiebig zeigte und einen Betrag von 1.400 Franc zur Verfügung stellte. Mit der finanziellen Unterstützung der Gemeinde und einer großzügigen Spende der Comtesse de Chambord, einer reichen Gönnerin des jungen Priesters, war es nun möglich, die dringendsten Baumaßnahmen durchzuführen und die Kirche vor dem weiteren Verfall zu bewahren.
Im Zuge der Renovierungsarbeiten kam es bald zu einer seltsamen Entdeckung, über deren Hergang jedoch unterschiedliche Berichte kursieren. Die wahrscheinlichste Version der Geschehnisse besagt, dass Antoine Captier, der Glöckner und Kirchendiener, in einer morschen Geländersäule eine Glasphiole fand, die ein altes, vergilbtes Schriftstück barg. Antoine Captier erzählte später seinem Urenkel, dass er das Dokument dem Dorfpfarrer überreicht habe, der hinter seltsamen Textpassagen eine codierte Botschaft vermutete.15 Nach vielen vergeblichen Entschlüsselungsversuchen wandte sich Saunière an seinen direkten Vorgesetzten Felix Arsène Billard, den Bischof von Carcassonne, der ihn wiederum an einen jungen Priesterschüler namens Emile Hoffet verwiesen haben soll. Emile Hoffet, der sich im Priesterseminar von Saint Sulpice in Paris auf seine Priesterweihe vorbereitete, galt in Kirchenkreisen als ausgewiesener Experte für alte Geheimschriften und schien der ideale Ansprechpartner für Saunières Anliegen zu sein.16 Es wurde verabredet, das Dokument an Emile Hoffet zu übergeben, der inoffiziell mit der Entschlüsselung des Textes beauftragt werden sollte. Anscheinend gelang Hoffet eine Dechiffrierung des Schriftstückes, über dessen Inhalt allerdings nie etwas nach außen drang und von dem später lediglich frei erfundene und gefälschte Fassungen in Umlauf gerieten.
Nach seiner Rückkehr aus Paris begann sich die Lebenssituation Saunières grundlegend zu ändern. Der kleine Geistliche schien schlagartig zu einem wichtigen Mann geworden zu sein, bei dem sich berühmte Künstler, Politiker und Standespersonen des europäischen Adels die Klinke in die Hand gaben. Der Priester empfing den französischen Kultusminister Dujardin-Beaumetz ebenso wie Johann Salvator von Habsburg, den Vetter des österreichischen Kaisers, der sich selbst als »Herr Guillaume« bezeichnete, im Dorf aber nur der »Ausländer« genannt wurde.17 Warum sich Angehörige des Erzhauses Habsburg für Rennes-le-Château und Saunière zu interessieren begannen, konnte damals absolut niemand verstehen. Ein Rätsel war auch der plötzliche Reichtum des Dorfgeistlichen. Der vormals arme Priester gab Unsummen für teures Porzellan aus und ließ sich ein neues Pfarrhaus und ein luxuriöses Landhaus, die Villa Bethania, errichten.18 Sein Arbeitszimmer richtete sich Saunière in einem zweigeschossigen Aussichtsturm ein, den er 1907 bauen ließ und der neben einer großen Bibliothek noch eine reichhaltige Sammlung von Ansichtskarten und Briefmarken beherbergte.
François Bérenger Saunière
Saunière wollte sich mit seinem mondänen Lebenswandel offenbar über eine frühzeitig gescheiterte theologische Laufbahn hinwegtrösten, die von den Eltern zunächst nach Kräften gefördert worden war. Er war 1852 im Nachbarort Montazels als ältestes Kind von Joseph und Marguerite Saunière geboren worden und hatte neben drei jüngeren Brüdern noch drei Schwestern. François Bérenger Saunières Vater hatte als Leiter eines kleinen Mühlenbetriebs alle Mühen und Kosten auf sich genommen, um seine drei Söhne studieren zu lassen. Jean-Marie Alfred und François Bérenger entschieden sich für die Priesterlaufbahn, während ihr Bruder Joseph bis zu seinem frühen Tod eine medizinische Fakultät besuchte. François Bérenger, der ehrgeizigste Sprössling der Familie, wurde 1874 in das Priesterseminar von Carcassonne aufgenommen und verbrachte die anschließende Vikariatszeit im Städtchen Alet-les-Bains. Nach der Besetzung des Dekanatsamtes in La Clat wurde er 1885 als 33-Jähriger zum Professor des Priesterseminars von Narbonne berufen, wo er aber infolge verschiedener Disziplinarverstöße sehr schnell zurückgestuft und nach Rennes-le-Château strafversetzt wurde.
Saunières Aussichtsturm
Obwohl Saunière Rennes-le-Château als einen Ort der Verbannung betrachtete, setzte er sich auf vorbildliche Weise für die ihm anvertrauten Gemeindemitglieder ein und investierte einen Teil seines neu erworbenen Reichtums in gemeinnützige Projekte und den weiteren Ausbau des Gotteshauses.
Der Priester ließ es sich nun nicht mehr nehmen, die Dorfkirche viel reichhaltiger auszuschmücken als es ursprünglich vorgesehen war. Gleich hinter dem Portal wurde eine Statue des Teufels aufgestellt, der das Weihwasserbecken auf seinem Rücken trägt und mit einem Ausdruck des Entsetzens auf den Boden blickt, als ob dort etwas Furchtbares auf ihn lauern würde. Das Gotteshaus wurde zusätzlich mit Inschriften, seltsamen Anagrammen und bunten Wandmalereien ausgestattet, die oft vom Signum B.S. flankiert sind. Über dem Türsturz der Kirche ließ der Pfarrer schließlich eine Inschrift anbringen, die dem 1. Buch Mose, der biblischen Genesis, entnommen wurde:
»Terribilis est Locus iste. Hic Domus Dei Est Et Porta.« (»Dieser Ort ist schrecklich. Es ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel.«)
Saunière machte sich mit seinen Projekten erwartungsgemäß nicht nur Freunde. Die adlige Familie d’Hautpoul de Blanchefort bezichtigte ihn sogar der Grabschändung. Der Priester hatte aus zunächst unerfindlichen Gründen mehrere Grabsteine auf dem Dorffriedhof versetzt und auch einen Stein der 1781 verstorbenen Marquise d’Hautpoul de Blanchefort entfernt und mit veränderter Inschrift wieder aufgestellt. Dominique Olivier d’Hautpoul, ein Verwandter der Marquise, beschwerte sich diesbezüglich im Februar 1895 beim Bürgermeister von Rennes-le-Château, der Saunière umgehend zur Rede stellte. Die Vorwürfe des Bürgermeisters und die Proteste der d’Hautpoul de Blancheforts hielten den Priester aber nicht davon ab, den Grabstein der Marquise später ganz zu entfernen und seine Bruchstücke an einem Mauerwinkel des Friedhofes abzulegen.
Inzwischen war das Bistum Carcassonne auf die Vorgänge in Rennesle-Château aufmerksam geworden und der neue Bischof Paul-Félix Beuvain de Beauséjour, der Nachfolger des 1901 verstorbenen Felix Arsene Billard, verlangte sofortige Aufklärung über die anscheinend beträchtlichen Einkünfte Saunières. Der Priester legte dem Bischof postwendend eine Liste seiner Einnahmen und Ausgaben vor, für die es jedoch keinerlei Nachweise oder Quittungen gab.
Monseigneur Beauséjour, dessen Geduld sich allmählich erschöpfte, war bald davon überzeugt, dass der aufsässige Priester in Wahrheit einen schwunghaften Messehandel betrieb und die erzielten Einkünfte seiner Privatschatulle zugutekommen ließ. Prinzipiell war es Priestern erlaubt, Zahlungen für Messen anzunehmen, solange sie tatsächlich abgehalten wurden und die Einnahmen wenigstens teilweise den jeweiligen Bistümern zuflossen, doch Beauséjour musste im vorliegenden Fall davon ausgehen, dass Saunière Gelder für Tausende von Messen unterschlagen hatte, die überdies nie gelesen worden waren. Der Bischof wollte die leidige Angelegenheit mit einer Strafversetzung Saunières bereinigen, doch der in Bedrängnis geratene Priester zog es vor, im Jahre 1909 von seinem Amt zurückzutreten und damit der bischöflichen Autorität zu entgehen. Gerade dies konnte Beauséjour nicht hinnehmen und lehnte Saunières Rücktritt kategorisch ab. Ihm blieb keine andere Möglichkeit, als Saunière ganz offiziell des Messehandels und der Simonie, der geistlichen Korruption, anzuklagen und die Rückgabe der unrechtmäßig vereinnahmten Gelder zu verlangen.
Die Folge der Auseinandersetzungen war ein mehrjähriger Prozess, in dem Saunière letztlich darum unterlag, weil er das bischöfliche Verbot des Messeverkaufs ignoriert hatte und sich fernerhin beharrlich weigerte, alle Geldquellen zu nennen. Eine 1911 als »suspensus a divinis« umschriebene Amtssuspendierung wurde vom Vatikan abschließend kirchenrechtlich geprüft und schon Anfang des Jahres 1915 – der exakte Zeitpunkt ist Saunières Personalakten im Bistumsarchiv von Carcassonne nicht mehr eindeutig entnehmbar –, nach einer entsprechenden Eingabe Saunières, wieder zurückgenommen. Dem Priester wurde eine vergleichsweise milde Strafe auferlegt, die im Wesentlichen aus geistlichen Exerzitien und einer Bußpilgerfahrt zum Wallfahrtsort Lourdes bestand. Die von Saunières Anwalt, dem Kanoniker Jean Eugène Huguet, geschickt formulierten Anträge und Schriftsätze konnten allerdings nicht verhindern, dass auch der Vatikan Angaben über die Geldquellen des Priesters einforderte. Da sich Saunière aber weiterhin konsequent weigerte, seine gesamten Einnahmen offenzulegen, wurde er vom Vatikan am 11. April 1915 noch einmal und diesmal endgültig des Priesteramtes enthoben.
Infolge des Prozesses war der vormals wohlhabende Priester in erhebliche Geldnöte geraten, hatte sämtliche Bankkonten überzogen und erwog sogar, seine Villa Bethania zu verkaufen. Saunières finanzielle Schwierigkeiten waren bald so groß geworden, dass er 1915 selbst die Pläne für den Bau eines bescheidenen Gartenhauses aufgeben musste.19 Die aufgebauschten Berichte, nach denen Saunière wieder zu neuem Reichtum gelangt sei und denen zufolge er den Bau eines 50 Meter hohen Turmes beabsichtigt habe, entbehren jeglicher Grundlage und wurden erst Jahrzehnte später von Noël Corbu in Umlauf gebracht, dem Marie Dénarnaud, die Haushälterin des Priesters, die von Saunière überschriebenen Liegenschaften vererbt hatte. Gemäß Corbus weiteren Erzählungen wollte ihm Dénarnaud die Ursprünge von Saunières Reichtum enthüllen, was jedoch angeblich durch einen Schlaganfall vereitelt worden sei, der sie kurz vor ihrem Tod im Jahre 1953 fast vollständig lähmte und ihrer Stimme beraubte. Eine hartnäckige Legende in Rennesle-Château berichtet davon, dass Dénarnaud auf dem Totenbett und im Hinüberdämmern nur noch einige schwer verständliche Sätze und Wortfetzen hervorgebracht und etwas von »Brot«, »Salz« und irgendeinem geheimnisvollen Gefäß gemurmelt habe.
Noël Corbu, der ganz davon besessen war, das Rätsel um Saunières Reichtum aufzuklären, starb 1968 unter mysteriösen Umständen bei einem Unfall in der Nähe von Fanjeaux. Sein Auto wurde von einem schweren LKW buchstäblich platt gewalzt, dessen Lenker Fahrerflucht begann und von der Polizei nie ermittelt werden konnte. Dabei war Corbu nur ein Schicksal in einer ganzen Reihe seltsamer Todesfälle, die es im Umfeld Saunières zu beklagen gab. Bereits 1897 war Saunières Freund Antoine Gélis, der Pfarrer des Nachbarortes Coustaussa, von einem Unbekannten in seinem Haus mit einem schweren Schürhaken erschlagen worden. Die Polizei fand eine aufgebrochene Schatulle, aus der wichtige Papiere entwendet worden waren, und ging etwas voreilig von einem Raubmord aus, obgleich die weiteren Umstände des Verbrechens gegen diese Vermutung sprachen. Gélis’ Mörder ließ nämlich eine wertvolle Goldmünze zurück, obwohl sie unübersehbar auf einer Kommode lag und von einem gewöhnlichen Einbrecher sicherlich gestohlen worden wäre. Seltsamerweise hinterließ der Täter eine offenkundig absichtlich gelegte Spur. Neben der blutüberströmten Leiche des alten Priesters entdeckte man ein Zigarettenpapier der Marke »Le Tzar«, auf dem die sonderbaren Worte »Viva Angelina« zu lesen waren.20
Aufgrund belastender Indizien geriet Saunière schnell ins Blickfeld der Polizei. Saunière, zu dessen bevorzugten Zigarettenmarken »Le Tzar« gehörte, hatte Gélis erst wenige Tage vor dem Mord eine Aktentasche mit wichtigen Unterlagen zur Aufbewahrung übergeben. Vielleicht, so wurde später vermutet, hatte Saunière es bereut, Gélis in sein Geheimnis eingeweiht zu haben und erschlug den überflüssigen Mitwisser, um die verräterischen Papiere wieder in seinen Besitz zu bringen. Die Vermutungen gingen auch dahin, dass der Mörder bewusst eine Fährte zu Saunière gelegt haben könnte, die allerdings auch von ihm selbst inszeniert worden sein kann, zumal nicht ernsthaft anzunehmen war, dass sich der Pfarrer von Rennes-le-Château mit einem beschriebenen Zigarettenpapier selbst belasten würde. Immerhin verfügte Saunière über ein zumindest damals glaubwürdiges Alibi, denn Marie Dénarnaud, die sich neben dem Hauswesen auch um die erotischen Bedürfnisse ihres Arbeitgebers kümmerte, versicherte der Polizei, dass der Priester in der Tatnacht das Pfarrhaus nicht verlassen habe.
Jahre später, in der ersten Februarnacht des Kriegsjahres 1915, kam es zu einem weiteren rätselhaften Gewaltverbrechen, als Abbé Rescaniers, der neue Pfarrer von Rennes-les-Bains, durch das geschlossene Fenster seines Pfarrhauses erschossen wurde. Abbé Rescaniers untersuchte im Auftrag des Bischofs de Beauséjour den Lebenswandel und die Vermögensverhältnisse Henri Boudets, des vormaligen Pfarrers von Rennesles-Bains, der als enger Freund und Mitwisser Saunières galt und ebenfalls über beträchtliche Geldmittel verfügt hatte. Erwartungsgemäß geriet Saunière abermals in Mordverdacht, der erst durch ein weiteres Alibi seiner Haushälterin entkräftet werden konnte.
Man könnte den Eindruck gewinnen, dass die Freunde, Vertrauten und Mitwisser Saunières ein sehr gefährliches Leben führten und ständig damit rechnen mussten, getötet zu werden. Andererseits gibt es nicht den geringsten Beweis dafür, dass die verschiedenen Gewaltverbrechen wirklich in einem ursächlichen Zusammenhang miteinander standen. In diesem Fall wären Marie Dénarnaud, Saunières Geliebte, und Henri Boudet, sein engster Gefährte, sicher ein bevorzugtes Anschlagsziel gewesen, doch beide starben friedlich und in hohem Alter eines natürlichen Todes. Auch Saunière selbst starb nachweislich eines natürlichen Todes. Die weitverbreitete und in vielen Büchern zitierte Überlieferung, Dénarnaud habe bereits am 12. Januar 1917, zehn Tage vor Saunières Tod, einen Sarg für ihn bestellt, beruht auf einem kuriosen Irrtum und ungenauen Recherchen. Die erhalten gebliebene Quittung zur Sargbestellung (Saunière-Museum in Rennes-le-Château) trägt nicht die Monatsbezeichnung Janvier (Januar), sondern ist auf den 12. Juin (Juni) datiert und stellt keinen Beleg für einen Mord an Saunière dar.
Der katastrophale körperliche Zustand des Priesters widerlegt endgültig alle Mord- und Verschwörungstheorien. Saunière hatte schon lange vor seinem Tod mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt, neigte zu Kreislaufbeschwerden und ließ sich 1902 sogar ein Glasauge einsetzen. Wie sein 1905 verstorbener Bruder Jean-Marie Alfred war er hochprozentigen Genüssen herzlich zugetan und trank bei nächtlichen Saufgelagen im Kollegenkreis große Mengen Karibik-Rum. Saunière hatte sich mit den Jahren eine gefährliche Leberzirrhose zugezogen, war zeitweise bettlägerig geworden und selbst eine Pilgerreise zum nahegelegenen Wallfahrtsort Lourdes ließ sich 1915 nur noch unter großen Schwierigkeiten durchführen. Mitte Januar 1917, wenige Wochen vor seinem 65. Geburtstag, erlitt der vom fortwährenden Alkoholmissbrauch und Tabakkonsum geschwächte Saunière einen Herzinfarkt, an dessen Folgen er am 22. Januar verstarb.
Welches Geheimnis verbirgt sich hinter dem Reichtum des Priesters? Ein erheblicher Teil des priesterlichen Vermögens stammte seltsamerweise aus dem Vermögen einflussreicher Gefolgsleute der französischen Bourbonen-Dynastie, die sich in der Legitimistischen Partei zusammengeschlossen hatten und Saunières politische Gesinnung durch großzügige Spenden honorieren wollten. Die Legitimistische Partei, eine Verbindung konservativer Adliger und monarchistischer Kleriker, betrachtete die 1830 vom Königsthron verdrängten Bourbonen als das einzige französische Adelshaus, das sich auf einen gottgegebenen, legitimen Herrschaftsanspruch berufen konnte. Dabei ist nachweisbar, dass Saunière von der Comtesse de Chambord, einer geborenen Habsburgerin aus der Linie Österreich-Este, 3.000 Franc zur Renovierung der Gemeindekirche erhalten hatte. Die Comtesse galt als Befürworterin einer Bourbonen-Monarchie in Frankreich, das seit dem Sturz des Kaisers Napoleon III. im Jahre 1870 zur Republik geworden war. Die Comtesse de Chambord hatte 1846 Henri Charles Ferdinand Marie Dieudonné de Bourbon-Artois geheiratet, den als Comte de Chambord bekannten Enkel des französischen Königs Karl X., der 1830 durch die sogenannte Julirevolution gestürzt worden war. Der Versuch der Legitimistischen Partei, die Bourbonen-Monarchie wiederherzustellen und den Comte, ihren König, als Heinrich V. auf den französischen Thron zu setzen, scheiterte letztlich an dessen Weigerung, eine liberale Verfassung anzuerkennen und die revolutionäre Trikolore als Nationalflagge zu akzeptieren. Die Legitimisten hatte vergeblich auf die Unterstützung monarchistisch gesinnter Kleriker gesetzt, die ihrerseits viel zu wenig Rückhalt in der Bevölkerung besaßen, um irgendeine nennenswerte politische Wirkung entfalten zu können.
Der Tod des Comte de Chambord verursachte ab 1883 den Zerfall der Legitimistischen Partei, deren Reste später notgedrungen den spanischen Zweig der Bourbonen unterstützten. Die Verbindung zwischen der Comtesse de Chambord, der ungekrönten Königin der Legitimisten, und den Vorgängen in Rennes-le-Château ist darin zu suchen, dass Alphonse-Henri Comte d’Hautpoul, ein entfernter Verwandter der ehemaligen Grundherren von Rennes-le-Château, zu den Erziehern des jungen Comte de Chambord gehört hatte und in der Folgezeit intensiv darum bestrebt war, Kontakte zwischen seinem Schützling und der einflussreichen Familie d’Hautpoul de Blanchefort herzustellen, die den Legitimisten ohnehin sehr nahestand.
Die von Saunière empfangene Geldspende der Comtesse war demnach Dank und Ermutigung für das monarchistische Engagement des Priesters und stand in einem Zusammenhang mit antirepublikanischen Vorträgen Saunières, die das Missfallen der zuständigen Präfektur erregt und dem Geistlichen von Oktober 1885 bis Juli 1886 sogar eine Amtssuspendierung eingebracht hatten.21 Saunières politische Haltung dürfte auch der Grund für die regelmäßigen Besuche Johann Salvator von Habsburgs gewesen sein, der sich in Absprache mit der Comtesse de Chambord als eifriger Spendensammler betätigte und seinem politischen Günstling innerhalb weniger Jahre etwa 20.000 Franc überreichte.
Saunière war in finanzieller Hinsicht jedoch nicht allein auf seine politischen Freunde angewiesen; er verfügte über weitere lukrative Einnahmequellen. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Vorwürfe Bischof Beauséjours durchaus berechtigt gewesen waren und Saunière tatsächlich immense Summen durch den Verkauf von Messen verdient hatte. Er inserierte in verschiedenen religiösen Zeitschriften und bot sich an, per Geldanweisung Seelenmessen für verstorbene Sünder zu halten.22 Da der übliche Preis für gekaufte Messen bei höchstens eineinhalb Franc lag und die von der Familie Captier entdeckten Aufzeichnungen Saunières (Saunière-Museum in Rennes-le-Château) etwa 110.000 veräußerte Messen nahelegen, lässt sich abschätzen, dass der Priester zwischen 1895 und 1915 bis zu 165.000 Franc für Gottesdienste kassiert haben muss, von denen die allerwenigsten jemals abgehalten wurden.
Fälschungen und Ausschmückungen
Die allgemein bekannte Geschichte von einer Schatzentdeckung des Priesters stammt aus der Umgebung Noël Corbus, dem Marie Dénarnaud das ehemalige Anwesen Saunières vererbt hatte. Im Januar 1956 veröffentlichte Corbu in der Lokalzeitung La Depêche du Midi eine reißerische Artikelserie über einen angeblichen Goldfund Saunières, von der er sich einen Schatzgräber-Tourismus und zusätzliche Einnahmen für sein unrentables Hotel de la Tour versprach, das er im Mai 1955 in der Villa Bethania eröffnet hatte. Die Artikelserie berichtet von einer kastilischen Königstochter namens Blanka (franz. Blanche de Castille), die im 13. Jahrhundert lebte und einen Schatz hinterlassen habe, dessen Entdeckung Saunière ein Vermögen von 50 Millionen Franc beschert hätte. Neugierigen Besuchern gegenüber phantasierte Corbu später auch vom beabsichtigten Bau eines riesigen Tempelturms, der gemäß den Plänen des Priesters einen Großteil des Corbières-Dorfes überspannen sollte und zu den größten Gebäuden Frankreichs gehört hätte. Corbu erzählte großspurig, Marie Dénarnaud habe ihm anvertraut, die Einwohner Rennes-le-Châteaus würden auf purem Gold wandeln, das ausreichte, um sie 100 Jahre lang zu ernähren und aufs Beste zu kleiden. Warum Dénarnaud trotz ihrer profunden Schatzkenntnisse dazu gezwungen war, ihren Lebensabend in sehr bescheidenen materiellen Verhältnissen zu verbringen, vermochte Corbu hingegen nicht zu erklären.
Die Schatzgräbergeschichten des umtriebigen Hoteliers riefen einen gewissen Pierre Plantard auf den Plan, einen wegen Kindesentführung vorbestraften Gauner, der sofort daranging, Kapital aus den Geschehnissen zu schlagen und die Erzählungen mit phantasievollen Elementen auszuschmücken. Zusammen mit seinem windigen Freund Philippe de Chérisey verfasste er in den 1960er Jahren zahlreiche Schriften, die unter dem Titel Dossiers secrets (Geheime Dossiers) in der Pariser Nationalbibliothek hinterlegt wurden und die Existenz einer Prieuré de Sion (Priorat von Zion) genannten Geheimorganisation belegen sollten.23 Die Prieuré de Sion, auf die Saunière bei seinen Nachforschungen gestoßen sein soll, wurde angeblich um das Jahr 1100 im Anschluss an den ersten Kreuzzug gegründet und soll die Aufgabe gehabt haben, die Nachkommen des fränkischen Herrschergeschlechts der Merowinger zu beschützen und ihren politischen Einfluss zu sichern.
Unter dem Pseudonym Henri Lobineau hinterlegte Plantard im Januar 1964 den ersten Teil der Dossiers secrets, die aus teilweise erfundenen Stammbäumen bestehen, mit denen er zu untermauern versuchte, dass das Geschlecht der Merowinger nach dem endgültigen Machtverlust im achten Jahrhundert nicht etwa ausstarb, sondern durch zahlreiche Nebenlinien und Eheschließungen bis in die Gegenwart fortbesteht und in den Adern vieler Adelshäuser und selbst in denen seiner eigenen Familie merowingisches Blut fließt. Mit zwei weiteren Ergänzungen, die im August 1965 und im Mai 1966 den Phantasieautoren Madeleine Blancasal und Antoine l’Ermite zugeschrieben wurden, verknüpfte Plantard die Dossiers secrets endgültig mit den Ereignissen in Rennes-le-Château und lenkte zugleich den Blick auf einen dort angeblich verborgenen Merowingerschatz. Die letzten vier Teile der Dossiers secrets wurden zwischen Mai 1966 und April 1967 als dokumentarische Arbeiten von Lionel Burrus, Eugène Stüblein, Pierre Feugère, Louis Saint-Maxent, Gaston de Koker und Philippe Toscan du Plantier ausgegeben und enthalten als Zugabe zu diversen Darstellungen von Grabinschriften eine Liste der Großmeister der Prieuré de Sion, in der neben weniger bekannten Persönlichkeiten so illustre Namen wie Leonardo da Vinci, Isaac Newton und Victor Hugo vertreten sind.
Die Stammbäume, Skizzen und wirren Kommentaren der Dossiers secrets waren eine wichtige Quelle für Gérard de Sèdes Buch Das Gold von Rennes oder das ungewöhnliche Leben von Bérenger Saunière, Pfarrer von Rennes-le-Château (L’Or de Rennes ou la vie insolite de Bérenger Saunière, curé de Rennes-le-Château), das 1967 erschien und dem der Autor ein Jahr später sein bekannteres Werk Der verwunschene Schatz von Rennes-le-Château (Le trésor maudit de Rennes-le-Château) folgen ließ. Es waren vor allem die Schilderungen des zuletzt genannten Werkes, die den Mythos des Dorfes für ein größeres Publikum zugänglich machten und damit andere Autoren wie Robert Charroux inspirierten, der in seinem 1972 veröffentlichten Buch Der Schatz von Rennes-le-Château (Le Trésor de Rennes-le-Château) über die Entdeckung geheimnisvoller Pergamentschriften spekuliert.
Zu den Informationen, die de Sède von Plantard und Chérisey erhalten hatte, gehören auch zwei Kopien der von Charroux erwähnten Pergamentschriften, die nach Auskunft Plantards aus der Dorfkirche von Rennes-le-Château stammen und wichtige Hinweise auf einen Merowingerschatz enthalten sollen. Die bittere Wahrheit kam aber schon 1967 ans Licht, als Plantard und Chérisey infolge diverser Streitigkeiten mit de Sède die Fälschung der Pergamentbotschaften einräumen mussten.24 So konnte einige Jahre danach auch der Journalist Jean-Luc Chaumeil den plumpen Schwindel durch den Briefwechsel Plantards und Chériseys noch einmal zweifelsfrei belegen und alle weiteren Ausreden endgültig ad absurdum führen.25 Plantard parierte die peinlichen Enthüllungen seines ehemaligen Freundes mit der weniger glaubwürdigen Behauptung, die de Sède zur Verfügung gestellten Schriftstücke seien modifizierte und leicht abgewandelte Abschriften von Originaldokumenten, wohingegen die Ursprünge der Prieuré de Sion immerhin bis ins Jahr 1681 zurückreichen würden. Diese Aussage musste Plantard jedoch schon 1993 wieder zurücknehmen, weil er im Zuge einer politischen Korruptionsaffäre verhört wurde, in die der Geschäftsmann Roger-Patrice Pelat, ein vermeintliches Mitglied der Prieuré de Sion, verwickelt war. Unter Eid gab Plantard zu Protokoll, dass Roger-Patrice Pelat niemals ein Mitglied der Prieuré de Sion gewesen sei, die Organisation de facto überhaupt nicht existiere und in Wahrheit eine reine Erfindung darstelle. Tatsächlich hatte Plantard die Gründungsurkunden der Prieuré de Sion am 7. Mai 1956 bei der Unterpräfektur in Saint-Julien-en-Genevois hinterlegt, den merkwürdigen Verein aber bereits nach wenigen Monaten wieder aufgelöst.
Die in den Vereinsstatuten festgelegten Ziele der Prieuré de Sion muten angesichts der mit dieser Gemeinschaft verbundenen Verschwörungstheorien wie ein schlechter Scherz an. Plantard und seine Mitstreiter André Bonhomme, Jean Deleaval und Armand Defago hatten bei der Vereinsgründung gegenüber den Behörden kundgetan, ihre Organisation, die auch unter der Bezeichnung C.I.R.C.U.I.T. (Chevalerie d'Institutions et Règles Catholiques d’Union Independante et Traditionaliste) geführt wurde, widme sich der »Verteidigung und Freiheit von Billigunterkünften« und unterstütze die römisch-katholische Kirche und deren Kampf für Schwache und Unterdrückte.26
Plantards und Chériseys Vereinsgründungen und Manipulationen konnten nur deshalb so viel Beachtung finden, weil sie von Autoren wie de Sède oder Charroux aufgegriffen und in populären Büchern verbreitet wurden. Von wahrhaft durchschlagender Wirkung waren aber die vorgeblichen Kopien der Pergamente aus der Dorfkirche von Rennes-le-Château, hinter denen viele Autoren erwartungsgemäß einen versteckten Schlüssel zu mystischen Geheimnissen oder legendären Schätzen vermuteten. Das kürzere der angeführten Dokumente enthält eine Erzählung des Lukas-Evangeliums (6,1-5), in der Jesus und seine Jünger von den Pharisäern gerügt werden, weil sie am Sabbat Getreideähren von den Feldern gepflügt hatten. Die entsprechende Passage der Abschrift enthält indessen einige formale Abweichungen und weist eine ganze Reihe von Besonderheiten auf. Zwei vom übrigen Text abgesetzte Wörter bilden sogar eine Warnung: »Solis Sacerdotibus« (»Nur für die Priesterschaft«). Werden die auffällig hervorgehobenen Buchstaben hintereinander gelesen, ergibt sich ein seltsamer Satz:
»A DAGOBERT II. ROI ET A SION EST CE TRESOR ET IL EST LA MORT.« (»Dieser Schatz gehört Dagobert II. und Zion, und dort liegt er tot.«)
Der genannte Dagobert II. war einer der letzten Merowingerkönige des Frankenreiches und spielte in der Geschichte Rennes-le-Châteaus deshalb eine wichtige Rolle, weil er angeblich Gisela von Razès geheiratet hatte, zu deren Ländereien das Corbières-Dorf gehörte. Plantard und Chérisey hatten demzufolge geographische Symbole und Hinweise auf historische Ereignisse geschickt miteinander kombiniert und als verschlüsselte Mitteilungen ausgegeben. »La Mort« (»der Tod«) ist dabei keine Anspielung auf irgendein Grab oder die Ermordung Dagoberts im Jahre 679. »Der Tod« steht für den ungewöhnlichen Namen eines kleinen Weilers, der fünf Kilometer nordöstlich von Rennes-le-Château zu finden war und irgendwann im 18. Jahrhundert aufgegeben wurde. Der Begriff »Sion«, eine französische Form von »Zion«, ist dagegen eine Anspielung auf die ominöse Prieuré de Sion und soll wohl an ihren ursprünglichen Hauptsitz, den biblischen Berg Zion, erinnern, den Plantard bei der Namensgebung seiner Loge allerdings zunächst überhaupt nicht im Blick hatte. Plantard hatte sich nämlich von einem gleichnamigen Berg in der Nähe seines westfranzösischen Wohnortes Annemasse inspirieren lassen und mit der eigentlich sinnlosen Pergamentbotschaft den Eindruck zu erwecken versucht, die in Wahrheit frei erfundene Prieuré de Sion sei im Besitz eines legendären Merowingerschatzes gewesen.
Die Verschlüsselungen des längeren Pergamenttextes hatten Plantard und Chérisey wesentlich komplizierter angelegt und mit einigen rätselhaften Andeutungen ausgeschmückt. Das Schriftstück, das sich bei näherer Betrachtung als Auszug aus dem Johannes-Evangelium erweist und vom Besuch Jesu bei Maria und Martha in Bethanien berichtet, enthält erneut keinerlei Wortzwischenräume und umfasst zudem 140 zusätzlich in den Text eingestreute Buchstaben, in denen sich eine verschlüsselte Botschaft verbirgt. Isolierte man 128 der Buchstaben nach dem im 16. Jahrhundert entwickelten Vigenere-Schlüsselsatz und verschiebt sie gemäß eines vorgegebenen Codewortes innerhalb des Alphabets, ergibt sich die folgende Botschaft, welche Chérisey 1973 in der französischen Zeitschrift Pegasus präsentierte:
»BERGERE PAS DE TENTATION QUE POUSSIN TENIERS GARDENT LA CLEF PAX DCLXXXI PAR LA CROIX ET CE CHEVAL DE DIEU J´ACHEVE CE DAEMON DE GARDIEN A MIDI POMMES BLEUES.« (»Schäferin, keine Versuchung. Dass Poussin, Teniers den Schlüssel besitzen; Friede 681. Beim Kreuz und diesem Pferd Gottes beende oder zerstöre ich diesen Dämon von Wächter. Blaue Äpfel am Mittag.«)27
Mit dem »Dämon von Wächter« ist offenkundig die Teufelsfigur in der Dorfkirche von Rennes-le-Château gemeint, hinter der ohne jedweden Beleg stets eine Darstellung des Wächterdämons Asmodi, des sagenumwobenen Hüters verborgener Schätze, vermutet wurde. Aus einem Rechnungsbeleg vom Juni 1897 geht jedoch klar hervor, dass Saunière bei einer Toulouser Firma namens Giscard lediglich ein »Weihwasserbecken mit Teufel« (»Bénitier avec Diable«) und keine Statue des Dämons Asmodi bestellt hatte.28 Der Teufel, der als Sonderanfertigung entstand und den Blickfang eines Figurenensembles bildet, trägt das schwere Weihwasserbecken, sitzt in gebückter Haltung unterhalb eines Kreuzes und soll gemäß einer über ihm angebrachten Inschrift durch eben dieses christliche Zeichen besiegt werden.
Die verschlüsselten Botschaften des größeren Pergaments entsprechen einer symbolischen Beschreibung der Figurengruppe am Eingang der Dorfkirche von Rennes-le-Château, wo gleichzeitig die rätselhaften »Blaue(n) Äpfel am Mittag« zu finden waren. Hier projizierte ein 1887 eingesetztes Buntglasfenster blassblau schimmernde Lichtkreise an die Innenwand des Gebäudes und vermittelte alljährlich zwischen dem 17. und dem 20. Januar den Eindruck eines verschwommenen Lichterbaumes mit blauen Äpfeln. Die blauen Lichtkreise bildeten aber keine Hinweise auf mystische Geheimnisse, sondern sind dem künstlerischen Geschmack des beauftragten Glasers geschuldet, der ähnliche Fenster mit vergleichbaren Lichteffekten auch in andere südfranzösische Kirchen einbaute.
Ganz im Gegensatz dazu bildet das sonderbare »Pferd Gottes« einen weiteren Fingerzeig auf die Landschaft um Rennes-le-Château. Etwa sechs Kilometer südöstlich des Dorfes erhebt sich eine stark verwitterte Felsformation, eine sonderbare Laune der Natur, die verblüffend an einen Pferdekopf erinnert und früher von den Einheimischen scherzhaft als »Pferd Gottes« bezeichnet wurde. Plantard und Chérisey hatten in ihrem selbst gefertigten Pergamenttext nur die Inneneinrichtung der Kirche von Rennes-le-Château beschrieben und zusätzlich einige Orientierungspunkte aus der Umgebung des Dorfes erwähnt. Lediglich der vorangestellte Satz, der die berühmten Maler Nicolas Poussin und David Teniers nennt, lässt sich zunächst überhaupt nicht einordnen und muss gesondert betrachtet werden.
Die drei Briten Lincoln, Baigent und Leigh, die Autoren des Weltbestsellers Der Heilige Gral und seine Erben (The Holy Blood and the Holy Grail), ließen sich durch Pergamentfälschungen nicht lange aufhalten und interpretieren das Material der Dossiers secrets als schlagenden Beweis für die Existenz eines Mysterium, das Jesus Christus und seine Familie umgibt. Sehr eigenwillig ausgelegte historische Zusammenhänge brachten das Autorengespann auf den Gedanken, hinter dem fränkischen Herrschergeschlecht der Merowinger die Nachkommenschaft Christi und Maria Magdalenas zu vermuten. Nach Aussage Henry Lincolns war der Legendenstoff um die Herkunft Merowechs, des sagenumwobenen Stammvaters der Merowinger, der eigentliche Ausgangspunkt ihrer Überlegungen.29 Die Briten waren bei ihren Recherchen auf einen Bericht des fränkischen Chronisten Fredegar gestoßen, dem zu entnehmen ist, dass Merowechs schwangere Mutter, die Frau des fränkischen Gaukönigs Chlodio, beim Baden von einem Meeresungeheuer vergewaltigt wurde und damit ein zweites Mal empfangen haben soll.30 Die Autoren betrachten die phantasievolle Erzählung als allegorischen Hinweis auf reale geschichtliche Ereignisse und setzen das Ungeheuer mit dem frühchristlichen Fischsymbol gleich, welches sich von »ichthýs«, dem griechischen Wort für Fisch, ableitet, das zufälligerweise die Anfangsbuchstaben eines christlichen Glaubensbekenntnisses enthält.31 In Anlehnung an das Sinnbild des Fisches deuten die drei Autoren das Meeresungeheuer der Fredegar-Chronik als Symbol der Nachkommen Christi, die über das Meer gekommen seien und sich mit den Vorfahren der Merowinger vermischt hätten.
Die Briten verweisen auf alte südfranzösische Sagen, laut denen Maria Magdalena und die Jüngerinnen Maria Kleophas und Maria Salome zusammen mit Martha von Bethanien und deren Bruder Lazarus um das Jahr 45 n. Chr. bei Saintes-Maries-de-la-Mer die Küste der Camargue betraten und sich fortan der Missionierung Südfrankreichs widmeten. Lincoln, Baigent und Leigh, denen die frommen Legenden offenbar nicht stichhaltig genug sind, bereichern die alten Mythen mit eigenen Vermutungen und behaupten ernsthaft, dass Maria Magdalena von ihren Kindern aus der Verbindung mit Jesus Christus begleitet worden sei, deren Nachfahren irgendwann in die Merowingerdynastie eingeheiratet hätten, die von nun an das heilige Blut in sich getragen habe. Folgerichtig sei der Heilige Gral, im Mittelalter meist als Gefäß mit dem Blut Christi gedeutet, nur ein Symbol der Blutlinie des Heilands gewesen, die später durch den Tempelritterorden beschützt wurde. Saunière, so meinen die Autoren, sei durch die Schriften aus der Dorfkirche dem Mysterium der Heiligen Familie auf die Spur gekommen und habe womöglich die katholische Kirche mit seinem Wissen erpresst oder gar den mumifizierten Leichnam Christi entdeckt, der die Kreuzigung überlebt haben könnte und vielleicht gemeinsam mit Maria Magdalena ins gallische Exil gegangen sei.32
Durch derlei Hypothese inspiriert und ermutigt, gingen die britischen Autoren Richard Andrews und Paul Schellenberger sogar noch einen Schritt weiter und verkündeten in den 1990er Jahren mit großer Ernsthaftigkeit, François Bérenger Saunière habe an der Westflanke des Pech Cardou die verborgene Grabhöhle Christi entdeckt und sich in der Folgezeit sein Stillschweigen von der katholischen Kirche teuer bezahlen lassen.
Mit welchen Beweisen Saunière die Kirche allerdings erpresst haben soll, wenn er doch, wie die Autoren außerdem behaupten, das unberührt gebliebene Grab überhaupt nicht geöffnet hatte, verraten die Briten seltsamerweise mit keinem Wort.33 Als Belege für ihre Thesen führen Andrews und Schellenberger unter anderem »Peillinien« ins Feld, die auf den Pech Cardou verweisen sollen, aber von den beiden Autoren vollkommen willkürlich und ohne erkennbare Ansatzpunkte in die von Plantard und Chérisey gefälschten Pergamente und Inschriften eingezeichnet worden sind.
Die Feststellung, dass die Indizienketten der erwähnten britischen Autoren nicht den einfachsten Überprüfungen standzuhalten vermögen, kann angesichts solcher Aussagen kaum überraschen. Eine Ehe zwischen Jesus und Maria Magdalena lässt sich anhand biblischer oder außerbiblischer Berichte weder beweisen noch widerlegen, doch selbst wenn beide wirklich Kinder miteinander gehabt hätten, gäbe es nicht den geringsten Beleg für eine Verbindung zu den Merowingern, zumal das ominöse Meeresungeheuer, das Merowechs Mutter geschwängert haben soll, nichts mit dem christlichen Fisch zu tun hatte und lediglich eine besondere Abkunft des fränkischen Herrschergeschlechts symbolisierte. Viele Theologen und Historiker bestreiten zudem energisch, dass Maria Magdalena je nach Gallien gekommen ist und verweisen in diesem Zusammenhang auf höchst widersprüchliche Überlieferungen. Nach der Version einer Legende landet die lebende Maria Magdalena in Gallien, während es in einer anderen Erzählung nur ihr Leichnam ist, der im neunten Jahrhundert nach Frankreich kommt. Einmal betätigt sich Maria Magdalena als christliche Missionarin und ein anderes Mal haust sie lediglich in einem südfranzösischen Höhlensystem und fristet ein ärmliches Dasein als fromme Einsiedlerin. Maria Magdalena scheint an den unterschiedlichsten Orten gleichzeitig aufgetaucht zu sein. Selbst im englischen Northumbria oder in der ägyptischen Wüste soll die vermeintliche Ehefrau Christi gelebt haben und gestorben sein.34