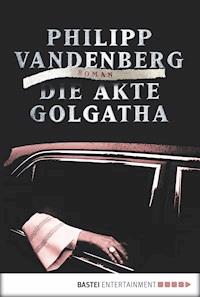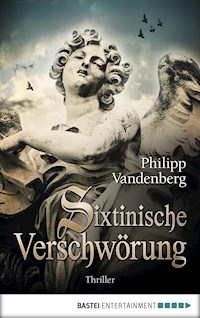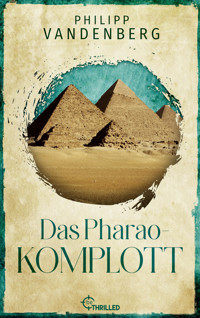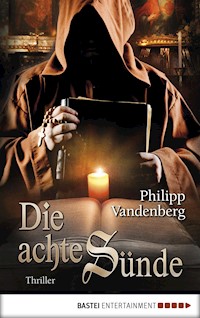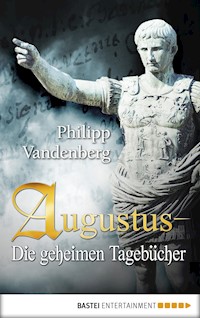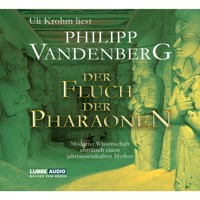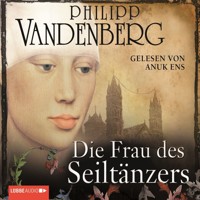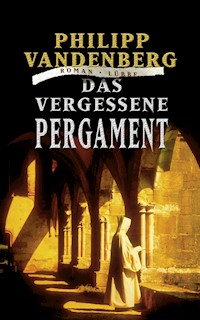
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Anno Domini 1412: In Köln, Straßburg, Regensburg, Chartres und Amiens stürzen Pfeiler ein, bersten Treppen, lösen sich Schlusssteine aus den Gewölben der Dome und Kathedralen - Strafe Gottes oder Teufelswerk? In einem fulminanten Roman erzählt Philipp Vandenberg die abenteuerliche Geschichte des Dombaumeisters Ulrich von Ensingen und der schönen Bibliothekarstochter Afra, die durch Zufall in den Besitz eines geheimnisvollen Pergaments gelangen. Als die Liebenden begreifen, dass sie mit dieser Schrift ein Dokument in Händen halten, für das der Vatikan zu töten bereit ist, sind sie bereits in Lebensgefahr. Gnadenlos von der "Loge der Abtrünnigen" verfolgt, beginnt eine wilde Jagd durch die größten Kirchen Europas ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 720
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
PHILIPP VANDENBERG
Mit Illustrationen von Tina Dreher
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2006/2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Daniela Bentele-Hendricks
Umschlaggestaltung: Bettina Reubelt
Unter Verwendung eines Motives von ©André Fasquel/Abtei Notre-Dame de Liteaux
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-7325-8434-5
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Prolog Teufelsspuren
1. Anno Domini 1400: Ein kalter Sommer
2. Bis zum Himmel und Höher
3. Ein leeres Pergament
4. Der schwarze Wald
5. Domgeheimnisse
6. Die Loge der Abtrünnigen
7. Bücher, nichts als Bücher
8. Für einen Tag und eine Nacht
9. Die Prophezeiung des Messer Liutprand
10. Hinter den Mauern von Montecassino
11. Der Kuss des Feuerschluckers
12. Eine Hand voll schwarzer Asche
Die Fakten
Nacht, tiefe Nacht lag über dem Straßburger Münster. Wie der Bug eines gestrandeten Schiffes ragte das Langhaus turmlos in den Himmel. Die Kathedrale war noch immer eine riesige Baustelle. Aus den engen Gassen drang vereinzelt Hundegebell zum Domplatz vor. Selbst der Gestank der Stadt, der während des Tages über den weiten Platz wehte, schien eingeschlafen. Das war die Stunde der Ratten. Fette struppige Tiere krochen hungrig aus ihren Schlupflöchern und huschten durch die Abfälle, die überall reichlich herumlagen. Längst hatten sie zum Inneren des Domes Zugang gefunden durch einen Brunnenschacht im Gebäude. Doch dort, wo die Menschen seelische Labsal suchten, gab es keine Rattenbeute.
Eine halbe Stunde nach Mitternacht versetzte ein mahlendes Geräusch die Domratten in Unruhe. So schnell es ihre fetten Leiber zuließen, verschwanden sie in ihren Verstecken. Nur hier und da ragte ein kahler Schwanz hervor. Das Geräusch kam näher, wurde lauter. Es hörte sich an, als riebe Stein auf Stein. Dann erneutes Schaben, Kratzen, Scharren – es war, als arbeitete sich der Teufel mit spitzen Krallen an den Wänden hoch. Dann wieder Stille. Man hätte Sand hören können, der zu Boden rieselt.
Plötzlich, als rollte ein gewaltiges Gewitter heran, schien es, als rumpelte ein Wagen durch den dunklen Chorraum der Kathedrale, dann hörte man das Krachen und Bersten zerspringenden Sandsteins. Wie bei einem Erdbeben erzitterten die fein gegliederten Pfeiler. Eine riesige Staubwolke drang bis in die entlegensten Winkel vor. Wieder wurde es still, und bald schon krochen die Ratten aus ihren Löchern hervor.
Eine Stunde mochte vergangen sein, als das Mahlen und Kratzen erneut einsetzte, so als ob ein unsichtbarer Steinmetz sich am Dombau zu schaffen machte. Oder versuchte Luzifer den Dom mit einer riesigen Brechstange zum Einsturz zu bringen? Man konnte geradezu fühlen, wie das Mauerwerk in Bewegung geriet. Stundenlang ging es so, bis im Osten das erste Grau des Morgens heraufzog. Noch hatte keiner von den Straßburger Bürgern, deren ganzer Stolz die Kathedrale war, bemerkt, was in dieser Nacht passiert war.
Am frühen Morgen machte sich der Küster auf den Weg zum Dom. Das Hauptportal war verschlossen, so wie er es am Vorabend zurückgelassen hatte. Er rieb sich die Augen, als er das Langhaus des Münsters betrat. Inmitten des Kirchenschiffs, dort wo sich Langhaus und Querschiff kreuzten, lagen Gesteinsbrocken herum, Teile eines geborstenen Quaders, der sich aus dem Gewölbe gelöst hatte.
Beim Näherkommen entdeckte der Küster linker Hand einen Pfeiler, der zur Hälfte in der Luft hing, weil ihm der Sockel abhanden gekommen war. Gesteinsreste lagen im Umkreis verstreut wie übel riechendes Futter, das von einem gefräßigen Ungeheuer zurückgelassen worden war. Fassungslos betrachtete der Küster das Bild der Zerstörung, unfähig, sich von der Stelle zu bewegen. Schließlich stürzte er schreiend und wie von Furien gejagt aus der Kathedrale und rannte, so schnell ihn seine alten Beine trugen, hinüber zur Dombauhütte, um zu berichten, was er mit eigenen Augen gesehen hatte.
Der Dombaumeister, ein Künstler seines Fachs und über die Grenzen des Landes berühmt für sein Können und die Exaktheit seiner Berechnungen, brachte kein Wort hervor, als er sah, was sich in der Nacht ereignet hatte. Von Natur aus eher den Erkenntnissen der Wissenschaft zugetan, der Physik und Arithmetik, stand er jedem Wunderglauben ablehnend gegenüber. Aber an diesem Morgen kamen ihm ernsthafte Zweifel. Nur ein Wunder war in der Lage, die Kathedrale zum Einsturz zu bringen. Und wenn er den sorgfältig herausgetrennten Schlussstein des Gewölbes betrachtete, dann kam dies einem Wunder gleich, einem teuflischen Wunder allerdings.
Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht, zuerst in der Stadt, schon bald aber im ganzen Land, der Teufel wolle die Kathedrale von Straßburg zum Einsturz bringen, weil sie, ein Menschenwerk, dem Himmel näher komme, als dem Leibhaftigen lieb sein konnte. Und bald darauf meldeten sich die ersten Augenzeugen, die in der fraglichen Nacht dem Teufel von Angesicht zu Angesicht begegnet sein wollten. Unter ihnen der Landvermesser, ein gottesfürchtiger Mann, wenngleich kein Frömmler. Er behauptete öffentlich, er habe des Nachts eine hinkende Gestalt beobachtet mit einem Pferdefuß, die mehrmals mit großen Sprüngen die Kathedrale umrundete.
Seither wagte sich keiner von den Straßburger Bürgern mehr in die stolze Kathedrale, bis Bischof Wilhelm erschien und mit einem Wedel aus feinstem Dachshaar geweihtes Wasser verspritzte im Namen des Allerhöchsten.
Noch während sich die Nachricht rheinabwärts verbreitete, während Maurer, Steinschneider und Steinmetze forschten, ob die Auflösungserscheinungen ihres Domes nicht eine natürliche Ursache haben könnten, geschah auch andernorts das Unfassbare. In Köln, wo Meister Arnold einen Dom errichten wollte nach dem Vorbild der Kathedrale von Amiens, gerieten des Nachts die steinernen Pfeilerfiguren Mariens und Petri, des Apostels, denen der halb fertige Dom geweiht war, in Bewegung. Ächzend, als litten sie unter ihrer eigenen Last, lösten sie sich von ihrem Sockel, drehten sich wie im Tanz um die eigene Achse und stürzten kopfüber in die Tiefe – nicht gleichzeitig wie durch ein Erdbeben verursacht, sondern als hätten sie sich abgesprochen eine nach der anderen in einer einzigen Nacht.
Den Steinmetzen, die nach einer stürmischen Nacht als Erste den Dom betraten, bot sich ein geisterhaftes Bild. Arme, Beine und Köpfe mit jenem Lächeln, das sie unter Anstrengung dem harten Stein abgerungen hatten, lagen am Boden verstreut wie billige Innereien, die auf dem nahen Markt feilgeboten wurden. Obwohl sie bekannt waren für die Härte ihres Charakters, begannen die Männer zu weinen in hilfloser Wut. Andere blickten ängstlich, ob nicht der Satan persönlich hinter einem der Pfeiler hervorträte, mit hämischem Grinsen im Gesicht und krächzender Stimme.
Bei näherem Hinsehen entdeckten die Steinmetze Goldmünzen im Schutt, ein kleines Vermögen wert und für viele der Hinweis, dass der Teufel stets mit barer Münze bezahle. Verächtlich und angewidert blickten die Männer auf das leuchtende Münzgold, und kaum einer wagte sich näher als zehn Fuß an das Teufelsgeld heran.
Endlich traf der Bischof, halb bekleidet und unordentlich, als habe er sich gerade erst aus den Armen einer Konkubine gelöst, am Schauplatz ein. Leise Gebete murmelnd – oder waren es gar Flüche? –, drängte er die Gaffer beiseite und besah sich den Schaden. Als er die Goldstücke erblickte, begann er die Münzen aufzuklauben. Eine nach der anderen verschwand in der Tasche seines Chorrocks. Bedenken der Steinmetze, es handle sich um Teufelsgeld, wischte er mit einer unwilligen Handbewegung beiseite und der Bemerkung, Geld sei Geld, im Übrigen habe nicht der Teufel, sondern er selbst vor Jahr und Tag die Goldmünzen unter dem Sockel des heiligen Petrus einmauern lassen, als Zeugnis für die Nachwelt.
Natürlich glaubte ihm niemand. Denn der Bischof war bekannt für seine Geldgier, und es hätte niemanden erstaunt, wenn er selbst vom Teufel Geld genommen hätte.
Drei Tage später kehrten Kaufleute an den Rhein zurück mit der Nachricht, in Regensburg, wo der Dombau weiter fortgeschritten sei als anderswo, habe der Teufel ebenfalls Einzug gehalten. Die Stadt quelle über von Gerüchten. Angeblich machten die Bürger inzwischen einen großen Bogen um die im Herzen Regensburgs gelegene Kathedrale. Sie fürchteten sogar, am helllichten Tag dem Leibhaftigen zu begegnen. Ja es gab Bürger, die wagten nicht mehr zu atmen, weil sie den pestilenten Gestank, der seit Wochen durch die engen Gassen wehte, für den Atem des Teufels hielten, der, würde er in ihr Innerstes dringen, die Seele zerfräße wie eine beißende Alchimistenlauge.
Auf diese Weise verlor ein Dutzend Regensburger Bürger sein Leben, allesamt gottesfürchtig und im Stand der Sakramente, darunter vier Nonnen des Damenstifts Niedermünster, nur einen Steinwurf von der Kathedrale entfernt, weil sie lieber erstickten als einzuatmen, was Luzifer bereits in seine Lungen aufgesogen hatte.
Im Stift Niedermünster hielten die Nonnen seither eine immerwährende Vigil, ein Chorgebet ohne Unterlass, Tag und Nacht, in der Hoffnung, dadurch den Teufelsatem aus der Stadt zu vertreiben. Dabei verbrannten sie Weihrauch in einem durchlöcherten Kessel, der vom Deckengewölbe ihrer Kirche hing und mit weit ausladenden Schwüngen in pendelnder Bewegung gehalten wurde. Die Rauchentwicklung des zentnerschweren Geräts war so stark, dass sie den frommen Frauen die Sicht nahm und sie hinderte, die Gebete in ihren Stundenbüchern zu lesen. Einigen raubte der auf diese Weise gereinigte Teufelsatem die Sinne. Sie verloren die Orientierung und irrten ziellos auf den Straßen umher. Andere brachen bewusstlos zusammen, für viele der Beweis, dass der Teufel auch im Niedermünster Einzug gehalten hatte.
Auslöser dieser Hysterie, die auch vor gesetzten Bürgern nicht Halt machte, waren wundersame Vorfälle im Dom, deren Wahrheitsgehalt den Chronisten jedoch in Bedrängnis bringt, weil die Wahrheit sich bekanntlich mit zunehmender Entfernung verflüchtigt.
So wollte ein Pelzhändler aus Köln mit eigenen Augen gesehen haben, wie der Südturm des Domes zu Regensburg in einer einzigen Nacht um ein ganzes Stockwerk zusammensank. Ein Wanderschausteller bezeugte beim Leben seiner greisen Mutter, das Westportal der Kathedrale sei, obwohl aus Stein errichtet wie alle Domportale, zusammengeschmolzen, als wäre es aus Wachs. Tatsache war, dass eines Morgens ein Sockelstein des Portals fehlte, und er tauchte auch nie wieder auf. Tatsache war auch das Verschwinden des Schlusssteins im Gewölbe des Langhauses. Der fehlende Stein wäre durchaus in der Lage gewesen, den Dom zum Einsturz zu bringen. Nur die hohe Kunst der Dombaumeister jener Tage und ihr schnelles Eingreifen verhinderten, dass dies geschah.
Die Gerüchte überschlugen sich, als von den Kathedralen in Mainz und Prag, von der Marienkirche in Danzig und der Frauenkirche in Nürnberg ähnliche Vorfälle gemeldet wurden. Sogar in Reims und Chartres gerieten Säulen und Pfeiler der großen Dome ins Wanken, stürzten Kapitelle und Galerien zu Boden, nachdem sie von unsichtbarer Hand aus dem Mauerwerk gelöst worden waren. Aus Burgos und Toledo, Salisbury und Canterbury wussten Reisende zu berichten, Menschen seien in den Kathedralen von berstenden Gesteinsmassen begraben worden.
Das war die große Zeit der Bußprediger, die winselnd und klagend durch die Lande zogen und dem Volk mit aufgehaltener Hand das irdische Jammertal vor Augen führten. Die Geißel der Hoffart habe sich zu jener der Wollust gesellt, und fraglos habe der Teufel seine scheußliche Pratze im Spiel. Gott der Herr lasse ihn nur deshalb gewähren, damit der Hochmut der Menschen zum Erliegen komme. Die geheimnisvollen Vorgänge seien der Beweis für den Unwillen des Allerhöchsten, der dem Pomp und Luxus der großen Dome abgeneigt sei. Ein Trugschluss sei es, zu glauben, die Kathedralen des Abendlandes seien für die Ewigkeit gebaut. Bewiesen nicht die Vorkommnisse der letzten Zeit das Gegenteil? Und konnte nicht jeden Tag, jede Stunde eine der großen Kathedralen, an die Luzifer gepisst hatte, einstürzen?
Mit ihren flammenden Reden verschonten die Bußprediger weder Volk noch Geistlichkeit, nicht einmal die Bischöfe kamen ungeschoren davon. Der Bußprediger Gelasius wetterte im Schatten des Kölner Domes gegen das verantwortungslose, gottlose Volk, dem nur an Macht und Reichtum gelegen sei. Bürgerfrauen wurden verteufelt, weil sie Kleider mit Schleppen trugen wie einen Pfauenschweif. Bedurften Frauen solcher Schwänze, so hätte Gott sie längst mit derartigen Auswüchsen versehen. Nein, nicht einmal die hohe Geistlichkeit sei ausgenommen von derlei Torheiten, wenn sie gelbe, grüne und rote Schuhe trüge, an jedem Fuß eine andere Farbe.
Wenn Mönche und gemeine Pfaffen, von Bischöfen ganz zu schweigen, ihre Gelüste mit fahrenden Frauen befriedigten, ohne daraus ein Geheimnis zu machen, dann stünden sie eher mit dem Teufel im Bunde als mit dem Allerhöchsten. Jeder wisse, dass der Bischof lieber die Brüste seiner Konkubine segne als den Leib unseres Herrn. Und wenn drei Päpste sich den Platz streitig machten um den Ersten auf Erden und jeder den anderen mit dem Kirchenbann belege, als wäre er ein Ketzer, dann sei das Jüngste Gericht nicht mehr fern, und niemand dürfe sich wundern, wenn der Teufel sich der Gotteshäuser bemächtige.
Wimmernd und greinend schlichen die Zuhörer davon. Und während die einen bange Blicke zur Giebelspitze des Domes warfen, krochen andere wie Tiere auf allen vieren und schluchzten wie Kinder, denen der Vater mit furchtbarer Strafe gedroht hat. Vornehme Männer rissen sich ihre samtenen Kappen vom Kopf und zertrampelten den Federschmuck. Frauen entledigten sich noch auf der Straße ihrer zuchtlosen Kleider, welche die Brüste zeigten, unverhüllt und wie gewachsen, und Ärmelstulpen, die beinahe bis auf die Erde reichten. Pöbel und Bettler, die das alles nichts anging, weil die Bibel ihnen ohnehin das Himmelreich versprach, stritten sich um die Gewänder und zerrissen die kostbare Kleidung, damit jeder einen Fetzen davontragen konnte.
In der Stadt herrschte Aufruhr, und die reichen Bürger verrammelten die Türen und stellten Wachen auf wie in Zeiten von Pest und Cholera. Sogar hinter verschlossenen Türen war man bemüht, das Husten und Niesen zu unterdrücken, galt es doch als Zeichen des Teufels, der aus dem Körper herausfuhr. Bei Nacht waren die Schritte der Stadtknechte zu hören, die mit baumhohen Lanzen bewaffnet durch die Gassen marschierten. Und was sonst nur am Karfreitag vor der Auferstehung des Herrn geschah: Die Badehäuser, Horte sündhaften Treibens, blieben leer.
Am nächsten Morgen erwachten die Bürger von Köln mit bitterem Geschmack im Mund. Den konnte nur der Teufel hinterlassen haben. Später als gewöhnlich verließen die meisten ihre Häuser. Über dem Dom kreisten große schwarze Vögel. Ihr Krächzen glich an diesem Morgen eher dem hilflosen Geschrei kleiner Kinder. Die aufgehende Sonne tauchte das Hauptportal der Kathedrale in helles Licht. Die Seiten des Bauwerks lagen im Schatten und wirkten düster und bedrohlich, anders als an anderen Tagen. Sogar die Steinmetze, die längst ihre Arbeit aufgenommen hatten und denen Wind und Wetter nichts ausmachten, fröstelten aus nicht ersichtlichem Grund.
Ein Steinmetz war es auch, dem der heruntergekommene Mann auf den Stufen des Domportals auffiel. Mit dem Rücken an die Wand gelehnt, dämmerte er vor sich hin. Das war keine Besonderheit. Fremde und Handwerker auf der Wanderschaft verbrachten häufig die Nacht auf den Domstufen. Aber nach einer Nacht wie dieser, wo Misstrauen die Blicke lenkte, erregte jeder Fremde besonderes Interesse. Sein langes Gewand war zerschlissen und ähnelte jener schwarzen Kutte des Bußpredigers, der die Stadt am Vorabend in Endzeitstimmung versetzt hatte. Und tatsächlich, im Näherkommen erkannte der Steinmetz Bruder Gelasius, der den Kölnern tags zuvor das Jüngste Gericht angekündigt hatte. Die Hände des Bußpredigers zitterten. Sein Blick war starr auf den Boden gerichtet.
Der Frage des Steinmetzen, ob er wirklich Gelasius sei, der Bußprediger, begegnete dieser mit einem stummen Kopfnicken, jedoch ohne aufzublicken. Der Steinmetz wollte schon gehen und sich seiner Arbeit zuwenden, als der Bußprediger unerwartet den Mund öffnete. Aber statt Worten quoll ein Schwall schwarzes Blut hervor und überflutete wie ein Sturzbach sein zerschlissenes Gewand.
Zu Tode erschrocken wich der Steinmetz zurück, er wusste nicht, was er tun sollte, und blickte Hilfe suchend um sich. Aber da war niemand, der ihm zu Hilfe eilte. Mit dem Zeigefinger deutete Gelasius auf seinen geöffneten Mund und gab gurgelnde, lallende Laute von sich wie ein Blöder aus dem Siechenhaus. Jetzt erst begriff der Steinmetz, ja er konnte es deutlich sehen: Man hatte dem Bußprediger die Zunge herausgeschnitten.
Der Steinmetz sah Gelasius fragend an. Wer hatte den Bußprediger auf so grausame Weise mundtot gemacht?
Gelasius krümmte seine blutverschmierten zitternden Zeigefinger und legte sie links und rechts an die Stirne. Und damit er sicher sein konnte, dass ihn der Steinmetz verstand, legte er seine Rechte an seinen Hintern und deutete eine Bewegung an, als wollte er einen langen Schwanz beschreiben.
Dann hob er seinen Blick ein letztes Mal, und in seinen Augen stand das Grauen.
Der Steinmetz bekreuzigte sich und stürzte in Panik davon. Wie hätte er auch ahnen können, dass es für das Unheil, das über die Städte eingebrochen war und die Menschen in Angst und Schrecken versetzte, eine durchaus natürliche Erklärung gab, die ihren Ursprung in einer verschlossenen Schatulle hatte, die – der Büchse einer Pandora gleich –, einmal geöffnet, das ganze Land in Aufruhr versetzen sollte. Enthielt sie doch ein Stück Papier, für das viele zu morden bereit gewesen wären. Im Namen des Herrn oder ohne ihn.
Hätte der Steinmetz gewusst, was zwölf Jahre zuvor, Anno Domini 1400, geschehen war, hätte er begriffen. Doch so begriff er nichts. Keiner konnte all das begreifen. Und die Angst ist ein schlechter Ratgeber.
Als die Zeit ihrer Niederkunft nahte, nahm Afra, die Jungmagd des Landvogts Melchior von Rabenstein, einen Korb, mit dem sie für gewöhnlich Pilze sammelte, und mit letzter Kraft schleppte sie sich in den Wald hinter dem Gehöft. Niemand hatte dem Mädchen mit den langen Zöpfen die notwendigen Handgriffe beigebracht, welche eine Geburt erfordert, denn ihre Schwangerschaft war bis zu diesem Tag unbemerkt geblieben. Geschickt hatte sie es verstanden, das Wachstum des Kindes in ihrem Leib unter weiten, derben Gewändern zu verbergen.
Beim letzten Erntefest war sie von Melchior, dem Landvogt, auf dem Heuboden der großen Scheune geschwängert worden. Wenn sie nur daran dachte, wurde ihr übel, als hätte sie fauliges Wasser getrunken oder madiges Fleisch gegessen. Unauslöschbar blieb das Bild in ihrem Gedächtnis eingebrannt, wie der geile Alte, dessen Zähne schwarz und brüchig waren wie vermodertes Holz, über sie herfiel mit gierigen Glotzaugen. Sein linker Beinstumpf, an dem über dem Knie eine hölzerne Keule festgeschnallt war zur Fortbewegung, zitterte vor Erregung wie ein Hundeschwanz. Nach der rüden Verrichtung hatte der Landvogt gedroht, Afra vom Hof zu jagen, sollte sie auch nur ein Sterbenswörtchen über den Vorfall verlauten lassen.
In ihrer Scham und von der Schande gezeichnet, schwieg sie. Nur dem Pfaffen beichtete Afra den Vorfall in der Hoffnung auf Vergebung ihrer Sündhaftigkeit. Das schaffte eine gewisse Erleichterung, zunächst jedenfalls, weil sie täglich, drei Monate lang, fünf Vaterunser und ebenso viele Ave-Maria betete zur Buße. Doch als sie bemerkte, dass die Untat des Landvogts nicht ohne Folgen geblieben war, überkam sie hilflose Wut, und sie weinte nächtelang. In einer dieser endlosen Nächte fasste Afra schließlich den Plan, sich des Bastards im Wald zu entledigen.
Jetzt klammerte sie sich, einem Instinkt folgend, mit gestreckten Armen an einen Baum, die Beine breit, in der Hoffnung, das ungewollte Leben würde aus ihr herausfallen wie bei einer Kuh, die kalbte. Das war ihr nicht fremd. An dem feuchten Stamm der Fichte wucherte der Hallimasch, ein gelber Blätterpilz, und verbreitete einen beißenden Geruch. Heftiger Schmerz drohte ihren Leib zu zerreißen, und um ihre Schreie zu unterdrücken, biss Afra in ihren Oberarm. Mit zitternden Lungen sog sie den Pilzgeruch durch ihre Nase. Er wirkte für einen Augenblick betäubend, so lange, bis das lebendige Etwas in ihr auf das weiche Moos des Waldbodens plumpste: ein Junge mit dunklem zottigem Haar, wie es der Landvogt hatte, und einer kräftigen Stimme, dass sie fürchten musste, man könnte sie entdecken.
Afra fröstelte, sie zitterte vor Angst und Schwäche und war nicht in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen. Ihr Plan, das Neugeborene nach der Geburt mit dem Kopf gegen einen Baum zu schlagen, wie es ihr mit den Stallhasen geläufig war, verflüchtigte sich. Was aber sollte sie tun? Wie von Sinnen entledigte sie sich eines Rockes, von denen sie zwei übereinander trug, riss ihn in Fetzen und wischte damit das Blut von dem kleinen Körper des Neugeborenen. Dabei machte sie eine seltsame Entdeckung, die sie jedoch zunächst kaum beachtete, weil sie glaubte, in ihrer Aufregung habe sie sich verzählt. Doch dann wiederholte sie den Zählvorgang noch einmal und noch einmal: An der linken Hand des Kindes wuchsen sechs winzige Finger. Afra erschrak. Ein Vorzeichen des Himmels! Aber was hatte es zu bedeuten?
Wie in Trance wickelte sie das Neugeborene in die übrig gebliebenen Fetzen ihres Rockes, legte es in den Korb und hängte diesen, zum Schutz vor wilden Tieren, am untersten Ast der Fichte, die ihr als Gebärstuhl gedient hatte, auf.
Den Rest des Tages verbrachte Afra im Stall bei den Tieren, um den Blicken des Gesindes aus dem Weg zu gehen. Sie wollte allein sein mit ihren Gedanken und der bangen Frage, was das Zeichen des Himmels zu bedeuten hatte: sechs Finger an einer Hand. Ihr Vorhaben, das Neugeborene zu töten, hatte sie längst aus dem Gedächtnis gestrichen.
Aus der Bibel kannte Afra die Geschichte vom kleinen Moses, der, von seiner Mutter ausgesetzt, in einem Weidenkorb nilabwärts schwamm, bis eine Prinzessin das Kind aus dem Wasser zog und ihm eine vornehme Erziehung angedeihen ließ. Keine zwei Stunden Weges entfernt floss der große Strom. Aber wie sollte sie unbemerkt das Kind dorthin bringen? Auch fehlte ihr ein sicheres Behältnis, das dem Kind als Schifflein gedient hätte.
Mit trüben Gedanken begab sich die Magd bei Einbruch der Dämmerung in die Gesindekammer unter dem Dachgebälk des Fachwerkhauses. Vergeblich versuchte sie Schlaf zu finden, aber obwohl ihr die heimliche Geburt die letzten Kräfte abverlangt hatte, tat sie kein Auge zu. Ihre Sorge galt dem Neugeborenen, das hilflos im Geäst hing. Sicher fror es in seinem Korb und weinte und lockte Menschen und Tiere an. Am liebsten wäre Afra aufgestanden und hätte sich in der Dunkelheit aufgemacht in den Wald, um nach dem Rechten zu sehen; doch das schien ihr zu verräterisch.
Voller Unruhe wartete sie am nächsten Morgen auf eine günstige Gelegenheit, sich unbemerkt vom Gehöft zu entfernen. Erst gegen Mittag gelang es ihr sich davonzustehlen, und Afra rannte mit bloßen Füßen in den Wald zu der Stelle, wo sie tags zuvor niedergekommen war. Atemlos machte sie Halt und suchte nach dem Ast, an dem sie den Korb mit dem Neugeborenen aufgehängt hatte. Zuerst glaubte sie, sie habe sich in der Aufregung verlaufen; denn der Weidenkorb war verschwunden. Mühsam versuchte Afra sich zu orientieren. War es ein Wunder, wenn das Ereignis des Vortages ihre Wahrnehmung verwirrt hatte? Schon wollte sie eine andere Richtung einschlagen, als ihr der penetrante Geruch der Baumpilze in die Nase stach, und als sie den Boden mit den Augen absuchte, entdeckte sie dunkle Blutflecken auf dem Moos.
Beinahe täglich lief Afra in den folgenden Tagen in den Wald, um nach dem Verbleib ihres ausgesetzten Kindes zu forschen. Der Dienstmagd sagte sie, sie suche nach Pilzen. Sie fand auch jedes Mal genug, gelbe Rehlinge und feiste Steinpilze, Braunkappen mit glänzenden Helmen und Hallimasch, so viel sie tragen konnte; aber eine Spur, einen Hinweis, was mit dem Neugeborenen geschehen sein mochte, fand sie ebenso wenig wie ihren Seelenfrieden.
Darüber verging das Jahr, es wurde Herbst, und die tiefe Sonne färbte die Blätter rot und die Nadeln braun. Wie ein Schwamm sog das Moos die kalte Nässe auf, und der Weg durch den Wald wurde immer beschwerlicher, und allmählich gab Afra die Hoffnung auf, noch irgendein Lebenszeichen ihres Kindes zu entdecken.
Zwei lange Jahre gingen ins Land, und während für gewöhnlich die Zeit alle Wunden heilt, die das Leben schlägt, kam Afra über das furchtbare Geschehen nicht hinweg. Jede Begegnung mit Melchior, dem Landvogt, ließ die Erinnerung wach werden, und sie nahm Reißaus, wenn sie das dumpfe Stampfen seines Holzfußes auch nur aus der Ferne vernahm. Auch Melchior mied den Umgang mit ihr, jedenfalls bis zu jenem Herbsttag im September, als sie auf dem größten Baum hinter der Scheune Äpfel pflückte, kleine grüne Früchte, die der regnerische kühle Sommer nicht größer hatte gedeihen lassen. Vertieft in die mühevolle Ernte bemerkte Afra nicht, wie der Landvogt heranschlich und am Fuß der Leiter mit gierigen Augen unter ihre Röcke spähte. Unterkleider waren ihr fremd, und so erschrak sie zu Tode, als sie die sündhaften Blicke des Mannes bemerkte.
Ohne Scham und in rauem Ton herrschte Melchior die Magd an: »Komm herunter, du kleine Hure!«
Verängstigt kam Afra der Aufforderung nach, doch als der Lüstling versuchte, sie ungestüm an sich zu pressen und ihr Gewalt anzutun, da wehrte sie sich heftig und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht, dass ein Blutstrahl aus seiner Nase schoss wie beim Abstechen eines Schweines, und ihr derbes Gewand verfärbte sich rot. Den rabiaten Landvogt schien ihre Gegenwehr nur noch mehr zu reizen, denn er ließ nicht von ihr ab, im Gegenteil, wie von Sinnen riss er das Mädchen zu Boden, stülpte ihr die Röcke über den Kopf und fingerte sein Gemächt aus den Beinkleidern.
»Nur zu, nur zu!«, keuchte Afra. »Es wird dir schon gelingen, mich ein zweites Mal ins Unglück zu stürzen, das auch das deine ist!«
Für einen Augenblick hielt Melchior inne, als sei er zur Besinnung gekommen. Afra nutzte den Augenblick und stieß hervor: »Dein letzter Fehltritt ist nicht ohne Folgen geblieben, ein Junge mit ebensolchem Kraushaar wie deins!«
Melchior blickte unsicher. »Du lügst!«, schrie er schließlich und fügte hinzu: »Kleine Hure!« Dann ließ er von ihr ab. Aber nicht, um sich nach den näheren Umständen zu erkundigen, sondern um sie zu schelten und zu beschimpfen: »Niederträchtige Metze, glaubst du, ich habe dich nicht durchschaut? Mit deinen Worten verfolgst du kein anderes Ziel, als mich zu erpressen! Ich werde dich lehren, wie man mit Melchior, dem Landvogt, umgeht, du hinterlistige Hexe!«
Afra zuckte zusammen. Jeder im Land zuckte zusammen, wenn er das Wort Hexe nur hörte. Frauen und Pfaffen schlugen ein Kreuzzeichen. Es genügte die Anschuldigung, eine Hexe zu sein, und bedurfte keines Beweises, um eine gnadenlose Verfolgung in Gang zu setzen.
»Hexe!«, wiederholte der Landvogt und spuckte in weitem Bogen auf den Boden. Dann ordnete er seine Kleider und humpelte mit hektischen Schritten davon.
Tränen rannen über ihr Gesicht, Tränen hilfloser Wut, als Afra mühsam aufstand. Verzweifelt presste sie die Stirne gegen die Leiter und schluchzte laut. Wenn der Landvogt sie als Hexe beschuldigte, hatte sie kaum eine Möglichkeit, ihrem Schicksal zu entkommen.
Als die Tränen nachließen, blickte Afra an sich herab. Das Mieder war zerfetzt, Rock und Bluse von Blut getränkt. Um Fragen aus dem Weg zu gehen, kletterte Afra bis in den Wipfel des Baumes. Dort wartete sie die Dämmerung ab. Nach dem Abendläuten, das aus der Ferne zu ihr herüberschallte, wagte sie sich endlich aus ihrem Versteck und schlich zum Hof zurück.
In der Nacht überfielen sie quälende Gedanken und Bilder. Folterknechte näherten sich ihr mit glühenden Eisen, und hölzerne Maschinen mit Rädern und Stacheln warteten darauf, ihren jugendlichen Leib zu schinden. In dieser Nacht fasste Afra einen Entschluss, der ihr Leben verändern sollte.
Niemand bemerkte, als Afra sich kurz nach Mitternacht aus dem Gesinderaum stahl. Sie mied jede Dielenplanke, die ein Knarren von sich gab, und gelangte, ohne ein verräterisches Geräusch zu verursachen, zu der steilen Treppe, die vom Dachgebälk im Zickzack nach unten führte. Behutsam schnürte sie in der Kleiderkammer der Mägde ein Bündel aus Gewändern, griff sich ein paar Schuhe, die sie in der Dunkelheit ertastete. Barfuß verließ sie das Haus durch die Hintertür.
Auf dem Hof schlug ihr feuchter Nebel wie ein dichtes Gespinst entgegen, und sie nahm den Weg zur großen Scheune. Obwohl Nebel Mond und Sterne verhüllte, setzte sie sicher einen Fuß vor den anderen. Der Weg war ihr geläufig. An dem kleinen Zugang neben dem großen Tor angelangt, schob Afra den hölzernen Riegel beiseite und öffnete die Türe. Noch nie war ihr aufgefallen, dass diese Türe beim Öffnen klagende Laute verursachte wie eine alte Katze, der man auf den Schwanz tritt. Die quietschende Türe erschreckte sie zu Tode, und als einer der sechs Hunde des Landvogts anschlug, fuhr ihr der Schreck in alle Glieder. Ihr Herz schlug bis zum Hals, und sie rührte sich nicht von der Stelle. Wie durch ein Wunder stellte der Köter das Bellen wieder ein. Es schien, als hätte sie niemand bemerkt.
Afras Ziel war der hintere Teil der Scheune, deren Boden zum Schutz vor Feuchtigkeit mit breiten Holzplanken bedeckt war. Dort unter der letzten Planke hatte Afra ihren kostbarsten und einzigen Besitz versteckt. Obwohl es stockfinster war in der Scheune, tastete die Magd sich bis zu ihrem Versteck vor, trat barfüßig auf eine Maus oder Ratte, die quiekend davonstob, hob das Bodenbrett hoch und zog eine flache, mit Sackleinwand bezogene Schatulle hervor. Sie war ihr wertvoller als alles andere. Bedacht, kein weiteres Geräusch zu verursachen, stahl Afra sich vom Gehöft des Landvogts, das ihr seit dem zwölften Lebensjahr Heimat gewesen war.
Sie musste davon ausgehen, dass ihre Abwesenheit schon früh am Morgen bemerkt würde, aber Afra war sich ebenso sicher, dass kaum jemand nach ihr suchen würde. Damals, vor drei Jahren, als die alte Gunhilda von der Feldarbeit nicht zurückkehrte, hatte sich auch niemand um sie gesorgt, und es war eher Zufall, als der Jäger des Landvogts ihre Leiche in einer Linde baumeln sah. Sie hatte sich erhängt.
Nach einer Stunde Weges in der Dunkelheit hob sich der Nebel, und Afra, die am Waldrand die westliche Richtung eingeschlagen hatte, versuchte sich zu orientieren. Sie wusste selbst nicht, wohin sie eigentlich wollte. Nur weg, weit weg von Melchior, dem Landvogt. Fröstelnd hielt sie inne und lauschte in die Nacht.
Von irgendwoher drang ein merkwürdiges Geräusch, nicht unähnlich dem munteren Zischeln und Murmeln kleiner Kinder. Im Weitergehen stieß Afra auf einen Bach, der sich ungestüm am Waldrand entlangschlängelte. Eisige Kälte stieg von dem Gewässer auf, und obwohl die flüchtende Magd das Bedürfnis hatte, die Luft tief in ihre Lungen zu saugen, atmete sie nur in kurzen Stößen. Sie war mit ihren Kräften am Ende. Ihre nackten Füße schmerzten. Trotzdem wagte sie nicht, die kostbaren Schuhe, die sie in ihrem Bündel mit sich führte, anzuziehen.
Am Fuß einer knorrigen Weide, dicht neben dem rauschenden Gewässer, ließ Afra sich nieder. Sie zog die Beine an und steckte die Unterarme in die Ärmel ihres Kleides. Und während sie vor sich hin döste, kamen ihr Zweifel, ob sie sich nicht voreilig zur Flucht entschlossen hatte.
Gewiss, Melchior von Rabenstein war ein ekelhaftes Scheusal, und wer weiß, was er ihr noch alles angetan hätte; aber wäre all das schlimmer gewesen, als irgendwo im Wald zu verhungern oder zu erfrieren? Afra hatte nichts zu essen, sie hatte kein Dach über dem Kopf, ja sie wusste nicht einmal, wo sie überhaupt war und wohin sie wollte. Aber als Hexe auf dem Scheiterhaufen enden? Aus ihrem Bündel zog Afra einen weiten Umhang aus dickem Stoff. Damit deckte sie sich zu und versuchte sich auszuruhen.
An Schlaf war nicht zu denken. Zu viele Gedanken strömten auf sie ein. Als sie schließlich nach endloser Nacht die Augen öffnete, plätscherte der Bach zu ihren Füßen im Morgenlicht. Milchige Schwaden stiegen aus dem Wasser auf. Es roch nach Fisch und Moder.
Sie hatte noch nie eine Landkarte gesehen, nur gehört, dass es so etwas gab, ein Pergament, auf dem Flüsse und Täler, Städte und Berge winzig klein und aus der Sicht der Vögel aufgezeichnet waren – ein Wunder oder Zauberei? Unentschlossen starrte Afra in das fließende Gewässer.
Irgendwohin, dachte sie, muss der Bach ja wohl fließen. Jedenfalls hielt sie es für angebracht, dem Gewässer flussabwärts zu folgen. Jeder Bach sucht einen Fluss, und an jedem Fluss liegt eine Stadt. Also nahm sie ihr Bündel wieder auf und folgte dem schlängelnden Bachlauf.
Linker Hand ihres Weges leuchteten rote Moosbeeren am Waldrand. Afra pflückte eine Hand voll und schaufelte sie mit hohler Hand in den Mund. Sie schmeckten sauer, aber die Säuernis weckte ihre Lebensgeister, und sie beschleunigte ihre Schritte, als gelte es, irgendwo zur festgesetzten Zeit zu erscheinen.
Gegen Mittag mochte es wohl sein, und Afra hatte etwa fünfzehn Meilen zurückgelegt, da traf sie auf einen wuchtigen gefällten Baumstamm, der quer über dem Bach lag und als Brücke diente. Vom jenseitigen Ufer führte ein ausgetretener Pfad zu einer Lichtung.
Eine innere Stimme mahnte Afra, den Bach nicht zu überqueren, und da sie ohnehin kein Ziel vor Augen hatte, ging sie weiter, immer den Bachlauf entlang, bis ihr Rauch in die Nase stieg, ein untrügliches Zeichen für eine menschliche Ansiedlung.
Afra überlegte, was sie auf Fragen antworten sollte, die man ihr stellen würde. Eine junge Frau, allein auf Wanderschaft, forderte Fragen geradezu heraus. Sie war nicht besonders geschickt im Geschichtenerfinden. Das Leben hatte sie nur die harte Realität gelehrt. Deshalb entschied sie sich, auf alle Fragen die Wahrheit zu sagen: dass der Landvogt ihr Gewalt angetan habe und dass sie auf der Flucht sei vor seinen Nachstellungen und bereit, jede Arbeit anzunehmen, die ihr Brot und ein Dach über dem Kopf verspreche.
Sie war noch nicht zu Ende mit diesem Gedanken, als der Wald, der sie die Nacht und den ganzen Tag begleitet hatte, abrupt endete und einer weiten Wiesenlandschaft Platz machte. In der Mitte des Wiesengrundes stand eine Mühle, und der klatschende Rhythmus des Wasserrades war eine halbe Meile weit zu vernehmen. Aus sicherer Entfernung beobachtete Afra, wie sich ein Ochsenfuhrwerk, beladen mit prallen Säcken, in südlicher Richtung entfernte. Das alles machte einen so friedfertigen Eindruck, dass Afra keine Bedenken hatte, sich der Mühle zu nähern.
»He, woher kommst du und was suchst du hier?«
Im oberen Stockwerk des alten Fachwerkhauses kam ein breiter Schädel zum Vorschein, das schüttere Haar weiß bestäubt, mit einem freundlichen Grinsen im Gesicht.
»Ihr seid wohl der Müller dieses schmucken Anwesens?«, rief Afra nach oben, und ohne eine Antwort abzuwarten, fügte sie hinzu: »Auf ein Wort!«
Der breite Schädel verschwand in der Fensteröffnung, und Afra begab sich zum Eingang. Augenblicklich erschien in der Türe eine wohlbeleibte Frau mit dicken Oberarmen und von gedrungenem Körperbau. Herausfordernd verschränkte sie die Arme vor der Brust. Sie sagte kein Wort und musterte Afra wie einen Eindringling. Schließlich trat der Müller aus dem Hintergrund hinzu, und als er die ablehnende Haltung seiner Frau bemerkte, änderte sich sein zunächst freundliches Gesicht von einem Herzschlag zum anderen.
»Wohl so eine Zigeunerin aus Indien?«, griente er mit verächtlichem Tonfall, »so eine, die unsere Sprache nicht spricht und nicht getauft ist wie die Juden. Wir geben nichts, und solchen schon gar nichts!«
Müller waren bekannt für ihren Geiz – Gott weiß, wie es zu diesem Verhalten kam –, aber Afra ließ sich nicht einschüchtern. Ihre vollen dunklen Haare und ihre von der Arbeit im Freien gebräunte Haut mochten in der Tat den Eindruck erwecken, sie sei eine von dem Zigeunervolk aus dem Orient, welches das ganze Land überzog wie ein Heuschreckenschwarm.
Deshalb erwiderte sie selbstbewusst, beinahe zornig: »Ich kenne Eure Sprache genauso gut wie Ihr, und getauft bin ich ebenso, wenngleich es noch nicht so lange her ist wie bei Euch. Wollt Ihr mich jetzt anhören?«
Da schlug der ablehnende Gesichtsausdruck der Müllerin mit einem Mal ins Gegenteil um, und sie fand freundliche Worte: »Musst seine Worte nicht übel nehmen, er ist ein guter, frommer Mann. Aber es vergeht kaum ein Tag, den Gott werden lässt, an dem nicht irgendwelches arbeitsscheues Gesindel um etwas bettelt. Würden wir allen etwas geben, hätten wir bald selbst nichts mehr zu beißen.«
»Ich komme nicht als Bettlerin«, entgegnete Afra, »ich suche Arbeit. Ich bin Magd seit meinem zwölften Jahr und habe arbeiten gelernt.«
»Noch ein Fresser unter meinem Dach!«, tat der Müller entrüstet. »Haben zwei Gesellen und vier kleine hungrige Mäuler zu stopfen, nein, zieh weiter und stiehl uns nicht die Zeit!« Dabei machte er eine Handbewegung in die Richtung, aus der sie gekommen war.
Afra sah ein, dass mit dem Müller kein Auskommen war, und wollte sich abwenden, als die dicke Frau ihrem Mann in die Seite puffte und den Müller zur Einsicht mahnte: »Eine Jungmagd zur Hilfe stünde mir gut an, und wenn sie tüchtig ist, warum sollten wir ihre Dienste nicht in Anspruch nehmen? Sie sieht nicht so aus, als würde sie uns die Haare vom Kopf fressen.«
»Tu, was du willst«, meinte der Müller beleidigt und verschwand im Inneren des Hauses, um seiner Arbeit nachzugehen.
Entschuldigend hob die feiste Müllerin ihre Schultern. »Er ist ein guter, frommer Mann«, wiederholte sie und unterstrich ihre Behauptung mit heftigem Kopfnicken. »Und du? Wie heißt du überhaupt?«
»Afra«, erwiderte Afra.
»Und mit der Frömmigkeit?«
»Mit der Frömmigkeit?«, wiederholte Afra verlegen. Weit her war es nicht mit der Frömmigkeit. Das musste sie zugeben. Sie haderte mit Gott, dem Herrn, seit ihr das Leben so übel mitgespielt hatte. Ein Lebtag lang hatte sie sich nichts zuschulden kommen lassen, hatte sie die Gebote der Kirche geachtet und kleinste Verfehlungen gebeichtet und Buße getan. Warum hatte Gott, der Herr, so viel Unglück über sie gebracht?
»Ist wohl nicht so weit her mit der Frömmigkeit«, sagte die dicke Müllerin, die Afras Zögern bemerkte.
»Was Ihr denken wollt!«, entrüstete sich diese. »Ich habe alle Sakramente empfangen, die meinem Alter angemessen sind, und das Ave-Maria kann ich sogar auf Lateinisch hersagen, was die meisten Pfaffen nicht einmal können.« Und ohne eine Reaktion der Müllersfrau abzuwarten, begann sie: »Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulicribus, et benedictus fructus ventris tui …«
Die Müllerin bekam große Augen und faltete andächtig die Hände über ihren gewaltigen Brüsten. Nachdem Afra geendet hatte, fragte sie unsicher: »Schwöre bei Gott und allen Heiligen, dass du nichts gestohlen hast und dir auch sonst nichts zuschulden hast kommen lassen. Schwöre es!«
»Das will ich gerne tun!«, erwiderte Afra und hob die rechte Hand. »Der Grund, warum ich hier vor Eurer Türe stehe, ist die Gottlosigkeit des Landvogts, der mir seinen Willen aufzwang und mir die Unschuld raubte.«
Die Müllerin schlug heftig mehrere Kreuzzeichen. Schließlich meinte sie: »Du bist kräftig, Afra. Und kannst sicher zupacken.«
Afra nickte und folgte der Müllerin ins Haus, wo vier kleine Kinder – das jüngste mochte gerade zwei Jahre alt sein – herumtollten. Als sie die Fremde erblickten, rief die Älteste, ein Mädchen von etwa acht Jahren: »Eine Zigeunerin, eine Zigeunerin! Sie soll verschwinden!«
»Du darfst das den Kindern nicht übel nehmen«, meinte die dicke Müllerin, »ich habe ihnen eingeschärft, Fremden aus dem Weg zu gehen. Wie ich schon sagte, treibt sich viel hungriges Gesindel in der Gegend herum. Sie stehlen wie die Raben und machen selbst vor Kindern nicht Halt, mit denen sie regelrechten Handel treiben.«
»Die fremde Hexe soll verschwinden!«, wiederholte die Älteste. »Ich fürchte mich vor ihr.«
Mit freundlichen Worten versuchte Afra, sich bei den Kindern einzuschmeicheln. Aber als sie versuchte, die Wange des ältesten Mädchens zu streicheln, zerkratzte die Göre ihr das Gesicht und schrie: »Fass mich nicht an, Hexe!«
Der Mutter gelang es schließlich durch gutes Zureden, die aufgebrachten Kinder zu beruhigen, und Afra bekam eine Ecke in dem großen düsteren Raum zugewiesen, der das ganze obere Stockwerk der Mühle einnahm. Hier legte Afra ihr Bündel ab, unter den misstrauischen Blicken der Müllerin.
»Wie kommt eine junge Magd wie du dazu, das Ave-Maria auf Lateinisch zu beten«, fragte die dicke Frau, der Afras Vortrag keine Ruhe gelassen hatte. »Du bist nicht etwa aus einem Kloster davongelaufen, wo man so etwas lernt?«
»Wo denkt Ihr hin, Müllerin«, lachte Afra, ohne auf ihre Frage zu antworten, »es ist so, wie ich sagte, nicht anders.«
Überall im Haus dröhnte das dumpfe Stampfen des Mühlrades, unterbrochen vom schäumenden Rhythmus des Wassers, welches aus den Radschaufeln in die Tiefe klatschte. In den ersten Nächten fand Afra keinen Schlaf. Allmählich gewöhnte sie sich jedoch an die neuen Geräusche. Auch gelang es ihr, das Zutrauen der Müllerskinder zu gewinnen. Die Knechte behandelten sie mit Zuvorkommenheit, und alles schien sich zum Besten zu wenden.
Doch um Cecilia und Philomena herum begann das Unheil. Tiefe dunkle Wolken jagten über das Land, angetrieben von eisigem Wind. Zaghaft zuerst begann es zu regnen, dann immer stärker, und schließlich stürzten die Wasser vom Himmel wie Sturzbäche im Gebirge. Der Bach, der die Mühle antrieb, für gewöhnlich kaum zehn Ellen breit, trat über die Ufer und gebärdete sich wie ein reißender Fluss.
In höchster Not öffnete der Müller die Schleuse, und die Knechte schaufelten eilig einen Graben, um die heranströmenden braunen Wassermassen zu teilen. Mit Bangen beobachtete der Müller, wie das riesige Mühlrad sich immer schneller drehte.
Nach vier Tagen und Nächten hatte der Himmel ein Einsehen, und der Regen ließ nach; doch der Bach schwoll noch weiter an und drehte das Mühlrad in rasender Geschwindigkeit. Nächtens wachte der Müller, um die hölzernen Achslager in kurzen Abständen mit Rindertalg zu schmieren, und er glaubte schon, das Schlimmste verhindert zu haben, als in den frühen Morgenstunden des sechsten Tages die Katastrophe hereinbrach.
Es schien, als bebte die Erde. Mit lautem Krachen brach das Mühlrad in drei Teile. Ungehindert schoss das Wasser über die Rampe und überschwemmte das Untergeschoss der Mühle. Zum Glück hielten sich alle Bewohner im oberen Stockwerk auf. Furchtsam schmiegten sich die Kinder an die Röcke ihrer Mutter, die ein Gebet murmelte, immer wieder dasselbe Gebet. Auch Afra hatte Angst, und in ihrer Angst klammerte sie sich an Lambert, den älteren der Müllerknechte.
»Wir müssen hier raus!«, rief der Müller, nachdem er im überschwemmten Untergeschoss nach dem Rechten gesehen hatte. »Das Wasser nagt an den Grundmauern. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Mühle in sich zusammenfällt.«
Da schwang die Müllerin ihre gefalteten Hände über den Kopf, und mit weinerlicher Stimme rief sie: »Heilige Mutter Martha, steh uns bei!«
»Die wird uns im Augenblick wenig hilfreich sein!«, knurrte der Müller unwillig, und in befehlendem Ton an Afra gewandt sagte er: »Du kümmerst dich um die Kinder, ich will zusehen, was zu retten ist.«
Afra nahm den Kleinsten auf den Arm und das Mädchen an der Hand. Behutsam stieg sie die steile Treppe hinab.
Im Untergeschoss hatte sich ein gurgelnder Strudel gebildet. Zwei Schemel, hölzerne Schuhe und ein Dutzend Mäuse und Ratten trieben im schmutzig braunen Wasser. Die stinkende Brühe reichte Afra gerade bis über die Knie. Während sie den Kleinen an sich presste, drückte die Älteste ihre Hand, dass es schmerzte. Ohne eine Träne zu vergießen, wimmerte das Mädchen leise vor sich hin.
»Gleich haben wir es geschafft!«, versuchte Afra das Kind aufzumuntern.
Abseits der Mühle stand ein Leiterwagen, wie ihn die Bauern der Umgebung zum Transport der Kornsäcke verwendeten. Afra setzte die Kinder auf das Fuhrwerk und ermahnte sie, sich nicht von der Stelle zu rühren; dann wandte sie sich um. Sie musste nach den beiden anderen Kindern sehen. Ihre nassen Röcke zogen sie beinahe zu Boden, als sie erneut durch das Wasser watete. Sie hatte gerade die Treppe erreicht, als ihr die Müllerin mit den beiden anderen Kindern entgegenkam.
»Was willst du hier noch?«, rief sie aufgebracht.
Afra gab keine Antwort und ließ die Frau mit den Kindern passieren. Dann begab sie sich noch einmal in das obere Stockwerk, wo der Müller und seine Knechte Hab und Gut zusammenrafften, so wie es ihnen gerade in die Hände fiel.
»Verschwinde, das Haus kann jeden Augenblick einstürzen«, herrschte der Müller Afra an. Jetzt hörte auch sie das Ächzen des Fachwerkgebälks. Aus dem Mauerwerk zwischen den Holzbalken polterten Gesteinsbrocken zu Boden. In Panik stürzten die Knechte zur Treppe und verschwanden.
»Wo ist mein Kleiderbündel?«, rief Afra aufgeregt.
Der Müller schüttelte unwillig den Kopf und zeigte in die Ecke, wo sie ihre Habe vor wenigen Tagen abgelegt hatte. Wie einen Schatz presste Afra das Bündel an sich und hielt einen Augenblick inne.
»Der Herr möge dir gnädig sein!« Die Stimme des Müllers, der sich bereits auf dem Weg nach unten befand, holte Afra schnell in die Wirklichkeit zurück. Plötzlich hatte sie das Gefühl, als ob die ganze Mühle schwankte wie ein Schiff auf den Wellen. Mit ihrem Bündel vor der Brust eilte sie zur Treppe, machte drei, vier Schritte nach unten, als über ihr die Decke zusammenbrach. Die Balken, welche die Decke trugen, knickten ein und blieben in einer Staubwolke liegen wie geknickte Strohhalme.
Ein Schlag traf Afra am Kopf, und für einen Augenblick glaubte sie das Bewusstsein zu verlieren, da spürte sie an ihrem rechten Arm einen starken Griff, der sie mit sich fortzog. Willenlos watete sie durch das Wasser. Endlich auf dem Trockenen, sank sie zu Boden.
Sie glaubte zu träumen, als vor ihren Augen die Mühle zu wanken begann und an der Seite, wo sich das geborstene Mühlrad befand, langsam in sich zusammensank wie ein Bulle bei der Schlachtung. Ein furchtbares, krachendes Geräusch, wie wenn der Sturm einen uralten Baum entwurzelt, ließ Afra erstarren. Dann wurde es still, unheimlich still. Nur das Gurgeln des Wassers war noch zu hören.
Unerwartet drang die Sonne durch die niedrigen Wolken und gab dem Bild einen schauerlichen Anstrich. Wie eine Insel ragten die Reste der Mühle aus dem Wasser, das sich kreisend und blubbernd einen Weg suchte. Der Müller blickte starr, beinahe teilnahmslos, als habe er das Geschehen noch gar nicht begriffen. Seine Frau schluchzte, die Hände vor den Mund gepresst. Die Kinder sahen ängstlich zu ihren Eltern auf. Einer der Knechte hielt noch immer Afras Arm umklammert. Von den Trümmern des Hauses stieg ein bestialischer, modriger Geruch auf. Quietschende Ratten versuchten sich in Sicherheit zu bringen.
Den ganzen Tag und die folgende Nacht, die sie in einer angrenzenden Holzhütte verbrachten, dauerte es, bis sich das Wasser verlaufen hatte. Keiner redete ein Wort, nicht einmal die Kinder.
Der Müller fand schließlich als Erster die Sprache wieder: »So soll es denn sein«, begann er mit einer hilflosen Geste und gesenktem Blick. »Kein Dach über dem Kopf, nichts zu essen und kein Verdienst. Was wird nur werden?«
Die Müllerin drehte den Kopf nach beiden Seiten.
An Afra und die Knechte gewandt, sagte der Müller mit leiser Stimme: »Geht Ihr Eures Weges, sucht Euch eine neue Bleibe, eine Stelle, die Euer Auskommen sichert. Ihr seht ja, wir haben alles verloren. Unsere Kinder sind das Einzige, was uns geblieben ist, und ich weiß nicht, wie ich sie ernähren soll. Ihr müsst verstehen …«
»Wir verstehen dich, Müller!«, nickte Lambert, der Knecht. Er hatte rotblonde borstige Haare, die nach allen Seiten wie ein Weihwasserwedel abstanden. Wie alt er war, vermochte er selbst nicht zu sagen, doch die Faltenringe um seine Augen verrieten, dass er nicht mehr zu den Jüngeren zählte.
»Ja«, stimmte der andere zu, Gottfried mit Namen und im Gegensatz zu Lambert eher jungenhaft und kein Freund langer Worte. Einen guten Kopf größer als dieser, breitschultrig und bärtig und mit halblangen, glatten Haaren war er eine beinahe stattliche Erscheinung, eher ein Stadtmensch als ein Müllersknecht.
Afra nickte nur stumm. Sie wusste selbst nicht, wie es weitergehen sollte, und es fiel ihr schwer, die Tränen zu unterdrücken. Für ein paar Tage hatte sie ein geregeltes Leben geführt mit Arbeit, Essen und Schlafen. Die Leute waren gut zu ihr gewesen. Und nun?
Frühzeitig am nächsten Morgen brach Afra mit den Müllersknechten auf. Gottfried wusste von einem Großbauern, dessen Hof talauswärts auf einem Hügel gelegen sei. Der sei zwar ein Nimmersatt und Pfennigfuchser und stolz wie ein Pfau im Hühnerstall, weshalb er nur Paul der Pfau genannt werde, aber er habe ihm, als er sein Korn zum Mahlen brachte, Arbeit und Brot angeboten für den Fall, dass er sich verändern wolle.
Auf dem Weg zu dem Hagestolz wollte nur selten ein Gespräch in Gang kommen. Nach vielen Stunden erst wusste Lambert lebhaft aus seinem Leben und mehr noch aus seiner Phantasie zu erzählen; aber weder Gottfried noch Afra hörten ihm richtig zu. Beide waren viel zu sehr mit sich selbst und der Lage beschäftigt, in die sie unversehens geraten waren.
Einmal unterbrach Lambert seinen Redefluss mit der Frage: »Sag Afra, wie kommt es, dass du mutterseelenallein durch das Land ziehst, als wärest du auf der Flucht. Ziemlich ungewöhnlich für ein Mädchen deines Alters und außerdem gefährlich.«
»Kann gefährlicher nicht sein als mein bisheriges Leben«, antwortete Afra schnippisch, und Gottfried sah sie erstaunt an.
»Bisher hast du kein Wort über dein Leben verloren.«
»Was geht’s euch an?« Afra machte eine abweisende Handbewegung.
Die Antwort machte Lambert nachdenklich, jedenfalls fiel er in längeres Schweigen. Gut eine Meile trotteten die drei stumm hintereinander her, bis Gottfried, der auf dem unbefestigten Weg vorausging, plötzlich innehielt und talwärts starrte, wo ihnen eine Horde Menschen entgegenstürmte.
Gottfried duckte sich und gab den anderen ein Zeichen, es ihm gleichzutun.
»Was hat das zu bedeuten?«, fragte Afra leise, als könnte ihre Stimme sie verraten.
»Weiß nicht«, erwiderte Gottfried, »aber wenn es eine von diesen Bettlerhorden ist, die plündernd und marodierend durchs Land ziehen, dann gnade uns Gott!«
Afra erschrak. Von den Bettlerhorden erzählte man sich grauenvolle Geschichten. Sie zogen zu hundert oder zweihundert Mann durch die Gegend; besitz- und arbeitslos, lebten sie nicht gerade vom Betteln, nein, sie nahmen sich, was sie brauchten. Menschen, die des Weges kamen, zogen sie nackt aus und beraubten sie ihrer Kleidung, Hirten nahmen sie ihre Tiere weg, und für ein Stück Brot schlugen sie seinen Besitzer tot, wenn er es nicht freiwillig herausrückte.
Die lärmende Meute kam immer näher. Zweihundert zerlumpte Gestalten mochten es wohl sein, bewaffnet mit langen Stangen und Keulen und in ihrer Mitte einen Leiterwagen mit einem Käfig ziehend und schiebend.
»Wir müssen uns trennen«, sagte Gottfried hastig, »am besten: Jeder läuft in eine andere Richtung. So können wir dem Gesindel noch am ehesten entkommen.«
Die Bettler hatten sie inzwischen entdeckt, denn sie kamen mit wildem Geschrei auf sie zugelaufen.
Afra erhob sich und begann, ihr Bündel an die Brust gepresst, zu rennen, so schnell sie konnte. Ihr Ziel war der Wald, linker Hand auf einer Anhöhe gelegen. Gottfried und Lambert schlugen die entgegengesetzte Richtung ein. Afra rang nach Luft, denn der Weg bergan wurde immer beschwerlicher. Die unflätigen Rufe der Bettler kamen näher und näher. Afra wagte nicht sich umzudrehen, sie musste den Waldsaum erreichen, sonst war sie die Beute der abscheulichen Meute. Was sie erwartete, wurde deutlich, als eine Holzstange dicht an ihrem Kopf vorbeisauste und im weichen Grasboden stecken blieb.
Zum Glück war das Bettelvolk alt und träge und nicht so gelenkig wie Afra, sodass sie in den Wald entkam. Dicke Eichen und Fichtenbäume boten ein wenig Schutz, aber das Mädchen rannte weiter, so lange, bis das Rufen und Schreien der Bettlerhorde immer schwächer wurde, und schließlich ganz verstummte. Am Ende ihrer Kräfte ließ Afra sich an einem Baumstamm nieder, und nun, da die Anspannung von ihr abfiel wie ein schwerer Stein, stiegen ihr Tränen in die Augen. Sie wusste nicht mehr weiter.
Orientierungslos und gleichgültig, wohin der Weg sie führen würde, ging Afra nach kurzer Rast weiter in der Richtung, die sie, der Not gehorchend, eingeschlagen hatte. Nach den beiden Müllersknechten zu suchen schien ihr unangebracht. Zum einen war es viel zu gefährlich, der Bettlermeute erneut in die Arme zu laufen, andererseits waren ihr die beiden ohnehin nicht ganz geheuer.
Der Wald schien endlos, aber nach einem halben Tag, der ihr die letzten Kräfte abverlangt hatte, wurden die Bäume lichter, und plötzlich erblickte sie ein weites Tal, auf dessen Grund sich der große Fluss dahinwälzte.
Sie kannte nur das karstige Hügelland mit dem Anwesen des Landvogts, und noch nie hatte Afra mit eigenen Augen ein so weites Tal gesehen, durch das man bis ans Ende der Welt zu blicken schien. Schön bestellte Felder und Wiesen fügten sich zusammen, und unten, in einer Schleife des Flusses, der Hochwasser führte, drängte sich, von drei Seiten geschützt, eine Ansammlung von festgemauerten Gebäuden, die sich aneinander schmiegten wie die Wehrtürme einer Burganlage.
Schnellen Schrittes lief Afra den leichten Abhang hinab, geradewegs auf ein Ochsengespann zu, das an einem Wiesenrain wartete. Im Näherkommen erkannte sie ein halbes Dutzend Frauen in grauer Ordenstracht, die ein umgepflügtes Feld bestellten. Die Ankunft der Fremden machte sie neugierig, und zwei von ihnen kamen Afra entgegen. Sie nickten nur, ohne ein Wort zu sagen.
Afra erwiderte den Gruß und fragte dann: »Wo bin ich hier? Ich bin auf der Flucht vor einer Bettlerhorde.«
»Sie haben dir doch nichts getan?«, fragte die eine, eine ältliche, verhärmte Frau von edler Statur, der man das Verrichten schwerer Feldarbeit nicht zugetraut hätte.
»Ich bin jung und habe schnelle Beine«, versuchte Afra das schreckliche Erlebnis herunterzuspielen. »Aber es mögen wohl zweihundert finstere Gesellen gewesen sein.«
Inzwischen kamen auch die anderen Ordensfrauen näher und umringten das Mädchen mit Neugier.
»Sankt Caecilien ist der Name unserer Abtei. Sicher hast du schon davon gehört!«, sagte die Verhärmte.
Afra nickte geflissentlich, obwohl sie noch nie von einem Kloster dieses Namens gehört hatte. Schüchtern blickte sie an sich herunter. Ihr derbes Gewand hatte auf der Flucht durch den Wald Schaden genommen. Fetzen hingen herab, und ihre Arme und Handrücken waren blutverschmiert.
Bei ihrem Anblick empfanden die Nonnen Mitleid, und die älteste sagte: »Der Tag geht zur Neige, wir wollen uns auf den Heimweg machen!« Und an Afra gewandt: »Steig auf den Wagen. Du wirst sicher müde sein vom weiten Laufen. Woher kommst du überhaupt?«
»Ich stand beim Landvogt Melchior von Rabenstein in Arbeit und Brot«, antwortete Afra und richtete den Blick in die Ferne, und unsicher, ob sie weitersprechen sollte, fügte sie hinzu: »Aber dann hat er sich an mir vergangen …«
»Du musst nicht weitersprechen«, bemerkte die Nonne mit einer abwehrenden Handbewegung. »Schweigen heilt alle Wunden.« Und nachdem alle Nonnen den Leiterwagen bestiegen und auf quer gelegten Brettern Platz genommen hatten, setzte sich das Ochsengespann in Bewegung. Die Fahrt verlief in merkwürdiger Stille. Jede Rede war auf einmal verstummt, und Afra hatte ein ungutes Gefühl, ob sie nicht besser geschwiegen hätte.
Sankt Caecilien lag wie alle Klöster etwas abgelegen, aber wohl befestigt wie eine Trutzburg. Der trapezförmige Umriss der gewaltigen, von dicken Mauern umgebenen Anlage fügte sich ideal in die Flussschleife. Das Eingangstor an der dem Fluss abgewandten Seite war mehr hoch als breit, mit Eisenplatten beschlagen und endete in der Höhe in einem Spitzbogen. Es lag leicht erhöht, und die Nonne, die die Ochsen zügelte, feuerte die Tiere mit Peitschenknall an, damit sie den Anstieg mit Anlauf nahmen.
Im Innenhof der Abtei stiegen die Nonnen vom Wagen und verschwanden eine hinter der anderen in einem rechter Hand gelegenen lang gestreckten Gebäude mit zwei Stockwerken und hohen spitzen Fenstern. Die ältere Nonne blieb bei Afra zurück, eine andere führte das Ochsengespann zu einer Remise an der Frontseite des großen Hofes. Hier waren Ställe mit Tieren, Futter und Vorräte, Wagen und Gerätschaften untergebracht für die Selbstversorgung des Klosters.
Die Kirche zur Linken war das höchste Gebäude, obwohl es nach der Regel des Ordens statt eines Turmes nur zwei Dachreiter aufwies. Die Außenwände waren mit Balken und langen Stangen eingerüstet und untereinander mit Bohlen verbunden, die als Arbeitsbühne dienten. Wie das Gerippe eines Riesenfisches ragten die nackten Dachbalken steil in den Himmel. Schmale Leitern aus roh geschlagenem Holz führten von einem Stockwerk zum anderen bis zum Dachgiebel. Die baufällige Kirche, noch im alten Stil errichtet, musste einem neuen Bauwerk weichen.
Jetzt, nach Einbruch der Dämmerung, ruhte die Arbeit. Die Handwerker hatten sich in ihr Hüttendorf an der westlichen Klostermauer zurückgezogen. Kein Mann durfte die Nacht innerhalb der Abtei verbringen.
Afra erschrak, weil das schwere Eisentor wie von Geisterhand bewegt mit lautem Krachen ins Schloss fiel.
»Du bist gewiss müde«, meinte die alte Nonne, der das Geräusch vertraut schien wie der Glöckchenklang beim Sanctus, »aber zuerst musst du bei der Äbtissin vorstellig werden und um Einlass bitten. So ist es Vorschrift. Nun komm!«
Bereitwillig folgte Afra der Nonne in das lang gestreckte Gebäude. Am Eingang legte sie ihr Bündel nieder. Gemeinsam stiegen sie eine enge wie eine Schnecke gewundene Steintreppe empor und gelangten zu einem endlos scheinenden Gang mit Kreuzrippen an der Decke und unregelmäßig gesetzten Steinquadern auf dem Fußboden. Die kleinen, schiffchenförmigen Fensterluken, die mit Butzenscheiben verglast waren, verbreiteten schon bei Tag wenig Licht, jetzt, in der Dämmerung, dienten sie gerade zur Orientierung. Am Ende des Ganges tauchte aus der Düsternis eine Nonne in weißem Gewand und schwarzem Skapulier auf. Sie nickte Afra zu, ihr zu folgen. Die andere Nonne entfernte sich wortlos in die Richtung, aus der sie gekommen waren.
Über eine zweite Treppe, der ersten gleich, gelangten sie schließlich in das obere Stockwerk zu einem kahlen Vorraum, dessen einzige Möblierung aus drei mal drei Stühlen bestand, welche an den Wänden des Raumes aufgestellt waren. An der vierten Wand eine Türe, darüber ein Heiligenbild al fresco gemalt. Nichts in dem Kloster sollte an privaten Besitz oder private Sphäre erinnern. Deshalb trat die Nonne ohne anzuklopfen ein, ein flüchtiges »Laudetur Jesus Christus« auf den Lippen.
Die Ausmaße des düsteren Raumes und stapelweise Pergamente in den Wandregalen ließen unschwer erkennen, dass es sich um das Zimmer der Äbtissin handelte. Sie erhob sich von einem derben Holztisch in der Mitte, auf dem ein Kienspan brannte und beißenden Geruch verbreitete. Es schien, als wüsste die Äbtissin längst Bescheid, denn die Nonne entfernte sich wortlos, und Afra stand plötzlich der Äbtissin allein und verlegen gegenüber. Sie fühlte sich nackt und verletzbar in ihrer zerlumpten Kleidung, und der Anblick der Äbtissin flößte ihr Respekt ein.
Das Gesicht der Nonne war von grünlicher, eigentümlicher Farbe und ihr Körper ausgedörrt und mager. Muskeln und Adern ihres fleischlosen Halses glichen dort, wo er aus dem Skapulier herausragte, einem Netz von Schnüren. Unter der Flügelhaube lugten mattgraue Haare hervor. Man hätte sie für eine Tote halten können, die gerade aus dem Grab gestiegen war, wären da nicht jene glühenden Funken gewesen, die tief aus ihren Augenhöhlen sprühten. Ein nicht gerade einnehmender Anblick.
»Die Welt hat dir, wie ich hörte, übel mitgespielt«, sagte die Äbtissin mit einer für ihr Aussehen durchaus angenehmen Stimme, und dabei trat sie ein paar Schritte auf Afra zu.
Afra nickte mit gesenktem Kopf und überlegte, wie sie einer Berührung durch die knochige, beinahe durchsichtige Äbtissin aus dem Wege gehen könnte. Doch zum Glück blieb diese zwei Schritte vor ihr stehen. Wie Hanfseile hingen ihre dürren Arme an ihr herab.
»So bist du denn bereit, jeglicher Art von Fleischeslust ein Leben lang zu entsagen, wie es die Regeln des heiligen Benedikt vorschreiben?«
Die Frage der Äbtissin stand nüchtern im Raum, und Afra wusste nicht, wie ihr geschah, wusste nicht, was sie antworten sollte. Sie hatte bei Gott die Nase voll von jedweder Fleischeslust, doch hatte sie auch nicht vor, den Schleier zu nehmen und dem Orden der stummen Nonnen beizutreten.
»Bist du bereit zu schweigen, auf Fleisch zu verzichten und auf Wein, und den Schmerz mehr zu lieben als die Wohltat?«, setzte die Äbtissin nach.
Ich will ein Dach über dem Kopf für die Nacht und vielleicht eine Wegzehrung, wollte Afra antworten. Fleisch, wollte sie sagen, habe sie ohnehin nur selten bekommen in ihrem Leben; doch die Äbtissin störte ihre Gedanken: »Ich verstehe dein Zaudern, meine Tochter, du musst auch nicht heute eine Antwort finden. Die Zeit wird dich die rechte Antwort lehren.«
Dann klatschte sie ein paar Mal in die Hände, worauf zwei ihrer Mitschwestern erschienen.
»Bereitet ihr ein Bad, versorgt ihre Wunden und gebt ihr neue Kleidung«, herrschte sie die beiden an. Der Tonfall ihrer Stimme stand im krassen Gegensatz zu jenem, in dem sie sich mit Afra unterhalten hatte.
Die Nonnen nickten devot mit über der Brust gekreuzten Armen und führten Afra in das Kellergewölbe hinab, wo sie ihr in einem Holzbottich ein Bad mit warmem Wasser bereiteten. Wann hatte Afra jemals in warmem Wasser gebadet? Sie war der körperlichen Reinigung ein Mal im Monat mit ein paar Scheffeln kalten Wassers nachgekommen, die sie sich über den Kopf schüttete. Starken Schmutz hatte sie mit einer Art Seife aus Talg, Tran und Kräuteröl bekämpft, das in einem Fass aufbewahrt wurde und stank wie ein aussätziger Bettler.
Sie errötete und schlug verlegen die Augen nieder, als die Nonnen für sie den Bottich mit einem Leinentuch ausschlugen, bevor sie heißes Wasser von der Feuerstelle nahmen und hineingossen. Dann halfen sie Afra beim Auskleiden, und nachdem sie in das Holzfaß gestiegen war, wuschen sie Afras Wunden, die sie sich auf der Flucht durch den Wald zugezogen hatte, mit Stoffballen. Schließlich brachten sie ihr einen grauen Habit aus kratzigem, derbem Stoff, wie ihn die Novizinnen trugen, und führten sie – Afra wusste nicht, wie ihr geschah – vom Kellergewölbe in das Obergeschoss des lang gestreckten Gebäudes.
Vor Afra tat sich ein langer, schmaler Saal auf, das Refektorium, in dem die Nonnen ihre Mahlzeiten einnahmen. Säulen aus grobem Tuffstein trugen ein spitzes Gewölbe wie in einer Kirche. An den Längswänden links und rechts waren schmale Tische aneinander gereiht, am oberen Ende verbunden durch einen Quertisch. Dahinter nahm, mit Blick in den Saal, die Äbtissin Platz. Die Nonnen blickten von ihren Plätzen schweigend zur Wand, wo herbe Sprüche sie an ihr irdisches Dasein erinnerten, Sprüche wie: Der Tod muss das Ziel deiner Gedanken sein. – Besser ist es, nicht zu denken, sondern zu gehorchen. – Oder: Der Mensch ist nicht geboren, um auf Erden sein Glück zu finden. – Oder: Du bist nichts als Staub und Asche.