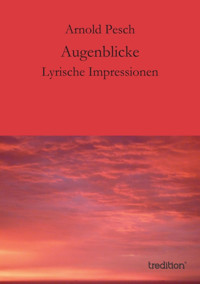6,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Barbara kehrt nach dem Tod ihrer Eltern in ihr Elternhaus zurück. Drei Tage wohnt sie dort, um das Haus aufzuräumen und um es gemeinsam mit ihrem Bruder zu verkaufen. Sie nimmt Abschied von der Vergangenheit. Dazu zählt auch die Auseinandersetzung mit ihren Eltern, vor allem mit ihrer Mutter, die ein anderes Leben für sie plante. In ihrer Jugend und auch später überhäuft sie Barbara mit Vorwürfen. Im Elternhaus liest sie ein letztes Mal das Tagebuch Konrads, der vor fünf Jahren an Nierenkrebs starb, um es dann für ihre Kinder Susanne und Lukas aufzubewahren, aber auch, um sich von Schuldgefühlen zu befreien. Mit dem Aufräumen des Hauses und dem Lesen tauchen Erinnerungen aus ihrer Kindheit, ihrer Jugend und den gemeinsamen Jahren auf. Bei Konrads Bemerkungen „Barbara, erinnerst du dich?“, entsinnt sie sich an die Jahre ihrer Ehe, die Geburt ihrer Kinder und an gemeinsame Urlaube. Sie durchlebt beim Lesen seines Tagebuchs noch einmal die Krankheit ihres Mannes, seine Verzweiflung und seine Hoffnung, davon gekommen zu sein. Zwei Jahre schleppt sie das Wissen um die Ausweglosigkeit mit sich herum; diese zwei Jahre seines Hinsiechens stürzen sie in Einsamkeit und Verzweiflung und lassen sie schuldig werden. Im Angesicht der Krankheit und des Todes ringt Konrad um seinen Gottesglauben, seinen Hoffnungen, dem Woher und Wohin; sie diskutierten über seine ureigenen Fragen und Gedanken. In den Tagebuchaufzeichnungen über das letzte gemeinsame Weihnachtsfest, wenige Wochen vor seinem Tod, kristallisieren sich noch einmal Konrads Gedanken und Gefühle, die sich bei Barbara tief in ihrem Gedächtnis einprägen. Nach fünf Jahren lernt sie bei einer Fahrradtour am Bodensee, an der sie auf Drängen ihrer Kinder in einer Gruppe teilnimmt, Georg kennen und verliebt sich. „Fünf Jahre sind genug!“ Sie sehnt sich nach Liebe und Geborgenheit. „Mama, du hast getan, was du konntest!“ Dieser Satz ihrer Kinder nach dem Tod des Vaters tröstet sie. Als sie nach drei Tagen das Tagebuch schließt, kann sie befreit ein neues Leben beginnen. „Lebe“, ist das letzte Wort im Abschiedsbrief Konrads.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Arnold Pesch
Das verlassene Haus
Tagebuchaufzeichnungen
vom Leben in den Tod
tredition Verlag
Impressum:
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung in elektronische Systeme.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar
Text und Titelbild: Arnold Pesch
Titelbild: Arnold Pesch
Umschlag-Design: tredition Verlag GmbH
2013: Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN:978-3-8495-5046-2
Inhalt:
Der erste Tag: Die Diagnose
Der zweite Tag: Nach der Operation
Der dritte Tag: Vom Leben in den Tod
Meiner Frau Edith
und
meinen Kindern
Uta und Christoph
gewidmet
sowie
allen Menschen, die verzweifelt, da unheilbar krank, um Leben und Tod kämpfen
Vorwort:
Personen und Handlung sind frei erfunden, obwohl ähnliche Krankheitsgeschichten sich täglich tausendfach ereignen.
Barbara kehrt in ihr Elternhaus zurück, nachdem ihre Eltern gestorben sind. Drei Tage wohnt sie in diesem Haus, um es in Ordnung zu bringen. Sie will Abschied nehmen von der Vergangenheit. Dazu zählt auch die Auseinandersetzung mit ihren Eltern, vor allem mit ihrer Mutter. Sie versucht Frieden mit ihr zu schließen.
Ein letztes Mal liest sie das Tagebuch ihres Mannes, der vor fünf Jahren an Nierenkrebs gestorben ist, um es dann für ihre Kinder Susanne und Lukas aufzubewahren, aber auch, um sich von Schuldgefühlen zu befreien. Bei einer Fahrradtour am Bodensee hat sie sich in Georg, verliebt. „Fünf Jahre sind genug!“ Sie sehnt sich nach Liebe und Geborgenheit.
Mit dem Aufräumen des Hauses und dem Lesen tauchen Erinnerungen aus der Kindheit, der Jugend und ihrer Ehe auf. Sie durchlebt die Krankheit ihres Mannes an Hand seiner Aufzeichnungen, sein Ringen im Angesicht des Todes um Glaube, Hoffnung, dem Woher und Wohin; aber auch in welche Einsamkeit und Verzweiflung diese zwei Jahre des Hinsiechens sie gestürzt haben. Als sie nach drei Tagen das Tagebuch schließt, kann sie befreit in ein neues Leben treten.
Der erste Tag
Barbara steckte den Schlüssel in das angerostete Gartentor, drehte einige Male, bis das Schloss unter Quietschen und Knarren nachgab und das schmiedeeiserne Tor sich öffnete. Seit dem Tod ihrer Mutter vor sechs Monaten hatte sie ihr Elternhaus nicht mehr betreten, nachdem sie mit ihrem Bruder das Wichtigste ausgeräumt hatte. Der Garten war zugewachsen, auf dem Rasen, sonst peinlich gepflegt, wucherte Unkraut und unter den Sträuchern vermehrten sich Brennnesseln. Die Blendläden an den Fenstern waren verschlossen. Sie ging hinein, riss die Fenster auf, um die Räume zu lüften. Sie plante, hier drei Tage bleiben, um alles zu ordnen. Im Garten pflückte sie einen Strauß dunkelroter Pfingstrosen, um das Grab ihrer Mutter zu schmücken; danach wollte sie mit dem Aufräumen beginnen.
Ein Jahr nach dem Tod Konrads, ihres Mannes, starb ihr Vater, die Mutter vor einem halben Jahr. Sie ging selten zum Grab ihrer Eltern, fragte sich, wenn sie dort stand, warum sie nicht weinen konnte, wie beim Tod des Vaters. Nach dem Requiem in der Kirche und der Beerdigung ihrer Mutter fühlte sie sich erleichtert, wie von einer unsichtbaren Last befreit. Sie hatte sie nicht geliebt, sie waren sich fremd geworden.
„Mutter, du siehst, ich bin dir nicht gram, ich habe dir einen Strauß deiner Blumen mitgebracht. Dein Garten, den du sehr geliebt hast, ist in diesem Frühjahr verwildert und voller Unkraut. Viele Sträucher blühen, vor allem der Flieder. Ich werde den Garten säubern und einige Sträucher roden, bevor wir das Haus verkaufen. Später wird ein Makler kommen, um sich das Haus anzusehen und zu schätzen. Wir müssen es verkaufen, es steht leer. Weder Hubert noch ich werden darin wohnen. Verstehe es bitte! Jetzt rede ich hier an deinem Grab mit dir, obwohl wir uns oft angeschwiegen haben. Oder wir sprachen miteinander und weder du noch ich haben einander zugehört. Deine Krankheiten musstest du mir jedes Mal wortreich ausmalen oder was die oder die Frau an Tratsch verbreitet hatte. Ich habe: Ja, Ja! geantwortet.
Du hast dich nach Vaters Tod beklagt, dass ich dich zu wenig besuche. Andere Töchter kämen zwei oder dreimal in der Woche vorbei. Was ich mache, was ich denke und fühle oder nach deinen Enkelkindern hast du dich nur selten erkundigt. Es wurde nicht einsamer um dich, wie du behauptet hast. Du hattest Bekannte in der Stadt, Freundinnen, mit denen du dich getroffen hast, bist verreist, konntest ins Theater oder in Museen gehen. Du warst nicht allein. Du hast andere für dein Glück und für dein Missgeschick verantwortlich gemacht. Du hast Vater, meinen Bruder und mich für dich ausgenutzt. Du wolltest immer die Erste sein, deinen Eitelkeiten hast du gefrönt. Mutter, hast du mir mein Glück geneidet, weil ich jung war? Weil meine Ehe mit Konrad gut war? Weil meine Kinder wohl geraten sind? Du hast nicht an meinen Freuden teilgenommen und schon gar nicht an meinen Nöten. In meiner Einsamkeit, als Konrad krank war, im Sterben lag und in den Tagen nach seinem Tod, hast du mich allein gelassen. Nicht nur ich auch deine Enkelkinder hätten dich gebraucht. Nach Vaters Tod hast du nicht getrauert. Hast du jemals um ihn geweint?
Gib mir eine Antwort, Mutter! Warum bist du gegangen, ohne dich zu verabschieden? Du hast es mir angedroht und davon gesprochen. Ich habe dich nicht ernst genommen, obwohl ich wusste, dass du es tun würdest. Wolltest du mir wehtun? Warum hast du es getan? Ich fühle mich schuldig an deinem Tod, obwohl ich ihn nicht verhindern konnte.
Du fragst nach dem Haus? Ich hänge an dem Haus, dort bin ich aufgewachsen. Als es mir noch nicht bewusst war, habe ich gedacht, bei dir und Vater glückliche Stunden und Jahre verlebt zu haben.
Ich erinnere mich, ich war bis zu dem Moment ein fröhliches Kind, als Hubert, mein Bruder, in unser Leben trat. Er wurde dein Liebling, an mir hattest du beständig etwas auszusetzen. Selbst Vater, der mich sonst seine kluge, große Tochter nannte, rief mich nun Dummerchen, obwohl er mir dabei schelmisch in die Wangen kniff oder an meinen Zöpfen zog. Du entschuldigst dich mit einer schweren Kindheit und Jugend. Es waren in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg harte Zeiten mit Hunger und Arbeitslosigkeit. Deinen Vater kennst du nicht, deine Mutter hat dich in eine fremde Familie gegeben, darunter hast du gelitten. Doch bei Oma hast du es gut gehabt, sie hat dich wie ihr eigenes Kind behandelt.
Während deiner Ehe mit Vater entbehrtest du nichts. Den Zweiten Weltkrieg überstandet ihr gesund. Er erfüllte dir alle Wünsche und ihr lebtet ohne Sorgen. Du standst als Frau des erfolgreichen Architekten im Mittelpunkt der Gesellschaft und hast dieses ausgekostet, aber auch anderen spüren lassen. Vater ertrug vieles in seinem Langmut, ohne zu murren oder aufzumucken. Du hast ihn umklammert und festgehalten, oft blieb ihm kaum Luft zum Atmen.
Ich will die Schuld abstreifen, die mich glauben macht, für dein Glück und deinen Tod verantwortlich gewesen zu sein. Manchmal gelingt es mir, aber zu oft steigt sie wieder aus einem düsteren Quell auf und nagt an meinem Gewissen. Mein Verstand sagt mir, niemand ist für das Glück eines anderen Menschen verantwortlich, das war Vater nicht, das war ich nicht. Du hast dich meiner bedient und eine Schau daraus gemacht, um zu zeigen, wie gut du als Mutter mit deiner Tochter auskommst.
Mutter, ich werde jetzt gehen! Sprich deinen Vorwurf aus: Mehr Zeit hast du nicht für mich! - Ich muss ihn hinnehmen. Wir werden das Haus verkaufen, ich muss es verkaufen! Nur so löse ich mich von deinen Vorwürfen, die mir Schuldgefühle einflößen. Jedes Mal, wenn ich hierhin zurückkehre, überfallen mich diese Gedanken, durchlebe ich gewesene Stunden und Jahre. Sie kleben wie Kletten an mir. Gekämpft und gerungen habe ich mit mir: Jetzt weiß ich, erst wenn dieses Haus verkauft ist, werde ich frei sein können! Ich bin jung, ich will leben.
Ich habe mich verliebt. Auch dass sollst du wissen! Du würdest fragen: Wer ist er? Was macht er? Wie viel verdient er?
Ich sehe deine Empörung, wenn ich dir sage: er lebt von seiner Frau getrennt und will sich scheiden lassen. Du rümpfst missbilligend die Nase: Einen geschiedenen Mann willst du heiraten, hast du dir das gut überlegt?
Nichts habe ich überlegt oder gar geplant, es hat mich überfallen. Ich liebe ihn. Genügt das nicht? Freust du dich mit mir? Das kannst du nicht.“
Ich ging zum Haus zurück, um mit dem Makler zu verhandeln. Mein Gesicht ist gerötet von innerer Erregung. Selbst nach ihrem Tod komme ich nicht zur Ruhe.
Gleich werde ich meinen Bruder treffen, mit dem ich vor einigen Tagen telefoniert habe. Wir haben uns gestritten, da Hubert nur Forderungen stellte und mich wie seine Untergebene behandelte, die seine Launen zu ertragen hat. Einen früheren Maklervertrag kündigte er, ohne mich zu benachrichtigen.
Zornig war ich und beschimpfte ihn: „Wie soll es nun weiter gehen? Was denkst du dir? Das Haus verkommt und wir erzielen weniger dafür!“
Er antwortete lapidar: „Für so einen läppischen Betrag verkaufen wir das Haus nicht!“
„Ach so, das sagst du mir, ohne mich zu fragen? Ich dachte, wir verkaufen gemeinsam?“
Mein Bruder bekleidet eine hoch dotierte Stellung in der Industrie, das bekomme ich zu spüren.
„Wenn du nicht genug bekommen kannst, gebe ich dir mein Erbteil dazu. Dann kannst du damit machen, was du willst!“ Wütend knallte ich den Hörer auf. Am nächsten Tag jedoch erwachte mein Kampfgeist. Ich wollte nicht verzichten, das konnte ich meinen Kindern nicht antun. Hubert sollte dieses Mal nicht über mich triumphieren. So habe ich einen neuen Makler gesucht und meinem Bruder den heutigen Termin mitgeteilt. Als Bemerkung – oder war es eine Drohung? – fügte ich hinzu: „Wenn du nicht kommst, lasse ich das Haus versteigern.“
Wir trafen uns am Haus. Er reichte mir die Hand und tat, als ob es keinen Streit gegeben hätte.
„Na, Schwesterchen, wie geht es dir?“
Kein Wort des Bedauerns oder der Entschuldigung, ich verbiss mir jede Bemerkung. Er war in Eile, da er eine Stunde später seinen Flug nach Toronto gebucht hatte. So wurden wir uns über die Angebotssumme und den Handlungsspielraum des Maklers schnell einig. Das Haus wird also verkauft.
Drei Tage werde ich hier bleiben, um im Garten auszumisten, den Rasen zu schneiden und das gröbste Unkraut zu jäten. Der jetzige Anblick schreckt jeden Käufer ab. Am Morgen hatte ich alle Fenster im Haus geöffnet, um die muffige und abgestandene Luft nach dem langen Winter zu vertreiben. Restliche Möbel stehen noch in den Räumen. Aber das werde ich erst in Angriff nehmen, wenn ein Käufer gefunden ist. Ein leeres Haus ist steril. Die kostbarsten Möbelstücke hatten wir ausgeräumt und unter uns verteilt, ebenso die Gemälde, die uns gefielen. Meine Eltern hatten einiges Vermögen darin angelegt.
Ein Haus ist kalt und leer, wenn niemand darin wohnt, aber ich muss ausharren, bis alles geordnet ist. Meine Eltern haben es Anfang der Fünfziger Jahre gebaut. Es liegt am Stadtrand. Das Grundstück fällt zur Straße leicht ab, so dass man weit über Felder und Wiesen blicken kann. Auch jetzt weiden dort nahe dem Bauernhof Kühe, ein vertrautes Bild aus meiner Kindheit, nur dass mir der Hof damals unendlich weit entfernt vorkam und die Tiere riesengroß. Das lang gestreckte Haupthaus des Hofes liegt eingebettet zwischen hohen Buchen, deren Blätter in diesen Maitagen im hellen Grün des Frühlings strahlen. An der Nordseite steht wie zum Trutz gegen Stürme eine uralte Eiche. Die Weide an der Auffahrt des Hofes war in diesem Winter nicht geköpft worden. Die langen Zweige berührten fast den Boden und bildeten um den Stamm eine schützende Laube. Im Schatten dieses Baumes, der uns wie in einer Höhle verbarg, habe ich als kleines Mädchen mit meiner Freundin Jutta gespielt. Mit trockenem Gras oder Laub bereiteten wir eine Wiege für unsere Puppen und für meinen geliebten Teddy. An anderen Tagen pressten wir unsere Ohren an den knorrigen Stamm, um zu horchen, was uns der alte Baum erzählte, wenn der Wind durch seine Zweige strich, die unsere Rücken berührten. Wir legten unsere kleinen Hände an die aufgerissene, raue Rinde des Baumes, unsere Fingerspitzen berührten sich gerade, so dick war die Weide.
„Er knurrt mit seiner tiefen Stimme, Barbara.“, flüsterte Jutta mir dann zu. „Drück dein Ohr fester an den Stamm, schließ deine Augen und horche!“
Der alte Baum erzählte uns seine Geschichte und seinen Traum von großen Seen und sauberen Flüssen, an denen er gern wachsen würde.
„Hat sich dein Traum erfüllt, alter Weidenbaum?“, fragten wir ihn. Nur die gebogenen Äste ächzten und in seiner Krone raschelten die Blätter.
Wie viele Jahre sind inzwischen vergangen?
Im Wohnzimmer zündete ich den Kachelofen an, die Abende im Mai sind oft kühl und frisch. Dieses Zimmer erstreckt sich im Erdgeschoss über die gesamte Rückseite des Hauses und über eine große Terrasse erreicht man den Garten. Von der Küche aus betritt man das Esszimmer. Mutter und Vater hatten sich zur Straße hin, die vor dem Haus verlief, jeder für sich ein Arbeitszimmer eingerichtet. Vom Flur aus führt eine Treppe in den Keller und in das obere Stockwerk, dort hatten meine Eltern ihr Schlafzimmer und mein Bruder und ich unsere Buden, wie wir sie nannten. In den Keller wagte ich mich als kleines Mädchen nur mit Bangen und Zittern. Noch heute rieche ich die klammen Wände und den Geruch gelagerter Kohlen und Kartoffeln. Mein Zimmer ist bis auf eine Schlafcouch leer. Die rosenholzfarbenen Tapeten mit stilisierten Rosenblüten sind verblichen, ein verwelkter Blumenstrauß, alles grau in grau; die Stehlampe mit dem schmiedeeisernen Fuß rostet. Die Feuchtigkeit hängt in den Räumen. Ich werde am warmen Kachelofen im Wohnzimmer übernachten.
Mich friert. Ich ziehe eine Strickweste an, die ich aus meinem Koffer hole. Oben auf liegt Konrads Tagebuch, das er während seiner Krankheit geschrieben hat. Wie einen kostbaren Schatz hüte ich es. Ich will es in diesen drei Tagen ein letztes Mal lesen, um es endgültig in meinem Schreibtisch daheim zu verschließen. Für meine Kinder werde ich es bewahren, sie sollen es später lesen. Sie haben ihren Vater auch so in wunderbarer Erinnerung. Ich muss mich von Konrads Gegenwart in meinen Gedanken und Träumen befreien. Ein Anderer ist in mein Leben getreten, mit ihm beginne ich einen neuen Lebensabschnitt.
An diesen drei Tagen in meinem Elternhaus werde ich auch versuchen, mich vom Erbe meiner Kindheit zu lösen. Manche Erinnerung bindet mich mit Fesseln, die ich enträtseln muss. Den ersten Schritt habe ich heute am Grab meiner Eltern getan.
Gedanken stürmen auf mich ein. Diesem Irrgarten der Gefühle will ich entkommen. Es ist ein Suchen auf dem Weg in die Freiheit. Ich sehe den Himmel, die weiter ziehenden Wolken, taste und stehe noch vor einer undurchdringlichen Wand. Mein Herz ist zum Kampfplatz geworden, gespalten bin ich zwischen Verstand und Fühlen.
Ich bin ins Freie geflohen und habe mich auf die Steintreppe, die auf die Terrasse führt, in die wärmende Sonne dieses Maitages gesetzt. In den Sträuchern tummeln sich die Vögel. Irgendwo trillert laut tönend ein Zaunkönig sein Liebeslied.
Auf unseren Wanderungen verharrte Konrad oft einen Augenblick: „Horch, Barbara, da singt eine Meise, ein Buchfink, eine Drossel, eine Goldammer.“ Er erklärte mir die Vogelstimmen oder ahmte sie nach.
Die Kletterrose neben der Treppe reicht fast bis an die Fenster meines Zimmers im ersten Stockwerk. Sie ist übersät mit dunkelroten Blüten, denen ein süßer Duft entströmt, Düfte der Erinnerung.
Dieser Garten war das Paradies meiner Kindheit. Hier habe ich gespielt, meine Puppen im Gras gebettet, mein Kaninchen und meinen Dackel Raschi laufen lassen. Über allem wachte meine strenge Mutter. Sie wurde zornig, wenn mein Hund durch ihre Gemüsebeete strolchte oder irgendwo das Bein hob.
„Geh mit deinem Köter auf die Straße!“
Mein Vater schenkte ihn mir, ein Skatfreund hatte einen Wurf Hunde. Jeder Winkel dieses Gartens weckt Erinnerungen, schmerzliche und erfreuliche. Meine Freundinnen kamen gern zu mir, da wir ein großes Haus und den verwunschenen Garten hatten. Mutter machte mir Vorhaltungen, wenn ich eine Freundin mitbrachte, die nicht unseres Standes war. Besonders Jutta lehnte sie ab, ihre Mutter arbeitete als Putzfrau.
„Wir sitzen in der Schule nebeneinander, sie ist meine beste Freundin.“
Sie entgegnete: „Ich werde mit deiner Lehrerin sprechen, dass sie dich versetzt. Das ist kein Umgang für dich.“
Sie mussten Akademikerfamilien entstammen, darauf legte Mutter wert, obwohl diese Klassenkameradinnen sich zumeist nur für neueste Mode und Kleider interessierten, mit ihrem Taschengeld prahlten oder über Tennispartner und Reitstunden tuschelten.
„Schämst du dich meiner, weil meine Freundin arm ist?“
„Ich will nicht, dass du mit diesem kleinbürgerlichen Gesindel spielst.“
„Mutter, du hast dich abgekehrt, du hattest nicht den Mut, in meine traurigen und entsetzten Augen zu schauen. Jutta würdigtest du keines Blickes, vermiedest jede Anrede und schicktest sie fort, wenn du mich in meinem Zimmer wähntest. Ich begehrte gegen deine Vorhaltungen und Befehle auf, die ich nicht einsah. Du hast uns nicht getrennt.“ Ich habe um Mutters Gunst gebuhlt, gegen ihre zurückweisenden Blicke war ich blind; ich bin meiner Mutter entfremdet. Hasse ich sie? Nein! In mir nagen die Enttäuschungen, die ich versucht habe aus meiner Seele auszubrennen, blutig sind die Narben. Sie hat mir Jahre meiner Kindheit gestohlen. Ich habe um Jutta gekämpft, sie meiner Mutter abgetrotzt; sie blieb meine Freundin und ist es bis heute. Schade, dass wir uns so selten sehen, sie wohnt mit ihrer Familie in einer anderen Stadt.
Mit Konrad saß ich an warmen Abenden auf der Gartenbank, um miteinander zu reden, zu lachen und zu küssen. Fragen um unsere Zukunft, über Gott, Glauben, Gerechtigkeit und Menschlichkeit, Zerstörung der Natur und unserer Umwelt beschäftigten uns, die später eine andere Dimension erreichten, als sie in den Fragen gipfelten: Warum trifft mich das Schicksal und was wird nach meinem Tod sein? Er erzählte mir seine Träume von Studium und Beruf, von Freundschaft, Liebe und Familie. Träume, deren Worte ich begierig in mich einsaugte. Hier hat er mich gefragt, ob ich seine Frau werden wollte. Das ist mein Elternhaus, angefüllt mit Erinnerungen. Wenn wir es nicht verkaufen, werde ich mich nicht von der Vergangenheit befreien können. Die Frage nach der Schuld um meine Mutter und der Schuld um Konrad, hängt wie ein schwerer Stein an mir. Ich kann sie nicht tilgen, mein Gewissen, das mich quält, wird erst ruhig sein, wenn ich sie anerkenne. In diesen Räumen und den nächsten drei Tagen durchleuchte ich meine Vergangenheit, ohne die es für mich keine unbeschwerte Zukunft geben wird.
Wenn ich Konrads Tagebuch in die Hand nehme, erbebe ich jedes Mal aufs Neue. Sechzehn Jahre waren wir verheiratet. In seinem Tagebuch entdecke ich Ungesagtes, weil der Alltag uns auffraß oder uns keine Zeit mehr blieb. Seine Worte sprechen von seinen Ängsten und Träumen, von der Liebe und Sorge um mich und unsere Kinder. Die Erinnerungen an ihn verschließe ich nicht in einem Tresor oder verbanne sie aus Furcht in eine Dunkelkammer. In den vergangenen fünf Jahren war ich nicht bereit für ein neues Leben; die Begegnung mit Georg hat mein Herz geöffnet. Ich will, ich wünsche mir, frei für ihn zu sein.
Diese Tage, als wir die Gewissheit seiner schrecklichen Krankheit erfuhren, waren dramatisch und erschütternd. Das Schweben zwischen Hoffen und Bangen zerrte an den Nerven. Konrad war sonderbar ruhig und still. Er nahm meine Zärtlichkeit hin, ohne sie zu beantworten. Seine Gedanken waren abwesend.
Er war in den Wochen vor der Diagnose seiner Krankheit häufig müde und abgespannt.
„Was ist mit dir?“, wollte ich eines Abends wissen.
„Gibt es Schwierigkeiten im Institut? Bist du überfordert oder beschäftigt dich ein Problem, das du nicht lösen kannst?“
Nur wenige Tage später sollte dieses Gespräch zur furchtbaren Wirklichkeit werden.
„Mach dir keine Sorgen, Barbara, im Institut läuft alles gut. Wir machen Tierversuche mit einem neuen Krebsmittel, das hoffnungsvolle Ansätze zeigt.“
„Warum hast du mir nicht davon erzähl? Ist es ein Chemotherapeutikum alter Art?“
„Nein! Keine Chemie, da forschen andere; es ist eine neue Idee. Wir versuchen einen spezifischen, homologen Impfstoff herzustellen! Unsere Versuche befinden sich momentan im Anfangsstadium.“
„Hattest du die Idee, da du über Impfstoffe promoviert hast?“
„Ja und nein! Es gibt verschiedene Versuche dieser Art. Unsere Theorie ist, dass sich Krebszellen gegenüber unserem Immunsystem durch bestimmte Eiweißmoleküle auf ihrer Oberfläche verraten. Spüren Abwehrzellen diese Strukturen auf, diese Tumor-Antigene, lösen sie im Körper eine Reaktion aus. Im Idealfall kann unser Abwehrsystem die bösartigen Zellen bekämpfen oder vernichten. Die Immunantwort ist jedoch fast immer zu schwach. Daher versuchen wir, die Abwehrreaktion zu steigern. Das Neue an unserer Arbeit ist, dass wir auf Zellen eines Primärtumors Bakterien ansetzen. Sie sollen das Wachstums des Tumors unterbinden!“
„Wenn ich dich richtig verstehe, sollen Bakterien bestimmte Abwehrstoffe erzeugen, die ihr isolieren wollt, um sie Erkrankten wieder einzuimpfen?“
„Ja, einfach ausgedrückt, ist es so. Die Schwierigkeit ist, das richtige Bakterium zu finden, das diese spezifischen Antikörper produziert. Wir experimentieren mit Kolibakterien und fügen in das Bakteriengenom kurze DNA Stränge aus Krebszellen ein, in der Hoffnung, dass sie so verändert im Körper spezifische Antikörper entwickeln, die das Wachstum eines Krebses stoppen.“
„Das klingt nach einer Baustelle, auf der ein Ingenieur bastelt.“
„Ein Kolibakterium enthält mehr als sechzig Millionen Biomoleküle, da hat ein Ingenieur viel zu tun. Es wäre der erste Schritt. Der nächste wäre dann eine Impfstoffherstellung oder eine gentechnologische Vermehrung des Antikörpers. Wir sind erst am Anfang.“
„Wie kommt ihr an das Krebsgewebe?“
„Wir arbeiten mit dem onkologischen Institut zusammen. Johannes informiert uns, wenn ein Primärtumor operiert wird und der Patient sein Einverständnis gegeben hat. Alle Kranken hoffen, dass man bei ihnen das rettende Medikament entwickelt; darum stimmen sie zu. Sind bereits Metastasen da, nehmen wir das Gewebe nicht.“
„Probiert ihr mit verschiedenen Tumorarten?“
„Ja, jedes Tumorgewebe ist unterschiedlich aufgebaut.“
„Und welche?“
„Es sind drei Arten: Brust-, Lungen- und Nierenkrebs.“
„Wenn es euch gelingt, diese Abwehrstoffe zu erzeugen, sind sie aber für jeden Krebs und jede Person unterschiedlich? Oder?“
„Liebling, du hast ein schlaues Köpfchen.“ Dabei stupse er mit seinem Finger auf meine Nase.
„Du siehst, auch Frauen denken logisch.“
„Das weiß ich schon lange. Sollten unsere Versuche Erfolg zeigen, wäre ein allgemeiner Impfstoff, der das Immunsystem spezifisch anstachelt, ein traumhaftes Endziel.“
„Das ist das Problem, mit dem du dich quälst oder weichst du mir aus? Du bist in letzter Zeit still geworden.“
Von Zeit zu Zeit hatte ich beobachtet, wie sich sein Gesicht vor Schmerz verzerrte.
„Konrad, du drehst dich abends sofort auf die andere Seite, bist du so müde und ausgelaugt? Du hast dich verändert, du redest nicht mehr mit mir. Es ist still geworden zwischen dir und mir. Liebst du mich nicht mehr? Wann haben wir zum letzten Mal miteinander geschlafen? Ist da eine andere Frau?“
Wir lagen nebeneinander im Bett, diese Frage quälte mich, nun war sie ausgesprochen. Konrad hatte kurze Zeit gelesen und dann das Licht ausgeschaltet. Er streckte seine Hand aus und nahm mich in den Arm, strich mir durch die Haare und streichelte mich. Diese Berührungen entbehrte ich, die er mir sonst oft in reichem Maße schenkte.
„Barbara, ich muss zum Arzt.“
Ich erschrak. „Was ist? Sag es mir!“
„Mich plagen von Zeit zu Zeit Nierenkoliken. Ich glaube, ich habe Nierensteine.“
Ich beugte mich zu ihm, küsste ihn und sagte lachend:
„Du Angsthase! Das ist doch kein Problem, mein großer sonst so tapferer Konrad! Entweder gehen sie so ab oder du lässt dich operieren.“
Nun verstand ich, warum er mich in den letzten Wochen so selten berührte und geliebt hatte. Ich atmete auf und war glücklich, kuschelte mich in seinem Arm, meine Hände streichelten seinen Körper. Sie weckten seine Begierde. Er lang lange Zeit still, ohne sich zu rühren. Sein Atem streifte mein Gesicht. Mein ganzes Ich wartete auf ihn, wollte ihm in mir Rettung aus seiner Angst schenken. „Barbara!“
Aus einer unendlichen Ferne kam dieser Schrei. Er stürzte sich auf mich, wir erlösten uns in unserer Vereinigung aus unseren Fragen und Ängsten.
„Danke! Du bist ein kostbares Geschenk für mich!“ Seine Stimme zitterte. Ich schaute in seine Augen und verstand wohl mehr als er selbst seine Ängste, die er in seinem Begehren offenbarte; unser Glück war in diesem Moment zurückgekehrt. Später in der Nacht wachte ich auf. Eine Nierenkolik quälte ihn, er hockte zusammengekrümmt auf der Bettkante und hielt sich stöhnend den Kopf. Ich kniete mich hinter ihn und stützte ihn. Seine Haare und sein Gesicht tropften vom Schweiß. Er litt unter unerträglichen Schmerzen. Ich zog ihn zurück, dass er an meiner Brust ruhte, wischte ihm das Gesicht ab und hielt ihn fest: „Es wird gleich besser, ich habe Tropfen genommen.“
Eine halbe Stunde verstrich, bis er sich entkrampfte. Erschöpft schlief er in meinem Arm ein.
Ruhig und entspannt ging er am anderen Morgen zu Johannes, seinem Freund, seinem Arzt in der Klinik war. Seit dem Gymnasium waren sie Freunde, wohnten während des Studiums im gleichen Studentenheim und später befruchteten sie sich gegenseitig in ihrer Arbeit. Während Johannes Medizin studierte, zog es Konrad zu den Naturwissenschaften, vor allem zur Biologie und später zur Mikrobiologie.
Gesprochene Worte, Tonbandaufnahmen, konnte er mir nicht zurücklassen, nur in meinem Gedächtnis haften sie. Dafür habe ich sein Tagebuch. Es ist nicht nur Papier, keine gemeißelten Runen, keine Kaligraphie und schöne Bilder, Seite um Seite spiegelt es unser Leben. Die Buchstaben und Worte tanzen vor meinen Augen, wenn ich darin lese. Worte, gesagt, trägt der Wind fort, geschrieben bleiben sie. Sie sind mir sein Vermächtnis:
20. Januar.
Ich beginne dieses Tagebuch am Tag eins meiner Krankengeschichte, werde schreiben, wenn es denn so ist, bis zum bitteren Ende. Die Seiten werden von meinen Ängsten und Hoffnungen erzählen, meinen Enttäuschungen, Zielen und Plänen; von den Quellen meines Lebens; von Begegnungen mit Menschen und deren Reaktionen, von Gesprächen, von meiner Familie, von meinen beiden Kindern und von Barbara, meiner geliebten Frau; meinen Wegen o der auch Umwegen zum Leben oder zum Tod. Der Tag ist da und kein Tag wird so wie früher sein! Johannes hat eine Geschwulst in meiner rechten Niere festgestellt. Er ist sich sicher, dass sie bösartig ist. Das Ultraschallbild zeigt eine stark vergrößerte rechte Niere mit einer pflaumengroßen Geschwulst in der Nierenrinde, die in Richtung Nierenbecken wächst: ein dunkler Fleck im Vergleich zum restlichen Nierengewebe. Er hat eine Probe für eine histologische Untersuchung entnommen. Morgen wird er ein CT machen, um sicher zu gehen, dass sich noch keine Metastasen gebildet haben. Die Geschwulst muss jedenfalls entfernt werden; ist sie bösartig, dann die Niere zusätzlich. Es sind keine Nierensteine. Meine Befürchtungen haben sich bewahrheitet, als die Nierenschmerzen nicht nachließen und der Urin sich blutig verfärbte. Blutig, das habe ich Barbara verschwiegen. Was sollten meine Ängste sie erschrecken?
Mit ihrer Zärtlichkeit entzündete sie meine Leidenschaft, die Angst tauchte in ein Dunkel unter. Wir liebten uns wie in unserer ersten Nacht. Erlöst stand ich später am Fenster und blickte in die Nacht, bis mich eine unerträgliche Kolik quälte. Auf Barbaras Gesicht fiel der matte Schein des Mondes und legte einen Kranz des Friedens um sie. Sie lächelte im Traum und murmelte unverständliche Worte.
Nach diesem Ergebnis kreisen meine Gedanken um Krebs. Ich will sie verdrängen, es gelingt mir nicht. Barbara starrte mich an, als ich sie über den Verdacht aufklärte, dass es nicht Nierensteine sondern vermutlich eine bösartige Geschwulst sei. Ich wollte es ihr bis zum endgültigen Ergebnis verschweigen, sie ließ nicht locker. Als sie begriff, was diese Diagnose bedeutete, nahm sie mich in den Arm und strich mir über den Kopf.
„Ich liebe dich, Konrad! Wir schaffen das gemeinsam!“
Ich spürte ihr Zittern, ihre Angst. Ihr Gesicht war nahe bei mir, doch ich konnte ihre Züge nicht enträtseln; habe ihre Nähe und Wärme ersehnt, doch sie beruhigte mich nicht.
Wir haben vor den Kindern nichts erwähnt, als sie aus der Schule kamen, um sie nicht zu verwirren. Sie erschraken, als wir von Krankenhaus und Operation sprachen.
Wie wird Barbara mit mir umgehen, wenn ich Krebs habe? Ich brauche sie mehr als zuvor, ihre Zeit und Zuneigung, ihre Zärtlichkeit und Liebe.
Die warme Maisonne scheint auf mein Gesicht und auf meine Arme. Ich lehne mich an die Mauer zurück und schließe die Augen. Die Stunden jener Tage tauchen aus der Erinnerung auf.
Konrad war still an diesem 20.sten Januar, als er von der Untersuchung zurückkam. Beim Öffnen der Tür sah ich, dass eine unheilvolle Diagnose gestellt worden war. Sein Gesicht war bleich. Ich ging auf ihn zu und musste mich selbst zur Ruhe zwingen. Mit geweiteten Augen schaute er mich an, sein Gesicht verschleierte sich:
„Barbara, ich habe Krebs, ich muss operiert werden.“
Er legte seine Arme um mich und ein Zittern schüttelte seinen Körper. Sein Kopf ruhte auf meiner Schulter. Ich kraulte stumm sein Haar. Lange Zeit standen wir so und hielten uns.
„Bist du sicher, kann es keine Zyste sein?“
„Zysten sind Ausstülpungen. Johannes zweifelt nicht, da das Gewebe sich im Ultraschallbild dunkel abgrenzt, eine Zyste hätte die gleiche Schattierung wie das übrige Nierengewebe. Zur diagnostischen Absicherung hat er eine Probe entnommen. Morgen bekomme ich das Ergebnis.“
Diese Diagnose, auch wenn Konrad sie herunterspielte, traf mich bis ins tiefste Mark; mein Innerstes sträubte sich dagegen. Er muss es geahnt haben und in der Nacht in unserer Vereinigung Erlösung aus seinen Ängsten gesucht haben. Die Tage vor der Operation waren schrecklich, ich war atemlos und wortlos; Angst, Angst um ihn und um unsere Zukunft lähmten mich.
Warten, - warten – eine endlose Zeit war es. Gutartig? Bösartig? Wie früh ist es? Diese Frage geisterte durch alles Denken immer mit der Hoffnung gepaart: Es ist ein Irrtum, eine Fehldiagnose! Es ist früh genug!
Was ist, wenn alle Befürchtungen wahr werden? Wie wird sich unser Leben ändern? Diese Fragen standen im Raum und die Antworten waren ungewiss. Auch der Gedanke, es muss nichts sein, erst alle Untersuchungen abzuwarten, beruhigte mich nicht. Krebs oder nicht Krebs, diese Schicksalsfrage war nicht zu verdrängen, erfasste jede Faser meines Denkens, als dieses fatale Wort ausgesprochen war. Ohnmächtig bedrängte sie mich, ich war ihr ausgeliefert.
Das aufgeschlagene Tagebuch ist mir aus den Händen geglitten. Mein Gesicht brennt und Tränen rinnen über meine Wangen.
Ich muss mich eincremen oder in den Schatten gehen, sonst bekomme ich in dieser Frühjahrssonne einen Sonnenbrand!
21. Januar:
Johannes hat ein langes Gespräch mit mir geführt. Gutartig? Bösartig? Diese Frage, die mich gequält hat, ist enträtselt. Die Antwort, die bittere Wahrheit, ist: Es ist Krebs, bösartig, sogar aggressiv, der Tumor infiltriert die Nierengefäße. Morgen werde ich in die Klinik gehen, es soll möglichst bald operiert werden. Die Niere wird nicht zu retten sein. Wenn damit alles ausgestanden ist, kann ich mit einer Niere leben.
Er tröstete mich: „Du hast Glück gehabt, Metastasen haben wir im CT nicht gefunden.“
„Sei offen mit mir!“, drängte ich ihn, „ich kann die Wahrheit ertragen. Ihr habt sie nicht gefunden, weil sie zu winzig sind?“
„Mikrometastasen sind mit der heutigen Technik nicht zu diagnostizieren, das weißt du. Bei der Operation sehen wir mehr!“
„Was meinst du mit mehr?“
„Ob lokale Lymphknoten befallen sind!“
Mir war klar, sollte das sein, verschlechterte sich die Heilungsprognose.
Ich lösche diese Zeilen nicht, will ehrlich mit mir umgehen, um es später, sollte ich es durchstehen, nachlesen zu können, durch welche Nächte und Täler ich gegangen bin, welche Dunkelheit ich durchschreiten musste, in welchem Dschungel ich mich verirrt habe. Können alle Ängste in den nächsten Wochen, Monaten oder gar Jahren wie eine Seifenblase zerplatzen? Nein, im tiefsten Innern, wo Verstand und Seele nicht geschieden sind, fühle ich: Mir ist nur noch eine begrenzte Zeit vergönnt. Die Zeit: sie spaltet meine Gedanken: Das Gestern kann ich nicht zurückholen; die verpassten Gelegenheiten sind für immer verloren; das Heute ist grausam und ich wage nicht zu denken, was das Morgen bringt. Ist das Morgen eine begrenzte Zeit? Was schreibe ich da? Jedes Leben hat seine begrenzte Zeit. Dieses wissen wir in unserem Unterbewusstsein und verdrängen es. Es zeigt uns unsere Grenzen auf, die wir nicht akzeptieren wollen. Ist die letzte Seite meines Lebensbuches aufgeschlagen?
In meiner jetzigen Situation grinst da ein Spötter: „Was jammerst du um Stunde, Tag oder Jahr? Warum hast du nicht gelebt?“
Ich möchte ihm ins Gesicht schreien: „Ich habe gelebt!“
Er höhnt. „Es war wohl nicht das wahre Leben.“
„Spötter weiche! Ich habe eine Chance!“
Sein Grinsen wird breiter.
Einen zweiten Urlaub wie im letzten Jahr wird es nicht geben.
Strahlend blau waren die Wintertage in diesem Januar. Nach Neujahr schneite es und für Ende Februar hatten wir eine Woche Urlaub geplant, um wie im Jahr zuvor im Kleinen Walsertal Skilanglauf zu machen. Dieser letzte gemeinsame Winterurlaub vor einem Jahr ist ein unvergessliches Erlebnis. Es war das erste Mal, dass wir ohne unsere Kinder eine Woche verreisten.
„Dann haben wir Zeit für uns und können miteinander reden.“
Morgens standen wir früh auf unseren Brettern. Konrad liebte es, die aufgehende Sonne zu betrachten, wenn die Berge im Morgenlicht glühen, die ersten