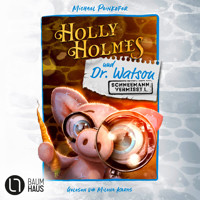6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein verlorener Traum.
Eine junge Seherin.
Ein Ritter in schwarzer Rüstung.
Zwei Mönche auf der Suche nach der Wahrheit.
Das größte Mysterium des Mittelalters.
Jenseits des Orients existiert ein Land, mächtiger und größer als alle Reiche des Abendlands: das Reich des Priesterkönigs Johannes. Auf vielen Karten ist es verzeichnet, in Liedern wird es besungen. Viele haben es gesucht - doch nie ist jemand von dort zurückgekehrt. Nur eines weiß man sicher: Es ist ein Reich der Christen. Als die Kreuzfahrer befürchten müssen, dass Jerusalem in die Hände Saladins fällt, werden der Mönch Cuthbert und sein Adlatus Rowan auf die Suche nach dem legendären Reich gesendet. Nur eine kann ihnen den Weg weisen: Cassandra, eine junge Frau, die seltsame Visionen plagen. Weder Rowan noch Cuthbert ahnen, dass sie sich an die Grenzen nicht nur der bekannten Welt, sondern auch ihres Glaubens begeben ...
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 680
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über das Buch
Titel
Widmung
Karte
Handelnde Personen
Prolog
Buch 1 – Wölfe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Buch 2 – Lämmer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Buch 3 – Löwen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Epilog
Nachwort
Über den Autor
Weitere Titel des Autors bei Bastei Lübbe
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Jenseits des Orients existiert ein Land, mächtiger und größer als alle Reiche des Abendlands: das Reich des Priesterkönigs Johannes. Auf vielen Karten ist es verzeichnet, in Liedern wird es besungen. Viele haben es gesucht – doch nie ist jemand von dort zurückgekehrt. Nur eines weiß man sicher: Es ist ein Reich der Christen. Als die Kreuzfahrer befürchten müssen, dass Jerusalem in die Hände Saladins fällt, werden der Mönch Cuthbert und sein Adlatus Rowan auf die Suche nach dem legendären Reich gesendet. Nur eine kann ihnen den Weg weisen: Cassandra, eine junge Frau, die seltsame Visionen plagen. Weder Rowan noch Cuthbert ahnen, dass sie sich an die Grenzen nicht nur der bekannten Welt, sondern auch ihres Glaubens begeben …
MICHAEL PEINKOFER
DASVERSCHOLLENEREICH
Historischer Roman
Für Erika Kutzi
1922–2012
HANDELNDE PERSONEN
(in alphabetischer Reihenfolge)
Amalric I. – König von Jerusalem
Balian von Ibelin – Edler im Reich Jerusalem
Blacwin – normannischer Tempelritter
Cassandra – eine Sklavin
Cuthbert of Durham – Benediktinermönch
Gaumardas – französischer Tempelritter
Gérard de Ridefort – Großmeister des Templerordens
Guy de Lusignan – Regent von Jerusalem
Edwin – Pater des Cluniazenserordens
Lady Escheva – Gattin Graf Raymonds
Farid el Armeni – Karawanenführer
Hugh de Lacy – Praeceptor von Metz
Humphrey von Toron – Gemahl Isabelas
Lady Isabela – Tochter Amalrics I.
Kathan – bretonischer Tempelritter
Mercadier – französischer Tempelritter
Raymond III. – Graf von Tripolis
Raynald de Chatillon – Graf von Antiochia
Raynald von Sidon – Edler im Reich Jerusalem
Robert de Morvaie – Sheriff von Berwickshire
Rowan of Lauder – Laienbruder, Diener Cuthberts
Lady Sibylla – Tochter Amalrics I.
Ungh-Khan – Fürst der Kerait
Yussuf Salah al-Din – Sultan von Syrien und Ägypten
PROLOG
BretagneHerbst 1151
Heftiger Wind strich von Norden über die See und peitschte sie auf, ließ graue Brecher gegen die Klippen rollen, um sie schließlich am schwarzen Fels zerschellen und sich in weißer Gischt auflösen zu lassen.
Eine einsame Gestalt stand auf den Klippen, als wollte sie den tobenden Elementen trotzen, die Hände gefaltet und das Haupt gesenkt. Der junge Mann trug Kleidung und Rüstzeug eines Ritters; Helm und Haube hatte er jedoch abgenommen, sein Schwert steckte neben ihm im kargen Boden. Der Ritter achtete weder auf den heulenden Wind, der an ihm zerrte, durch sein Haar fuhr und seinen Umhang bauschte, noch auf den einsetzenden Regen. Seine Aufmerksamkeit gehörte dem kleinen Hügel, der an der höchsten Stelle der Klippe aus faustgroßen Steinen aufgeschichtet worden war, gekrönt von einem hölzernen Kreuz, in das drei Namen geritzt worden waren.
Clarisse.
Ruvon.
Alicia.
Wie ein Echo klangen die Namen in seinem Bewusstsein nach, und bei jedem Widerhall glaubte er vor Schmerz den Verstand zu verlieren. Eine endlos scheinende Weile stand er so, während der Regen seine Kleider durchnässte und den Boden zu seinen Füßen aufweichte. Dem Ritter war es gleichgültig, weder Zeit noch Welt schienen mehr Gewalt über ihn zu haben.
Irgendwann beugte er die Knie und sank nieder. Auf sein Schwert gestützt, sprach er ein stilles Gebet, das Haupt gebeugt und die Augen geschlossen. Dann, als der Schmerz unerträglich wurde, warf er den Kopf in den Nacken und brüllte seine Trauer und seine Verzweiflung hinaus, doch der Sturm trug seinen Schrei auf rauschenden Schwingen davon.
Ungehört.
Unerwidert.
Jäh erhob sich der Ritter, zog das Schwert aus dem Boden und rammte es in die Scheide an seinem Gürtel. In einem Entschluss, der ihn Kraft und Überwindung kostete, riss er sich von dem Grabhügel los und wandte sich um, ging zu den beiden Tieren, die er ein wenig abseits im Schutz eines Hünengrabes angepflockt hatte. Das eine war ein destrier, ein hochgewachsenes Streitross, dessen Schabracke ebenso durchnässt war wie der Ritter selbst; das andere ein roncin, ein Packpferd, das die Habe des Ritters trug – das, was ihm noch davon geblieben war.
Der Ritter drehte sich nicht ein einziges Mal um, während er die Zügel löste und sich auf den Rücken des Rosses schwang. Unnachgiebig trieb er die Tiere an, und schon kurz darauf hatte der Vorhang aus Regenschleiern und grauem Nebel ihn verschlungen.
NordfrankreichWinter 1172
Sie rannte, so schnell sie konnte.
Weder spürte sie die Kälte noch den harschen Schnee, auf den sie ihre nackten Füße setzte, hastig und in rascher Folge.
Alles, was sie spürte, war Angst.
Todesangst.
Das Herz schlug ihr bis zum Hals, während sie immer weiterrannte, zwischen den kahlen Bäumen des Waldes hindurch den Hang hinab. Auf die Zweige, die ihr ins Gesicht peitschten und blutige Striemen hinterließen, achtete sie ebenso wenig wie auf den eisig kalten Wind, der ihr vom Tal entgegenblies. Sie wollte nur weiter, zurück nach Hause.
Im Laufen blickte sie sich um.
Der Wolf war noch näher gekommen.
Deutlich konnte sie die kalten, eisblauen Augen sehen, das zähnestarrende Maul, aus dem dampfender Atem drang – und ihre Angst steigerte sich in Panik.
Gequält schrie das Mädchen auf und lief noch schneller, die Bestie im Nacken, die weiter aufholte. Als hätte sich die Zeit verlangsamt, konnte es jeden einzelnen Muskel unter dem grauschwarzen Fell des Untiers arbeiten sehen, glaubte seinen Atem im Nacken zu fühlen.
Um sein Leben rennend, strapazierte das Mädchen seinen zerbrechlichen, ausgemergelten Körper bis zum Äußersten – und erreichte unvermittelt den Hohlweg zum Dorf. Vielleicht, mit ein wenig Glück …
Das Mädchen schloss die Augen und hastete weiter durch den gefrorenen Schnee, ungeachtet der blutigen Spuren, die seine wunden Füße hinterließen. Die Bestie musste noch immer hinter ihm sein … aber warum konnte es sie plötzlich nicht mehr hören?
Ein flüchtiger Blick über die Schulter.
Der Wolf war nicht mehr da!
Unfähig, darüber Erleichterung oder auch nur Verwunderung zu verspüren, eilte das Mädchen weiter bis zum Ende des Hohlwegs, von wo aus man die Häuser des Dorfes bereits sehen konnte – doch der Anblick, der sich ihm bot, war so unerwartet und erschreckend, dass es wie angewurzelt stehen blieb.
Das Dorf stand in Flammen!
Orangerote Feuerzungen loderten von den strohgedeckten Dächern zum grauen Himmel, Brandgeruch tränkte die kalte Luft. Dem Mädchen schossen Tränen in die Augen. Das ganze Dorf brannte, nicht eine einzige Hütte war verschont geblieben – doch mehr noch als die lodernden Feuer bestürzten das Mädchen die leblosen Körper, die rings um die brennenden Hütten verstreut lagen, blutbesudelt und mit zerfetzten Kehlen. Und da waren zwei Wölfe, die sich an ihrem Fleisch weideten, der eine kräftig und mit dunklen, fast schwarzen Augen, der andere dürr, knochig und mit rötlichem Fell.
Wie ein Irrlicht huschte der Widerschein der Flammen über das von namenlosem Entsetzen gezeichnete Gesicht des Kindes, das nicht mehr in der Lage war, sich zu regen. Wie erstarrt stand es da, den kleinen Mund zu einem stummen Schrei geöffnet – als der Feuerschein plötzlich von einem Schatten verdunkelt wurde.
Das Mädchen blickte nach oben und erkannte erschrocken, dass sein Verfolger es eingeholt hatte: Oberhalb der Mündung des Hohlwegs stand der große graue Wolf auf einem Felsen. Mit eisfarbenen Augen betrachtete er sein Opfer, machte jedoch keine Anstalten, sich auf es zu stürzen.
Ein endlos scheinender Augenblick verstrich, in dem das Mädchen das Gefühl hatte, vor Angst und Entsetzen den Verstand zu verlieren. Und plötzlich hatte es das Gefühl, das tiefe Knurren, das aus der Kehle des Untiers drang, zu verstehen.
»Sie werden kommen«, sagte die Bestie. »Die Wölfe werden kommen.«
In diesem Augenblick erwachte das Mädchen aus seinem Albtraum.
Berwickshire, SchottlandFrühjahr 1173
»Warum, Mutter? Warum nur?«
Zum ungezählten Mal wiederholte der Junge die Frage, doch wie zuvor bekam er auch diesmal keine Antwort. Nicht, weil seine Mutter, eine junge, zerbrechlich wirkende Frau mit milden, von pechschwarzem Haar umrahmten Zügen, ihm nicht hätte antworten wollen – sondern weil sie es nicht konnte. Sie begnügte sich damit, ihrem Sohn tröstend über das lange schwarze Haar zu streichen und zu lächeln, auch wenn ihr nicht danach zumute war.
»Es ist alles gut, Rowan«, sagte sie, während sie mühsam mit den Tränen kämpfte. »Es ist alles gut.«
»Nein«, widersprach der Junge entschieden und blickte hilflos an ihr empor, »es ist nicht gut! Ich will nicht mit diesem Mann mitgehen, verstehst du? Ich will bei dir bleiben!«
Sie holte tief Luft und versuchte, ihren pochenden Herzschlag zu beruhigen, doch es wollte ihr nicht gelingen. »Dieser Mann«, erwiderte sie, jedes Wort bedachtsam wählend, »ist dein Vater, Rowan.«
»Ich will aber nicht, dass er mein Vater ist«, erwiderte der Junge trotzig, wobei sich eine kurze, senkrecht verlaufende Zornesfalte in der Mitte seiner Stirn bildete.
»So etwas darfst du nicht sagen«, wies sie ihn sanft, aber bestimmt zurecht. »Sir Robert de Morvaie ist nicht nur dein Vater, sondern auch Sheriff des Königs und damit der mächtigste Mann von Berwickshire. Und er will nur das Beste für dich.«
»Das Beste?« Die Zornesfalte wurde noch ein wenig tiefer. »Wenn er nur das Beste für mich will, warum muss ich dann fort von dir?«
»Es steht uns nicht zu, die Entscheidungen deines Vaters zu hinterfragen, Rowan. Wenn er uns etwas befiehlt, so sind wir ihm zum Gehorsam verpflichtet.«
»Du vielleicht«, knurrte der Junge. »Ich nicht!«
»Rowan!« Das gütige Gesicht der Mutter wurde streng. »So etwas darfst du niemals wieder sagen, hörst du? Niemals wieder! Sir Robert hat gut für uns gesorgt in all den Jahren – nun musst du ihm zeigen, dass du sein Vertrauen und seine Zuwendung verdient hast.«
»Was bedeutet das? Ich verstehe nicht …«
Sie seufzte abermals. Ihr Herzschlag beruhigte sich daraufhin ein wenig, nicht aber der Schmerz, der in ihrer Brust tobte und sie fast zerreißen wollte. Am liebsten hätte sie dem Jungen gesagt, dass er, obschon erst acht Winter alt, nur allzu recht hatte; dass sein Vater kaltherzig und gefühllos war und es ihr das Herz brach, ihren Sohn mit ihm ziehen zu lassen. Aber das konnte sie nicht. Nicht um ihrer selbst willen – und auch nicht um Rowans willen.
»Dein Vater hat weise entschieden«, behauptete sie, nachdem sie sich mit einem weiteren tiefen Atemzug gestärkt hatte. »Du wirst es bei den Mönchen gut haben. Das Kloster von Melrose ist weithin bekannt für seine Gelehrten. Du wirst dort lesen und schreiben lernen, und man wird dich die Sprache der Kirche lehren.«
»Ich will aber nicht!« Rowan schüttelte heftig den Kopf. »Ich will bei dir bleiben, Mutter!«
Er klammerte sich an sie, vergoss bittere Tränen in das grobe Leinen ihrer Schürze. Tröstend strich sie ihm übers Haar, wie sie es früher oft getan hatte, wenn er sich die Knie blutig geschlagen oder sich geschnitten hatte. Doch diesmal waren der Schmerz und die Wunde ungleich größer.
Noch während Rowan schluchzte, war von draußen Hufschlag zu hören. »Sie kommen«, sagte die Mutter leise.
»Nein.« Der Junge klammerte sich noch fester an sie.
»Du musst jetzt tapfer sein«, beschied sie ihm, und indem sie ihre ganze Kraft aufwandt, löste sie sich aus dem Griff seiner kurzen, aber kräftigen Arme. »Dein Vater ist hier.«
Gegen den Willen des Jungen, der sich mit aller Kraft wehrte, gelang es der Mutter, die Tür der kleinen, aus Lehm und Stroh errichteten Hütte zu öffnen. Grelles Tageslicht flutete herein, das Rowan blendete. Er rieb sich die Augen, einerseits der Helligkeit wegen, andererseits, um die Tränen fortzuwischen.
Vier Reiter standen vor der Hütte des kleinen, von einer hüfthohen Natursteinmauer umgebenen Gehöfts. Zwei von ihnen waren Soldaten, die in den Diensten des Sheriffs standen; der dritte ein Mann, der eine helle Mönchstracht trug und dessen Haupt mit einer Tonsur versehen war; der vierte schließlich war Sir Robert selbst, ein hochgewachsener Mann mit harten normannischen Zügen. Rowans Mutter würdigte er keines Blickes; seine Augen, in denen ein kaltes Feuer zu lodern schien, richteten sich sofort auf den Jungen.
»Nun, Rowan«, fragte er, »bist du bereit?«
Der Junge erwiderte nichts, stattdessen drängte er sich furchtsam an seine Mutter, die sich genötigt sah, es ein letztes Mal zu versuchen. »Bitte, Herr«, begann sie, »wollt Ihr es Euch nicht noch einmal …«
»Nein, Weib«, fiel Sir Robert ihr entschieden ins Wort. »Ich habe entschieden!«
Kurz entschlossen stieg er von seinem riesigen Kriegspferd und gab einem seiner Soldaten den Zügel. Mit klirrenden Sporen kam er auf Rowan zu und streckte die behandschuhte Rechte nach ihm aus. »Komm, Sohn«, sagte er. »Dies ist der Tag, von dem deine Mutter dir erzählt hat. Der Tag, der dein Leben verändern wird.«
Der Junge starrte wie gebannt auf die Hand, die sich ihm entgegenstreckte, zögerte jedoch, sie zu ergreifen.
»Dies dort«, fuhr der Sheriff deshalb fort, auf den Mönch deutend, »ist Pater Angus vom Zisterzienserkloster von Melrose. Er hat sich bereit erklärt, dich in seine Obhut zu nehmen.«
Rowan schaute zu dem Mönch, der auf seinem Reittier saß und ihn mit einer Mischung aus Langeweile und Geringschätzung betrachtete. »Ich will nicht«, erklärte er schlicht.
»Was?« Sir Robert hob eine schmale Braue.
»Er ist noch jung«, sagte die Mutter rasch. »Er weiß noch nicht, welche Wohltat Ihr ihm erwiesen habt, Herr!«
»Noch nicht.« Der Sheriff rümpfte die Nase. »Aber du wirst es verstehen, Junge. Spätestens dann, wenn die Mönche dich Manieren lehren und dir den aufsässigen Schotten austreiben. Komm jetzt, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit.«
Rowan widersprach nicht mehr, aber er leistete der Aufforderung auch nicht Folge. Ängstlich zog er sich hinter die schlanke Gestalt seiner Mutter zurück.
»Ist es das, was du ihn gelehrt hast, Weib?«, fragte Sir Robert. »Sich hinter deinem Rock zu verstecken?«
»Verzeiht, Herr«, sagte sie und beugte das Haupt. »Er ist ein guter Junge, Ihr werdet sehen. Er wird alles tun, um Euch stolz zu machen.«
»Das will ich hoffen«, knurrte der Sheriff des Königs – und noch ehe Rowan reagieren oder seine Mutter noch etwas sagen konnte, hatte er den Jungen bereits gepackt und zog ihn fort.
»Mutter!«
»Rowan!«
Vergeblich streckte der Junge die Arme nach seiner Mutter aus – der Griff des Vaters war stärker.
»Mutter, bitte!«
Als sie das Flehen in seiner Stimme hörte, die Furcht in seinen Augen sah und die Tränen, die über seine Wangen liefen, hielt sie es nicht mehr aus. Sie lief ihm hinterher, worauf sich der Junge von seinem Vater losriss und ihr entgegeneilte. Ungeachtet des Morasts, der den Innenhof bedeckte, fiel sie auf die Knie nieder und schloss ihn noch einmal in die Arme, fühlte sein pochendes kleines Herz an ihrer Brust – ehe er erneut von ihrer Seite gerissen wurde.
»Was fällt dir ein, Weib?«
Sie spürte, wie etwas sie an der Schläfe traf, hart und schmerzhaft, und sank zurück auf den schlammübersäten Boden. Mit verschwimmenden Blicken sah sie, wie ihr kleiner Sohn von einem der Soldaten hochgehoben und auf dessen Pferd gesetzt wurde.
»Mutter, nein! Bitte nicht!«
Das Letzte, was sie hörte, ehe der Abgrund der Ohnmacht sie verschlang, waren Rowans Schreie, während die Reiter ihre Pferde wendeten und davonritten.
Dann kam die Dunkelheit.
1
»Zwischen dem Sandmeere und den erwähnten Bergen findet sich in einer gewissen Ebene ein Quell von seltener Heilkraft; die Christen und welche es werden wollen, befreit er […] von allen sie quälenden Gebrechen.«
Brief des Johannes Presbyter, 142 – 145
NordfrankreichNovember 1173
Sie kamen im Morgengrauen.
Und sie waren zu dritt.
Drei schemenhafte Gestalten, die im ersten Tageslicht die schäbige Straße herabkamen, in weite Umhänge gehüllt, die sie riesigen Schwingen gleich umwehten. Lautlos glitten ihre Schatten über die steinigen Äcker, deren Furchen schwärenden Wunden glichen, erstarrt in Reif und Frost. Nur hier und dort erhoben sich die knorrigen Stämme entlaubter Bäume aus der Ödnis, knochigen Klauen gleich, die nach den drei Reitern zu greifen schienen.
Nicht mehr lange, und es würde schneien. Der Winter kündigte sich an, in dunklen Wolken, die sich einer feindlichen Heerschar gleich am stahlfarbenen Himmel ballten und zum Angriff sammelten.
Bald schon, sehr bald …
Kathan hasste den Winter. Beinahe ebenso sehr, wie er die Heiden hasste. Und das nicht nur, weil er die Kälte und Feuchte nicht mehr gewohnt war und sie in seinen Knochen schmerzten. Sondern auch, weil der Winter Erinnerungen wachrief. Erinnerungen an ein anderes, ein früheres Leben, das er hinter sich gelassen hatte.
Vor langer Zeit.
Wäre es nach ihm gegangen, wäre er niemals in dieses karge, von Kälte und Nebel zerfressene Land zurückgekehrt. Doch die Dinge hatten sich anders entwickelt.
Der harte Hufschlag auf dem gefrorenen Boden ging in ein dumpfes Trampeln über, als die Reiter ihre Tiere auf einer Hügelkuppe zügelten. Unterhalb davon folgte die Straße, die wenig mehr als ein schmales graues Band aus erstarrtem Morast war, einem Flusslauf. Jenseits des Flusses stiegen hinter den Hügeln dünne Rauchsäulen empor.
»Bist du sicher, dass das der richtige Weg ist, Mercadier?« Gaumardas beugte sich fragend in seinem Sattel vor. Genau wie seine beiden Gefährten trug auch er eine wollene Haube unter dem coif aus Kettengeflecht, um das Haupt vor Kälte zu schützen; als Einziger der drei hatte er jedoch die Kinnbrünne nicht hochgeschlagen, sodass das entstellte Gesicht mit den beiden Mündern zu sehen war. »Es kommt mir vor, als wären wir hier schon einmal gewesen.«
»Das liegt daran, dass in dieser gottverlassenen Gegend ein Hügel aussieht wie der andere«, entgegnete der Angesprochene und zog den Umhang enger um seine Schultern. Seine Stimme klang dumpf durch die geschlossene Kinnklappe. »Hier gibt es nur Kälte, Stein und Elend.«
»Und das sagst ausgerechnet du?« Gaumardas’ Augen blitzten. »Wurdest du nicht in dieser Gegend geboren?«
Mercadier lachte bitter auf. »Daran siehst du, dass ich weiß, wovon ich spreche.«
Gaumardas lachte, hechelnd wie ein Hund. »Und was sagt unser stolzer Bretone dazu?«, wollte er dann wissen.
Kathan blieb eine Antwort schuldig. Er hatte sich an die überflüssigen Wortwechsel seiner beiden Mitbrüder gewöhnt, verspürte allerdings kein Verlangen, sich daran zu beteiligen, und hörte schon gar nicht mehr richtig zu.
»Warum so wortkarg?«, hakte Gaumardas nach. »Weilst du mit deinen Gedanken wieder in der Vergangenheit?«
Kathan wandte den Blick und schaute seinen Mitbruder durchdringend an. »Schweig«, sagte er nur.
»Warum sollte ich? Wir alle sind dabei gewesen, und wir haben nicht weniger geblutet als du.«
»Schweig, sage ich.« Die Art und Weise, wie Kathan sprach, machte seinem Mitbruder klar, dass es besser war, sich zu fügen. Das Grinsen, das Gaumardas’ Mund und die darunter liegende, quer über das Kinn verlaufende Narbe verzerrt hatte, verschwand augenblicklich.
»Die Siedlung dort hinter den Hügeln heißt Bouvais«, wechselte Mercadier das Thema. Sein Ross schnaubte und scharrte mit den Hufen, Dampf wölkte aus den Nüstern. »Vielleicht bekommen wir dort den Hinweis, nach dem wir suchen.«
»Hoffentlich«, knurrte Gaumardas verdrießlich. »Ich bin es leid, von einem traurigen Kaff zum nächsten zu reiten und immer dieselben Fragen zu stellen. Wie lange soll das noch so weitergehen?«
»Bis wir die richtigen Antworten erhalten«, entgegnete Kathan schlicht und trieb sein Pferd den Hügel hinunter.
»Bis wir die richtigen Antworten erhalten«, wiederholte Gaumardas gehässig. »Und wann wird das sein? Wir wissen ja noch nicht einmal, wonach wir eigentlich suchen. Womöglich jagen wir einem Geist hinterher, einem Hirngespinst.«
»Hab Vertrauen«, riet Mercadier ihm und gab seinem Pferd ebenfalls die Sporen.
»Vertrauen?«, rief Gaumardas ihm hinterher. »Worauf?«
Mercadier wandte sich zu ihm um. Ein eisiger Windstoß erfasste den Umhang mit dem Tatzenkreuz und bauschte ihn auf. »Ich weiß nur, dass wir diese Frau finden müssen«, entgegnete der Tempelritter ausweichend. »So lautet unser Befehl.«
»Wozu?«, fragte Gaumardas. Seine kleinen Augen, die etwas von einem Raubtier hatten, blitzten erneut. »Was ist der Sinn von alldem hier, Mercadier? Hast du dich das einmal gefragt? Warum hat man uns ausgerechnet hierher geschickt?«
Sein Mitbruder blickte ihn lange an. »De par dieu«, zitierte er dann den Wahlspruch ihres Ordens, ehe er sich wieder nach vorn wandte und sein Pferd weiter antrieb. »Weil Gott es so will. Allein daran solltest du niemals zweifeln, Bruder.«
Königreich JerusalemZur selben Zeit
Der Anblick schien stets derselbe zu sein, dennoch übte er eine eigentümliche Faszination auf Cuthbert aus.
Gebannt beobachtete der Mönch, wie das Pendel, jener kleine Gegenstand aus Messing, der die Form eines umgekehrten Tropfens hatte, an dem ledernen Strick hin und her baumelte, den er zwischen Daumen und Zeigefinger hielt. Bald schwang es hierhin, bald dorthin, gelenkt von den kaum merklichen Bewegungen, die Cuthberts rechte Hand vollführte – und dennoch folgte es stets seinem eigenen Prinzip.
Cuthbert hatte es sich zur Angewohnheit gemacht, das Pendel immer dann unter den Falten seiner dunklen Robe hervorzuziehen, wenn er gezwungen war, auf etwas zu warten. Geduld hatte nie zu seinen hervorstechendsten Eigenschaften gehört, als Diener seines Ordens pflegte er mit der ihm gegebenen Zeit sorgsam umzugehen. Es missfiel ihm, die Zeit, die der Herr ihm auf Erden geschenkt hatte, mit Warten zu verschwenden, und das Pendel bot eine Möglichkeit, die Lücken des Tages mit nutzvollen und erhellenden Gedanken zu füllen.
»Was ist das?«
An dem schwingenden Stück Messing vorbei schaute Cuthbert auf das Kind, das zu ihm getreten war.
Es war ein Mädchen von zwölf Jahren, mit aschbraunem Haar und blauen Augen. Das Kleid, das es trug, verriet die vornehme Abstammung, mehr als die staunend geschürzten Lippen und das neugierig vorgereckte Kinn.
»Was habt Ihr da, Bruder Cuthbert?«
»Ein Pendel«, erklärte der Mönch bereitwillig. Mit der Fingerspitze tippte er das Messing an und beendete auf diese Weise die Schwingung. »Wollt Ihr es einmal halten, Prinzessin?«
Das Mädchen nickte ohne Zögern, trat näher und griff nach der Schnur. Sofort begann der metallene Tropfen in seiner Hand hin und her zu schwingen.
»Gut so«, lobte Cuthbert.
Ein flüchtiges Lächeln huschte um die ernsten Züge des Kindes, während es das Pendel betrachtete. »Und wozu ist es gut?«
»Zu mancherlei Dingen.«
Das Mädchen legte den Kopf schief. »Hat es Zauberkräfte?«
»Nein.« Cuthbert schüttelte den Kopf. »Und Ihr solltet nicht so leichtfertig über derlei Dinge sprechen. Ich bin ein Mann des Glaubens, Prinzessin Sibylla, nicht des Aberglaubens.«
»Wozu ist das Pendel dann gut?«, wollte das Mädchen ungeduldig wissen.
»Der Mann, der es mir gab, behauptete, dass es die Antwort berge.«
»Die Antwort worauf?«
Cuthbert lächelte. »Genau das ist die Frage. Eure Klugheit übertrifft bei Weitem Euer Alter.«
Sibylla ließ das Pendel noch einen Augenblick lang schwingen und betrachtete es dabei, während Cuthbert das Kind musterte. Die Haarfarbe und die schmalen Augen hatte es fraglos von seiner Mutter; die schmale, ebenmäßige Nase, das kantige Kinn und die grüblerische Stirn jedoch waren ein Erbe seines Vaters.
Mit einem unwilligen Seufzen ließ Sibylla das Pendel sinken. »Wenn Ihr die Frage nicht kennt und es über keine Zauberkraft verfügt, ist dieses Ding zu nichts nütze«, stellte sie fest und gab es dem Mönch zurück. Cuthbert wollte etwas erwidern, doch in diesem Moment kehrte der Diener zurück, auf den er gewartet hatte. »Ihr dürft jetzt eintreten, Bruder«, sagte er. »Seine Majestät erwartet Euch.«
Cuthbert verabschiedete sich von Sibylla mit einem Augenzwinkern – wobei das Mädchen keine Miene verzog –, dann folgte er dem Diener an den Wachen vorbei durch den Türbogen, der so niedrig war, dass er sich bücken musste. Das Pendel ließ er dabei unter seiner Robe verschwinden.
Jenseits des Türbogens herrschte schummriges Halbdunkel. Die Vorhänge an den hohen, mit arabischen Bogen versehenen Fenstern waren zugezogen, sodass sie das einfallende Sonnenlicht dunkelrot färbten. Teppiche bedeckten die Wände und den Boden, der wiederum von großen seidenen Kissen übersät war. Der Geruch von Myrrhe und anderen Kräutern, die in einer flachen Schale verbrannt wurden, lag schwer und einschläfernd in der warmen Luft.
Hätte Cuthbert es nicht besser gewusst, hätte er die Kammer für das Domizil eines Orientalen gehalten; erst beim zweiten Hinsehen wurde offenbar, dass ihr Bewohner christlichen Glaubens war: in lateinischer Schrift und Sprache gehaltene Bücher, ein Dreiecksschild mit dem Abbild eines Löwen, ein mit Gemmen besetztes Kruzifix. Wenig bis nichts wies jedoch darauf hin, dass dies das Gemach des mächtigsten Mannes in Jerusalem war.
»Bruder Cuthbert, mein König«, kündigte der Diener an, ehe er sich ebenso leise wie respektvoll zurückzog.
Cuthbert blieb stehen, das Haupt so weit gesenkt, wie es einem weltlichen Herrscher zukam. Jenseits der Schleier, die von der Decke hingen und den Arbeitsbereich vom Schlafraum trennten, war schemenhaft die Gestalt des Monarchen zu erkennen.
Amalric war feist geworden.
Nur noch wenig erinnerte an den Mann, der vor nunmehr sieben Jahren in Nachfolge seines Bruders Baldwin den Thron von Jerusalem bestiegen hatte. Obwohl er noch keine vierzig Winter gesehen hatte, war der König ein alter Mann, gebeugt nicht nur durch die Last seines Körpers, sondern auch durch die der Ereignisse, die sein Leben und seine Herrschaft verdunkelten.
»Kommt näher, mein Freund«, forderte er Cuthbert in seiner langsamen, bedächtigen Sprechweise auf, die ihm bei Hofe den Ruf eines Zauderers eingetragen hatte, tatsächlich jedoch ein Teil seines Wesens war. »Ich muss gestehen, dass mich Unruhe befällt, nun, da Ihr hier seid.«
»Das tut mir leid, mein König.« Cuthbert leistete der Aufforderung Folge und trat durch den Wall der Schleier. Ganz offenbar war Amalric allein in seiner Kammer, was nur äußerst selten der Fall war. Der König hatte die Neigung, sein Gehör Beratern aller Art zu schenken, die oft genug nur den eigenen Vorteil im Sinn hatten. Sie waren der Grund dafür, dass Cuthbert sich in den vergangenen Jahren mehr und mehr vom Hof zurückgezogen und wieder dem Klosterleben zugewandt hatte. Umso überraschter war er gewesen, als der König ihn plötzlich zu sich gerufen und mit einer Aufgabe betraut hatte.
Der König von Jerusalem thronte auf einem Haufen seidener Kissen, die jedem muselmanischen Wesir zur Ehre gereicht hätten. Sein Gewand bestand aus grünem Brokat mit goldfarbenen Borten und war nach orientalischer Art geschnitten. Die einstmals edlen Züge waren rot und wirkten aufgedunsen, das lange blonde Haar hing in fettigen Strähnen. Der Bart, der die untere Hälfte seines Gesichts überwucherte, war lang und ungepflegt.
»Seid mir gegrüßt, alter Freund.«
»Mein König.« Cuthbert verneigte sich.
»Wisst Ihr, dass es fast dreißig Jahre her ist, da wir uns zum ersten Mal begegneten? Ich war noch ein Knabe damals, und mein Vater Fulk hatte Euch als meinen Lehrer ausgewählt.«
»Fürwahr eine lange Zeit.«
»Ihr habt mir beigebracht, dass wir die uns gegebene Zeit auf Erden nutzen müssen«, fuhr Amalric fort, »geradeso, als ob Ihr kein Mann des Glaubens, sondern ein Anhänger des alten Epikur wärt. Ich muss oft daran denken. An Eure endlosen Lektionen in lateinischer Literatur. An Eure Beharrlichkeit, wenn es darum ging, Syllogismen und philosophische Lehrsätze zu studieren.«
»Ihr wart ein sehr begabter Schüler«, erkannte Cuthbert an.
»Noch mehr als Euer Wissen jedoch«, fuhr der König fort, ohne auf das Lob einzugehen, »habe ich stets Eure Ehrlichkeit geschätzt. Als Herrscher von Jerusalem bin ich von Lügnern umgeben – von solchen, die mir übelwollen, aber auch von Speichelleckern, die mir aus reiner Gefallsucht das Wort reden. Ihr jedoch habt in all den Jahren stets das ausgesprochen, was Ihr dachtet, auch wenn es mir nicht gefiel. Deshalb habe ich Euch und niemand anderen mit dieser wichtigen Sache betraut.«
»Ich danke Euch, mein König«, versicherte Cuthbert und verbeugte sich abermals. »Ich weiß Euer Vertrauen zu schätzen.«
»So habt Ihr die Schrift geprüft, die zu untersuchen ich Euch gebeten habe?« Amalrics Miene verriet keine Regung. Seiner bebenden Stimme jedoch war die Anspannung deutlich anzumerken.
Cuthbert biss sich auf die Lippen und ertappte sich dabei, dass er sich in eine andere Zeit und an einen anderen Ort wünschte. Der Mann, der dort vor ihm thronte, war ganz offenkundig nicht mehr der Jüngling, den er einst in Jaffa unterrichtet hatte. Dennoch schien irgendwo unter den feisten, von Trauer und Sorge gezeichneten Zügen noch etwas von eben diesem Jungen zu stecken, den Cuthbert seiner Aufgewecktheit und seines Scharfsinns wegen mehr geschätzt hatte als jeden anderen Schüler.
»Das habe ich, mein König.«
»So sagt mir, zu welchem Ergebnis Ihr gekommen seid.«
Cuthbert holte tief Luft. Es war sinnlos. Der Moment ließ sich hinauszögern, vermeiden ließ er sich nicht.
»Ich habe die lateinische Abschrift, die Ihr mir zu lesen gabt, übersetzt«, begann er seinen Bericht. »Dabei habe ich jedes einzelne Wort und jede Bedeutung, die es in unserer Sprache haben mag, genau bedacht und abgewogen. Das Ergebnis meiner Bemühungen wird Euch jedoch nicht gefallen, mein König – denn ich fürchte, dass jenes Schriftstück Euch nicht helfen wird.«
»Was?«
In einer Zorneswallung sprang Amalric auf die Beine, seiner Leibesfülle ungeachtet. »Was redet Ihr da? Der Brief, dessen Abschrift ich Euch zu lesen gab, ist über jeden Zweifel erhaben! Er stammt aus dem Besitz des Kaisers von Byzanz und wurde mir anvertraut, als ich im vorletzten Jahr dort weilte!«
»Daran zweifle ich nicht, mein König.« Cuthbert schüttelte das demütig gesenkte Haupt.
»Nur wenigen ist das Privileg zuteil geworden, diesen Brief zu lesen, unter ihnen der Kaiser, seine Heiligkeit der Papst sowie der König von Frankreich – und Ihr zweifelt an seiner Echtheit?«
»Das tue ich in keiner Weise, mein König«, versicherte Cuthbert weiter kopfschüttelnd. »Aber ich sehe keine Möglichkeit, aufgrund der darin enthaltenen Informationen jenen Ort zu finden, von dem dort die Rede ist.«
»Wie könnt Ihr so etwas sagen? Noch dazu mit derartiger Endgültigkeit?« Amalrics weit aufgerissene Augen schienen aus ihren Höhlen treten zu wollen. »Wisst Ihr nicht, was auf dem Spiel steht? Habe ich es Euch nicht eindringlich genug erklärt?«
»Das habt Ihr, mein König. Ich fürchte nur …«
»Ihr fürchtet?«, herrschte Amalric ihn an. »Ich werde Euch sagen, was Ihr zu befürchten habt, Bruder Cuthbert! Damietta ist ein Fehlschlag gewesen! Der Kampf um Ägypten ist verloren, und man braucht kein Hellseher zu sein, um zu wissen, was die Zukunft bringen wird. Dunkle Wolken ballen sich am Horizont. Ein Sturm zieht auf, der einen Namen trägt: Salah al-Din! Der Wesir von Ägypten gewinnt täglich an Macht! Früher oder später wird er kommen, um sich Jerusalem zu nehmen und sich für das zu rächen, was seinen Leuten angetan wurde, als wir die Stadt eroberten. Noch bin ich stark genug, um mein Königreich zu behaupten – aber wie lange noch? Und was wird geschehen, wenn ich diese Welt verlassen habe? Wer wird mir auf den Thron von Jerusalem folgen? Meine halbwüchsige Tochter? Oder mein männlicher Erbe, der vom Aussatz befallen ist?«
Cuthbert senkte den Blick.
Dass Amalrics Sohn Baldwin seit seiner frühen Kindheit an Lepra litt, war eine bedauerliche Tatsache. Der Junge hatte den Scharfsinn und die Tatkraft seines Vaters geerbt, aber vermutlich würde er nicht alt genug werden, um die Krone von Jerusalem auf seinem Haupt zu tragen.
»All jene, die mir jetzt noch die Füße küssen, werden wie Hyänen über den Jungen herfallen«, fuhr Amalric düster und mit heiserer Stimme fort, »und Jerusalem wird schwach und schutzlos sein, den Sarazenen hilflos ausgeliefert. Die Fürsten werden keinen Aussätzigen auf dem Thron des Reiches respektieren, und Baldwin wird nicht stark genug sein, um seine Macht zu behaupten. Der Junge muss genesen – und mit ihm auch mein Königreich!«
»Ihr wollt ein Wunder, mein König«, entgegnete Cuthbert, »und Wunder vermag allein der Allmächtige zu wirken.«
»Was Ihr nicht sagt – es sieht aber nicht so aus, als wollte er ein Wunder an mir und meiner Familie wirken! Stattdessen heißt es, Gott hätte sich von uns abgewandt. Wisst Ihr nicht, was in den Straßen gemunkelt wird? Es heißt, dass ich allein die Verantwortung für die Niederlage in Ägypten trüge! Dass ich unsere heilige Sache vor den Mauern Damiettas verraten hätte! Dass ich mich von den Sarazenen hätte kaufen lassen und schuld daran sei, dass dieser Emporkömmling Salah al-Din – oder Saladin, wie sie ihn jetzt nennen – seine Macht festigen konnte! Und es heißt auch«, fügte er leiser und mit glasigem Blick hinzu, während er kraftlos zurück auf die Kissen sank, »dass der Herr mich und die Meinen dafür strafen wolle.«
»Ihr kennt mich, mein König«, wandte Cuthbert ein. »Ich bin ein Mann des Glaubens und der Wissenschaft. Ich gebe nichts auf das Gerede in den Straßen. Was für mich zählt, sind Fakten, denn in ihnen spiegelt sich Gottes Ordnung.«
»Und nichts anderes als Fakten bat ich Euch zu untersuchen«, bestätigte Amalric trotzig. »Heißt es in jenem Brief nicht, dass es eine Quelle von seltener Heilkraft gibt, die Christen von jeglichen Gebrechen befreit?«
»So heißt es«, stimmte Cuthbert zu, »doch reichen die Ortsangaben bei Weitem nicht aus, um diese Quelle zu finden. Zwar ist von Bergen und Flüssen die Rede und wohl auch von einer großen Wüste, jedoch ist keiner dieser Orte mit Namen benannt. Auch sind keine Himmelsrichtungen erwähnt oder die Position von Gestirnen.«
»Und?«
»Herr, wir wissen nicht viel über die Länder jenseits des Orients, abgesehen davon, dass sie wild und heidnisch sind und von nahezu unermesslicher Weite. Wenn es jenen Quell gibt, von dem der Brief berichtet, so könnte er überall sein, und ein ganzes Menschenleben würde nicht ausreichen, um …«
»Genug!«, fiel Amalric ihm ins Wort. Seine Stimme überschlug sich, und seine Augen bekamen einen fiebrigen Glanz. »Ich will nichts von solchen Einwänden wissen! Dies Schriftstück ist von großer Seltenheit und für die Augen mächtiger Herrscher bestimmt!«
»Und ich danke Euch für das Privileg, es studieren zu dürfen, Herr«, stimmte Cuthbert zu. »Alles, wovon in diesem Brief die Rede ist, mag genauso existieren. Ich bestreite es nicht, weil ich das Gegenteil nicht beweisen kann. Aber wenn Ihr behauptet, dass Ihr mich meiner Ehrlichkeit wegen zu diesem Dienst berufen habt, so muss ich Euch um der Wahrheit willen sagen, dass ich ohne genaue Beschreibung des Ortes nicht die geringste Möglichkeit sehe, jenen heilenden Quell zu finden.«
»Aber … ich will es!«, entgegnete Amalric mit hilflosem Trotz, der mehr von jenem halbwüchsigen Knaben hatte, den Cuthbert einst unterrichtet hatte, als von einem reifen Mann.
Einmal mehr ertappte sich der Mönch dabei, dass er Mitleid empfand. Unwillkürlich machte er einen Schritt auf den König zu, der dort vor ihm auf seidenen Kissen kauerte, mit hängenden Schultern und gesenktem Haupt. »Bisweilen«, sagte er leise, »ist Wollen nicht genug, mein König.«
Amalric schaute ihn an. Der Zorn war aus seinem Blick gewichen, nur noch Resignation war darin zu erkennen. Und, wie Cuthbert betroffen feststellte, nackte Furcht.
»Ihr habt keine Ahnung«, flüsterte er, »könnt nicht begreifen, wie es ist, wenn alles, wofür man zeit seines Lebens gekämpft hat, einfach endet und nichts davon bleibt.«
»Das könnt Ihr nicht wissen, mein König. Die Wunder des Herrn offenbaren sich auf mancherlei Weise, jedoch nicht immer so, wie wir es erwarten.«
»Natürlich.« Amalric lachte freudlos auf. »Ich höre meinen alten Lehrer sprechen. Stets habt Ihr mich angehalten, mit wachen Augen durch das Leben zu gehen und die Vielfalt der Schöpfung zu würdigen. Habt Ihr mir nicht auch geraten, die Sarazenen nicht nur als Feinde zu betrachten, sondern auch von ihnen zu lernen? Das Beste beider Welten zu vereinen?«
Cuthbert zögerte. Die Art und Weise, wie Amalric fragte, gefiel ihm nicht. Der Herrscher von Jerusalem ähnelte einem verwundeten Löwen, der sich zurückgezogen hatte, um seine Wunden zu lecken. Er mochte geschlagen und geschwächt sein – dennoch war er noch immer ein Löwe. »Das habe ich«, räumte der Mönch vorsichtig ein und ließ den Blick durch die Kammer schweifen, »und wie ich erkennen kann, habt Ihr meine Ratschläge berücksichtigt.«
»Das habe ich allerdings.« Amalric beugte sich zu ihm herab, sodass Cuthbert den schweren, nach Wein und Fäulnis schmeckenden Atem seines Herrschers riechen konnte. »Ist Euch je der Gedanke gekommen«, fragte er leise, »dass meine Offenheit den Heiden gegenüber der Grund dafür sein könnte, dass Gott mich auf so schreckliche Weise bestraft? Womöglich, mein alter Freund, tragt Ihr die Schuld an meinem Unglück!«
Cuthbert zuckte innerlich zusammen. Seine Freude darüber, aus der Schar der Berater, mit denen sich der König umgab, herausgehoben worden zu sein, war längst verblasst. Nun schwand auch noch der letzte Rest geschmeichelter Eitelkeit. Ernüchtert kam er zu der Erkenntnis, dass für seinen einstigen Schüler Amalric vor allem eines zählte.
Amalric.
Er holte tief Luft und wählte seine nächsten Worte mit Bedacht, wohl bewusst, dass es seine letzten sein mochten. »Mein König«, begann er leise, aber mit fester Stimme, »in all den Jahren, da ich die Ehre hatte, Euch zu unterrichten, seid Ihr mir immer mehr gewesen als nur ein Schüler. Ich habe Euch geliebt wie einen meiner Mitbrüder, und wenn es etwas gäbe, das ich tun könnte, um Euch zu helfen oder Eure Drangsal zu lindern, so würde ich es ohne Zögern tun. Aber ich kann es nicht.«
»Ist das Euer letztes Wort?«
Cuthbert beugte das Haupt. »Ich fürchte, so ist es.«
»Dann geht!«, herrschte Amalric ihn von seinem hohen Sitz herab an. »Verlasst meinen Palast und kehrt niemals wieder zurück! Niemals wieder, solange ich lebe, habt Ihr verstanden?«
»Mein König, ich …«
»Habt Ihr mich nicht verstanden? Ihr sollt gehen!«
Cuthbert war klar, dass jeder Widerspruch oder jeder weitere Erklärungsversuch nicht nur zwecklos gewesen wären, sondern womöglich tödlich. Dem Herrscher des Landes seine Hilfe zu verweigern, warum auch immer, konnte als Hochverrat ausgelegt werden – der Grund, warum Amalric es jetzt nicht tat, hing vermutlich mit jenem halbwüchsigen Jungen zusammen, der noch immer irgendwo unter der aufgedunsenen, fleischigen Hülle steckte.
Cuthbert verbeugte sich tief und demütig und verließ dann die Kammer. Auf der Schwelle blickte er sich ein letztes Mal um, sah den König jenseits der Schleier auf seinen Kissen thronen.
Geschlagen.
Allein.
Jetzt erst merkte der Mönch, dass ihm das Herz bis zum Hals schlug. Er verspürte das Bedürfnis, den Palast sofort zu verlassen, doch als er sich umwandte, versperrte ihm jemand den Weg.
Es war nur eine schmächtige Gestalt, die ihm kaum bis zu den Hüften reichte, Cuthbert fuhr dennoch erschrocken zusammen. »Prinzessin Sibylla! Verzeiht, ich … ich habe Euch nicht gesehen!«
Amalrics Tochter erwiderte nichts. Es war nicht zu erkennen, ob sie wusste, was hier vor sich ging. Der Blick ihrer blauen Augen jedoch durchbohrte Cuthbert wie die Spitze eines Speeres – und er schien sagen zu wollen, dass die Angelegenheit noch nicht beendet war.
Irgendwann würden sie einander wiederbegegnen, und er würde sich rechtfertigen müssen.
Eines fernen Tages.
2
»Bei uns lügt keiner und kann keiner lügen; denn hat jemand wissentlich eine Lüge ausgesprochen, so stirbt er zur Stund.«
Brief des Johannes Presbyter, 199 – 201
Ascalon, Königreich JerusalemJanuar 118714 Jahre später
»Nein! Mutter! Bitte nicht!«
Mit einem Aufschrei schoss Rowan in die Höhe und riss die Augen auf. Helles Licht blendete ihn, gegen das sich die verschwommenen Umrisse einer schlanken Gestalt in einem langen Kleid abzeichneten.
»Mutter?«
»Nicht ganz, mein Junge. Aber es freut mich, dass du erwacht bist.«
Für einen Augenblick empfand Rowan nur heillose Verwirrung. Er stellte fest, dass sein Haar und der obere Teil seines Gewandes völlig durchnässt waren, sah den hölzernen Eimer in den Händen seines Gegenübers – und begriff, dass es ein Wasserschwall gewesen war, der ihn so jäh aus seinem Traum gerissen hatte.
Mit dieser Erkenntnis kehrte auch die Erinnerung zurück. Und gleichzeitig das Dröhnen in seinem Schädel, das von einem wuchtigen Schlag auf den Hinterkopf rührte. Unwillkürlich befühlte er die Stelle, die sich knapp unterhalb der Tonsur befand. Das kurz geschnittene Haar war mit verkrustetem Blut verklebt, aber offenbar hatte sich die Wunde geschlossen.
»Ich muss zugeben, ich hatte dich mir anders vorgestellt. Nach allem, was ich gehört hatte, hatte ich mir einen vierschrötigen Rüpel vorgestellt, mit dem Gesicht eines Kamels und dem Verstand eines Ochsen. Du jedoch scheinst das Gegenteil von alldem zu sein.«
Benommen, wie er noch immer war, verstand Rowan nur jedes zweite Wort und war nicht sicher, ob er soeben gelobt oder gerügt worden war. Er wollte etwas erwidern, brachte jedoch nur ein Krächzen zustande.
»Sachte, mein Sohn«, mahnte ihn der Fremde, der, wie Rowan jetzt erst feststellte, in seiner Muttersprache mit ihm redete. »Du bist noch nicht wieder bei Kräften, solch ein Kampf hinterlässt Spuren. Wie man mir berichtete, bedurfte es der vereinten Kräfte des Cellerars, dreier Novizen sowie von vier Laienbrüdern, um dich zu überwältigen. Und ein hölzerner Knüppel soll dabei auch noch eine Rolle gespielt haben.«
Rowan nickte nur. Vor allem Letzterer war seinem Schädel noch in lebhafter Erinnerung.
»Wer seid Ihr?«
»Sieh an, sprechen kannst du auch! Die Überraschungen scheinen heute gar kein Ende nehmen zu wollen.«
Durch die halb geschlossenen Lider blinzelte Rowan gegen das Sonnenlicht. Ganz allmählich konnte er Einzelheiten erkennen. Die nackten Wände des carcer, in den man ihn offenbar gesperrt hatte, während er ohne Bewusstsein gewesen war, die Gitter vor dem hohen Fenster – und die Gestalt, die vor ihm stand.
Nun, da sich seine Augen an die Helligkeit gewöhnten, erkannte Rowan deutlich, dass es kein Kleid war, das der Fremde trug, sondern ein Mönchshabit, dazu eine weite Kukulle mit zurückgeschlagener Kapuze. Beides war allerdings nicht in den hellen Farben des Zisterzienserordens gehalten, sondern im düsteren Schwarz der Benediktiner, was Rowan noch mehr verwirrte.
Der fremde Mönch war von schmaler Postur, jedoch nicht allzu groß, sodass er zumindest in dieser Hinsicht durchaus etwas Feminines an sich hatte; seine Züge waren fein geschnitten und trotz der Falten, die sich darin eingegraben hatten, von einer jugendlichen Neugier, wie Rowan sie noch bei keinem anderen Mönch gesehen hatte. Buschige Brauen wucherten über kleinen, aber äußerst wachen und aufmerksamen Augen, deren Blick so leicht nichts zu entgehen schien. Das Haar des Mannes, dessen Alter Rowan auf über sechzig Winter schätzte, war dünn und grau. Die Tatsache, dass nur noch ein schmaler Kranz davon geblieben war, der sich am Hinterkopf entlang von einem Ohr zum anderen zog, machte eine Tonsur überflüssig.
»Ich bin Bruder Cuthbert«, stellte sich der Fremde vor, ehe Rowan die Frage wiederholen konnte.
»Ihr … Ihr seid kein …«
»Nein«, räumte Cuthbert bereitwillig ein, »ich gehöre zum Orden von Sankt Benedikt. Jedoch hat es meinen eigenen Leuten gefallen, mich zum Botschafter bei unseren Zisterzienserbrüdern zu machen – vielleicht, um das Miteinander der Diener Christi zu fördern, vielleicht auch nur, weil sie meiner überdrüssig waren. Inzwischen haben sie mich wohl längst vergessen – geblieben sind mir jedoch die Kleider, die mich an meine Herkunft erinnern.«
»W-was?« Rowan griff sich an den schmerzenden Hinterkopf. Er war sich nicht sicher, ob er recht verstanden hatte – zum einen sprach der Benediktiner sehr viel schneller, als es seinem dröhnenden Schädel zuzumuten war. Zum anderen hatte er eine Art, über sich und andere zu sprechen, die für einen Mönch ungewöhnlich war. Ein gewisser Spott war nicht zu überhören, der allerdings nicht beißend oder übelwollend war, sondern von einer Milde, wie sie Rowan lange nicht begegnet war.
»Kannst du aufstehen?«, erkundigte sich Cuthbert unvermittelt.
»I-ich denke schon.«
»Das ist gut. Es würde wohl ziemlich seltsam aussehen, wenn ich meinen Diener tragen müsste.«
»Euren Diener?«
»Ganz recht. Du wurdest mir als mein neuer Diener zugeteilt. Und du wirst Ascalon noch heute verlassen.«
»Natürlich.« Rowan nickte – er hatte nichts anderes erwartet. So ging es schon, seit er die Mönchskutte zum ersten Mal übergezogen hatte, und das war vor vierzehn Jahren gewesen.
Den Anfang hatten die Ordensbrüder von Melrose gemacht, die ihn seines, wie es hieß, »ungehorsamen und aufrührerischen Geistes« wegen ins Kloster von Tintern versetzt hatten. Von dort hatte man ihn nach Frankreich geschickt, nach Clairvaux, Fontenay und Sénanque. Schließlich war er nach Italien gelangt, bis sich auch der Abt von San Clemente nicht mehr anders zu helfen gewusst und ihn ins Heilige Land geschickt hatte, wohl in der Hoffnung, dass die Verhältnisse dort sein unbeugsames Wesen brechen oder es zumindest ein wenig einschüchtern würden. Vor zwei Jahren war Rowan nach Ascalon gelangt, wo die Zisterzienser eine kleine Niederlassung unterhielten – nun schien erneut die Zeit des Aufbruchs für ihn gekommen.
»Nur falls du dich das fragen solltest – es hat mich keine allzu große Mühe gekostet, den Prior zu überreden, dich aus seinen Diensten zu entlassen.«
»Das glaube ich gern.«
»Er sagte, dass du der störrischste Laienbruder seist, der ihm in seiner langen Zeit in den Diensten des Herrn untergekommen ist. Und dass ich – wie hat er sich gleich ausgedrückt? – von allen guten Geistern verlassen sein müsste, mir ausgerechnet dich als meinen neuen Adlatus auszusuchen.«
»Ihr … Ihr habt mich ausgewählt?« Ungläubig schaute Rowan an dem Benediktinermönch empor.
»In der Tat. Da es dem Herrn gefallen hat, mich mit einem langen Leben zu segnen und meinen Verstand im selben Maße zu erhalten, wie er meine Körperkraft hat schwinden lassen, bin ich auf die Hilfe eines Mitbruders verwiesen, wenn ich mich auf Reisen begebe – und nichts anderes habe ich vor.«
»Ihr wollt zu einer Reise aufbrechen? Wohin?«
»Jerusalem«, sagte Cuthbert nur.
»I-Ihr geht nach Jerusalem?«, stammelte Rowan. »U-und ich soll mit?«
»Eigenartig.« Der Benediktiner rieb sich das Kinn. »Ich dachte, ich hätte es mit einem wachen Verstand zu tun. Sollte ich mich etwa geirrt haben?«
»Warum gerade ich?« Die Frage beschäftigte Rowan mehr als alles andere. Allein für die Aussicht, den Konvent von Ascalon zu verlassen, wäre er Bruder Cuthbert beinahe überall hin gefolgt – dass es nach Jerusalem gehen sollte, der hohen Stadt, von der er so viel gehört, die er aber noch nie betreten hatte, machte die Sache noch viel aufregender.
»Zum einen, weil wir Landsleute sind«, erwiderte der Benediktiner lächelnd, was erklärte, weshalb er des Gälischen mächtig war. »Meine Geburtsstätte liegt nahe Dumfries. Dort wuchs ich auf, ehe die Mönche von Durham mich zu sich nahmen. Und irgendetwas sagt mir, dass wir Schotten, starrköpfig und eigenbrötlerisch, wie wir nun einmal sind, zusammenhalten sollten.«
Rowan verzog keine Miene. Alles in ihm wehrte sich dagegen, diesen seltsamen Kauz sympathisch zu finden. Aber es war offensichtlich, dass er sich in mancher Weise von Rowans bisherigen Meistern unterschied. »Und zum anderen?«, wollte er wissen.
Das Grinsen in Cuthberts jungenhaften Zügen wurde noch breiter. »Weil ich eine Schwäche für Rebellen habe.«
JerusalemZur selben Zeit
»Und was gedenkt Ihr dagegen zu tun?«
Die Frage stand im Raum, drohend wie die Spitze eines Dolchs, penetrant wie der beißende Geruch, den der Wind aus den engen Gassen des armenischen Viertels zum Königspalast herauftrug.
Sibylla stand am Fenster und blickte gen Osten, zu ihren Füßen die Heilige Stadt, das Zentrum der Welt. Einsamen Wächtern gleich ragten die Türme und Kuppeln aus dem staubgrauen Häusermeer und der unüberschaubaren Wirrnis flacher Dächer, zwischen denen sich Straßen und Gassen erstreckten – hier die Kirche von Sankt Jakobus, dort jene des heiligen Martinus, den die Franzosen als ihren Schutzheiligen verehrten, rechts davon Sankt Peter. Und dahinter, hoch auf dem von mächtigen Mauern umgebenen Plateau, thronte der Felsendom, das Wahrzeichen der Stadt, in dessen goldfarbener Kuppel sich das Licht der aufgehenden Sonne brach. Das schwarz-weiße Banner der Templer wehte dort, die den heiligen Berg zu ihrem Domizil erkoren hatten. Zusammen mit dem trutzigen Turme Davids, in dessen Schutz sich der Palast des Königs erhob, stellte er den Pfeiler dar, auf dem die Macht des Reiches Jerusalem seit fast einhundert Jahren ruhte.
Doch diese Macht war nicht unerschütterlich.
Sibylla dachte an ihren Vater Amalric, der oft an diesem Fenster gestanden und auf die Stadt geblickt hatte, seine Stadt, für die er solch große und schwere Opfer gebracht hatte. Wehmut überkam sie, und sie riss sich von dem Anblick los, wandte sich wieder dem Mann zu, der jetzt in den königlichen Gemächern wohnte.
»Ich habe Euch gefragt, was Ihr dagegen zu tun gedenkt, meine Gemahlin.« Guy de Lusignan saß auf der Kante des Bettes, das die Mitte der Kammer einnahm und in dem er stets allein zu ruhen pflegte. Wünschte er Sibyllas Gesellschaft, so besuchte er sie gewöhnlich in ihrer Kammer. In letzter Zeit allerdings waren diese Besuche seltener geworden. Guy plagten Sorgen, und diese schienen auch seine Manneskraft zu beeinträchtigen.
»Was ich dagegen zu tun gedenke?«, erwiderte sie mit einem Anflug von Spott. Dies war nicht der Mann, den sie geheiratet hatte! Jener Guy de Lusignan, der einst aus Frankreich nach Jerusalem gekommen war, bereit, die Heiden mit eiserner Faust zu zerschmettern, war nicht zu vergleichen mit der traurigen, von Ehrgeiz und Sorge zerfressenen Gestalt, die dort am Bettrand kauerte. Jung und voller Tatendrang war er einst gewesen, ein strahlender Held in ihren Augen, dessen Avancen sie sogleich erlegen war. Noch keine zwanzig Winter war sie damals alt gewesen und dennoch schon eine Witwe. Guillaume de Montferrat, den sie auf Weisung des Regenten Raymond von Tripolis gegen ihren Willen geheiratet hatte, war gestorben, kurz nachdem sie ihm einen Sohn geboren hatte. Als Mutter des zukünftigen Königs war ihr gestattet worden, am Hof von Jerusalem zu verbleiben, jedoch war ihr Einfluss zusehends geschwunden – bis Guy in ihr Leben getreten war.
Sibylla wusste nicht mehr zu sagen, was ihn so unwiderstehlich hatte scheinen lassen: die körperliche Anziehung, die er auf sie ausgeübt hatte, oder die Aussicht, durch seine Hilfe wieder zu Macht und Einfluss zu gelangen. Möglicherweise beides. Guy, der ihre Not und Einsamkeit ebenso gespürt zu haben schien wie seine Chance, durch ihr Zutun in höchste Kreise aufzusteigen, hatte ihr den Hof gemacht. Wer wessen Reizen erlegen war, war im Nachhinein nicht mehr festzustellen. Sie hatten einander gefunden wie zwei Falken im Sturm, und schließlich war es Sibylla gelungen, ihren von Lepra gezeichneten Bruder Baldwin zu überreden, ihr Guy zum Mann zu geben.
Vor, so schien es, undenklich langer Zeit …
»Sollte ich es nicht sein, die Euch diese Frage stellt, werter Gemahl?«, erkundigte sich Sibylla spitz. »Muss ich Euch daran erinnern, dass Ihr der König von Jerusalem seid? Dass Ihr diese Bürde von meinem vom Aussatz geschwächten Bruder übernommen habt?«
Guy starrte sie an. Dann, in einem selten gewordenen Ausbruch von Temperament, schoss er in die Höhe und kam auf sie zu. Mit wenigen Schritten seines ausgreifenden, ein wenig linkisch wirkenden Gangs war er bei ihr. Das schulterlange schwarze Haar umwehte seine schmalen Züge, die durch den spitzen Kinnbart noch betont wurden. Zorn sprach aus den tief liegenden Augen, die stets ein wenig getrieben wirkten.
»Du solltest so etwas nicht sagen«, beschied er ihr streng und mit mühsam gedämpfter Stimme. »Vergiss nicht, dass wir beide in diese Sache verwickelt sind, Sibylla. Ohne mich wärst du nicht Königin …«
»… so wie du ohne mich nicht König wärst«, konterte sie. Stolz warf sie das Haupt mit dem kunstvoll geflochtenen Haar in den Nacken und taxierte ihn aus ihren schmalen Augen, die nach orientalischer Art dunkel umrandet waren, was das Azurblau ihrer Pupillen noch deutlicher hervortreten ließ.
»Wie ich schon sagte«, stieß er zwischen zusammengepressten Zähnen hervor, während er noch näher trat, »wir stecken gemeinsam in dieser Sache. Wir können ohne einander nicht sein, Sibylla, sind aneinandergebunden wie der Blinde und der Lahme.«
»Ein schöner Vergleich.« Sie lächelte matt und ließ ihren Blick an seiner schlanken Gestalt herabgleiten. »Wer von beiden du bist, ist nicht weiter schwierig zu erraten.«
»Sibylla!« Er packte sie an den Schultern und stieß sie hart gegen die Wand. »Das ist kein Spiel! Begreifst du nicht, was hier vor sich geht? Die Krone auf meinem Haupt wankt! Viele der eingesessenen Familien hätten es lieber gesehen, wenn Graf Raymond deinem Bruder nachgefolgt wäre. Nur mit List ist es uns gelungen, sie zur Zustimmung zu überreden, und viele zürnen uns deswegen.«
»Und? Was hast du erwartet, mein Gemahl? Dass es einfach werden, dass dir die Macht in den Schoß fallen würde?«
»Nein, aber ich …«
»Oder hast du etwa Angst?«
»Schweig, Weib!« Er presste sie noch fester an die Wand. »Weder bin ich ein Feigling noch habe ich je eine Konfrontation gescheut«, zischte er, »aber diesen Kampf können wir nicht gewinnen. Wenn Saladin erst sein Heer formiert hat und gegen Jerusalem zieht, wird der Adel von uns abfallen und sich Raymond von Tripolis zuwenden, und dann …«
»Du hast Angst«, stellte sie fest, streng und abweisend. »Wo sind deine Visionen geblieben, Guy? Wo dein Ehrgeiz? Wo dein Hunger nach Geltung? Dein Streben nach Macht? Hast du vergessen, was wir gemeinsam erreichen wollten?«
»Sei still«, beschied er ihr. »Was weißt du schon über mich? Ich bin noch immer so hungrig wie am ersten Tag unserer Begegnung!«
»Wirklich?« Ihre blauen Augen musterten ihn herablassend. »Sosehr ich mich auch bemühe, mein Gemahl, ich kann davon nichts erkennen.« Sie versuchte vergeblich, sich aus seinem Griff zu winden. Zumindest was die Körperkraft betraf, schien er ihr also noch überlegen zu sein.»Strapaziere meine Nachsicht nicht allzu sehr, Sibylla«, riet er ihr. »Du solltest keine Spiele mit mir treiben. Und du solltest nicht den Fehler begehen, mich zu unterschätzen!«
Er presste sich noch ein wenig fester an sie – und zu ihrer Überraschung stellte sie fest, dass offenbar auch seine Lenden noch nicht so lahm waren, wie sie angenommen hatte.
Obwohl ihr kaum noch eine Möglichkeit blieb, sich zu bewegen, drehte sie den Kopf zur Seite, als wollte sie sich ihm verweigern – sie kannte ihn gut und lange genug, um zu wissen, wie er auf eine solche Zurückweisung reagieren würde.
»Hexe«, zischte er, packte mit der Rechten, die den Siegelring des Reiches Jerusalem trug, ihr Kinn und riss es herum. Keuchend presste er seine schmalen Lippen auf die ihren, während seine Linke unter die Rockschöße ihres Kleides glitt. Die Königin gab einen unterdrückten Schrei von sich, der die Lust ihres Gemahls nur noch anzuspornen schien. Mit lautem Stöhnen ließ er den Mund an ihrem Hals bis hinab zum Ansatz ihres Busens wandern und biss zu. Sibylla schrie erneut auf, diesmal laut und ungehemmt. Der Schmerz bereitete ihr eine Wonne, die sie lange nicht verspürt hatte. Mit bebenden Händen half sie ihm, die Verschnürung seiner Beinkleider und der Bruche zu lösen. Und während er bebend und keuchend in sie eindrang, mit einer Macht, als wollte er sie für ihre Aufsässigkeit bestrafen, hauchte sie in sein Ohr, zischelnd wie eine Schlange:
»Sei unbesorgt, Geliebter – ich habe bereits alles Nötige veranlasst. Schon bald werden unsere Feinde vernichtet sein.«
3
»Unser Land strömt über von Honig und hat überall Milch im Überfluss.«
Brief des Johannes Presbyter, 88 / 89
Jerusalem18. Januar 1187
Es war unbegreiflich.
In all den Jahren, in denen er nun schon im Heiligen Land weilte, hatte Rowan viel über die angeblichen Wunder gehört, die Jerusalem umgaben; von den geheiligten Stätten, an denen der Erlöser gewirkt hatte, wo er gekreuzigt worden und auferstanden war … doch gesehen hatte er sie noch nie. Ihn hatte man stets in Werkstätten und Lagerhäuser gesteckt, wo er niedere Arbeiten verrichten musste – mehr hatte man seinem widerspenstigen Geist nicht zugetraut. Zweifel an all den wundersamen Geschichten, die man über die Hohe Stadt erzählte, hatten sich bereits in ihm breitgemacht, ja, fast hätte er begonnen, Jerusalem selbst für ein Gerücht zu halten, für trügerischen Schein – nun jedoch sah er die Stadt mit eigenen Augen. Und ihm wurde klar, dass alles der Wahrheit entsprach.
Vor zwei Tagen waren sie in Jerusalem eingetroffen, Rowan und sein neuer Meister, der verschrobene Bruder Cuthbert. Alle bisherigen Herren, denen Rowan gedient hatte, hatte er schon nach wenigen Tagen durchschaut: ob sie streng waren oder nachsichtig, fromm oder lax, wenn es um die Einhaltung der benediktinischen Regeln ging; ob sie gebildet waren oder nur so taten; ob sie Verfechter der Sache Christi waren oder nur auf den eigenen Vorteil bedacht.
Bei seinem neuen Meister jedoch war es anders. Obwohl er ein schottischer Landsmann war und Rowan ihn womöglich noch eher hätte verstehen müssen, wurde er einfach nicht schlau aus ihm. Noch am Tag ihrer Ankunft in Jerusalem hatten sie den Ölberg bestiegen und jenen Ort besucht, an dem sich einst der Garten Gethsemane befunden hatte. Doch statt den Herrn laut zu preisen und über die Sünde des Judas zu klagen, war Cuthbert nur auf die Knie gefallen und hatte stille Andacht gehalten – auch auf diese Weise, so sagte er, könne man der Leiden des Herrn und der menschlichen Fehlbarkeit gedenken.
Aber auch in anderer Hinsicht schien sich der alte Benediktinermönch grundlegend von allen zu unterscheiden, in deren Diensten Rowan bisher gestanden und die ihn früher oder später alle verjagt hatten. Jeder hatte versucht, Rowans widerspenstigen Geist zu zähmen, ihm fortwährend Vorhaltungen gemacht und endlose Bibelrezitationen angedeihen lassen, in der Überzeugung, dass dadurch ein besserer Mensch aus ihm würde. Cuthbert hingegen erwies sich als beharrlicher Schweiger. Reden schien nicht seine Sache zu sein, und er sprach nur, wenn es sich nicht vermeiden ließ.
Vom christlichen Viertel aus, wo sie in einer von Zisterziensern unterhaltenen Herberge wohnten, hatten sie am zweiten Tag einen Rundgang unternommen, der sie durch das armenische Viertel zu jenen mächtigen, noch aus Salomons Zeiten stammenden Mauern geführt hatte, über denen sich groß und prächtig der Felsendom erhob. Dies, so hatte Cuthbert in einem seltenen Anflug von Redseligkeit erklärt, sei das Hauptquartier des Templerordens, dessen Mitglieder als Streiter Christi das karge Dasein von Mönchen fristeten – mit dem Unterschied, dass ihr Einfluss den gewöhnlicher Mönche bei Weitem übertraf.
Soweit Rowan es beurteilen konnte, unterschied sich Jerusalem von allen anderen Städten, in denen er je gewesen war. Die Betriebsamkeit und das Gedränge in den Gassen waren unvergleichlich. Unter gestreiften Baldachinen hatten Händler ihre Waren ausgebreitet, aus Läden und Tavernen, die sich tief ins Innere gedrungener Gebäude erstreckten, drangen exotische Gerüche. Männer und Frauen drängten sich auf den lärmenden Straßen – Handwerker, die ihre Dienste feilboten, Mönche verschiedener Orden, Wasserverkäufer, Pilger in zerschlissenen Gewändern, Diener auf Botengängen, Soldaten der Stadtwache und noch viele mehr. Händler zerrten schwer beladene Kamele hinter sich her, dazwischen ragten vornehm gekleidete Herren und Damen aus der Masse, die hoch zu Ross reisten oder in Sänften getragen wurden.
Nicht weniger faszinierend als das bunte Durcheinander waren die vielen Stimmen und Sprachen, die allenthalben zu hören waren – neben den Pilgern aus dem Abendland waren auch Armenier und Griechen anzutreffen, dazu Turban tragende Türken, mit Kaftan und Burnus bekleidete Berber sowie Menschen aus Afrika, deren Haut so dunkel war, als wäre sie von der Sonne verbrannt. Sie alle in – so jedenfalls schien es – trauter Einheit zu sehen verwirrte Rowan, und Dutzende von Fragen lagen ihm auf der Zunge, die er Cuthbert gerne gestellt hätte. Er ließ es bleiben, da er sich vor dem seltsamen Benediktiner keine Blöße geben wollte. Sein Erstaunen jedoch blieb und wurde immer größer.
Über die via dolorosa folgten sie am Morgen des dritten Tages dem Leidensweg des Herrn und gelangten zur Kirche des Heiligen Grabes.
Aus Erzählungen wusste Rowan, dass jener Bau, der im Nordwesten der Stadt auf uralten Felsen thronte, nicht derjenige war, der in den alten Tagen dort errichtet worden war; die Heiden hatten ihn vernachlässigt und teilweise zerstört, erst nach der Eroberung der Stadt durch das christliche Heer war die Kirche wieder aufgebaut worden – ein gewaltiger, von einer hohen Kuppel bekrönter Bau, der sich über jenem Felsengrab erhob, in das die sterbliche Hülle des Herrn einst gebettet worden und aus dem er auferstanden war.
Obwohl es noch früher Morgen war, warteten bereits viele Gläubige, die die Kirche besuchen und das Heilige Grab mit eigenen Augen sehen wollten. An der Seite seines neuen Meisters reihte sich Rowan in die Schlange ein, die sich vor dem Kirchenportal gebildet hatte. Pilger stimmten Choräle an, allenthalben falteten die Menschen die Hände und beteten – und Rowan konnte nicht verhindern, dass sich ein seltsames Gefühl seiner bemächtigte.
Was in aller Welt tat er hier?
Schon am Ölberg hatte eine eigenartige Rührung von ihm Besitz ergriffen, und nun hatte es den Anschein, als wollte dieses Gefühl zurückkehren – und das ungewollt.



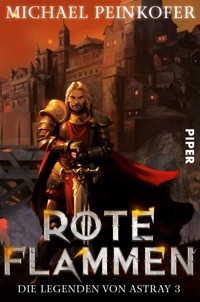
![Die Farm der fantastischen Tiere. Voll angekokelt! [Band 1] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/710616cb53ccb4acc4a9849ce5514b3c/w200_u90.jpg)
![Die Farm der fantastischen Tiere. Einfach unbegreiflich! [Band 2] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4d3987251531d3c0eb5b0ada994d2676/w200_u90.jpg)