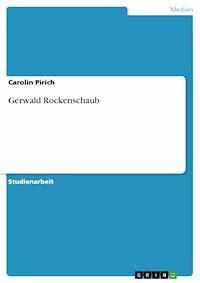Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Berenberg Verlag GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was ist das mit der Musik ? Warum ergreift sie uns so unmittelbar, so intensiv ? In fünfzehn Begegnungen mit Menschen, die sich ihr ganz verschrieben haben, spürt Carolin Pirich dem Wesen der Musik nach und versucht, ihren Zauber greifbar zu machen. Denn: Musik ist mit den Menschen verbunden, so einfach ist es. Sie erzählt vom Leben, Menschen teilen sich über sie mit, andere hören ihnen zu. Carolin Pirich fragt und hört genau zu, wenn eine Dirigentin wie Joana Mallwitz, Musiker wie Christian Tetzlaff oder Igor Levit, aber auch Nachwuchstalente, Mozarts Geige, der Platzanweiser in der Oper oder die Musik selbst in Worten, Tönen und Pausen erzählen – und so entsteht wie nebenbei ein lebhaftes Bild des modernen Musikbetriebs: vom Vorspiel bis zum Medienstar. »Mit dem ersten Einsatz, bei dem die Musik wirklich erklingt – von da an wird alles gut.« Joana Mallwitz
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carolin Pirich
Das Vorspiel
Begegnungen mit Musik in 15 Variationen
BERENBERG
»Die Musik ist der einzige Bereich, in dem der Mensch die Gegenwart realisiert.«
Igor Strawinsky
Das Konzert I
I.
Gegen den Strich
Das Vorspiel
Vom Mut, zu viel zu sein
Vor dem Vorhang
II.
»Ich will nicht nur der Mann sein, der die Tasten drückt«
Stillstand
Machine for Contacting the Dead
Auf beiden Saiten
Klassischer Krimi
III.
Ausgegraben
Vom Lärm der Zeitenwende
Zum Leben erweckt
Die dunkle Seite der Sonate
Das Konzert II
Nachwort und Dank
Nachweis
Über die Autorin
Das Konzert I
Musik hat kein Gewicht. Ein Klavier schon. Dieses hier wiegt 380 Kilo und ist schwarz lackiert, ein Steinway O-180, ein kleiner Konzertflügel, Versicherungswert: 94.000 Euro. Er soll jetzt übers Wasser. Die Klavierträger haben ihm Beine und Lyra abmontiert und ihn senkrecht auf einen Rollwagen gestellt. Als sie ihn über die Uferbefestigung auf das Pontonboot schieben und sein Gewicht ganz auf dem Boot liegt, sinken die Pontons ein paar Zentimeter tiefer in den See. Die Klavierträger wechseln stumm einen Blick. Der Himmel über Berlin ist blau. Einer der Klavierträger, er stellt sich als Kutte vor, umfasst mit einer Hand die Reling, mit der anderen überprüft er, ob der Gurt den Flügelkorpus hält.
»Wie oft macht ihr das so?«, fragt er.
Mit seinem Kinn beschreibt Kutte einen Kreis, der das Instrument, das Boot und die Insel meint, zu der wir fahren. Er sieht Ronny an, vielleicht, weil Ronny das Boot steuert. Eine Schwanenfamilie schwimmt vorbei. Ronny schweigt. Ich kann nicht schwindeln. »Das ist eine Premiere«, sage ich. Für Ronny, der einen Flügel über den See fährt. Für die Insel im Tegeler See, auf der Hütten, Zirkuswägen, ein paar Häuser und viele Buchen, Erlen und Kastanien stehen. Und es ist eine Premiere für mich als Konzertveranstalterin.
Hätte ich gewusst, was bis zu dem Moment alles auf mich zukommt, hätte ich es womöglich bei der Idee belassen. Ich sitze hinter dem Flügel auf dem Boot und habe die Worte des Chefredakteurs vom Magazin der Süddeutschen Zeitung im Ohr, der den Anstoß zu dieser Situation gegeben hat, in der mich anstrenge, ein entspanntes Gesicht zu machen, während ich versuche, eine Stelle am Flügel zu finden, an der ich ihn festhalten kann. Als würde das irgendwas nutzen, wenn das Boot Schlagseite bekäme. »Du bist keine Mäzenin«, hatte er am Telefon gesagt, als er die Regeln des Projekts erklärte. Aber das Wort ärgerte mich. Mäzenin. Als bräuchte klassische Musik zwangsläufig Mäzene. Als wären Menschen nicht bereit, ihre Wertschätzung für Kunst in Euro auszudrücken. »Es geht darum, das Geld zu mehren«, hatte er gesagt, dann legten wir auf.
Wobei.
Wenn eine Welle über das Boot schwappte und den Flügel erwischte, bräuchte ich mir zumindest über die Geldvermehrung keine Gedanken zu machen. Das wäre versenkt.
Als er im Januar anruft und sagt, er stelle ein Startkapital von 1000 Euro, ich könne machen, worauf ich Lust hätte, denke ich sofort an ein Konzert. Mit klassischer Musik. Ich brauche hin und wieder Live-Musik wie andere einen Besuch im Schwimmbad: sie erfrischt mich, füllt die Reserven wieder auf, bringt neue Perspektiven. Seit Monaten schon fließen die Tage grau und leise ineinander. Die Coronafallzahlen steigen, Schulen, Restaurants, Kinos, Konzerthäuser: geschlossen. Alle haben zu kämpfen oder leiden still – Kinder, Teenager, Familien, Alleinerziehende, Hotelangestellte, Restaurantbetreiber. Musiker sitzen zuhause und üben ziellos vor sich hin. Manche fragen sich, ob es ein Fehler war, sich in dieses Dasein begeben zu haben, als wäre klassische Musik weder Berufung noch Beruf, sondern nicht mehr als ein luxuriöses Nice-to-have, auf das man verzichtet, wenn es eben sein muss.
Trotzdem: Ich will nicht nur Konzerte besuchen, ich will jetzt selbst eines veranstalten.
Wie ich das anstellen soll, davon habe ich nur eine vage Vorstellung. Als ich einem Freund, er ist Musiker, davon erzähle, dass ich ein Konzert plane, sagt er, er wisse nicht, ob er mich bedauern oder beglückwünschen solle. Ich denke noch, er meint das finanzielle Risiko.
Was braucht es für ein Konzert? Kann ja nicht so schwer sein. Einen Ort, Publikum, Musik und jemanden, der oder die sie macht. Ich spiele Klavier. Aber das bringt mich hier nicht weiter. Mein Konzert braucht eine Musikerin, für die ich auch selbst Eintritt bezahlen würde.
Es ist ein Sonntagnachmittag im Februar, als ich Julia Hagen frage. Sie ist Cellistin, 26 Jahre alt, wir hatten uns im Sommer 2020 bei den Salzburger Festspielen kennengelernt, während einer Lockdown-Pause. Wir saßen nach einem Kammermusikabend zufällig nebeneinander, draußen, bis der Kellner die Stühle auf die Tische räumte. Mir fiel auf, dass Julia spricht, wie sie Cello spielt: mit Wärme, Tiefe, Humor. Und frei von Angst. Sie gehört nicht zu den Menschen, die sich lange mit Zweifeln aufhalten. Wenn sich für sie etwas richtig anfühlt, dann ist es für sie richtig.
Im Februar ist die Leichtigkeit aus Salzburg verflogen. Wir gehen an der Spree spazieren. Natürlich nieselt es. Julia hatte ihr letztes Konzert irgendwann vor Weihnachten gegeben, Woche für Woche wurden ihr Termine abgesagt, erst eine Japanreise, dann eine Tour in Frankreich und auch sonst überall. Sie sitzt viel zuhause, spielt Cello, backt Kuchen. Und fotografiert die Kuchen, wenn sie fertig dekoriert sind. Es sei derzeit ein ständiges Hin und Her der Gefühle, sagt Julia. Mal keime ein bisschen Hoffnung auf, dann wieder fühle sie sich ratlos, oft machtlos. Das Schlimmste sei dieses unsichtbare Achselzucken, das sich einschleiche. »Man gibt es ein bisschen auf«, sagt sie. Die Zusicherungen des Publikums, dass es Konzerte vermisse, sowie die Beteuerungen mancher Politiker, wie wichtig Kultur für die Gesellschaft sei, sind in Debatten darüber verebbt, wie die Kurve flach zu bekommen sei. Die Tränen der anderen scheint derzeit niemand mehr sehen zu wollen. Die Empathiereserven der Menschen füreinander sind aufgebraucht.
Jetzt hat Julia nicht nur Lust, selbst ein Konzert auf die Beine zu stellen, sie hat ja auch Zeit. Im Sommer, wenn Corona kein Thema mehr wäre, träumen wir: Die Menschen hielten Gläser mit schimmernden Getränken, und sie würden sich volllaufen lassen mit Musik. Klar. Aber mit welcher? Mir fällt ein, was der Dirigent Jukka-Pekka Saraste am Anfang der Pandemie gesagt hatte. Es ging um die Frage, welche Rolle Konzerte in Krisenzeiten spielten. Er erzählte davon, wie Anfang der neunziger Jahre die Menschen in Finnland während der Wirtschaftsrezession kein Geld hatten und trotzdem ins Konzerthaus strömten. Es habe keine leichten Programme gegeben, sondern Sinfonien von Schostakowitsch. Saraste sprach von einer »Katharsis«, die das Publikum in der Musik erleben wollte und erlebt habe.
Welche Musik würde jetzt in die Zeit passen? Julia und ich drehen Runden an der Spree und halten immer wieder an, um auf einen Zettel zu kritzeln, was uns zur Pandemie einfällt: Einsamkeit, Langsamkeit, Nähe, Fernweh, Unklarheit, Heimlichkeit, Enge. Was noch? Gewichtszunahme, das auch. Könnte das alles in ein Konzertprogramm übersetzt werden?
Ich denke an den Dirigenten Vladimir Jurowski, der schon seit Jahren Programme entwirft, die die großen Themen der Zeit aufgreifen wollen, den Klimawandel zum Beispiel. Die Konzepte sind gut, funktionieren aber allein schon deshalb, weil es dem Dirigenten gelingt, praktisch jeden Klang so zu formen, dass man überzeugt ist, ihn nie wieder anders hören zu wollen. Ich denke auch an Igor Strawinsky, der mal befand, dass Musik gar nichts ausdrücke, nur sich selbst. Strawinsky war aller Zweck, den manche der Musik auferlegen, zuwider. Ich kann das nachvollziehen. Ich hatte mein Studium der Musikwissenschaften abgeschlossen mit einer Arbeit über Strawinskys Idee des Gesamtkunstwerks, die sich entschieden von den Vorstellungen Richard Wagners abhob, der die Musik dem Drama unterordnete und dessen Musik sich vielleicht auch deshalb für Ideologien missbrauchen ließ.
Trotzdem löst Musik etwas aus, wenn auch in jedem etwas anderes. Als wir durch den Februarmatsch laufen, stellen Julia und ich uns vor, wie wir unserem Publikum Papier und Stift in die Hand geben, mit der Bitte, aufzuschreiben, wie sie in unser Konzert gekommen sind und wie sie danach wieder gehen. Vielleicht wäre das eine Art Beleg für einen Satz, den ich irgendwo mal gehört hatte: Man kommt in ein Konzert als Individuum hinein und geht als Gemeinschaft wieder heraus. Jedenfalls glaube ich an diesem nieselgrauen Februartag, dass das Wichtigste bei einem Konzert die Wahl des Programms ist. Dass der Inhalt die Form bestimmt.
Nach ein paar Stunden sind wir leergeredet, aber haben ein Konzept. Sieben Werke, sieben Zustände im Neuland der Pandemie. Wir finden uns sehr zeitgemäß.
Die Auswahl der Werke wollen wir dann mit den anderen Musikern zusammen treffen. Sobald wir wissen, wer mit dabei ist. Ein Cello allein reicht für unser Konzert nicht, finden wir, der Klang wäre nach einer Weile zu einsam. Wir brauchen zumindest eine Pianistin oder einen Pianisten, die können schon mal ein ganzes Orchester ersetzen, sind aber weniger aufwändig. Wir planen ein Konzert in einer Zeit, in der niemand mehr Pläne macht. Es wird sich sicher jemand finden, denken wir. Zusammen würden wir den Termin bestimmen und einen perfekten Ort finden. Einen speckigen Ballsaal aus den 1920er Jahren (Atmosphäre). Oder eine Plattenbausiedlung (Musik für alle). Oder eine Galerie (Hipness). Aber die Pianisten, die wir fragen, sagen erst begeistert zu, dann winden sie sich wieder raus. Vielleicht, weil sie unser Vorhaben aussichtslos finden? Weil wir keine erfahrenen Veranstalterinnen sind, die Aufmerksamkeit versprechen? Aufmerksamkeit ist in der Musikwelt wie überall in Kultur und Unterhaltung eine feste Währung. Wenn es schon kein Geld gibt, dann wenigstens ein bisschen Ruhm. Dabei hat bislang keiner nach einer Gage gefragt, und selbst wenn: Wir haben ja nur eine Idee und 1000 Euro. Die würden allein für die Saalmiete draufgehen. Und einen Klavierstimmer.
Außerdem sieht es weiter schlecht aus für Veranstaltungen mit Publikum. Für Ende März hat der Berliner Senat Pilotprojekte mit neun Konzerten, Opernund Theatervorstellungen vor Publikum geplant, mit personalisierten Tickets, Coronatests, Masken. Aber die Infektionszahlen steigen weiter, in der Politik rufen sie zur »Osterruhe« auf. Das Pilotprojekt wird abgebrochen. Sollen wir unser Konzert streamen, ein Geisterkonzert ohne Besucher, wie es gefühlt alle machen? Aber fast das ganze Leben findet ja gerade vor dem Bildschirm statt. Julia ist dagegen. »Wirst sehen, das wird schon«, sagt sie. Wir haben keinen Ort, keinen Termin, keine Musiker. Dafür das Virus. Und Julias Optimismus.
Es ist einer der wenigen Tage im Mai, an dem die Sonne scheint, als Julia uns in unserer Datsche in Berlin-Reinickendorf besucht. »Perfekt«, sagt sie. Sie läuft über die große Gemeinschaftswiese am Strand, das Wasser glitzert, frisches Grün leuchtet an den Bäumen, das Gras wächst dicht wie im Garten von Schloss Windsor. »Das Konzert machen wir hier«, stellt sie fest. Es klingt wie »und nirgendwo sonst«.
Die Wiese liegt auf einer Insel. Keine Straßen, keine Autos, am Wochenende steuert eine kleine Fähre den schmalen Anleger an. Wer die verpasst, hängt eine ganze Weile am Ufer herum, muss ein Tretboot leihen oder schwimmen. Oft schon haben wir Freunde mit dem Stand-up-Paddle-Board abgeholt, weil sie die Fähre verpasst oder gar nicht erst gefunden haben.
»Da sollte die Bühne stehen.« Julia deutet auf eine Stelle unter alten Bäumen, dahinter die Havel, zweifellos ein schöner Ort für ein Open-Air-Konzert. Vielleicht hört sie schon einen melodischen Mendelssohn oder leidenschaftlichen Schumann unter den hohen Baumkronen. In unserem Projekt wird Julia gerade zur Architektin und ich zur Statikerin, die die schöne Vision auf Machbarkeit überprüft. Hygienekonzept, Ordnungsamt, Stuhlreihen, saubere Toiletten, so was.
»Ich könnte zum Beispiel am 26. Juni«, sagt Julia. Der erste Samstag der Berliner Sommerferien. Das ist in gut drei Wochen. Irgendwann muss man sich ja festlegen. Der Senat hat bis 18. Juni weitere Öffnungsschritte angekündigt, und wer weiß, was der August bringt. Eine vierte Welle?
Ich ahne, ich muss jetzt eine Menge Leute davon überzeugen, dass es völlig vernünftig und alternativlos ist, auf dieser Insel mit 1000 Euro Startguthaben ein klassisches Konzert auszurichten. Und wenn ich gedacht hatte, bei einem Konzert käme es auf ein schlüssiges Programm an, lerne ich spätestens von nun an, dass dabei, wie in der Musik, wie im Leben überhaupt, wenig wichtiger ist als Timing.
Als Julia wieder auf die Fähre steigt, dreht sie sich zu mir um: »Wir brauchen auf jeden Fall ein Klavier«, ruft sie. Die Fähre legt ab, sie winkt mir fröhlich zu.
An meiner Mail an die Firma Steinway & Sons in Berlin sitze ich mehrere Tage. Wie formuliere ich die Anfrage, jemandem wie mir einen Flügel zu bringen, für wenig Geld und, ähem, auf eine Insel, auf der es keine befestigten Wege gibt? Ich kenne die Steinway-Leute, sie sind wahnsinnig nett, aber sie sind nicht verrückt. Ich recherchiere Anfahrtsweg, Uferhöhe, Höhe der Bühne, auf die der Flügel gestellt werden muss (je höher die Bühne, desto teurer der Transport), mache ein Foto vom Pontonboot, zeichne in Google Maps mit einem pinkfarbenen Strich die Route des Boots vom Festland bis zum Inselstrand. Das sieht irgendwie nach Urlaub aus. Das Anschreiben formuliere ich so ehrlich wie möglich und schließe mit der Feststellung: »Es wird nicht regnen.« Mehr als absagen können sie nicht, denke ich. Ich schicke die Mail ab.
Zwei Tage später kommt die Zusage. Sie würden uns ein Instrument zur Verfügung stellen (ohne Saalmiete!) und für uns einen Spezialpreis für den Transport verhandeln wollen. Die Pandemie hatte die ganze Branche ausgedörrt. Der Sommer liegt vor uns, jeder scheint Lust zu haben, was zu machen, und ich hatte unterschätzt, dass Menschen, die im Umfeld der Kunst arbeiten, anders ticken. Kunst muss nicht vernünftig sein, sie muss Kraft haben.
Julia fragt Musiker an, jetzt kann sie Pianisten sagen, dass wir auch ein Instrument haben.
Ich spreche mit dem Inselwart. Er heißt Ronny Kötteritzsch, ist gelernter Veranstaltungstechniker und hat ein gutes Händchen für Partys, Lichtinstallationen und transparente Stoffe im Wind. Aber seit fast zwei Jahren hat es auf der Insel kein großes Fest gegeben. Ronny zögert. Bis ich ihm vom Flügel erzähle. »Ihr bringt ein Klavier? Ernsthaft?« Er würde gleich den Inselbesitzer ansprechen. Er würde die Bühne bauen, Getränke mit dem Boot vom Festland bringen, an wie viele Leute würden wir denken?
Ich beschäftige mich mit Hygienekonzepten, Abständen, Personenzahlen, rufe bei Ämtern an, wo ich jeweils jemanden erreiche, der oder die gerade nicht zuständig für Genehmigungen von Open-Air-Konzerten ist, dann gebe ich es auf. Die Insel ist in Privatbesitz, was bedeutet, dass wir das Konzert auch als private Veranstaltung durchführen können. Das bedeutet aber auch, dass ich nicht groß Werbung machen kann, keinen Hinweis im Radio, keinen Veranstaltungstipp im Stadtmagazin, keine Vorfreude-Fotos auf Social-Media. Aber kommen dann überhaupt genug Leute auf die Insel? Und lassen diese Leute auch genug Geld da? Meine 1000 Euro sind schon längst verplant, für den Bühnenbau, für den Klaviertransport, außerdem, erfahre ich, werde ich eine technische Verstärkung einrechnen müssen, falls Wind aufkommt und den Klang fortträgt. Ich bin ja keine Mäzenin.
Ich brauche Tickets, allein, um eine Kontrolle zu haben, wie viele Menschen kommen, wegen des Hygienekonzepts. Könnte ich Ticketpreise von 20 Euro pro Erwachsenen aufrufen, bräuchte ich etwa 100 Gäste, um die Kosten für die Musik zu decken, am besten 200, dann wäre wenigstens das Taxi für die Musiker drin, wenn sie nachts die Insel verlassen. Im Tegeler Forst. Allerdings weiß ich nicht, was noch alles anfällt und was Menschen mir an Zeit und Arbeit schenken. Ich darf die Tickets ohnehin nicht verkaufen, dafür müsste ich ein Gewerbe anmelden. Also muss ich um Spenden bitten. Aber Quittungen ausstellen kann ich nicht, dazu müsste ich einen Verein gründen. Und dazu fehlt mir schlicht die Zeit. Spenden Deutsche ohne Quittung?
Ich brauche eine Bühne, Lautsprecherboxen, ein Mischpult, Mikrofone, einen Tontechniker, Stühle fürs Publikum, Desinfektionsmittel, eine Person, die die Toiletten reinigt, eine Einladungsliste und jemanden, der den Überblick über Zu- und Absagen behält, damit wir nicht zu viele werden, wegen Corona. Ich brauche Leute, die Tickets und Coronatests anschauen, Spendenboxen und Leute, die darauf aufpassen, und Jens, den Fährmann der Insel, der an dem Tag Extrafahrten macht.
Wer mir über den Weg läuft, hört von mir »Konzert dies, Konzert das«.
»Hab immer einen Kasten kühles Bier da«, rät eine Freundin, die beim Theater arbeitet, als sie uns auf der Insel besucht. Das halte die Stimmung der Helfer oben. Sie wippt auf dem Liegestuhl und blinzelt in die Sonne. Mir fällt auf, dass wir das Gras mal dringend mähen müssten. Den Gedanken streiche ich gleich wieder, spielt keine Rolle fürs Konzert.
Was, wenn es regnet?, frage ich. Die Freundin tippt auf ihrem Handy. Sie liest vor: »Profizelt Cappuccino mit Seitenwänden inklusive Auf- und Abbau. Preis auf Anfrage.« Sie zeigt mir ein Foto. Das Zelt sieht aus, als fiele es beim nächsten Windstoß um, von ästhetischen Fragen mal abgesehen. Ronny muss der Bühne doch ein Holzdach bauen, auch wenn es teurer ist.
Ich brauche eine Bar. Das ist zwar noch mehr Orga, aber mit dem Getränkeverkauf würde sich die Bar selbst finanzieren, und darüber hinaus würden wir mehr Kosten decken als durch die Spenden für die Kunst. Vermute ich. Die Bar braucht: Leute hinterm Tresen, Gläser, Wein, Cremant, Wasser, Gin, Tonicwater, Wassereis für die Kinder und Eiswürfel, und all das muss auf die Insel. Kühlschränke, Brunnenwasser und einen Tresen gibt es schon. Strom auch.
Ich schlafe zu wenig. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass Organisation nicht unbedingt mein Hobby ist. Man muss viele Bedürfnisse im Blick haben, und ich lade ja nicht zu einer Party nach Hause ein. Ich soll keinen Verlust machen, sondern »Geld mehren«, das dann gespendet wird, sprich: Eine Gage kann ich nicht zahlen. Die Musiker treten also für Liebe, den Sommer und den guten Zweck auf. Also will ich dafür sorgen, dass sie alles haben, was sie brauchen. Eine Klavierbank mit Holzbeinen zum Beispiel wünscht sich einer, Metallbeine an Klavierbänken lehne er ab, schreibt er mir und setzt ein Smiley dazu. Solche Sorgen hätte ich in dem Moment auch gern gehabt.
Was, wenn der Flügel vom Boot rutscht?
Ich telefoniere mit Versicherungen. Ein Open-Air-Konzert, mit Flügel? Versicherungswert 94.000 Euro? Schwierig. Wir seien ja nicht in Italien.
Ich checke jeden Tag die Wettervorhersage, aber längst nicht mehr auf der Wetter-App meines Smartphones, die ist zu pessimistisch. Ich schaue auf die Seite vom Deutschen Wetterdienst. Überall Dauerregen in Deutschland. Außer in Berlin. In Berlin soll ausgerechnet am Samstag, dem 26. Juni, die Sonne scheinen, 26 Grad.
Ich frage alle, die es noch hören können, danach, wie wir unser Event nennen sollen (es wird simpel: »Inselkonzert«), und verschicke Einladungen mit dem Link zu einer App, auf der man sich selbst an- und abmelden kann. Die Einladung geht an Menschen, die Julia oder ich kennen oder die einen Bezug zur Insel haben, und nur an Journalisten, mit denen wir befreundet sind, denn manche Journalisten zeigen eine Tendenz, zu glauben, ihre Anwesenheit sei schon Spende genug. Ich fühle mich schäbig. Aber ich bin ja keine Mäzenin. Ich richte ein Paypal-Konto ein, falls jemand lieber online überweist.
Ein paar Tage nachdem die Einladungen raus sind, bekomme ich meine zweite Corona-Impfung. Ich bin sehr müde. Mein Telefon klingelt ständig. Der Tontechniker fragt, ob wir Monitoring wollen (ich weiß nicht mal, was das ist), der Bekannte, der sich um die Bar kümmert, will wissen, ob wir einen guten, aber teuren oder eher einen anderen Cremant bestellen (den guten), es fehlen noch Notenpulte, Pultleuchten, Orchesterstühle, die Geige haben wir noch nicht besetzt, und die Sache mit der Klavierbank habe ich auch noch nicht gelöst.
Wie hoch wäre der Schaden, wenn ich alles absage?
Nach nur vier Tagen haben sich schon knapp zweihundert Personen angemeldet. Auf meinem Paypal-Konzert-Konto ist tatsächlich schon Geld eingegangen, und mit dem Geld: Vorschussvertrauen. Jens, der als Fährmann der Insel jeden kennt, erzählt, mit wem er schon alles gesprochen habe, und alle wollen sie kommen. Im Sommer steuert Jens die Fähre »Odin«, im Winter hat er verschiedene Jobs, mal als Brandwächter bei Konzerten, mal im Sicherheitsdienst. »Und sie bringen euch ein Klavier, ja?«, fragt er nochmal. Die Vorstellung eines Konzertflügels, der übers Wasser kommt, scheint was mit den Menschen zu machen. Vielleicht auch deshalb, weil es in eine Zeit fällt, in der man sich daran gewöhnt hat, vernünftig sein zu müssen. Einen Konzertflügel über den See zu fahren ist wohl das Gegenteil von vernünftig. Absagen ist keine Option mehr.
In diesen Tagen lege ich mich immer mal für zwei, drei Minuten in die Hängematte, die wir auf der Insel zwischen einer Linde und einem Ahorn aufgespannt haben. Mein Ohrengeräusch kommt zurück, ich sollte mal wieder richtig schlafen. Was habe ich mir und uns da zugemutet? Und warum? Für den Moment?
Meine Großmütter fallen mir ein, sie sind schon lange tot, aber mit ihren Geschichten bin ich aufgewachsen. Die eine war Sängerin, Mezzosopranistin, der auf dem Weg zur Bühne der Krieg dazwischenkam. Nach dem Krieg war sie zu alt für die Oper. Sie wurde eine der ersten Nachkriegs-Kritikerinnen, die allerdings in ihren Texten immer viel Empathie zeigte für die Menschen, die Musik ausübten. Die andere, Tochter eines Schusters mit zwölf Kindern, machte das Schreiben immer große Mühe, sie hatte in Danzig nur die Grundschule besuchen können. Wenn der Nachbar auf dem Klavier spielte und sein Fenster offen stand, hörte sie die Musik durch den Hof. Bis an ihr Lebensende blieben ihr seine Stücke im Kopf.
Musik kann man nicht essen, man kann sie sich nicht übers Sofa hängen, man kann sie nicht anfassen. Sie ist da, und dann ist sie auch schon wieder weg. Aber sie lässt etwas zurück. Was ist das mit ihr? In den vergangenen Jahren hatten die Texte, die ich schrieb, meistens mit Musik zu tun, das hat sich so ergeben. Es fasziniert mich, was Menschen bereit sind, für Musik zu tun. Warum verwenden sie einen großen Teil ihrer Lebenszeit darauf, Noten einzustudieren, die Menschen aufgeschrieben haben, die oft schon lange tot sind? Ohne diese Menschen gäbe es diese Musik heute nicht. Was machen Menschen mit der Musik, und vor allem: Was macht die Musik mit ihnen? Was ist ihr Wesen?
In anderen Worten, auf die Frage, was dieses Buch ist, würde ich antworten: Es ist eine Sammlung von Versuchen, der Musik nahezukommen.
I.
»Zu meinem vierzehnten Geburtstag habe ich mir diese kleine gelbe Taschenpartitur von Schuberts Unvollendeter Sinfonie gewünscht. Ich glaube, meine Eltern haben sich damals ein bisschen über mich gewundert. Als ich sie dann hatte, las ich immer wieder in diesem Büchlein herum wie in einem Lieblingsbuch und hörte dabei innerlich diese Musik und dachte: Man fliegt ja weg! Man kriegt ja Flügel, wenn man sich nur vorstellt, wie das klingt.«
Joana Mallwitz
Gegen den Strich
Sie fragt: Vielleicht möchten Sie mich in Aktion sehen?
Man hätte dann schon mal einen Eindruck.
Sie schlägt vor, dass wir uns in einem Raum der Staatsoper Unter den Linden treffen. Es ist später Vormittag, die Februarsonne hängt milchig hinter Wolken, drinnen ist es stickig, und Franziska Pietsch nimmt den Bogen, greift die Geige am Hals und legt sie in einer fließenden Bewegung unters Kinn. Dann lässt sie die Geige schreien. Von null auf hundert. Die Geige kreischt, jammert, weint. Und dann löst sich der Ton fast in Luft auf, ganz zart. Sie will das so.
Franziska Pietsch probt ein kaum bekanntes Stück von Eugène Ysaÿe, sein einziges Streichtrio. Musiker, die es gespielt haben, finden es »sauschwer« und »verworren«. Ysaÿe war ein Virtuose, der eines Tages nicht mehr Geige spielen konnte. Deshalb hat er komponiert. Er musste diesen Drang kanalisieren.
Die Komponisten, die Franziska Pietsch interessieren, brauchten die Musik als Ventil, weil sie etwas bedrängte. Das spürt sie. Das soll auch das Publikum spüren. Sie sagt: Man soll nicht gemütlich im Konzert sitzen.
Sie nimmt gern Musik auf, die ganz und gar nicht gefällig ist. Bartók zum Beispiel. Die letzte Sonate, die er vor seinem Tod fertig geschrieben hat, entstanden im Krieg, im Exil in New York, in einem Zustand völliger Verlorenheit. Sie sagt: Da gibt es nichts Weiches. Wenn damit einer gefallen will, sage ich: Er hat nichts verstanden.
Jemand schrieb mal, Franziska Pietsch sei die Anne-Sophie Mutter des Ostens. Ein anderer stellte dann fest, das sei gewiss gut gemeint, treffe aber schon deshalb nicht zu, weil Franziska Pietschs Geigenton nicht nur rund und schön sei.
Wer sie Beethoven spielen hört, den kann sie erst einmal durchaus einlullen. Aber dann fährt es einem kalt in die Glieder. Sie spielt, als gehe es in der Musik um die nackte Existenz.
Franziska Pietsch könnte ihre Geschichte als deutsch-deutsche Geschichte erzählen. Dann würde sie von dem Wunderkind handeln, das die DDR fallen ließ, als der Vater nach einem Konzert im Westen geblieben war.
Aber sie sagt: Es ist keine Opfergeschichte.
Sie könnte auch von den Grenzen des Systems berichten, an denen sie heute steht: als eine Frau um die fünfzig, die entgegen aller Wahrscheinlichkeiten ihrer Branche versucht zu erreichen, was nur wenigen gelingt – als Solistin auf der Bühne zu stehen. Aber auch das wäre nicht die ganze Wahrheit.
In jedem Fall ist es eine verzwirbelte Geschichte, bei der schwer zu sagen ist, welchen Faden man zuerst aufnehmen soll. Den, als sie als Vierjährige erfuhr, dass ihr Vater gar nicht ihr echter Vater war, sondern ein gewisser Horst, der dann mit einem Baby namens Susanna zu Franziska und ihrer Mutter in die Wohnung zog? Oder vielleicht den, als sich an einem vernieselten Herbstvormittag 1984 in Ost-Berlin ihre Zukunft auflöste. Sie saß in ihrer Klasse, 14 Jahre alt, sie hatten Bio oder Chemie, als ihr Lehrer an der »Spezialschule für Musik« in der Rheinsberger Straße in Berlin-Mitte sie aufforderte, aufzustehen, und sie aus dem Klassenzimmer führte. Zwei Treppen runter, quer über den Hof. Vor dem Schultor übergab der Lehrer Franziska zwei Stasi-Mitarbeitern, die mit dem Auto gekommen waren. Stumm setzte sie sich auf den Rücksitz. Stumm fuhren sie zum Verhör.
So erzählt es Franziska Pietsch, als sie über dreißig Jahre später an der Pförtnerin ihrer ehemaligen Schule vorbeischreitet, tack, tack, tack, auf hohen Absätzen, das Haar weht hinter ihr her, das Kinn reckt sie vor, bis sie auf dem Hof stehen bleibt, die Fußspitzen nach außen gedreht, die Knie durchgedrückt, gerade wie eine Ballerina. Sie schaut hinauf zu den rundgebogenen Fenstern der Aula.
Sie legt die Hände hinter die Ohren. Sie sagt: Ich höre das noch heute.
Da waren die Stimmen der Jungs aus den beiden zehnten Klassen, 1981 im Spätsommer. Die Jungs lehnten sich aus den Fenstern im zweiten Stock, als sie zum ersten Mal zum regulären Unterricht erschien. Sie raunten, da kommt es, unser Geigenmädchen. Ganz genau erinnert sie sich nicht an den Ausdruck, aber sie spürte damals: In den Augen der anderen war sie eine Sehenswürdigkeit. Die kleine Pietsch. Tochter des Konzertmeisters Horst Pietsch und der Geigerin Karin Pietsch. Schülerin von Geigenprofessor Scholz, Werner Scholz, der Koryphäe.
Franziska war zwölf, als sie zum ersten Mal als reguläre Schülerin »die Spezi« betrat, das Haar damals wie heute lang bis zur Taille, ein fein geschnittenes Gesicht, der Mund groß, die Augen himmelblau. »Spezi«, so nannten sie die Schule, heute ist in dem Backsteingebäude das Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach untergebracht. Wer auf diese Schule geht, hat seine Entscheidung schon getroffen. Sie oder er will Musikerin, Musiker werden, so war es früher, so ist es heute. Sonst nichts.
Franziska Pietsch war da schon wer. Sie hatte in der Komischen Oper auf der Bühne gestanden und das a-Moll-Konzert von Vivaldi gespielt, es war ein Triumph gewesen. Sie hatte den Bach-Wettbewerb in Leipzig gewonnen. In der Musikerwelt machte sie das zu einer Berühmtheit. Die Exzellenzen, die Talente suchten und sie gezielt förderten, hatten oft ein gutes Gespür bewiesen. Sie meinten: Die kleine Pietsch, die ist Solistin. Die machen wir groß. Von der wird Glanz auf die DDR zurückstrahlen.
Die Kindheit von Franziska Pietsch ist wie die vieler begabter Musikerkinder: wenig Freispiel, viel üben, Erwartungen erfüllen. Die Anspannung vor den Vorspielen, vor der Klasse, der ganzen Schule, einer Jury. Sie kennt es nur so.
Sie sagt: Ich bin Kind von zwei Geigern.
Ihre erste Geigenlehrerin war Heide-Maria Milatz. Franziska Pietsch spricht von ihr als einer warmherzigen, fröhlichen Frau, bei der es anders zuging als bei ihr zuhause. Irgendwie freier. Heide-Maria Milatz unterrichtete sie, bis Franziska sieben war. 1985 verließ Milatz die DDR, da war Franziska sechzehn und Franziskas Vater schon weg. Bis zu ihrer Pensionierung spielte Heide-Maria Milatz bei den Duisburger Philharmonikern. Am Telefon schwärmt sie heute noch von Franziskas »großem, warmem Ton«, der musikalischen Fantasie des Mädchens und dessen Fleiß. Sie spricht auch davon, wie man Franziska »auf Solistin gedrillt« habe. Im autoritären Staat und später in der BRD.
Franziska Pietsch spielte Geige, bevor sie lesen konnte. Ihre Eltern hatten sie in ein Konzert mitgenommen, als sie noch ein kleines Kind war. Dort flüsterten sie ihr den Namen des Solisten zu. David Oistrach spielte die Frühlingssonate von Beethoven. Die kleine Franzi hockte inmitten der Musik, das war wie eine Burg. Sie fühlte sich sicher. Was draußen war, blieb draußen. Drinnen gab es nur sie, und es war, als hörte sie ihre eigene Stimme. Danach sagte sie nicht, sie wolle Geige spielen. Sie sagte: »Ich will Solistin werden.« Von da an strich sie stundenlang über die Saiten. Jeden Tag. »Wir zwingen sie nicht«, beteuerte ihre Mutter gegenüber den erstaunten Nachbarn. »Der macht das Spaß.« Vielleicht sind die Eltern auch diejenigen, die treiben, aber wie soll man das eine vom anderen unterscheiden? Die Bilder, die Franziska für die Schule malen sollte, malte die Mutter. Sie schrieb auch ihre Aufsätze. Wenn sie mit ihrer jüngeren Halbschwester Susanna in eine Rangelei geriet, gab Franziska irgendwann nach. Sie rief dann: »Meine Arme! Meine Arme!« Susanna spielt heute Geige im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Sie lacht wie ihre große Schwester, ansteckend und hell, eine dunkelblonde, lebhafte Frau, von der Franziska Pietsch sagt: »Sie ist so ganz anders als ich.« Susanna Pietsch sagt über ihre Schwester: »Sie ist sehr fanatisch mit ihrer Geige.«
Manchmal fiel Franziska Pietsch damals selbst auf, wie die Geige alles dominierte. Wie einmal, als sie über den Schulhof rannte, als hätte man eine Rakete gezündet. Sie jagte ihrer Freundin hinterher, rutschte auf dem Kies aus und stürzte auf die Hand. Die linke Hand, die beim Geigespielen die Saiten drückt, die virtuose Hand. Sie blutete.
Franziska Pietsch zupft sich den Lederhandschuh von den Fingern und zeigt auf die blasse Narbe unter dem Daumenballen.
Sie sagt: Einmal die Geige vergessen, und zack, die Quittung dafür.
Man sieht, wie sie die Kontrolle fahren lassen kann: In einem kurzen Moment zum Beispiel, wenn sie den Kopf in den Nacken wirft und ihr Gesicht aufglänzt wie eine Messerklinge in der Sonne. Sie lacht so, dass man sich umschauen will, ob ein dünnwandiges Glas in der Nähe ist, das springen könnte.
»Wenn du ein Profi werden willst, musst du mit vierzehn technisch fertig sein«, sagt Franziska Pietsch. Das waren auch die Worte ihres Lehrers, Werner Scholz. Als Franziska vierzehn war, konnte sie alles spielen. Die Intonation – perfekt. Die Technik – ausgereift. Die Angst vor dem Auftritt war kleiner als der Genuss des Applauses. Für Musiker ist das eine ganz normale Entwicklung, so beschrieb es Anne-Sophie Mutter in einem Interview: »Menuhin, Rubinstein, Heifetz sind alle in diesem Alter aufgetaucht. Zwischen zwölf und vierzehn offenbart sich eine Seelenreife, die nichts mit der Lebensreife zu tun hat und etwas Gottgegebenes ist.«
Den Rollkies auf dem Schulhof, auf dem sie ausgerutscht war, haben sie weggeschafft. Heute ist der Hof hell und dunkel in Pflastersteine gegliedert. Klaviertöne plätschern aus einem Fenster. Eine Dame mustert uns im Vorbeigehen. Ein adretter Jugendlicher grüßt bleich, dann verschwindet er im Gebäude. Franziska Pietsch schlüpft durch die Holztür und steigt die Treppe hinauf zur Aula der Schule.
»Hat dein Vater mit dir gesprochen?«, fragten die Stasi-Leute beim Verhör, da war ihr Vater bereits seit ein paar Monaten im Westen. Es waren mehrere, aufgereiht hinter einem großen Schreibtisch. Franziska saß ihnen gegenüber. Sie hatte sich vorn an den Rand des Stuhls gesetzt. Sie fragten geschickt, nicht direkt, sie fragten zu unverfänglichen Ereignissen aus den Monaten davor. Vielleicht würde das Mädchen die Konzentration verlieren und sich verplappern. Wenn sie verraten würde, dass sie von den Fluchtplänen gewusst hatte … Franziska musterte ihre Gesichter. Die Lippen, wie sie sich bewegten. Psychologen nennen das Blitzlichterinnerungen, wenn sich Details um ein wichtiges Ereignis herum ins Gedächtnis einbrennen.
Franziska Pietsch war an einem Punkt, an dem sie namhaften Dirigenten hätte vorspielen können. Sie hätte mit ihnen Platten aufnehmen, in Salzburg auftreten können, in London, New York, Wien und Paris. Sie hätte wie der Tenor Peter Schreier und der Trompeter Ludwig Güttler einer der wenigen internationalen Musikstars der DDR werden können. Es hätte im Osten für Franziska Pietsch losgehen können wie wenige Jahre zuvor für Anne-Sophie Mutter im Westen.
Sie sagt: Mein Gefühl war, mein Leben war hier zu Ende.
Sie denkt an ihren Vater, wie er sich an einem Maiabend zu ihr ans Bett setzte. Sie müsse jetzt stark sein, sagte er.
Es war ein Abend kurz nach ihrer Jugendweihe. Sie war mit ihrer Schwester und der Mutter von einem Ausflug nach Budapest zurückgekommen, müde von der Fahrt. Franziska hatte sich die Haare gebürstet, die Zähne geputzt, den Schlafanzug angezogen. Sie hatte sich in ihr Bett gelegt und sich zugedeckt.
Am nächsten Morgen werde er fahren, sagte der Vater, er saß auf ihrer Bettkante. Es sei eine Konzertreise mit seinem Streichquartett in den Westen, wie schon oft. Diesmal werde er nicht zurückkehren, sagte der Vater. Sie würden dann den Ausreiseantrag stellen – den »Antrag auf Familienzusammenführung« – und nachkommen.
Sie fragte nicht: Wann sehen wir uns wieder, was wird aus uns? Sie hielt ihn nicht am Arm fest und verlangte: Bleib hier! Franziska nickte und löschte das Licht. Am nächsten Morgen rollte der Vater mit dem grünen Lada 1600 aus der Ausfahrt.
Sie sagt: Ich wusste, der kommt nicht wieder.
Es war, als hätte er etwas von ihr mitgenommen. Sie kommt nicht darauf, was das war.
Hätte Franziska sich vor den Stasi-Leuten verplappert, hätten sie vielleicht ihre Mutter verhaftet. Hätte sie etwas gesagt, hätten sie alle als republikflüchtig gegolten. Vielleicht hätten sie ihre Schwester und sie ins Heim gesteckt. Aber Franziska Pietsch verplapperte sich nicht. Sie war ja ein Bühnenkind. Ein Bühnenkind weiß, wie man Angst versteckt.
Sie sagt: So viel Kraft hatte ich damals schon.
Franziska Pietsch hat sich später oft gefragt, warum es ausgerechnet zu jenem Zeitpunkt sein musste. Das Leben war okay. Der Vater konnte reisen. Von den Honoraren der Auftritte im Westen musste er den Großteil der Republik überlassen. Das ging schon, aber das musste im Westen keiner machen. Bei denen standen auch nicht diese Hunde hinter der Grenze, bei deren Anblick man sich schon gebissen fühlte und sich fragte: Habe ich mir etwas vorzuwerfen? Aber Franziska Pietsch hat ihn nie gefragt, warum er gegangen ist. Sie hat ihm auch nicht erzählt, wie es für sie war. Sie haben bis heute kaum über die Zeit im Osten gesprochen. Ihre Eltern leben heute zusammen in Hannover.
Sie sagt: Meine Eltern sind Menschen, die nach vorne schauen.