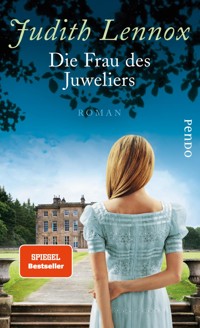9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bestsellerautorin Judith Lennox erzählt von drei jungen Mädchen im England der Swinging Sixties und Seventies. Sie wollen für immer zusammenhalten. Doch als die schwangere Rachel ein schreckliches Geheimnis entdeckt und ihre beiden Freundinnen am dringendsten braucht, kommen Liv und Katherine zu spät … Eine mitreißende Geschichte um Liebe und Schuld, Vertrauen und lebenslange Freundschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Danielle,in Erinnerung an jene Zeit
Übersetzung aus dem Englischen von Mechtild Sandberg
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe16. Auflage 2010
ISBN 978-3-492-95342-9
© Judith Lennox 2000
Titel der englischen Originalausgabe:
»The Dark-Eyed Girls«, Macmillan, London 2000
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 2002
Umschlagkonzept: semper smile, München
Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München
Umschlagabbildung: plainpicture, Arcangel
Teil I
Ferne Ufer
1960–1969
1
LIV SUCHTE IN den Kieseln nach farbigen Glasstücken. Als sie klein gewesen war, hatte sie geglaubt, es wären Edelsteine: Smaragde, Saphire, Diamanten und – eine Rarität – Rubine. Ihr Vater, Fin, hatte ihr erklärt, daß es vom Meer geschliffene Glasscherben waren. Liv stellte sich vor, die Wellen höben die Scherben zerbrochener Flaschen und eingeschlagener Fensterscheiben auf und das Meer riebe sie mit einem Tuch, bis sie im weichen Schimmer der Perlen glänzten, die Thea um den Hals trug.
Vor ihr schritten Fin und Thea den Strand entlang. Die Kiesel knirschten unter ihren Füßen, sie hielten die Köpfe gesenkt. Fins Mantel bauschte sich hinter ihm zu einem flatternden dunklen Cape, und Theas Seidenschal kräuselte sich wie ein blasses Banner im Wind. Die Schreie der kreisenden Möwen waren ein Echo des zornigen Auf und Ab ihrer Stimmen. Beide hatten sie die Hände tief in die Manteltaschen geschoben, und im Gehen begannen ihre Wege sich zu trennen. Fins nahm die Richtung zum Meer, Theas wandte sich kaum wahrnehmbar landwärts. Liv beachtete weder ihre Eltern noch die Wellen, sondern hielt den Blick fest auf den schmalen Kieselstreifen gerichtet und suchte nach Rubinen und Diamanten.
Ein Jahr später reisten sie von der Küste ins Innere des Landes. Auf der Fahrt regnete es ununterbrochen. Wie Tränenströme, dachte Thea, die in Gedanken versunken zusah, wie die Wassertropfen an den Fensterscheiben des Busses herabglitten. Sie warf einen Blick auf ihre Tochter, die neben ihr saß. »Jetzt sind wir bald da«, sagte sie ermutigend und lächelte.
Liv lächelte nicht. Und sie sagte auch nichts. In den acht Monaten, seit ihr Vater sie und ihre Mutter verlassen hatte, war sie mit Worten immer sparsamer geworden, und der Blick ihrer dunkelbraunen Augen hatte sich zusehends verschlossen. Noch einmal versuchte Thea sie aufzumuntern. »Wir brauchen nicht zu bleiben, wenn es dir nicht gefällt, Schatz.« Wo sie allerdings hingehen sollten, wenn es in Fernhill nicht klappte, das wußte sie selbst nicht.
Der Regen hatte nicht nachgelassen, als sie ihren Bestimmungsort erreichten. Es tropfte von den Kastanien, und die zarten Blütenblätter des Mohns am Straßenrand hingen müde und regenschwer herab. Die Räder des Busses wirbelten braunes Wasser auf, als er abfuhr und Mutter und Tochter allein an der Straße zurückließ. Thea rief sich Dianas Anweisungen ins Gedächtnis. »An der Bushaltestelle hältst du dich rechts, weg vom Dorf. Wir wohnen gleich hinter dem Hügel.«
Thea ging mit gesenktem Kopf. Die Beine waren ihr schwer. Die hektische Energie, die sie dieses grauenvolle vergangene Jahr hindurch aufrechterhalten hatte, schien sie verlassen zu haben. Sie versuchte, sich zu erinnern, wann sie Diana das letzte Mal gesehen hatte. Bei Rachels Taufe natürlich. Aber das war zehn Jahre her. Sie mußten sich dazwischen noch einmal gesehen haben. Mit nassen Fingern rieb sie sich die nasse Stirn.
Auf der Höhe des Hügels blieb sie stehen und blickte, ein wenig außer Atem, auf die Collage aus Feldern, Bächen und Buckeln hinunter, die Landschaft, die das Gebiet an der Grenze zwischen Cambridgeshire und Herfordshire kennzeichnete. Parallel zur Straße erhob sich eine Mauer mit einem prächtigen schmiedeeisernen Tor. Thea las die Inschrift darauf, Fernhill Grange, und sah dahinter das große rote Backsteinhaus, das inmitten eines gepflegten Parks stand. »Du meine Güte«, sagte sie verblüfft und hatte einen Moment lang Mühe, sich die praktische, gutmütige Diana ihrer Erinnerung als Herrin eines so imposanten Landsitzes vorzustellen. Aber Diana stammte ja selbst aus guter Familie, sagte sie sich, als sie das Tor aufstieß, und hatte eine gute Partie gemacht. Henry Wyborne saß mittlerweile als Abgeordneter im englischen Parlament. Außerdem war Diana immer schon ein Glückspilz gewesen.
Sie stapften durch den Regen die Auffahrt hinauf. An der Haustür blieb Thea stehen und sah zu ihrer Tochter hinunter. »Ich hatte keine Ahnung, daß es so nobel sein würde«, sagte sie. Behutsam schob sie Liv das nasse dunkle Haar aus den Augen.
Bei Tee und Gebäck erinnerte Diana sie: »Du warst dreiundfünfzig das letzte Mal bei einem unserer Treffen, Thea. Seither haben wir uns nicht mehr gesehen.«
»Vor sieben Jahren? So lang ist das her?«
»Du hättest letztes Jahr kommen sollen.« Diana lachte. »Es war unheimlich nett. Bunty Naylor war da – du erinnerst dich doch an Bunty, sie war immer schon zum Kaputtlachen. Weißt du noch, damals, als …«
Diana schwelgte in Erinnerungen. Thea hörte nur mit halbem Ohr zu, während ihr Blick durch das große gemütliche Zimmer schweifte. Die beiden kleinen Mädchen hockten auf der Fensterbank. Rachel erzählte; Liv hörte zu und schwieg, wie meistens in letzter Zeit. Rachel war nur wenige Monate älter als Liv. Thea erinnerte sich an die Taufe: Rachel, das vollkommene Kind, das mit dunklen Augen gelassen unter einem Geriesel kostbarer alter Spitze hervorsah. Auch jetzt noch, zehn Jahre später, war Rachel vollkommen, ein schönes kleines Mädchen – anders konnte man es nicht sagen – mit dickem kastanienbraunem Haar und klaren braunen Augen, das Wohlbefinden und Selbstvertrauen ausstrahlte. Theas Blick wanderte von Rachel in ihrem frischen Baumwollkleidchen zu Liv in der braunen Strickjacke mit den geflickten Ellbogen. Die Augen ihrer Tochter unter den allzulangen Stirnfransen wirkten unglücklich und gehetzt. Thea mußte eine plötzliche Aufwallung von Bitterkeit und Liebe unterdrücken.
»Thea?«
Sie fuhr schuldbewußt zusammen. Diana sah sie neugierig an. Sie versuchte, sich zusammenzunehmen. »Entschuldige, Diana. Es ist nur – es scheint alles so weit weg.« Sie krampfte ihre kräftigen hellen Hände ineinander. »Der Krieg, meine ich. Der Erste-Hilfe-Dienst. Diese scheußliche Kaserne, wo wir stationiert waren.«
Eigentlich wollte sie sagen, ich bin nicht mehr das junge Ding von damals. Ich kann mich kaum noch an dieses Mädchen erinnern.
Diana sagte teilnahmsvoll: »Natürlich. Du hast ein schlimmes Jahr hinter dir. Hör einfach nicht hin, Darling, du weißt doch, ich plappere immer ins Blaue hinein.« Den Blick auf die beiden kleinen Mädchen gerichtet, hielt sie inne und sagte leise: »Unsere Mädchen mit den dunklen Augen, Thea.«
Thea biß sich auf die Lippen und preßte die Fingernägel in ihre Handballen. Sie hörte Diana sagen: »Rachel, willst du nicht Olivia dein Zimmer zeigen?« und hielt gerade noch so lange durch, bis die Tür sich hinter den beiden Mädchen schloß, ehe sie zu weinen anfing.
Als sie einmal angefangen hatte, konnte sie nicht mehr aufhören, bis Diana ihr schließlich sanft ein Glas in die Hand drückte und sagte: »Komm, das hilft meiner Erfahrung nach besser als Tee.« Thea trank, von den Nachwehen ihres Ausbruchs geschüttelt, einen großen Schluck Whisky und lehnte sich mit geschlossenen Augen in ihrem Sessel zurück.
Nach einer langen Weile machte sie die Augen wieder auf und sagte leise: »Entschuldige.«
»Hör auf, Thea. Warum sollst du nicht heulen?«
»Es ist doch eine ziemliche Zumutung …«
»So ein Quatsch. Dafür sind Freundinnen da.«
Thea hatte vergessen, was für eine warmherzige Person Diana war. Ein bißchen wichtigtuerisch manchmal und albern, aber immer voller Güte.
»Du hast wohl nichts gehört …?«
Thea schüttelte den Kopf. »Es sind jetzt acht Monate. Er hatte mir einen Zettel auf den Küchentisch gelegt. Es tut mir leid. Du bist ohne mich besser dran. Ich werde Dich nicht mit langen Erklärungen oder Bitten um Verzeihung belästigen, die höchstens eine Beleidigung wären. In Liebe, Fin. Er kommt nicht zurück«, erklärte sie mit Entschiedenheit. »Meine Ehe ist vorbei. Der Umzug hierher – das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Ein klarer Schlußstrich.« Sie holte einmal tief Atem. »Kann ich das Häuschen wirklich haben, Diana?«
»Aber ja. Es ist nur furchtbar klein.« Dianas Miene drückte Zweifel aus. »Aber eigentlich ganz idyllisch. Es hat ein Wohnzimmer, eine Küche und zwei Schlafzimmer. Es müßte eigentlich gerade das Richtige sein für …« Sie sprach nicht weiter.
»… für uns beide«, vollendete Thea für die Freundin. Früher einmal waren sie zu dritt gewesen, jetzt waren sie nur noch zu zweit. Sie hatte sich beinahe schon daran gewöhnt. »Hat das Haus auch ein Bad?«
Diana schnitt eine Grimasse. »Es gibt eine Toilette, aber sie ist draußen im Freien, eine ziemliche Zumutung. Die Seagroves haben sich in der Küche gewaschen und in einer Blechwanne gebadet.«
Mrs. Seagrove, die frühere Bewohnerin des Häuschens, war Dianas Haushaltshilfe gewesen. Sie war vor kurzem zu ihrer Tochter nach Derby übersiedelt.
»Die Miete …« Thea schluckte ihren Stolz hinunter. Das opulente Wohnzimmer der Wybornes sprach von Geld und Wohlstand.
»Sehr preiswert, soviel ich weiß.«
Thea atmete erleichtert auf.
Dann fügte Diana etwas zaghaft hinzu: »Es wäre vielleicht einfacher, Thea, wenn …«
»Ja?«
»Es würde dir das Leben hier vielleicht erleichtern, wenn du die Leute in dem Glauben läßt, du wärst Witwe. Fernhill ist ein kleines Dorf und in vieler Hinsicht ziemlich altmodisch. Und das Häuschen gehört der Kirche, weißt du. Der Pfarrer ist ein sehr guter Freund von uns, und …« Dianas Stimme verklang.
Thea wußte nicht, ob der plötzlich aufflammende Zorn gegen Diana gerichtet war oder gegen Fin. Sie sagte kalt: »Keine Sorge, Diana, ich werde dich nicht in Verlegenheit bringen.«
»Aber so habe ich das doch nicht gemeint …« Dianas Gesicht glühte.
Thea schämte sich plötzlich. »Bitte entschuldige. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Wo du dich so bemühst! Außerdem hast du ganz recht.«
Diana sah auf ihre Uhr. »Wir können uns das Häuschen jetzt ansehen, wenn du Lust hast. Mrs. Nelson paßt solange auf die Kinder auf. Wir nehmen den Wagen – du hättest dich von mir am Bahnhof abholen lassen sollen Thea, anstatt durch den strömenden Regen zu patschen …«
»Und das ist meine Puppensammlung.« Rachel öffnete den nächsten Schrank. »Daddy bringt mir von jeder Auslandsreise eine Puppe mit, weißt du.«
Liv betrachtete die Puppen: Die kleine Holländerin, die Italienerin, die Japanerin in ihrem pinkfarbenen Kimono.
»Das ist meine Neueste«, sagte Rachel und hielt Liv eine Puppe in bretonischer Tracht hin. Liv berührte sie vorsichtig, um sie nicht in ihrer starren Vollkommenheit zu stören.
»Wir könnten Mensch ärgere dich nicht spielen«, schlug Rachel vor. In ihrer Stimme lag ein Unterton der Verzweiflung, den Liv hörte und verstand. Sie wußte, daß sie langweilig war; sie hatte kaum ein Wort gesprochen, seit Rachel sie nach oben geführt hatte, um ihr die Spielsachen, Bücher und Kleider in ihrem geräumigen Zimmer zu zeigen. Sie wußte, daß sie versuchen sollte, mit Rachel Freundschaft zu schließen. Ihre Mutter würde das von ihr erwarten, wenn sie in Zukunft in Fernhill lebten. Aber die rosa-weiße Pracht des Zimmers und Rachels selbstsichere Liebenswürdigkeit schüchterten sie ein und vertieften das Gefühl, das sie ständig begleitete, seit ihr Vater fortgegangen war: daß alles Vertraute ihr entrissen war und es nichts gab, worauf sie sich verlassen konnte.
»Oder wollen wir in den Garten gehen?« Rachel schaute zum Fenster hinaus. »Es regnet fast gar nicht mehr.«
Liv nickte. Sie gingen ins Freie hinaus. Sie stapften durch nasses Gras und knieten am Teich voll Seerosen und dicker Goldfische nieder. Sie spielten auf der Schaukel und rannten durch die langen Reihen üppiger Rosenbüsche. Rote Tulpen blühten selbstherrlich in großen Beeten; von den Magnolien fielen Blütenblätter wie Porzellan ins kurz gemähte Gras. Liv fühlte sich an die Grünanlagen an der Strandpromenade von Great Yarmouth erinnert.
Rachel zeigte Liv ihr Pony. »Reitest du?« fragte sie.
Liv schüttelte den Kopf.
»Ich reite wahnsinnig gern«, erklärte Rachel. »Aber ich hasse Turniere.«
»Wegen der vielen Menschen?«
»Menschen?«
»Wie wenn man in eine neue Schule kommt. Wenn man das erste Mal in die Klasse kommt und keinen kennt … da starren einen doch alle an.« Mit den Worten sprudelten Livs lang aufgestaute Ängste heraus.
»Ich werde deine Freundin sein«, sagte Rachel gutmütig. »Und Katherine auch.«
»Wer ist Katherine?«
»Meine beste Freundin. Wie heißt deine beste Freundin?«
»Ich hab gar keine.« Liv, die fürchtete, das könnte bemitleidenswert klingen, erklärte hastig: »Ich war an ganz vielen verschiedenen Schulen. Und manchmal bin ich gar nicht zur Schule gegangen – manchmal hat mein Dad mich zu Hause unterrichtet.«
Rachel riß die Augen auf. »Hast du’s gut! Du mußtest nicht zur Schule gehen?«
»Nein. Aber jetzt muß ich sicher gehen.«
»Weil dein Daddy fort ist?«
Liv nickte unglücklich.
»Vielleicht kommt er wieder zurück.«
»Wie soll er zurückkommen, wenn wir jetzt hier wohnen?« fragte sie logisch. »Er weiß ja gar nicht, wohin.«
Rachel runzelte die Stirn. »Wir könnten hexen.«
Liv starrte sie an. »Hexen?«
»Ja, wir könnten machen, daß er zurückkommt.«
»Richtig hexen?«
»Ja, Katherine weiß, wie’s geht. Sie hat ein Buch darüber. Einmal haben wir Miss Emblatt krank gehext, damit Katherine keinen Ärger mit ihrer Handarbeit bekam, und sie hat sich tatsächlich den Knöchel verstaucht. Und als Katherine ein neues Fahrrad haben wollte, haben wir auch wieder gehext …«
»Hat sie eines bekommen?«
»Nein. Wir müssen es noch mal versuchen. Mein Daddy sagt, wenn man was nicht gleich schafft, darf man nicht lockerlassen, sondern muß es immer wieder versuchen.« Rachel kicherte. »Aber meistens hab ich dazu überhaupt keine Lust. Zum Beispiel bei den Reitturnieren.« Sie strich ihrem Pony über die Mähne. »Ich gewinne nie, aber ich probier’s auch nicht noch mal. Pokale und Rosetten und das ganze Zeug … ich verstehe nicht, was das alles soll. Du?«
»Es zeigt wahrscheinlich, daß man irgendwas besser kann als die anderen«, meinte Liv.
»Das sagt Daddy auch, ja. Aber mich interessiert das nicht, verstehst du. Es ist mir egal, ob ich was am besten kann oder nicht.« Rachel schien völlig gelassen. »Daddy sagt immer, es geht nicht ums Gewinnen, sondern nur ums Dabeisein. Und dann lacht er und sagt: ›Aber das Wichtigste ist natürlich der Sieg, Darling.‹«
Nun war endlich die Sonne herausgekommen. Regennasse Wiesen und Felder und ferne Hausdächer glänzten. Liv drehte sich, die Augen gegen das Licht abgeschirmt, einmal langsam im Kreis.
»Was suchst du?«
»Das Meer.« Liv kniff die Augen zusammen. »Ich habe gedacht, ich könnte das Meer sehen.«
»Das ist sehr weit weg von hier. Daddy ist im Sommer mal mit uns hingefahren, und die Fahrt hat stundenlang gedauert. Aber wenn du so machst –« Rachel streckte beide Arme zur Seite aus – »dann kannst du es vielleicht sehen, weil dann nämlich alles anfängt zu schwanken.«
Rachel begann sich zu drehen. Liv sah ihr einen Moment zu, dann begann sie ebenfalls, sich mit ausgebreiteten Armen zu drehen, langsam zunächst, dann immer schneller. Im wirbelnden Kaleidoskop von Farben, zu dem Wiesen, Bäume und Haus verschmolzen, meinte sie, weit, weit weg ein schmales Band silbernen Meeres zu erkennen.
Wie Kreisel, die den Schwung verlieren, gerieten sie nach einer Weile beide aus dem Gleichgewicht und fielen atemlos vor Schwindel und Gelächter zu Boden.
»Was meinst du?« hatte Diana gefragt. »Findest du es sehr gräßlich?«, und Thea hatte aufrichtig antworten können, sie finde es überhaupt nicht gräßlich. Es sei klein, gewiß, aber das störe sie nicht, da würde man wenigstens nicht Unsummen für die Heizung ausgeben müssen, und sie und Liv würden sich nicht verloren vorkommen.
Jetzt endlich allein – Diana war nach Fernhill Grange zurückgefahren, um die Mädchen zu holen –, ging Thea still durch das Haus, besichtigte ein Zimmer nach dem anderen, und stellte sich vor, es gehörte ihr. Draußen im Garten stand – sauber geschrubbt, die Holzwände fast ganz mit ausgeschnittenen Bildern von Küstenlandschaften bedeckt – die Toilette neben dem Kohleverschlag. Der Brunnen in der Mitte der kleinen Rasenfläche belohnte Theas Anstrengungen mit einem dünnen Strom eiskalten Wassers. Der Garten war lang und schmal und besaß mit seinen verschlungenen Wegen und verwilderten Büschen einen unerwarteten Zauber. Thea streifte zwischen rankenden Hundsrosen und früh blühendem Jelängerjelieber hindurch. Sie schloß die Augen und sog den Duft ein. Über ihrem Kopf trafen sich die ausladenden Äste hoher Bäume und umhüllten sie mit dunkelgrünen Schatten, in denen die ersten Glockenblumen und Bärlauchstengel durch die Erde emporstießen. Am Ende des Gartens floß ein kleiner Bach zwischen steilen Ufern. Jenseits weitete sich der Blick auf flaches Land.
Erschöpft von der Reise und den Tränen am Nachmittag setzte Thea sich auf dem Stamm eines umgestürzten Baums nieder und genoß die Stille und den Frieden, die sie umgaben. Der quälende Zorn, der seit Fins Verschwinden keinen Moment nachgelassen hatte, begann sich langsam zu legen. Sie dachte, ich werde ihn mir nur noch einmal ins Gedächtnis rufen und ihn dann vergessen. Sie dachte an den Tag, an dem sie einander zum erstenmal begegnet waren. Es war während der Luftangriffe auf London gewesen, sie hatte sich gerade zum Krankendienst gemeldet – einundzwanzig Jahre alt, zum erstenmal von zu Hause fort – und befand sich auf der Fahrt zum Standort ihrer Einheit. Der Zug war überfüllt; sie stand eingezwängt irgendwo mitten im Waggon, vor den Augen Uniformknöpfe, die Nase in feuchtem Uniformstoff, der wie nasses Hundefell roch, so erregt und geängstigt bei dem Gedanken an ihr neues Leben, daß ihr flau zu werden begann. Und genau in dem Moment, als die Blamage unvermeidlich schien, schwang plötzlich ein Paar kräftiger Hände sie in die Höhe, eine Stimme rief: »Platz da!«, und sie landete für den Rest der Bahnfahrt im Gepäcknetz.
Er heiße Finley Fairbrother, sagte er. Ein echter Zungenbrecher, fügte er hinzu. Nennen Sie mich einfach Fin. Er hatte lockiges schwarzes Haar und sehr dunkle Augen und war wie die anderen Männer im Waggon in Uniform. Thea konnte sich noch erinnern, wie das Geflecht des Gepäcknetzes in ihre Beine eingeschnitten hatte. Sie konnte sich noch erinnern, wie der Blick seiner dunklen Augen sie fasziniert hatte.
Fin hatte sie verändert. Er hatte eine exzentrische Ader in der Pfarrerstochter entdeckt und sie herausgekitzelt. Thea fand danach nie wieder in das konventionelle Leben zurück, das sie einmal geführt hatte. Während der Kriegsjahre trafen sie sich ab und zu. Er erzählte ihr von den Gegenden, die er gesehen, von den Dingen, die er unternommen hatte. Seine Geschichten voll Farbe und Abenteuer brachten einen tröstlichen Glanz in das triste Grau der Kriegszeit in England. Thea verlor ihre Unschuld in einem schäbigen Hotelzimmer in Paddington, Fins Liebe die einzige Konstante in einer Welt, die in Trümmer zu gehen schien.
Freunde warnten sie vor ihm. »Natürlich, er ist hinreißend, aber er ist unstet, Darling. Er ist kein Mann, den man heiratet.« Sie hatte ihn trotzdem geheiratet. 1947 war Fin aus dem Fernen Osten zurückgekehrt; die Hochzeit fand im Jahr darauf statt. In den ersten Jahren ihrer Ehe waren sie unablässig auf Reisen, blieben niemals länger als einige Monate an einem Ort. Es war eine herrliche, aufregende Zeit der Ungewißheiten; sie hüteten Schafe in den walisischen Bergen, eröffneten in einem Londoner Souterrain eine Töpferei, unterrichteten an einer Schule in Lincolnshire. Nichts war von Dauer gewesen, aber immer hatten neue Abenteuer und neue Horizonte gewinkt, so daß Thea dieses Leben anfangs nur genossen hatte. Gerade seine Kreativität, rastlose Energie und Unbeschwertheit hatten sie ja zu Fin hingezogen.
Doch mit der Zeit wurde ihr bewußt, daß sie etwas vermißte: ein Zuhause. Das vage Gefühl des Unbehagens verstärkte sich, als sie entdeckte, daß sie schwanger war. Die Vorstellung, ein neugeborenes Kind von einer provisorischen Unterkunft zur nächsten zu schleppen, erschreckte sie. Sie mieteten ein Haus in Oxford. Dort kam Olivia zur Welt. Thea gefiel das häusliche Leben, und sie liebte ihre kleine dunkeläugige Tochter abgöttisch. Sie hoffte, mit der Geburt des Kindes würde Fin zur Ruhe kommen. Aber schon sechs Monate später verschwand er eines Tages. Auf dem Küchentisch hatte er einen Zettel mit den Worten »Bin in ein paar Tagen wieder da« hinterlassen. Er blieb vierzehn Tage weg. Bei seiner Rückkehr bat er sie um Verzeihung, sie zogen um und machten einen neuen Anfang. Im folgenden Jahr verschwand er wieder, einen ganzen Monat diesmal. Er sei auf Reisen gewesen, erklärte er bei seiner Rückkehr. Nur auf Reisen.
Es war zum Muster ihres gemeinsamen Lebens geworden – Trennungen und Wiedersehen, ständig wechselnde Gelegenheitsarbeiten, ständig wechselnde Wohnorte, immer enger hatte sich die Spirale zusammengezogen. Immer weiter hatten sie sich von der Mitte Englands entfernt und sich schließlich an der Küste Suffolks niedergelassen, als sähe Fin im Meer seine Rettung. Die Mauern des rosafarbenen Hauses, das sie mieteten, konnten das Unglück zwischen ihnen nicht eindämmen. Auf grauen Kiesstränden stehend, blickte Fin zum fernen Horizont. Thea spürte seine Hoffnungslosigkeit; in ihr brodelten Zorn und Unverständnis. »Es ist ja nicht so, daß ich dich nicht liebe«, sagte er, und sie schlug schreiend mit den Fäusten auf ihn ein. Es war keine Überraschung, als sie am folgenden Morgen beim Erwachen sah, daß er fort war. Ein Monat verging – noch einer und noch einer. Thea konnte sich jetzt nicht mehr an den genauen Moment erinnern, als sie begriffen hatte, daß er für immer fortbleiben würde.
Zorn und Trotz hatten sie anfangs daran gehindert, den praktischen Schwierigkeiten ihrer Situation ins Gesicht zu sehen. Als dann in ein und derselben Woche ein Brief von der Bank kam und einer von ihrem Vermieter, in dem er ihr mitteilte, daß der Mietvertrag für das Haus Ende des Monats auslaufe, mußte sie handeln.
In den Jahren unsteter Wanderschaft mit Fin hatte Thea den Kontakt zu den meisten ihrer Freunde verloren. Ihre Eltern waren seit zehn Jahren tot. Es gab ein paar mißbilligende Verwandte, die sie seit Jahren nicht gesehen hatte, aber, sagte sie sich, lieber würde sie im Straßengraben schlafen als diese Leute um Hilfe zu bitten. Dann war ihr Diana eingefallen.
Diana, deren Freundschaft ihr geholfen hatte, die anfängliche Zeit beim Erste-Hilfe-Dienst zu überstehen; deren Leben – Krankendienst, Heirat, Geburt einer Tochter – dem ihren so ähnlich war; die sich in Henry Wyborne verliebt hatte, einen der Helden von Dünkirchen. Während des Krieges hatten sie einander ihre Hoffnungen und Ängste anvertraut. Später, in den schwierigen Jahren ihrer Ehe, waren ihr Dianas Briefe mit ihren unaufregenden Geschichten vom häuslichen Alltag oft ein Trost gewesen. Und so hatte sich Thea in ihrer Verzweiflung schließlich an sie gewandt.
Sie erinnerte sich ihres Gesprächs vom Nachmittag. »Ich sollte mich vielleicht gleich einmal bei der Schule erkundigen«, hatte sie gesagt, und Diana hatte mit einer Grimasse erwidert: »An der Dorfschule? Plumpsklos und ein chaotischer Stundenplan. Du mußt Olivia in Cambridge zur Schule schicken, Thea, auf die Lady-Margaret-Klosterschule, zusammen mit Rachel. Ich habe schon mit der Direktorin gesprochen. Sie vergeben Stipendien.«
Der Abschied von der silberglänzenden Ferne der Küste Ost-Anglias, der Entwurzelung und Verpflanzung bedeutete, bestätigte die Auflösung der Familie, die sie einmal gewesen waren. Aber die Lady-Margaret-Privatschule – eine Einrichtung, vermutete Thea, wo Zucht und Ordnung herrschten – würde Liv vielleicht einen Teil der Geborgenheit bieten, die sie so dringend brauchte; würde vielleicht auch ein Gegengewicht bilden zu der Impulsivität und den romantischen Neigungen, die sie von ihrem Vater geerbt zu haben schien.
Eine Woche später zogen sie in das Cottage. Liv machte die Aufnahmeprüfung an der Lady-Margaret-Schule und bestand, und Thea bedankte sich zähneknirschend, als Diana ihr ein Bündel gebrauchter Schuluniformen überreichte. Im Sommer trugen die Schülerinnen rot-weiß gestreifte Kleider und rote Strickjacken, eine Tracht, die der zarten dunklen Liv gut zu Gesicht stand.
Thea nahm eine Arbeit beim Zeitungsladen im Dorf an. Die Tätigkeit war nicht anspruchsvoll und merkwürdig beruhigend; Thea mochte den zuckrigen Geruch der Bonbonmischungen, die sie den Schulkindern in kleinen Tütchen verkaufte, und sie blätterte gern in den Zeitschriften mit den Kochrezepten und Strickanleitungen und den anheimelnden Berichten über die königliche Familie. Durch die Arbeit im Zeitungsladen lernte Thea nach und nach die Dorfbewohner kennen. Einmal in der Woche besuchte sie in der Schule einen Abendkurs, wo sie riesige, farbenprächtige Gefäße mit ausgefallenen Mustern töpferte. Im Dorf glaubte man allgemein, sie wäre Witwe. Und wahrscheinlich, dachte Thea manchmal, war Fin ja wirklich tot. Er war nie besonders vorsichtig gewesen.
Nach drei Monaten in Fernhill lernte Thea Richard Thorneycroft kennen. Mr. Thorneycroft erschien eines Tages im Laden, trat an den Verkaufstisch und reichte Thea ein Sechs-Pence-Stück und einen Zettel mit der Bitte, ihn im Schaufenster auszuhängen. »Für zwei Wochen«, blaffte er kurz und ging. Mrs. Jessop, der der Laden gehörte, sagte: »Der kriegt doch niemanden, und wenn wir das ein Jahr aushängen. Mabel Bryant hat’s versucht und Dot Pearce auch. Sie hat’s nicht länger als eine Woche ausgehalten, obwohl sie eine Engelsgeduld hat.« Sie senkte die Stimme. »Er hat Frau und Kind bei den Bombenangriffen verloren. Schrecklich, aber noch lang keine Entschuldigung für schlechte Manieren, wenn Sie mich fragen.«
Thea las den Zettel. ›Haushälterin gesucht‹, stand darauf. ›Drei Stunden am Tag. Ruhig und fleißig. Keine dummen Gänse.‹
Am Nachmittag suchte sie Mr. Thorneycroft auf. »Mein Name ist Thea Fairbrother«, sagte sie. »Ich möchte mich um die Stellung als Haushälterin bewerben.«
Er musterte sie mit zusammengekniffenen Augen. Er war groß und dünn und hatte einen abgetragenen Tweedanzug an. In der rechten Hand hielt er einen Spazierstock. »Dann kommen Sie mal rein.«
Sie folgte ihm ins Haus. Es war ein altes Haus, Queen Anne, vermutete Thea, einer der schöneren Bauten im Dorf, obwohl die nüchterne Strenge der Einrichtung seiner gelassenen Schönheit nicht gerecht wurde.
»Was hätte ich denn für Aufgaben?«
»Leichte Hausarbeit. Zweimal die Woche kommt eine Frau zum Reinemachen. Einkaufen. Morgens drei Stunden, vier Schillinge die Stunde.«
»Zwei Stunden nachmittags, fünf Schillinge die Stunde. Ich muß mich nach meiner anderen Arbeit und den Unterrichtsstunden meiner Tochter richten, Mr. Thorneycroft.«
Er runzelte die Stirn, sagte aber: »Tja, in der Not kann man wohl nicht wählerisch sein.«
Im ersten Monat ihrer Tätigkeit bei Mr. Thorneycroft wurde Thea jeden Morgen, wenn sie in den Laden kam, von Mrs. Jessop mit dem gleichen Spruch begrüßt: »Na, haben Sie die Arbeit bei dem alten Griesgram schon aufgegeben?« Worauf Thea kopfschüttelnd zu antworten pflegte: »Nein, ich arbeite gern dort.« Es war ihr ernst mit ihren Worten, sie fühlte sich wohl in dem Haus, das sie, still und heiter, an das Pfarrhaus in Dorset erinnerte, in dem sie groß geworden war. Ihr neuer Arbeitgeber hatte keinen härteren Ton, als ihr Vater oder ihr Einheitsführer beim Krankendienst gehabt hatten. Sie respektierte Mr. Thorneycroft; er verfügte über eine Beharrlichkeit, die Fin letztlich gefehlt hatte. Sein rechtes Bein war infolge einer Kriegsverletzung, die er sich bei einer Minenexplosion in Süditalien zugezogen hatte, fünf Zentimeter kürzer als das linke, doch er klagte nie, obwohl er, vermutete Thea, gewiß häufig Schmerzen hatte.
Mr. Thorneycroft schrieb an einem Buch über den Dardanellen-Feldzug. Sein Arbeitszimmer war eine düstere Höhle voller Bücher und Dokumente. Als Thea es das erste Mal saubermachte, stand er die ganze Zeit an der Tür und achtete darauf, daß sie alles wieder an den rechten Platz stellte. Sie griff nach einem gerahmten Bild, um es abzustauben. Es war eine Zeichnung, Kreide und Tusche, von blumengesprenkelten Felsen, die zu einem türkisfarbenen Meer abfielen. »Wo ist das?« fragte sie, eine abwehrende Antwort erwartend.
Aber er antwortete: »In Kreta. Dort war ich vor dem Krieg.«
»Es ist wunderschön.«
Er sagte: »Es war das Paradies«, und ging hinkend davon.
Thea wußte, daß es großenteils Rachel zu verdanken war, wie schnell Liv sich an der Schule eingewöhnte. Rachel hatte die Großherzigkeit geerbt, die Thea auch jetzt noch bei Diana erlebte und die es ihr ermöglichte, Dianas Besserwisserei und ihre gönnerhaft-plumpen Anwandlungen zu ertragen. Aus Rachel hätte leicht das typische verwöhnte Einzelkind werden können, aber dazu war es wunderbarerweise nicht gekommen. Sie absolvierte ihre Ballettstunden, Musikstunden und Reitstunden mit einem sonnigen Mangel an Interesse, der Thea insgeheim erheiterte. Sie hielt sich an der Lady-Margaret-Schule hochzufrieden irgendwo im Mittelfeld ihrer Klasse auf, nicht weil es ihr an Intelligenz fehlte, sondern weil sie keinerlei Ehrgeiz besaß. Thea kam zu dem Schluß, daß es Rachel tatsächlich an nichts fehlte, und fragte sich manchmal, was geschehen würde, wenn Rachel je das Wünschen entdecken sollte.
Rachel teilte alles mit Liv: Bücher, Kleider, Malfarben, Kreiden. Und sie teilte Katherine mit ihr. Katherine Constant war schlank und langgliedrig, leidenschaftlich und klug, mit glattem sandblondem Haar, das den dünnen Zöpfen in eigenwilligen Strähnen entschlüpfte, und braunen Augen mit dem Schmelz von Toffee. Thea wunderte sich über das ungleiche Paar und gelangte schließlich zu der Überzeugung, daß Rachel bei Katherine den Enthusiasmus und die Leidenschaftlichkeit fand, die ihr selbst fehlten. In Katherines dunklem Blick spiegelten sich ein Lebenshunger und eine Ungeduld, die Thea anfangs erschreckten. Bis sie Liv eines Nachmittags ins Dorf begleitete, zu einem Besuch bei Katherines Familie. Sie sah das große, häßliche, unordentliche Haus, in dem Katherines Vater, ein Arzt, seine Praxis hatte, und lernte die erschöpft wirkende Mrs. Constant und Katherines drei Brüder kennen, Michael, den Ältesten, Simon, Katherines Zwillingsbruder, und Philip, den Jüngsten, der nach einer Masernerkrankung mit Komplikationen, die er als Säugling durchgemacht hatte, geistig und körperlich behindert geblieben war. Thea hätte gern zu Katherine gesagt: »Hab Geduld, dann wirst du bekommen, was du willst«, aber sie spürte, daß Geduld eine Eigenschaft war, die Katherine verachtete. Sie hätte Katherine gern öfter einmal in den Arm genommen, um ihr zu geben, was sie offenbar zu Hause nicht bekam. Aber immer wenn sie es tat, spürte sie, wie Katherines magerer Körper in ihrer Umarmung sofort unruhig wurde, als hätte das Mädchen selbst vor diesem flüchtigen Innehalten Angst.
Im Lauf der Monate nahmen Thea und Liv das Häuschen in Besitz. Sie schmückten kahle Wände und leere Konsolen mit Samenschoten und filigranzarten Blattgerippen, die sie auf ihren Spaziergängen fanden, und mit Steinen und Muscheln, die sie in den Jahren am Meer gesammelt hatten. Sie fertigten Vorhänge und Jalousien für die kleinen Fenster und lose Bezüge und Kissen, um die alten Sofas und Stühle aufzuhellen. Die Patchworkvorhänge an den Wohnzimmerfenstern erzählten Thea von Olivias Kindheit: ein Rest von einem Spielhöschen in der einen Ecke, ein Fetzchen von einem geblümten Sommerkleid in einer anderen. Draußen wuchsen Geranien und Lobelien in Theas pinkfarbenen und orangeroten Töpfen; drinnen lagen Berge von Fallobst – Äpfel und Pflaumen – in Schalen und Schüsseln, die mit den Abbildern alter Götter und Göttinnen bemalt waren, Pomona, Diana, Apollo.
Zwei Jahre nach ihrem Einzug in das Häuschen ließ der Hauseigentümer am rückwärtigen Teil ein Badezimmer anbauen. Thea und Liv gaben zur Feier des Abbruchs des alten Außenaborts ein Fest. Sie tranken Cider und Apfelschorle und machten im Garten ein großes Feuer, in dem sie die Holzbretter, den Toilettensitz und die Bilder tropischer Strände verbrannten. Diana und Rachel und die Constant-Zwillinge kamen ebenso zu dem Fest wie Theas Freunde aus dem Töpferkurs und Mrs. Jessop vom Zeitungsladen.
1964 verloren die Konservativen die Wahl. Thea tröstete Diana, obwohl ihr der Machtwechsel gleichgültig war. »Wenigstens hat Henry seinen Sitz behalten.«
»Aber eine sozialistische Regierung – schauderhaft!«
Insgeheim vermutete Thea, daß alles so weitergehen würde wie bisher. Sie stellte sich ans Fenster und sah, die Hände auf den Sims gestützt, in den Garten hinaus, wo die drei Mädchen Arm in Arm im Sonnenschein über den Rasen gingen. Sie hörte schallendes Gelächter. Und sie dachte, eigentlich habe ich meine Sache doch ganz gut gemacht. Ja, Fin, wo auch immer du sein magst, eigentlich habe ich meine Sache ganz gut gemacht. Wir haben ein Zuhause, und ich hab Arbeit. Und Olivia kann wieder lachen.
2
KATHERINE HATTE DIE Anzeige im Lokalblatt entdeckt. ›Statisten für Filmarbeiten am Ort gesucht‹, hieß es da. Sie zeigte Liv und Rachel die Zeitung. »Ein Film! Vielleicht werden wir entdeckt.« Sie fegte alle Einwände beiseite. Liv und Rachel hatten am Mittwoch die letzte Stunde frei; Katherine selbst hatte Latein bei Miss Paul, die man um den Finger wickeln konnte. Es wäre ein Kinderspiel.
Liv spann Phantasien. Sie stellte sich den Regisseur groß und dunkel vor, mit einem ausländischen Akzent vielleicht. Er würde sie unter allen auswählen. »Die ist es«, würde er sagen. »Sie muß meine Muse werden.«
Sie hatten sich verspätet und mußten laufen. Sie zogen ihre roten Mützen und die Schulkrawatten aus und versteckten sie in ihren Taschen. Sie rollten ihre Röcke am Bund auf, um sie kürzer zu machen. Katherine hatte Wimperntusche und Eyeliner mitgebracht und dazu Miner’s Make-up in einem orangebraunen Ton, der Liv an die Tontöpfe ihrer Mutter erinnerte, bevor sie gebrannt wurden. Rachel hatte einen hellrosa Lippenstift und eine Flasche Joy von Patou mit, von dem sie sich im Laufen auf Hals und Handgelenke spritzten. Es war Februar, und die schattigen Stellen auf dem Bürgersteig waren gefroren. Liv, die kurz stehenblieb, um einen besonders lästigen Pickel abzudecken, merkte, daß ihre Finger vor Kälte klamm waren. Sie hatte ihre Zweifel, daß das Make-up helfen würde; wahrscheinlich, fürchtete sie, würde es ihr Gesicht eher fleckig machen – blaugefrorene Nase und blasse Haut bis auf die bräunlichen Schminkeflecken.
Die Schlange vor dem Gemeindesaal, wo die Auswahl stattfand, reichte bis auf die Straße hinaus. Es waren ungefähr zehnmal so viele Frauen wie Männer da, größtenteils junge Mädchen wie sie selbst. Manche kämmten sich noch einmal durch langes, glattes Haar, wie Liv es sich immer wünschte und selbst mit riesigen Mengen von Creme Silk, das sie sich über die dicken dunklen Locken kippte, nicht hinbekam. Die meisten Mädchen trugen normale Kleidung, keine Schuluniformen.
»Ich habe jemanden sagen hören«, flüsterte Katherine, »daß es für ›Krieg und Frieden‹ ist.«
»Da bräuchten sie doch Männer – für die Schlachten.«
»Ich hab Simon gefragt, aber er wollte nicht. Er hat gesagt, das wäre garantiert langweilig.«
Liv fand oft, Simon sei das genaue Gegenteil von Katherine: helle Augen und dunkles Haar und ein Temperament, das eher zur Trägheit neigte. Sie stellte sich vor, wie die beiden einander im Schoß ihrer Mutter von Angesicht zu Angesicht gegenübergelegen hatten, einer das Gegenstück des anderen.
Im folgenden Oktober wollten Katherine und Simon zum Studium nach Oxford gehen. Auch Liv hatte sich entschlossen zu studieren, hauptsächlich allerdings, weil sie nicht wußte, was sie sonst tun sollte. Sie hatte sich aus einem Impuls heraus für Lancaster entschieden; das klang neu und aufregend, rauh und kalt. Sie sah sich schon mit weit ausholendem Schritt über Hochmoore streifen oder durch Schneestürme zu den Vorlesungen stapfen. Sie sehnte sich nach einsamen, rauhen Landschaften und nach etwas – einer Sache, einem Menschen oder einer Kunst –, das sie ganz in seinen Bann schlagen würde. Sie mußte einen Ausweg aus der Langeweile finden, die sie zunehmend plagte. Ihr kleines Zimmer war vollgestopft mit den Produkten ihrer ständig wechselnden Leidenschaften – Gobelinstickerei, Papiermachéskulpturen, Smokarbeit –, die meisten nur halb fertig. Nichts befriedigte sie auf die Dauer.
Rachel sagte: »Hab ich’s euch schon erzählt? Ich geh im September nach Paris. Daddy hat schon alles arrangiert.«
»Du Glückliche«, sagte Katherine neidisch.
»Nur in ein Mädchenpensionat. Wo man lernt, wie man Soufflés macht und Dankesbriefe schreibt.«
Sie schoben sich langsam die kurze Treppe hinauf in den Saal. Rachel sah Liv und Katherine an. »Ihr vergeßt mich doch nicht, oder?«
»Wie kommst du denn auf die Idee?«
Rachels Kaschmirschal flatterte im frischen Wind. »Na ja, wenn ihr dann auf der Universität seid. Lauter neue Leute. Das wird bestimmt wahnsinnig aufregend. Ihr ruft mich doch an, ja? Ich habe Angst, daß ich mich – daß ich mich ausgeschlossen fühle.«
»Wir sind Blutsschwestern«, sagte Liv. »Oder hast du das vergessen?«
»Unsere Hexenzaubersprüche.« Rachel lächelte. »Ja, die hatte ich tatsächlich vergessen.«
Liv erinnerte sich an ihren gemeinsamen Versuch, Fin, ihren Vater, nach Hause zu hexen: Mondlicht, das in den Weiden am Ende des Gartens spielte, und der Geruch des Feuers, das sie angezündet hatten.
Sie gelangten endlich in den Saal. Zwei Männer und eine Frau saßen mit Klemmbrettern in den Händen an einem Pult. Ein anderer Mann legte die Hände um den Mund und bat laut um Ruhe.
»Es haben sich so viele Bewerber gemeldet, daß wir nur noch eine Person für eine bestimmte Szene brauchen.« Er setzte sich in Bewegung und ging langsam durch den Saal, wobei er sich jedes einzelne Gesicht aufmerksam ansah. Katherine starrte ins Leere, und Liv zupfte hastig an ihren Stirnfransen, um den Pickel zu verstecken. Ihr stand beinahe das Herz still. Wenn er mich auswählt, dachte sie, und stellte sich die Fotografien in den Farbbeilagen der Zeitungen vor: Die achtzehnjährige Olivia Fairbrother, der Shootingstar des Jahres 1968 …
Vor Rachel blieb er stehen. »Sie«, sagte er. »Kommen Sie mit.«
Die anderen Mädchen sanken enttäuscht in sich zusammen und drängten langsam aus dem Saal. Liv hörte Katherine murren: »Immer Rachel!«
Draußen setzten sie sich auf die niedrige Mauer, die die Kirche umgab, und Katherine kramte die Überreste einer Rolle Drops aus ihrer Tasche; rote Wollfasern von ihrer Strickjacke hafteten an den Bonbons, aber sie lutschten sie trotzdem.
»Na ja, wir wollten ja nicht unbedingt Schauspielerinnen werden«, sagte Liv tröstend.
»Mir wäre alles recht«, erklärte Katherine heftig. »Alles! Hauptsache ich komm von zu Hause weg. Manchmal krieg ich solche Angst, daß ich am Ende genauso werde wie meine Mutter – eine abgewirtschaftete Hausfrau.« Sie starrte Liv an. »Deine Mutter wird wenigstens dafür bezahlt, daß sie Mr. Thorneycroft versorgt. Meine Mutter tut’s umsonst.«
»Du kannst doch nicht erwarten, dafür bezahlt zu werden, daß du deine eigenen Kinder versorgst! Das tut man doch aus Liebe.«
»Liebe!« sagte Katherine geringschätzig. »Du verliebst dich in irgendeinen Kerl und heiratest in so einem kitschigen weißen Kleid, und dann stehst du mit einem Haufen brüllender Fratzen am Schürzenzipfel den ganzen Tag in der Küche. Nein danke, nicht mit mir.«
»Aber glaubst du nicht«, wandte Liv ein, »daß es anders wäre, wenn es deine Kinder wären und dein Mann? Daß es dir dann gar nichts ausmachen würde?«
Katherine kniff die Augen zusammen. »Meiner Mutter macht es sehr wohl was aus. Sie sagt’s zwar nie, aber ich weiß es. So wie sie möchte ich nie werden. Niemals!« Sie blickte auf, als Rachel aus dem Gemeindesaal kam. »Also, ist es eine Hauptrolle, Rachel? Bist du jetzt der große Star?«
»Ich hab denen gesagt, daß ich nicht kann.«
»Was?«
»Sie drehen Ende März. Aber da fahren wir nach Chamonix. Also kann ich nicht.«
»Aber Rachel …!«
»Es hörte sich sowieso fürchterlich an. Ein Musical, das im mittelalterlichen England spielt.«
Rachel nahm den Weg zur Bushaltestelle, und Katherine folgte ihr mit einem letzten Seufzer der Erbitterung.
Ein paar Wochen später waren Liv und Katherine an einem Samstag abend bei einer Tanzveranstaltung des Jugendklubs in einem der Nachbardörfer verabredet. Der Saal, in dem das Tanzvergnügen stattfand, war riesengroß und zugig, und die Jungen, mit pickeligen Gesichtern und kleinen Zapata-Bärtchen, lümmelten an den Wänden und beobachteten verstohlen die Mädchen, die allein tanzten.
Liv lehnte draußen vor dem Haus an der Mauer und wartete auf die Constant-Zwillinge. Es war nach neun, als sie endlich kamen. »Entschuldige, daß wir so spät dran sind«, sagte Katherine. »Jamie Armstrong hat uns mitgenommen, und er mußte warten, bis sein Vater ihm das Auto gegeben hat.«
Simon sah sich im Saal um. »Nennt man das Tanzen, was diese Trampel da aufführen?«
Katherine zischte: »Wo ist das Klo? Ich mußte nach dem Abendessen abspülen und hatte keine Zeit mehr, mich zu schminken.«
In der engen kleinen Damentoilette spie Katherine in das Kästchen mit der Wimperntusche, starrte dann mit weit aufgerissenen Augen in den mit Fliegendreck gesprenkelten Spiegel und hantierte wie eine Wilde mit dem Bürstchen.
Liv musterte sie. Sie hatte ein Minikleid aus graugrünem Chiffon an.
»Ist das neu?«
»Rachel hat’s mir geliehen. Mary Quant. Ist es nicht toll?«
»Schade, daß sie nicht mitkommen konnte.«
»Rachel? In einem Dorfbums?« Katherines Ton war scharf. »Stell dir doch nur mal vor, was man sich da alles holen kann. Stell dir nur vor, mit was für Leuten man da zusammenkommt!«
»Dafür kann sie doch nichts.«
»Nein, ich weiß. Das sind Mami und Daddy. Aber sie sollte mal rebellieren.«
Liv dachte daran, Katherine zu erklären, daß Rachel ihren Eltern folgte, weil sie sie liebte und ihnen keine Schwierigkeiten bereiten wollte, und daß Rachels Eltern überfürsorglich waren, weil sie ihre Tochter mehr als alles auf der Welt liebten; daß Rachel mit Charme und freundlicher Überredung letztlich doch immer erreichte, was sie wollte. Aber statt dessen sagte sie: »Aber nicht gerade heute abend. Ihre Eltern geben eine Party und wollten, daß Rachel da ist.«
»Deine Haare!« sagte Katherine plötzlich und starrte Liv verblüfft an.
»Ich hab sie mir gefärbt. Eigentlich soll es kastanienbraun sein.«
»Sieht mehr wie rote Bete aus.«
»Ich glaub, ich hab die Lösung zu lange drauf gelassen.« Liv warf einen Blick auf ihr Spiegelbild. »Vielleicht könnte ich es hier über dem Waschbecken ausspülen.«
»Du spinnst wohl!« Katherine legte hellen Lippenstift auf. Ihre schwarz umrandeten braunen Augen sprangen aus einem weißen Gesicht hervor. »Es ist sowieso stockdunkel da drüben. Da fällt das überhaupt nicht auf.«
Sie gingen wieder in den Saal hinüber. Katherine glitt in Jamies Arme. Simon Constant bot Liv die Hand. »Liv?«
»Ja?«
»Mach nicht so ein erstauntes Gesicht. Ich will dich nur zum Tanzen auffordern.« Als er sie im Arm hielt, blickte er zu ihr hinunter. »Das kommt alles bloß von dieser Klosterschule. Das ist doch völlig unnatürlich, Mädchen eingesperrt zu halten. Dabei toben die Hormone. Sogar Kitty ist noch Jungfrau, obwohl sie das bestimmt halb zu Tode ärgert.« Er lachte. »Du wirst ja rot, Liv.«
»Es ist so heiß hier.«
»Ist es dir peinlich, über Sex zu reden?«
»Ach wo.« Wichtig war, daß er nicht merkte, wie ahnungslos sie war. In der Theorie wußte sie natürlich über die Sexualität Bescheid, Thea hatte es ihr alles schon vor langem erklärt, aber wie das Ganze ablief, was es für ein Gefühl war und warum alle so ein Buhei darum machten, war ihr schleierhaft. Sie war noch nie von einem Jungen geküßt worden. Die Jungen, die versuchten, sie zu küssen, waren nicht so, daß sie von ihnen geküßt werden wollte. Liv wünschte sich ihren ersten Kuß atemberaubend und ekstatisch, als ein Ereignis, an das sie sich ihr Leben lang erinnern würde.
Als die Musik endete und es wieder hell wurde, ließ Simon sie nicht aus den Armen, sondern hielt sie fest und starrte sie unverwandt an. »Hey, was ist mit deinen Haaren passiert?« sagte er schließlich.
Brennend rot vor Scham trat sie von ihm weg.
Katherine sagte: »Wie rote Bete, stimmt’s, Simon?«
»Magenta. Ziemlich prächtig.« Simon lachte. Er sah auf seine Uhr. »Hauen wir ab. Kommst du mit, Liv?«
»Wohin wollt ihr?«
»Nach Cambridge. Bevor die Pubs zumachen.«
»Ich kann nicht.«
»Nur für eine Stunde.«
»Nein, ich hab meiner Mutter versprochen, daß ich den letzten Bus nehme.« Sie sah zur Uhr hinauf.
»Ach komm, sei kein Spielverderber, Liv.«
»Wenn sie sagt, daß sie nicht kann, dann kann sie nicht, Simon«, fuhr Katherine ihren Bruder an.
Mit quietschenden Reifen und immer noch miteinander zankend, brausten sie ab, daß der Kies aufspritzte. Liv holte ihre Strickjacke und ihre Tasche und rannte die Straße hinunter. Als sie um die Ecke bog, sah sie den Bus gerade noch wegfahren. Sie schrie und winkte, aber er hielt nicht an. Sie lief zur Haltestelle und sah sich den Fahrplan an. Es war für heute der letzte Bus gewesen. Der nächste fuhr erst am Sonntag morgen.
Nachdem die erste kopflose Panik sich gelegt hatte, begann sie zu marschieren. Bis Fernhill waren es sechs Kilometer. Wenn sie Tempo machte, sagte sie sich, konnte sie vielleicht in einer guten Stunde zu Hause sein. Mit dem Dorf ließ sie die Straßenlampen und die Lichter der Häuser hinter sich zurück. Sie suchte in ihrer Tasche nach der Taschenlampe, die sie auf Theas Geheiß stets bei sich trug. Der kleine wässrige Lichtkreis huschte schwankend auf der Straße vor ihr her. Es hatte leicht zu regnen begonnen. Sie hoffte, der Regen würde ihr wenigstens die scheußliche Farbe aus den Haaren spülen, und versuchte, nicht an Thea zu denken, die sich immer schlafend stellte, wenn ihre Tochter nach Hause kam, aber in Wirklichkeit, das wußte Liv, stets wach blieb, bis sie da war. Sie wünschte zum hundertstenmal, sie hätten ein Telefon zu Hause, obwohl sie sich Theas Entsetzen vorstellen konnte, wenn sie ihr die Situation erklärte. Du gehst zu Fuß nach Hause? Ganz allein? Durch die Dunkelheit?
Sie sang laut vor sich hin, um sich Mut zu machen. »You can’t hurry love« und »Pretty Flamingo« und »House of the Rising Sun«. Als ihr die Lieder ausgingen, dachte sie an ihre Lieblingsgestalten aus der Literatur: Max de Winter aus »Rebecca«, Heathcliff und Mr. Darcy natürlich. Und an all die wahnsinnig attraktiven, grüblerischen Helden der historischen Liebesromane, die sie weiterhin zu lesen pflegte, obwohl sie sich mittlerweile schämte, das einzugestehen.
Ihre Phantasien boten ihr Trost und Zuflucht, aber gleichzeitig quälte sie die Tatsache, daß es nur Phantasien waren und sie immer noch auf die echten Abenteuer und die echte Liebe wartete. Sie brauchte Spannung und Herausforderung; sie sehnte sich nach dem Gefühl, mitten im Strom des Lebens zu schwimmen, anstatt immer nur am Rand zu stehen und zuzuschauen. Aber gleichzeitig wünschte sie sich jetzt, als sie durch die Dunkelheit eilte, wo Blätter knisterten und Zweige knarrten und Undefinierbares im Gras raschelte, nur zu Hause zu sein. Die Beine taten ihr weh, und die Brust war ihr eng, und immer wieder meinte sie, hinter sich Schritte zu hören, und sah sich um, gewiß, daß jemand ihr folgte. Aber die Straße war stets leer.
Sie war etwa zwanzig Minuten unterwegs, als ein Auto an ihr vorüberfuhr. Bremsen quietschten, dann wurde krachend der Rückwärtsgang eingelegt, und der Wagen kam schlingernd zu ihr zurück. Das Herz klopfte ihr bis zum Hals, als das Autofenster heruntergekurbelt wurde und ein junger Mann zu ihr heraussah.
»Entschuldigen Sie die Belästigung, aber ich habe mich irgendwie verfahren.« Er schaltete die Innenbeleuchtung ein. Seine Nickelbrille rutschte ihm zur Nasenspitze hinunter, als er eine Karte konsultierte, und eine Haarsträhne fiel ihm lockig in die Stirn. Er hielt Liv die Karte hin. »Können Sie mir vielleicht sagen, wo ich bin?«
Blinzelnd sah sie auf die Karte hinunter. »Genau hier.«
»Oh! Völlig verkehrt natürlich«, stellte er heiter fest. Er sah sie fragend an. »Wohin wollen Sie?«
»Nach Fernhill.« Sie zeigte auf den Punkt auf der Karte.
»Das liegt auf meinem Weg. Steigen Sie ein.«
Liv stand einen Moment reglos, gelähmt von Unschlüssigkeit und Furcht. Sie konnte beinahe Theas Stimme hören: Laß dich nie von Fremden im Auto mitnehmen, Liv. Doch dieser Fremde hatte sympathische blaue Augen und eine angenehme Stimme, außerdem war es spät, und sie war müde. Wenn sie sein Angebot annahm, konnte sie in zehn Minuten schon zu Hause sein und nicht erst in einer Stunde.
Als sie die Tür aufzog, sah sie vor sich die Schlagzeilen in der Zeitung: Grausiger Fund – Mädchen erschlagen im Straßengraben. Doch auf dem Sitz und im Fußraum war alles voller Bücher und Karten. Das Chaos beruhigte sie ein wenig. Ein Mädchenmörder würde bestimmt nicht in einem kleinen Sportwagen voller Bücher herumfahren.
Er sammelte die Bücher ein und warf sie nach hinten. Als er den Motor anließ, sagte er: »Ich war noch nie in dieser Gegend. Überall diese kleinen Dörfer, von denen eines aussieht wie das andere, wenn man sich hier nicht auskennt.«
»Woher kommen Sie denn?« Sofort bedauerte sie ihre Frage. Viel zu persönlich, dachte sie. Gleich würde er herüberlangen und ihren Oberschenkel tätscheln und sagen, wie wär’s, wenn ich dir mal zeige, wo ich herkomme, Kleine?
Aber seine Hände blieben am Lenkrad, und er antwortete höflich: »Aus Northumberland. Waren Sie da schon mal?«
»Nein. Noch nie.«
»Dann sollten Sie das schleunigst nachholen. Es ist die schönste Gegend auf der Welt.« Er warf ihr einen Blick zu. »Im Handschuhfach liegen Pfefferminzpastillen, wenn Sie welche wollen.«
Und nimm niemals von Fremden Süßigkeiten an! »Nein, danke.«
»Ja, ich mag sie auch nicht besonders, sie sind so scharf. Aber ich versuche gerade, das Rauchen aufzugeben. Eine idiotische Angewohnheit – ich habe in der Schule damit angefangen und –-« Er brach ab und runzelte die Stirn. Der Wagen hatte zu hoppeln begonnen. »Ach, Mist!« sagte er. »Ich glaube, wir haben eine Reifenpanne.«
Er trat auf die Bremse und hielt am Straßenrand an. Liv biß sich auf die Lippe. Jetzt würde er sich auf sie stürzen. Verzweifelt spähte sie nach draußen. Nirgends Busch noch Baum, weit und breit kein Haus in Sicht. Im Mondlicht konnte sie die gerundeten Kuppen der Kreidehügel erkennen, die sich vereinzelt in der Landschaft erhoben. Sie dachte, wenn er mich anrührt, schrei ich wie am Spieß. Sie wußte, was für entsetzliche Dinge geschehen konnten und tatsächlich geschahen: Sie selbst war von ihrem Vater verlassen worden, und man brauchte ja nur den armen Philip Constant anzuschauen. Nur Menschen wie Rachel hatten einen Glücksstern, der sie immer und überall beschützte.
Aber als er die Fahrertür öffnete, sagte er: »Es tut mir wirklich furchtbar leid. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, aber keine Sorge, wir können gleich weiterfahren. Im Reifenflicken bin ich ziemlich gut.«
Liv stieg ebenfalls aus. Die Kofferraumklappe wurde geöffnet, Werkzeug klapperte. Sie hörte ihn vor sich hin summen und war ganz unlogischerweise von neuem beunruhigt. Als er den Reifen repariert hatte, hielt er einen langen Eisennagel hoch.
»Das war die Ursache.« Er runzelte die Stirn. »Meine Hände …« Sie waren ölverschmiert.
Sie bot ihm ihr Taschentuch an. »Schade drum«, sagte er. Das Taschentuch war blütenweiß. In eine Ecke eingestickt war der Buchstabe »O«. »Hm, lassen Sie mich raten …« Er betrachtete sie. »Olga? Oonagh? Ophelia?«
Sie lächelte. »Olivia. Olivia Fairbrother.«
»Und ich bin Hector Seton. Ich würde Ihnen gern die Hand geben, aber Sie sehen ja, wie meine Hände ausschauen.«
Sie fuhren weiter. Als sie sich dem Haus der Wybornes näherten, überlegte Liv rasch. »Könnten Sie mich vielleicht hier absetzen, Mr. Seton?« Besser, sich nicht bis zum Cottage fahren zu lassen. Da würde ihre Mutter nur Erklärungen verlangen.
Fernhill Grange strahlte im Glanz unzähliger Lichter wie ein Märchenschloß. Im Garten war ein Festzelt aufgebaut, und zwischen den Bäumen spannten sich Ketten bunter Lichter. Festlich gekleidete Paare ergingen sich auf dem Rasen, und aus der Ferne vernahm Liv Musik.
Dann sah sie Rachel. Sie trug ein Kleid, das Liv noch nie an ihr gesehen hatte, hell und zart wie ein Hauch. Vor dem eleganten schmiedeeisernen Tor hob Liv sich auf Zehenspitzen und rief ihren Namen.
Jahre später dachte sie manchmal darüber nach, wie es für Hector gewesen sein mußte. Der Duft der Frühlingsblumen nach dem Regen, das Mondlicht, das auf Rachel herabschien, als diese sich herumdrehte und lächelnd herankam, eine silberne Flamme in der Dunkelheit.
Katherine lag auf dem Rücksitz von Jamie Armstrongs Wagen. Jamie sagte: »Mann, das war phantastisch«, und wälzte sich von ihr herunter.
Eine Sekunde war es still, dann sagte Katherine: »Ja, super, nicht?« setzte sich auf und begann, ihre Kleider zu richten.
»Zigarette?«
»Ja, bitte.« Er gab ihr Feuer. Sie rauchten schweigend. Dann sagte sie: »Ich muß nach Hause, sonst regt meine Mutter sich auf«, er antwortete hörbar erleichtert: »Klar«, und sie krochen nach vorn.
Als sie vor dem Haus der Constants anhielten, gab Jamie ihr verlegen einen flüchtigen Kuß auf die Wange. »Wie schaut’s nächstes Wochenende aus?«
Katherine lächelte und trat in den Garten. Sie schloß das Törchen sehr leise hinter sich.
Im Haus tappte sie vorsichtig zwischen all den Dingen hindurch, die wie immer im Vestibül herumlagen. Aber sie ging nicht gleich in ihr Zimmer, sondern holte sich aus dem Kühlschrank in der Küche ein Glas Milch, mit dem sie sich ins Wohnzimmer setzte, um zum Fenster hinaus in den mondbeschienen Garten zu blicken. Das Haus war geräumig, trotzdem schien es nicht groß genug für die ganze Familie. Die Schränke quollen über, so daß stets alle verfügbaren Flächen im Haus mit den abenteuerlichsten Gegenständen – Angeln, Fußballstiefeln, Philips Spielsachen – übersät waren. Im Moment leisteten Katherine auf dem Sofa zwei Teddybären, Simons Kricketpulli und der Strickbeutel ihrer Mutter Gesellschaft. Katherine war es schleierhaft, wieso das Haus ständig wie eine Müllhalde aussah, obwohl ihre Mutter jeden Tag vierzehn Stunden schuftete, um es sauber zu halten. Da konnte man mal wieder sehen, daß Hausarbeit die reine Zeitverschwendung war.
Sie spülte das Glas in der Küche aus und ging nach oben. An den Wänden ihres kleinen Zimmers hingen die Plakate, die sie bei Reisebüros zu erbetteln pflegte – der Eiffelturm, die Wasserspiele der Villa d’Este in Tivoli, das Empire State Building – und Abbildungen karibischer Strände und Schweizer Alpenlandschaften, alle aus dem »National Geographic Magazine« ausgeschnitten, das zusammen mit dem »Punch« zur Grundausstattung des Wartezimmers in der Praxis ihres Vaters gehörte.
Beim Auskleiden blickte Katherine mit einem plötzlichen Gefühl der Enttäuschung und der Verwunderung an sich hinunter. Sie hatte geglaubt, sie würde anders aussehen hinterher. Mit zusammengekniffenen Augen musterte sie sich im Spiegel. Sie hatte erwartet – ja, was denn? Ein inneres Leuchten … geheimnisvolle weibliche Ausstrahlung? Sie mußte lachen, als sie ihr Spiegelbild betrachtete, an dem sich nichts verändert hatte durch den Verlust der jungfräulichen Unschuld, nicht die blitzenden braunen Augen, nicht das blasse Gesicht, umrahmt vom glatten aschblonden Haar. Zum hundertstenmal wünschte sie, sie hätte Rachels welliges kastanienbraunes Haar, Rachels milchhellen, von keiner Sommersprosse getrübten Teint. Für Rachel war alles immer so leicht.
Katherine hockte sich auf ihr Bett, umschloß die angezogenen Beine mit beiden Armen und versuchte, sich mit ihrer Verwirrung auseinanderzusetzen. Wozu bloß der ganze Wirbel, dachte sie. Ein paar Augenblicke des Unbehagens und der Verlegenheit, und die Leute schrieben Gedichte darüber. Als Jamie zuckend laut aufgestöhnt hatte und dann von ihr hinuntergerollt war, hätte sie beinahe gesagt: Ist das alles? Aber sie hatte es geschafft, den Mund zu halten. Ihm hatte es ja allem Anschein nach gefallen; es mußte daher ihre eigene Schuld sein, daß sie nichts daran finden konnte. In allen Büchern und allen Schlagern hieß es immer, Sex wäre was ganz Tolles.
Aber neben ihrer Verwirrung war sie sich auch eines Gefühls des Triumphs und der Erleichterung bewußt. Sie hatte sich fest vorgenommen, vor ihrem achtzehnten Geburtstag im August auf jeden Fall zwei Dinge zu tun: neue Kleider zu kaufen und endlich mit einem Jungen zu schlafen, um endlich ihre Unschuld loszuwerden. Von dem, was sie sich mit ihrem Samstagsjob verdiente, hatte sie inzwischen elf Pfund für die Klamotten auf die Seite gelegt (den Rest legte sie für die Weltreise zurück, auf die sie schon sparte, seit sie acht war), aber das Projekt Unschuld ade war nicht so leicht zu verwirklichen gewesen. Nur häßliche Mädchen oder brave Mädchen wie Rachel oder hoffnungslose Romantikerinnen wie Liv waren mit achtzehn noch Jungfrau. Doch nun hatte sie ihr Ziel erreicht. Daß es keinen besonderen Spaß gemacht hatte, war unwichtig. Hauptsache, es war geschafft.
Hector Seton wartete vor dem Cottage, als Liv am Dienstag von der Schule nach Hause kam.
»Ich wollte Ihnen das zurückgeben.« Er hielt ihr ihr Taschentuch hin, frisch gewaschen und gebügelt. »Ich habe auf der Post gefragt, wo Sie wohnen – die Familie Fairbrother …« Er fuhr sich mit den Fingern durch das zerzauste Haar. »Sagen Sie, hätten Sie einen Moment Zeit? Ich wollte noch etwas anderes …«
Sie lud ihn zu einer Tasse Tee ein, und er ging mit ihr ins Haus. In der Küche blieb er vor dem Fenster stehen, berührte lächelnd die Schnüre mit den aufgefädelten Muscheln, die als Jalousie dienten. »Das ist eine tolle Idee. Viel origineller als geblümter Chintz.«
Liv setzte das Wasser auf.
Hector sagte: »Das Mädchen, mit dem Sie mich neulich bekannt gemacht haben …«
»Rachel?«
»Ja. Ist sie – ich meine, hat sie – Also, sie geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf.«
»Oh.« Liv starrte ihn an. Hector Seton hatte sich also in Rachel verliebt. Es wunderte sie überhaupt nicht, daß jemand sich so mir nichts, dir nichts verlieben konnte; in ihren Büchern passierte das andauernd.
»Es würde mich interessieren, ob es jemanden gibt – ob sie zum Beispiel verlobt ist.«
»Rachel hat keinen Freund. Aber die Jungs laufen ihr natürlich in Scharen hinterher«, fügte Liv eilig hinzu. »Sie hat nur noch nicht den Richtigen getroffen.« Sie reichte ihm eine Tasse Tee. »Wollen wir in den Garten gehen?«
Er öffnete ihr die Tür. Ein paar Schritte weiter war ein kleiner Platz mit zwei wackligen Stühlen und einem Tisch.
»Der ist ja wirklich toll.« Hector bewunderte den Tisch.
»Den hab ich selbst gemacht.«
»Tatsächlich? Hut ab.« Er musterte die Platte: ein in Gips gefaßtes Mosaik aus farbigen Glasstückchen.
»Ich hab sie am Strand gefunden. Wir haben früher am Meer gelebt. Als ich klein war, dachte ich, es wären Edelsteine.«
»Zu Hause war ich auch immer am Strand und habe alles mögliche gesammelt – Fossilien und Muscheln und Treibholz. Ich habe fast ein ganzes Zimmer damit vollgestopft.«
Liv erinnerte sich ihres Gesprächs im Wagen. »In Northumberland?«
Hector zwinkerte ein paarmal, seine Augen hinter den Brillengläsern erinnerten an die einer Eule. »Ich wohne dort schon lange nicht mehr. Ich lebe in London. Aber für mich ist es immer noch mein Zuhause.« Er sah Liv an. »Ihre Freundin Rachel …«
»Sie haben ihr gefallen.«
Seine Miene, ja, seine ganze Haltung veränderte sich. Er schien von innen heraus aufzuleuchten. »Wirklich?«
»Ja. Sie hat es mir selbst gesagt.« Rachel hatte es allerdings ein wenig anders formuliert. Weißt du, Liv, es kommt mir ständig so vor, als wäre ich ihm schon einmal irgendwo begegnet. Als ich mit ihm sprach, hatte ich das Gefühl, ihn schon seit Jahren zu kennen. Seitdem zerbreche ich mir den Kopf, aber ich glaube, wir sind uns nie begegnet. Sie schien verwirrt.
»Ihre Eltern – wie sind sie?«
»Tante Diana ist sehr nett. Mr. Wyborne …« Liv dachte an Rachels tüchtigen, ehrgeizigen Vater – »er ist Parlamentsabgeordneter.«
»Ach so. Der Henry Wyborne.« Er lächelte. »Macht er einem angst?«
»Ein bißchen schon.«
Ein Schweigen folgte, dann sagte Hector: »Ich muß sie wiedersehen.« Nicht »Ich würde sie gern wiedersehen« oder »Es wäre schön, sie wiederzusehen«, sondern »Ich muß sie wiedersehen.«
Katherine hatte sich einen genauen, wenn auch etwas unordentlichen Plan gemacht, was sie bis zur Prüfung alles wiederholen wollte. Sie hatte die drei Fächer in Themenkreise aufgeteilt und diese in unterschiedlichen Farben gekennzeichnet. Es blieben nur noch sechs Wochen bis zur Prüfung und bisher war nicht eine der grellfarbigen Kategorien abgehakt. Die Hände auf die Ohren gedrückt, starrte Katherine in ihre »Aeneis« und versuchte, das Geschrei, das Läuten des Telefons und vor allem die Stimme, die immer wieder ihren Namen rief, auszublenden. »Tendebantque manus ripae ulterioris amore?« murmelte sie: Sie streckten voll Sehnsucht die Hände nach dem anderen Ufer.
Klopfen an ihrer Zimmertür. »Kitty?« Heftigeres Klopfen. »Kitty!!«
Sie riß die Tür auf. »Was denn?«
»Du sollst zu Mama kommen«, sagte Simon. »Philip führt sich wieder auf, und jemand muß ans Telefon gehen.«
»Warum kannst du das nicht tun?«
»Fahrstunde«, versetzte Simon selbstzufrieden und ging pfeifend, die Hände lässig in den Hosentaschen, durch den Gang davon.
»Ich habe Prüfungen!« schrie sie ihm nach.
Er drehte sich um. »Für dich lohnt sich’s auch, wenn ich’s schaffe. Dann bist du nicht mehr auf Jamie angewiesen.«
Sie spürte, wie sie rot wurde. Sie hatte Jamie Armstrong seit mehr als einem Monat nicht mehr gesehen. Er hatte nicht angerufen. Sie war beinahe erleichtert; sie mußte sich auf die Schule konzentrieren, und sie war insgeheim froh, daß ihr weitere Handgreiflichkeiten auf dem Rücksitz seines Autos erspart bleiben würden. Aber einmal, als sie nachmittags nach Hause gegangen war, hatte Jamie an der Bushaltestelle gestanden. Er hatte sie nicht gegrüßt, sondern weiter mit seinen Freunden geredet, als wäre sie nicht vorhanden. Flittchen, hatte sie gehört. Sie war weitergegangen und hatte sich mit aller Willenskraft bemüht, nicht rot zu werden. Doch schon bei der Erinnerung an dieses gemurmelte Wort wurde ihr innerlich kalt.
Barbara Constant war in der Küche und fütterte Philip. Philip war zwölf, aber durch den Gehirnschaden infolge der schweren Masernerkrankung geistig weit zurückgeblieben. Er mußte wie ein kleines Kind versorgt werden. In letzter Zeit hatte Katherine den Eindruck, daß ihre Mutter in dem Maß schrumpfte wie Philip körperlich wuchs, daß sie immer mehr graue Haare bekam, ihre Kleidung immer ungepflegter und ihr Gesicht immer müder wurde.
Barbara sah auf, als Katherine in die Küche kam. »Er ist sehr quengelig heute und will absolut nicht selbst essen. Vielleicht brütet er irgendeine Krankheit aus. Und der Abwasch ist auch noch nicht gemacht, und die Kartoffeln sind nicht geschält. Und das Telefon läutet ununterbrochen.«
»Ich muß Hausaufgaben machen«, erklärte Katherine trotzig. »Kann Michael denn nicht …?«
Sie sah, daß Philips Gesicht fleckig war vom Weinen. Als er seine Arme ausstreckte, drückte sie ihn an sich, und sein struppiges rotblondes Haar rieb an ihrer Wange. Er sah zu ihr hinauf. Der Blick seiner Augen, so warm und braun wie ihre eigenen, suchte Trost und Beruhigung. Er holte einmal tief und zitternd Atem und lehnte sich dann auf seinem Stuhl zurück, während sie ihm sachte den Rücken tätschelte.
Als Barbara Constant ihm einen Löffel voll Essen hinhielt, schlug er ihn ihr aus der Hand.
»Mein Gott, ich …« Ihre Stimme zitterte vor Spannung.
Das Telefon begann von neuem zu läuten.
Katherine sagte hastig: »Komm, laß, ich mach das schon.« Sie hob den Löffel vom Boden auf und spülte ihn unter dem fließenden Wasser.