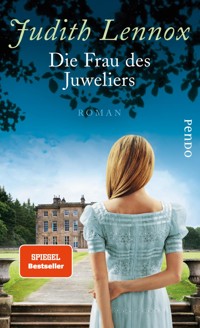9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mitreißend und bewegend wie »Das Winterhaus« ist dieser wundervoll erzählte Roman von Judith Lennox, in dem sie zwei unterschiedliche Frauen zusammenführt. Tilda Franklins erschütternde Lebensgeschichte, der die talentierte junge Biografin Rebecca nachspürt, gibt ihrem eigenen Schicksal die entscheidende Wende.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Iain, in Liebe
Übersetzung aus dem Englischen von Mechtild Sandberg
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe16. Auflage 2010
ISBN 978-3-492-95346-7
© Judith Lennox 1997
Titel der englischen Originalausgabe:
»Some Old Lover`s Ghost«, Doubleday / Transworld Publishers Ltd., London 1997
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 1999
Umschlagkonzept: semper smile, München
Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München
Umschlagabbildung: Plainpicture, Arcangel
Teil I
Prolog
SEIT ZWEI TAGEN überzog Rauhreif wie Silberfiligran Schilf und Gras. Eisperlen auf jedem Blatt und Ast glitzerten in den letzten Strahlen der untergehenden Sonne. Eis bedeckte die Ufer des Kanals. Ein glanzloser weißlicher Mantel rund um die Stengel der Pflanzen am Wasserrand verbarg die Verwesung darunter. Dort, wo das Wasser frei strömte, stieg Dunst in kleinen wirbelnden Wölkchen auf wie Dampf von einem heißen Bad, als flösse in den schwarzen Tiefen ein warmer Strom.
Schnurgerade zog sich der Kanal durch die flache Landschaft East Anglias. Zu beiden Seiten waren weite, konturlose Felder, deren Grenzen von einem gefurchten Feldweg oder niedrigem struppigen Buschwerk gekennzeichnet waren. Die Sonne berührte den Kirchturm und die kahlen Äste der Bäume, die ihn umgaben, und wanderte langsam weiter zum offenen Land dahinter, wo sie die langen Furchen, die der Pflug hinterlassen hatte, in Licht und Schatten tauchte. Alles war still; kein Lüftchen raschelte im froststarren Gras oder wirbelte ein Häufchen toter Blätter auf, um die nackte Erde darunter bloßzulegen.
Sein Atem bildete graue Wölkchen in der kalten Abendluft, während er auf dem Deich entlangging. Obwohl der Mensch dieses Land dem Meer entrissen hatte, obwohl die tiefen Einschnitte der Kanäle und Gräben von der Hartnäckigkeit und Findigkeit des Menschen zeugten, war dieses Land, so schien ihm, nie Eigentum geworden, immer nur Leihgabe gewesen. Der tiefe Horizont, die endlose Weite des Himmels ließen den Menschen zu rastloser Bedeutungslosigkeit schrumpfen. Wenn es einen Gott gab, dann gab dieser Gott sich durch Überschwemmung und Sturm nur als Mahner an die Ohnmacht des Menschen zu erkennen. Wenn das Land selbst nichts Beständiges war, was für eine Chance hatten dann vergängliches Fleisch und Gebein? Manche hatten geglaubt, die Herrschaft über dieses Land zu besitzen; sie waren von der Übermacht des Wassers vertrieben worden.
Als er den Blick geradeaus richtete, sah er das Haus, das allein etwa anderthalb Kilometer von der Kirche entfernt stand. In den Strahlen der untergehenden Sonne leuchteten die Fensterscheiben rotgolden, und die schroffen Mauern verloren etwas von ihrer Trostlosigkeit, so daß das Haus wieder lebendig zu werden schien. Er blieb stehen und erinnerte sich. Die Worte Ach, wenn nur durchschnitten sein kältestarres Herz, wie der Kanal die kalte Erde durchschnitt. Dann sank die Sonne hinter den Horizont, und das Haus zog sich in die Schatten zurück.
Er kehrte um, ging den Weg zurück, den er gekommen war. Es war jetzt ganz dunkel. Eine dünne Wolkenschicht bedeckte den Mond, die Sterne leuchteten nur schwach. Sich des Wassers an der Seite bewußt, bewegte er sich vorsichtig und wünschte, er hätte eine Fackel oder Laterne mitgenommen. Allein der Gedanke, in den Kanal zu stürzen – knackendes Eis und dann Stille – machte ihn schaudern. Ertrinken war der schlimmste Tod: Wasser in Lunge, Mund und Nase, das einen erstickte. Wie lebendig begraben zu werden.
Das Geräusch eines Schrittes und ein keuchender Atemzug erschreckten ihn, der sich allein geglaubt hatte, und er stolperte. Sein Herz hämmerte gegen seine Rippen, während er suchend nach rechts und links blickte, halb in der Erwartung, daß die Dampfwirbel, die vom Wasser aufstiegen, Körper und Gestalt gewonnen, sich in die Irrlichter verwandelt hätten, die in den Fens spukten.
Aber dann lichtete sich die Wolke, und der Mond zeigte ihm den Hund, der an der schräg abfallenden Böschung des Deiches scharrte: scharfe Krallen, die an der beinharten Erde kratzten, feuchte Nase, die Geheimnisse aufspürte.
Er bückte sich, nahm eine Handvoll Kiesel und warf sie nach dem Hund, bis dieser aufjaulend in der Dunkelheit verschwand.
1
ALS TOBY GEGANGEN war, nahm ich die Blumen, die er mir mitgebracht hatte, und spülte sie eine nach der anderen in der Toilette hinunter. Ein paar Blütenblätter blieben auf dem Wasser zurück, glatt, rosig, süß duftend. Ich ging wieder in das triste kleine Zimmer am Ende des Korridors und starrte zum Fenster hinaus. Feiner Oktoberregen legte einen dunklen Glanz auf die Straßen vor dem Krankenhaus. Der Fernsehapparat lief, aber ich hörte nichts. Ich hörte nur Tobys Stimme: Ich denke, wir sollten uns in Zukunft nicht mehr so häufig sehen, Rebecca.
»Toby, bitte! Nicht jetzt«, hatte ich schwach gesagt, und er war zusammengezuckt. Dann hatte er entgegnet: »Es stimmt doch schon seit einer Weile nicht mehr zwischen uns. Aber wegen des Kindes …« Er war rot geworden und hatte weggesehen, und ich hatte kühl gesagt: »Natürlich. Wenn du es so empfindest.« Nur das nicht, nur nicht zum unerwünschten, lästigen, bemitleideten Anhängsel werden!
Ich wandte mich vom Fenster ab. Im Fernsehen lief East-Enders. Ein sehr junges Mädchen in einem schäbigen Morgenrock saß vor dem Apparat und rauchte. Sie bot mir eine Zigarette an, und ich nahm sie, obwohl ich seit dem Studium nicht mehr geraucht hatte. Auf der Packung stand RAUCHEN KANN DER GESUNDHEIT IHRES UNGEBORENEN KINDES SCHADEN, aber das spielte jetzt keine Rolle mehr. Das Kind, das ich erwartet hatte, gab es nicht mehr. Ich zündete die Zigarette an und schloß einen Moment die Augen. Ich sah Blütenblätter auf Wasser treiben, rosig und wie Föten geformt.
Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus kehrte ich in meine Wohnung in Teddington zurück. Ich bewohnte das Erdgeschoß eines der vielen viktorianischen Häuser, die für das Straßenbild im Westen Londons so typisch sind. Die Räume – Küche, Badezimmer und Wohn-Schlaf-Zimmer – wirkten fremd und verstaubt. Unter dem Briefkastenschlitz in der Wohnungstür lag ein Stapel Post, und der Anrufbeantworter blinkte wie verrückt. Ich ließ beides, wie es war, und legte mich im Mantel auf das Bett.
Ich dachte an Toby. Ich hatte ihn vor anderthalb Jahren in South Kensington kennengelernt. Von einem Platzregen überrascht, stand ich ohne Schirm und Mantel da, als auf einmal ein Mann neben mich trat und anbot, seinen Schirm mit mir zu teilen. Ich nahm dankbar an. Toby Carne wirkte vom Scheitel bis zur Sohle wie der vollendete Gentleman im besten altmodischen Sinn des Wortes – Burberry und schwarzer Regenschirm; dunkles Haar, das gerade noch seinen Kragen streifte; eine alte, aber unverkennbar teure lederne Aktentasche. Meiner Schätzung nach mußte er ungefähr zehn Jahre älter sein als ich. Seite an Seite gingen wir weiter, und ich war so fasziniert von seinem Lächeln und dem unmißverständlichen Interesse in seinem Blick, daß ich vergaß, auf die Pfützen auf der Straße zu achten. Als er vorschlug, irgendwo gemeinsam ein Glas zu trinken, um dem Regen zu entkommen, willigte ich ein. Und als wir uns später trennten, hatte er meinen Namen und meine Telefonnummer. Ich erwartete nicht, daß er sich melden würde, aber er tat es wenige Tage später. Ich hätte ihn zum Lachen gebracht, erklärte er. Ich sei erfrischend, so anders.
Toby war für mich das große Abenteuer. Er kam aus einer anderen Welt, und ich bildete mir ein, durch ihn würde ich eine andere werden. Eine Zeitlang war das auch so. In der Zeit mit Toby wurde ich schlanker, kleidete mich pfiffiger und ließ mein langes Haar aufhellen. Ich trug hohe Absätze, ohne bei jedem Schritt zu stolpern, und ich kaufte mir teures Make-up, das wirklich hielt. Ich besuchte Tobys Eltern in Surrey und tat so, als wären Sofas ohne Flecken und Badezimmer mit farblich aufeinander abgestimmten Handtüchern alltäglich für mich.
Wir reisten nach Amsterdam, Paris und Brüssel; wir aßen in teuren Restaurants und wurden zu schicken Partys eingeladen. Er stellte mich seinen Freunden, die meisten von ihnen Anwälte wie er, als »Rebecca Bennett, die Biographin« vor; eine Reaktion blieb häufig aus, was ihm nach einiger Zeit auffiel. Er schlug vor, ich solle einen Roman schreiben; ich erklärte, daß ich zum Schreiben das feste historische Gerüst brauchte. In einer von Alkohol verklärten Sommernacht sagte er, er wolle ein Kind von mir, und als ich ihm zwei Monate später eröffnete, daß ich schwanger sei, feierte er das Ereignis mit dem besten Champagner. Aber er sagte kein Wort davon, daß wir nun zusammenziehen sollten. Und als ich mehrere Wochen später bei einem langweiligen, aber wichtigen geschäftlichen Abendessen Blutungen bekam und danach eine Fehlgeburt hatte, war er nur verärgert, daß ich mir ausgerechnet diesen Zeitpunkt und diesen Ort dafür ausgesucht hatte.
Ich hatte geglaubt, die Verwandlung, die er bei mir bewirkt hatte, werde von Dauer sein. Aber mit einem einzigen Satz – Ich denke, wir sollten uns in Zukunft nicht mehr so häufig sehen – hatte er mich daran erinnert, wer ich wirklich war. Mein »Anderssein« war lästig geworden, schlimmer noch, peinlich. Und ich hatte ihn seit einer Ewigkeit nicht mehr zum Lachen gebracht.
Nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus setzte ich tagelang keinen Fuß vor die Tür meiner Wohnung. Ich trank eine Tasse Tee nach der anderen und ernährte mich, wenn ich schon mal Appetit hatte, von alten Konserven, die ganz hinten auf dem Küchenregal schon eine Staubschicht angesetzt hatten. Ich ging nicht ans Telefon, und ich machte die Post nicht auf. Der dumpfe Schmerz in meinem Unterleib verging langsam. Die innere Panik, das Gefühl des totalen Zusammenbruchs, blieb. Ich schlief, soviel ich konnte, fast nie ohne Alpträume.
Dann kam Jane. Jane ist meine ältere Schwester. Sie hat zwei kleine Söhne, ein Jahr und drei Jahre alt, und ein Haus in Berkshire. Immer hat leiser Neid von beiden Seiten unsere Beziehung mit geprägt.
Jane hämmerte an die Tür, bis ich aufmachte, warf einen Blick auf die verwahrloste Wohnung und ihre verwahrloste Schwester und rief: »Also wirklich, Becca, du bist unmöglich.« Ich fing an zu weinen, und wir umarmten einander mit täppischer Verlegenheit, Kinder einer Familie, in der zärtliche Gefühle selten gezeigt worden waren.
Ich verbrachte eine Woche bei Jane, dann kehrte ich nach London zurück. »Du mußt anfangen, dein Leben wieder in die Hand zu nehmen«, sagte sie, als sie mich zum Zug brachte. Aber ich hatte das Gefühl, als wäre nichts übrig von meinem Leben. Meine Zukunftspläne hatten sich um Toby und das Kind und die Weiterführung meiner schriftstellerischen Arbeit gedreht. Toby und das Kind hatte ich verloren, und schreiben konnte ich nicht, obwohl ich mich jeden Tag gewissenhaft an den Schreibtisch setzte und den Computer anstarrte. Mir fiel nichts ein, worüber zu schreiben sich gelohnt hätte. Jeder Satz, den ich zusammenbastelte, klang hölzern und leer. Ideen schossen mir durch den Kopf, und ich notierte sie mir in meinem Heft, aber am nächsten Morgen erschienen sie mir unweigerlich belanglos und oberflächlich.
Zu Weihnachten luden Jane und Steve mich zu sich ein. Das fröhliche Lärmen der beiden kleinen Jungen füllte die Lücken, die der Tod meiner Mutter vor vier Jahren hinterlassen hatte, und half über die Lieblosigkeit meines Vaters hinweg.
Zurück in London, ließ ich mich von Charles und Lucy Lightman auf eine Silvesterfete schleppen. Ich kenne Charles seit vielen Jahren. Er und seine Schwester Lucy haben beide blaßgrüne Augen und sehr feines hellbraunes Haar, das sich nicht bändigen läßt. Charles und ich kennen uns seit der Uni, inzwischen hat er seine eigene Produktionsfirma, Lighthouse Productions, die auf Fernsehsendungen mit archäologischem oder historischem Schwerpunkt spezialisiert ist. Im vergangenen Sommer hatten wir gemeinsam einen Dokumentarfilm mit dem Titel Mondschwestern gemacht.
Alles auf der Party erschien mir künstlich, die üblichen Annäherungsrituale – Was arbeiten Sie? und Kann ich Ihnen etwas zu trinken holen? – fand ich nur albern. Im Badezimmer sah ich mich im Spiegel. Rundes Gesicht, kurzes mausbraunes Haar (Ich hatte es einige Wochen zuvor schneiden lassen und machte mir nicht mehr die Mühe, es zu tönen), blaßblaue Augen mit einem Ausdruck fassungsloser Verwirrtheit, der mir für meine einunddreißig Jahre unangemessen schien. Einen Moment lang starrte ich dieses jämmerliche Spiegelbild angewidert an, dann nahm ich meinen Mantel und fuhr nach Hause. Aber, dachte ich, als ich mir im Bett die Decke über den Kopf zog, um das ausgelassene Treiben auf der Straße nicht hören zu müssen, ich bin auf dem Weg der Besserung. Es war Wochen her, seit ich mich das letzte Mal in den Schlaf geweint, seit ich das letzte Mal beim Anblick eines dunkelhaarigen Mannes oder eines Kinderwagens Schmerz verspürt hatte. Ich übte mich darin, nicht zu fühlen. Und ich machte gute Fortschritte.
Vierzehn Tage später hängte ich im Laden um die Ecke eine Anzeige aus, in der ich Nachhilfeunterricht in Geschichte für die Oberstufe anbot. Ich hatte früher an einer Schule unterrichtet, diese Tätigkeit jedoch nach dem ersten bescheidenen Erfolg meiner Biographie über Ellen Wilkinson frohen Herzens an den Nagel gehängt. Leider schien nun jeder Funke von Kreativität in mir erloschen zu sein, und mein Bankkonto war weit überzogen. Ich erhielt mehrere Antworten auf meinen Aushang, doch als ich die vereinbarten Stunden in meinen Terminkalender eintrug, überfielen mich nervöse Bedenken, ein ängstlicher Verdacht, daß ich auf diese unbekannten Schüler langweilig wirken und es mir nicht gelingen würde, sie zu begeistern.
Eines Abends Mitte Februar läutete Charles bei mir. Er brachte ein komplettes Abendessen vom Chinesen und eine Flasche Rotwein mit. Um neun sollte Mondschwestern gesendet werden. Er sah sich erstaunt um, als er eintrat, und sagte: »Aber du bist doch sonst immer die Ordnung in Person, Darling«, und einen Moment lang waren mir die Stapel ungespülten Geschirrs und die Staubflusen, die sich in den Zimmerecken gesammelt hatten, peinlich.
Wir setzten uns auf mein Bett und sahen uns bei Zitronenhühnchen mit gebratenem Reis unseren Film an. Mein Name wurde im Vorspann genannt, und obgleich ich den Film natürlich kannte, erschien er mir jetzt so fremd, als hätte ich mit ihm überhaupt nichts zu tun. Eine andere hatte mit diesen gebrechlichen alten Frauen gesprochen, eine andere hatte diese erschütternden Berichte von Verlassenwerden und Verrat auf Tonband aufgezeichnet. Mondschwestern erzählte die Geschichten einer Gruppe von Frauen, die zu den Opfern des 1913 erlassenen Gesetzes über die Unterbringung von Geisteskranken gehörten. Dieses Gesetz hatte die örtlich zuständigen Behörden berechtigt, schwangere Frauen, die mittellos oder, nach Meinung irgendeiner von persönlichen Interessen geleiteten männlichen Autorität, unmoralisch waren – mit anderen Worten, ledige Mütter –, für geisteskrank zu erklären und in eine Anstalt einzuweisen. Das Gesetz wurde erst in den fünfziger Jahren aufgehoben, doch da war den Frauen die Anstalt längst zum Zuhause geworden, und die Welt draußen fremd und unverständlich.
Bei den Recherchen für den Film lernte ich in einem Altersheim in Nottingham Ivy Lunn kennen. Sie war fast neunzig, blitzgescheit und bei klarem Verstand. Ich lud sie in ein Café ein. Halb erfreut, halb ängstlich kam sie mit. Als sie sich bei Tee und Kuchen ein wenig entspannt hatte, erzählte sie mir ihre Geschichte. Kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs war sie mit vierzehn Jahren als Dienstmädchen in einem vornehmen Haus in London in Stellung gegangen. Eines Morgens, als sie im Badezimmer gerade die Wanne geputzt hatte, war der älteste Sohn der Familie hereingekommen, hatte ihren Rock hochgeschlagen, sie gepackt und vergewaltigt. Aus Angst hatte sie nicht geschrien, hatte auch nicht gewagt, sich irgend jemandem anzuvertrauen. Sie hatte überhaupt nicht begriffen, was er ihr angetan hatte, und von den möglichen Folgen keine Ahnung gehabt. Aber sie hatte gewußt, daß er sie verletzt und erniedrigt hatte. Als ihre Schwangerschaft offenkundig geworden war, hatte man sie entlassen. Auf ihren Versuch einer Erklärung war ihr klargemacht worden, daß sie allein die Verantwortung trage. Der Sohn kehrte ins Internat zurück, Ivy kam in eine Anstalt.
Ich hatte geweint, als Ivy mir ihre Geschichte erzählt hatte. Ich hatte ihr in dem schäbigen kleinen Café gegenübergesessen und Tränen des Mitleids geweint. Ivy hatte mich trösten müssen. Aber jetzt, als ich neben Charles auf meinem Bett saß, fühlte ich gar nichts.
Der Nachspann lief ab, die Musik verklang, und Charles sprang mit einem Triumphschrei auf. Seine grünen Augen blitzten erregt, und er sprach sehr schnell.
»Toll, findest du nicht, Becca? Das gibt bestimmt großartige Besprechungen. Ich geh morgen gleich in aller Frühe los und kauf sämtliche Zeitungen. Wir sind doch ein prima Team, hm?« Mit einem Schritt war er bei mir und küßte mich.
»Ich mach uns einen Kaffee«, sagte ich kurz und befreite mich von ihm.
»Ich hab schon eine Idee für einen neuen Film«, rief er, während ich in der Küche Kaffee mahlte. »Internate zu Beginn des Jahrhunderts. Du weißt schon, Prügelstrafe und Homosexualität. Das Ganze verknüpft mit dem Ersten Weltkrieg, mit dem Abbröckeln des Empire und dem ganzen Krempel …«
Er sprudelte weiter, während ich kochendes Wasser in die Cafetiere goß und Geschirr auf ein Tablett stellte. Nach einer Weile hörte ich ihm nicht mehr zu. Um einen Dokumentarfilm zu schaffen, der den Zuschauer wirklich berührt, muß man mit den Menschen fühlen, deren Geschichten man erzählt. Wenn das Schicksal Ivy Lunns, die vergewaltigt und eingesperrt und fast ein Leben lang von ihrem einzigen Kind getrennt worden war, mich nicht mehr erschüttern konnte, was dann?
Eine Woche später rief mich meine Agentin, Nancy Walker, an. »Ich habe phantastische Neuigkeiten, Rebecca«, rief sie. »Du wirst es nicht glauben!« Nancy ist immer sehr dramatisch. »Eben hat Sophia Jennings von Crawford mich angerufen. Sie würde sich gern mal mit dir zusammensetzen, um ein mögliches Projekt zu besprechen.« Ich hörte sie förmlich lächeln.
Crawford ist ein angesehener und gutgehender Londoner Verlag. »Sie haben vor«, fuhr Nancy fort, »eine Lebensgeschichte Dame Tilda Franklins rauszubringen.«
Bis vor wenigen Jahren war für jeden ernstzunehmenden Zeitungs- oder Fernsehbericht über Kinder- und Jugendfürsorge ein Gespräch mit Dame Tilda, die dieser Aufgabe ihr Leben geweiht hatte, unerläßlich. Sie hatte zahllose Waisenkinder adoptiert oder in Pflege genommen, hatte psychiatrische Kliniken zur Betreuung gestörter Kinder eingerichtet, wohltätige Vereine, Notrufdienste und Kinderhäuser für mißbrauchte und gefährdete Kinder ins Leben gerufen. Liebevoll, aber energisch; sanft, aber entschieden. An Tilda Franklins Gesicht hatte ich nur eine vage Erinnerung – nur ein flüchtiger Eindruck charismatischer Schönheit gepaart mit der Ausstrahlung von Intelligenz und Kraft war mir im Gedächtnis geblieben.
»Die wollen mit mir reden?« fragte ich ungläubig. »Bist du sicher?«
»Offenbar versuchen sie schon seit Jahren Dame Tilda für so ein Projekt zu gewinnen, aber sie hat bisher stets abgelehnt. Nun hat sie selbst beim Verlag angerufen und besteht darauf, daß du die Sache übernimmst. Jemand anders käme für sie nicht in Frage.«
Es trat eine Pause ein. Nancy wartete auf meinen Kommentar. Aber ich sagte nichts. Mir hatte es buchstäblich die Sprache verschlagen. Ich konnte mir nicht vorstellen, aus welchem Grund Tilda Franklin ihre Lebensgeschichte ausgerechnet von mir schreiben lassen wollte, und ich hatte immer noch den Verdacht, daß es sich um ein Mißverständnis handeln müsse. Trotzdem war mir, als gewahrte ich weit entfernt am Ende eines langen dunklen Tunnels plötzlich einen Lichtschimmer. Ich wußte, ich sollte Nancy sagen, daß ich nicht mehr schreiben konnte, aber aus irgendeinem Grund – aus Stolz wahrscheinlich – tat ich es nicht.
»… eine faszinierende Geschichte«, hörte ich Nancy sagen. »Sie hat, glaube ich, im Krieg irgendwas sehr Heldenhaftes getan – Rebecca?« Ein besorgter Ton schwang in ihrer Stimme. »Freut dich das denn nicht?«
»Doch, doch«, murmelte ich und sah mich wie gelähmt vor meinem Computer sitzen, unfähig, auch nur einen einzigen zusammenhängenden Satz zu produzieren. »Aber ich weiß nicht recht, Nancy«, sagte ich vorsichtig. »Die vielen Kinder … Könnte ich ihr wirklich gerecht werden? Und es wäre ein Haufen Arbeit …«
»Na, davon hast du dich doch früher nicht abhalten lassen«, entgegnete Nancy energisch. »Du würdest das bestimmt glänzend hinkriegen. Überleg’s dir, Rebecca. Ruf mich an, dann vereinbare ich einen ersten Termin mit Sophia.«
Nach dem Gespräch saß ich erst mal eine Weile da und starrte die Wand an. Ich hätte Nancy erklären sollen, daß ich mein ganzes Vertrauen in meine schriftstellerischen Fähigkeiten verloren hatte. Und daß es eigentlich überhaupt nicht mein Fall war, die Biographie einer Heiligen zu schreiben. Ich zeige lieber das, was sich hinter der Fassade verbirgt. Geschichte interessiert mich erst, wenn die Glasur springt und der rohe Ton zum Vorschein kommt.
Wie sollte ich die glücklichen Familien beschreiben, die Tilda Franklin geschaffen hatte, wo ich selbst solche Geborgenheit nie erlebt hatte? Wie sollte ich über die Freuden des täglichen Sorgens für Kinder schreiben, wo mein einziger Versuch, ein Kind in die Welt zu setzen, kläglich gescheitert war? Ich griff zum Telefon, um Nancy zurückzurufen und ihr zu sagen, daß es sinnlos sei, eine Verbindung zwischen mir und dem Verlag herzustellen, aber ich legte den Hörer zurück, ohne die Wähltasten berührt zu haben. Der Funke der Zuversicht, der gedämpfte Schimmer wiedergekehrten Selbstvertrauens waren eben doch noch da.
Ich nahm meine Wagenschlüssel und fuhr hinaus nach Twickenham. Dort machte ich einen langen Spaziergang und sah zu, wie die Nebel von der Themse aufstiegen. Ein nasser, kläffender Hund rannte mir am Ufer entgegen und schüttelte sich, daß die Wassertropfen glitzernd in alle Richtungen flogen. Die Wolken hatten sich endlich gelichtet, und ich konnte die Sonne sehen, ein wenig trübe, aber dennoch leuchtend. Das Wasser leckte an meinen Stiefelspitzen, doch ich kehrte dem Fluß den Rücken zu, bevor die Wolken zurückkehren und erneut die Sonne verdunkeln konnten. Zu Hause rief ich Nancy an und sagte ihr, ich sei mit einem Termin bei Crawford in der nächsten Woche einverstanden.
Dame Tilda Franklin lebte in Woodcott St. Martin, einem Dorf in Oxfordshire. Auf der Fahrt zu ihr, eingekeilt zwischen zischenden Transportern und ungeduldigen Handlungsreisenden, wünschte ich beinahe, ich könnte umkehren. Aber ich tat es nicht, sondern kroch, vom einschläfernden Summen der Scheibenwischer begleitet, weiter im endlosen Troß.
Ich hatte das Projekt mit meiner zukünftigen Lektorin erörtert. Sie hatte vorgeschlagen, ich solle zunächst einmal mit Tilda Franklin sprechen und danach, falls der Auftrag mich immer noch reizte, dem Verlag meine Ideen vorlegen. Bei Gefallen würde man mir einen anständigen, wenn auch nicht übermäßig großzügigen Vorschuß zahlen.
Ich war froh, als ich die Autobahn verlassen konnte, um in eine Landschaft sanft gewellter Hügel und schmaler, gewundener Straßen einzutauchen, in deren Tälern noch Nebel lag. Ich mußte mehrmals anhalten und mich anhand der Karte des Wegs vergewissern. Es war früh am Tag, noch nicht einmal neun, die Welt noch halb im Schlaf. Nach ungefähr einer halben Stunde erreichte ich Woodcott St. Martin, ein auseinandergezogenes Dorf mit einem Marktplatz, einem Ententeich und zwei Geschäften. Vor dem Zeitungsladen hielt ich an, um mich nach dem Weg zu Dame Tildas Haus, dem sogenannten Roten Haus, zu erkundigen. »Es geht ihr nicht besonders gut«, sagte der Zeitungshändler. »Sie bekommt um diese Jahreszeit leicht mal eine Bronchitis.«
Das Rote Haus stand etwas abseits vom Dorf. Auf seiner einen Seite sah ich den Schimmer eines Flusses, auf der anderen Spielplätze, deren Schaukeln still und verlassen im grauen Licht hingen. Das Haus war groß und alt, mit steinumrandeten Giebelfenstern. Die Mauern waren aus dunkelrotem Backstein, die Dachschindeln von Flechten verfärbt. Buchsbäume, zu gewaltigen Kugeln und Pyramiden geschnitten, standen wie Mauern zu beiden Seiten des schmalen Fußwegs. Der Nebel bleichte ihr dunkelgrünes Laub und sprenkelte die weitgespannten Spinnweben in ihrem Geäst mit Glitzer. Kalt und unverrückbar schlossen mich die großen gestalteten Büsche ein und schnitten mich vom Garten ab. Mich fröstelte: Dies war nicht die liebliche Wildnis von Rosen und Astern, die ich erwartet hatte. Diese Bäume waren dunkel und geheimnisvoll, ihre Formen von einer Symbolik, die mir verschlossen blieb. Ich war froh, als ich den kleinen gekiesten Vorplatz des Hauses erreichte. Hastig wischte ich mir die Spinnweben ab, die sich auf meiner Jacke verfangen hatten, und läutete.
Drinnen folgte ich Dame Tildas Haushälterin durch Korridore und Zimmer. Kindergesichter – gemalt, gezeichnet, fotografiert – blickten von den Wänden zu mir herab. Alles Kinder, vermutete ich, die Tilda Franklin unter ihre Fittiche genommen hatte. Kleinkinder und Halbwüchsige, Mädchen mit Schleifen im Haar, Jungen in ausgebeulten Cordhosen und heruntergerutschten Söckchen. Verblassende Kinderzeichnungen, ein mühsam gearbeitetes Stickdeckchen, der unscharfe Schnappschuß eines Jungen mit einer Haartolle im Stil der fünfziger Jahre, der neben einem blitzenden Motorroller stand. Die goldenen Rahmen der Bilder erhellten die dunklen, eichengetäfelten Wände.
Die Haushälterin führte mich zu einem Raum ganz hinten im Haus und klopfte. »Miss Bennett ist hier, Tilda.«
Der Wintergarten war mit alten bequemen Möbeln eingerichtet. Pflanzen – Wachsblume, Bleiwurz, Bougainvillea – rankten sich an den Wänden empor. In einer Ecke des Raumes stand eine Frau mit einer Gartenschere in der Hand. Sie drehte sich herum.
»Miss Bennett? Wie schön, daß Sie kommen konnten! Sie müssen entschuldigen, daß ich Sie schon so früh am Tag hierhergelockt habe, aber nachmittags kann ich, so schrecklich das ist, manchmal schlecht die Augen offenhalten.«
»Mrs. …« Mir fiel der Adelstitel ein. »Ich meine, Dame Matilda …« prompt geriet ich ins Stocken.
Sie legte die Gartenschere weg. »Nennen Sie mich bitte einfach Tilda. Der Titel ist so steif, und Matilda hat mich nie jemand genannt. Der Name ist ziemlich abschreckend, finden Sie nicht auch?« Sie lächelte.
Tilda Franklin war achtzig Jahre alt, aber die Schönheit des gutgeschnittenen Gesichts war auch jetzt noch im Schwung der hohen Wangenknochen und in der Linie der geraden, schmalen Nase zu erkennen. Die zarten, blaugeäderten Augenlider wirkten beinahe durchsichtig, die hellen Augen lagen tief in den Höhlen des klargemeißelten ovalen Gesichts. Sie hielt sich trotz ihres Alters kerzengerade. Neben ihr kam ich mir klein und plump und mopsgesichtig vor. Sie trug einen weichen Tweedrock, einen Kaschmirpullover, Perlen; ich einen langen schwarzen Rock und eine zerknautschte Wildlederjacke, die ich bis zu diesem Moment lässig elegant gefunden hatte. Ich hätte mein gutes Kostüm anziehen sollen.
Ich bat sie, mich Rebecca zu nennen, und wir gaben einander die Hand. Ihre Finger waren leicht, beinahe schwerelos, wie die Knochen eines kleinen Vogels. Wenn ich zu fest zugreifen würde, dachte ich, müßten sie brechen.
»Sie trinken doch eine Tasse Kaffee mit mir, Rebecca? Nach dieser langen Fahrt! Es ist wirklich lieb von Ihnen, daß Sie sich die Mühe gemacht haben.«
Sie erzählte mir von den Pflanzen im Wintergarten, bis die Haushälterin mit dem Kaffee und einem Teller selbstgebackener Plätzchen kam.
»Die Wachsblume ist schon in voller Blüte. Sie hat einen köstlichen Duft, aber leider nur nachts. Ich verstehe bis heute nicht, wieso manche Pflanzen nur zu einer bestimmten Tageszeit duften und sonst nicht. Patrick, mein Enkel, hat einmal versucht, es mir zu erklären.« Sie setzte hinzu: »Ich freue mich sehr, daß Sie sich zu diesem Gespräch mit mir bereit gefunden haben, Rebecca. Wissen Sie eigentlich, warum ich mir ausbedungen habe, daß Sie meine Biographie schreiben?«
»Ich vermute, Sie haben mein Buch gelesen«, antwortete ich unsicher.
Sie schüttelte den Kopf. »Ich muß leider gestehen, daß ich kaum noch lese. Meine Augen haben schrecklich nachgelassen. Aber ich sehe fern. Und ich habe mir Ihre Dokumentation angeschaut.«
Alles an ihr und um sie herum – ihre Erscheinung, dieses Haus, selbst die Kaffeetassen – zeugte davon, daß sie einer anderen Zeit angehörte. Ich konnte mir nicht vorstellen, daß sie im Wohnzimmer auf dem Sofa saß und mit der Fernbedienung die Programme durchzappte.
»Sie haben Mondschwestern gesehen?«
Sie nickte. »Ja. Und ein paar Tage später war ich in der Buchhandlung, um meiner Enkelin ein Geburtstagsgeschenk zu besorgen, und da fiel mir Ihr Name auf einem Buchumschlag ins Auge. Wenn das nicht Vorsehung ist!« Sie hielt einen Moment inne. »Ich habe Ihren Film sehr, sehr anrührend gefunden.«
Mit Bestürzung sah ich die Tränen in ihren Augen.
»Sehr anrührend und sehr intelligent. Keine unnötige Sentimentalität. Keine Effekthascherei. Sie haben sich ganz im Hintergrund gehalten und diese Frauen einfach erzählen lassen. Das hat mir sehr gefallen. Solche Zurückhaltung beweist Klugheit und ein Bewußtsein für die eigene beschränkte Wichtigkeit im größeren Rahmen der Dinge. Und sie beweist Gerechtigkeitsgefühl. Ich glaube an Gerechtigkeit, Rebecca.« Ihr Gesicht nahm einen anderen Ausdruck an, die hellen grauen Augen verdunkelten sich. »Die Menschen haben diese Frauen vergessen. Sie haben vergessen, wieviel Macht Männer wie Edward de Paveley besaßen. Niemand sollte über so viel Macht verfügen dürfen.«
»Wer ist – war – Edward de Paveley?«
»Er war mein Vater. Er hat meine Mutter, die in seinem Haus angestellt war, vergewaltigt, und ließ sie, als sie schwanger wurde, in ein Armenhaus mit Arbeitszwang einweisen. Von dort kam sie in eine Nervenheilanstalt in Peterborough.«
Ich war überrascht. Es war schwer zu glauben, daß diese stolze, elegante Frau aus so elenden Verhältnissen stammte.
»Man sagt mir nach, ich hätte ein interessantes Leben geführt«, fuhr Tilda fort, »aber mein Privatleben war mir immer heilig. Erst als ich neulich Ihren Film sah, kam mir der Gedanke, daß man mir das eher als Feigheit denn als Bescheidenheit auslegen könnte. Und danach habe ich mit mir selbst eine Vereinbarung getroffen: Ich werde meine Lebensgeschichte erzählen, damit die Geschichte meiner Mutter publik wird.«
Sie stellte ihre Tasse nieder. »Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich entschließen könnten, meine Biographie zu schreiben, Rebecca. Ich erwarte selbstverständlich nicht, daß sie mir sofort eine Antwort geben. Aber Sie werden darüber nachdenken, hoffe ich.«
Ich murmelte etwas Unverbindliches. Ich brachte es nicht fertig, ihr rundheraus zu sagen, daß ich nicht mehr schreiben konnte; daß Toby mir mit meiner Selbstachtung auch die Kreativität genommen hatte.
Sie faßte mein Schweigen als Zustimmung auf. »Darf ich Ihnen etwas mehr erzählen? Sowohl die Familie meiner Mutter – die Greenlees – als auch die de Paveleys lebten in Southam, einem Ort in den Fens von Cambridgeshire. Die kleinen Ortschaften in dieser ländlichen Gegend waren damals sehr einsam und abgelegen, kleine Welten für sich. Meine Mutter ist über Ely nie hinausgekommen, und selbst diese kurzen Fahrten zur Stadt waren eine Seltenheit. Ein reicher Großgrundbesitzer hatte in einer solchen Welt natürlich großen Einfluß.« Ihre Augen wurden schmal. »Die Familie meiner Mutter hat seit Generationen in Southam gelebt und gearbeitet. Meine Großmutter starb jung, und mein Großvater – der Vater meiner Mutter – war als Arbeiter bei den de Paveleys beschäftigt. Sie hatten zwei Töchter, Sarah war die ältere, Deborah die jüngere. Ihr kleines Arbeiterhaus gehörte der Familie de Paveley, und Wohnrecht hatten sie nur, solange mein Großvater für diese Familie arbeitete. Als er 1912 starb, verloren die Schwestern daher nicht nur den Vater, sondern auch das Zuhause. Deborah, die damals sechzehn war, ging bei den de Paveleys in Stellung; Sarah verließ das Dorf, sie wollte versuchen, anderswo ihr Glück zu machen.«
Als sie innehielt, warf ich einen kurzen Blick zum Fenster hinaus. Die Sonne hatte den Nebel aufgelöst. Vom facettierten Glas des Kristallüsters gebrochen, der von der Zimmerdecke herabhing, wanderte ihr Licht in regenbogenfarbenen Kringeln über die Wand.
»Ich weiß nicht genau, was geschah, sicher ist aber, daß Edward de Paveley meine Mutter vergewaltigt hat und sie vor die Tür setzte, als sich zeigte, daß sie schwanger war. Sie wußte nicht, wohin, und landete im Armenhaus. Ich vermute … ich vermute, meine Mutter hat de Paveley um Hilfe gebeten. Sie wird ihm gesagt haben, daß das Kind von ihm sei, und auf seine Unterstützung gehofft haben.«
Ich sah eine düstere, konturlose Landschaft, von schmalen geraden Wassergräben durchzogen. Ich sah eine junge Frau, deren beinahe noch kindlicher Körper von der Schwangerschaft entstellt war; und einen Mann – zu Pferd vielleicht oder am Steuer eines dieser kastenförmigen Automobile der Jahrhundertwende –, der anhielt, um mit ihr zu sprechen.
»Ich weiß nicht, was meine Mutter zu de Paveley sagte, aber er lehnte es ab, ihr zu helfen«, fuhr Tilda fort. »Im Mai 1914 brachte sie mich im Armenhaus zur Welt, unmittelbar danach wurde sie in die Nervenheilanstalt eingewiesen. Ich besitze eine Kopie der behördlichen Verfügung. Sie trägt die Unterschrift Edward de Paveleys. Er war der Bezirksrichter.«
Sie schwieg, und als ich die tiefe Traurigkeit in ihrem Blick sah, ahnte ich, was es sie gekostet haben mußte, mir, einer Fremden, diesen Blick in ihr Privatleben zu gestatten, das ihr bisher so heilig gewesen war. Aber dann veränderte sich plötzlich ihr Gesicht; es war, als hätte sie sich einen inneren Ruck gegeben.
»Ich bin im Armenhaus geboren«, sagte sie, »aber dann sofort in ein Waisenhaus gekommen. Uneheliche Kinder wurden ihren Müttern damals immer gleich nach der Geburt weggenommen. Adoptiert wurden solche Kinder selten; man glaubte, die ›Sittenlosigkeit‹ der Mütter würde sich auf sie vererben.«
Das ungewollte Kind, das die Wunde der eigenen Geburt zu heilen suchte, indem es sein Leben der Rettung anderer verlassener Kinder weihte. Eine schöne runde Geschichte, dachte ich.
»Ich lebte ungefähr ein Jahr lang in dem Waisenhaus. Dann kam Sarah.« Tilda lächelte. »Meine Tante Sarah. Ich habe ein Bild von ihr.«
Sie schlug das Album auf, das auf dem Tisch lag. Ich sah mir das Foto an. Das Gesicht, das mir entgegenblickte, zeigte diesen feierlich ernsten, ein wenig befangenen Ausdruck, den man von so vielen Porträtaufnahmen aus den frühen Jahren des Jahrhunderts kennt. Vermutlich wurde er von dem erzwungenen langen Stillsitzen vor der Kamera hervorgerufen. Tildas Tante Sarah trug eine hochgeschlossene Bluse über einem üppigen, formlos wirkenden Busen. In ihrem reizlosen, kräftigen Gesicht konnte ich keine Spur Tildas erkennen.
»Deborah war die Hübsche, Sarah die Kluge«, sagte Tilda, als hätte sie meine Gedanken gelesen. »Leider habe ich von Deborah kein Foto.«
»Sie sagten, daß Sarah nach dem Tod ihres Vaters fortging. Wohin, wissen Sie das?«
»Ach, so wie ich Sarah kannte, war sie wohl bald hier, bald dort. Sie hielt es nie lange an einem Ort aus. Als ich nach Cambridgeshire zurückkam, war meine Mutter schon auf den Tod krank. Das Leben in den Armenhäusern und Nervenheilanstalten war hart, und Deborah war nie besonders kräftig gewesen.«
Tilda schlug das Album zu. Flüchtig berührte ihre magere Hand die meine. »Sarah erfuhr erst, was ihrer Schwester zugestoßen war, als sie ins Dorf zurückkam. East Anglia war zu Beginn des Jahrhunderts praktisch aus der Welt. Kaum jemand hatte Telefon, und meine Mutter, die mit zehn Jahren die Schule abgebrochen hatte, um für ihren Vater zu sorgen, konnte kaum lesen und schreiben. Nun, kurz und gut, Sarah besuchte meine Mutter im Asyl und konnte kurz vor ihrem Tod noch mit ihr sprechen. Deborah berichtete ihr, was passiert war. Manchmal … manchmal stelle ich mir vor, was in Sarah vorgegangen sein muß. Wie tief ihr Zorn und ihre Schuldgefühle gewesen sein müssen.«
»Schuldgefühle?«
»Ja, weil sie nicht da war, als ihre Schwester sie brauchte. Sarah war eine starke Frau, Rebecca. Sarah wäre eine Lösung eingefallen. Niemals hätte sie Deborah im Armenhaus enden lassen.«
»Und Sarah hat Sie dann adoptiert?«
»Ja. Sie begrub ihre Schwester und adoptierte ihre Nichte. Ich erinnere mich natürlich nicht an das Waisenhaus – ich war ja kaum ein Jahr alt, als Sarah mich dort herausholte. Aber sie hat nie vorgegeben, meine Mutter zu sein. Ich habe sie für diese Ehrlichkeit immer bewundert. Sobald ich alt genug war, um es zu verstehen, erklärte sie mir, daß ich das Kind ihrer jüngeren Schwester sei. Mehr sagte sie mir natürlich nicht.«
Dein Vater hat deine Mutter vergewaltigt. Unmöglich, eine solche Ungeheuerlichkeit zu erklären.
»Und wo haben Sie gelebt?« fragte ich.
»Überall in East Anglia und Südengland. In Suffolk, Norfolk, meistens in Kent. Sarah verdiente sich ihr Geld als Saisonarbeiterin auf dem Land.«
Ich lächelte. »Wie Tess von d’Urbervilles?«
»So ähnlich, ja. Im Sommer haben wir in Kent bei der Ernte und beim Hopfenpflücken geholfen, im Winter haben wir Näharbeiten angenommen. Meine Tante Sarah war im Nähen sehr geschickt, ihre Stiche konnte man überhaupt nicht sehen. Von ihr habe ich das Nähen gelernt. Von ihr habe ich überhaupt alles gelernt.«
»Sind Sie nicht zur Schule gegangen?«
»Doch, hin und wieder, wenn wir länger als ein paar Wochen in einem Dorf geblieben sind. Aber Schreiben und Lesen hat Sarah mich gelehrt, und sie war eine wahre Rechenkünstlerin. Wenn ich wirklich einmal zur Schule ging, wurde ich immer mehrere Klassen über meinem Jahrgang eingestuft.«
Das hörte sich nach einem bunten Zigeunerleben an, bis mir einfiel, daß Tilda im verhängnisvollen Jahr 1914 geboren, und ihre Kindheit in die hektischen, unsicheren zwanziger Jahre gefallen war. »Das muß manchmal sehr schwer gewesen sein«, sagte ich vorsichtig.
»O ja. Ich habe nie wieder in meinem Leben so sehr gefroren wie damals. Ich kann mich heute noch an die beißende Kälte erinnern, die sich in meine Hände und Füße hineingefressen hat. Und an die Wölkchen, die in die Luft aufstiegen, wenn ich morgens meinen ersten Atemzug tat. Und ich bin natürlich von anderen Kindern gehänselt worden. Weil ich anders war.«
Sie sprach ganz sachlich, ohne eine Spur von Wehleidigkeit. Sie saß noch immer so aufrecht wie die Frau auf der Sepiafotografie, die Tante, die sie aus dem Waisenhaus gerettet hatte.
»Ich bin ein bißchen müde«, sagte sie unvermittelt. »Ach, das Alter ist schon eine Last.« Sie wandte sich mir zu und sah mich mit ihren klaren grauen Augen an. »Möchten Sie mehr hören, Rebecca? Soll ich Ihnen von Jossy erzählen?«
»Jossy?«
»Jossy de Paveley. Edward de Paveleys Tochter.« Wieder veränderte sich ihr Gesicht unter dem Einfluß eines jener plötzlichen Stimmungswechsel, die, wie ich mit der Zeit lernte, typisch waren für sie. »Sie war meine Halbschwester …«
Als ihr Vater im Jahr 1918 verwundet wurde, betete Joscelin de Paveley jeden Abend darum, daß er sterben würde. Als er dann doch nach Hause zurückkehrte und sich auf Krücken von seinem Bentley zur Haustür schleppte, erfuhr Jossys kindlicher Glaube an Gott eine heftige Erschütterung, von der er sich nie wieder so recht erholte.
Zweifellos hatten die Kriegserlebnisse, der Verlust eines Beins in den letzten Monaten erbitterter Kämpfe und die ständige Bedrohung durch den Tod Eward de Paveley gezwungen, seiner eigenen Hinfälligkeit ins Auge zu sehen, aber auf sein despotisches Wesen hatte diese Erfahrung nicht mildernd gewirkt. Soweit Jossy sehen konnte, hatte dieser Krieg, der Europa für immer aus seiner selbstzufriedenen Beschaulichkeit gerissen hatte, nur eine bleibende Wirkung bei ihrem Vater hinterlassen: Er war nicht mehr so beweglich wie früher. Es war leichter, vor ihm davonzulaufen.
Jossys ganze Kindheit hindurch führten sie, ihr Vater und ihr Onkel Christopher im Verwalterhaus getrennte Leben, Planeten, die sich um einen gemeinsamen Mittelpunkt – das Gut und das Herrenhaus – drehten, ohne einander zu berühren. Onkel Christophers Sphäre waren die Felder, die Deiche und die Pachthöfe, Jossys Sphäre die Schule und das alte Kinderzimmer.
Das Haus der de Paveleys hieß allgemein das Herrenhaus. (Es hatte früher vielleicht einmal einen anderen Namen gehabt, aber der war lang vergessen.) Das nächste Dorf hieß Southam. Southam und das Herrenhaus waren auf kleinen, voneinander getrennten flachen Inseln schweren Lehmbodens erbaut. In feuchten Wintern leckte das Überschwemmungswasser an den Schoten und Sämlingen in Jossys Garten.
Jossys Leben war beherrscht von dem Bestreben, ihrem Vater aus dem Weg zu gehen, seinen verächtlichen Blick und den kalten Sarkasmus, der ihr die Tränen in die Augen trieb, zu meiden. Ab und zu jedoch kreuzten sich ihre Wege, jedes Mal mit katastrophaler Wirkung. Einmal wollte er ihr das Reiten beibringen. Die Lektion dauerte keine Stunde. Jossy hing wie ein Häufchen Elend im Sattel, während ihr Vater sie anbrüllte und mit der Reitgerte auf sein Holzbein einschlug. Einem anderen hätte sie vielleicht zu erklären versucht, daß sie das Pony zwar liebte, aber auch ein wenig Angst vor ihm hatte. Bei ihrem Vater, der vor nichts Angst hatte, hätte das nichts gefruchtet. Als ihr aufging, daß er vorhatte, das Pony, an dem sie nun schon hing, zu verkaufen, begann sie zu weinen, und das steigerte noch seine Wut. Die Gerte traf brennend ihre Hände an den Zügeln, und Edward de Paveley wütete gegen das Schicksal, das ihn mit einer Tochter geschlagen hatte, die eine Memme war.
In der Schule fühlte Jossy sich wohl, zu Hause hing ihr Wohlbefinden vom Erfolg ihrer Vermeidungsstrategien ab. Sie hatte ihr eigenes kleines Reich, das Kinderzimmer, wo sie mit ihren Puppen Schule spielte und Teekränzchen veranstaltete, und den Garten mit der alten Schaukel. Sie hatte den Schreibtisch ihrer Mutter im Damenzimmer, an dem sie Geschichten schrieb und zeichnete. Sie erfand sich eine Familie, malte Bilder von ihr. Sie waren drei Schwestern: Rosalie, die älteste, Claribel, die jüngste, und dazwischen Jossy selbst. Ihr Vater war tot, und ihre Mutter war ein verklärter Schatten.
Als Jossy ungefähr elf war, wurde ihr klar, daß ihr Vater nicht wieder heiraten würde. Zum Tee bei ihrer Freundin Marjorie in Ely hörte sie die Mutter des Mädchens zu einer anderen Frau sagen: »Ich habe Marjorie vorgeschlagen, die arme kleine Joscelin de Paveley einzuladen. Ich kannte Alicia, ihre Mutter. Ihr Vater wird nicht wieder heiraten, ich habe gehört, daß seine Kriegsverletzung es nicht zuläßt.« Jossy hatte die Ohren gespitzt, um mehr zu hören, aber Mrs. Lyons hatte die Stimme zu einem Flüstern gesenkt.
Es wunderte Jossy nicht, daß ihr Vater wegen seines Holzbeins nicht wieder heiraten wollte. Es war ein grausiges Ding. Der Klang seines unregelmäßigen Schrittes auf den Steinfliesen des Herrenhauses war der Klang des Schreckens. Sie hatte einmal gehört, wie die Köchin zu Nana gesagt hatte, das Bein des Herrn sei ganz oben an der Hüfte abgerissen worden; und ein andermal, als sie in einem Flur gestolpert war, war sie gegen das Holzbein ihres Vaters gestoßen. Es hatte sie gegraust, ein totes Ding, das an einem lebendigen Körper hing.
Jossy neigte zur Rundlichkeit, ihr Haar und ihre Augen bezeichnete sie selbst als schmutzig braun. Mit fünfzehn begann sie, ihr Haar mit Zitronensaft zu spülen, stand hinterher stundenlang vor dem Spiegel und schaffte es beinahe, sich einzureden, es würde heller.
Mit neunzehn ging sie von der Schule ab. Sie hatte zwei Anläufe genommen, die Abschlußprüfung zu machen, und war beide Male durchgefallen. Aber so erging es den meisten Mädchen an ihrer Schule, die ihr Vater als Bewahranstalt für die dummen Gänse aus reichem Haus bezeichnete. Sie erwartete, daß am Tag ihres Schulabgangs ein besonderes Ereignis davon künden würde, daß sie nun erwachsen war, eine junge Dame. Sie würde über Nacht zur Schönheit erblühen. Sie würde so souverän die Herrschaft im Haus übernehmen, daß selbst ihr Vater beeindruckt wäre. Und sie würde, natürlich, dem Märchenprinzen begegnen.
Der Märchenprinz war groß, dunkel und anmutig. Er saß so sicher und unerschrocken im Sattel eines Pferdes wie am Steuer eines Automobils. Er hatte eine geheimnisvolle, unergründliche Vergangenheit, und er liebte Jossy mehr als alles in der Welt. Sie würden einander unter romantischen Umständen begegnen: Um dem Trubel und der Hitze eines Balls zu entkommen, würde sie in den nächtlichen Park hinauswandern, und dort würde er sie das erste Mal sehen. Ihre Schönheit würde ihn augenblicklich in Bann schlagen. Sie würden allein durch die süß duftende Nacht tanzen, im milden Schein des Mondes blumengesäumte Pfade hinunterwirbeln …
Aber es änderte sich nichts. Mrs. Bradley und die Köchin führten weiterhin das Regiment im Haus, und Jossys Haar blieb trotz allen Zitronensafts hartnäckig schmutzig braun. Sie besuchte Tanzveranstaltungen und Feste bei Freunden, aber die jungen Männer waren tolpatschig, hatten picklige Gesichter und redeten nur von Kricket und Automobilen. Nana fuhr fort, Jossys Kleider zu schneidern, die keine Ähnlichkeit mit den raffinierten hautengen Satinroben in den Journalen hatten, die Jossy sich regelmäßig kaufte. Ihre Tage verliefen im altgewohnten Wechsel zwischen Kinderzimmer, Damenzimmer und Garten, und es gab nicht einmal mehr Schulferien, um das Einerlei zu unterbrechen. Ihre Ausflüge führten sie in die Kirche oder zu ihrem Vetter Kit ins Verwalterhaus. Die Tage zogen sich endlos. Doch sie hielt an ihrem Glauben fest: Sie wußte, daß er kommen würde. Zwei Jahre nach ihrem letzten Schultag wartete Jossy de Paveley immer noch auf den Märchenprinzen.
Ich nahm die Finger von den Computertasten und lehnte mich zurück. Ich war erschöpft und fühlte mich trotzdem wie neugeboren. Vier Seiten! Ich war von Oxfordshire nach Hause gefahren und hatte, ohne auch nur den Mantel auszuziehen, vier Seiten am Stück geschrieben. Und es war ganz leicht gewesen. Es war, als hätte sich das Seil um meinen Hals, das monatelang jeden Satz abgewürgt hatte, plötzlich gelockert.
Ungewöhnlich war, daß ich das Gehörte in Form einer romanhaften Erzählung niedergeschrieben hatte. Normalerweise brachte Rebecca Bennett nur sorgfältig überprüfte Fakten zu Papier, sachlich und objektiv. Aber die Vergangenheit ist eben nicht mit Sicherheit zu erfassen, sie schillert wie die Lichtreflexe des Kristallüsters in Tilda Franklins Wintergarten.
Später traf ich mich mit Charles Lightman. Bei Risotto und einer Flasche Pinot Grigio setzte er mir seine neueste Idee auseinander.
»Die Veränderung der Arbeitswelt, das Ende der industriellen Revolution, verstehst du, Darling. Man kann zeigen, wie ähnlich das Leben des modernen Telearbeiters dem seiner vorindustriellen Vorfahren ist.« Er gestikulierte mit seiner Gabel. »Früher kriegten die Leute von der ewigen Arbeit am Webstuhl chronische Sehnengeschichten oder so was und kamen ihr Leben lang nicht über ihren Heimatort raus.« Wieder stach die Gabel zu. »Heute kriegen sie HWS-Syndrom und kommen höchstens raus, wenn sie sich ein Auto leisten können. Ist doch gut, oder?«
»Ich dachte, du wolltest was über die Internate machen«, sagte ich. »Du hast doch …«
»Das Thema ist ziemlich abgelutscht, findest du nicht?« Charles zuckte wegwerfend die Achseln. »Das hier wäre wesentlich relevanter.«
Ich berichtete ihm meine Neuigkeiten, und er brauchte einen Moment, um den Namen Tilda Franklin einzuordnen.
»Ach, die Retterin der Witwen und Waisen«, sagte er dann.
»Es waren nur Waisen.«
»Ist an dem Stoff denn genug dran für dich?«
Der Kellner schenkte uns Kaffee ein. Ich runzelte die Stirn. »Ich denke schon. Wenn das auch natürlich alles ziemlich lang her ist …«
»Na ja … Ellen Wilkinson … Es ist die Aufgabe des Biographen«, fügte Charles ziemlich sentenziös hinzu, »die Relevanz der Geschichte seiner Hauptfigur für die heutige Zeit herauszuarbeiten.«
»Ihrer Hauptfigur«, verbesserte ich automatisch. Ich dachte daran, mit welchem Schwung ich Jossys Geschichte niedergeschrieben hatte, die Worte waren mir förmlich aus den Fingern geflossen. Aber jetzt dämpfte schon wieder Furcht meine Hochstimmung. Vielleicht war das nur ein vorübergehendes Wiederaufflackern gewesen. Vielleicht würde sich das nächste Mal, wenn ich schreiben wollte, die Lähmung wieder einstellen.
»Und …?« hakte Charles nach.
»Und ich habe noch nie über eine lebende Person geschrieben. Ellen Wilkinson ist 1947 gestorben.«
Er zuckte die Achseln. »Aber von den Frauen in Mondschwestern sind noch welche am Leben.«
»Das stimmt.« Ich goß Sahne in meinen Kaffee. »Aber es kommt dazu, daß sie allem Anschein nach die reinste Heilige ist.«
Die Lebensgeschichte einer solchen Stütze der Gesellschaft zu schreiben, würde viel Zeit kosten und viel Frustration bedeuten. Tilda hatte selbst darauf hingewiesen, wie wichtig ihre Privatsphäre ihr war – welche Türen zu ihrem Leben würde sie mir verschlossen halten? Sie war alt und hinfällig, dennoch hatte ich hinter der Gebrechlichkeit eine große Kraft gespürt. Sie hatte den Aufstieg aus dem Armenhaus in dieses vornehme alte Landhaus geschafft, das ich heute besucht hatte. Einem schwachen Menschen wäre das nicht gelungen. Ihre Kraft faszinierte mich und rief gleichzeitig eine große Scheu hervor.
»Ja, ja, Heilige sind langweilig«, sagte Charles mitten in meine Gedanken hinein. »Darum ist ja Satan in Das verlorene Paradies die interessanteste Figur.«
»Weißt du, diese vielen geretteten Waisenkinder – diese Kinderzeichnungen, mit denen sie ihre Wände gepflastert hat – das alles wirkt wie eine Barriere. Ich frage mich, wie ich es schaffen soll, zu ihr selbst durchzudringen.«
Tildas Güte und Schönheit waren wie ein strahlender Panzer, vor dem ich schrumpfte und der sie unberührbar machte. Mein Blick würde nur den Glanz dieses Panzers einfangen, und ich würde meinem eigenen Spiegelbild nicht trauen können.
»Vielleicht«, meinte Charles verschmitzt, »entdeckst du ja doch noch irgendwas Pikantes. So ein richtig schönes klapperndes Skelett im Keller. Das wäre doch was, hm?«
Das Wochenende verbrachte ich bei Jane. Am Sonntag packten wir die Jungen warm ein und machten alle zusammen eine lange Wanderung. Winterstern blühte gelb in den Hecken, und Jack und Lawrie planschten vergnügt in Matsch und Pfützen. Jane klagte mir ihr Leid über das Einerlei ländlichen Lebens und die Unmöglichkeit, einmal eine Nacht durchzuschlafen, und ich erzählte ihr von Tilda Franklin.
»Besuch sie wieder, bleib im Gespräch mit ihr«, sagte sie sehr vernünftig. »Du hast doch nichts zu verlieren.«
Also rief ich am Montag morgen Tilda an und fuhr schon am Dienstag wieder zum Roten Haus. Wir saßen im oberen Wohnzimmer am Feuer. Der Raum war ursprünglich eine Sonnenterrasse gewesen: Ein großes, halbrundes Fenster blickte zum vorderen Garten hinaus und ließ die Sonne von allen Seiten herein. Hitze staute sich im Zimmer. Ich zog meine Kostümjacke aus und krempelte meine Ärmel hoch. Die Alten sind viel kälteempfindlicher.
Aber Tildas Stimmung hatte sich seit der vergangenen Woche verändert. Sie war reizbar und schwierig, wich meinen Fragen aus oder gab nur kurze Antworten. Sie schien über Nacht zarter und gebrechlicher geworden zu sein, und ihre Haut hatte die durchsichtige Blässe hohen Alters. Draußen fegte der Wind von einem vorausgegangenen Sturm abgerissene Äste und Blätter durch den Garten. Sein Pfeifen und das Knallen der Zweige, die gegen Fensterscheiben schlugen, schienen sie noch nervöser zu machen. Ich sprach sie auf Jossy an und auf Sarah Greenlees, aber sie blieb einsilbig und kurz. Hätte ich sie nicht in der Woche zuvor als eine Frau von großer Geradlinigkeit und Kultiviertheit kennengelernt, ich hätte ihre abwehrende Haltung als Ungezogenheit auffassen müssen. Ich verspürte Zorn und Enttäuschung. Die Biographie zu schreiben war schließlich ihre Idee gewesen, nicht meine.
Bemüht, den Tag irgendwie zu retten, bat ich sie, mir noch einmal das Fotoalbum zu zeigen. Ich blätterte ihr um, und sie betrachtete ohne Interesse die Bilder. Eine Aufnahme fiel mir besonders ins Auge, sie zeigte einen Mann und ein Kind von auffallender Schönheit. Gerade wollte ich Tilda fragen, wer die beiden seien, da hob sie den Kopf und sagte: »Kommt da nicht jemand den Weg herauf? Würden Sie mir sagen, wer es ist, Rebecca?«
Ich stand auf und schaute aus dem Fenster hinunter zum Fußweg zwischen den mächtigen Buchsbäumen. »Ein Mann … blond … ziemlich groß. Jung.«
»Patrick«, sagte Tilda und lächelte zum ersten Mal an diesem Tag. Ich erinnerte mich, daß sie bei meinem letzten Besuch einen Enkel namens Patrick erwähnt hatte.
»Patrick!« rief sie, als der Besucher die Tür zum Sonnenzimmer öffnete. »Warum hast du nicht vorher angerufen? Du hättest mit uns Mittagessen können.«
Er umarmte sie. »Ach, das war so eine plötzliche Eingebung. Ich mußte zu einem Mandanten in Oxford.«
Tilda wandte sich mir zu. »Ich möchte dich mit Miss Bennett bekannt machen. Rebecca, das ist mein Enkel Patrick Franklin.«
Wir tauschten einen Händedruck. »Ich habe heute morgen eine Karte von Dad bekommen«, berichtete Patrick seiner Großmutter. »Aus Ulan Bator.«
Tilda rümpfte die Nase. »Joshua muß doch immer die Gefahr herausfordern. Und so ganz unnötig.«
»Das liegt wohl in der Familie.«
Patrick Franklin trug Jeans und eine Lederjacke. Nach Mandantenbesuch sah das nicht aus, fand ich.
»Würdest du Joan bitten, uns eine Tasse Tee zu machen, Patrick? Oder hast du noch nicht gegessen? Joan würde dir sicher ein Omelett machen, wenn du möchtest.«
Ich sagte schnell: »Ich kann Ihrer Haushälterin Bescheid sagen, wenn ich jetzt gehe, Tilda.«
Sie drehte sich nach mir herum. »Aber Sie können doch jetzt nicht schon gehen, Rebecca! Wir haben ja noch gar nicht richtig angefangen.«
Ich hatte einige Mühe, meine Ungeduld zu unterdrücken. »Sie und Patrick haben sich bestimmt einiges zu erzählen …«
»Patrick und mir bleibt noch Zeit genug zum Reden. Es wäre wirklich albern, wenn Sie jetzt schon nach London zurückfahren würden. Die ganze Fahrt umsonst.«
Aber nach dem Tee nickte Tilda ein. Ihr Mund blieb hübsch geschlossen, die Augen zuckten hinter den geschlossenen Lidern, während sie träumte. Patrick Franklin legte ihr eine Decke über.
»Sie wird jetzt vielleicht zehn Minuten schlafen«, sagte er. »Es ist wahnsinnig heiß hier drinnen. Ich muß unbedingt eine Weile raus. Hat meine Großmutter Ihnen schon den Garten gezeigt, Rebecca?«
Der Garten des Roten Hauses, den ich bei meinem letzten Besuch vom Wintergarten aus gesehen hatte, lockte mit verwunschenen Wegen und überwachsenen alten Bäumen. Ich folgte Patrick hinaus. Es hatte aufgehört zu regnen, aber die Luft war feucht, und der Wind blies kräftig. »Tilda hat mir erzählt, daß Sie Schriftstellerin sind«, bemerkte Patrick, als wir die Stufen der Terrasse hinunterstiegen.
»Ich habe eine Biographie Ellen Wilkinsons geschrieben.«
»Nur das eine Buch?«
»Und eine Fernsehdokumentation.«
»Ach ja, über die Nervenheilanstalten. Sind Sie Journalistin?«
Er schien erleichtert, als ich den Kopf schüttelte. »Die Wilkinson-Biographie war eine Fortführung meiner Magisterarbeit«, erklärte ich. »Ich habe verschiedene Artikel für History Today geschrieben.« Das hörte sich alles ziemlich dürftig und wenig beeindruckend an. Von meiner Tätigkeit als Nachhilfelehrerin sagte ich nichts; das hätte zu armselig geklungen.
Unter tropfenden Bäumen, an rotem Hartriegel mit gekalkten Stämmen vorbei gingen wir durch den Garten. Krokusse schoben violett und goldgelb ihre Köpfe aus der Erde. Auf gewundenen, mit Ziegeln ausgelegten Wegen gelangten wir zu einer kleinen kreisrunden Lichtung, die mit moosbewachsenen Backsteinen in spiraliger Anordnung gepflastert war. Eine steinerne Nymphe, von Flechten dunkel gefleckt, stand auf einem Sockel in der Mitte des Rondells.
»Ich hätte nie gedacht, daß Tilda einmal ihre Biographie schreiben lassen würde.« Patricks Hand ruhte auf dem Kopf der Nymphe. »Im Lauf der Jahre haben immer wieder Verlage bei ihr angefragt, aber sie hat sie alle abgewiesen.«
Ich sagte ihm klipp und klar, wie ich zu dem Vorhaben stand. »Es ist noch nichts entschieden. Tilda hat mich zwar gebeten, die Biographie zu schreiben, aber ich bin mir noch nicht sicher.«
»Und warum nicht?«
»Es ist eine große Verpflichtung. Ich muß erst sicher sein, daß ich die Richtige für diese Aufgabe bin.«
Patricks Augen waren von einem tieferen Blau als die Tildas. Ein kleines Lächeln spielte um seine Mundwinkel. »Tilda scheint aber fest zu glauben, daß Sie sie übernehmen werden. Ich muß allerdings zugeben, daß ich erleichtert wäre, wenn Sie ihr einen Korb gäben. Ich habe versucht, sie von der Idee abzubringen, aber sie ist manchmal so störrisch wie ein Esel.«
Verärgert fragte ich mich, ob dies der Grund für Tildas heutige veränderte Haltung war. Hatte die ungebetene Einmischung ihres Enkels Bedenken wachgerufen? »Was haben Sie denn dagegen? Liegt es an meiner Person? Bin ich Ihnen nicht renommiert genug?« Ich wußte, daß mein Ton sarkastisch war.
Wieder das kleine Lächeln. »Sie sind sicher so gut wie jeder andere. Vielleicht besser als die meisten.«
Ich wußte nicht, was ich von dieser Antwort halten sollte. Ein Kompliment war sie jedenfalls nicht. »Ja, aber …«
»Tilda ist alt und schwach. Sie will das nicht glauben, aber es ist so. Ich habe Angst, das alles wird ihr zuviel werden. Die ganze Vergangenheit wieder aufzuwühlen, noch einmal zu durchleben. Sie hat in vieler Hinsicht ein schweres Leben gehabt.«
»Sind Sie darum heute hergekommen? Um mich abzuwimmeln?«
Der Blick, mit dem er mich ansah, war kalt. »Ich bin hergekommen, um Sie unter die Lupe zu nehmen.« Seine Schroffheit wirkte wie eine kalte Dusche.
Er machte kehrt, um zum Haus zurückzugehen, und ich folgte ihm, mußte laufen, um mit ihm Schritt halten zu können.
»Ich könnte mir vorstellen, daß das verdammt harte Arbeit wird«, bemerkte er, halb nach rückwärts gewandt, und die Worte wurden vom Wind fortgerissen. »Meine Großmutter ist nämlich nicht gerade sehr mitteilsam.«
»Es gibt ja auch noch andere Quellen. Tagebücher, Zeitungsartikel, die Familie …«
Er lachte. »Na, da wünsche ich Ihnen viel Vergnügen!«
»Wie meinen Sie das?« keuchte ich, immer noch hinter ihm herlaufend.
»Einige von uns sind ziemlich unstete Gesellen, immer auf Wanderschaft. Und wir sind eine sehr große Familie, wenn Sie alle Adoptiv- und Pflegekinder mit einbeziehen. Und jeder hat seinen eigenen Kopf.«
Ich hatte den Eindruck, daß er es darauf anlegte, mich zu reizen. Der Blick, mit dem er mich ansah, war eine einzige Herausforderung. Es war teuflisch, daß er so gut aussah. Ich war mir seiner Nähe bewußt und zugleich einer prickelnden Erregung. Ein ähnliches Gefühl hatte ich gehabt, als ich mit der Arbeit zu Mondschwestern angefangen hatte … als ich Toby das erste Mal begegnet war. Wütend auf mich selbst, drängte ich mich durch Brombeergestrüpp und Waldrebe und übergoß Patrick mit einem Tropfenschauer.
Tilda war wach, als wir ins Sonnenzimmer zurückkamen. Das Fotoalbum lag aufgeschlagen vor ihr.
»Rebecca, das ist Daragh«, sagte sie, als wollte sie mich mit dem Mann auf dem Foto bekannt machen, das mir zuvor bei der Durchsicht des Albums aufgefallen war. Daragh hatte dunkles, unregelmäßig geschnittenes Haar, und seine tiefliegenden, ein wenig schräggeschnittenen Augen lachten mir über die Jahre hinweg entgegen. Er hatte ein ungewöhnliches Gesicht, unschuldig und räuberisch zugleich im Ausdruck.
»Zunächst einmal muß ich klarstellen«, begann Tilda zögernd, »daß ich natürlich vieles nicht mit Sicherheit weiß. In vielen Dingen kann ich nur raten und vermuten. Teile von Daraghs Geschichte … von Jossys … Aber ich habe vierzig Jahre lang Zeit gehabt, darüber nachzudenken, wie es gewesen sein könnte … wie es wahrscheinlich gewesen ist …«
»Natürlich«, stimmte ich aufmunternd zu. »Und ich kann nur versuchen, die Bruchstücke aufzugreifen und zu einem Bild zusammenzufügen. Aber einiges wird unweigerlich immer Vermutung bleiben.«
Tilda nickte nachdenklich. »Ja«, sagte sie vage. »Ja …« Dann wurde sie energischer. »Patrick, du mußt uns jetzt in Ruhe arbeiten lassen. Sieh doch mal nach dem Wasserhahn in der Spülküche. Er tropft. Dichtungen sind im Unterschrank. Sie zeigte sich wieder bestimmt und entschlossen. Dennoch hatte ich den Eindruck einer gewissen gespielten Forschheit. Es war, als hätte sie einen inneren Kampf abgeschlossen und wäre endlich zu einer Entscheidung gelangt. Ich schluckte meinen Ärger über Patrick Franklin hinunter und bemühte mich, meine Gedanken auf die Vergangenheit zu konzentrieren.
»Ich möchte Ihnen erzählen«, begann Tilda, »wie es dazu kam, daß Sarah und ich uns in den Fens niederließen. Damals wußte ich natürlich nicht, daß ich mit den de Paveleys verwandt war. Sarah hat mir nie etwas von meinem Vater erzählt, und ich habe sie nie gefragt – so etwas tat man damals einfach nicht. Man respektierte die Älteren. Nun, wie dem auch sei, Tante Sarah teilte mir mit, daß sie ein kleines Haus in Southam gemietet hatte.«
Southam, erinnerte ich mich, war das Dorf in den Fens, wo die de Paveleys lebten.
Tilda war sichtlich aufgewühlt. »Sie müssen bedenken, Rebecca, daß Sarah zwei Gründe hatte, Edward de Paveley zu hassen. Er hatte ihr die Schwester und das Zuhause genommen.«
»Und trotzdem ist sie dorthin zurückgekehrt, an einen Ort, wo sie ihm jeden Tag begegnen konnte?«
»Er war damals schon krank. Wie viele Männer seiner Generation hat sich Edward de Paveley von den Greueln des Kriegs nie wieder richtig erholt. Und das Herrenhaus war ja mehr als anderthalb Kilometer vom Dorf entfernt.« Tilda blätterte im Album, hielt dann plötzlich stirnrunzelnd inne. »Sarah veränderte sich, als wir wieder in Southam lebten. Sie war immer anders gewesen, unkonventionell, aber als wir in unser kleines Haus zogen, das Long Cottage, wurde sie praktisch zur Einsiedlerin. Sie lehnte es ab, mit den Leuten im Dorf zu verkehren. Heute weiß ich natürlich, warum, aber damals verstand ich es nicht.« Sie blätterte weiter. »Da«, sagte sie und schob mir das Album über den Tisch zu. »Das war unser Haus.«
Die Schwarzweißaufnahme zeigte ein niedriges kleines Backsteinhaus mit einem Reetdach.
»Es war früher einmal ein Bauernhaus gewesen, aber der größte Teil des Hofs war verkauft worden. Trotzdem hatten wir immer noch fast einen Morgen Land. Ich fand es herrlich. Im Frühling, wenn die Apfelbäume blühten, war es besonders schön.«
Ich versuchte, mir Tilda vorzustellen, wie sie damals gewesen sein mußte, hellhaarig, mit grauen Augen und klarem Gesicht, in einem dieser Kleider mit fallender Taille, wie sie die jungen Mädchen zwischen den Kriegen zu tragen pflegten. »Wie alt waren Sie?«
»Ich war siebzehn. Sarah und ich sind Ende 1931 nach Southam gezogen.«
Es klopfte, und Patrick schaute zur Tür herein. Ich sah auf meinen Block hinunter.
»Ich habe den Wasserhahn repariert«, sagte er, »und Joan hat Kaffee gemacht.«
Tildas liebevoller Blick folgte ihm, als er das Tablett ins Zimmer trug und auf den Tisch stellte. Ich sah rasch auf meine Uhr, es war schon vier. Für sechs hatte ich mich mit einer Freundin zum Essen verabredet.
Ich lehnte die Einladung zum Kaffee dankend ab und verabschiedete mich. Tilda sagte: »Das nächste Mal erzähle ich Ihnen von Daragh.«
Ich spürte, daß Patrick mich ansah, doch ich wich seinem Blick aus. Aber meine Entscheidung stand nun fest. In meinem Kopf bildeten sich schon die ersten Sätze; am liebsten hätte ich auf der Stelle angefangen. Tildas Geschichte hatte mich in ihren Bann geschlagen, mich mit so feinen Fäden eingesponnen wie die Spinnen die Buchsbäume im Garten des Roten Hauses.
Als ich in meinen Wagen stieg, störten mich auf einmal der kühle graue Kunststoff im Inneren, die vielen Hebel und Knöpfe des Armaturenbretts, der Wust leerer Chipsbeutel und Saftbehälter. Sie schienen aus einer anderen Zeit, einer anderen Welt zu sein.
2
DARAGH CANAVAN BRACH so bald es möglich war von Liverpool nach London auf. In Liverpool waren zu viele Iren.