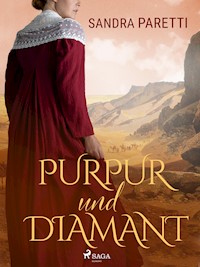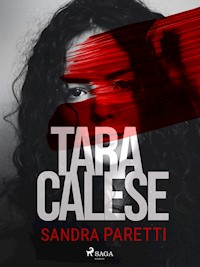Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Schiffsreise, die eine überraschende Wendung nimmt!Mit einem Luxusdampfer will die Kronprinzessin Cecile im Juli 1914 von New York nach Bremerhaven reisen. Als die Fahrt beginnt, ahnt niemand, dass das Schiff niemals in Bremerhaven ankommen wird. Noch bevor es den Hafen erreicht, erfährt der Kapitän, dass in Europa ein großer Krieg ausgebrochen ist. Kapitän Polack will seine Cecile auf keinen Fall in Gefahr bringen, weshalb er im Handumdrehen umkehrt und die Passagiere nach Maine bringt. In Bar Habor angekommen verändert die Ankunft des Schiffes die ruhige Routine des Örtchens und somit auch das Leben der Bewohner für immer. Sandra Paretti erzählt die Geschichte eines Sommers, eines Krieges und des Aueinandertreffens ungleicher Menschen.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sandra Paretti
Das Zauberschiff
Saga
Das Zauberschiff
Copyright © 2022 by Helmut and Anka Schneeberger, represented bei AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de)
Originally published 1977 by Droemer Knaur Verlag, München
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1977, 2022 Sandra Paretti und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788728469453
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
The Liner, She’s a Lady.
Rudyard Kipling
Freitag, 31. Juli 1914
Das Schiff fuhr hellerleuchtet durch die Nacht; es hielt Kurs auf Osten, genau dorthin, wo die Dunkelheit am tiefsten war. Der Mond stand steuerbord, fast ein Vollmond.
Das stetige Fallen und Steigen des Bugs war auf der Brücke kaum zu spüren; nicht Wasser schien das Schiff zu durchschneiden, sondern Nacht und Ewigkeit. Das Meer teilte sich von selbst, als wäre das Schiff nur ein Blendwerk der Nacht, nicht wirklicher als sein eigenes Spiegelbild auf der dunklen Wasserfläche – beide Schiffe in ihrem funkelnden Lichterglanz Zauberei.
Auf der Brücke der kronprinzessin cecilie brannte kein Licht; nur rund um den beleuchteten Instrumententisch herrschte ein gedämpftes Halbdunkel. Der Mann, der vorne an der Glasfront stand und über das Vorderschiff und den Bug wegblickte, war ein Hüne. Seine Kapitänsmütze berührte fast die Decke. Den kälteren Temperaturen angemessen, die in diesem Breitengrad herrschten, trug er die Uniform aus dunkelblauem Wolltuch. Die Jacke spannte sich über seinem Rücken. Ein paar bunte Konfetti lagen auf seiner linken Schulter. – Die Ankunft im ersten europäischen Hafen und damit das traditionelle Kapitäns-Dinner stand noch bevor; aber das Geschäft an Bord, das die dabei unentbehrlichen Artikel führte – Konfetti, Luftschlangen, Papphütchen –, hatte heute bereits mit dem Verkauf begonnen, und eine der Damen am Kapitäns-Tisch hatte sich nicht bis morgen gedulden können . . .
Außer Charles Polack, dem Kapitän, waren noch fünf andere Männer auf der Brücke. Sie alle kannten Polack lange, und die Blicke, die sie sich hinter seinem Rücken zuwarfen, drückten Verwunderung aus, eine gewisse Unruhe. Es ging auf elf Uhr, und zu dieser Stunde gab es für den Kapitän keinen Grund, auf der Brücke zu sein. Der Kurs des Schiffs für die Nacht war festgelegt, ebenso die Geschwindigkeit. Es gab hier nichts zu tun für ihn – warum also sollte er den Speisesaal verlassen, er, der sonst das Dinner mit den Damen an seinem Tisch nur zu gern bis lange nach Mitternacht ausdehnte?
Vielen Kapitänen auf den großen Passagierschiffen im Nordatlantikverkehr war der gesellschaftliche Teil ihres Berufs eine Last. Nicht für Charles Polack. Er führte nicht das schnellste Schiff, nicht das luxuriöseste, und doch zählte die cecilie unbestritten zu den beliebtesten auf der goldenen Route des Nordatlantiks. Die Passagiere liebten ihn, diesen schnauzbärtigen Riesen, vor allem die Amerikaner. Wenn sie im New Yorker Büro des Norddeutschen Lloyd ihre Buchungen machten, verlangten sie nicht etwa das Schiff, den Doppelschraubenschnelldampfer kronprinzessin cecilie – das war für amerikanische Zungen sowieso unaussprechbar. Sie fragten einfach: »Wann fährt Kapitän Polack nach Europa?« Es gab Passagiere, die ihm seit zwanzig Jahren die Treue hielten und auf allen seinen Schiffen mit ihm gefahren waren. Für sie war er »Papa Polack«, oder einfach »Charly«.
Er war einer der besten und erfahrensten Kapitäne im Nordatlantikverkehr. Er hatte Kunststücke fertiggebracht, die in die Lehrbücher der Seefahrt aufgenommen wurden. Wenn es sein mußte, stand er achtundvierzig Stunden auf der Brücke. Bei einem Dinner bewies er dieselbe Ausdauer, und es war nicht einfach, ihn loszueisen, wenn er erst einmal bei den Nachspeisen und seinem geliebten Kosakenkaffee angelangt war. Diese Vorliebe war kurios bei einem Mann wie Polack. Er konnte Glas um Glas davon trinken, gut gelaunt, zurückgelehnt in seinen Sessel am Kapitänstisch im großen, prunkvollen Speisesaal der I. Klasse. Kosakenkaffee und dazwischen Erdbeereis. Warum war er heute nicht sitzen geblieben?
Von den Männern auf der Brücke kannte ihn niemand besser als Pommerenke, sein persönlicher Steward, sein »Tiger« in der Marinesprache. Die beiden Männer waren seit dreißig Jahren zusammen, davon sechsundzwanzig bei Lloyd, und so spürte Pommerenke mehr noch als die anderen die Spannung, die von der Gestalt des großen Mannes ausging. Polack hatte kein Wort gesprochen, seit er die Brücke betreten hatte. Er stand immer noch an derselben Stelle, die Spitzen der schwarzen Schuhe auf dem polierten Teakholz, die Absätze auf dem roten Läufer. Das Konfetti auf der linken Schulter störte Pommerenke mehr als alles andere; er war abergläubisch, und dieses Konfetti, voreilig und verfrüht gestreut, weckte böse Vorahnungen in ihm. Am liebsten hätte er die Hand ausgestreckt und es weggefegt. Er trat einen Schritt näher. »Kaffee?« fragte er.
Auf der Brücke wurde stets ein tiefschwarzes Spezialgebräu für Polack bereitgehalten. Es geschah selten, daß er es ablehnte. Doch diesmal schien der Kapitän die Frage nicht einmal gehört zu haben.
»Das Nachtglas«, sagte er und streckte die Hand aus. Pommerenke beobachtete ihn, wie er es mit beiden Händen hob und für seine Augen einstellte. Aber was gab es zu sehen, da draußen in dem Dunkel, das auch für das Glas undurchdringlich sein mußte?
»Irgend jemand sonst . . . Kaffee?« fragte Pommerenke aufmunternd.
Die Männer vor den Instrumenten, in der schwachen Beleuchtung von unten einander seltsam ähnlich, wechselten Blicke, aber keiner bejahte die Frage. Das Schweigen hielt an, unterbrochen nur von den gewohnten Geräuschen des Schiffs, dem leisen Ächzen beim Steigen und Fallen des Rumpfs, dem kaum vernehmbaren Ausschlag des Ruders, dem Vibrieren der Motoren, der fernen Musik, die manchmal von den Gesellschaftsräumen bis zu ihnen heraufdrang.
Um so lauter klangen die Schritte, die sich auf dem Niedergang näherten, und die Rollen der Eisentür, die jetzt an der Seite der Brücke aufgeschoben wurde. Simoni, der Funker der cecilie , zögerte angesichts der schweigsamen Gestalten. Polack nahm das Glas von den Augen; er hatte das Kommen des Funkers gehört, und in der Scheibe vor sich, die wie ein dunkler Spiegel wirkte, sah er auch die Gestalt Simonis. Aber er wandte sich nicht um. Pommerenke schien es sogar, als würde sein Rücken noch breiter und abwehrender.
Simoni, der Funker, stand irritiert da und blickte auf das weiße Blatt in seiner Hand. Er kam nicht oft auf die Brücke; meist schickte er eintreffende Kabel durch einen Boten herauf, und während die Stille um ihn andauerte, wünschte er, auch diesmal hätte er es so gehalten und hätte sich nicht hinreißen lassen, selber den Weg zu machen. Als er endlich sprach, klang seine Stimme weniger alarmiert als vielmehr entschuldigend. »Eine Nachricht für den Kapitän.« Er vermied es, die große stumme Gestalt selber anzusprechen. »Dringend und vertraulich.« Polack wandte sich langsam um, und das allein genügte, um den Männern das Gefühl zu geben, daß ihre düsteren Gedanken reine Hirngespinste waren. Selbst wenn er ernst war wie jetzt, hatte Polacks Gesicht etwas, das Optimismus ausstrahlte. Es waren vor allem die Augen, lebenslustige Augen, umgeben von vielen Fältchen, in denen immer ein Schmunzeln zu nisten schien. Er gab das Glas dem 3. Offizier zurück und nahm aus der Hand des Funkers das weiße Blatt entgegen, ohne allerdings einen Blick darauf zu werfen, als interessiere ihn der Inhalt nicht im mindesten.
»Ich nehme jetzt einen Kaffee«, sagte er. »Hoffentlich ist er s-teif genug, Pommerenke.« Er sprach das »s-teif« wie ein Mann von der Waterkant.
»Steif und heiß wie der Teufel, Käpt’n«, kam von Pommerenke die Antwort. »Irgend jemand sonst noch Kaffee?« Seine Stimme und seine Miene drückten Erleichterung aus. Drei Männer meldeten sich gleichzeitig, und der Duft des Kaffees verbreitete sich auf der Brücke. Simoni stand immer noch da, den Blick erwartungsvoll auf Polack gerichtet; der chiffrierte Text der Nachricht machte ihm Kopfzerbrechen; das war der Grund, warum er das Kabel persönlich überbracht hatte. Aber als auch jetzt keine Reaktion erfolgte, ja, als Polack sich abwandte und auf die Tür im Hintergrund zuging, verließ auch der Funker die Brücke; und obwohl er beruhigt war, daß er die Bedeutung der Nachricht offensichtlich überschätzt hatte, empfand er fast etwas wie Enttäuschung.
Polack hatte die Tür zur Navigationskabine geöffnet. Er mußte sich bücken, um einzutreten. Die cecilie war nicht für ihn gebaut worden; er hatte das Schiff erst vor drei Jahren übernommen, von einem Kapitän, den er um zwei Köpfe überragte.
Polack knipste die Lampe über dem Tisch an, auf dem die Seekarten ausgebreitet waren. Pommerenke, der ihm gefolgt war, stellte ihm eine zweite Tasse mit Kaffee hin. Das Kabel, ein gelber Streifen, der auf ein weißes Blatt geklebt war, lag unmittelbar im Lichtschein der Lampe, aber Pommerenke machte nicht den Versuch, die Nachricht zu entziffern, sondern musterte nur das Papier mit einem feindseligen Blick.
»Gestatten Sie?« Er konnte sich nicht länger zurückhalten, jetzt, wo sie allein waren, und fegte Polack das Konfetti von der Schulter.
»Diese amerikanischen Damen . . .«, Polack lächelte, »sind mit Sechzig noch Backfische.«
»Gloria Linzee ist weit von den Sechzig entfernt.«
»Schön, du hast recht wie immer, aber wo steht geschrieben, daß der Kapitän nur ältere Jahrgänge an seinen Tisch bitten darf.« Er war froh, eine Bemerkung machen zu können, die nichts von seiner wahren Stimmung verriet; es war ohnehin schwer, Pommerenke hinters Licht zu führen, was seine Stimmungen betraf. Das Gute daran war, daß er ihm auch nicht zu sagen brauchte, wenn er allein gelassen werden wollte. Auch jetzt verstand ihn der »Tiger« ohne ein Wort und zog sich zurück.
Charles Polack war ein Mann, der nicht an zwiespältige Gefühle gewöhnt war; er haßte diesen Zustand, und wenn möglich beendete er ihn schnellstens: Ein Schiff und ein Mann hatten s-tatisch richtig bes-timmt zu sein – das war die Devise, nach der er lebte.
Er strich die Meldung glatt, beschwerte die aufgerollte Ecke. Der chiffrierte Text war kurz, mit einem Blick zu lesen:
erhard an blasenkatarrh erkrankt, siegfried
Obwohl er die Bedeutung ahnte, fand er die Worte lächerlich. Der Dechiffriercode war ihm vor drei Tagen, kurz vor dem Auslaufen in New York, ausgehändigt worden. Es war ein seltsamer Moment gewesen, als der Überbringer, ein Marine-Attaché der Deutschen Botschaft, ihm das versiegelte Kuvert in die Hand gelegt hatte; trotz der kursierenden Gerüchte über einen drohenden Kriegsausbruch in Europa hatte Polack die Gewichtigkeit, mit der es geschah, übertrieben gefunden, und nachdem das Kuvert im Safe verschwunden war, hatte er es vergessen; das heißt, er hatte sich befohlen, es zu vergessen . . .
Schon beim Auslaufen von Bremerhaven, westwärts zur Fahrt nach New York, am 15. Juli, hatte er den Vorsatz gefaßt, das Gerede über einen bevorstehenden Krieg zu ignorieren. Wie viele Kapitäne war er ein unpolitischer Mann. Sicher, er war Deutscher, aber seine eigentliche Heimat war das Meer; sein eigentliches Zuhause war sein Schiff; und seine eigentliche Nationalität, das war die Reederei, deren Emblem – Anker und Schlüssel – er auf dem Rockaufschlag trug. Ein Krieg war nicht gut für die Seefahrt, nicht gut für Lloyd, für niemanden gut.
Mit jedem Tag mehr, mit jeder Meile Ozean mehr zwischen der cecilie und Europa, hatten die Gedanken an Krieg tatsächlich an Gewicht verloren, und in New York schließlich hatten sie sich fast ganz verflüchtigt: Irgendein österreichisches Thronfolgerpaar, das ermordet worden war, irgendwo weit weg auf dem Balkan; in New York, mit mehr als dreitausend Meilen Atlantik zwischen sich und Europa, hatte man für dieses Ereignis nur ein Lächeln.
Und noch etwas hatte dazu beigetragen, Polacks Sorgen zu zerstreuen. In Bremerhaven hatte man für die Rückfahrt der cecilie mit einem leeren Schiff gerechnet. Genau das Gegenteil war eingetreten: Unbeeindruckt hatten die Amerikaner ihren sommerlichen Europatrip gebucht. Polack hatte sich, was er selten tat, vom Oberzahlmeister die Passagierliste zeigen lassen: Die vertrauten Namen, die jeden Sommer wiederkehrten! Seine getreue Gefolgschaft, die Jahr für Jahr auf seinem Schiff den Atlantik überquerte, vollzählig!
Die Namensliste der I. Klasse las sich wie ein »Who’s who« der oberen Zehntausend. Ein Präsidentensohn, Senatoren, Bankiers, und der Damenflor, die Creme der reichen Witwen, und die heiratsfähigen Töchter der großen Familien, in denen man auf Schwiegersöhne mit einem europäischen Adelstitel Wert legte. Sie alle glaubten nicht an Krieg, sondern machten sich wie eh und je auf zur »Grand Tour«: Shopping an der Place Vendôme und auf dem Faubourg St. Honoré; eine Audienz beim deutschen Kaiser in Potsdam; eine Fahrt auf dem Rhein, ein Besuch in Bayreuth. Zum obligatorischen Programm gehörte weiter: der Louvre, der Prado, eine Kahnfahrt in der Blauen Grotte, eine Besteigung des Ätna, ein Eselsritt nach Amalfi, das Füttern der Tauben auf dem Markusplatz in Venedig, das Einritzen der Namen in die Stufen der Spanischen Treppe in Rom, die Brotzeit im Münchner Hofbräuhaus, der Besuch des Dresdener Zwingers und noch viele andere must.
1280 Passagiere hatte die cecilie an Bord. Die I. und II. Klasse waren ausgebucht. Als man in letzter Minute noch eine Kabine für die zwei New Yorker Bankiers brauchte, die den Goldtransport begleiteten, hatte Polack seine Kapitänskajüte freiwillig abgetreten und kampierte für diese Überfahrt im Navigationsraum.
Das Gold! Elf Millionen Dollar Münzgold für englische und französische Banken. Dazu drei Millionen in Silber. Polack dachte daran, während er noch immer auf den chiffrierten Text blickte.
Es mochte ja sein, daß ein paar amerikanische Damen, braungebrannte Schönheiten aus Kentucky und pfirsichhäutige Debütantinnen aus Kansas, die politische Lage falsch beurteilten. Aber hartgesottene Banker aus New York? Würden die zwei größten amerikanischen Banken einem deutschen Schiff vierundvierzig Millionen Mark in Gold und Silber anvertrauen, wenn sie befürchteten, der Transport könnte Europa nicht erreichen? Nie hatte eines seiner Schiffe eine so wertvolle Fracht befördert. In New York hatte diese Tatsache ihn beruhigt, jetzt allerdings steigerte die Vorstellung der aufeinandergeschichteten Goldbarren im Sicherheitsraum der cecilie seine Besorgnis . . . Er stand auf. Trotz seiner Größe waren seine Bewegungen leicht, fast elegant. Der Safe hatte eine Buchstabenkombination, die nur er und der Oberzahlmeister kannten. Er stellte die Buchstaben nacheinander ein‒E‒D‒J‒E‒D – langsam und versonnen. Er brach das Siegel des Kuverts auf und kehrte mit dem grauen Heft an den Kartentisch zurück. Wieder zögerte er, als könnte er damit noch etwas ändern. Die Unterschrift auf dem Kabel – siegfried – bedeutete, daß die Nachricht von der Direktion des Norddeutschen Lloyd kam.
Er schlug das graue Heft auf und suchte den Code, schrieb die Auflösung an den Rand des weißen Blatts. Dechiffriert lautete die Nachricht:
krieg mit frankreich, england und russland. kehren sie um.
Wer dachte sich so einen Code aus? Es war eine absurde Frage in diesem Moment, und dennoch der einzig klare Gedanke, den Polack fassen konnte. Sein Kaffee stand unberührt da . . .
Er zog sich die Seekarten mit dem eingezeichneten Kurs der cecilie heran. Ihre Position lag 30 Grad West, nördlich der Azoren, fast 1600 Seemeilen von New York entfernt, etwa 1400 Seemeilen vor Plymouth, dem ersten europäischen Hafen, den sie nach. Plan am Sonntagabend erreichen sollten. Er klappte das Codeheft zu und schloß es zusammen mit dem Kabel in den Safe ein.
Er schien äußerlich ruhig, als er auf die Brücke zurückkehrte. Er wußte, er war den Männern eine Erklärung schuldig, und er fühlte auch, daß sie darauf warteten. Warum sagte er ihnen nicht einfach, was zu sagen war, in den einfachen Worten, die sie von ihm gewohnt waren. Wir haben Krieg! Warum nicht?
Er hatte sich nie vor Verantwortung gefürchtet. Im Gegenteil, der absolute Herrscher auf einem Schiff zu sein, auf einem Stück Universum, das seinen Gesetzen gehorchte, war etwas Selbstverständliches für ihn. Es war immer so gewesen und würde immer so sein, solange er ein Schiff führte. Er war jetzt vierundfünfzig, und wie er manchmal an seine erste Zeit als Kapitän dachte, so versuchte er auch hin und wieder, sich vorzustellen, wie es sein würde, wenn er nicht mehr zur See fahren, sondern als pensionierter alter Herr leben würde. So gerne er beim ersten Gedanken verweilte, der zweite erfüllte ihn mit Furcht – und eben diese Furcht hatte die Nachricht vom Kriegsausbruch in ihm ausgelöst. Nur diese eine Empfindung beherrschte ihn im Augenblick, nicht der Gedanke an Krieg. – Krieg, das war hier mitten auf dem Atlantik etwas Abstraktes, Unvorstellbares. Was er denken konnte, war nur das eine: Sie nehmen dir dein Schiff! Er fühlte sich noch nicht bereit für Entscheidungen und Befehle. Er zog die Tür auf, die zur Plattform hinausführte, und trat an die Brüstung. Die Luft war ruhig, nur der Fahrtwind ging. Er blickte hinunter auf das Spiegelbild des erleuchteten Schiffs im dunklen Wasser, auf die Reihen heller Lichtreflexe, die wie Schnüre von geschliffenen Diamanten funkelten. Er lauschte auf die Musik aus den Gesellschaftsräumen, auf die Stimmen, das Lachen, die hier draußen lauter zu hören waren. Er schloß die Augen. Es war ihm, als sei er selber ein Teil des Schiffs, mit ihm verwachsen: Seine Füße auf der rauhen eisernen Plattform, seine Hände auf der Brüstung, sie nahmen alles auf, was im Schiff geschah, jede Bewegung, jedes Geräusch. Er hatte viele Schiffe kennengelernt, aber mit keinem hatte er sich so verbunden gefühlt wie mit ihr, als seien das Schiff und er tatsächlich ein einziger Körper.
Ihm schien nichts wichtiger in diesen Minuten, als sein Verhältnis zu seinem Schiff zu überprüfen, nur auf diesem Weg konnte er mit sich selber ins reine kommen. Wenn er auch keine zwiespältige Natur war, ganz so unkompliziert, wie die meisten glaubten, war Polack nicht. Unter der weichen Schale war er ein rauher, ehrgeiziger Mann. Als er die kaiser wilhelm der grosse und die kaiser wilhelm ii . befehligte, war er der Kapitän mit den schnellsten Schiffen auf der Nordatlantikroute. Beide Schiffe hatten das begehrte »Blaue Band« errungen, bis die lusitania und kurz darauf die mauretania , zwei Engländer, neue Schnelligkeitsrekorde aufgestellt hatten. Das war jetzt sieben Jahre her, aber immer noch gab es ihm einen Stich, wenn er in New York das »Blaue Band« am Mast des Engländers sah.
Die cecilie hatte niemals eine echte Chance gehabt, es zurückzuholen, und deshalb hatte er auch zuerst gezögert, sie zu übernehmen. Er erinnerte sich genau an den Tag, an den Augenblick, als er sie das erstemal sah, im Vorhafen der großen Kaiserschleuse. Es war Liebe auf den ersten Blick gewesen, zwischen ihm und dem Schiff. Die cecilie war ein schönes Schiff, so harmonisch in den Proportionen, daß sie selbst an der Pier, wo viele Schiffe häßlich und schwerfällig aussahen, anmutig wirkte. Insgeheim hatte er ihr damals sogar zugetraut, daß sie das »Blaue Band« zurückgewinnen könnte. Aber wie eine schöne Frau, die keine Söhne bringt, hatte sie die Hoffnungen nicht erfüllt. Er hatte sich damit abgefunden, und diese gemeinsame Niederlage, mit der er und das Schiff fertig werden mußten, hatte das Band zwischen ihnen noch fester geknüpft. Er konnte nicht mehr zählen, wie oft er mit ihr den Atlantik überquert hatte, weit über hundertmal. Bei keinem Wetter hatte sie ihn im Stich gelassen. Und was er besonders an ihr liebte, und was er in diesem Augenblick ganz intensiv spürte, war ihre weiche Gangart, sehr weiblich, sehr elegant – eine vollkommene Lady. Schiffe hatten eine Seele, daran glaubte er fest, und die Seele seiner cecilie war voller weiblicher Sanftmut.
Daß dies vielleicht ihre letzte gemeinsame Fahrt sein sollte, war für Charles Polack ein so unvorstellbarer Gedanke, daß ihm die Lösung plötzlich sehr einfach schien: Er brauchte nur die Sonne daran zu hindern aufzugehn, und er konnte mit seinem Schiff ewig durch die Nacht fahren . . .
Er kehrte auf die Brücke zurück. Seine Männer warteten, er fühlte ihre Blicke, aber keiner fragte oder drängte ihn.
»Wir vermindern die Geschwindigkeit«, befahl er. »Fünfzehn Knoten, gleicher Kurs.«
Der Maat am Maschinentelegraphen wiederholte den Befehl.
Polacks Stimme hatte ganz normal geklungen.
Der Rhythmus der Maschinen änderte sich. Polack ging zu der Tür, durch die der Funker verschwunden war. Bevor er sie öffnete, wandte er sich noch einmal um.
»Holen Sie die Offiziere zusammen, alles, was abkömmlich ist. Dann brauche ich den Oberzahlmeister, den Leitenden Ingenieur und den Proviantmeister.« Er zögerte, fuhr dann aber fort: »Er soll eine Aufstellung aller Vorräte mitbringen . . . Keine Spekulationen, meine Herrn, vor allem kein Aufsehen vor den Passagieren. In einer halben Stunde will ich hier alles versammelt sehen . . . Bis dahin gleicher Kurs.«
Die Funkerkabine lag am obersten Vorderdeck. Auf dem Weg dorthin vernahm Polack die Klänge des Orchesters, das in der Main Lounge zum Tanz aufspielte. Blue Ribbon Rag . . . Es war nicht zu überhören, daß die Steward-Kapelle mit dem neumodischen amerikanischen Rhythmus Mühe hatte. Aber die Tanzfläche war bestimmt so überfüllt, daß von Tanzen sowieso nicht mehr die Rede sein konnte. Ob Temperence C. Butler immer noch darauf wartete, daß er zurückkam, um mit ihr zu tanzen? Einen altmodischen Tanz selbstverständlich. In diesem Punkt war Temperence C. Butler sehr konservativ. War das jetzt nicht eines ihrer Lieblingslieder?
Linger, longer Lucy,
Linger, longer Lo,
How I love to linger, Lucy,
Linger, longer you.
Temperence C. Butler sang ihre Lieblingslieder beim Tanzen immer mit. Vermutlich hatte sich Fred Vandermark ihrer angenommen. Nein, Polack mußte sich keine Gedanken machen wegen der Damen, die er am Kapitänstisch zurückgelassen hatte, solange sein 2. Offizier bei ihnen war.
Bisher hatte Polack nur an sein Schiff gedacht. Jetzt versuchte er, sich vorzustellen, wie die Passagiere reagieren würden. Am liebsten hätte er Kuhn, den Oberzahlmeister, vorgeschickt; die unangenehmen Dinge lud er auf Kuhn ab, doch diesmal ging das wohl nicht. Kuhn konnte lediglich die Auswahl der Passagiere treffen, die man später ins Rauchzimmer bitten würde. Der Rest war Sache des Kapitäns . . .
Polack war bei der Kabine des Funkers angelangt. Ein viereckiger Metallkasten, klebte sie an dem Mast, der die Antennen trug, vom übrigen Schiff ganz isoliert. Obwohl die Tür geschlossen war, hörte Polack das Krachen und Ticken des Morsetelegraphen heraus. Zu niedrig waren alle Türen auf dem Schiff für Polack, aber diese hier war auch noch extrem schmal, so daß er nicht nur den Kopf, sondern auch die Schultern einziehen mußte.
Simoni blickte von seinem Drehstuhl auf. Als er sah, daß es der, Kapitän war, versuchte er so etwas wie eine militärische Haltung anzunehmen. Er richtete sich auf, seine melancholischen Augen weiteten sich. Für einen Moment wurde er zu einem gut gewachsenen, hübschen Mann, dann wurde sein Rücken wieder krumm, der Kopf sank nach vorne, und er war wieder ein Teil seines Schalttisches: Sein ganzer Körper schien eine Hörmuschel zu bilden, als sei es sein geheimer Ehrgeiz, notfalls auch ohne die Geräte, die ihm zur Verfügung standen, die Wellen aus dem Äther aufzufangen.
Polack hatte sich auf den einzigen Stuhl gesetzt, den es in der Kabine gab, eigentlich nur, damit wieder mehr Platz wurde in dem engen Raum. Simoni blickte zu dem Apparat, der eben wieder zu ticken anfing.
»Weitere Meldungen aus Europa?« fragte Polack.
Simoni beugte sich über den Streifen. »Ein Privat-Kabel.«
»Keine Mobilmachungen? Abbruch der diplomatischen Beziehungen?« Polack sprach die Worte langsam: »Keine Kriegserklärungen? Nichts Offizielles? Von keiner Seite?«
Der Rücken des Funkers wurde noch runder. »Die letzten Kommentare klangen eher beruhigend . . .«
Polack war davon nicht überrascht. Aber das war für ihn kein Grund, neue Hoffnung zu schöpfen. Er fand es ganz natürlich, daß man beim Norddeutschen Lloyd über Informationen verfügte, die der Öffentlichkeit vorenthalten wurden. Die Reederei. Darum kreisten seine Gedanken. Nicht Krieg, nicht Armeen, die in diesem Augenblick mobil machten – der Norddeutsche Lloyd. Er stand seit sechsundzwanzig Jahren in seinem Dienst. Ihm gehörte seine Treue. Seinem Schiff und Lloyd. Was gut für Lloyd war, das war gut für Deutschland.
»Von der ›Ryndam gehört?« fragte er. Das holländische Schiff war am gleichen Abend wie die cecilie von New York nach Europa ausgelaufen.
»Sie liegt etwa zweihundert Seemeilen hinter uns.«
»Und hält weiter Kurs?«
»Nach den letzten Funksprüchen, ja.«
»Wie sieht es im New Yorker Hafen aus? Die ›Vaterland‹ – sollte die nicht heute auslaufen?« Es war der neue 54 000-Tonner von der Konkurrenz aus Hamburg, das größte Schiff der Welt im Moment, das erst seine vierte Reise machte.
Simoni zögerte. Er litt sichtlich darunter, schlechte Nachrichten weitergeben zu müssen. »Die Abreise ist verschoben . . . heißt es. Vorerst für vierundzwanzig Stunden. Auch die ›Prinzessin Irene‹ hat Hoboken nicht verlassen.«
»›Kronprinz Wilhelm‹ und der ›Große Kurfürst‹?«
Der Funker schien noch mehr mit seinem Gerätetisch zu verwachsen. »Sind ausgelaufen, aber von der Reederei nach New York zurückgerufen worden. Ich habe keine Bestätigung von den Schiffen. Nur den Rückruf selber.«
Das Bild wurde für Polack klarer. Bisher hatte er nur an sich selber gedacht, jetzt sah er auch die anderen Schiffe auf dem Nordatlantik, die anderen Kapitäne, von denen er die meisten persönlich kannte, und die in dieser Nacht vor einer ähnlichen Entscheidung standen wie er.
»Was ist mit den englischen und französischen Schiffen?« fragte er.
»Die ›Mauretania‹ und die ›Olympic‹ laufen westwärts, Kurs New York. Die ›Olympic‹ muß uns in den Morgenstunden passieren.«
Die olympic – dachte Polack. Sie hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit seiner cecilie , ebenfalls vier Schornsteine. Ihm kam eine vage Idee, aber er schob sie beiseite. »Irgendein Engländer oder Franzose, der sich in den letzten Stunden für unsere Position interessiert hat?«
Simoni blickte überrascht auf. »Die ›Savoia‹. Erst vor einer Stunde. Man bat um Meldung unserer Position.« Entschuldigend fügte er hinzu: »Ein Cousin von mir . . . er ist Funker auf der ›Savoia‹.«
Polacks Blick war auf den Boden geheftet. »Keine Kriegsschiffe?«
Der Funker fuhr sich durch das dunkle, gekräuselte Haar. »Die ›Essex‹ . . . Englischer Kreuzer. Er funkt wild herum . . . benützt einen Code.«
Polack nickte und richtete sich auf, soweit ihm das in der niedrigen Kabine möglich war. »Schön, Simoni«, sagte er. »Sie werden in den nächsten Tagen nicht viel Schlaf bekommen! Bleiben Sie an den Geräten. Vergessen Sie alles andere, achten Sie nur auf eines: Wer fragt nach unserem Kurs! Vergessen Sie Europa und New York, aber hören Sie jeden Engländer und Franzosen ab. Und achten Sie darauf, wer sich unserer Position nähert. Wer immer uns auf den Leib rückt – schicken Sie mir sofort eine Meldung darüber.«
Wieder begann der Apparat zu ticken. Der schmale Streifen schob sich aus dem Schlitz und rollte sich zusammen. Simoni nahm das Ende, zog es glatt und beugte sich darüber.
Polack, der hinter ihm stand, zeigte zum erstenmal Ungeduld. »Was gibt es?«
Das Ticken verstummte. Der eigenartige metallische Geruch in der Kabine schien sich zu verstärken. »Was ist?«
Als Simoni sich umwandte, stand ein sonderbares Lächeln auf seinem Gesicht; ein Rest seiner Unruhe, seiner Besorgnis war noch da, jedoch überstrahlt von etwas anderem. »Ein Telegramm für den Zweiten Offizier.«
»Für Vandermark?«
»Ja, Käpt’n.« Das Lächeln verstärkte sich, die Hoffnung, daß die Welt in Ordnung bleiben würde. »Es ist schon das vierte heute, Sir! Und das liegt unter dem Durchschnitt, was sonst nach der Abfahrt von New York hereinkommt. Gleich zwei Damen, die ihn mit Telegrammen bombardieren. Eine aus Philadelphia, eine aus New York. Kein Wunder, daß Sie ihn ›Lucky Fred‹ nennen. Wollen Sie den Text hören?«
»Ein andermal. Außerdem, ich kann’s mir denken. Stellen Sie’s ihm zu, und dann«, Polacks Miene wurde ernst, »dann, Simoni, schließen Sie Ihre Kabine für jeglichen Privatverkehr . . . Nur, damit Sie vorbereitet sind . . . Etwa in einer Stunde wird ein gewaltiger Ansturm bei Ihnen einsetzen. Dutzende von Passagieren werden Telegramme aufgeben wollen. Man wird Sie bestürmen, man wird jeden Trick versuchen, Tränen, Bestechungen, Drohungen. Sie können sie zu mir schicken . . . Nein, sie sollen sich an den Oberzahlmeister wenden. Also, machen Sie sich auf einiges gefaßt. Hängen Sie ein Schild raus, daß keine Telegramme angenommen werden, und verrammeln Sie die Tür. Haben wir uns verstanden: Nicht ein einziges Telegramm geht mehr raus! Kein Funkspruch, nichts. Von niemandem, Offiziere und Mannschaft eingeschlossen. Absolute Funkstille, und zwar ab sofort. Verstanden! So, als gäbe es die ›Cecilie‹ nicht mehr, als hätte uns der Atlantik verschluckt.«
»Darf ich eine Frage stellen . . . Wird es Krieg geben, Käpt’n?« Einen Moment schwieg Polack. Dann sagte er: »Wir haben ihn, Simoni. Wir haben Krieg.«
»Kehren wir um?«
Polack senkte den Kopf. Im Grunde war es das gewesen, was ihn an dem Befehl gestört hatte – eine begonnene Fahrt nicht zu Ende zu bringen war etwas, das seiner ganzen Natur widersprach. In allen Häfen, die er mit der cecilie anlief, war seine Pünktlichkeit geradezu sprichwörtlich. Zehn Minuten Abweichung für eine Atlantiküberquerung war das Äußerste, was er der cecilie zugebilligt hatte. – Warum also nicht die Fahrt fortsetzen, Plymouth und Cherbourg auslassen und direkt mit voller Kraft nach Bremerhaven laufen? Aber es ging nicht um ihn. Er mußte an die Passagiere denken – und an das Gold, das er an Bord hatte. Die Engländer und die Franzosen würden Jagd auf ihn machen. Eine Goldladung von vierundvierzig Millionen . . .
»Ja, wir kehren um.«
»Nach New York?«
Auch diese Entscheidung hatte er inzwischen getroffen. New York kam nicht in Betracht. Auf diesem Kurs würde man ihn am ehesten vermuten und ausmachen. Sicher würde er in wenigen Minuten bei der Offiziersbesprechung erfahren, daß ihr Kohlenvorrat für die Rückkehr nach New York nicht mehr reichte. Newport News dann? Boston? Vermutlich würde es auch dafür zu knapp werden. Es blieb nur die kürzeste Route, die Nordroute. Das bedeutete in dieser Jahreszeit fast mit Sicherheit dichter Nebel, aber das sollte ihm nur recht sein . . .
»Nein, nicht New York«, sagte er, »wir laufen die Nordroute und machen uns unsichtbar. Und . . .denken Sie daran, ab sofort gibt es die ›Cecilie‹ nicht mehr . . .«
Es ging auf Mitternacht. Die Stimmung der Passagiere in der Main Lounge war ausgelassen. Keiner hatte bemerkt, daß die Offiziere sich während der letzten halben Stunde zurückgezogen hatten. Die zwölf Musiker der Kapelle spielten ein Stück, das sich Alabama Jigger nannte, aber bei ihnen wurde daraus mehr ein Souza-Marsch als ein Rag. Die Tanzfläche war gedrängt voll, und die Paare schienen entschlossen, die Nacht durchzuhalten, Derwische, die eigentlich keine Kapelle brauchten, sondern ihren Rhythmus selber mit den Füßen trommelten. Für die anderen war das Tanzen nur ein Vorwand, sich eng umschlungen halten zu können. Doch jetzt geschah etwas Seltsames: Die Bewegungen der Tänzer sahen plötzlich so aus, als wäre das Parkett unter ihren Füßen nicht mehr eben. Alles kam außer Tritt, eine tiefe Tangobeugung geriet aus dem Gleichgewicht, das gleichmäßige Gewoge der Paare geriet durcheinander.
Jetzt wechselte auch die Musik. Ein Sänger trat vor. By the light of the silvery moon . . . Sein Englisch klang sehr berlinerisch.
War die See plötzlich rauher geworden? Das veränderte Geräusch der Schiffsmaschinen legte diese Erklärung nahe; es war nicht mehr der tiefe beständige Rhythmus, der fast wie ein zusätzliches Baßinstrument mitgeklungen hatte, sondern ein hartes ungleichmäßiges Stampfen. Die ersten Paare verließen die Tanzfläche. Sie strebten zur Bar oder an ihre Tische. Einige gingen hinaus an Deck, um Luft zu schöpfen. Sie waren es, die zuerst bemerkten, was geschehen war. Ihre erstaunten Ausrufe pflanzten sich über das Schiff fort. Dann strömten sie von überall her, aus dem Speisesaal, dem »Wiener Café«, aus der Bibliothek, dem Schreibzimmer, dem Rauchsalon, hinaus auf die Decks. Sie schlossen sich den Gruppen an, die schon dort standen und zum Nachthimmel zeigten.
Der Mond, fast ein Vollmond, an dem wolkenlosen Nachthimmel, der vorher auf der Steuerbordseite gestanden war, hatte einen vollen Halbkreis beschrieben und schien nun auf die Backbordseite des Schiffs herab.
Es vergingen Minuten, bis die ersten Passagiere erfaßten, was das bedeutete: Die cecilie hatte ihren Kurs um 180 Grad geändert – und fuhr nicht mehr nach Osten, Europa entgegen, sondern lief mit voller Kraft nach Westen zurück . . .
Erster Teil
Erstes Kapitel
Bar Harbor, auf der Mount-Desert-Insel im Staate Maine, ist fast der nördlichste Punkt der Vereinigten Staaten, und seine »Berge« sind die höchsten an der atlantischen Küste. Selbst im Hochsommer gibt es Tage, an denen man an die Nähe der Arktis erinnert wird – aber nicht heute. Der 3. August 1914 war das, was die Einheimischen einen typischen Bar-Harbor-Tag nannten: Sonne, wolkenloser Himmel und eine Luft wie Glas.
Sie hatte Pferd und Wagen am Ende des Waldwegs zurückgelassen und stieg nun die Stufen empor, die in den Küstenfelsen gehauen waren. Sie hatte von hier einen weiten Ausblick auf den Ort und die Bucht. Das Wasser war so hell und durchsichtig, als hätte der Himmel mit der Bucht den Platz getauscht; und die Luft war so klar, daß sie die Entfernungen und Farben veränderte, ja die Dinge selbst. Sie sah jede Welle, die der Wind auf der Wasseroberfläche vor sich hertrieb, sah die Schaumperlen darauf glitzern. An den Segeln der Fischerboote waren die geflickten Stellen erkennbar, an den Yachten die Namen, ebenso die Zeichen auf den Bojen, die den Wasserweg der Dampfer markierten, die Bar Harbor mit der Außenwelt verbanden. Die Felsen von Egg Rock, die den Eingang zu Frenchmans Bay bewachten, sonst eine graue Masse, schimmerten rötlich, und der Leuchtturm strahlte weiß und blau wie ein frisch angemaltes Spielzeug.
Die Bäume auf den Höhenzügen, vor allem die Pappeln, Föhren und Rottannen des Mount Cadillac, standen wie ausgesägt vor dem Himmel. Im Osten, jenseits von Frenchmans Bay, lag die Schoodic-Halbinsel; sonst nur eine ungewisse Linie am Horizont, war sie heute zum Greifen nahe.
Ein vollkommener Sommertag. Sommer und Bar Harbor – das waren zwei Dinge, die für sie untrennbar zusammengehörten. Soweit sie zurückdenken konnte, hatte sie jeden Sommer hier verbracht, und es waren nur gute Erinnerungen, die sie daran bewahrte.
Sie hatte aufgehört, die Stufen zu zählen, sie wußte auch so, daß es zweihunderteinundzwanzig waren, bis sie die Umzäunung von Onkel Sols Besitz erreichte. Es gab einen zweiten, weniger mühsamen Weg, einen Aufzug, der unmittelbar von der Küste an der Klippenwand in die Höhe führte, aber sie mochte diesen klapprigen Käfig nicht, in dem nur zwei Personen Platz fanden und dessen Geräusche sie ängstigten. Praktisch wurde er nur in Betrieb gesetzt, um einmal im Monat die Lebensmittel nach oben zu schaffen. Onkel Sol selber benützte ihn schon lange nicht mehr; seit Jahren hatte er seine Felsenburg nicht mehr verlassen, und er hatte vor, es auch in Zukunft nicht zu tun.
Sie war nun bei der Umzäunung angelangt, und prompt schlug Onkel Sols Wachhund an. Mit wütendem Kläffen verfolgte er innerhalb des Zauns ihren Weg bis zum Tor. Sie zog an dem verrosteten Glockengriff, und irgendwo in der Ferne ertönte ein leises Bimmeln. Sie wartete vor dem hohen Holztor, das jeden Einblick verwehrte, auf die Schritte, auf das Klicken eines Gewehrs, das gespannt wurde, auf die rauhe, unwirsche Stimme – sie hätte etwas vermißt, wenn die Begrüßung anders ausgefallen wäre. Salomon Butler, der Bruder ihrer Großmutter, verabscheute Menschen.
»Was gibt es? Was soll das? Dies ist Privatbesitz!« Da war die rauhe, unwirsche Stimme.
»Ich bin es«, rief sie über das Tor. »Anne.«
»Anne Butler?«
»Was ist – kennst du meine Stimme nicht mehr?«
»Für mich klingen alle Frauenstimmen gleich. Warte . . .«
Sie hörte, wie er den Hund zu sich rief. Das Holztor lag versteckt zwischen wild wuchernden Sträuchern, und es dauerte eine Weile, bis er alle Schlösser und Riegel geöffnet hatte.
Der Mann, der dann sichtbar wurde, hielt ein Gewehr in der Beuge des Armes und den Hund an der Leine. Seine nackten Füße steckten in Sandalen; die hellen Hosen waren abgetragen und so kurz, daß sie weit über den Knöcheln endeten; das karierte Flanellhemd war geflickt und stand über der Brust offen. »Na, komm schon herein. Du bist also zurück?« Er hatte breite Schultern, einen flachen Leib, und sein Gesicht war von der Sonne tief gebräunt. Nicht einmal das schneeweiße Haar, das wirr unter seinem Strohhut hervorkam, ließ sein Alter – er war sechsundsiebzig – vermuten.
Anne hatte ihn nie anders als weißhaarig gekannt. Es war ein Erbstück der Familie Butler; so um das vierzigste Lebensjahr ergrauten die dunkelhaarigen Butlers und wurden innerhalb weniger Jahre weiß, und manchmal fragte sich Anne, ob es auch ihr so ergehen würde. Sie hatte zwar das helle Haar ihrer Mutter, aber der dunkle Teint und die dunklen Augen waren Butler-Erbe. Nicht, daß sie das beunruhigte; mit ihren neunzehn Jahren war vierzig ein unvorstellbares Alter . . .
Onkel Sol gab dem Hund mehr Leine. »Keine Angst. Er braucht nur wieder deinen Geruch. So ein Jahr ist lang.« Er ließ den Schäferhund los, und das große schwarzbraune Tier umstrich Anne, schnupperte an ihren Schuhen, an ihrem Rock.
»Siehst du! Wir Butlers scheinen einen besonderen Geruch zu haben. Er hat nie einen Butler angefallen.« Seine dunklen Augen blieben wachsam, mißtrauisch. »Ich meine einen richtigen Butler, nicht die Angeheirateten.«
Hatte Anne ihren Onkel jemals lächeln sehen? Er konnte laut lachen – lachen, daß es ihn schüttelte, aber lächeln?
»Wie riechen wir Butlers denn?« fragte sie.
Er zuckte mit den Achseln, während er vorausging. »Jedenfalls anders als gewöhnliche Leute.« Er musterte sie von der Seite.
»Was ist mit deinem Haar?«
Sie fuhr unwillkürlich mit der Hand zum Kopf. »Mein Haar?«
»Früher war es länger.«
»Ach so, ja.« Zum Ball der Debütantinnen, dem großen Ereignis für ein junges Mädchen aus einer der ersten Familien Bostons, hatte sich Anne im Winter vorher das lange Haar abschneiden lassen.
Onkel Sol schüttelte den Kopf. »Die Röcke werden immer kürzer, die Haare werden immer kürzer . . . Wie nennt sich denn diese neumodische Frisur?«
»Es war mal ein Gibson-Girl. Seit einem halben Jahr lasse ich es schon wieder nachwachsen.«
»Es war noch kürzer?«
»So eine Art Pagenkopf.« Annes Haar wuchs schnell, aber es dauerte einfach seine Zeit, und am Wirbel oberhalb der Schläfe war es immer noch etwas zu kurz und so störrisch, daß sie meist eines der Stirnbänder aus ihrer College-Zeit tragen mußte.
»Grünweiß«, sagte er, »das sind die Farben von Oldfields College, nicht wahr?«
»Daß du so was überhaupt bemerkst . . .«
Als habe er bereits zuviel Interesse und Herzlichkeit gezeigt, brummte er etwas Unverständliches und beschleunigte seine Schritte. Das Haus, auf das er zustrebte, lag am Ende des Hochplateaus; aus einer gewissen Entfernung schien es ein Teil der Felswand zu sein, vor der es stand, eigentlich nur durch die funkelnden Fenster vom grauen Stein zu unterscheiden. Es gab noch ein zweites Gebäude vorne am Rand der Klippe, ein nüchterner Würfel, über dessen Dach ein hoher Antennenmast aufragte. Diese komplizierte technische Konstruktion wirkte fremd und unpassend an diesem Ort, wo sonst alles wild und ursprünglich war, und verkörperte genau die moderne Welt, vor der Onkel Sol sich zurückgezogen hatte. Er hatte viel Geld aufwenden müssen, um diese Klippe überhaupt zugänglich und bewohnbar zu machen. Allein die Trinkwasserleitung hatte ein kleines Vermögen verschlungen. Wasser, das vom Mount Kebo, viele Meilen entfernt, in Holzrohren herangeführt und in einem Brunnen vor dem Haus gefaßt wurde. Ein Haufen frisch gespaltenes Holz lag um einen Hackstock, in dem ein Beil steckte. Es roch nach Kiefernharz. Vermutlich hatte sie ihn beim Holzhacken unterbrochen; das war eines seiner Gesundheitsrezepte, jeden Tag eine Stunde Holz zu hacken. Er hatte Dutzende solcher Spezialrezepte für Gesundheit und ein langes Leben; sie wechselten von Monat zu Monat, nur am Holzhacken hielt er schon seit Jahren fest.
Er hing das Gewehr an einen Haken neben der Haustür und wies auf eine grobgezimmerte Gartenbank. »Seit wann bist du in Bar Harbor?«
»Dies ist mein erster Tag.«
»Kommst du direkt von Boston?«
»Von New York. Wir – Edith Connors und ich – haben Großmutter begleitet und sie aufs Schiff gebracht.«
»So – ist es mal wieder soweit. Jedes Jahr nach Europa! Das ist ja schon eine Krankheit!« Er hatte sich neben sie gesetzt, aber jetzt sprang er wieder auf und ergriff das Beil. Er stellte ein Holzstück auf den Hackstock und starrte es an wie einen Verurteilten, den er hinrichten sollte.
»Zum Teufel mit den Weibern!« Er schlug zu . . . »Meine liebe Schwester. Sonst ist Temperence eine so vernünftige Person, aber da setzt auch bei ihr der Verstand aus. Europa! Was die Weiber nur daran finden?« Ein zweites Holzstück zersplitterte. »Paris, wie? Gay Par-ee . . . hipp hipp hooray, let’s be gay . . . Eine miese Bande, diese Europäer, voran die Franzosen . . . Monsieur Seligman lacht sich ins Fäustchen, weil er jetzt seine gefälschten Rembrandts anbringt, und das Sèvres-Geschirr kommt aus Italien. Aber die Kunst ist ja nur Vorwand . . . der eigentliche Grund für unsere amerikanischen Damen, das sind die Frenchies mit ihrem Charme und ihren langen Frackschößen und ihren gewichsten Schnurrbärten. Alle diese falschen Grafen, langmähnigen Künstler, Nichtstuer, Parasiten . . . aber sie küssen den Damen die Hand – wenn es dabei bleibt . . .«
»Onkel Sol!«
»Qui! Tray bong! Ich bin schon still. Temperence ist meine Lieblingsschwester, aber in diesem Punkt werde ich sie nie verstehn. Wenn sie zurückkommt, hat sie einen französischen Akzent, oder jedenfalls das, was sie dafür hält.«
»Ich mache mir Sorgen um sie«, sagte Anne. »Liest du keine Zeitungen?«
»Wozu?«
»Es gibt Krieg in Europa.«
»Gut, sage ich! Die Deutschen werden es diesen Frenchies schon zeigen.«
»Ich habe Großmutter vor sieben Tagen an Bord gebracht. Seit vier Tagen bin ich jetzt ohne Nachricht von ihr. Es gibt überhaupt keine Nachrichten mehr von dem Schiff. Niemand weiß, wo es sich befindet. Ich bin beunruhigt, versteh mich doch. Ich habe Alec gebeten . . . Er ist doch da?« Sie blickte hinüber zu dem Antennenmast über dem grauen Haus am Rand der Klippe. Bei der Erwähnung des Namens Alec hatte sich das Gesicht des alten Mannes noch mehr verschlossen. Er ließ die Axt sinken. »Und ich dachte wirklich einen Augenblick, dein Besuch gilt mir . . . Ja, er ist da. Worauf wartest du? Geh zu ihm . . .« Anne erhob sich. »Kann ich einen Schluck Wasser haben?« »Niemand hindert dich.«
Sie schöpfte sich einen Becher aus dem Brunnen und trank es langsam, kostete jeden Schluck betont aus. »Ich kenne kein Wasser, das so gut schmeckt.«
Er murmelte etwas, und sein Gesicht hellte sich auf.
»Wirklich, es ist das beste Wasser weit und breit.« Im Zusammenleben mit ihrer Großmutter hatte Anne gelernt, mit alten Menschen umzugehen. So hart und eigensinnig sie auch sein mochten, schlug man die richtige Saite an, wurden sie weich wie Wachs. Bei Onkel Sol war es besonders einfach. Fiel der Name seines Sohnes Alec, versteinerte er, lobte man sein Wasser, ging ihm das Herz auf.
»Mount-Kebo-Wasser«, sagte er. »Unverdorben. Im ganzen Staate Maine gibt es kein besseres. Weißt du, daß man mir vorgeschlagen hat, es in Flaschen abzufüllen und auf den Markt zu bringen? So sind die Menschen. Müssen aus allem ein Geschäft machen!« Er schob den Strohhut aus der Stirn.
»Bar Harbor war einmal ein Paradies, und was ist es jetzt? Ein Rummelplatz. Touristen, stinkende Automobile, knatternde Motorboote. Siehst du noch einen Menschen mit einem Zeichenblock oder einer Botanisiertrommel? Siehst du jemand Muscheln sammeln? Der Mensch kann nicht anders, er muß alles zerstören . . .«
Die Klagen, daß es in Bar Harbor nicht mehr so war wie früher, gehörten zu Onkel Sol wie sein Haß gegen die Franzosen und die Spannungen mit seinem Sohn Alec. Anne nahm das hin, ohne weiter darüber nachzudenken. Er war eben ein eigenbrötlerischer alter Mann, der sich von den Menschen und der Welt zurückgezogen hatte und dessen Denken und Fühlen nur noch um ein paar Dinge kreisten. Nur manchmal fragte sie sich, wo der andere Mann geblieben war, der Onkel Sol von früher, der Bankier in New York. Das waren ihre ersten, immer noch lebendigen Erinnerungen an ihn: New York, Wallstreet, die enge Schlucht einer Straße, ein schmales Gebäude, die Bank, ein dämmriges Büro, und darin Onkel Sol, schwarz gekleidet, damals schon weißhaarig; ein Mann, der die Fünfjährige bei der Hand nahm und mit ihr in einen unterirdischen Tresor stieg, um ihr die dort gestapelten Goldbarren zu zeigen! Das Erlebnis hatte sich ihr unauslöschlich eingeprägt. Er hatte ihr einen Barren in die Hände gelegt. Er war groß wie ein Ziegelstein, nur viel, viel schwerer. Und auch seine Worte hatte sie nicht vergessen. ›Sind es nicht die schönsten Ziegelsteine der Welt?‹ Gold und Grund, das war Salomon Butlers Metier gewesen, und auch in Bar Harbor hatte er sich auf diesem Gebiet betätigt. Er hatte Land gehortet, über Jahre hinweg, und dann die Preise in die Höhe getrieben. Anne Archbold, die Standard-Oil-Millionärin, hatte den Besitz in Hulls Cove von ihm gekauft; der Verleger Pulitzer ein Grundstück mit Strand, wo er seinen eigenen Yachthafen anlegte. Nach solchen spektakulären Käufen schnellten die Preise jeweils noch mehr in die Höhe, und den Gewinn machte Sol Butler. Nüchtern betrachtet hatte er alles getan, um aus dem verschlafensten Badeort an der Atlantikküste die Sommerhauptstadt des Landes zu machen, in der viele große Familien einen Sommersitz hatten, was Jahr für Jahr immer mehr andere Sommerfrischler anlockte. Aber offensichtlich hatte er das inzwischen vergessen.
»Früher, lange bevor du auf der Welt warst, da konnte es im Sommer vorkommen, daß Elche durch die Bucht schwammen und den Garten deiner Großmutter umwühlten . . .«
Anne lachte. Sie war zu jung, um sich vom Pessimismus eines alten Mannes anstecken zu lassen. Wahrscheinlich war auch das eines seiner Gesundheitsrezepte, täglich eine gehörige Menge zu schimpfen. Ihr Blick ging in die Landschaft: Grüne Hügel – das Grün der Mischwälder von Bar Harbor war eine ganze Symphonie –, die Villen in den großen Gärten, der Ort selber mit den vielen Stegen, die ins Wasser ragten, die weite blaue Bucht, und darin Bar Island und die vier »Porcupines Islands«, die wirklich, wie der Name sagte, wie Stachelschweine aussahen mit ihren bewaldeten Rücken.
»Für mich«, sagte sie, in den Anblick versunken, »ist es immer noch ein Paradies.«
Er sah sie an, diesmal nicht abwehrend und kritisch, sondern nur melancholisch. »Dazu muß man so jung sein wie du.« Er nahm das Beil, umfaßte den Griff mit beiden Händen. Er stellte sich breitbeinig hin, um mehr Halt und Kraft zu haben; das karierte Flanellhemd hing ihm aus der Hose.
Während Anne zur Funkstation hinüberging, begleitete sie das helle Geräusch von splitterndem Holz.
Zweites Kapitel
Je näher sie dem Rand der Klippe kam, um so deutlicher hörte sie vom Meer herauf das Anschlagen der Brandung und das Kreischen der Möwen, die in den Spalten der Felsen nisteten. Die Bucht weitete sich hier aus, und an einem Tag wie heute konnte man in der Ferne an der dunkleren Färbung des Wassers die Strömung des Atlantiks erkennen.
Ein Raddampfer zog eben in die Bucht herein, hinter sich eine breite Schaumfurche, die seine beiden Schaufelräder im Wasser aufpflügten. Der Zeit nach mußte es der Dampfer von Rockland sein, wo man Anschluß nach Boston hatte. Bar Harbor besaß keine Eisenbahnlinie; man konnte nur mit dem Wagen oder auf dem Wasser hergelangen. Von Boston war es immer noch eine Reise von zehn Stunden; früher, in ihrer Kindheit, hatte die Fahrt noch weit länger gedauert, aber gerade das hatte Bar Harbor zu etwas Besonderem gemacht, zu einem Versteck am Ende der Welt.
Die Funkstation von Alec Butler bestand nur aus einem einzigen großen Raum; es war alles in einem, Wohnzimmer, Schlafraum und Funkstation. Die breite Fensterfront lag nach Südosten hin, gab den Blick auf den Golf frei.
Dort, an dem Tisch mit den Funkgeräten, saß Alec Butler. Er hatte den Kopfhörer auf, trotzdem mußte er ihr Kommen bemerkt haben, denn er hob die Hand zum Gruß. Er schrieb etwas auf den Block, der vor ihm lag, erst dann nahm er den Kopfhörer ab und drehte sich mit seinem Drehstuhl um.
»Hallo, Anne!«
Sie hatte ihn eigentlich umarmen wollen, aber nun sagte sie ebenso: »Hallo, Alec!«
Herzlicher waren die Begrüßungen unter den Mitgliedern der Familie Butler einfach nicht. Nur ihre Großmutter machte da eine Ausnahme. Temperence C. Butler ging großzügig um mit Umarmungen und Küssen; Onkel Sol nannte das eine »europäische Unsitte«, und von gewissen Bostoner Kreisen wurde ihr Benehmen als exaltiert getadelt, was Temperence C. Butler freilich nicht störte, im Gegenteil, denn ihr Ehrgeiz war es immer gewesen, die steifen puritanischen Bostoner zu schockieren.
Alec, ihr Vetter zweiten Grades, dagegen hielt es mit der »echten« Bostoner Tradition: Man stellte seine Gefühle nicht zur Schau. Man ging damit ebenso vorsichtig um wie mit seinem Vermögen, nach dem Prinzip: Was man ausgibt, kann sich nicht vermehren. Auch äußerlich entsprach er diesem Bild. Alles an ihm war peinlich korrekt: das weiße Hemd, der blaue, doppelreihige Blazer, die Bügelfalten der Hose, die polierten Schuhe. Und obwohl er gerade den Kopfhörer abgenommen hatte, lag sein dunkles Haar glatt an seinem Kopf, der Seitenscheitel wie mit dem Lineal gezogen. Sie kannte ihn nicht anders. Schon mit Sechzehn – er war sechs Jahre älter als sie – war er ihr wie ein fertiger junger Mann vorgekommen; jetzt, mit Fünfundzwanzig, hatte er sich bereits als Anwalt einen Namen gemacht und stand am Beginn einer glänzenden Karriere.
Aber neben dem erfolgreichen jungen Mann gab es noch einen anderen Alec Butler, der unsicher war und gehemmt, und der in diesem Augenblick nicht wußte, wo er seine Hände lassen sollte. »So setz dich doch«, er machte einen Stuhl für sie frei. »Du bist allein hergekommen?«
»Mit Pferd und Wagen.«
»Und mit Jenkins, hoffe ich.«
»Bitte, keine Erziehungsstunde, Alec. Dies ist Bar Harbor, nicht Boston.«
»Wenn du meinst, daß es einen Unterschied macht.«
»Du wirst genug Gelegenheit haben, den Aufpasser zu spielen . . .« Sie beobachtete ihn aufmerksam, aber nichts in seinem glatten Gesicht verriet ihr etwas von seinen Gefühlen. Auch das gehörte zu den Sommern in Bar Harbor, daß Alec immer in der Nähe war. Egal, ob sie im Meer schwamm, ob sie segelte, Tennis spielte, ausritt oder im Kanu-Club tanzte und flirtete – Alec war immer da, unauffällig, im Hintergrund, aber immer zur Stelle, wenn sie ihn brauchte.
»Wie hat Vater dich empfangen?« fragte er.
»Sagen wir – normal unfreundlich . . . Hast du mein Telegramm bekommen?«
Er machte eine Geste zu der Fensterfront in die Weite des Meeres hinaus. »Nichts. Keine einzige Meldung seit Tagen. Die ›Cecilie‹ ist wie vom Erdboden verschluckt. Alle suchen sie; dauernd fange ich Funksprüche auf, in denen man sie auffordert, ihre Position bekanntzugeben. Der ganze Äther schwirrt von ihrem Namen, aber sie bleibt stumm.«
Anne ließ den Blick über die Apparate schweifen. Er hatte ihr einmal erklärt, wie alles funktionierte, und jetzt ärgerte sie sich, daß sie damals nicht besser aufgepaßt hatte. Alec, der ihren Lehrmeister spielte, dagegen hatte sie sich immer gewehrt.
»Was in den Zeitungen steht, widerspricht sich«, sagte sie.
»Weil sie selber nichts wissen. Überhaupt, was die Zeitungen schreiben, ist immer mit Vorsicht zu genießen.«
Seit dem 1. August machte die cecilie Schlagzeilen. Das deutsche Schiff war immer schon ein Lieblingsobjekt der amerikanischen Reporter gewesen, seit der Jungfernreise nach New York. Damals, im Jahr 1907, waren fünftausend New Yorker an den North River geeilt, um ihre Ankunft zu sehen; und während der fünf Tage, die sie an der Pier in Hoboken lag, hatten Zehntausende sie besichtigt. Von den Reportern war ihr der Beiname queen of the seas verliehen worden, der ihr seither geblieben war. Jetzt hatten sie einen neuen erfunden, the treasure ship , das Schatzschiff, wegen der vierzehn Millionen Dollar an Gold und Silber, die sich an Bord befanden. Die Zeitungen stellten die wildesten Vermutungen an: Englische Kreuzer verfolgten sie; die Franzosen hätten sie aufgebracht; die cecilie sei in der Irischen See gesichtet worden, vor der Küste Norwegens; andere wieder wollten wissen, daß sie längst in ihren Heimathafen eingelaufen sei. Die Berichte über das Schiff beherrschten die ersten Seiten der Zeitungen und hatten sogar den europäischen Krieg in den Hintergrund gedrängt, so als sei an diesem Krieg nur das Schicksal der cecilie interessant – und Anne erging es nicht anders: Der Krieg war etwas Fernes, Unvorstellbares, Abstraktes. Das Schiff jedoch war etwas Reales.
»Ich habe ihr täglich Telegramme geschickt«, sagte sie. »Zuerst war es nur wegen des Rennens. Du weißt schon, das Knickerbocker-Race. Eines von Großmutters Pferden ist dort gelaufen. Es war ihr Wunsch, daß ich ihr das Ergebnis telegraphiere.« »Meadow Beauty?«
»Glaubst du, es ist etwas passiert? Ein Schiff kann nicht einfach verschwinden.«
»Wäre etwas passiert, gäbe es eine Nachricht. Ich habe praktisch die letzten vierundzwanzig Stunden hier verbracht, seit meiner Ankunft. Nein, darüber mach dir keine Gedanken. Irgendwann im Lauf des Tages werden wir bestimmt etwas hören.« Er suchte in den Zetteln, die auf dem Tisch lagen. »Sie sind am 28. Juli ausgelaufen, das heißt, sie sind jetzt bereits sechs Tage auf See – mit dem Kohlenvorrat, den sie an Bord haben, können sie nicht viel länger draußen bleiben.« Alecs Argumente waren wie immer klar und einleuchtend, nicht auf Gefühlen, sondern auf Tatsachen begründet, dennoch genügten sie nicht, um ihre Ängste zu beschwichtigen; es waren Ängste, die tief in ihr verwurzelt waren – die furchtbare Erinnerung an das Schiffsunglück, bei dem sie ihre Eltern verloren hatte: Alpträume von brennenden Schiffen, niemals überwunden, auch wenn das Ganze schon vierzehn Jahre zurücklag und sie damals erst fünf Jahre alt war.
»Fast hätte Großmutter ihre Reise verschoben, wegen des Rennens.« Irgendwie schien Anne diese Tatsache wichtig, sie klammerte sich daran. »Die ersten drei Tage hat Großmutter ihren Trainer mit Telegrammen bombardiert.«
»›Meadow Beauty ‹ hat das Rennen gewonnen, nicht wahr? Es ist doch ihr Pferd?«
»Ja . . . und sie weiß es nicht!«
»Du hängst sehr an ihr, nicht wahr?«
Sie blickte ihn an. Sie verstand seine Frage nicht. Sie hatte auch nie verstanden, warum zwischen ihm und seinem Vater ein so gespanntes Verhältnis herrschte. Anne war seit ihrem vierten Lebensjahr Waise, sie war ohne Vater und Mutter aufgewachsen, aber die Großmutter hatte ihr alles ersetzt, so daß Anne immer das Gefühl hatte, in einer richtigen Familie zu leben.
»Laß uns nach draußen gehn«, sagte sie unvermittelt. Es war sehr warm in dem Raum, wärmer als im Freien, denn die große Fensterfront verdoppelte die Kraft der Sonne. Trotzdem fröstelte Anne plötzlich.
Das Geschrei der Möwen war wieder da, das stetige Anrollen der Brandung. Gedämpft klang das Horn des Dampfers durch die Bucht; man konnte ihn nicht sehen, wahrscheinlich passierte er gerade Egg Rock. Sie hatten sich auf die Steinbank gesetzt, ein Felsblock, den man zugeschlagen hatte.
»Du bleibst den Sommer über hier?« fragte Alec.
»So war es geplant . . . bis zur Rückkehr von Großmutter im Oktober.«
»Und danach? Ich meine . . . willst du wirklich auf die Universität?« Er versuchte, der Frage kein Gewicht zu geben, aber es gelang ihm nicht.
»Ich habe mich eingeschrieben.«
»Veterinärmedizin – verrückt!«
»Vor einem Jahr hörte ich es anders.«
»Ehrlich gesagt, hielt ich es für eine Laune.«
»Das ist nicht gerade ein Kompliment . . .«
»Die Mädchen, die ich kenne, denken alle nur an drei Dinge: an ihr Debüt, an eine große Reise und . . . ans Heiraten. Und je schneller das aufeinanderfolgt, um so besser.«
»Vielleicht kennst du die falschen Mädchen.« Sie lachte unbefangen, aber natürlich hatte er recht. Oldfields hatte strenge Regeln, und die strengsten betrafen Jungen. Jungen waren tabu. Man traf keine Jungen, man schrieb ihnen keine Briefe, und man bekam auch keine. Und doch hatten die Mädchen, mit denen Anne in Oldfields war, nichts anderes im Kopf gehabt als Jungen. Kleider auch noch, aber zuerst kamen die Jungen. Anne hatte es immer vermieden, sich an diesen Gesprächen zu beteiligen. Nicht, weil die dem Thema gleichgültig gegenüberstand, sondern einfach, weil sie ihre Meinung dazu lieber für sich behielt. Sie wäre nicht die Enkelin von Temperence C. Butler gewesen, wenn sie über diesen Punkt nicht sehr eigenwillige Vorstellungen gehabt und die Diskussionen anderer Mädchen nicht ziemlich albern gefunden hätte.
»Ich glaube wirklich, mein lieber Alec, du kennst die falschen Mädchen.«
»Möglich.«
Etwas in Alecs Benehmen irritierte sie; was es genau war, hätte sie nicht sagen können, aber es war nicht mehr so wie früher zwischen ihnen. Alec und sie, das war immer wie Bruder und Schwester gewesen, nur daß sie sich besser verstanden hatten, als das sonst meist der Fall war zwischen älteren Brüdern und jüngeren Schwestern. Was hatte sich daran geändert? Oder richtiger, wer von ihnen hatte sich geändert? War es Alec oder sie? Sie wollte keine Änderung. Sie wollte einen unbeschwerten Bar-Harbor-Sommer wie früher.
»Begleitest du mich heute abend in den Kanu-Club?
« Alec ging nicht darauf ein. »Es hätte sein können, daß du es dir anders überlegst mit dem Studieren. Schließlich ist es nur natürlich, wenn ein Mädchen in deinem Alter ans Heiraten denkt.«
Sie blickte ihn überrascht an, versuchte zu erraten, was sich hinter dieser Bemerkung verbarg; ob es nur eine Feststellung war, oder ob er vielleicht von sich selber sprach.
»Was man so hört aus Boston«, fuhr er fort, »fehlt es dir nicht an Verehrern . . . und Anträge hast du bestimmt auch schon bekommen.«
»Du vergißt Großmutter. Das ist ihr Ressort, und da überlegt es sich jeder zweimal.«
»Warum weichst du aus?«
»Ich weiche nicht aus. Sicher, die Mädchen, die mit mir auf dem College waren, haben nichts anderes im Kopf, als schnell heiraten. Aber kannst du dir das vorstellen – ich als Ehefrau?«
Seine Lippen öffneten sich kaum, als er antwortete: »Wenn wir Männer uns vorstellen könnten, wie das ist, wenn ein junges Mädchen sich in eine Ehefrau verwandelt, ich fürchte, dann würden nur noch wenige heiraten.«
Einen Moment war sie verblüfft, dann lachte sie hellauf. »Das klingt sehr nach deinem Vater. Ich sehe schon, eines Tages wirst du auf dieser Felsenburg sitzen, so wie er jetzt, und alle Frauen – er sagt Weiber, nicht wahr? – verfluchen . . .«
»Er kam nur zu spät dahinter. Aber lassen wir das Thema.«
»Ich habe nicht davon angefangen . . . Wirst du länger bleiben?« »Vierzehn Tage, drei Wochen . . . bis zum Ende der Gerichtsferien. Kann sein, daß ich zwischendurch einmal nach Washington muß. Die Marine interessiert sich für meine Funkstation.« »Die Marine?«
»Wir sind hier Europa am nächsten, und durch die Höhe der Berge ist es die einzige Stelle, von der man vierundzwanzig Stunden lang mit Europa Kontakt halten kann.«
Unwillkürlich blickte Anne sich um. Alles hier oben war so, wie die Natur selber es erdacht hatte. Selbst die schmalen Pfade schienen so alt wie der Berg.
»Das kannst du deinem Vater nicht antun. Außerdem wird er nicht zustimmen. Er wird seine Burg energisch verteidigen.«
»Man wird ihn nicht lange fragen. Wenn es um nationale Interessen geht . . .«
»Das ist nicht dein Ernst.«
»Wieso nicht? Wozu braucht ein alter Mann einen ganzen Berg für sich allein?«
Wieder einmal war sie verblüfft von der Gehässigkeit, die zwischen den beiden herrschte.
»Was ist nur zwischen euch?« Es war das erstemal, daß sie ihm diese Frage so direkt stellte. »Warum haßt du ihn?«
»Tue ich das?«
»Natürlich.«
Er stand auf. »Was hast du da gesagt von heute abend? Wie ich dich kenne, hast du keine Lust, an deinem ersten Abend in Bar Harbor allein zu Hause zu sitzen.«
Sie zögerte, aber sie wußte, es hatte keinen Wert, weiter in ihn zu dringen. Und dann war die Aussicht auf einen vergnügten Abend ihr wichtiger als die Probleme zwischen Alec und seinem Vater.
»Komm zum Abendessen«, sagte sie, »dann sehn wir weiter.«
»Um acht?«
»Punkt neun, sonst stürzt Whites Welt ein.«
Er stand vor ihr. Die Gespanntheit war verschwunden. »Hoffentlich haben sie im Kanu-Club eine bessere Kapelle als voriges Jahr.«
»Damms Orchester spielt seit dem 1. August.«
»Ich denk’, du bist erst heute gekommen?«
»Also, weißt du, welches Orchester im Kanu-Club spielt, das weiß ich schon in Boston.«
»Also dann bis heute abend.« Er deutete auf die Funkstation. »Vielleicht höre ich bis dahin etwas von der ›Cecilie‹ . . . Anne?«
»Ja?«
»Ich . . . freue mich auf heute abend.« Er wandte sich schnell ab und ging zurück zur Funkstation.
Der Haufen gespaltenen Holzes um den Hackstock hatte sich vergrößert; Onkel Sol stand am Brunnen, mit nacktem Oberkörper. Er mußte sich eben gewaschen haben, denn einzelne Tropfen standen noch auf seiner glatten dunklen Haut.
»Du gehst wieder?« sagte er, als sie näherkam.
Anne nickte.
»Wird man dich nochmals sehen, hier oben?«
»Du legst keinen großen Wert auf Besuch oder?«
Er zog sein Hemd an und stülpte den Strohhut auf den Kopf. »Betrachte dich als eine Ausnahme.«
»Es scheint, du hast heute deinen freundlichen Tag.«
»Ich mag dich. Du bist ein richtiges Butler-Mädchen.«
»Und wie sind die?«
Er sah sie an, mit diesem ausdruckslosen Gesicht, das ganz beherrscht wurde von den wachsamen Augen, und wieder einmal fiel ihr auf, wie ähnlich sich die beiden waren, Vater und Sohn, die sich beide so haßten, daß sie tagelang kein Wort miteinander sprachen.
»Bei den Butler-Mädchen ist es genau umgekehrt wie bei den anderen Frauen. Die meisten sind schön, wenn sie jung sind. Ihre Schönheit ist nichts anderes als ihre Jugend. Die Butler-Mädchen blühen spät, aber dann blühen sie lang.«
»Danke, Onkel Sol. Ich werde mir Mühe geben.«