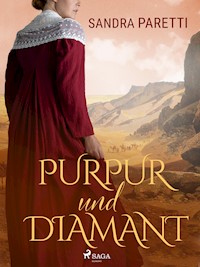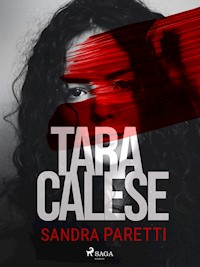Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Geliebte Caroline
- Sprache: Deutsch
Es gibt ein neues Mädchen in der Stadt, über das sogar in den Pariser Salons geflüstert wird! Caroline de la Romme Allery ist jung, schön und hungrig nach Abenteuern. In Paris macht sie sich durch ihre heißen Affären und Liebschaften einen Namen. Insbesondere ihre Beziehung zu Kaiser Napoleon ist in aller Munde. Mit ihrem Liebreiz und Charme verdreht sie den Männern, denen sie begegnet, den Kopf. Eine Geschichte über eine junge Frau, die sich nimmt, was sie will.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sandra Paretti
Rose und Schwert
Saga
Rose und Schwert
Copyright © 2022 by Helmut and Anka Schneeberger, represented bei AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de)
Originally published 1967 by Krüger Verlag, Stuttgart
Coverimage/Illustration: Shutterstock, free domain
Copyright © 1967, 2022 Sandra Paretti und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788728469361
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
1
Das glühende Holzscheit brach prasselnd entzwei. Funken sprühten auf, flogen über die Esse, fielen auf die Reitstiefel des Mädchens und sengten schwarze Flecken in das hellgraue Wildleder. Caroline achtete nicht darauf. Gedankenverloren starrte sie in das Feuer und schlug mit dem schmiedeeisernen Schürhaken weiter auf den glühenden Strunk ein. Ihre schlanke Gestalt in dem enganliegenden Reitkostüm aus silbergrauem Samt warf einen langen Schatten auf den hellen Steinboden der Schloßküche von Rosambou.
Diese mächtige Feuerstelle hatte sie schon als Kind magisch angezogen. Abends, wenn es ruhig wurde, hatte sie stundenlang vor dem Feuer gehockt: wenn die frisch gescheuerten Steinplatten des Bodens noch vor Feuchtigkeit glänzten, wenn die Kupferkessel wieder blitzend an der Wand hingen und die zwei Kerzen auf dem Tisch so tief heruntergebrannt waren, daß man meinen konnte, das grüne Blattwerk auf den Kacheln sei wirklicher Efeu, der die Wände überwachse... Mit dem Feuer konnte sie besser reden als mit den Menschen; das Feuer verstand sie besser als die Menschen. Das Feuer war ihr Element – wild und verzehrend. Aber heute versagte der geheimnisvolle Zauber. Die leisen Stimmen des Feuers gingen unter in dem dumpfen Donner der Kanonen und dem harten Geknatter der Gewehre, das der Ostwind vom Schlachtfeld herübertrug.
Seit dem Morgen tobte an diesem 21. März 1814 die Schlacht bei Arcis-sur-Aube zwischen Napoleon und den Alliierten; den Preußen, den Österreichern und den Russen. Der Graf Romme Allery hatte seine Bauern unter Waffen gestellt, sein ganzes Zinn eingeschmolzen und zu Kugeln gegossen. Simon hatte eine Fuhre nach der anderen zur Front gebracht. Die letzte vor einer Stunde. Im Hof standen die Kutschen und Karren, vollbepackt, bereit zur Abfahrt. Noch diese Nacht würden sie Rosambou verlassen – vielleicht auf immer.
Marianne, die Beschließerin, wirtschaftete an dem großen Tisch in der Mitte der Küche. Vor ihr aufgetürmt lag ein Berg von Lebensmitteln: Schinken, Würste, getrüffelte Pasteten in Steingutnäpfen, geräucherter Aal, ein Korb Eier, silberne Dosen mit Kaffee und Tee, Zucker und Mehl in roten Leinensäckchen, Fladenbrote, flache Käselaibe, Kristallschalen mit Konfekt und Backwerk – und auf einer Silberplatte türmten sich frisch gebackene Kapaune. Marianne verpackte alles sorgfältig in die zwei riesigen Waschkörbe, die neben ihr am Boden standen. Sie war eine mittelgroße, rundliche Frau von fünfzig Jahren. Die weiße Schürze, die sie über dem apfelgrünen Hauskleid trug, war steif gestärkt. Marianne war eine flinke Person – aber heute schien sie bei jedem Handgriff zu zögern. Immer wieder lief sie zur Tür, spähte in den Hof und lauschte in die Nacht hinaus und kam schließlich atemlos zurück: »Caroline! Es ist Ruhe! Mein Gott, wäre das ein Glück. Vielleicht überlegt es sich der Herr Graf jetzt doch noch anders, und wir bleiben. Das Schloß und alles im Stich lassen! Es wäre Wahnsinn! Das schöne Schloß.«
Caroline blickte über die Schulter. »Packen Sie fertig, Marianne.«
Die Beschließerin blieb mit offenem Mund an der Tür stehen. »Ja, gehen Sie denn so leicht von hier weg?« fragte sie fassungslos.
Ohne ein weiteres Wort hing Caroline den Schürhaken an den Halter neben dem Kamin, ging zum Tisch und begann einzupakken. Marianne stützte die Hände in die Hüften. »Mein Gott! Ihre Mutter hat es kommen sehen. Gut, daß ihr das erspart geblieben ist. – Was ist das für eine Zeit, in der wir Frauen unsere Söhne nur noch fürs Sterben gebären! – Und alles wegen diesem –« Sie verschluckte das Schimpfwort, das sie auf der Zunge hatte, denn im selben Augenblick war die Küchentür aufgeflogen.
»Man hört dich bis nach Arcis-sur-Aube für unseren Kaiser beten, Marianne!«
Caroline sah kurz auf – aber Simons Gesicht verriet nichts. Und wenn der Feind schon vor dem Tor stünde, Simon würde immer noch Witze reißen. Lachend warf er den schwarzen Umhang auf einen Stuhl und nahm den schwarzen Schlapphut ab. Simon Valmon war nicht nur der kräftigste und größte Kerl weit und breit, er war auch der verschwiegenste – und treu, wie es nur die Bretonen sein können. Seit mehr als zwanzig Jahren war er im Dienst des Grafen Frédéric Auguste de la Romme Allery. Als dessen Bursche hatte er den italienischen und den ägyptischen Feldzug mitgemacht. Er hatte sich ausgezeichnet, aber er war kein Soldat geworden – und auch kein Höfling, obwohl er dem Grafen Sekretär, Vertrauter und Gutsverwalter in einer Person war. Simon Valmon war Bauer geblieben. Ein bretonischer Bauer – ein Herr. Mit langsamen Schritten, die Hände auf dem Rücken gefaltet, ging er um den großen Tisch und griff sich schließlich einen Kapaun. »Warten Sie, Monsieur Valmon, ich decke gleich für Sie!«
Marianne hatte mehr als eine mütterliche Schwäche für Simon. Aber er wehrte ab. Heißhungrig biß er in das knusprige Hähnchen und goß sich aus einem dunkelblauen Steingutkrug Wein ein. Ein paar Minuten lang fiel kein Wort. Über den drei Menschen lag eine unheimliche Spannung. Sie dachten alle dasselbe, aber sie wagten nicht, es auszusprechen.
»Wie steht es?« brach Caroline das Schweigen.
Simon warf die abgenagten Knochen in das Feuer, wusch sich die Hände in dem runden eingemauerten Marmorbecken an der Wand.
»Erzählen Sie doch!« drängte auch Marianne. »Ist endlich Schluß mit der Schießerei? Hat’s der Kaiser ihnen wieder gegeben?«
Zwischen Simon und Caroline flog ein Blick hin und her. In dem Gesicht des Mannes ging ein Lächeln auf. Aus den Fältchen um die Augen strahlte es über das verschlossene Gesicht. In seinem schleppenden bretonischen Tonfall begann er dann: »Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn Leutnant Leterpe nicht gewesen wäre...«
»Was ist mit Albert?« fiel ihm Caroline ins Wort.
»Ihr Verlobter hat den Kaiser herausgehauen! – Eine Geschichte für die Geschichtsbücher! Ich hätte dabeisein mögen. Es geschah in einer Feuerpause. Der Feind schien sich zurückzuziehen, aber es war nur ein Hinterhalt. Plötzlich wälzt sich eine Staubwolke heran – sechstausend russische Kosaken greifen an! Und unsere Dragoner auf und davon, wie eine Herde Schafe, wenn es blitzt. – Und der Kaiser – allein auf den Feind!« Er machte eine Pause. Dann fuhr er fort: »Leterpe war der einzige, der den Kopf nicht verlor. Er schoß mitten in die Fliehenden hinein, brachte sie zur Besinnung. Ohne ihn wäre der Kaiser verloren gewesen.«
Simon hatte Caroline die ganze Zeit nicht aus den Augen gelassen. Verflucht! Dieses achtzehnjährige Ding war aus Erz gemacht! Ohne mit der Wimper zu zucken hatte sie zugehört. Noch nie hatte er sie so bewundert wie in diesem Augenblick. Für so eine Frau – da hätte er die Welt aus den Angeln gehoben... Marianne schlug ungeduldig die Deckel über den Körben zu.
»Und?«
»Sie leben beide. Der Kaiser und Leterpe.«
»Und wir haben gesiegt?« fragte Marianne weiter.
Über Simons Gesicht ging ein Schatten. »Komm, pack an!« Zu zweit packten sie einen der schweren Körbe an und schleppten ihn hinaus.
Die Tür fiel hinter Simon und Marianne zu. Caroline löste ihr Halstuch, breitete es auf dem Tisch aus und raffte darin zusammen, was noch dalag: Brot, Speck, Äpfel, eine Flasche Wein. Von dem Bord neben der Tür nahm sie eine Traglaterne und entzündete sie. Dann öffnete sie die Tür zum anschließenden Bügelzimmer, an dessen Ende eine Steintreppe ins Freie führte. Rechts von ihr lag der nächtliche Park. Aber Caroline wandte sich nach links, eilte den überwachsenen Pfad entlang, der im Schatten der Bäume, die längs der Schloßmauer wuchsen, verlief. Der Umriß des alten runden Wehrturms tauchte auf. Seit dem mysteriösen Tod der Mutter vor acht Jahren hatte ihn niemand mehr betreten.
Seit sechs Tagen hielt Caroline hier ihren Bruder Philippe versteckt. Niemand auf Schloß Rosambou ahnte etwas davon. Als sie eines Morgens ihr Ankleidekabinett betrat, hatte ihr Bruder vor ihr gestanden. Er war desertiert, aber Caroline hatte sich keinen Augenblick besonnen. Sie kannte den Vater. Er durfte nichts erfahren. Er würde den Sohn einem Standgericht ausliefern – oder im ersten blinden Zorn selber richten. Auf dem letzten Absatz der Wendeltreppe blieb Caroline stehen und klopfte dreimal kurz hintereinander mit dem Schlüssel gegen die Wand: das verabredete Zeichen. Mit ein paar Schritten war sie dann bei der Tür, schloß auf. Die dicke Honigkerze, die auf dem runden Tischchen neben dem einfachen Lager stand, flackerte. Ihr süßer Duft machte die verbrauchte Luft des Raumes noch stickiger. Philippe sprang vom Bett auf, breitete die Arme aus. »Die Sonne geht auf.« Dabei stieß er gegen den Tisch, die Kerze fiel zu Boden.
»Philippe, paß auf!« Caroline bückte sich schnell. »Der Turm ist wie Zunder.«
»Verbrennen? – Wäre wenigstens ein theatralischer Abgang.« Sein Lachen klang nicht froh. Er sah sich um. »Ich verstehe nicht, daß Mutter die zwei Fenster zumauern ließ...« Er warf sich wieder auf das Bett – »Überhaupt! Wie sie es hier nur ausgehalten hat?«
Der runde Raum enthielt außer Bett, Tisch und Stuhl nichts. Nur die Wände waren ringsum, von der Decke bis zum Boden, mit schwarzsilbernem Brokat verhangen. Am Boden lag ein dunkelvioletter Teppich. Eine Klosterzelle voll düsterer Pracht. Im Oktober 1805, als Napoleon den Feldzug gegen Österreich begann, hatte die Gräfin – eine gebürtige Wienerin – das Turmzimmer bezogen. Es war ihr stummer Protest gegen ihren Mann, der den fünfzehnjährigen Philippe gezwungen hatte, an diesem Krieg teilzunehmen. Hier hatte man sie ein Jahr später tot gefunden ....
Philippe hatte die Hände hinter dem Kopf verschränkt. Die blonden Haare waren zurückgefallen, gaben die Stirn frei. Noch nie war Caroline aufgefallen, wie ähnlich er der Mutter sah. Derselbe hohe weiche Schwung der Augenbrauen, dasselbe samtene Braun der Augen, derselbe schmale langgezogene Mund. Nur das knochige Kinn und die gebogene Nase kamen vom Vater. Unbequem war dieses Gesicht, nervös und aggressiv. Philippe setzte sich auf, zog die Beine an und schlug die Arme um die Knie. Mit einem spöttischen Blick musterte er seine Schwester. »Daß du auf den Albert Leterpe verfallen bist, das will mir einfach nicht in den Kopf. Ärger wird er dir bestimmt nicht machen, nur einen Haufen Kinder – und Langeweile.«
»Das wird von mir abhängen.« Sie lachten beide – aber Caroline wußte genau, daß seine gute Laune nur Attrappe war. Sie spürte die Verzweiflung dahinter, die Unrast. Sie hielt das Bündel noch immer in der Hand; er nahm es ihr jetzt ab, knöpfte den Knoten auf. »Gestern eine Fuhre, heute schon wieder eine, du willst mich wohl mästen?«
»Du wirst die Vorräte brauchen. – Wir reisen diese Nacht ab – nach Paris.«
Sie hatte Bestürzung erwartet oder einen Zornausbruch. So verschieden Philippe von seinem Vater war, in seinem Jähzorn übertraf er ihn noch. Aber Philippe warf den Kopf zurück und lachte. »General Frédéric Auguste de la Romme Allery flieht! – Endlich mal eine menschliche Regung! Sehr gut – der Alte wird mir sympathisch!«
»Wir fliehen nicht – Vater wird in Paris gebraucht!«
»Ich weiß, meine kleine Heroine! In unserer Familie gibt es nur einen Feigling: mich! – Wie konnte ich mir einbilden, Vater hätte diesen größenwahnsinnigen Korsen endlich durchschaut.«
Carolines graue Augen wurden schmal und schwarz. »Wegen dieses hergelaufenen Korsen wird der Name Frankreichs...«
»Unsterblich und so weiter und so weiter...«, unterbrach er sie. »Ich höre Vater reden! Und außerdem haben alle Frauen was übrig für geniale Ungeheuer.«
»Schweig!« Caroline preßte ihm die Hände vor den Mund. – Jetzt hörte auch er die Geräusche, helles Klirren, wie wenn Metall auf Stein stößt. »Ich muß gehen.«
Sie wandte sich um, aber Philippe hielt sie fest. Ohne etwas zu sagen, nahm er sie in die Arme, küßte sie auf die Stirn. »Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast.« Seine Stimme klang plötzlich sehr weich.
Caroline war hinausgeschlüpft und hatte – instinktiv, ohne zu denken – den Schlüssel herumgedreht und abgezogen. Auf den Zehenspitzen schlich sie die Wendeltreppe hinab, dem Geräusch folgend. Der dicke Teppich, mit dem die Mutter die Stiege hatte belegen lassen, schluckte ihre Schritte. Jetzt kam der Quergang, der zur Empore der Schloßkapelle hinüberführte. Caroline war jetzt sicher, daß die Geräusche von dort kamen. Sie schob den Riegel zurück. Ächzend öffnete sich die schwere Tür. Sie machte ein paar zögernde Schritte. Die Dielen knarrten unter ihr. Jetzt sah sie unten im Kirchenschiff einen Lichtschimmer – und dann die hagere, hohe Gestalt des Vaters mit dem schneeweißen, kurzgeschnittenen Haar hinter dem Altar hervortreten. »Caroline? Bist du es?«
Sie stieg die steile Treppe links neben der Orgel hinunter. Die Kapelle von Schloß Rosambou war ein alter romanischer Steinbau und seit sechshundertfünfzig Jahren unverändert: das Taufbecken aus rötlichem Granit, das Deckengewölbe, an dessen roten Schlußsteinen immer wieder das Wappen der Grafen Romme Allery auftauchte – Rose und Schwert –, der Chor mit den verblichenen Fresken und der schwarze schimmernde Basaltblock, der als Altar diente. Auf dem Altar stand als einziger Schmuck ein fünfundsiebzig Zentimeter hohes goldenes Kreuz, über und über mit kostbaren Steinen besetzt. Aber wenn man die Kirche betrat, sah man den Altar nicht. Vierzehn Fahnen, die von den Seitenwänden über Kreuz in den Raum hingen, verdeckten ihn ganz. Es waren die Fahnen der vierzehn Schlachten, die der Graf unter Napoleon geschlagen hatte. Seit dem Tod der Mutter hatte hier kein Pfarrer mehr die Messe gelesen. Es war eine Kirche des Krieges. Eine Kirche, in der es nach Feuer und Blut roch.
»Du hast für den Sieg gebetet?« Der Vater hob die Lampe und betrachtete das Gesicht seiner Tochter.
»Ich habe Abschied genommen.« Die schönen grauen Augen blickten ihn ruhig an; auf den Wangen lag der zarte, blühende Hauch, der ihrem Teint den Schimmer kostbarer Perlen verlieh.
Der Graf machte eine Bewegung, als wolle er etwas abschütteln. »Seltsam – als ich vorhin die Schritte hörte, hatte ich ein Gefühl, als wäre Philippe im Haus...«
Caroline hielt dem Blick des Vaters stand. Sie spürte keine Angst. Was sie für ihren Bruder getan hatte, würde sie immer wieder tun und auch vor dem Vater verteidigen. Nicht weil sie Philippes Handeln billigte, sondern ganz einfach, weil er ihr Bruder war. Aber der Graf schien die Wahrheit nicht zu ahnen. »Ich wollte es dir schon gestern sagen«, fuhr er fort, »Philippe ist nicht tot, wie wir befürchtet haben. Ich habe nachforschen lassen. Er muß in Gefangenschaft geraten sein« – er zögerte –, »oder aber – mein Sohn...« Er verstummte, wandte sich ab. Er wollte nicht, daß Caroline in diesem Augenblick sein Gesicht sehen konnte. Er trat hinter den Altar. »Komm, ich habe dir etwas zu zeigen!«
Caroline trat neben den Vater. Es drängte sie zu sprechen, dem Vater die Wahrheit zu sagen, so schwer sie ihn auch treffen würde. Aber eine innere Stimme sagte ihr, daß das jetzt nicht die Stunde dafür war...
Der Graf hob die Laterne. Der Lichtschein fiel auf den Boden. »Ich habe hier eine Kassette mit Goldmünzen und Dokumenten vergraben. Unter dem Stein in der Mitte. Ich werde eines Tages nicht mehr sein – und wenn du es brauchst, Simon weiß davon. Simon kannst du vertrauen.«
Caroline griff nach der Hand des Vaters, eine Geste der Zärtlichkeit, die er selten duldete, aber in diesem Augenblick sogar erwiderte.
»Ich weiß, Caroline, was auch immer geschehen mag, du wirst schon das Richtige tun.« Er deutete auf das Wappen: »Die Rose und das Schwert – so ist das Leben –, Liebe und Kampf...«
Er öffnete die Tür zur Sakristei und trat an den Schrank, in dem man früher die Meßgeräte und Gewänder aufbewahrt hatte. Er drückte auf eine Feder: Ein Geheimfach sprang heraus. Eine Schmuckschatulle kam zum Vorschein. Der Vater klappte den Deckel zurück: Funkelnde Pracht lag vor Carolines Augen. »Deine Mutter hat ihren Hochzeitsschmuck nur einen Tag lang getragen – dann nie mehr. Er gehört jetzt dir.« Caroline beugte sich über das Geschmeide. »In Paris wirst du genug Zeit haben, das Zeug zu betrachten...«
Caroline nahm die Schatulle. Als sie die Kirche betrat, sah sie ihren Vater, wie er die Fahne von Marengo aus dem Schaft zog, sie auf den Steinboden legte und die Verschnürungen löste. Er faltete sie zusammen. Den Fahnenschaft stieß er mit dem Fuß zur Seite. »Mit der will ich begraben sein – versprich mir das!« Sein schmales, braunes Gesicht mit den tiefliegenden Augen unter den buschigen Brauen und der gebogenen Nase war beherrscht wie immer. Sie konnte nur erraten, was in ihm in dieser Stunde vorging...
Der Hochzeitsschmuck ihrer Mutter lag ausgebreitet auf ihrem Himmelbett: Diadem, Halsband, Ohrringe, Armband und Ring. Ein funkelndes Gewirr aus Sternen und Blumen. Caroline konnte der Versuchung nicht widerstehen. Sie mußte ihn anlegen! Für ein paar Minuten wenigstens.
Im Treppenhaus hallten die schweren Schritte Simons wider und die ungeduldige Stimme ihres Vaters. In zwanzig Minuten würden sie aufbrechen. Caroline schnürte die Reitstiefel auf, legte das Reitkostüm ab. Sie hatte es so eilig, daß sie nicht einmal mehr das leise Klirren des Schlüssels zum Turmzimmer hörte, als sie die Jacke über einen Hocker warf. Sie schlüpfte in das weiße Spitzennegligé, zündete die beiden Kerzen neben dem hohen venezianischen Wandspiegel an und steckte ihr blauschwarzes Haar mit silbernen Spangen hoch. Dann legte sie den Schmuck an, fühlte ihn schwer und kühl auf der Haut – und es war ihr, als sprächen diese Steine auf eine geheimnisvolle Weise zu ihr: Paris! Sie trat vom Spiegel zurück und lächelte. »Wir sind alle verrückt. Philippe, Vater, ich – und Mutter muß es auch gewesen sein, sonst hätte sie diesen Schmuck getragen...«
Die Uhr auf dem Kamin zeigte drei Viertel acht. Um acht Uhr mußte sie fertig sein. Sie mußte sich beeilen. Hastig trennte sie an dem Mantel, der schon bereitlag, die Pelzbesätze an Ärmel und Kragen auf und versteckte den Schmuck darin. Dann nähte sie alles wieder mit schnellen Stichen zu. Der große schwarze Schiffskoffer mit ihren Kleidern war schon gepackt, aber sie ging noch einmal zurück in ihr Ankleidekabinett. Dort lagen die Habseligkeiten aus ihrer Kindheit: eine alte Stoffpuppe, Zinnsoldaten, ein kleiner Degen, eine Pappschachtel; rosa Seidenpapier raschelte – in silberner Filigranarbeit lag Napoleons Krönungskutsche vor ihr, die der Vater einmal aus Paris mitgebracht hatte. Und dann in einer Mappe aus rotem Saffianleder: Alberts Briefe.
Albert! Die Worte ihres Bruders fielen ihr ein. War Albert wirklich so? Sie sah ihn vor sich: groß, wuchtig, auf den breiten geraden Schultern den mächtigen Kopf mit den braunen Locken, alles war einfach und gerade an ihm — wie seine Welt. Eine Welt ohne Abgründe, ohne Probleme und im Grunde so verschieden von der ihren! Aber davon schien er nichts zu ahnen.
Ein Schlag ans Fenster ließ sie zusammenschrecken. Sie zog hastig die schweren goldgelben Brokatvorhänge zurück – da sah sie den Mann auf dem unteren Sims der Erkermauer stehen. Zuerst erkannte sie ihn nicht, in dem grauen schlammverspritzten Umhang.
Mit einem Klimmzug war Albert Leterpe über der Fensterbrüstung und stand vor ihr. Sein Gesicht war grau vor Müdigkeit, der rote Uniformrock unter dem Umhang zerfetzt. Er strömte den Geruch von Pferden, Pulver und Schweiß aus. »Wir brauchen Kutschen – frische Pferde!« stieß er hervor. Dann erst bemerkte er, daß Caroline im Negligé war. »Caroline!« Er schlang seine Arme um ihren schlanken biegsamen Körper. Ihr Leben sprang heiß auf ihn über ‒ und er hob sie auf und trug sie zum Bett... der Krieg, die Kutschen, die Pferde, alles versank. Es gab nur noch sie! »Caroline. .. Caroline«, stammelte er.
Caroline erging es wie ihm. Bebend lag sie an ihn geschmiegt – brannte unter seinen Küssen, seinen Berührungen. Jetzt waren seine Hände am Gürtel ihres Negligés, versuchten die Schleife zu lösen...
»Und ich dachte, du seist wegen der Kutschen gekommen«, murmelte sie zärtlich.
»Ich dachte es auch«, flüsterte er zurück. Erst dann begriff er den Sinn der Worte. Er mußte sich Gewalt antun, sie zu lassen. »Caroline – du bist eine Zauberin.« Er erhob sich. Da sah er den Koffer. Caroline war seinem Blick gefolgt. »Wir verlassen Rosambou und gehen nach Paris«, sagte sie.
»Ich muß mit deinem Vater sprechen. Ich brauche Kutschen und Pferde, die besten, für den Kaiser!«
»Ist die Schlacht verloren?«
»Wir haben alles zurücklassen müssen. Ich muß heut nacht noch St. Dizier erreichen.«
»Eine Sekunde. Ich komme mit zum Vater.« Sie verschwand im Ankleidekabinett. Als sie zurückkam, trug sie ein hochgeschlossenes lavendelblaues Wollkleid, dessen einziger Schmuck eine kostbare römische Gemme war.
Leterpe hatte seine Leute im äußeren Wirtschaftshof absitzen lassen. Ein Stalljunge füllte die steinerne Tränke mit frischem Wasser aus dem Ziehbrunnen und schleppte eine Haferkrippe herbei. Die Soldaten rieben ihre dampfenden Pferde ab und sanken dann neben der verglimmenden Feuerstelle auf den Boden. Marianne kam mit zwei Tragkörben über den Hof auf die Soldaten zugerannt. Sie ging von Mann zu Mann und teilte Wein, Schinkenstücke und Brot aus. Die Männer griffen zu und aßen gierig. Leterpe, zu dem Marianne zuletzt trat, winkte ab. Er hatte keinen Appetit.
»Geben Sie mir!« Ein Soldat sprang auf, riß Marianne die Weinflasche aus der Hand und blieb dann vor Leterpe stehen. Es war Peran, ein alter Haudegen mit einem wilden, pockennarbigen Gesicht. »Hätte man prima zu einem Stützpunkt ausbauen können – das Schloß hier...« Er setzte die Flasche wieder an den Mund.
Peran ging Leterpe auf die Nerven, aber er schwieg. Er war mit den Gedanken woanders. Peran trat noch näher auf ihn zu: »Partisanenkrieg! Verstehst du... Wie die Russen müßte man es machen: alles anzünden – damit sie nichts mehr finden.« Er starrte in das verglimmende Feuer, und in seinem trunkenen Hirn keimte ein Entschluß auf...
2
Arcis-sur-Aube brannte immer noch.
Caroline preßte ihr Gesicht an das Kutschenfenster. Sie war noch ganz benommen von den Bildern des Aufbruchs... Simon, unter der Last ihres Koffers – Vater, wie er mit dem großen Schlüsselbund die Haupttore verschloß – Marianne, das rote wollene Tuch um die Schultern, wie sie weinend in der Nacht verschwand, um im nahen Hof ihres Bruders unterzuschlupfen. Und dann Luna, ihr schwarzer Vollbluthengst mit dem weißen Stern auf der Stirn, wie fröhlich er gewiehert hatte, als Simon ihn aus dem Stall geholt und an Alberts Pferd angekoppelt hatte.
Draußen huschte die Landschaft vorüber, glänzende Pferdeleiber, bunte Uniformröcke, und immer wieder tauchte das gespannte, übernächtige Gesicht Alberts auf. Die Landschaft glich einer magisch beleuchteten Theaterkulisse. Die Bäume, die Sträucher, alles schien plötzlich fremd und unwirklich unter diesem violetten Himmel mit dem Halbmond, blaßrot und durchsichtig wie eine Mohnblüte.
Der Troß – die drei Kutschen für Napoleon, die Kutsche und der Karren des Grafen – rollte durch den Schloßpark von Rosambou. Hier war Caroline aufgewachsen. Auf diesen Kieswegen hatte sie laufen gelernt. Im Teich beim türkischen Pavillon wäre sie beinahe ertrunken. Die Steinfiguren bei den Wasserspielen am Ende des Parks – sie hatte als Kind bittere Tränen darum vergossen, denn sie hatte geglaubt, es seien verzauberte Menschen. Wie lange war das her... Sie kamen an der großen Lichtung vorüber, an deren Ende der Park ins offene Land überging. Jenseits, längs eines Baches, war ein Laubengang angelegt, über und über mit wilden Rosen umsponnen. Dort hatte Albert sie zum erstenmal geküßt, dort war unter seinen Liebkosungen die Frau in ihr erwacht. Die Nacht war kalt. Caroline wischte den Beschlag vom Fenster. Albert ritt jetzt neben ihrer Kutsche. Sie versuchte sein Gesicht zu erkennen. Aber er war nur eine dunkle Silhouette vor dem glühenden Himmel. Caroline fröstelte plötzlich. Eine kalte, ahnungsvolle Angst um Albert befiel sie. Am liebsten hätte sie anhalten lassen, wäre auf ihr Pferd gesprungen, das Albert neben sich führte, und wäre an seiner Seite geritten!
Sie wandte sich zu ihrem Vater. Er saß ihr gegenüber, die Hände auf den Knien – ein undurchdringliches Schweigen umgab ihn. »Krieg ist etwas Gräßliches!« Zum erstenmal fühlte sich Caroline in eine Welt gestoßen, vor der ihr graute. Sie war wie erlöst, als die Stimme des Vaters aus der Dunkelheit kam. »Gräßlich gewiß – aber menschlich. In allem was lebt, steckt dieser Keim zum Kampf; zwischen allen Menschen, sogar zwischen Liebenden.« Nach einer Pause fuhr er fort: »Deine Mutter war eine stille Frau, aber ich bin sicher, in allen ihren Gebeten hat sie Gott angefleht, er möge mich ändern. Sie hätte mich schwächer gewollt... Auch das ist Kampf...«
»Ich kann einfach nicht glauben, daß ein Gott diese wüste Welt erschaffen hat – verstehst du mich?« Caroline wunderte sich selbst über ihre Worte.
»Nur zu gut. Du wirst noch oft zweifeln. Vielleicht gibt es einen Gott – und es genügt, wenn er sich alle paar hundert Jahre einmal zeigt – in Menschen, an denen alles groß ist: ihr Verstand, ihr Mut‒ihr Herz...«
Sie hatten den Park verlassen. Gleich würde die Anhöhe kommen, von der aus man noch ein letztes Mal Schloß Rosambou sehen konnte. Caroline drehte das Fenster herunter. Albert, der vorausgeritten war, ließ sein Pferd in Trab fallen. Er beugte sich zum Kutschenfenster herunter. Seine Stimme war ganz Wärme: »Die Nacht ist kühl.«
Aber Caroline hörte es nicht, denn dort, wo das Schloß mit seiner breiten, wuchtigen Fassade und den runden Wehrtürmen stand, zuckte greller Feuerschein in den nächtlichen Himmel. Rosambou. Rosambou brannte! Philippe! Sie mußte zurück. Ohne eine Sekunde zu überlegen, riß Caroline den Schlag der Kutsche auf. »Halt an, Simon!« schrie sie dem Mann auf dem Kutschbock zu. Sie hatte ihren Fuß schon auf dem Tritt, aber der Vater war schneller. Er packte sie bei den Schultern und riß sie in den Fond zurück. Die Kutschentür schlug krachend im Fahrtwind.
»Was zum Teufel soll das? Willst du dir alle Glieder brechen?«
»Rosambou! Es brennt! Sieh doch! Ich muß hin!«
Der Graf schaute zurück. »Was willst du? Wegen einer brennenden Remise zurück? Reiß dich zusammen!«
Wie sollte er sie verstehen? Er wußte nicht, was sie wußte. Verzweifelt versuchte sie sich aus seinen Händen zu winden. »Laß mich – oder du wirst es bereuen!« Er war jetzt nicht mehr ihr Vater, sondern nur eine fremde Macht – so feindlich wie das Feuer, das Philippe töten würde...
Der Graf starrte sie fassungslos an. Simon hatte die Pferde gezügelt, und die Kutsche kam zum Stehen. Caroline schnellte auf und sprang nach draußen. »Schnell mein Pferd! Bind mein Pferd los!«
Sie wollte sich auf den sattellosen schwarzen Hengst, den Leterpe mit sich führte, schwingen – als der Vater ihr die Arme auf den Rücken riß. »Caroline! Komm zur Besinnung!« Die Hände auf dem Rücken, stieß er sie vor sich her zur Kutsche. »Los, fahr zu Simon!« Und zu Caroline: »Voran, steig ein!« Sein harter Griff, mit dem er ihr die Hände auf den Rücken hielt, schmerzte, daß sie hätte schreien mögen. Aber sie preßte die Lippen aufeinander.
»Philippe ist in Rosambou im Turm!« sagte sie dann mit unheimlicher Ruhe – und ohne darauf zu achten, ob Leterpe sie vielleicht hörte. Jetzt konnte nur noch die Wahrheit Philippe retten.
»Philippe?« Der Vater ließ sie los.
»Ja, Philippe. Ich selbst habe ihn dort versteckt – vor dir!«
Für den Bruchteil einer Sekunde schien der Graf wie gelähmt. Es stimmte also, was er die ganze Zeit geahnt hatte, aber nicht wahrhaben wollte. Sein Sohn – der Sohn des napoleonischen Generals de la Romme – ein Deserteur! Im eigenen Haus versteckt!
Caroline sah, wie das Gesicht ihres Vaters versteinerte – gleich würde er das Todesurteil sprechen, wie damals, als man in einer Jagdhütte beim Schloß den siebzehnjährigen Sohn eines Pächters entdeckte, der desertiert war. »Ein Deserteur hat sein Leben verwirkt«, hatte ihr Vater damals zu den Eltern des Jungen gesagt – und sie gezwungen, ihn dem Standgericht auszuliefern. Caroline fuhr zusammen, als sich die Hand des Vaters auf ihr Haar legte. »Ich reite zurück.«
»Laß mich mit!« bat sie.
Er schüttelte den Kopf. »Das ist eine Sache zwischen Philippe und mir. Ihr fahrt weiter.«
Caroline nickte stumm. Sie versuchte im Gesicht des Vaters zu lesen. Was hatte er vor? Würde er Philippe selber richten? Sie sah ihm nach, als er sich auf ihr Pferd schwang und den Abhang hinunterjagte. Leterpe, der alles stumm beobachtet hatte, trat zu Caroline. »Was ist mit Philippe?«
Sie antwortete nicht. Sie starrte in die Nacht hinaus, zu dem brennenden Schloß dort unten. Der ganze linke Trakt stand in Flammen. Kapelle und Turm waren nicht mehr zu sehen. Caroline schlug die Hände vors Gesicht.
Noch ein anderer hatte alles beobachtet und gehört: Peran. Vorhin, bei der kurzen Rast auf Rosambou, hatte er drei Flaschen Wein geleert – und dann war in seinem trunkenen Kopf eine Idee aufgekeimt, verzweifelt, sinnlos und verbrecherisch: Er würde das Schloß in Brand stecken. Der Feind sollte nichts mehr finden als schwelende Asche... Und er hatte es getan. Er ließ sein Pferd zurückfallen. Niemand achtete darauf. Als der Abstand zu den anderen groß genug war, riß er es herum und preschte dem Grafen mit verhängten Zügeln nach.
Die steile Stichflamme machte den äußeren Wirtschaftshof taghell. Vom Scheunendach aus, wo das Feuer ausgebrochen war, hatte es auf den angrenzenden Wehrgang und den runden Holzturm an dessen Ende übergegriffen. Der Turm war einer der ältesten Teile von Schloß Rosambou, das Holz Jahrhunderte alt und morsch. Links fand das Feuer keine Nahrung: Die Kapelle war aus Stein, und hinter dem Turm verlief die steinerne Schloßmauer. Auch dort würde das Feuer sich nicht ausbreiten können. In einer Stunde würde alles vorbei sein. Nur vom Turm würde dann nichts mehr übriggeblieben sein als ein Haufen Asche.
Der Graf brachte sein Pferd unter dem Torbogen zum Stehen. Er war so in Gedanken versunken, daß er Peran nicht bemerkte, der jetzt ebenfalls das Tor erreichte, absaß und, sein Pferd am Zügel führend, hereinschlich. Mit abwesendem Gesicht starrte der Graf auf den brennenden Turm, in dem sein Sohn war – hörte das Zischen der gefräßigen Flammen – atmete den scharfen Brandgeruch. War das nicht wie ein Gottesurteil? Hatte nicht eine höhere Gewalt eingegriffen? Sein Sohn hatte sein Leben verwirkt – aber seine Ehre war noch zu retten, durch diese Flammen. Den Grafen schauderte vor seinen eigenen Gedanken – aber er konnte sie nicht mehr zügeln. Er würde dafür sorgen, daß der Name seines Sohnes in die Vermißtenliste aufgenommen würde – ein paar Jahre später würde man ihn für tot erklären lassen. Die Ehre des Sohnes, die Ehre der Familie wäre gerettet. Aber Caroline! Sie würde ihn durchschauen – und er würde auch sie noch verlieren. Er sprang vom Pferd.
Der Graf war ein Mann, der für seine Kaltblütigkeit als General berühmt gewesen war. In Augenblicken höchster Gefahr handelte er, der sonst so oft ein Opfer seines Temperaments wurde, kalt und überlegt. Auch jetzt. Er rannte in den Geräteschuppen, holte sich eine Hacke, einen Kübel mit Sand, Säcke und lederne Gurte. Er nahm seinen schweren dunkelgrünen Tuchmantel ab und warf ihn zusammen mit dem Hut und den Säcken in den Trog, aus dem die Pferde getränkt wurden. Er wartete, bis sich alles mit Wasser vollgesogen hatte. Mit den nassen Sackfetzen umwickelte er sich die Füße, schnürte sie mit Lederriemen fest. Den triefend nassen Mantel zog er mit einem Ruck fest um den Leib und setzte den Hut auf. So betrat er die Kapelle. Von der Empore drückten dunkle Rauchschwaden herunter.
Peran hatte sein Pferd angebunden und war dem Grafen in die Kapelle gefolgt.
Der Graf stürmte mit angehaltenem Atem die schmale Treppe zur Empore hinauf. Hinter der Orgel befand sich ein altes Rosettenfenster aus buntem Glas mit dem Wappen der Familie. Er schlug es mit der Hacke ein, stieg hindurch in den Wehrgang. Hier stand schon alles in Flammen. Von der Decke fiel glühender Staub. Der Rauch war so dicht, daß er kaum noch etwas sah. Endlich erreichte er die Wendeltreppe. Die erste Stufe gab unter ihm nach. Mit der rechten Hand fing er sich an der dicken Kordel, die an der Mauer angebracht war und als Geländer diente, und zog sich daran, dicht an die Mauer gepreßt, weiter. Als er endlich taumelnd an der Tür anlangte, bemerkte er, daß er die Hacke nicht mehr hatte. Mit seiner ganzen Körperkraft warf er sich gegen die Tür. Krachend fiel dicht vor ihm ein Stück Decke herunter. Er wich zurück, atmete den Geruch versengter Haare ein. Eine plötzliche Schwäche überkam ihn. Doch dann warf er sich wieder mit den Schultern gegen die Tür, wieder und wieder, bis er fühlte, wie sie splitternd aus Schloß und Angeln brach. Er fiel nach vorne. Als er sich aufraffte, spürte er etwas Weiches, einen Körper. Philippe! Er rüttelte den Leblosen. Mit letzter Kraft packte er den Bewußtlosen unter den Armen, zog ihn hinter sich her. Flammen züngelten an ihm empor, Dielen barsten unter seinem Schritt. Endlich erreichte er den Wehrgang, das eingeschlagene Rosettenfenster...
Im Hof legte der Graf den Sohn auf den Boden, riß sich die glimmenden Kleider vom Leib und die brennenden Fetzen von den Füßen. Dann kniete er sich über ihn, öffnete das Wams über der Brust und horchte. Das Herz schlug noch, flach und unregelmäßig.
Er faßte die Arme seines Sohnes bei den Handgelenken und begann sie mit gleichmäßigen rhythmischen Bewegungen auf die untersten Rippenbögen zu pressen. Ein leises Stöhnen war das erste Zeichen des zurückkehrenden Atems ‒ und dann bewegte Philippe die Lippen, murmelte etwas. Der Graf sprang auf die Füße, eilte zum Ziehbrunnen, füllte einen Kübel mit kaltem Wasser – und schwappte es über den Sohn. Ein Zittern lief durch Philippes Körper – und dann richtete er sich mit langsamen, traumwandlerischen Bewegungen auf, stützte den Oberkörper auf die Ellbogen. Verstört blickte er um sich, wie ein Mensch, der aus einem bösen Traum erwacht...
Peran, der alles beobachtet hatte, trat jetzt aus dem Schatten, in der Rechten eine Flasche Wein, die er irgendwo im Hof aufgeklaubt hatte. Leicht schwankend trat er auf Philippe zu, kniete sich vor ihm nieder, um sein Gesicht deutlicher zu erkennen. Als er sich aufrichtete, war sein Gesicht eine höhnische Grimasse. Er lachte betrunken: »Sieh mal an. Der vermißte Leutnant de la Romme! Hier also, in diesem Schlupfwinkel, steckt er! Ich ahnte es doch, daß etwas faul war.« Er sah den Grafen frech an. Sein Atem roch nach Wein. »Und die anderen? Herr Graf? Mit Ihrem feinen Sohn sind noch drei andere verduftet. Wo sind sie?«
Der Graf griff in die Jackentasche nach der Pistole. Er spannte den Hahn und zielte, aber dann ließ er die Waffe sinken und sagte kalt: »Das hier geht nur meinen Sohn und mich etwas an. Verstanden! Verschwinde, ehe ich dich niederknalle.« Er wandte sich ab, ohne weiter auf ihn zu achten.
Er sah nicht, daß Peran den Weg zum Turm einschlug – nur besessen von dem Gedanken, die anderen Deserteure zu finden... »Ich werde sie herausholen, diese Verräter, diese Hunde...«, murmelte er vor sich hin...
Philippe hatte sich zu dem Wassertrog geschleppt. Er füllte die Handflächen mit Wasser und trank gierig. Dann erhob er sich, trat auf seinen Vater zu. Er blickte auf die Waffe, die der Graf noch immer in der rechten Hand hielt. »Also tue es schon« sagte er befehlend.
Der Vater rührte sich nicht vom Fleck. Wie angewurzelt stand er da, seinem Sohn gegenüber, der in der weißen Hose und dem grünen Rock eines Dragoneroffiziers vor ihm stand.
»Los! Ein Mensch weniger, was ist das schon. Dein Kaiser hat ganze Jahrgänge ausgemerzt!« Philippe trat noch einen Schritt auf den Vater zu, riß das geöffnete Wams vollends auf. »Worauf wartest du noch? Ich habe zwar viel vergessen, was man mir eingebleut hat, aber eines nicht: Ein Deserteur ist nicht mehr wert als ein toller Hund... Los, rette die Ehre der Grafen Romme!«
Der Vater schüttelte den Kopf, steckte die Waffe weg. Er kämpfte mit Empfindungen, die sich mit seiner Ehre nicht vereinbaren ließen. »Ich muß zurück«, sagte er beherrscht. »Unsere Wege trennen sich – für immer. Leb wohl.« Er zog seine Brieftasche, nahm ein Bündel Banknoten heraus und hielt sie dem Sohn hin.
»Weißt du, was du tust? Du hilfst einem Deserteur zur Flucht.« »Ich helfe meinem Sohn. Zum letztenmal. Nachher wird es keinen Sohn mehr für mich geben – ich habe ihn in dieser Stunde verloren.«
Der Graf wollte sich abwenden. Aber Philippe griff nach seinem Arm. »Wir sind noch nicht fertig, wir zwei. Ich habe zu lange geschwiegen und zu oft. Als du mich als Kind in die Kadettenschule und mit fünfzehn Jahren in die Armee gezwungen hast – in die Armee, die gegen Österreich marschierte, gegen das Land deiner Frau – das war ihr Tod, das hat sie umgebracht! Und du! Du hast es mit angesehen! – Warst du so blind – oder warst du so grausam? Ich habe schon damals meinen Vater verloren.«
Der Graf sah seinen Sohn an, und es war ihm, als tue er zum erstenmal einen Blick in dessen wahres Wesen. Die Stunde, in der er zum erstenmal spürte, daß etwas von ihm selbst in dem Sohn weiterlebte – diese Stunde machte zugleich alles zunichte. Er machte eine Bewegung auf Philippe zu, aber ein Schrei ließ sie beide auffahren. Er kam vom Turm. Ein gellender Todesschrei. Und dann sahen sie in den Flammen die Silhouette eines Mannes – mit den Händen ins Leere greifend. Im selben Augenblick stürzte der Turm krachend in sich zusammen, begrub die Gestalt unter sich in einem sprühenden Feuerregen.
Sie fanden Peran unter den Trümmern, aber jede Hilfe kam zu spät. Philippe beugte sich zu dem Toten und drückte ihm die ins Leere starrenden Augen zu. »Schon wieder ein Vater, der seinen Sohn verloren hat.« – Und nach einer kleinen Pause: »Also dann, bis in Paris – das verspreche ich dir, ich werde dabeisein, wenn Paris kapituliert!« Ohne das Geld zu beachten, das der Vater noch immer in der Hand hielt, wandte Philippe sich ab. Er ging zu den beiden Pferden, die am Tor angebunden waren und, von dem Feuer unruhig gemacht, ängstlich wieherten. Er nahm Perans Pferd, und ohne sich noch einmal umzusehen, ritt er davon.
3
Der Mond warf sein blasses Licht auf Carolines Gesicht, verwandelte das dunkle Grau ihrer Augen in irisierendes Silber. Albert, der neben ihr in der Kutsche saß, die holpernd auf der Straße zwischen den mächtigen Alleebäumen dahinfuhr, zog sie an sich. Caroline bog den Kopf zurück, lächelte ihn an. Aber ihre Gedanken waren beim Vater. Er hätte längst zurück sein müssen. Albert neigte sich über sie. Mit dem Zeigefinger zog er die Linien ihres Gesichts nach. Die Brauen, die Wangen, die Nase mit ihren zarten vibrierenden Flügeln, den Mund. »In wenigen Tagen werden wir in Paris sein«, brach er das Schweigen. »Und du wirst sehen, es wird bald Frieden geben. Dann werden wir heiraten! Dann werde ich dich endlich ganz für mich haben. Alle Tage, alle Nächte! Immer mußt du um mich sein. Die ganze Welt schauen wir uns zusammen an. Das wünschst du dir doch immer.«
Caroline wunderte sich über sich selbst. Was war los mit ihr? Sie liebte ihn doch? Wenn diese Liebe auch so ganz anders war, als sie sich immer gedacht hatte, daß Liebe sein würde. Liebe – ein Feuer, das einen verzehrt.
Der Hufschlag eines Pferdes schreckte sie aus ihren Gedanken. Und dann sah sie ihren Vater. Im Mondlicht glänzte das dunkle Fell Lunas vor Schweiß. Der Graf rief etwas, und die Kutsche hielt.
Caroline und Albert waren ausgestiegen. Albert nahm die Zügel von Luna und sah den Grafen forschend an. Der fehlende Mantel, die versengten Haare – aber er fragte nicht. »Sie haben einen Mann verloren«, sagte der Graf. »Peran.«
»Peran?«
»Ja, er ist mir nachgeritten. Vielleicht wollte er mir helfen. Er war in dem brennenden Turm, als er zusammenstürzte. Er war sofort tot.«
Caroline bewunderte ihren Vater, seine absolute Beherrschung. Aber zugleich war er ihr unheimlich.
Albert hätte noch viele Fragen gehabt, aber die Zeit drängte. »Wir müssen uns jetzt trennen. Ich muß diese Nacht noch St. Dizier erreichen. Auf der Hauptstraße sind Sie jetzt sicher. Und vielen Dank für die Kutschen.«
»Sagen Sie dem Kaiser, daß er auf den General de la Romme rechnen kann, wenn er ihn braucht.« Der Graf stieg in die Kutsche, er wollte die beiden jungen Leute nicht stören bei ihrem Abschied.
Albert schlug seine Arme um Caroline – mit einer plötzlichen Heftigkeit, die sie an ihm bisher nie erlebt hatte – und flüsterte, während er sie küßte: »Bald hab’ ich dich ganz für mich, Tag und Nacht.«
Bald war Albert mit seinem Trupp auf einem Seitenweg in der Nacht verschwunden. Caroline winkte ihm nach, so lange sie noch etwas von seinem Helmbusch sehen konnte. Der Graf klopfte an die Wand zum Bock. »Vorwärts, Simon!« Mit einem Ruck fuhr die Kutsche an.
»Lebt er?« fragte Caroline. Der Vater nickte. Sein Gesicht verriet nichts. Und sie wagte nicht weiterzufragen. Es hatte zu regnen begonnen. Der Wind peitschte die Tropfen gegen das Kutschendach. Carolines Kopf lehnte an der Schulter des Vaters. Sie hatte die Augen geschlossen, aber sie schlief nicht. Der Rest der Nacht erschien ihr wie ein Spuk: das eintönige Trommeln des Regens, die vor Kälte beschlagenen Scheiben, das Holpern der Räder über die schlechte Straße – Simons Stimme und Peitsche, wenn er die Pferde antrieb. An irgendeiner Poststation hatten sie Rast gemacht. Es war tief in der Nacht gewesen. Dann der Aufbruch im Morgengrauen – die vereinzelten Schüsse entfernter Vorpostengefechte, die der Wind zu ihnen hertrug – und endlich St. Dizier.
Es war gegen Mittag, als sie es erreichten. Über dem Biwak auf den Feldern vor der Stadt hing tief und schwer ein verregneter Himmel. Alles war grau und naß: die Zelte, die Pferde, die Karren und die Kutschen – und auch die Menschen, die dazwischen herumhasteten. Der Graf holte sich einen neuen Mantel aus dem Gepäck, warf ihn über die Schultern und wandte sich an Caroline: »Warte hier auf mich – ich muß zum Kaiser.«
Simon füllte zwei lederne Futtertaschen mit Hafer und hängte sie den Pferden um. Auch Caroline war inzwischen aus der Kutsche gesprungen, strich sich die verdrückten Röcke glatt und klaubte ein paar Stäubchen von ihrem violetten Tuchmantel mit dem silbergrauen Luchsbesatz. Im Kutschenfenster prüfte sie ihre Haare. Sie waren hochgesteckt. Unter dem silbergrauen Pelzbarett drängten sie in wilder unbezähmbarer Fülle hervor. Aber das gehörte zu ihr, das machte sie schöner als gedrechselte Lockenpracht. Aus ihrem Beutel holte sie ein duftendes Spitzentaschentuch und steckte es in den Ärmel. Ihre Toilette war beendet. Simon reichte ihr vom Bock den Essenskorb herunter. »Sie sind sicher hungrig?«
»Nein, neugierig! Ich sehe mich etwas um, ich bin gleich wieder zurück.«
Das Gelände war morastig. Überall standen Pfützen. Mit beiden Händen raffte Caroline die Röcke, setzte Fuß vor Fuß, schritt mitten durch die Soldaten, die müde und abgerissen auf dem nackten Boden lagen. Bisher kannte sie Armeen nur von Paraden und Schlachtenbildern. Was sie jetzt sah – das waren Geschlagene – eine Armee aus Kindern und Invaliden. Wo sie durchschritt, richteten sich Männer auf, riefen ihr Scherzworte nach, pfiffen durch die Zähne. Caroline lief es kalt über den Rücken. Diese Art der Bewunderung war ihr unheimlich. Sie war froh, als sie das spitze Zelt mit der kaiserlichen Standarte entdeckte – und dann sah sie auch ganzin der Nähe die drei Kutschen. Siegingdaraufzuundsah, wie ein Mann damit beschäftigt war, das Wappen der Grafen Romme mit einem großen goldenen N zu übermalen. Und dann entdeckte sie auch Kira, Alberts Pferd. Sie wollte das Tier streicheln, aber es wich nervös und ängstlich der Berührung aus und schnaubte erregt. Sie tratan den Wagen. Die Vorhänge warenzugezogen. Vielleichtschlief Albert noch. Ihre Hand griff nach dem silbernen Türknauf. In der Nähe schrie eine Männerstimme: »Haltet sie zurück! Schnell!« Aber Caroline hatte den Schlag schon geöffnet.
Das erwartungsvolle Lächeln auf ihrem Gesicht erlosch vor dem entsetzlichen Anblick. Auf dem Boden der Kutsche lag Albert mit einer klaffenden Wunde quer über der Stirn. »Albert! Albert!« Sie warf sich über den Toten.
Der Kaiser hatte sich hinter seinem Schreibtisch erhoben und war dem Eintretenden entgegengegangen. »Graf de la Romme! Es tut gut, ein altes, vertrautes Gesicht zu sehen.«
In dem runden Zelt aus schwerer grüner Seide mit dem goldgestickten Adler hinter dem Schreibtisch standen auf niedrigen Steinsockeln fünf breite Kupferbecken, bis zum Rand mit glühender Holzkohle gefüllt. Räucherstäbchen aus Aloe, die glimmend auf dem Rost über der Glut lagen, strömten einen herben Duft aus. »Es tut mir leid, daß unser erstes Wiedersehen mit einer schlimmen Nachricht für Sie beginnt«, sagte der Kaiser. »Ihr zukünftiger Schwiegersohn, Leutnant Leterpe... er ist tot.«
»Leterpe? Tot?« Der Graf starrte fassungslos in das Gesicht des Kaisers.
»Ein feindlicher Spähtrupp. Sie überfielen den Troß mit den Kutschen. Leterpe fiel in dem Gefecht. Die anderen kamen durch.«
Der Graf hatte den Kopf gesenkt. Sein erster Gedanke war Caroline! Er mußte zu ihr. Sofort, bevor sie es vielleicht von anderen erfuhr. Napoleon legte die Hand auf die Schulter des Grafen und sagte mit leiser Stimme: »Es sind immer die Besten...« Sein gebieterisches Gesicht verlor für einen Moment seine Ruhe und zeigte einen Zug tiefer Erschöpfung. Vor dem Zelt wurden Stimmen laut. Der Vorhang teilte sich, ein Soldat der Wache trat zögernd ein. »Was soll das?« fuhr ihn der Kaiser an. »Ich will ungestört sein!«
»Majestät! – Ein junges Mädchen – bei der Kutsche – sie hat den Toten gefunden.«
Noch bevor er zu Ende gesprochen hatte, war Graf de la Romme an ihm vorbei aus dem Zelt gestürzt.
Reglos lag Caroline über dem Toten. Ihre Arme umschlangen den kalten, erstarrten Körper. Ihre Haare hatten sich unter dem Pelzbarett gelöst und fielen in schweren schwarzen Flechten über das Gesicht des Toten, bedeckten die klaffende Wunde. »Caroline!« Der Graf war herangetreten und half seiner Tochter behutsam auf. Sie ließ es geschehen, blieb an ihn gelehnt stehen, das Gesicht an seiner Schulter vergraben. Der Graf legte schützend den Arm um sie, wollte sie wegführen – da erblickte er den Kaiser, der ihm gefolgt war.
»Majestät.« Der Graf machte eine Geste. »Darf ich Ihnen meine Tochter vorstellen.« Dann wandte er sich wieder Caroline zu, redete leise auf sie ein.
Sie löste sich aus seinem Arm, aber er wartete vergeblich darauf, daß sie vor dem Kaiser in eine Reverenz versinken würde.
Caroline stand regungslos, mit zurückgeworfenem Kopf. Sie blickte den Mann an, der vor ihr stand, in dem legendären grünen Rock, sah das Gesicht, blaß im kalten Licht des grauen Tages. Sie hatte den Kaiser bisher nur von ferne gesehen – bei Paraden. Was jetzt, da sie so dicht vor ihm stand, von ihm ausging, konnte kein Bild und keine Büste wiedergeben.
»Komtesse«, brach Napoleon das Schweigen – »ich verstehe Ihren Schmerz. Ich leide mit Ihnen.«
Sie sah ihn offen an, ihre Augen waren plötzlich zwei schwarze Flammen. »Dann müssen Sie mit sehr vielen leiden – mit Millionen!« Ihre Stimme war leise, aber eisig und anklagend, voller Haß.
Graf Romme packte seine Tochter am Handgelenk. Entsetzen stand auf seinem Gesicht. »Majestät! Vergebung! Der Schock – sie weiß nicht, was sie sagt.«
Caroline riß sich vom Vater los. Sie machte einen Schritt auf Napoleon zu. Mit einer Handbewegung wies sie auf den Toten am Boden der Kutsche und dann in die Runde – dorthin, wo auf dem nackten Erdboden die erschöpften, abgerissenen Soldaten lagen: der Rest der großen Armee. Ein Schluchzen kam aus ihrem Mund – dann brach sie zusammen.
Der Kaiser fing sie im Sturz auf. Einen Augenblick lang lag sie in seinen Armen. Ihr Gesicht, vor Sekunden noch flammend vor Haß, hatte jetzt einen Ausdruck der Hilflosigkeit. Die Lippen stammelten unverständliche Worte, aus dem langen dunklen Wimpern flossen Tränen.
»Majestät ... Verzeihen Sie! Ich werde mich um meine Tochter kümmern. In der Nähe ist ein Kloster der Zisterzienserinnen. Dorthin werde ich sie bringen.«
»Das geht auch mich an, Graf.« Der Kaiser winkte die Wache herbei, erteilte kurze Befehle. Eine Bahre wurde gebracht. Vier Diener betteten die Bewußtlose darauf, legten eine rote Seidendekke über sie und schoben die Bahre in eine kaiserliche Kutsche. Napoleon ließ sein Pferd vorführen. Die beiden Männer ritten voraus.
4
Caroline schob das Tablett auf das Tischchen neben dem Bett und lehnte sich in die Kissen zurück. Vier Tage waren vergangen, seit man sie ins Kloster gebracht hatte. Auf Geheiß der Oberin hatte man heute ihr Bett in den Wintergarten gerollt. Denn über Nacht war es Frühling geworden. Durch die hohe Glaswand schien die Märzensonne.
Die Oberin ging mit einer kupfernen Kanne von Pflanze zu Pflanze. Diese zwanzig Quadratmeter blühender Wildnis mit dem gepflasterten Weg in der Mitte und den plätschernden Brunnenbecken an den Wänden waren ihre ganze Freude. Hin und wieder warf sie der Patientin einen Blick zu. Die ersten zwei Tage lang hatte sie wie eine Tote geschlafen. Dann war das Leben allmählich zurückgekehrt. Aber sie war apathisch geblieben, und es war der Oberin bis heute nicht gelungen, dieses unheimliche Schweigen zu brechen. Sie stellte die Kanne weg. Als sie sich umwandte, sah sie das leere Tablett. Die Patientin hatte alles aufgegessen: den Reis, das Geflügelfrikassee, den Salat, die Nußcreme. Die Oberin setzte sich zu Caroline ans Bett.
»Ich freue mich, daß es Ihnen besser geht, Komtesse. Dann kann ich heute einen Kurier abschicken. Haben Sie besondere Nachrichten für den Kaiser?«
»Für den Kaiser?« Unwillkürlich setzte sich Caroline auf. »Wie käme ich dazu?«
»Nun, er schien sehr um Sie besorgt. Und er bat mich ausdrücklich, ihn über alles zu unterrichten.«
Caroline ließ sich in die Kissen zurücksinken. Ihr Gesicht verschloß sich. Seltsame Gefühle stritten in ihr. Dann war es also wahr, was sie in den letzten Tagen für die Erinnerung an einen Fiebertraum gehalten hatte... Und obwohl sie sich dagegen wehrte, war es ihr auch jetzt wieder, als ruhten die Augen Napoleons auf ihr und als klänge seine Stimme in ihr nach. Es war wie ein Zwang, neben dem alles andere verblaßte: die Erinnerung an Albert, ihre Verzweiflung über seinen Tod, ihr ohnmächtiger Haß gegen den, für den er sein Leben gelassen hatte. Aber auch jetzt wieder versuchte sie, diesen geheimnisvollen Zwang abzuschütteln. »Mein Vater?« fragte sie. »Haben Sie Nachricht von ihm?«
»Er ist mit dem Kaiser nach Paris.«
»Ohne mich?« Caroline sagte es mehr zu sich.
Die Oberin zog die Brauen hoch. »Ich weiß nicht, ein junges Mädchen ist hier sicherer.«
Carolines Antwort war ein helles, herausforderndes Lachen. Mein erster Eindruck war also doch der richtige, dachte die Oberin. Als man die Bewußtlose vor vier Tagen gebracht hatte, das wirre dunkle Haar um das schöne Gesicht, das in der Ohnmacht noch voll Stolz und Trotz war, hatte sie sofort an ein schlummerndes Raubtier denken müssen. Ein Wesen, wild, unbezähmbar und stark. Was immer diesem Mädchen zustoßen würde, es würde die Kraft haben, sich wieder zu erheben, wie der Phönix aus der Asche. Die Oberin drehte unwillkürlich an dem Ring, den sie am kleinen Finger der linken Hand trug. In dem dunkelblauen Lapislazuli war das Wappentier der Herzöge der Lamare eingraviert: der Phönix. In der Familie lebte seit Jahrhunderten der Glaube an die magische Kraft dieses Wappentieres. Ihr hatte er nie geholfen. Sie war zerbrochen, damals, vor zehn Jahren, als man ihr die Nachricht vom Tode ihres Geliebten brachte. Sie hatte Paris verlassen, hatte sich in die Anonymität eines klösterlichen Lebens geflüchtet. In Paris hielt sich noch immer das Gerücht, die Herzogin Eliette de Lamare lebe unter einem angenommenen Namen in England. Nur einer kannte die Wahrheit, ihr Halbbruder Gil. Aber auch ihm war es nicht gelungen, sie ins Leben zurückzureißen. Dies hier war nur ein Warten, das wußte sie wohl; ein Warten auf den Tod. Aber dieses Geschöpf da war stark – und deshalb würde es für sie immer wieder das neue lockende Ufer – das Leben – geben.
Carolines Stimme riß die Oberin aus ihren Gedanken. »Und der Feind?«
»Nähert sich Paris! Diesmal steht alles auf dem Spiel.«
Simon hatte gewußt, was er tat, als er Carolines Hengst im Kloster zurückließ. Als sie davon hörte, war sie nicht mehr länger im Bett zu halten. Zwei Tage lang hatte die Oberin sie noch am Ausritt hindern können. Aber am dritten Tag fragte Caroline nicht mehr. In aller Frühe holte sie Luna aus dem Stall – und ritt davon.
Im Reiten legte sie ihre Hand an Lunas Hals, klopfte ihm zärtlich das glänzende Fell am Nacken. Der schwarze Hengst mit dem weißen Stern auf der Stirn trug sie davon; immer weiter vom Kloster weg, eine Anhöhe hinauf, der aufgehenden Sonne entgegen.