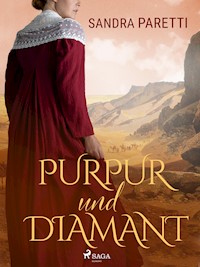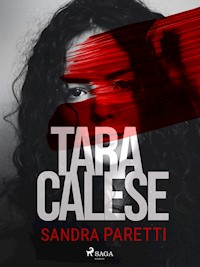Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Geliebte Caroline
- Sprache: Deutsch
Das vornehme Paris ist im Bann der schönen Caroline. Mit ihrer verführerischen Art verzaubert sie die Männer in ihrer Nähe und könnte jeden haben. Doch sie entscheidet sich, den Herzog von Belômer zu heiraten. Am Abend vor der geplanten Hochzeit wird dieser jedoch plötzlich verhaftet. Was hat es damit auf sich? In "Lerche und Löwe", dem zweiten Teile der Caroline-Trilogie, setzt Sandra Paretti die Geschichte um eine junge Frau und ihr aufregendes Leben in Frankreichs Hauptstadt fort. -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sandra Paretti
Lerche und Löwe
Saga
Lerche und Löwe
Copyright © 2022 by Helmut and Anka Schneeberger, represented bei AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de)
Originally published 1969 by Krüger Verlag, Stuttgart
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1969, 2022 Sandra Paretti und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788728469378
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
1
Im Brand der sinkenden Sonne jagte der Braut-Troß die Küstenstraße nach Saint-Malo dahin. Der Staub wirbelte unter den Hufen der Pferde, ihre Mähnen flogen im Wind. Die beiden silberbeschlagenen Karossen und die Gepäckwagen, auf denen sich die Sandelholzkisten türmten, ächzten in den Federn. Über allem lag die stumpfe Schmutzpatina einer Dreihundertmeilenfahrt. Aber Caroline ging es immer noch nicht schnell genug. Sie hätte Pferde gebraucht, die schneller waren als ihre Wünsche. So nah am Ziel kannte ihr Herz keine Geduld mehr.
Ihr gegenüber saß Philippe. »Ich glaube, noch nie sind Kutschen so schnell von Paris nach Saint-Malo gekommen. Wenn seine Yacht so schnell war wie wir, muß er den Cup des Prinzregenten gewonnen haben.«
Caroline antwortete nur mit einem Lächeln. Sie hatte die Regatta der Hochseesegler um die Isle of Wight, die der Herzog mitmachte, ganz vergessen, und jetzt lenkte etwas anderes ihre Aufmerksamkeit auf sich. In der Ferne tauchte die Silhouette der bretonischen Hafenstadt auf: die Stadtmauer mit ihren Toren, von Regen, Wind und Sonne ausgewaschene Giebel, Zinnen aus dem Grau alten Silbers schoben sich in den Himmel, überragt vom Filigran der gotischen Kathedrale. Dort, in Saint-Vincent, würde sie morgen an seiner Seite vor dem Altar knien, am Tag der Tagundnachtgleiche, wie es seit Generationen in ihrer Familie Tradition war. Aus der Komtesse Caroline de la Romme Allery würde an diesem 23. September 1815 die Herzogin von Belômer werden.
Philippe rückte neben sie.
»Dort! Das ist das Schloß!«
Von dem weißen Saum der Brandung umspült und durch eine Mole mit dem Land verbunden, glich Schloß Mortemère mit den vier Ecktürmen aus dem 16. Jahrhundert eher einer Wasserfeste.
Ein Trupp Reiter kam ihnen entgegen. Eine Pferdelänge vor der ersten Kutsche teilten sie sich. Im vollen Galopp zogen sie die Zügel an. Die Kutschen rollten durch das Spalier der Pferde. Plötzlich war die Luft voller Blumen. In den Steigbügeln stehend, warfen die Männer Rosen über die Kutsche der Braut. Von dem Kordon der Berittenen umgeben, rollte der Zug der Kutschen weiter. Sie bogen von der breiten Straße auf einen schmaleren Weg ab, der im Schatten der Festungswälle von Saint-Malo in einem weiten Bogen abwärts führte. Aus der grünen See stieg Schloß Mortemère auf, alt und unzerstörbar wie der Fels, aus dem seine Mauern und Türme wuchsen. Auf den Ecktürmen wehten Fahnen. Donnernd rollten die Kutschen über die Bohlen der mit Mauern und Zinnen befestigten Mole in den Schloßhof. Ein Gärtner war mit einem Gehilfen beschäftigt, die Portale und Fenster mit frischem Grün und bunten Blumengirlanden zu umwinden. Zimmerleute hämmerten an einem Tanzpodium. Mägde trugen in flachen Körben frischen Lachs ins Haus. An einem eisernen Gestell hingen Wildbret, abgezogene Lämmer, rote Rinderhälften. Aus den offenen Fenstern der Küche zog würziger Pastetenduft über den Hof. Über allem lag das tiefe Leuchten des vergehenden Tages, der zu zögern schien, als gebe ihm das farbenprächtige Bild der Kutschen, der Reiter, der jubelnden Menschen einen Grund, länger zu verweilen.
Mit einem Ruck kam die Kutsche vor dem Portal zum Stehen. Philippe sprang heraus und reichte Caroline die Hand. Dann eilte er zu der zweiten Kutsche, um Eliette, der Halbschwester des Herzogs, die mit ihnen aus Paris gekommen war, herauszuhelfen. Pagen rollten einen blauen Läufer aus, in den mit Goldfäden das Wappen der Herzöge von Belômer, der Phönix, eingewebt war.
Lächelnd schritt Caroline durch das Spalier der Menschen, die alle einen Blick dieser Frau erhaschen wollten, die einen Mann bezaubert hatte, dessen Herz für uneinnehmbar gegolten hatte. Sie war nur wenige Schritte vom Portal entfernt, da trat aus dem Halbdunkel Leblanc, der Vermögensverwalter des Herzogs. Seine Verbeugung vor Caroline war mehr Höflichkeit eines Herrschers als Ergebenheit eines Dieners. »Komtesse – im Namen des Herzogs, Willkommen auf Schloß Mortemère!«
Sie stand vor der Schwelle, zu der sie ein so weiter Weg geführt hatte – und zögerte. So nahe am Ziel überfiel sie Bangigkeit. Die ganzen letzten Wochen hatte sie sich nie eingestanden, daß in der Melodie ihres Glücks ein dunkler Ton mitschwang. Jetzt war er unüberhörbar. Sie wehrte sich dagegen. Sie wollte nicht denken, daß das Glück auch diesmal vielleicht nur ein Trugbild war. Aber sie war in ihrem Leben schon durch zu viele Schrecken gegangen, um in diesem Augenblick die Kontrolle über sich zu verlieren. Sie richtete den Blick auf Leblanc. »Geben Sie mir Nachricht, wenn die Yacht des Herzogs gemeldet wird.« Ihre Stimme verriet nichts von ihren Gefühlen.
Leblanc verbeugte sich. Die Legende, die dieser Frau vorausging, hatte ihn nicht beeindruckt. Die Schönheit einer Frau hatte nie etwas über diesen Mann vermocht. Er besaß die Stärke jener, die stark sind, weil sie weder Zweifel noch Hoffnung kennen, weder Liebe noch Haß. Aber die Ruhe, mit der sie diesen Augenblick gemeistert hatte, hatte ihn gewonnen. Diese Frau schien seines Herrn würdig zu sein – und auch der Dienste eines Leblanc. »Darf ich Sie führen?«
Die Gästezimmer lagen im westlichen Turm. Erst morgen, nach der Trauung, würde die Braut in die neu umgebauten Wohnflügel umziehen. Caroline hatte die Diener angewiesen, die großen Reisekoffer und Kisten unausgepackt stehen zu lassen. Sie stand in dem weiten Rund des Fensters, das den Blick auf das Meer freigab. »Ich verstehe ihn nicht«, sagte Eliette neben ihr, »daß er nicht einmal an einem solchen Tag auf sein Vergnügen verzichten konnte.«
Caroline antwortete nicht. Nichts konnte ihre Laune verderben. Mit einem Blick voll Bewunderung und Resignation sah Eliette ihr zu. Sie kam sich uralt vor neben diesem Geschöpf. Viel zu alt und viel zu vorsichtig, um geliebt zu werden. Nie würde ihr die Hingabe dieses Mädchens an den Augenblick möglich sein. Immer würde sie vor dem letzten Schritt zurückschrecken. »Ich habe einfach nicht die Kraft, die man braucht, um das Glück zu halten – so wie Sie.« Fast gegen ihren Willen hatte Eliette zu sprechen begonnen.
Caroline schüttelte lachend den Kopf. »Sie kennen ihn doch, Segeln ist seine Leidenschaft. Und Sie wissen auch, daß er, seit es den Regent's Cup gibt, ihm nachjagt. Immer ist er ihm um Haaresbreite verlorengegangen. Aber diesmal hat er ihn gewonnen. Ich spüre es. Und ich habe das Gefühl, er hat ihn allein mir zuliebe gewonnen.«
Draußen kamen Schritte näher, dann klopfte es an der Tür. Leblanc näherte sich. Er wies die beiden livrierten Lakaien an, die Silberleuchter in den Raum zu tragen. »Schließt die Läden«, sagte er mit seiner dunklen Stimme, die außer seinen Augen das einzige Lebendige an diesem Mann zu sein schien. »Wir bekommen Sturm!«
»Sturm!?« Er hatte den Satz gar nicht an sie gerichtet, aber Caroline zuckte bei diesem Wort zusammen. »Es ist die Zeit der Stürme jetzt, im September. Werden Sie das Essen auf dem Zimmer einnehmen?«
»Es eilt nicht. Ich werde mich melden.«
Die Tür schloß sich hinter Leblanc und den beiden Dienern.
»Ich werde nie ganz klug aus ihm«, sagte Eliette. »Seinen richtigen Namen kennt niemand. Er war neun oder zehn Jahre, ich war noch nicht geboren, als das Meer ihn hier anspülte und die Familie ihn aufnahm. Schon damals waren seine Haare schneeweiß. Daher der Name Leblanc, der Weiße.«
Caroline sah wieder die feine, wie gestochene Handschrift des Heiratsvertrages vor sich, den Leblanc aufgesetzt hatte. »Und er verwaltet das Vermögen?«
»Es gibt nichts, was in seinen Händen nicht zu Gold würde. Er findet immer neue Quellen; er gräbt alte, in Vergessenheit geratene Lehensdokumente aus, uralte Privilegien. Er bekommt Wegzoll für jedes Stück Vieh, das hier auf den Wochenmarkt getrieben wird; die Gemeinde Dinard-Saint-Enogat hat uns an jedem Osterfest Lebkuchen zu liefern; die Pfarrei von Saint-Vincent schuldet uns zwölf Messen im Jahr – und ich weiß nicht, was noch alles. Die Leute hier nennen ihn nur den König von Saint-Malo. – Fragen Sie mich nicht, was uns alles gehört. Ich kenne mich darin so wenig aus wie der Herzog. Ich weiß nur: In einer Zeit, in der ganze Adelsgeschlechter verarmt sind, in der die Emigranten alles verloren haben, hat Leblanc Geld zusammengetragen, hat es aufgehäuft, vermehrt.«
Aus dem Haus drangen Geräusche geschäftigen Lebens: gedämpfte Stimmen, eilige Schritte, das Klirren beladener Tablette, das Prasseln der Öfen, die von den Gängen aus beheizt wurden, fernes Lachen. Eliette war gegangen. Caroline verschloß die Tür und eilte in das anschließende Schlafkabinett. Auf der Bergère hingebreitet lagen die beiden Roben für die Hochzeit. Die Journalisten der Pariser Modejournale hatten ihrem Schneider Leroy die Tür eingerannt, um die Erlaubnis zu erhalten, diese beiden Kleider abbilden zu dürfen. Wie gerne hatte sie die Hauptstadt verlassen. Wie glücklich war sie gewesen über den Entschluß des Herzogs, in Saint-Malo zu heiraten, fern von diesem Paris, in dem jeder ihrer Schritte, jedes ihrer Worte in der nächsten Stunde stadtbekannt waren . . .
Caroline hatte sich vor dem Frisiertisch niedergelassen. Sie nahm die Nadeln und Kämme aus dem Haar, löste die Bänder der Ziegenlederhandschuhe, streifte die seidenen Strümpfe ab. Sie zog die Jacke aus, die Bluse. Raschelnd sanken Rock und Unterkleider zu Boden. Im Spiegel erblickte sie ihren nackten Körper. Verwirrt wandte sie sich ab. Fliehend vor sich selbst, vor der Unruhe, schlüpfte sie in das Bett. Sie war müde, und doch ersehnte ihr Körper eine andere Erlösung als die des Schlafs.
Ein strahlender Himmel spannte sich am anderen Morgen über Saint-Malo.
Das Frühstückstablett stand unberührt neben Caroline auf dem kleinen runden Tischchen. Sie hatte nur im Bad eine Tasse Tee getrunken. Nicht einen Bissen hätte sie essen können. Der Sturm war vorüber, der ersehnte Morgen gekommen; aber er war noch immer nicht da.
Sie öffnete den Schmuckkoffer, der auf dem Frisiertisch stand, hob das Zwischenfach heraus. Sie drehte den winzigen goldenen Schlüssel um, schlug den Deckel auf. Der taubeneigroße Diamant lag auf dem scharlachroten Samt, weißes Feuer versprühend, Symbol des Unzerstörbaren, Magnet des Glücks. Und doch berührte sie etwas Dunkles in diesem Augenblick. Sie kannte es. Sie hatte dagegen gekämpft, und sie hatte geglaubt, es besiegt zu haben – für immer: Der Fluch, der sie zu verfolgen schien, seit jener Nacht vor eineinhalb Jahren, als sie aus Rosambou, dem Schloß ihrer Kindheit, hatten fliehen müssen. Betäubt von dem dunklen Vorgefühl, hörte sie nicht den Tumult, der unten entstanden war. Erst als die Tür aufsprang und Philippe hereinstürzte, kam Caroline wieder zu sich. »Die Yacht! Sie müssen gleich einlaufen.«
In der Halle warteten schon die Hochzeitsgäste, die mit zur Kirche fahren würden. Caroline eilte grußlos an ihnen vorbei, hinaus auf den Hof. Als sie zu der steilen Steintreppe kamen, die zu dem kleinen Yachthafen hinabführte, wollte Philippe ihr die Hand reichen, aber sie wehrte lachend ab.
Die Yacht, schwarz die Segel, schwarz der Schiffsleib, schoß über die glatte See. Die Segel flogen herum, das Boot legte sich zur Seite. In einem scharfen Bogen fuhr es in den Hafen ein, glitt an die Kaimauer heran.
Gebannt starrte Caroline hinüber. In einer Luke erschien ein roter Haarschopf. Ein Hüne in rostroter Uniform stand plötzlich an der Reling – sprang mit einem gewaltigen Satz zur Mole hinüber, noch ehe die Taue befestigt waren. Der Riese eilte an ihr vorbei auf Leblanc zu, den sie erst jetzt entdeckte. Das Gesicht des Verwalters war grau. Er machte eine Geste, als wolle er Carolines Hand ergreifen. »Es ist etwas Unfaßbares geschehen, Komtesse«, sagte er dann. »Man hat den Herzog in England verhaftet.«
Philippe, der neben ihr stand, nahm ihren Arm, wollte sie wegführen. Caroline stieß ihn zur Seite. Sie trat einen Schritt vor und winkte den Hünen heran. »Was ist geschehen?«
Charles Tarr trat zögernd näher. Der eckige Schädel des Norwegers, der unmittelbar auf den mächtigen Schultern zu sitzen schien, deutete eine Verbeugung an. »Wir hatten den Cup gewonnen. Am nächsten Morgen wollten wir in See gehen.« Er sprach stockend, schien die einzelnen Worte zusammenzusuchen. »Der Herzog kam nicht, am nächsten Morgen . . . nur ein Bote . . . mit der Nachricht, daß man den Herzog verhaftet hätte, während des Festes.«
»Und der Grund?«
Der Norweger zuckte mit den Schultern. »Wußte niemand . . .«
Caroline begriff, es war sinnlos, weiterzufragen. Sinnlos wie diese mysteriöse Verhaftung, sinnlos wie ihre Hoffnung. Sie blickte hinaus zu der Yacht. Eben fielen die schwarzen Segel herab, sanken in sich zusammen. Mit einer Schnelligkeit, die für Caroline in diesem Augenblick etwas Grausames hatte, entkleideten die Seeleute das Schiff. Schwarz schaukelte es auf der gleißenden Flut, schwarz starrten die Masten in den blauen Himmel – ein Skelett.
Mit dem rechten Fuß warf sie den schweren Brokatrock zur Seite, wandte sich zum Gehen. Etwas so Wildes ging von ihr aus, daß Leblanc und der Norweger vor ihr zurückwichen. Auch der Priester, der unvermittelt aus der Menge auf sie zutrat, um ihr ein Wort des Trostes zu sagen, prallte zurück. Das schwarze Feuer ihrer Augen schloß ihm den Mund. Sie eilte die steile, in den Fels gehauene Treppe empor. Als sie den Schloßhof betrat, blieb sie unwillkürlich stehen. Die ganze Hochzeitsgesellschaft stand dichtgedrängt in dem engen Halbrund. Caroline war es, als müsse sie davonrennen, fliehen aus dieser Arena, gefüllt mit Menschen, lüstern vor Neugier. Zu einer Hochzeit waren sie gekommen; aber was war schon eine Hochzeit gegen dieses Schauspiel einer Braut ohne Bräutigam! Caroline straffte sich. Hocherhobenen Hauptes, ohne Hast durchschritt sie die sich bildende Gasse. Es war wie ein Zwang. Sie mußte in die Gesichter dieser Menschen blicken. Die Männer wichen ihren Augen aus, manche schuldbewußt wie Jungen, die man beim Quälen eines hilflosen Tieres ertappt hatte. In den Augen der Frauen aber funkelte unter dem dünnen Schleier des Mitgefühls Triumph. Und mit diesen Menschen wäre sie in die Kirche eingezogen, mit ihnen hätte sie an einer Tafel gesessen, die gleichen Speisen gegessen, den gleichen Wein getrunken, zur selben Melodie getanzt!
Sie schritt die Stufen hinauf. In ihren Schenkeln, in ihrem Rücken war das Zittern der Erschöpfung wie nach einem scharfen Ritt. Aber die Menschen sahen nur das stolz erhobene Haupt, die Hand, die voll Anmut den Rock raffte, das Leuchten einer unbesiegbaren Kraft im Schatten der dichten Wimpern – und sie hatten plötzlich das Gefühl, daß man sie um etwas betrogen hatte . . .
Aufatmend betrat Caroline die Halle. Es vergingen Sekunden, bis sich ihre vom Sonnenlicht geblendeten Augen an die Dämmerung gewöhnten. In einer natürlichen Reaktion ihrer starken Natur trat sie, um erst einmal Atem zu schöpfen, an die lange Tafel, auf der das kalte Büfett aufgebaut war. Es waren nicht die üblichen pompösen Platten mit kunstvollen Arrangements. Antoine Carème, der ungekrönte König der französischen Küche, den der Herzog nach Saint-Malo hatte kommen lassen, hatte sich nicht mit Alltäglichem zufriedengegeben. Aus Hummern, Lachsen, Aalen, Forellen, aus Bärenschinken, Rehziemern, Gänsebrüsten, Straußeneiern, weißen und schwarzen Trüffeln, aus allen Früchten und Kräutern dieser Erde hatte er eine fantastische Landschaft aufgebaut. Ein abwesendes Lächeln auf den Lippen, stand Caroline davor. Für einen Augenblick hatte der Schmerz seine Macht über sie verloren. Aber als sie sich jetzt umwandte und Monsieur Carème gewahrte, mußte sie sich Gewalt antun, um ihn nicht schroff zurechtzuweisen. »Bitte, Monsieur Carème, lassen Sie alles abräumen . . .«
Antoine Carème starrte sie mit offenem Mund an, rührte sich nicht von der Stelle. »Ich habe vier Tage und vier Nächte daran gearbeitet, ununterbrochen. Ich habe mein Bestes gegeben. Nein, nein, das kann nicht alles umsonst gewesen sein . . .« Er hob flehend die Hände. »Noch sind die Gäste da! Sie werden ihnen diese Köstlichkeiten nicht vorenthalten!«
Carolines Geduld war am Ende. War dieser Mensch so naiv oder war er so roh? »Monsieur Carème, Sie haben meinen Wunsch gehört. Sie können die Speisen an die Armen von Saint-Malo verteilen.«
»Nein!« Er breitete theatralisch die Arme aus. Wie ein Besessener lief er vor der Tafel auf und ab. »Lieber zerstöre ich es mit meinen eigenen Händen.« Caroline stand am Fuß der Treppe. Sie wünschte lachen zu können über diese groteske Szene. Aber ihr graute.
2
Die fünf Schläge der Uhr im Eckturm verklangen. Der Schrei eines Wasserhuhns kam aus dem nahen, schilfbestandenen Ufer. Caroline stand unter dem Portal und blickte in den Schloßhof. Es dunkelte. Die Gäste waren abgereist. Als letzte hatten vor wenigen Minuten Philippe und Eliette Mortemère verlassen. Es war nicht leicht gewesen, ihren Bruder davon zu überzeugen, daß er in Paris beim König mehr für den Herzog tun konnte, als wenn er sie nach England begleitete. Von zwei Knechten gezogen, rollte ihre Reisekutsche auf den Hof. Vier Pferde wurden aus dem Stall geführt, haselbraun und kräftig. Ihren Reisekoffer auf der Schulter, sprang Batu auf den Bock, warf ihn auf das Kutschendach. Sorgfältig begann er ihn festzuschnüren.
Ein Tag war vergangen, vierundzwanzig endlose Stunden, und jetzt verlangte es sie mit Ungeduld, von hier fortzukommen . . .
Caroline durchschritt die Halle, suchte den Weg zum Arbeitszimmer. Die Wände des uralten Raumes nahmen vom Boden bis zur Decke Archivschränke ein, schwere Schlösser hingen davor. Leblanc, in dem hochlehnigen Stuhl hinter dem Schreibtisch, saß nach vorne gebeugt da. Die Feder in seiner Hand raschelte über das vor ihm liegende Papier.
»Bitte, Monsieur Leblanc«, brach Caroline das Schweigen, »sorgen Sie dafür, daß alle zwanzig Meilen frische Pferde bereit stehen.«
Die steile Falte zwischen seinen Brauen vertiefte sich. »Ich hoffte, Sie würden es sich doch noch anders überlegen, Komtesse.« Er legte den Federkiel aus der Hand. Er öffnete den Mahagonikasten, in dem er Petschaft und Siegellack aufbewahrte. So eine Frau war ihm noch nicht begegnet. Jede andere hätte eine Tragödie daraus gemacht. Diese da hatte niemand weinen sehen. Eine Weile war sie auf ihren Zimmern geblieben. Dann hatte sie ihrer Zofe geklingelt, hatte sich ein Bad bereiten und dazu frischen Lachs, Butterkartoffeln und Weißwein servieren lassen. Sie war anders. Sie war stark. Er hatte nicht Angst um sie, wenn sie allein nach England fuhr. Einen Augenblick spielte er sogar mit dem Gedanken, ob er sie nicht zu seiner Verbündeten machen sollte. Es war eine spontane Gefühlsaufwallung – und das genügte, ihn davon Abstand nehmen zu lassen. Er sah zu ihr auf. »Fahren Sie nicht nach England. Hören Sie auf mich.«
Carolines Blick war auf die Gegenstände gefallen, die neben Leblanc auf dem Tisch lagen: mit seltsamen Zeichen bedeckte Blätter, Zirkel und Winkelmesser, ein siderisches Pendel, ein Astrolabium. Dieser Mann setzte sie in Erstaunen. »Wie ich sehe«, sagte sie lächelnd, »beschäftigen Sie sich mit Astrologie, Monsieur Leblanc. Sie wollen mich doch nicht etwa deshalb von meinem Vorhaben abbringen, weil die Sterne und Zeichen dagegen sind?«
Er blickte sie an, aus Augen, deren Feuer sein weißes Haar und die Runen, die das Alter in sein Gesicht gegraben hatte, vergessen ließ. »Es ist nur ein Zeitvertreib«, sagte er, »der Zeitvertreib eines Mannes, der wenig Schlaf braucht.«
»Und erfüllen sie sich – Ihre Berechnungen? Sind in Ihrem Leben die Dinge eingetroffen, die in den Sternen standen?«
»Ich habe das Glück, mein eigenes Horoskop nicht stellen zu können!«
»Und mein Horoskop? Und das des Herzogs? Haben Sie es gestellt? Was haben Sie herausgefunden?« Für einen Augenblick vergaß sie, warum sie hergekommen war.
»Die Bahnen seiner Sterne sind unauflöslich mit denen Ihrer Sterne verbunden, Komtesse.« Seine Stimme war voller Zurückhaltung, fast abwehrend.
»Ich will es sehen«, sagte sie. »Zeigen Sie es mir!« Sie trat näher an den Tisch. Aber er legte die Hände über einige Blätter.
»Wir haben hier ein Sprichwort«, sagte er. »Ein sehr weises. Wenn man auf die eigenen Füße schaut, stolpert man.«
Zuerst war Caroline betroffen von seiner Weigerung, aber dann lachte sie. »Ich will es beherzigen«, sagte sie. »Ich werde nicht auf meine Füße blicken, sondern auf schnellstem Weg reisen.«
Wieder sah er sie an. »Ich bezweifle, ob es der beste Weg sein wird, Komtesse, dem Herzog zu helfen.«
»Nennen Sie mir einen besseren, und ich will ihn gerne befolgen. Wenn Sie einen Verdacht haben, sprechen Sie!«
»Einen Verdacht?« Leblanc entzündete eine Kerze, hielt sie an den Siegellack. Langsam drehte er den roten Lackstift. Der erste Tropfen fiel auf das weiße Papier. Er preßte das Siegel in den Lack. »Ein Mann, der so reich ist wie der Herzog, hat immer Feinde«, sagte er. »Reich zu sein – und ein Träumer, nichts schlimmer als das! Keine Schwäche zu haben, das hat die Welt noch keinem verziehen.« Mit abwesendem Blick räumte er die Schreibsachen auf. Sicher, er hatte eine Vermutung. Es war ihm immer klar gewesen, daß einmal der Tag kommen mußte: So dicht das Netz der Geheimhaltung auch gesponnen war, so gut die Papiere der Schiffe auch getarnt waren, so unauffällig das Geld in den verschiedensten Bankhäusern deponiert war, einmal hatte eine Masche dieses Netzes reißen müssen. Aber noch war es nichts weiter als ein Verdacht. Und Leblanc war ein zu weitsichtiger, zu praktisch denkender Mann, um seine Entschlüsse auf Vermutungen zu gründen. Er erhob sich, reichte ihr ein offenes Kuvert. »Eine Vollmacht für das Londoner Bankhaus Barring. Wenn Sie sie vorzeigen, erhalten Sie jede beliebige Summe, Komtesse. Eine Kaution kann unter Umständen sehr hoch sein.«
»Eine Kaution?« Sie begriff nicht gleich. »Was auch immer geschehen ist, der Herzog ist zu Unrecht inhaftiert!«
Was verheimlichte er vor ihr? Die Frage lag ihr schon auf der Zunge, aber sie wußte, dieser Mann würde nicht antworten. Eine Hand auf den Schreibtisch gestützt, stand er da. Seine Gestalt verschwand in dem Halbdunkel, das aus den Ecken des Raumes drängte, und Caroline schien es, als sei er aus demselben ungreifbaren und doch undurchdringlichen Stoff gemacht und kehre nur in sein eigentliches Element zurück. Nein, hier kam sie nicht vorwärts. Genausogut hätte sie die Mauern dieses Schlosses befragen können. Sie nahm das Kuvert aus seiner Hand entgegen. Wie hatte sie überhaupt ein Wort verlieren können! Vom Hof drang das Geklingel des Pferdegeschirrs herauf. »Ich danke Ihnen.« Leblanc verneigte sich. Eigentlich waren es nur seine Augen, die noch mehr ins Dunkel zurücksanken.
Sie streckte die Beine wohlig auf dem Fußpolster aus, das zwei flache, mit heißem Wasser gefüllte Kupferflaschen von unten her erwärmten. Sie öffnete den Deckel des runden Proviantkörbchens, das neben ihr stand. Ihre Finger glitten tastend über vielerlei Tüten und Dosen. Sie suchte nicht die kandierten Früchte, das Schokoladengebäck. Sie hatte Lust auf das Stück Roggenbrot, das Batu ihr immer in einer silbernen Dose hineinschmuggelte. Jede Magd bekam davon, soviel sie wollte, nur sie mußte sich dieses Stück Brot seit ihrer Kindheit ›stehlen‹. Marianne, die Beschließerin von Rosambou, und für sie fast so etwas wie eine Mutter, die es selber so gerne aß, am liebsten frisch aus dem Backofen, hatte immer getan, als würde Caroline krank davon werden. Nur weil sie eine Adlige war!
Caroline hatte das nie begriffen. Aber es war immer noch so. Die Revolution? Auch sie hatte daran nichts geändert. Gerade die einfachen Menschen waren es, die hartnäckig auf diesen äußerlichen Zeichen des Unterschiedes zwischen Herr und Diener beharrten, als wäre es eine Schande, einem Herrn zu dienen, der dasselbe Brot aß. Diese Welt war manchmal schwer zu begreifen . . .
Die Kutsche kam so unvermittelt zum Stehen, daß der Ruck Caroline vornüber warf. Mit beiden Händen fing sie sich gerade noch an der dicken Kordelschlaufe, die neben dem Vorhang herunterbaumelte.
Sie stieß den Schlag auf. Der Nebel war so dicht, daß sie die zwei Führungspferde des Vierergespanns kaum erkennen konnte. »Was ist denn? Warum geht es nicht weiter?« Plötzlich entdeckte sie die Männer. Zwei hielten die Zügel der Leitpferde. Der dritte kam auf sie zu.
Die breite goldene Verschnürung einer Kapitänsuniform schimmerte auf, als der Mann an den Schlag trag. Er setzte den Fuß auf das aufgeklappte Trittbrett. Caroline sah es mit Empörung; sie wünschte, sie wäre nicht so leichtsinnig gewesen, ihre Waffe in den Koffer zu werfen. »Wer sind Sie? Und woher nehmen Sie die Frechheit, meine Kutsche anzuhalten?«
Ein dunkles Gesicht hob sich ihr entgegen. »Manuel Janio Herera, Kapitän der Myrmidon.« Er sprach ein rauhes, kehliges Französisch. »Und dieser Aufenthalt dient nur Ihren Interessen, Komtesse.«
Er kannte sie! Und wagte es dennoch, sie aufzuhalten. »Ich bin in Eile. Befehlen Sie Ihren Leuten . . .«
»Ich kenne den Grund Ihrer Eile«, fiel er ihr in seinem seltsamen Tonfall ins Wort. »Aber warum die weite Reise nach England, wenn Sie von Manuel Herera aus Peru erfahren können, weshalb der Bräutigam nicht zur Hochzeit erschienen ist.«
Er legte den Kopf ein wenig zur Seite. Sein glattes, von Feuchtigkeit benetztes Haar glich einem schwarzen Helm. »Da ich befürchte, Sie werden meinen Worten kaum Glauben schenken, ist es besser, Sie überzeugen sich mit eigenen Augen.«
»Was sollen diese Andeutungen? Reden Sie endlich!« Sie sah die Züge des Peruaners jetzt deutlicher, das olivfarbene Gesicht, die breiten Backenknochen, die schrägen, weit auseinanderstehenden Augen, die Reflexe von zwei Pupillen, die unverwandt auf sie geheftet waren und etwas Tigerhaftes hatten.
Um den breiten, schmallippigen Mund des Mannes lag ein gespannter Zug. Es konnte ein freundliches oder ein grausames Lächeln sein. »Ich möchte Ihnen ein Schiff zeigen. Eines der vielen Schiffe des Herzogs. Vor allem aber die Fracht, die wir an Bord haben. Wir werden gerade zurechtkommen, wenn die Ware ausgeladen wird. Dann werden Sie vieles verstehen, Komtesse.« Er wandte sich einen Augenblick ab, gab seinen Männern ein Zeichen. Die Pferde zogen an. Er schwang sich in die anfahrende Kutsche. Warum hatte sie das zugelassen? Sie konnte sich immer noch nicht beruhigen, daß es diesem Mann gelungen war, sie zu überrumpeln. Ein Schiff des Herzogs? Sie wußte nicht einmal, daß Schiffe zu seinem Besitz gehörten. Und was sollten diese Andeutungen von der Fracht? Wo fuhren sie überhaupt hin? Die Scheiben der Kutsche waren blind vom Nebel, und nicht einmal das Geräusch der unter den Rädern wegspringenden Steine konnte ihr das entsetzliche Gefühl nehmen, daß kein Boden mehr unter ihnen war. Sie hatte jede Orientierung verloren. Tückisch und lautlos, wie durch einen bösen Zauber, hatte sich die Welt verwandelt. Gab es im Leben des Herzogs etwas, von dem sie nichts wußte? Etwas, das er ihr verschwiegen hatte, um sie zu schonen, sie in Sicherheit zu wiegen?
Verschwommen drangen Lichter durch den Nebel, Stimmen, die Silhouetten nackter Schiffsmasten. Die Kutsche hielt. Herera sprang hinaus, streckte ihr die Hand entgegen.
Alles in Caroline wehrte sich dagegen, sich auf den Arm dieses Mannes zu stützen; doch etwas warnte sie, seinen Stolz zu sehr zu verletzen. Als hätte sie seine Hand übersehen, stieg sie schnell aus.
Das Licht der wenigen Laternen versickerte im Nebel. Das weite Halbrund des Hafenkais von Saint-Malo glich einer im Ungewissen dahintreibenden Insel. Schweigend schritt sie neben dem Peruaner den Kai entlang. Der Anschlag der Wellen begleitete ihren Weg, aufgespannte Fischernetze, überzogen mit dem glitzernden Gespinst der Feuchtigkeit. Ein Boot wartete auf sie; am Heck steckte eine rauchende Fackel. Sie nahm auf der Bank Platz. Ein anderes, tief im Wasser liegendes Boot kam ihnen beim Übersetzen entgegen. Schulter an Schulter, in drei Reihen, kauerten dunkle Gestalten. In das Klatschen der Ruder mischte sich Kettengeklirr. Durch einen Riß des Nebels fiel Licht auf sie: schwarze krause Köpfe, schwarze nackte Leiber – Sklaven? Sie wandte den Kopf, suchte den Blick des Peruaners. Doch Herera beachtete sie nicht. Auch an Deck der Myrmidon erwartete sie dasselbe Bild; die nächste Kolonne dunkler nackter Leiber stand zum Ausladen bereit. Beleuchtet von Laternen, ragte am Heck die Kapitänskajüte auf. Caroline schloß geblendet die Augen, als sie eintrat. Überall brannten Lampen, deren geschliffene Glaszylinder die Helligkeit vervielfachten.
Trotz der strahlenden Helligkeit und des verschwenderischen Reichtums der Einrichtung hatte der Raum etwas Düsteres. Der chinesische Seidenteppich, die Vorhänge und Portieren – schwarze barbarische Muster bedeckten sie: Riesenblumen mit weitgeöffneten tierähnlichen Kelchen, feuerspeiende Drachen.
Wortlos hatte Herera ihr einen Stuhl hingeschoben; es war dieselbe Bewegung wie an der Kutsche, herrisch und zugleich unterwürfig. »Muß ich noch viel erklären«, begann er jetzt, »oder erraten Sie die Wahrheit? Die Myrmidom ist nichts anderes als ein Sklavenschiff, Komtesse! Eine schwarze, aber goldene Fracht. Ich bin nur mit einem Achtel an diesem Schiff beteiligt – aber selbst dieses Achtel macht mich zu einem reichen Mann.« Sein schmallippiger Mund öffnete sich zu einem lautlosen Lachen. »Diese eine Fahrt allein bringt 50000 Pfund ein. Und ich weiß mit Sicherheit von fünf weiteren solchen Schiffen, die dem Herzog von Belômer gehören. Monsieur Leblanc könnte Ihnen gewiß noch genauere Auskünfte geben.«
Caroline hatte das Gefühl, von einem bösen Traum gefangengehalten zu werden. Und wie im Traum fühlte sie sich wie gelähmt, ihrer Sprache beraubt.
»Nicht, daß ich etwas dagegen einzuwenden hätte, daß der Herzog auf diese Art seinen Reichtum vermehrt«, fuhr Herera fort. »Viele haben sich an dieser goldenen Ernte beteiligt. Der Reichtum Liverpools, Bristols, Londons, es gäbe ihn nicht ohne den Sklavenhandel. Warum ich Ihnen das alles sage: Weil gerade die Engländer, die dieses Geschäft mit soviel Tüchtigkeit und Erfindungsgabe betrieben haben, plötzlich ihre sentimentale Ader für das Recht dieser Schwarzen entdeckt haben. Kurz, Komtesse, England hat seit einigen Jahren den Handel mit Sklaven auf allen seinen Schiffen zum Verbrechen erklärt. Sie kontrollierten ein Schiff namens Felicidade. Ein Spanier? Zur Tarnung, ja. Aber in Wirklichkeit gehört das Schiff Ihrem zukünftigen Gatten, und es hatte dreihundertfünfzig Sklaven an Bord. Nach dem englischen Gesetz wird so etwas mit fünfzehn Jahren Deportation bestraft. Das war der Grund für die Verhaftung des Herzogs!«
Carolines Gehirn registrierte die Worte. Der Mann sprach zu sicher, als daß es eine Lüge sein konnte. Und doch hatten seine Worte keine Gewalt über sie. Sie hob den Kopf. »Und das ist alles? Deshalb haben Sie mich hierhergebracht?«
Er starrte sie an. Wie er sie haßte, diese stolzen, marmornen Seelen der Weißen. Zu lange trug er den Wunsch in sich, sie einmal in seinem Leben seinem Willen zu unterwerfen. Er, der Nachfahre eines Indio, der sich selbst dazu verdammt hatte, unter diesen schwarzen Kreaturen zu leben.
»Sie sind mir eine Antwort schuldig, Kapitän Herera«, sagte Caroline ruhig. – »Ich denke, Sie stehen in den Diensten des Herzogs. Aber ich will Sie gerne davon entbinden . . .«
Herera zuckte die Achseln. »Leblanc hat Ihnen kein Wort von alledem gesagt. Ist es so? Er hätte Sie nach England reisen lassen, ohne daß Sie überhaupt gewußt hätten, worum es geht. Er scheint Geheimnisse ebenso zu lieben wie das Geld.«
Leblanc! Caroline erinnerte sich an Eliettes Worte, daß der Herzog sich nie um Geld oder Geschäfte gekümmert hatte. Wenn er von diesen Geschäften ebensowenig wußte wie sie bis zu dieser Stunde? Wenn es allein ein Werk Leblancs war? Aber noch während sie es dachte, wurde ihr klar, daß es ihr im Grunde gleichgültig war. Sie mußte zu ihm. Alles andere war bedeutungslos. Sie hatte schon genug Zeit verloren. Sie sah Herera an. »Sie haben mir gezeigt, was Sie mir zeigen wollten«, sagte sie. »Welches Interesse hatten Sie daran?«
»Ganz einfach. Wir beide sind gleich stark an einer Sache interessiert – an der Freiheit eines Menschen. Ich habe Ihnen die Freiheit des Herzogs anzubieten – gegen die Freiheit eines Mannes, den Intendant Leblanc auf Mortemère beherbergt.«
»Ein Gefangener – auf Schloß Mortemère?«
»Ich sagte beherbergt!!«
»Aber Sie meinen: Gefangen. Was ist mit ihm? Kommen Sie zur Sache!«
»Ich habe Freunde, die sich für diesen Mann interessieren, das heißt für eine Erfindung, die er gemacht hat. Das Haus Santi und Leblanc hatten ursprünglich vor, diese Erfindung gemeinsam auszuwerten – aber Leblanc scheint plötzlich das Geschäft allein machen zu wollen. Übergeben Sie mir den Mann, und schon morgen wird der Herzog frei sein. Das Haus Santi ist mächtig genug.«
Caroline hörte zu, ohne den ganzen Sinn der Worte zu begreifen, die Hintergründe dieses überraschenden Angebots. Und sie versuchte es auch gar nicht erst. Was gingen sie diese Männergeschäfte an? Sie dachten alle nur an sich, an ihren Vorteil, an ihre Ziele. Sie mußte es genauso machen. »Was reden wir lange«, sagte sie. »Lassen Sie uns aufbrechen. Sie sollen Ihren Mann haben.«
Herera verneigte sich. Um seinen Mund spielte ein Lächeln, halb Staunen, halb Triumph.
3
Der große Saal, die leere abgeräumte Tafel – Caroline schritt achtlos daran vorüber. Ein Lichtstreif fiel durch den Spalt der angelehnten Tür zu Leblancs Arbeitszimmer. Sie öffnete sie leise, trat ein. Er saß an seinem Schreibtisch, im Lichtkreis einer einzigen Kerze. Er hob den Kopf, stand auf, als er sie erkannte, Verwunderung auf den Zügen, Überraschung, dann Freude. »Sie sind zurückgekehrt? Ein weiser Entschluß, Komtesse!«
Caroline stand da, drehte die Handschuhe zwischen den Fingern. Nein, Leblanc war kein Untergebener, dem man einen Befehl erteilte und der blind gehorchte. Zu lange Jahre stand er schon in den Diensten der Herzöge von Belômer. Er hatte ein Recht auf eine Erklärung. »Es geschah nicht freiwillig«, sagte sie. »Ich bin aufgehalten worden, gegen meinen Willen . . . von Herera, dem Kapitän der Myrmidon.« Sie beobachtete sein Gesicht, aber kein Muskel verriet ihr seine Gedanken, und doch spürte sie instinktiv, daß ihn diese Nachricht traf. »Er hat mich auf die Myrmidon gebracht, die gerade ihre Fracht löschte.«
Leblanc stand da, die Arme auf der Brust ineinander verschränkt, blickte sie ruhig an. Kein Erschrecken, nicht der Schatten eines schlechten Gewissens lag in seinem Blick, eher Trauer, Melancholie. »Und dieses Wissen – macht es Sie leichter, glücklicher?«
Sie wich seinem Blick nicht aus. »Der Herzog – weiß er von diesem Handel?«
Leblanc schüttelte bedächtig das Haupt. »In der Welt eines Herzogs von Frankreich ist es nicht üblich, von Geld zu sprechen, noch sich darüber Gedanken zu machen, wie es erworben wird. Das ist allein meine Aufgabe.« Er lächelte. »Wenn man seine hohen Begriffe bewahren will, ist es besser, die Wirklichkeit nicht kennenzulernen. Ich rate Ihnen, vergessen Sie, was Sie gesehen haben.«
»Sie vergessen, daß diese Art von Geschäften der Grund ist, warum man den Herzog verhaftet hat. Eines seiner – Ihrer Schiffe wurde aufgebracht. Die Felicidade, mit Sklaven an Bord. Herera bot mir einen Handel an: Die Freiheit des Herzogs gegen die Freiheit eines Mannes, den Sie hier gefangenhalten. Herera wartet draußen darauf, daß ich ihm diesen Mann ausliefere.«
»Es ist gut, daß Sie Herera hergebracht haben«, sagte Leblanc. »Ich werde mit ihm sprechen. In einer Sprache, die er versteht.«
»Nein! Es ist genug geredet worden. Sie geben den Mann heraus!«
»Ich vertrete die Interessen des Herzogs«, sagte Leblanc. »Und ich würde sie verletzen, wenn ich Ihren Befehl befolgte.« Er neigte den Kopf. »Wenn mich eine Schuld trifft, dann die, daß ich nicht genug Vorsicht habe walten lassen, und das wäre in der Tat ein unverzeihlicher Fehler. Was die Art des Handels, den wir mit einigen Schiffen betreiben, anbelangt . . . die Welt ist häßlich und schmutzig, gewiß. Ich habe sie nicht gemacht, ich finde mich nur in ihr zurecht, Komtesse. Es gab eine Zeit nach der Revolution, da wurden die Schlösser des Adels geschleift, die Alleen zu Brennholz zerhackt, da saßen Herzöge in London in der Emigration in kalten Dachstuben, da verbargen sich die stolzesten Namen Frankreichs hinter den Zeichen von Pastetenbäckern und Schnapsbrennern. Der Herzog von Belômer aber konnte Hunderten das Leben retten, dank seines bewahrten Vermögens. Er bekämpfte Napoleon, während ich, sein Diener, ganz Europa mit Marmorbüsten des Kaisers überschwemmte. Und während unsere Schiffe, Gesetze und Verbote übertretend, Spezereien und Zucker ins Land schmuggelten, konnte der Herzog Ihren Vater aus Vincennes befreien, vor dem sicheren Tod . . .« Er schien nicht mehr zu ihr zu sprechen. Rastlos durchmaß er den Raum, den Kreis des Lichts verlassend, wieder in ihn zurückkehrend. »Es ist soviel Böses im Namen des Guten geschehen, warum nicht Gutes im Namen des Bösen?« Er blieb vor Caroline stehen, warf ihr einen forschenden Blick zu. Mit seinem untrüglichen Sinn für die Realität wußte er, daß er dem Herzog mit der Auslieferung Ramon Sternes nicht im mindesten half. Aber wie sollte er das dieser Frau klarmachen? Trotzdem sagte er: »Hören Sie mir bitte noch einen Augenblick zu, Komtesse, dann mögen Sie entscheiden. Sie wollen, daß ich diesen Mann ausliefere – gegen ein vages Versprechen. Dieser Mann besitzt ein wertvolles Geheimnis: das Wissen und die Pläne, Schiffe zu bauen, die schneller sein werden als der schnellste Klipper. Begreifen Sie, was das bedeutet? Wer diese Schiffe besitzt, der wird . . .«
Caroline hörte seine Worte, fühlte seinen erwartungsvollen Blick auf sich gerichtet. Sie hatte ihm die ganze Zeit zugehört, obwohl es sie große Überwindung gekostet hatte. Jetzt war es ihr genug. Das war nicht der Augenblick, nachzudenken! Wenn sie damit anfing, würde sie morgen noch hier sein.
»Und wenn dieser Mann Gold machen könnte! Geben Sie ihn frei!«
Leblanc sah Caroline mit dem Blick eines Menschen an, für den es nur eines gab, vor dem ihm graute: Handlungen, die vom Gefühl diktiert waren. Trauer war in seinem Blick, die ganze Kluft zwischen Vernunft und Leidenschaft. Er neigte leicht das Haupt. »Ihr Diener, Komtesse.« Ohne ein weiteres Wort wandte er sich um. Er zog einen Vorhang an der Schmalseite des Raumes zur Seite. Eine Tür wurde sichtbar, schwang lautlos auf.