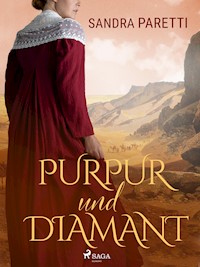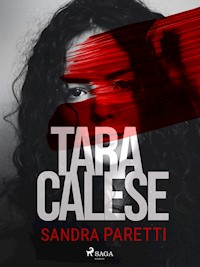6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Berlin zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Camilla Hofmann, die 17jährige Tochter aus einem großbürgerlichen Berliner Fabrikanten-Haus, erlebt eine unbeschwerte und sorgenfreie Jugend in Steglitz. Doch der prunkvolle Lebensstil ist nur die Fassade zerrütteter Familienverhältnisse. Und schließlich kommt der Tag, an dem der Konkurs der Firma des Vaters nicht mehr zu verheimlichen ist. Die Familie hält dem Schicksalsschlag nicht stand und zerbricht daran. Auch Camilla muss ihr geliebtes Zuhause verlassen. Der Linde im Park ihres Elternhauses, dem sagenumwobenen »Wunschbaum«, vertraut sie ihre Hoffnungen auf eine glücklichere Zukunft an: Eines Tages will sie in das Haus, in dem sie ihre Kindheit verbracht hat, zurückkehren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 588
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Sandra Paretti
Der Wunschbaum
Roman
Erster Teil
1
Es war noch sehr früh, und sie fragte sich, woher kommt die Helligkeit – ein zarter Schein hinter den gelben Cretonnevorhängen, nicht kräftig genug, um in den Raum vorzudringen, aber doch zu hell für diese Stunde, denn es war Winter und noch nicht sechs Uhr.
Ihr Zimmer lag nach Osten; sie hatte sich das gewünscht. Der Morgen war ihre Tageszeit; diese kurze Spanne, in der die Welt aus dem Schlaf erwachte und alles ganz neu war, verbrachte sie im Winter wie im Sommer draußen, in dem weitläufigen Park, der das Haus umgab. Niemand hörte sie das Haus verlassen, niemand sah sie zurückkommen; aber etwas von dem Schmelz der morgendlichen Natur blieb an ihr haften und strahlte von ihr aus. Warum stehe ich nicht auf, dachte sie. Wovor habe ich Angst? Bin ich gar nicht mehr im Haus, in meinem Zimmer? Hatte man sie bereits daraus vertrieben?
Wo hing das Gemälde der Großmutter, das mit dem Strohhut, auf dem sie ihr so ähnelte? Wo stand der Sekretär, an dem sie gestern so viele Briefe begonnen und nicht vollendet hatte? Wo hing das Kleid, das sie am Abend tragen sollte? Der Raum gab nichts davon preis; undurchdringliches Halbdunkel umgab sie, lag auf ihr wie ein Albdruck, machte ihr das Atmen schwer. Sie zwang sich, den Kopf zu heben, wobei sie das Gewicht der langen dunklen Haare spürte, die sie nachts in Zöpfen geflochten trug. Sie begann, das Haar zu lösen, aber es fehlte ihr immer noch die Kraft aufzustehen, es war fast wie in dem schrecklichen Traum von heute Nacht.
Es kam selten vor, dass sie sich beim Erwachen an Träume erinnerte, und noch seltener, dass sie nachts wach lag. Sie hatte den festen Schlaf einer Siebzehnjährigen; gestern war sie früh zu Bett gegangen – auch sofort eingeschlafen – mit dem festen Vorsatz, diesen Tag, den letzten des Jahres 1900, der so wichtig in ihrem Leben sein würde, ausgeruht zu beginnen. Im Grunde war bereits alles entschieden; sie hatte dem Vater ihr Versprechen gegeben; da gab es kein Zurück, und es würde auch kein Retter in letzter Minute auftauchen. Sie würde den Tag durchstehen, und sollte ihr zum Weinen sein, so würde sie ihre Tränen vor den anderen zu verbergen wissen.
Wieder kehrten ihre Gedanken zu dem Traum zurück: Ohne Klopfen hatte sich die Tür zu ihrem Schlafzimmer aufgetan, und Rothe war hereingekommen, war an ihr Bett getreten, ungeniert, als sei das schon sein Recht, hatte sich über sie gebeugt und die Hand nach ihr ausgestreckt; so nahe war seine Hand gekommen, dass sie die schwarzen Haare gesehen hatte, die darauf wuchsen, bis hin zum Mittelglied der Finger … in diesem Augenblick war sie voller Entsetzen aufgeschreckt, und selbst in der Erinnerung schnürte es ihr wieder den Hals zu.
Jeden Stundenschlag hatte sie von da an gehört. Die Steglitzer Kirche, die Uhren aus dem Haus: aus der Halle die Standuhr, aus der Bibliothek die Jahresuhr, die einen besonders hellen, weithin tragenden Ton hatte. Aus den entferntesten Teilen des großen Hauses waren die Geräusche zu ihr gedrungen. Die dicken Ziegelmauern schienen plötzlich durchlässig; Heizungsrohre, Wasserleitungen und Kamine sandten ihre Signale. Kurz vor zwölf Uhr war eine Kutsche am Haupteingang vorgefahren; der Arzt, den die Mutter hatte rufen lassen. Um drei Uhr war der Vater nach Hause gekommen; die Zeit sagte ihr, dass er die Nacht beim Spiel verbracht hatte. Wie immer, wenn es so spät wurde, benützte er die rückwärtige Einfahrt zu den Stallungen, und wie immer ging er dann nicht gleich zu Bett, sondern hielt sich noch eine Weile in seinem Arbeitszimmer auf und rekapitulierte mit einem Paket neuer Spielkarten die interessantesten Partien, vor allem, wenn er verloren hatte. Sie hatte sich überlegt, ob sie nicht mitten in der Nacht zu ihm gehen und ihm sagen sollte, dass sie ihr Versprechen zurücknahm, gleichgültig, was das für Folgen haben würde. Aber die Folgen, allen voran der Verlust dieses Hauses, waren ihr nicht gleichgültig. Und schließlich, was konnte sie ihrem Vater von Angesicht zu Angesicht abschlagen, wenn sie es nicht einmal hatte schreiben können …
Die Helligkeit begann das Dunkel allmählich aufzulösen, und das Erste, was in Umrissen sichtbar wurde, war das Kleid, das ihrem Bett gegenüber außen am Schrank hing. Zwei Dienstmädchen hatten es aus dem Bügelzimmer heraufgetragen, damit die empfindliche Seide keinen Knick bekam. Abends bei der Silvesterfeier würde sie darin vor der Familie und den Gästen erscheinen. Wie sollte sie die langen Stunden bis Mitternacht durchhalten, bis der Vater an sein Glas klopfte, einen Toast auf das neue Jahr ausbrachte und anschließend die Verlobung seiner jüngsten Tochter mit Alexander Rothe bekannt gab? Waren wirklich alle so ahnungslos, wie der Vater behauptete? Auch Keith?
Sie konnte nur hoffen, dass er in diesem Augenblick bereits draußen im Garten war, um die letzten Vorbereitungen für das Feuerwerk zu treffen.
Was für ein herrlicher Tag dieser 31. Dezember 1900 hätte werden können! Was für ein gutes Ende das alte Jahr hätte nehmen können, und was für einen guten Anfang das neue Jahr. Noch als sie den Stoff für das Ballkleid kaufte, wie glücklich und unbeschwert war sie da gewesen, neun Meter Zephyrseide, neun Meter gesponnenes Sonnengold, aber jetzt im Halbdunkel war die Farbe ein bleiches Gespenstergrau.
Gemeinsam mit dem Vater hatte sie den Stoff ausgesucht, in Paris, als Belohnung für ihre Mitarbeit während der Weltausstellung, auf der auch die Firma Hofmann einen Stand im Pavillon der deutschen Parfümeriefabriken hatte. Jetzt fragte sie sich, ob der Vater nicht schon damals einen Hintergedanken damit verbunden hatte. Von heute auf morgen konnte es ja schließlich nicht geschehen, dass kein Geld mehr da war und die Situation so kritisch wurde, dass der Vater – ausgerechnet er! – nur noch einen Ausweg sah, wenn er sie gegen einen Einschuss in die Firma Alexander Rothe zur Frau gab.
Alexander Rothe. Wenn sie wenigstens gewusst hätte, wie Rothe auf sie verfallen war. Sie versuchte, sich die wenigen Begegnungen ins Gedächtnis zurückzurufen: ein paar allgemeine Bemerkungen zur neuesten Wildenbruch-Premiere im Foyer eines Theaters; ein nichtssagendes Gespräch auf dem Wohltätigkeitsbasar im Hotel Kaiserhof, wo sie als Verkäuferin in der sogenannten »Seelenapotheke« mitgeholfen hatte, einem der erfolgreichsten Stände, der mit seinem »Liebes-Heil-Serum« und »Anti-Eifersuchtin« einen horrenden Umsatz erzielte; ein einziger Tanz auf einem Fastnachtsball. Nie war ein persönliches Wort zwischen ihr und Rothe gefallen; nie hatte er ihr geschrieben oder den Versuch gemacht, sich mit ihr zu verabreden. Nie hatte sie einen Gedanken an ihn verschwendet, es sei denn, dass schon bei den kurzen Begegnungen sein eigenartiges Haarwasser sie gestört hatte, und noch mehr seine Art, geräuschvoll durch den halb offenen Mund zu atmen; und auch das war ihr erst wieder eingefallen, nachdem der Vater ihr eröffnet hatte, Alexander Rothe habe um ihre Hand angehalten.
Sie hatte es im ersten Augenblick nur komisch gefunden – der Vater als Heiratsvermittler, in der Rolle also, die der Mutter auf den Leib geschrieben war, aber ihm gewiss nicht. Nach und nach war er dann mit der Wahrheit herausgerückt, nicht direkt, das war nicht seine Art. Man hätte meinen können, nicht er sei es, der in Schwierigkeiten steckte, sondern ein Dritter, und als verfolge er das aufziehende Unheil mit der Neugier eines Unbeteiligten, der eine gewisse Schadenfreude nicht unterdrücken kann. So viel war schließlich herausgekommen: Er steckte bis zum Hals in Schulden, und nur ihre Verbindung mit Alexander Rothe konnte ihn noch retten.
Damals vor drei Wochen, als dieses Gespräch stattfand, war alles noch weit weg; hinzu kam, dass sie mit drei Schwestern aufgewachsen war, von denen jede den Mann geheiratet hatte, den die Eltern für sie ausgesucht hatten. In den letzten sieben Jahren war immer irgendetwas in der Schwebe gewesen; seit ihre Töchter im heiratsfähigen Alter waren, hatte die Mutter das zu ihrem Lebensinhalt gemacht, überall hatte sie nach Möglichkeiten sondiert, überall hatte sie ihre Fühler ausgestreckt, rastlos und mit geradezu kriminalistischem Spürsinn. Und die Töchter hatten die Autorität der Mutter in diesen Belangen voll anerkannt; ein Veto von ihr genügte, um eine Neigung im Keim zu ersticken; und wenn sie ihre Wahl schließlich getroffen hatte, war alles Weitere nur noch eine Formalität. Bei Camilla, ihrer jüngsten Tochter, hatte sie seltsamerweise keinerlei Aktivität in dieser Richtung entwickelt, was Camilla nachträglich darauf schließen ließ, dass auch die Mutter den finanziellen Ruin längst hatte kommen sehen und dass sie wusste, für Camilla stand nicht mehr jene Mitgift von einhunderttausend Mark zur Verfügung, die für eine Partie nach ihrem Geschmack unabdingbar war.
Was für eine Komödie war das gewesen, bis Maxi, Alice und Lou unter der Haube waren. Camilla hatte das sogar unterhaltsam gefunden, vor allem aber selbstverständlich, dass es bei einer Heirat nicht nur um Liebe gehen musste, sondern dass Name, Rang und Vermögen des Mannes Faktoren von weit größerer Bedeutung waren. Eine Ehe ohne Liebe, vielleicht war das ganz normal, vielleicht war nichts daran schrecklich, nicht so schrecklich jedenfalls, wie sie es sich vorstellte …
Die Helligkeit hinter den Vorhängen gewann immer mehr an Kraft, und allmählich nahm der Raum Gestalt an, die zarten grünen Streifen der hellen Tapete wurden sichtbar, die Konturen der Möbel aus Nussbaum, das Muster des Smyrnateppichs, des letzten und schönsten, den die Großmutter geknüpft hatte. Dennoch blieb das Licht eigenartig; auch die Geräusche aus dem Garten klangen anders als sonst. Von dem überlangen Nachthemd behindert, lief sie barfuß zum Fenster. Und dann, als sie die Vorhänge zur Seite zog, gab es eine ganz natürliche Erklärung für dieses verfrühte Hellwerden, das sie so irritiert hatte: Schnee war gefallen über Nacht, nicht nur ein dünner Belag, der keinen Tag überdauern würde, sondern Massen von Schnee, und der Himmel hielt noch mehr bereit. Ja, es schien keinen Himmel mehr zu geben, nur einen grenzenlosen weißen Raum, durch den sich andeutungsweise Linien zogen, die einmal Wege waren, und in dem sich kleine Hügel erhoben, die Sträucher sein mochten. Nur der Baum in der Mitte der weiten Lichtung stand dort wie immer, der breite schwarze Stamm und darüber die mächtige Krone.
Um den Park an diesem Morgen noch für sich allein zu haben, war es jetzt allerdings zu spät; schon führte ein freigeschaufelter Pfad zum Gärtnerhaus, und ein zweiter zu den Treibhäusern, aus denen die Palmen, die Lorbeerbäume und die vielen, vielen Blumen für das heutige Fest kommen würden. Auch der Weg zur Lieferantentür war bereits zur Hälfte freigeschaufelt; sehen konnte sie niemanden, aber als sie nun das Fenster öffnete, hörte sie das Einstechen der Schaufel und den dumpfen Aufprall, mit dem der Schnee auf die volle Schubkarre flog. Die Geräusche sagten ihr, dass der Schnee fest war und nicht gleich wieder schmelzen würde. Sie hatte sich Schnee gewünscht; gegen die Vorhersage des Gärtners und Tante Lenkas, die Stein und Bein geschworen hatten, dass es im alten Jahr keinen mehr geben würde; und eigentlich mussten sie es wissen, da sie aus Russland stammten. Aber nun war der Schnee da! Sie hatte recht behalten, und nun würde Keith, der in seinem ganzen Leben noch keinen Schnee gesehen hatte, vor seiner Abreise das Haus und den Park doch noch im Schnee erleben.
Sie stand dort, vor dem offenen Fenster, atmete in tiefen Zügen die Luft ein, durstig, als könnte sie damit die fiebrige Unruhe beschwichtigen. Nicht mehr lange, und es würde heller Tag sein. Als sie das Fenster schloss und sich in den Raum wandte, der jetzt vom kühlen, winterlichen Licht erfüllt war, leuchtete ihr das gelbe Ballkleid hell entgegen, bedrohlich und unausweichbar. Sie hielt es plötzlich nicht länger aus. Sie musste nach draußen, ins Freie.
Es schlug sieben, als sie ihr Zimmer verließ, in Mantel und festen Stiefeln und einer Pelzkappe, unter der das lange dunkle Haar hervorquoll. Von der Einfahrt her hörte sie eine Kutsche vorfahren: der Barbier, der kam, um den Vater zu rasieren; jeden Tag um diese Stunde, auf die Minute genau. Eine Nebensächlichkeit; aber in diesem Moment maß Camilla ihr Bedeutung bei. Noch ist alles wie bisher, dachte sie, während sie die breite Treppe mit dem geschnitzten Holzgeländer hinunterschritt, noch hat sich nichts verändert. Ein Mädchen staubte in der Halle mit einem Federwisch die Goldrahmen der Rembrandtkopien ab; am Abend würde hier die Tanzfläche sein. Der Korb des Gärtners stand dort, schon halb voll mit den alten Schnittblumen, die er aus den Zimmern zusammentrug, bevor er die neuen brachte. Ein anderes Dienstmädchen war mit einem Korb voller Bettwäsche auf dem Weg zu den Gästezimmern im Westflügel: Im Laufe des Tages würden die drei verheirateten Schwestern mit ihren Männern eintreffen, um an der Silvesterfeier teilzunehmen, und sie würden, wie jedes Jahr, bis zum Dreikönigstag bleiben.
Bald würde Tante Lenka das Haus verlassen, um die Frühmesse zu besuchen. Der Vater würde sich mit dem Barbier über das Neujahrsrennen der Traber unterhalten. Und später, in einer halben Stunde etwa, würde in dem großen Klingelkasten in der Küche die »15« aufleuchten, und Mamsell Schröter würde für die Mutter das Frühstück zubereiten; den Tausendgüldenkraut-Tee und den Zwieback, den der Arzt sicher in der Nacht verordnet hatte; die Mutter würde alles zurückweisen und ihren Kaffee verlangen, eine spezielle Sorte, die per Express von Hamburg geschickt werden musste; dazu etwas »Herzhaftes«, ein paar Krabben vielleicht, etwas ausgelöstes Wachtelfleisch mit Cumberland-Sauce, nicht etwa Reste vom Sonntagsessen, sondern eigens für sie jetzt am Morgen zubereitet, denn Aufgewärmtes war in den Augen der Mutter Gift.
Unten ging die Haustür, und durch den Windfang, einen schweren roten Filzvorhang, der dort im Winter aufgemacht wurde, trat der Barbier. Er klopfte sich den Schnee von den Füßen, hing den Mantel mit der dreifachen Pelerine an die Garderobe und verschwand dann mit seiner Ledertasche in dem Korridor, der zur Bibliothek, zum Rauchzimmer und zu den Räumen des Vaters führte.
Camilla lauschte auf die Schritte, die sich langsam entfernten, wartete, bis sie die Tür hörte und die Stimme des Vaters erklang: »Morgen, Schütte. Na, was sagen Sie zu dem Schnee? Da werden die russischen Pferde ganz schön im Vorteil sein …« Camilla lächelte. Es war gut, die Stimme des Vaters zu hören, die fest gefügte Ordnung des Hauses überall bestätigt zu finden, das Ticken der vielen Uhren, die Schritte der Dienstboten, die leise Geschäftigkeit, die aus den Wirtschaftsräumen zu vernehmen war.
Nein, es durfte nicht sein, niemals, dass all das ein Ende nahm.
2
Es war etwas Merkwürdiges an Camillas Liebe zu diesem Haus. Der Vater hatte es erbaut, und die Mutter herrschte darin, aber Camilla fühlte sich als die eigentliche Besitzerin. Es stand nun seit sechs Jahren; von 1893 auf 1894 war es gebaut worden. Steglitz war damals noch ein verschlafener Vorort gewesen, und, verglichen mit den Bauerngehöften und kleinen Einfamilienhäusern, hatte sich das Haus, das der Apotheker Hofmann hinstellte, wie ein Palast ausgenommen: ein lang gestreckter Bau mit einem zweistöckigen Mitteltrakt und einstöckigen Seitenflügeln, hellgrau verputzt, mit einem Schieferdach, weißen Fensterläden und vielen Fenstern – genau wie Camilla sich »ihr Haus« vorstellte, seit Tante Lenka ihr einmal eine Geschichte aus einem alten Buch in kyrillischer Schrift vorgelesen hatte. Camilla hatte die Geschichte von da an immer wieder hören wollen, eigentlich nur wegen der einen Stelle, an der die Tante den Blick hob und sagte: »Und das Haus besaß dreihundertundfünfundsechzig Fenster.« Worauf sie noch mal eine Pause machte: »Für jeden Tag des Jahres eines.«
Zu der Zeit hatten Camillas Eltern noch in Neukölln gewohnt, zwischen Landwehr- und Teltowkanal, kurz vor dem Zusammenfluss, wo keine Kastanien mehr standen, sondern die Ufer kahl waren; im Sommer war das Wasser dort immer mit einer irisierenden Ölschicht bedeckt, und im Winter fror es nicht zu wegen der vielen Abwässer. Die Apotheke, ein alter Bau und lange im Besitz der Familie Hofmann, war noch das Stattlichste, aber das Hinterhaus, in dem die Familie wohnte, war mehr als einfach, und außerdem war es ewig dunkel und feucht. Von ihrer Kammer im dritten Stock blickte Camilla auf den Fabrikhof; er stieß unmittelbar an den Kanal, sodass die Rohstoffe dort angeliefert und die fertigen Waren verschickt werden konnten.
Nur wegen des Geldes hatte ihr Vater mit der Fabrikation von Seife begonnen – erst später war er auch auf Parfümerie-Artikel übergegangen –, und man konnte kein Fenster öffnen, ohne dass nicht der Gestank der Fette, die zu Seife verkocht wurden, hereinströmte; auch bei geschlossenen Fenstern sickerte der Geruch durch, das ganze Haus war getränkt davon, sogar die Kleider; und darunter litt Camilla am meisten, denn noch in der Schule hing der Trangeruch an ihr.
Am Morgen weckte sie der Lärm, wenn die gusseisernen Kessel angeheizt wurden; von Jahr zu Jahr waren es mehr geworden, der Gestank immer penetranter, und sie hatte sich immer geniert, wenn auf dem Markt am Maybacher Ufer in den Buden die Hofmann’sche Kernseife ausgeschrien wurde, oder wenn sie auf der Straße den Wagen begegnete, mit denen die Berliner Kunden der Firma beliefert wurden, an den Seitenwänden die Reklamefigur, die stadtbekannt war: die lachende Wäscherin, die hinter einem Waschbottich voll schäumender Seife stand. Dieselbe Reklamefigur, nur riesig vergrößert, war an den Brandmauern der seitlich angrenzenden Häuser zu sehen, ein unvermeidlicher Anblick, sooft Camilla ans Fenster trat.
Aber alles das war von einem Tag auf den anderen unwichtig geworden; an jenem Sonntag nämlich, als ihr Vater sie zu einem Besuch des Tiergartens mitnahm. Sie hatten nicht wie üblich die Pferdebahn bestiegen, sondern eine Droschke, und der Vater war mit ihr, der Neunjährigen, aus der Stadt hinausgefahren, immer weiter, in eine Gegend, die für sie ganz neu war. Schließlich hatte der Vater die Droschke anhalten lassen, und sie waren zu Fuß weitergegangen.
Es war ein heißer Tag. Sie kamen über verwildertes Weideland, dann in ein Gebiet, das von Kiefern und Föhren bestanden war. Das hohe, verschilfte Gras raschelte leise im Wind, in den Buchenhecken schrien die Kiebitze. Der Vater schien die Orientierung verloren zu haben, zweimal legte er einen Grenzstein frei, kontrollierte die Himmelsrichtung, in der sie sich bewegten, bis sie dann endlich auf die Lichtung hinaustraten, in deren Mitte eine mächtige Linde stand. Von da an war kein Wort mehr gefallen; er hatte sie nicht mehr wie zuvor auf Pflanzen und Vögel aufmerksam gemacht. Er hatte ihre Hand genommen, und sie waren auf den großen Baum zugegangen. Sie waren unter seine weit ausladende Krone getreten, und dort hatte der Vater, indem er beide Arme ausbreitete, als wollte er die ganze Lichtung umfangen, verkündet: »Hier wird unser Haus stehen!«
So hatte er sie in sein Geheimnis eingeweiht. Das erste große Geheimnis, das man ihr anvertraut hatte, denn er hatte sie zu strengstem Stillschweigen verpflichtet. Erst viele Jahre danach hatte sie begriffen, dass ihr Vater damals eine Verbündete gebraucht hatte für seinen kühnen Plan und dass er niemand andern gehabt hatte als sie, ein Kind. Armer Vater!
Der Pakt zwischen ihnen hatte sich bewährt. Sie hatte das Geheimnis gehütet, und er hatte sie bei allem, was nun folgte, ins Vertrauen gezogen: Er hatte die ersten Bauskizzen vor ihr ausgebreitet; sie waren gemeinsam vor dem ausgeschachteten Fundament gestanden. Es war eine schreckliche Zeit gewesen, als sie an den Masern erkrankte und die Ausflüge zum »Observatorium« ausfallen mussten. Aber der Vater war jeden Abend an ihr Bett gekommen, hatte ihr vom Fortgang der Arbeiten berichtet, mit gedämpfter Stimme trotz der verriegelten Tür.
Der Rohbau wurde fertiggestellt, das Richtfest gefeiert, der Innenausbau in Angriff genommen – immer noch herrschte der übrigen Familie gegenüber strengstes Stillschweigen. Selbst als die Arbeiten am Haus beendet waren und der Vater bereits den Hausschlüssel bei sich trug, zögerte er noch immer, die übrige Familie einzuweihen, aber Camilla zersprang fast vor Ungeduld, das Haus in Besitz zu nehmen, und so gab er ihrem Drängen nach und verkündete beim Mittagessen, dass die ganze Familie nachmittags ein »Picknick im Grünen« machen würde. Es war der 22. August 1894, das Datum prägte sich Camilla für alle Zeit ein; und kurz nach drei Uhr, nachdem die Mutter ihre Siesta gehalten hatte, wurde die große Equipage angespannt. Damit man ganz unter sich war, kutschierte der Vater selber. Immer wieder hielt er an, wies auf die Schönheiten der Gegend hin, aber nach und nach wurde er einsilbig, so als könnte ihm sein Geheimnis zu früh entschlüpfen. Auf jeden Fall deutete Camilla es so, die neben ihm auf dem Bock saß und kaum erwarten konnte, dass auch die Mutter und die Schwestern das Wunderwerk zu Gesicht bekämen. Für Camilla war das Haus ein Wunderwerk; auch wenn es nicht für jeden Tag des Jahres ein Fenster hatte, so gab es doch so viele Fenster, wie das Jahr Wochen hatte, man musste nur ein bisschen großzügig beim Zählen sein. Das Herz klopfte ihr bis zum Hals, als sie Steglitz erreichten, an der Kirche vorbeifuhren, das letzte Haus hinter sich ließen, von der Straße abbogen. Ein paar Meter noch, eine letzte Krümmung des Weges, und die Baumreihe würde auseinandertreten, das schmiedeeiserne Einfahrtstor sichtbar werden, dahinter das Haus. Und dann … Wie oft hatte sie sich den nächsten Moment ausgemalt!
Aber es endete alles mit einer Katastrophe. Die »Überraschung« löste nicht Freude aus, sondern schroffe Ablehnung. Camilla hatte das Gesicht der Mutter bis heute nicht vergessen, zuerst ungläubig, dann versteinert. Kaum dass der Vater sie dazu bewegen konnte, wenigstens einen Rundgang durch das Haus zu machen. Vielleicht hatte er sich davon einen Umschwung erhofft; aber die Mutter machte bei der Besichtigung nicht ein einziges Mal den Mund auf, und auch während der Heimfahrt, die auf ihren Wunsch sogleich angetreten wurde, hüllte sie sich in eisiges Schweigen. Erst zu Hause war der Streit zwischen den Eltern ausgebrochen, hinter verschlossenen Türen zwar, aber laut genug, dass Camilla, die am Gang lauschte, alles verstand. Die Mutter lehnte es kategorisch ab, »sich ans Ende der Welt« verbannen zu lassen. Eine Flut von Anklagen ergoss sich über den Vater. Vor allem einen Satz, der immer wiederkehrte, prägte sich Camilla ein. »Dafür ist also Geld da!«
In den folgenden Tagen und Wochen flammte dieser Streit bei jeder Gelegenheit wieder auf; ein halbes Jahr wehrte sich die Mutter. Tatsächlich blieb das Haus in Steglitz den ersten Winter über leer stehen, erst im Frühjahr erzwang der Vater den Umzug mit der Begründung, er brauche das Hinterhaus zur Vergrößerung der Fabrik. Der Kampf der Eltern war damit allerdings nicht beendet. Er dauerte an, nicht mehr laut, ohne dramatische Szenen, aber unablässig und unversöhnlich bis zum heutigen Tag. Auch der Arzt, den die Mutter heute Nacht hatte rufen lassen, war ein Requisit in diesem Kampf …
All das ging Camilla durch den Kopf, während sie das Haus verließ und an den Treibhäusern vorbei den Weg in den Park einschlug. Auf Schritt und Tritt kamen ihr die Erinnerungen: das jahrelange Hin und Her der Eltern, wie Park und Garten angelegt werden sollten. Der Vater wollte hinter dem Haus, wo Camilla sich jetzt befand, das ursprüngliche Gepräge der Landschaft möglichst erhalten; die Mutter wartete nur, bis er eine längere Reise unternahm; während seiner Abwesenheit ließ sie dann einen künstlichen Teich anlegen, eine Holzpagode bauen, Volieren aufstellen und exotische Nadelbäume anpflanzen. Glück hatte sie damit nicht, die Bäume gingen ein, und auch die Vögel überstanden den ersten Winter nicht. Durch diesen Misserfolg keineswegs abgeschreckt, brachte die Mutter im folgenden Jahr von einer Reise an die oberitalienischen Seen einen Waggon voller Palmen, Magnolien und Orangenbäume mit. Auch sie hielten dem nördlichen Klima nicht stand. Nach diesem zweiten Fehlschlag hatte die Mutter keine weiteren Versuche unternommen, dem Park ein »kultiviertes Aussehen« zu geben, sondern sich mit einem Ziergarten im französischen Stil vor dem Haus getröstet, und mit den beiden Treibhäusern, in denen nicht nur die vielen Blumen für den Hausschmuck gezogen wurden, sondern auch ein Regiment südlicher Zierbäume, wie die Zitronenbäume, die heute Abend zur Dekoration des Speisesaals dienen würden.
Camilla hatte all diese Dinge niemals mit Geld in Zusammenhang gebracht – jetzt freilich tat sie es: Was hatte das wohl alles gekostet? Das Grundstück, das Haus, die Stallungen, die Kutschen und Pferde, die Treibhäuser, die vielen Dienstboten …
Sie war ins Freie gegangen, um solchen Gedanken zu entrinnen, aber sie ließen sich nicht abschütteln, sie folgten ihr auf Schritt und Tritt.
Das hohe schmiedeeiserne Tor der Einfahrt war eben aufgegangen, der geschlossene Wagen einer Delikatessenhandlung fuhr am Lieferanteneingang vor. Die Köchin erschien, der Diener, und dann wurden Kisten und Körbe ins Haus geschleppt. Den ganzen Vormittag würde das so weitergehen; der Patissier, der Fischhändler, der Fleischer, der Tapezierer, der die Girlanden in der Halle anbrachte, und schließlich, allerdings erst am späten Nachmittag, die zusätzlich engagierten Lohndiener und die Musiker für den Ball. So war das bei jedem großen Fest. Nur im Kreis der Familie zu feiern, ohne Gäste und ohne eine gewisse Prachtentfaltung, das wäre für die Mutter kein Fest gewesen. Auch das hatte Camilla bisher als selbstverständlich hingenommen, aber jetzt musste sie an die Kosten denken, die damit verbunden waren, an die vielen Rechnungen, die schließlich alle auf dem Schreibtisch des Vaters landen würden; sie hatte die große Ledermappe gesehen, in der er sie aufbewahrte; bei dem Gespräch über ihre Verbindung mit Rothe hatte der Vater ihr diese Mappe gezeigt, prall gefüllt; sie erinnerte sich an die Geste, mit der er die Mappe wieder unter die Rennzeitungen geschoben hatte, und an seine Bemerkung: »Bis zum Jahresende werden sie warten – aber dann?«
Camilla hatte die freigeschaufelten Wege in der Nähe des Hauses längst verlassen. Es war nicht so kalt, wie sie gedacht hatte. Wildspuren zogen sich über den Schnee; sie hatten ein paar Eichhörnchen im Park und viele Vögel. Die Wolkendecke hing immer noch tief herab, aber Camilla war sich nicht sicher – bedeutete das noch mehr Schnee oder Regen? Sie war ganz ziellos gelaufen, nur um sich zu bewegen, um frische Luft zu atmen und irgendwie mit ihren Gedanken fertigzuwerden. Ohne sich dessen recht bewusst zu sein, hatte sie den Weg zu der alten Linde eingeschlagen, die allein inmitten der Lichtung stand. Der Boden stieg an in der Nähe des Baumes, sie hatte das Gefühl, dass es seine Wurzeln waren, die den Boden wölbten.
Sie blieb einen Moment stehen, um den Baum zu betrachten. Sie kannte ihn bei allen Jahreszeiten, und in jeder hatte er seine besondere Schönheit. Die Krone war so hoch und dicht, dass im Sommer das Sonnenlicht nur tropfenweise durchsickerte; nicht einmal im Herbst, wenn er sein Laub abwarf, wurde er kahl wie die anderen Bäume. Von der Ferne gesehen, blieb die Krone auch dann voll und dicht. Jetzt war jeder Zweig, bis hinein in die feinsten Verästelungen, vom Schnee wie mit einem Silberstift nachgezeichnet, und in diesem Filigran hing der Himmel, schien darauf zu ruhen.
In dem weiten Kreis, den die Krone bildete, lag der Schnee dünner; in unmittelbarer Nähe des Stamms kam das Moos durch. Der Schnee, der von den Enden der Zweige fiel, hatte unten eine Linie gezeichnet, und das verstärkte den Eindruck, dass der Baum in einem magischen Kreis stand.
Vom ersten Tag an, noch ehe sie davon wusste, welche Kräfte man ihm andichtete, hatte dieser Baum sie seltsam angezogen. Weithin sichtbar hatte er sich über die flache Ebene erhoben, einsam und herrisch; und sein Duft – er blühte damals – hatte die ganze Gegend erfüllt. Jedes Jahr im Frühling, wenn im Haus die Fenster offen standen, verbreitete sich der starke Duft seiner Blüten in den Räumen. Der Baum war sehr hoch für eine Linde, und um seinen Stamm zu umfassen, bedurfte es dreier Männer. Die Schätzungen über sein Alter schwankten; zweihundert sagten die einen, vierhundert andere. Eigentlich war es ein Wunder, dass er so alt geworden war, denn er stand in einem Gebiet, wo Holz knapp war. Vielleicht hatte man ihn wegen des Schattens wachsen lassen, den er im Sommer gab, oder vielleicht, weil er so schön war, groß und ebenmäßig, mit dieser gewaltigen Kuppel aus Zweigen und Blättern.
Die Leute in der Umgebung, die Bauern, die Fischer und Jäger, nannten ihn nur den Wunschbaum. Wie er zu diesem Namen und zu der Legende gekommen war, die damit verknüpft war, darüber gab es ebenso viele Meinungen wie über sein Alter; alle aber glaubten an die wunderbaren Kräfte, die dem Baum innewohnten: Wenn man unter diesem Baum einen Wunsch aussprach, so konnte man sicher sein, dass er in Erfüllung ging.
Dies war nicht nur eine Legende, die unter ein paar alten Leuten kursierte; immer wieder kamen Fremde, die um Erlaubnis baten, dem Baum einen Besuch abstatten zu dürfen: Die meisten aber drangen einfach nachts heimlich in den Park ein, sodass der Gärtner immer zu tun hatte, die beschädigten Stellen im Zaun zu flicken. Camilla stand jetzt unter dem Baum, mit dem Rücken an den breiten, glatten Stamm gelehnt. Die Föhren jenseits der Lichtung schwankten leise im Wind, aber hier war es ganz still. Wie lange war es wohl her, dass auch dieser Stamm sich im Winde gebogen hatte? Wie viele Winter und Sommer hatten vergehen müssen, wie tief hatte er seine Wurzeln in die Erde senken müssen, um so stark zu werden?
Sie hatte viel über die Legende nachgedacht, und in den ersten Jahren war sie manchmal auch versucht gewesen, den Zauber des Baumes auf die Probe zu stellen. Irgendetwas hatte sie aber immer daran gehindert: einmal der Gedanke, dass es nicht recht war, den Zauber wegen einer Kleinigkeit in Anspruch zu nehmen; zum anderen hielt sie eine gewisse Nüchternheit ab, die ihr sagte, bloßes Warten und Hoffen sei kein Weg, damit Wünsche sich erfüllten. Aber jetzt, in diesem Augenblick, als sie so allein dort stand, den Stamm in ihrem Rücken, und hinüber zum Haus blickte, fühlte sie sich versucht, die Augen zu schließen und einen Wunsch zu tun: Lass es nicht geschehen, lass mich in diesem Haus bleiben! – Aber dann sah sie die Kutsche des Barbiers wegfahren, und ihre Gedanken nahmen eine andere Richtung: Ich muss den Vater fragen, ob er die Überschreibung des Hauses auf mich schon in die Wege geleitet hat. So überrumpelt sie auch von dem Heiratsprojekt des Vaters gewesen war, am Schluss hatte sie ihren kühlen Kopf wiedergefunden und dieses Versprechen mit ihm ausgehandelt.
Das Pferd vor dem zweirädrigen Gefährt des Barbiers fiel in Trab; von ihm selber waren unter dem schwarzen Dach nur die Hände zu sehen, mit denen er die Zügel hielt; jetzt zog er mit der Rechten den schwarzen Hut und grüßte eine große schlanke Frau in einem bis zu den Knöcheln reichenden Pelzmantel. Tante Lenka, die von der Frühmesse zurückkehrte. Als habe sie nur darauf gewartet, trat Camilla schnell aus dem Schutz des Baumes und lief quer über die Lichtung zum Haus zurück.
3
Offiziell titulierte man Tante Lenka im Haus als die Majorin Hofmann, oder kurz: die Majorin. Camillas Mutter, für die Name und Rang eines Menschen von größter Wichtigkeit waren, hatte das eingeführt; sie fand, Majorin Hofmann, das hatte Klang und machte aus ihrer verwitweten Schwägerin fast eine Person von Stand. Das Schicksal der jungen Frau – Lenka war neunzehn und erst knapp ein Jahr verheiratet, als ihr Mann 1870 gleich in den ersten Tagen des Kriegs bei Metz fiel – hatte Emmi Hofmann keine Ruhe gelassen. Sie sah darüber hinweg, dass sie selbst eine geborene von Weskow war und Lenka nur die Tochter eines Petersburger Kaviarhändlers, und fasste den Entschluss, sie wieder vorteilhaft zu verheiraten. Sie ließ ihre Beziehungen zum Hofe spielen, aber leider zeigte Lenka keinerlei Neigung, sich wieder zu verehelichen. Emmi Hofmann musste erleben, wie die junge Witwe das Glück mit Füßen trat; sie schlug die besten Partien aus, einen Offizier, einen geadelten Bankier, Männer, die auf der Hofliste standen, und sicher wäre es zwischen den beiden Frauen zum Bruch gekommen, wenn Lenka nichts weiter als die arme Verwandte gewesen wäre. Aber Lenka hatte Vermögen, und für die Aussicht auf eine Erbschaft – sei es nun für sich oder Camilla, deren Patentante Lenka war – hätte Emmi Hofmann noch ganz andere Charakterfehler in Kauf genommen. Geld, viel Geld, war das Einzige, das dem Adel die Waage halten konnte. So gehörte die Majorin zur Familie, gehörte zum Jahresablauf wie Sommer und Winter, war selbst so etwas wie eine Jahreszeit: Ohne Ankündigung fuhr sie jedes Jahr am 10. November vor, einen Tag vor Camillas Geburtstag, und Anfang März kehrte sie nach Warnemünde zurück, wo sie ein Haus besaß. Jedes Jahr nahm sie das Versprechen mit, dass die Familie im Sommer zu ihr an die See kommen würde, aber wenn es dann so weit war, fuhr die Mutter mit den drei älteren Schwestern doch wieder nach Bad Ems oder Bad Homburg; von den Ostseebädern wäre allenfalls Heiligendamm in Frage gekommen, allerdings erst, seit es neuerdings vom Kronprinzen frequentiert wurde, nie und nimmer jedoch Warnemünde, das nach Emmi Hofmanns strengen Maßstäben rettungslos kleinbürgerlich war.
So verbrachte nur Camilla mit ihrem Vater die Ferien dort, und bei der Tante hatte sie die Wärme, die Liebe und das Verständnis gefunden, die sie an der Mutter immer vermisst hatte.
Camilla kam gerade noch zurecht, um der Tante in der Halle aus dem Mantel zu helfen. Die Tante nahm den kleinen Handbesen, um ein zweites Mal ihre schwarzen hochgeknüpften Stiefel zu reinigen.
»Nun, was sagst du? Jetzt haben wir doch noch Schnee bekommen!« Camilla sah die Tante an; sie war neunundvierzig, und obwohl ihre dunklen, altmodischen Kleider und ihre Frisur eher dazu angetan waren, sie älter erscheinen zu lassen, strahlte ihre Erscheinung etwas sehr Junges und Frisches aus.
»Schnee, sagst du! Das nennst du Schnee? Aber Kind, fühle meine Hände! Spürst du, dass sie kalt sind? Und ich habe nicht mal Handschuhe getragen. Ein Winter in Petersburg – vorher kannst du nicht mitreden über Schnee. Einmal vor die Haustür, und die Unterröcke waren steif wie Bretter.«
»Aber du hast bezweifelt, dass es überhaupt schneien wird.«
»Ihr Berliner mit eurem Schnee – Puderzucker!« Sie hatte eine dunkle Stimme und ein noch dunkleres Lachen.
Die Flügeltüren zum Speisesaal standen auf. Der Diener und ein Mädchen waren dabei, weißen Damast über die lange Tafel zu breiten. Ein anderes Mädchen kam aus der Küche, ein silbernes Tablett in der Hand, auf dem ein Stapel Karten lag. Tante Lenka winkte das Mädchen heran und nahm eine der gedruckten Menükarten, auf denen die Namen der Gäste handschriftlich eingesetzt waren. »Silvester 1900/1901 Gala-Diner«, las die Tante halblaut, »Kaisersuppe, Lachsforelle, Lammrücken garniert; 1883er Kiedricher Auslese, getrüffelte Gänseleberschnitten, Roederer … Da schon Champagner!«, entfuhr es ihr. »Poularde, Salat, Artischockenböden mit Mark, 1878er Château d’Yquem, Haselnussbombe, Käsestangen, Cliquot, Mokka, Mitternachtsbüfett.« Sie legte die Karte zu den anderen zurück. »Es ist gut«, sagte sie zu dem Mädchen, das mit einem Lächeln knickste. »Gehn Sie nur.« Die Tante wartete, bis das Mädchen im Speisesaal verschwunden war. »Da übertrifft sich jemand!« Sie schüttelte den Kopf. »Ist etwas Besonderes im Gange?«
»Was soll denn Besonderes sein …« Camilla, die zur Garderobe getreten war, um Mantel und Mütze abzulegen, blickte kurz in den Spiegel: Nein, man sah ihr nicht an, dass sie kaum geschlafen hatte. Wie immer, wenn sie von draußen kam, war ihre Gesichtsfarbe frisch und gesund und ohne die geringste Spur jener Blässe, die für ein junges Mädchen ihrer Kreise fast unerlässlich war. Nein, dachte sie, wie jemand, der unglücklich ist, sehe ich nicht gerade aus, und das ist gut so.
»78er Château d’Yquem – den Jahrgang habe ich lange nicht mehr auf dem Tisch gesehen, dein Vater hütet die letzten Flaschen …« Tante Lenka war einem guten Wein nicht abgeneigt.
»Vergiss nicht – Mamas Schwiegersöhne werden da sein.«
Die Tante schien nicht weiter in Camilla dringen zu wollen, jedenfalls wandte sie sich jetzt zur Treppe. »Wie geht es deiner Mutter? Ich habe heute Nacht den Arzt gehört.«
»Das musst du nicht so ernst nehmen. Ich glaube, sie tut es selber auch nicht. Und sie kann wunderbar von ihrem Bett aus regieren.« Die Treppe mit dem roten Läufer in der Mitte war breit genug, dass sie nebeneinander die Stufen hinaufsteigen konnten. Die Zimmer der Tante lagen im zweiten Stock, ein großer Wohnsalon und ein kleineres Schlafzimmer. Lenka hatte die Räume selbst eingerichtet; nach dem Tod ihres Mannes hatte sie die Wohnung in Berlin aufgegeben, einen Teil der Möbel nach Warnemünde geschafft, den Rest aber in Berlin untergestellt, über zwanzig Jahre lang, bis Schwager und Schwägerin ihr hier, in dem neuen Haus in Steglitz, zwei Zimmer für dauernd zur Verfügung stellten. Nicht einmal dann hatte sie es fertiggebracht, sich auch nur von einem einzigen Stück zu trennen, sondern alles in diese beiden Räume gestopft, sodass sie mit zu vielen und zu schweren Möbeln überfüllt waren, mit Schränken und Vitrinen, die ihrerseits fast aus den Nähten platzten, so voll standen sie mit Sammeltassen, kolorierten Miniaturen, Freundschaftsalben, Daguerreotypien, Scherenschnitten, Spieldosen, aber auch seltsameren Dingen, nach deren Herkunft Camilla nie zu fragen wagte, wie ein Paar Abendschuhe mit ganz dünnen Sohlen und einer Schnalle aus unechten Steinen. Allein der alte, bemalte Flügel nahm einen großen Teil des Raumes ein.
Auf diesem Flügel legte die Tante jetzt die schwarze Samttasche ab, nachdem sie das Wohnzimmer betreten hatte, und Camilla musste lächeln bei dem Gedanken, was diese Tasche enthielt: Neben dem Gebetbuch, vielleicht sogar zwischen den Seiten des heutigen Evangeliums, lag bestimmt ein dünnes Papierkärtchen mit dem Tageshoroskop. In Warnemünde war eine Dame die Lieferantin; hier in Steglitz holte die Tante sich die Karten an der Station der Stadtbahn, wo ein automatischer Astrologe stand, ein rot-grünes Ungeheuer, in dem eine mechanische Figur nach Einwurf der Münze die Hand über eine Kristallkugel streichen ließ und dann plötzlich anhielt, wenn der Automat seine grüne Karte ausspuckte.
Wie ernst die Tante das alles nahm, hätte Camilla nicht sagen können, und es schien ihr auch nicht wichtig. Selbst die Behauptung der Mutter, Tante Lenka würde an spiritistischen Sitzungen teilnehmen, hatte bei Camilla keine Neugier wecken können; und sie machte auch jetzt keine Bemerkung, als die Tante an den Tisch trat, auf dem ein Kartenspiel ausgebreitet lag – die meisten der Karten mit dem Rücken nach oben –, und eine davon aufnahm.
»Das Pik-As, ausgerechnet, da kann ich mich ja auf etwas gefasst machen.« Sie blickte Camilla an und lächelte unvermittelt. »Sei froh, dass ich nicht deine Mutter bin, sonst hättest du das bestimmt geerbt. Ich habe es auch von meiner Mutter, und die von ihrer. Das geht durch eine Familie wie rote Haare. Wir möchten zu gerne all das wissen, was dem Menschen verborgen ist, alle Geheimnisse zwischen Himmel und Erde …« Sie legte das Pik-As zurück und wandte sich zu der Anrichte, wo der Samowar stand. »Ich mache uns jetzt erst einmal einen Tee.« Sie zündete die Flamme unter dem Samowar an, holte zwei gehäkelte Deckchen aus einer Schublade, stellte zwei Tassen bereit. Wieder ging ihr Blick zu Camilla, und erst jetzt bemerkte sie, dass Camilla noch nicht gekämmt war. »Setz dich«, sie deutete auf den Hocker, der wie alle Polstermöbel einen gehäkelten Überwurf hatte; die Tante stellte sie selber her, aus feinstem naturfarbenem Seidengarn. Camilla folgte der Tante mit den Augen, als diese jetzt in das Schlafzimmer ging, um Kamm und Bürste zu holen. Das Bett, das dabei sichtbar wurde, war sicher das merkwürdigste Stück unter den Möbeln der Tante: Eine Art gotischer Schrein aus Ebenholz mit roten Damastdraperien und einem spitzen Baldachindach, stand es auf einem zweistufigen Podest, das mit verblichenem Gobelinstoff bezogen war. Seit sie zugesehen hatte, wie es aus dem Möbelwagen gehoben, durch das Haus transportiert und im Schlafzimmer der Tante aufgestellt wurde, beschäftigte dieses Bett Camillas Neugier; sie hätte gerne gewusst, wie es hinter den roten Damastdraperien aussah, im Halbdunkel des Baldachins, aber gleichzeitig vermied sie es, auch nur in die Nähe des Bettes zu kommen. Die Tante hatte das offene Haar über Camillas Schulter ausgebreitet und begann es nun auszukämmen. »Was für schönes Haar!«, sagte sie.
»Ich glaube, ich werde es abschneiden.«
»Abschneiden! Das wäre ein Jammer.«
»Es stört mich.«
»Wobei stört es dich?«
Camilla antwortete nicht darauf, sondern fragte: »Bin ich eigentlich hübsch?«
»Was hast du heute?«
»Bin ich es?«
Tante Lenka legte den Kamm zur Seite und nahm die Bürste. »Hast du dich verliebt?«
»Nur weil ich frage, ob ich hübsch bin?«
»Ist es dieser Amerikaner, Keith?«
»Nein!«
»Wie lange bleibt er noch?«
»Ein paar Tage, soviel ich weiß.«
»Ein wenig unpassend, ihn hier im Haus wohnen zu lassen, auch wenn er der Sohn von guten Freunden ist. Was hat er in Berlin überhaupt getan?«
»Ich weiß nicht genau. Brauereien besichtigt …«
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dabei viel lernen kann. In Amerika ist doch alles anders als bei uns.«
»Er hat noch nie im Leben Schnee gesehen.«
»Dann hätte er noch etwas weiter fahren müssen als nur bis Berlin. Aber liegt dieses Kalifornien denn so weit im Süden? Das muss ich mir einmal auf dem Globus deines Vaters anschauen.« Tante Lenka umfasste Camillas Kopf mit beiden Händen. »Ein bisschen mehr nach vorne. Und halt still … Sag mal, du machst doch keine Dummheiten?«
»Was meinst du mit Dummheiten?«
»Sich in jemanden zu verlieben, der nichts davon weiß und den du nie mehr im Leben wiedersehen wirst; stillhalten, sag’ ich.« Sie steckte die letzten Nadeln in den Knoten, den sie aus fünf Haarsträngen geschlungen hatte. »Ein Meisterwerk ist es nicht geworden, du warst zu unruhig. Heute Abend machen wir es dafür umso schöner.« Tante Lenka ging zu der Anrichte, wo der Samowar summte. Sie füllte die Tassen auf, und dabei fiel Camillas Blick auf die beiden miteinander verbundenen Eheringe an der rechten Hand der Tante; vom langen Tragen waren sie ganz dünn geworden, sahen fast wie ein Ring aus.
»Hat Mutter meinen Vater aus Liebe geheiratet?«, fragte Camilla.
Die Tante sah kurz auf, dann nahm sie ihre Tasse und setzte sich damit an ihren Platz am Fenster.
»Ich habe dich etwas gefragt«, beharrte Camilla.
»Schau, deine Mutter …«
»Warum behandelt mich jeder wie ein Kind. Hat sie ihn geliebt? Und wenn ja, was ist daraus geworden? Mit wem soll ich sonst darüber reden?«
»Natürlich können wir darüber reden, obwohl … meine eigenen Erfahrungen auf dem Gebiet sind nicht groß. Du würdest die Frage besser deiner Mutter stellen.«
»Ihr Fragen stellen! Wo denkst du hin? Und noch dazu solche.« Camillas Blick ging durch die halb offene Tür ins Schlafzimmer der Tante zu dem Bett; sie musste sich überwinden, die nächsten Worte auszusprechen: »Seit wir in diesem Haus wohnen, haben Vater und Mutter ihre eigenen Schlafzimmer …« Sie fühlte, wie sie rot wurde. »… ist man mit vierzig eine alte Frau? Ich habe einmal gehört, als Mutter sagte, sie sei froh, damit nicht mehr behelligt zu werden … Sie hat sich deutlicher ausgedrückt, verstehst du …«
»Seit wann lauschst du an Türen?«
»Ich habe nicht gelauscht! Es wäre mir lieber, ich hätte das nicht mit anhören müssen, aber sie macht gar kein Geheimnis daraus. Sie redet mit Lou darüber und mit der Schröter, richtig gehässig, als sei Vater … Ich kann nicht wiederholen, was sie wirklich gesagt hat. Und dabei konnte es ihr all die Jahre nicht schnell genug gehen, Männer für ihre Töchter zu finden; wie sie uns beobachtet hat, wie sie mit dem Arzt getuschelt hat, der uns untersuchen musste … und sie selber lebt mit ihrem Mann wie eine Fremde. Warum hasst sie ihn?«
»Tut sie das?«
»Warum hasst sie dieses Haus?«
»Das kann ich schon eher beantworten, wenigstens zum Teil. Sie hatte sich etwas anderes vorgestellt, weißt du, sie hatte sogar schon ihre Wahl getroffen, ein Haus in der Behrenstraße bei der Hedwigskirche, also unmittelbar beim Kaiserlichen Palais. Seit Jahren ging sie dort ein und aus, weil eine ihrer Freundinnen dort wohnte, du kennst sie auch, diese Vorleserin bei Hof, den Namen kann ich mir nie merken. Also, endlich stand dieses Haus zum Verkauf, und deine Mutter wollte es unbedingt haben. Du kennst ihre Vorliebe für den Hof. Von diesem Haus aus hätte sie das ganze Auf und Ab verfolgen können: jeden Hofwagen, die Schildwachen, und mit einem Feldstecher hätte sie auch sehen können, wer alles zu den Hoffesten erschien und zu den beiden großen Couren. Aber sie dachte noch weiter, beim Krönungs- und Ordensfest hätte sie die Fensterplätze zu horrenden Preisen vermieten können. Einmal hat sie mich mitgenommen und mir alles gezeigt und erklärt … Und dann geht dein Vater her und gibt hunderttausend gute Goldmark für ein Haus auf dem Land aus.«
»Hunderttausend?«, fragte Camilla überrascht. »Bist du sicher?«
Aber die Tante nickte nur, ohne weiter auf diesen Punkt einzugehen, und nahm das Häkelzeug aus dem Korb. »Deine Mutter hat ihm das nie verziehen. Du weißt, dass sie bei jeder Gelegenheit ihre adlige Herkunft betont und ihre Beziehungen bei Hof. Einen Jour fixe mit einem erlesenen Kreis von Leuten, das war immer ihr Traum, und dazu wäre das Haus in der Behrenstraße ideal gewesen. Im Grunde hat sie sich nie damit abgefunden, dass sie unter ihrem Stand geheiratet hat. Dein Vater ist nur ein Bürgerlicher, kein Militär, kein hoher Beamter, nicht einmal ein Gelehrter, den man, mit den richtigen Titeln und Orden ausgestattet, notfalls zur Berliner Gesellschaft zählen könnte.«
»Warum hat sie ihn dann genommen?«
»Wie soll ich das wissen? Vielleicht glaubte sie, ihr Ehrgeiz und ihre Beziehungen würden genügen, um ihm das alles mit der Zeit zu verschaffen. Nur, dein Vater zog nicht mit. Den Kommerzienrats-Titel hat er zwar, aber er benützt ihn nicht; den Kammerorden vierter Klasse besitzt er, aber er legt ihn nicht an. Er hat keinen Sinn für diese Dinge. ›Knopflochtag‹, sagt er zum Ordensfest, und das zu deiner Mutter! Und schließlich das Geld, das hat sie vollends auseinandergebracht.«
»Ich dachte immer, wir sind reich; das heißt, ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht.«
»Nicht reich genug. Dein Vater ist nur ein Apotheker, mein Kind. Kein Apotheker ist arm; aber reich, wie deine Mutter sich das vorstellt? Er ist ein guter Apotheker, ein guter Chemiker, fast genial. Aber er ist kein Fabrikant. Die Seifen, die Parfümerie-Artikel – das war die Idee deiner Mutter. Wahrscheinlich sah sie ihn schon als frisch geadelten Hoflieferanten, auf jeden Fall sah sie viel Geld darin. Sie hat ihn angestachelt, sie hat ihm keine Ruhe gelassen. Tatsache ist, dass sie beide immer mehr Geld brauchten, immer mehr und mehr. So viel er auch verdiente, es reichte nie.«
Camilla starrte auf die Garnrolle in dem Handarbeitskorb der Tante. Es ist also wahr, dachte sie, und plötzlich kam ihr eine Idee. »Du meinst, Vater ist in Schwierigkeiten?«
»Ich würde sagen, er war immer in Schwierigkeiten. Er kann mit Geld einfach nicht umgehen. So viel er auch hat, und so geschickt er es einteilen will, sobald es in seinen Händen ist, wird es zu Wasser und fließt ihm durch die Finger.«
»Wenn er ernsthaft in Schwierigkeiten wäre, würdest du ihm helfen?«
Die Tante ließ ihre Handarbeit sinken und sah Camilla prüfend an. »Was ist los, Kind? Verheimlichst du etwas vor mir?«
»Ich meinte nur, würdest du ihm helfen … es könnte ja einmal notwendig sein …«
»Nein, Kind, ich würde deinem Vater nicht helfen. Erstens, weil ich ihn kenne, und zweitens, ihr glaubt alle, ich sei reich, aber das war einmal. Dein Vater weiß Bescheid, denn er war es, der mich um mein Geld gebracht hat; nichts für ungut, du siehst, ich rege mich heute nicht mehr darüber auf. Aber du solltest deinen Vater so sehen, wie er ist.«
»Er hat dich um dein Geld gebracht?«
»Nicht um das ganze. Das Haus in Warnemünde gehört mir, und ich kann leben; aber der Reichtum ist dahin. Natürlich fing alles mit einer großartigen Idee an, so wie alles bei ihm. Er wollte mein Glück, und dumm wie ich war, damals mit neunzehn, bin ich prompt auf ihn hereingefallen. Es schadet nichts, einmal darüber zu reden, jetzt wo wir schon angefangen haben. Ich hatte ein ansehnliches Vermögen von zu Hause, aber ich verstand nichts vom Geld. Dein Vater erbot sich, es für mich anzulegen, als Schwager fühlte er sich wohl verpflichtet, sich meiner anzunehmen, und ich war ihm auch dankbar dafür. Unglücklicherweise kaufte er Eisenbahnaktien, in Russland, im Balkan, im Orient, was weiß ich, wo sonst noch; dein Vater rechnete mir vor, dass ich in wenigen Jahren Millionen besitzen würde. Kurz, drei Jahre später, 1873, war der Traum vom Reichtum ausgeträumt. Dieser Mann, der die Bahnen finanzierte und projektierte, entpuppte sich als gerissener Betrüger – und alle meine schönen Aktien und Obligationen waren nicht mehr das Papier wert. Vielleicht verstehst du jetzt, dass ich deinem Vater kein Geld mehr anvertrauen würde. Er hat sich seit damals nicht geändert, er hat nichts dazugelernt. Er ist unverbesserlich. Verzeih mir den Ausdruck, aber er ist ein Spieler. Er hat ununterbrochen großartige Ideen, einige Eisen im Feuer, wie er es nennt. Er ist ein hoffnungsloser Optimist. Er sieht immer nur, was er zu sehen wünscht, und das wird sich nie ändern. Es ist schon so. Wenn man es weiß, ist es gut. Aber man muss es wissen, dann kann man ihn mögen, so, wie er ist.«
Camilla wünschte, sie hätte ihre Frage nie gestellt, denn nun erhob sich die Tante, fasste sie beim Kinn und hob ihren Kopf, sodass Camilla ihr in die Augen blicken musste: »Was ist? Es ist doch etwas! Warum alle diese Fragen auf einmal? Was geht vor? Will man dich verheiraten?«
»Nein, nein!« Camilla hielt dem Blick der Tante stand, aber sie war nicht sicher, ob die Tante sich davon täuschen ließ.
»Camilla, so weltfremd bin nicht einmal ich! Kaisersuppe, Lachsforelle, getrüffelte Gänseleberschnitten, Poularde – so war es doch! Ich habe auch die Sitzordnung für das Silvesteressen studiert; ein Herr Rothe neben deiner Mutter, die Frau neben deinem Vater, und ein Alexander Rothe neben dir!«
Was konnte Camilla erwidern, wenn sie den Vater nicht verraten wollte? Sie konnte nicht lügen, aber sie konnte auch nicht die Wahrheit sagen und damit den Vater preisgeben; dabei hatte die Tante es ihr so leicht gemacht, und dabei war ihr selber so danach zu Mute, ihr Herz auszuschütten. Alles, was sie an Schönem erlebt hatte, hing mit dem Vater zusammen: die Besuche der Sternwarte, die vielen Zirkusvorstellungen, die Reisen, zuletzt die herrlichen Wochen in Paris während der Weltausstellung – und natürlich das Haus, das er nach Camillas Empfinden eigentlich nur für sie gebaut hatte.
»Sollst du jetzt das Geld ins Haus bringen? Ist das die Idee deiner Mutter?«
»Nein, sie hat nichts damit zu tun.« Dass der Verdacht der Tante in die falsche Richtung zielte, erleichterte Camilla einen Moment. Aber dann dachte sie: Dieses verhasste Geld! Seit wir in diesem Haus wohnen, dreht sich alles nur noch darum, im Guten wie im Bösen. Kein Gespräch, das nicht unvermeidlich dabei endet; kein Streit, der nicht darüber entbrennt; manchmal ist das Haus auf Tage in zwei feindliche Lager gespalten, auf der einen Seite der Vater, auf der anderen die Mutter, die dann unsichtbar bleibt, bis sie ihren Willen durchgesetzt hat und der Vater mit dem Geld herausrückt.
Von früh an daran gewöhnt, hatte Camilla sich verhalten wie bei schlechtem Wetter; man weicht aus, so gut man kann, aber man nimmt es nicht weiter tragisch. Die letzte Frage der Tante ließ sie plötzlich alles mit anderen Augen sehen. Liebe, Ehe, das waren Geldgeschäfte, sonst nichts. Mädchen wurden nur geheiratet, wenn sie eine nennenswerte Mitgift hatten. Ehemänner wurden nur geliebt, wenn sie viel verdienten. Eine Familie war nur angesehen, wenn sie reich war. Geld – Geld – Geld – nur das zählte!
Immer nur Geld …
Camilla richtete den Blick auf die Tante. Sie vergaß, dass auch Lenka einmal verheiratet gewesen war; man konnte es leicht vergessen, sie besaß mehr Jugend als die Mutter, ja sogar als die Schwestern; so, als wäre die neunundvierzigjährige Frau nur die Hülle, in der sich ein sehr junges, unberührtes Mädchen verbarg.
»Ich werde nie heiraten! Niemals, nein nein, ich will nicht heiraten!«
»Aber Kind! Was ist nun wieder?«
»Ich werde so leben wie du.«
»Oh, sag so etwas nicht.«
Das Gesicht der Tante bekam jenen abwesenden Ausdruck, mit dem sie manchmal an ihrem Nähtisch saß, wenn Camilla unverhofft bei ihr eintrat.
»Aber du bist glücklicher als alle anderen.«
»Glücklicher?«
»Bist du es nicht?«
»Sagen wir lieber, ich bin nicht unglücklich, jetzt nicht mehr. Aber ich habe lange gebraucht, um dahin zu kommen. Und wenn man nicht unglücklich ist, heißt das noch nicht, dass man glücklich ist.« Sie hatte sich erhoben und füllte Tee in ihre Tasse nach. »Für dich auch noch?« Sie kehrte zu ihrem Platz am Fenster zurück. »Zwischen siebzehn und neunzehn, das waren die zwei Jahre in meinem Leben, in denen ich glücklich war. Das ist sehr viel, weißt du, zwei Jahre Glück.«
Ihre Stimme wurde immer leiser, die Worte waren kaum noch zu verstehen. Es war, als spräche sie mit sich selbst und hätte vergessen, dass jemand bei ihr war, sodass Camilla das Gefühl hatte, sich leise entfernen zu müssen. Aber ein kurzer Blick der Tante über die Schulter und eine kleine Geste, näher zu treten, sagten ihr, dass die Tante sehr wohl wusste, an wen sie ihre Worte richtete.
»Ich habe gelebt und doch nicht gelebt – soll ich dir das wünschen? Ich wünsche, dass du wirklich lebst, nicht mit Träumen, die sich nicht erfüllen, nicht mit Gedanken an etwas, das hätte sein können. Man muss vergessen können, um wirklich zu leben; man muss neugierig bleiben, und man darf nicht zu ängstlich sein. Mir fehlte es an allem.« Sie schüttelte energisch den Kopf. »Nein, mich darfst du nicht als Vorbild nehmen. Ich kann dir nicht einmal gute Ratschläge geben, wie du dir dein Leben einrichten sollst, so gerne ich es täte. Ich kann nur wünschen, dass du glücklich wirst und dass du dein Glück dann mit beiden Händen festhältst. Komm her.« Sie erhob sich und öffnete das Fenster. Es hatte wieder zu schneien begonnen.
Die Tante deutete hinaus ins Freie, mit der rechten Hand, an der die beiden miteinander verbundenen goldenen Ringe steckten.
»In Petersburg …«, begann sie und lachte dann mit ihrer warmen dunklen Stimme und sagte: »Erinnerungen … aber das ist nicht Glück. Glück ist Gegenwart.«
4
Sie saß in dem rosaroten Doppelbett, viele Kissen in den Rücken gestopft, und kaute, wobei sie eine Serviette vor den Mund hielt, gerade so, als zählte alles das nicht, was sie unter der Serviette in den Mund schob. Ihr rosarotes Gesicht glänzte noch von der Nachtcreme, und das blonde Haar war noch ungekämmt und nur mit ein paar Kämmen festgesteckt. Sie lehnte dort in den rosaroten Kissen, ein rosaroter weiblicher Buddha – wenn nicht die Augen gewesen wären, hellblaue, alles beobachtende Augen, und so sagte sie sofort, als die Schröter sich den Vorhängen näherte: »Nicht doch! Es ist mir hell genug hier. Willst du, dass ich wieder meine Kopfschmerzen bekomme?«
Links und rechts des breiten Betts brannten zwei Lampen mit weißen Porzellanfüßen und rosaroten Schirmen und sorgten dafür, dass Rosarot der beherrschende Farbton des ganzen Raumes war; die golddurchwirkte Seidenbespannung der Wände war davon überhaucht, die Spiegeltüren des Schranks, der die Längsseite des Raums einnahm, schienen aus Rosenquarz gefertigt, nur der Chinateppich konnte in dieser Beleuchtung seinen tiefen Bernsteinton behaupten.
Ohne sich um den Protest ihrer Herrin zu kümmern, zog die Schröter die Vorhänge etwas auf. »Wie soll ich hier aufräumen, wenn ich kein Licht habe?«
Sie war eine kleine, etwas verwachsene Person, die auch die hohen Absätze ihrer Stiefeletten und das weiße Häubchen auf dem Haar nicht größer erscheinen ließen. Sie rückte den wuchtigen Sessel zurecht, bückte sich, um vom Teppich etwas aufzuheben, und betrachtete dann voller Missbilligung die zwei leeren Pralinenschachteln, die in dem wilden Durcheinander auf dem Tisch neben dem Sessel lagen. »Eines Tages werden Sie zwei Sessel brauchen, um sich hinzusetzen.«
Emmi Hofmann lachte. Die Schröter war die Einzige, die sich solche Bemerkungen erlauben durfte. Ja, Emmi Hofmann hätte wahrscheinlich nur halb so viel Befriedigung aus ihrer Esslust gezogen ohne diese beständigen Ermahnungen – sie reichten bis in ihre Mädchenzeit zurück –, die ihr das Gefühl gaben, etwas Verbotenes zu tun. Sie wischte sich den Mund ab und ließ die Serviette aus der Hand gleiten, zu den anderen Sachen, die auf und neben ihrem Bett herumlagen: Bücher, Zeitschriften, Modehefte und natürlich der unvermeidliche adlige Taschenkalender, der griffbereit unter dem Kopfkissen steckte. Die Schröter war an das Bett getreten. »Was ist? Wenn ich das Bett machen soll, müssen Sie schon aufstehen.« Sie sprach Hochdeutsch, nur hin und wieder, und nur bei ihrer Herrin, kam ihr ursprünglicher Posener Tonfall etwas durch. Sie hatte schon dem Vater gedient, einem adligen Agrarier, wie sie ihn zu bezeichnen pflegte, der große Ländereien bei Posen besaß, und Emmi hatte sie mit in die Ehe eingebracht. »Lassen Sie mich wenigstens die Kissen aufschütteln.«
»Das hat Zeit. Ich habe einiges mit dir zu besprechen.«
»Wie Sie meinen.« Den täglichen Kleinkrieg mit ihrer Herrin nahm die Schröter gerne in Kauf, denn sie sah darin nur eine Bestätigung ihrer Vorrangstellung im Haus. Auch unter normalen Umständen verließ Emmi Hofmann ihr Schlafzimmer nicht vor elf Uhr; manchmal den ganzen Tag nicht; und dann gab es Zeiten, da wurden aus Tagen Wochen. So war es jetzt wieder einmal: Niemand im Haus hatte Emmi Hofmann seit dem zweiten Weihnachtstag mehr zu Gesicht bekommen, nur der Arzt und natürlich die Schröter. Alle waren daran gewöhnt, niemand machte sich Sorgen, denn alle wussten, eines Tages würde die Patientin wieder aus ihrem Zimmer auftauchen, blühend, aufreizend gesund geradezu.
Dass Emmi Hofmann auch während ihrer Klausuren allgegenwärtig blieb und das häusliche Regiment keineswegs laxer wurde, dafür sorgte die Schröter. Mochten Herrin und Dienerin hier im Schlafzimmer auch wie Hund und Katze sein, sobald die Schröter den Raum verließ, kam kein Wort gegen ihre Herrin mehr über ihre Lippen. Kein Klatsch, keine Bemerkung über den Gesundheitszustand; die private Sphäre der Hausherrin war sakrosankt. Nur ihre Befehle drangen nach draußen, die Anweisungen für die Küche, die Bediensteten, den Gärtner, die Lieferanten und Handwerker. Und so waren auch die Vorbereitungen für die große Silvestereinladung getroffen worden.
»Es läuft alles wie am Schnürchen für heute Abend«, sagte die Schröter. »Die Zimmer sind hergerichtet; und mit dem Dekorieren der Tafel haben sie schon begonnen.«
»Gut, dass du mich an die Dekoration erinnerst. Ich will diesmal am Tisch keine Jardinieren mit Blumen und Grün! Und keine Girlanden an den Fenstern und Kronleuchtern! Das ist ja ein wahrer Fimmel. Je höher die Temperatur steigt, umso stärker duftet das Grün. Das will ich nicht haben. Und was ist mit den Gläsern? Ein Schliff! Weihnachten sah der Tisch aus wie die Ausstellung eines Glaswarenladens.«
»Dann müssten wir nachkaufen.«
Emmi Hofmann machte eine Handbewegung, die besagte, sie doch damit nicht zu behelligen. »Und nun der Champagner.« Auf dem Tisch neben ihrem Bett stand ein Glas bereit; danach streckte sie jetzt ihren rosaroten Arm aus, nahm es und führte es zum Mund. Im Gegensatz zu ihrem glatten Gesicht und ihren glatten Armen wies ihr Hals tiefe Falten auf, die sich wie Ringe in das Fleisch gegraben hatten, und diese bewegten sich jetzt mit, während sie in kleinen Schlucken trank. Erst als das Glas ganz leer war, stellte sie es zurück. »Zu süß!«
»Zu warm vielleicht. Es ist Roederer.«
»Ich sage dir, er ist zu süß!«
»Die meisten mögen ihn süß.«
»Was ich mag, darauf kommt es wohl nicht an! Ich sage dir, Roederer, Cliquot, Crémant und Rosé sind in Acht und Bann; reine Damenweine, aber nichts zum Essen. Hier …« Sie suchte unter dem Wust von Zeitschriften, gab es aber dann auf. »Süße Schaumweine sind passé! Verlass dich auf mich. Ein guter Sekt muss herb sein, trocken. Also, wir nehmen Pommery brut. Warte …« Wieder begann sie zu suchen, und diesmal hatte sie mehr Glück. Sie zog ein herausgerissenes Blatt zwischen zwei Zeitschriften hervor und deutete auf eine unterstrichene Stelle. »84-er Pommery brut, das ist ein berühmter Jahrgang.«
»Wir werden ihn nicht im Haus haben.«
»Dann werden wir bestellen.«
»In den Menükarten steht aber schon der Roederer und der Cliquot.«
»Das muss dann eben geändert werden.«
»Sie meinen, die ganzen Karten neu drucken? Heute noch?«
Die auffallend kleinen Hände Emmi Hofmanns, die rosarot und friedlich auf dem durchbrochenen Bezug der Daunendecke lagen, begannen plötzlich, unhörbar zu trommeln, ein Zeichen, auf das die Schröter sofort reagierte, indem sie ein anderes Thema anschnitt.
»Wir wollten die Kleider aussortieren.« Sie holte die Körbe, die sie an der Tür abgestellt hatte. »Womit fangen wir an?«
»Mit den Abendkleidern, die nehmen den meisten Platz weg. Die im linken Schrank, die gesondert hängen, brauchst du mir gar nicht zu zeigen.« Sie setzte sich etwas mehr auf, um die Schröter besser beobachten zu können.
Die Schröter rückte einen Schemel vor den Schrank und stieg darauf. Sie nahm vier lange Roben von den Bügeln, schlug sie zusammen und warf sie in den Korb.
»Wenn Sachen dabei sind, die du für deine Verwandten brauchen kannst, bitte …«