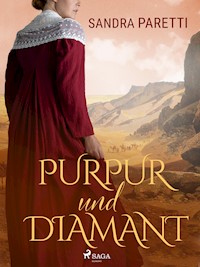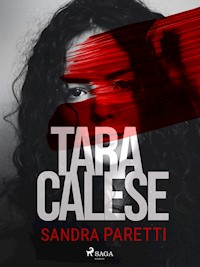3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Italien, 1943. Das Leben der jungen Römerin Maria Canossa ist im Umbruch. Nach einer gescheiterten Ehe will sie nichts anderes, als in ihre Heimat zurückzukehren, doch die Hauptstadt ist ebenso zerrissen wie Marias Inneres. Widerstandsgruppen und alliierte Gegner kämpfen gegen das faschistische Regime in Italien. Wird Maria in diesen Trümmern glücklich werden können? Wird sie jemals mit ihrer Vergangenheit abschließen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Sandra Paretti
Maria Canossa
Roman
Saga
Maria Canossa
Copyright © 2022 by Helmut and Anka Schneeberger, represented bei AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de)
Originally published 1979 by Droemer Knaur Verlag, München
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1979, 2022 Sandra Paretti und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788728469392
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
Wo bist du, geliebtes Morgen?
Wir alle, jung und alt, stark und schwach,
Reich und arm,
Wir alle, in Freud und Leid,
Suchen dein süßes Lächeln.
Bis wir an deinem Platz das finden,
Vor dem wir geflohen sind – das Heute.
Shelley
Dieser Roman schildert Ereignisse, die sich im Sommer des Jahres 1943 in Rom zugetragen haben.
Die Namen wurden aus Rücksicht auf noch lebende Personen geändert.
Fünfzig Kilometer nordöstlich von Rom, in den Tiburtiner Bergen, liegt der Ort Saracinesco. Die wenigen Häuser und die Kirche wachsen unmittelbar aus dem hellen Lavagestein. Unten, in der Ebene, fließen der Aniene und der Fiumicino und machen die Erde fruchtbar. In Saracinesco gibt es nur den Stein, die weite Sicht ins Land, den Wind, der selten schläft und den Himmel, der sehr nahe ist. Um ihre Toten zu begraben, haben die Bewohner weder den Platz noch die Erde. Der Friedhof befindet sich unterhalb des Ortes, an der Straße, die sich den Berg hinaufwindet und eigentlich nur ein Saumpfad ist. Ein paar verkrüppelte Olivenbäume und ausgewachsene Weinstökke geben Schatten. In der obersten Reihe steht ein Tuffstein. Er trägt, schon verwittert, die Inschrift MARCO VARELLI, NATUS 1900 – OBIIT 1943.
Fast immer liegen frische Blumen dort. Nur wenige wissen, daß das Grab in der weißen Erde leer ist.
Erster Teil
1
Aufzeichnungen des Dott. Lennart Larsson
Rom, Villa Kristina, 22. April 1943
Der Tag geht zu Ende. Noch ist es hell genug, um ohne Licht zu schreiben. Nur die Luft färbt sich allmählich blau. Ich sitze in meinem Sprechzimmer am Schreibtisch. Die Tür zur Terrasse ist offen, und ich warte auf den Abend. Ein leichter Wind geht; bei Sonnenuntergang wird er sich legen. Hin und wieder wehen die Verdunklungsvorhänge auf, ein warmer Duft dringt ins Zimmer und verdrängt den Geruch von Anästhetika; Mimosen und Oleander blühen auf der Terrasse.
Einen Frühling wie diesen habe ich in den vierzig Jahren, die ich in Rom bin, nicht erlebt. Es ist, als wolle die Natur die Römer für ihre Leiden entschädigen. Ich brauche mich nicht zu erheben, um alles zu sehen; die Stadt liegt zu meinen Füßen: im Osten San Carlo al Corso, im Süden das Denkmal Vittorio Emanuele II und dazwischen das Pantheon und San Andrea della Valle mit ihren Kuppeln.
Roma eterna, voller Sonne, es hat doch wieder triumphiert, geübt in Untergang und Auferstehung – das gehört zu dieser Stadt.
Dennoch warnen mich die Freunde. Siege machen die Sieger milde. Aber wie werden sie reagieren, wenn die Niederlagen kommen? Der schwedische Chargé d’affaires hat mich heute aufgesucht – Teresa, die nie genug Lebensmittelvorräte anhäufen kann, schätzt seine Besuche wegen des Kaffees, den er regelmäßig mitbringt – und mich erneut bedrängt, das Land zu verlassen. Die Kapitulation in Nordafrika ist für ihn eine feststehende Tatsache, nur eine Frage von Tagen. Dann ist der Weg nach Italien für die Alliierten frei. Ob Rom verschont bleibt? Die Römer sind davon überzeugt, daß die Gegenwart des Papstes sie schützen wird ...
Ich habe mir geduldig angehört, was er zu sagen hatte, aber ich weiß, ich bin zu alt, um hier wegzugehen. Meine Bibliothek hier, meine Ausgrabungen; ohne meine Patienten könnte ich leben, aber nicht ohne Italien. Hier ist meine Heimat. Ich werde bleiben und hinnehmen, was kommt. Und dann ist da noch etwas; ich halte es geheim, sogar vor mir selber – Maria. Ein Frühling für einen alten Mann? Eine Illusion? Was immer es ist, es gibt mir das Gefühl, jung zu sein, ein letztes Mal jung und ein letztes Mal glücklich ... Es war immer meine Theorie: Illusionen sind Anodyna, schmerzlindernde Mittel.
Später
Vor drei Wochen war ich bei Dr. Hartmann, wegen meiner Augen. Er ist das, was ich einmal war und wohl auch noch bin, ein Modearzt. Sein Wartezimmer in der Via Po war überfüllt, die gleichen Damen der römischen Gesellschaft, die früher zu mir kamen und die ich nach und nach abgeschüttelt habe. Hartmann empfing mich sofort. Sein Anzug aus naturfarbener Seide erinnerte mich daran, daß ich früher zum Hausbesuch bei gewissen Patienten eine weiße Nelke ins Knopfloch steckte ...
Hartmann nahm sich viel Zeit. Die Verschlechterung auf beiden Augen ist eindeutig, vor allem auf dem rechten. Dennoch: Augendruck normal, keine Anzeichen für grünen Star, nichts, was zu operieren wäre. Der Defekt liegt nicht am Auge, sondern irgendwo im Nervensystem. »Ein Fall für einen Wunderheiler, Herr Kollege, nicht für mich!«
Sein Rat: Schonung. Möglichst wenig lesen, und das nur bei Tageslicht; noch besser, jemanden finden, der mir vorliest. Zum Schreiben eine Maschine benützen. Im übrigen fand er meine körperliche Verfassung für einen Mann von vierundsechzig Jahren »beneidenswert«. Ich glaubte, mich selber zu hören!
Noch am selben Tag holte ich meine alte schwedische Schreibmaschine hervor. Am Anfang mußte ich jeden Buchstaben suchen; inzwischen geht es etwas flüssiger. Und dann – ich habe Maria zum Vorlesen; jeden Abend, mit Ausnahme der Wochenenden, kommt sie zu mir, zwei, drei Stunden. Ich warte jetzt auf sie.
Noch später
Warum kommt sie nicht? Es ist ihre Stunde.
Ich schreibe nieder, was mir durch den Sinn geht. Ich mache lange Pausen, lasse den Blick über die Dinge gehen, die auf dem Schreibtisch liegen: den Totenkopf, das Stethoskop, den Rezeptblock. Ich weiß nicht, warum ich diese Dinge aufschreibe. Mein ganzes Leben habe ich nicht viel geschrieben. Die Zettel zum Bezeichnen meiner archäologischen Sammlung, die Notizen für die Shelley-Ausgabe – und Rezepte natürlich. Und jetzt sitze ich hier und versuche Ordnung in meine Gedanken zu bringen, Worte zu finden. Was soll daraus werden? Meine Geschichte? Die Geschichte von Maria Canossa?
Illusion ist ein Anodynum. Darum? Schreibe ich nach Tausenden und aber Tausenden von Rezepten für andere nun eines für mich? Ein Rezept gegen Einsamkeit, gegen Erinnerungen, die weit zurückliegen und trotzdem immer noch weh tun? Also eine Therapie. Zeitvertreib und Therapie für einen Mann, der zu alt ist für ... Warum muß ich mich zwingen, es hinzuschreiben: zu alt für die Liebe.
Gift und Gegengift. Absurd, daß Ärzte sich selber nie helfen können!
Wie auch immer, ich werde weiterschreiben. Fingerübungen eines alten Mannes, der nichts zu tun hat und der nachts nicht schlafen kann.
Insomnia. Davon haben Dr. Hartmann und ich nicht gesprochen. Nicht, daß ich mir einbilde, er wüßte nicht Bescheid. Ein guter Arzt sieht das einfach. Schlaflosigkeit. Ich hatte viele Patienten, die daran litten, und ich habe sie noch. Insomnia ist sehr verbreitet unter meinen deutschen Patienten. Sie ist kein Leiden, an dem man stirbt. Aber sie kann einen Menschen aushöhlen, bis zum Selbstmord. Am Tag ist der Kopf leer, unfähig zur Konzentration. Nachts beginnt er zu arbeiten, rastlos, türmt Gebirge von Gedanken auf. Die Diagnose ist klar. Aber die Therapie?
Maria. Sie wird bald kommen. Ich werde ihre Schritte schon von draußen hören, wenn sie die Steinstufen der Rampa Mignanelli heraufsteigt. Die Glocke wird anschlagen, Teresa wird die Haustür öffnen. Dann wird Maria in die Bibliothek gehen, die unter meinem Sprechzimmer liegt. Für Augenblicke wird es still werden, wenn sie überlegt, welches der Bücher, die ich bereitgelegt habe, sie zum Vorlesen wählen soll.
Ich werde ihre Stimme hören. Ich werde die Augen schließen und ihr zuhören, ohne auf die Worte zu achten ...
Der Wind hat sich gelegt. Die Vorhänge bewegen sich nicht mehr. Bald wird die Sonne in der Stadt versinken.
Teresa geht durchs Haus. Sie zieht die Verdunklungsrollos herunter. Die Geräusche verraten, daß sie es mit Widerwillen tut: oft vergißt sie auch ein Fenster, und irgendwann kommt von außen der Schrei: »Licht aus!«
Teresa stammt aus den Abruzzen, wo man von Verdunklung nicht viel hält. Außerdem ist sie eine fromme Seele und glaubt fest, das il papa alles Unheil von Rom fernhalten wird, also auch Flugzeuge und Bomben. Teresa hat für alle Probleme einen himmlischen Helfer. Für meine Augen zum Beispiel ist nach Teresas Ansicht die heilige Lucia zuständig. Seit sie bei mir ist, versucht sie, den ungläubigen Schweden, wie sie mich hinter meinem Rücken nennt, zu bekehren. Vergeblich. So stiftet sie eben jede Woche eine Kerze, damit die heilige Lucia dem svedese, che non crede niente, hilft. Das heißt, sie schickt dem Pfarrer von Santa Lucia degli Abruzzi das Geld für die Kerzen. Man sollte meinen, daß es unter Roms mehr als vierhundert Kirchen eine gibt, wo man der heiligen Lucia ebenso Kerzen stiften kann, aber Teresa wird schon wissen, was man tun muß, wenn man von einem Heiligen ein Wunder will. Als Arzt habe ich mir ein Leben lang verboten, auf Wunder zu hoffen.
Hoffe ich jetzt auf ein Wunder?
Es ist ein so schöner Tag. Ja, mit den Tagen werde ich fertig. Maria.
Laß mich nicht allein im Dunkeln! Laß mich deine Stimme hören! Komm, und bleib noch eine kleine Weile bei mir!
2
Die Junkers-Maschine der Lufthansa hatte nur sieben Passagiere an Bord, sechs Männer und eine Frau. Die Männer saßen vorne, fünf in Uniform, einer in Zivil. Hin und wieder erschien der Copilot und versicherte, daß es mit der Landung in Rom keine Probleme geben würde, was die Passagiere mit skeptischem Schweigen anhörten. Sie hatten weite Umwege gemacht, mehrmals den geplanten Kurs geändert, um feindlichen Jägern auszuweichen.
Im Flugzeug war es dunkel bis auf den schwachen Lichtschein aus der Pilotenkanzel. Es ging auf elf Uhr nachts; der Flug Berlin – Rom dauerte nun schon neun Stunden, wenn man die Zwischenlandung in Venedig mitrechnete. Drei Passagiere hatten dort die Maschine verlassen. Niemand war hinzugekommen.
Die Frau saß ganz hinten im Flugzeug, in der letzten Reihe. Sie hatte in Tempelhof instinktiv diesen Platz gewählt und sich erst später daran erinnert, daß sie damit einen Rat Giannis befolgt hatte: In der großen, schweren Ju 52 überlebte man einen Abschuß am ehesten im Heck.
Es war ein kleines Wunder, daß die Lufthansa jetzt, im April 1943, immer noch regelmäßig Rom anflog. Als sie von der Klinik aus das Lufthansa-Büro angerufen hatte, war das ein blinder Versuch gewesen. Ein Ertrinkender, der die Hand ausstreckt ... Ein Flug nach Rom? Einfach? Für den 15. April? Geht in Ordnung.
Das und Giannis Telegramm waren wie ein Fingerzeig gewesen. Rom. Ein Fluchtpunkt. Ein erster Hoffnungsschimmer. Sie war blond. Bis Venedig hatte sie ein schräg sitzendes Hütchen mit Schleier und Feder getragen. Die Fülle blonden Haars, die darunter zum Vorschein gekommen war, als sie es abnahm, hatte die Männer an Bord überrascht. Blondes Haar mit einem Stich Kupfer – sanguigno hätten die Italiener gesagt. Ihr Teint, obwohl blaß, ja fast kränklich, erweckte unwillkürlich die Vorstellung, daß er in der Sonne schnell einen Goldton annehmen würde. Die Augen unter unrasierten Brauen waren dunkel, auffallend groß, auffallend ernst. Ihr Mund war schön, vielleicht das Schönste an ihr, gemacht zum Sprechen, zum Lächeln, aber jetzt lagen die Lippen fest aufeinander, angespannt.
Das graue, gestreifte Schneiderkostüm und der Silberfuchs, den sie um die Schultern trug, betonten die angespannte Haltung, mit der sie dort saß. Hat sie sich je in ihrem Sitz bewegt, fragte sich der Copilot. Je die Beine übereinandergeschlagen? Je die Hände in den grauen Wildlederhandschuhen vom Schoß genommen?
Auf dem Sitz neben ihr lagen ein Popelinemantel – in Berlin hatte es geregnet und gestürmt – und eine graue Handtasche. Unter ihrem Sitz stand eine Reisetasche. Sonst war kein Gepäck von ihr an Bord.
Nach dem Namen auf der Passagierliste war sie eine Deutsche. Aber das hatte den Copiloten nicht irregeführt. In Venedig, während der Zwischenlandung, hatte er sie zu einem Kaffee eingeladen – eine Vergünstigung für Piloten. Sie lehnte ab, auf italienisch.
Auch den Ersatzkaffee aus Gerste, den man den Passagieren anbot, wollte sie nicht, keine belegten Brote. Sie wanderte nur unruhig auf und ab. Verschwand im Waschraum, kehrte frisch frisiert und gepudert zurück, nahm ihre Wanderung wieder auf. Ging zum Informationsschalter: Wann würde der Flug fortgesetzt? Wann würden sie in Rom eintreffen? Würde man die Abholenden von der Verspätung der Maschine unterrichten? Si, signora! Außerdem, jedermann vergewissere sich, bevor er sich auf den Weg zum Flughafen mache. Eine Maschine, die nach Flugplan landet, damit rechne niemand mehr in diesen Zeiten ...
Könnten Sie eine Nachricht ans Stadtbüro der Lufthansa in Rom durchgeben? Für wen bitte? Gianni Canossa, C-a-n-o-ss-a? Ja.
Der Copilot hatte seine Einladung wiederholt, vergeblich. Sie wanderte in der Halle auf und ab; Information, Glasfront zum Flugfeld, nervös, angespannt, den Hut in der Hand. Als sie endlich abflogen, saß sie wieder auf ihrem Platz im Heck ... »Alles klar in Rom! Wir sind in einer Viertelstunde unten. Das Wetter dort ist ausgezeichnet. Die Mittagstemperatur war zweiundzwanzig Grad.« Das Gesicht des Copiloten in der offenen Tür der Kanzel war gezeichnet von Müdigkeit. »Nur zweieinhalb Stunden Verspätung. Zeit genug für eine ausgiebige römische Nacht, meine Herren ...« Der Scherz verfing nicht, vielleicht, weil seine Stimme zu erschöpft klang, zu heiser von den vielen Gesprächen mit der Bodenstation.
Das Flugzeug schwenkte nach rechts, flog einen weiten Bogen, ging tiefer. Die Frau veränderte zum erstenmal ihre Haltung. Sie beugte sich vor, soweit es der Gurt zuließ, und blickte aus dem Fenster. Außer den Umrissen der Tragflächen konnte sie in der Dunkelheit nichts erkennen. Sie wußte, jetzt mußten sie über dem Meer sein. Während der ersten Stunden des Flugs hatte sie sich immer wieder diesen Moment vorgestellt: die auffunkelnde Wasserfläche des Mare Tirreno. Blendende Helligkeit – eine heiße Welle Licht, die sie überflutete, alles auslöschte, die Kälte, die Angst, alles, wovor sie auf der Flucht war. Aber da war kein Meer. Ein schimmernder Metallflügel. Trimmklappen, die spielten. Sonst nur Dunkelheit. Ja, für einen Augenblick war sie nicht einmal sicher, ob Rom, die Stadt, wirklich existierte.
Roma. Roma cara.
Erinnerungen rührten sich, ein Gedanke: Ich war einmal glücklich dort! Sie wollte den Gedanken festhalten. Er entglitt ihr. Nur Berlin. Das existierte. Die Nacht vor vier Tagen. Der Krankenwagen, der mit ihr in die Klinik raste trotz Fliegeralarm und der ersten Bomben. Sie, von Schmerzen gepeinigt, die Kehle ein brennendes Feuer, von der Jodtinktur, die sie getrunken hat. Was kümmern sie die Bomben! Sie wünscht nur, man möge sie sterben lassen. Die Klinik. Hände, die sie halten. Der glatte rote Schlauch, der sich ihrem Mund nähert ... Und später, mit ausgepumptem Magen auf eine Bahre geschnallt, in einem zugigen Kellergang bei flackernder Luftschutzbeleuchtung, während draußen die Bomben explodieren ...
Aber ich war einmal glücklich. Sie versuchte, den Gedanken neu zu beschwören. Das Glück, jung zu sein, alles noch vor sich zu haben. Das Mädchen, das sie damals war – was war damit geschehen? Gab es sie überhaupt noch, begraben unter den Trümmern einer Ehe, die neun Jahre gedauert hatte. Hatte diese überstürzte Flucht noch einen Sinn? Oder war es nur die Asche, die sie nach Rom zurückbrachte ...
Einmal noch glücklich sein, nur einen einzigen Augenblick! Ihre Hand griff nach dem Medaillon, das sie an einer feinen Goldkette um den Hals trug. Maria in Aracoeli, morgen besuche ich dich. Ich stifte dir eine Kerze, zehn Kerzen, hundert, nein, für jeden restlichen Tag dieses Jahres eine Kerze ... zweihundertsechzig würden das sein. Nicht viel für ein Wunder ...
Durch eine harte Bewegung der Maschine glitt ihr das Medaillon aus der Hand. Lichter tauchten auf – die Landebahn? – und verlöschten sofort wieder, als die Räder den Boden berührten. Das Schaukeln wurde stärker, als es in der Luft war. Es preßte sie in ihren Sitz zurück, als die Maschine die Schräglage einnahm.
Sie verharrte reglos, öffnete nicht einmal den Sicherheitsgurt. Sie hatte eben der Muttergottes ein Versprechen gemacht, aber sie konnte sich jetzt schon nicht mehr daran erinnern, überwältigt von der Tatsache, daß sie wirklich in Rom gelandet waren.
Die Maschine stoppte mit einem Ruck. Licht flackerte auf. Die Motoren verstummten. Ein Moment Stille und dann die Stimmen der Männer, laut, plötzlich fröhlich nach all dem aufgestauten Schweigen. Sie holten das Handgepäck hervor, schwere Aktentaschen, die Hüte, die Mäntel, verließen die Maschine.
Die Frau saß noch immer auf ihrem Platz, als die Piloten aus der Kanzel kamen. Der Copilot stutzte, kam zu ihr. »Es war hoffentlich nicht zu schlimm?« Er hatte seine Jacke angezogen, einen Seidenschal umgeschlungen. Der fliegende Vogel auf seiner Mütze glänzte. Auf seinem Gesicht lagen die Schatten eines dunklen Barts. »Ich helfe Ihnen.« Er holte ihre Reisetasche unter dem Sitz hervor. »Ein Osterausflug?«
Sie sah ihn an, als müsse sie über die Frage nachdenken. Ein schwaches Lächeln trat auf ihr Gesicht, machte es schön trotz der Blässe und der Spannung. »Ich bin in Rom zu Hause.« Er hatte versucht; ihr Alter zu schätzen. Jetzt, da sie lächelte, dachte er, Anfang Dreißig.
Sie nahm den Popelinemantel über den Arm. Er deutete auf den Hut, der noch auf dem Sitz lag. Sie schüttelte den Kopf, und das Lächeln kehrte zurück. »Ich habe schon lange vor, ihn einmal irgendwo liegenzulassen.«
Sein Blick ging zu ihrer rechten Hand. Durch den Handschuh konnte er nicht sehen, ob sie einen Ehering trug. Er hatte eine Schwäche für blonde Italienerinnen, und ein Ehering störte ihn nicht. Im Gegenteil. Mit verheirateten Frauen war vieles unkomplizierter. »Sie werden abgeholt?« Er hatte von Anfang an italienisch mit ihr gesprochen.
»Ja.«
»Schade.« Sie gingen auf das langgestreckte Flughafengebäude zu. Die Nacht war klar und mild. Sie blickte zum Himmel und sah den Mond, eine riesige blaßrote Mohnblüte, durchsichtig, schwerelos. Es war lange her, daß sie so einen Mond gesehen hatte ...
Dann erst bemerkte sie den Panzer, die Posten unter Gewehr, die Flugzeuge unter Tarnnetzen und weit weg die Silhouetten von Flakgeschützen mit ihren langen Rohren.
»Vorsicht!« Der Copilot nahm für einen Moment ihren Arm, als sie das Flughafengebäude betraten. Draußen war es heller gewesen als hier. Die dunkelgrün abgeschirmten Lampen gaben kaum Licht. Die Fenster waren mit schwarzem Papier zugeklebt.
Sie betraten den Raum der Paß- und Zollkontrolle; die Helligkeit dort blendete im ersten Moment. Die Passagiere der Lufthansa-Maschine waren bereits abgefertigt, nur der Zivilist stritt sich noch mit dem italienischen Zöllner.
Der Copilot stellte die Reisetasche auf den Boden, tippte mit der Hand kurz an seine Mütze. »Vielleicht ein andermal, tanti auguri!«
Sie legte ihren Mantel auf die Tasche und holte das Lederetui mit dem Paß aus ihrer Handtasche. Der Beamte nahm den Paß mit einem wohlwollenden Nicken, aber als er ihn aufschlug, verfinsterte sich seine Miene. Er blätterte vor und zurück. »Ich sehe kein Visum.«
»Aber es muß ein Visum dasein.«
»Ein abgelaufenes. Seit einem Jahr abgelaufen.« Der Mann von der Zollkontrolle war mit dem Zivilisten fertig. Er trat zu seinem Kollegen. Sie betrachteten gemeinsam das Dokument. Der Zollbeamte deutete auf eine Stelle, dann richtete er den Blick auf die Frau.
»Canossa?« Sie nickte, ohne zu verstehen, was ihr Mädchenname mit der Sache zu tun hatte.
»Kein allzu häufiger Name.« Der Zöllner forschte in ihrem Gesicht. »Enrico Canossa, der Flieger – sind Sie vielleicht verwandt mit ihm?«
»Er war mein Vater.« In dem Lederetui, in dem der Paß steckte, gab es auch ein Fach mit einer vergilbten Fotografie: das Flugfeld von La Spezia. Ein Doppeldecker. Ein großer Mann im Fliegeroverall mit langem Schal, in den Händen die Lederkappe und die große Brille. Ein Mädchen, nicht älter als zehn, steht neben ihm, blickt zu ihm auf – sie selber.
»Ihr Vater, der große Enrico Canossa!«
Sie hätte dem Mann eine Freude gemacht, wenn sie ihm das alte Foto gezeigt hätte, aber sie nickte nur. »Ja.«
»Il comandante! Ich habe ihn noch fliegen sehen. September 1920, Venedig ... Warten Sie ... Er flog die SIAI-Savoia S 12 ... vierteilige Schraube. Wendemarke zwei Ballone. Er gewann das Rennen ...« Er unterbrach sich und flüsterte seinem Kollegen etwas zu. Sie sah, wie der Paßbeamte das Lederetui zuklappte. Dann gab er es ihr zurück. »Sie müssen sich ein Visum besorgen.«
Sie steckte den Paß zurück und wollte den Verschluß der Reisetasche öffnen. Der Zöllner winkte ab. Sie war erleichtert. Die Tasche enthielt nicht viel Wertvolles, außer dem Schmuck vielleicht, den sie geerbt hatte. Der Inhalt war typisch; jeder in Berlin hatte so eine Tasche bereit, die man sofort ergreifen konnte, wenn die Alarmsirenen aufheulten und man in den Keller lief: die Papiere, die Lebensmittelkarten, Geld, Schmuck, Dinge, an denen man hing. In ihrem Fall war das ein Bündel Briefe ihres Bruders Gianni, die Kuverts mit einem Band zusammengehalten, die Briefe auf grauem Feldpostpapier, zerknittert und brüchig vom vielen Lesen. Das waren ihre gesamten Andenken an Berlin. An neun Jahre Leben.
Ihr Mann hatte noch ein Nachthemd hineingestopft, den Kulturbeutel – was für ein schreckliches deutsches Wort! –, ein Paar Hausschuhe. Ihr war erst am zweiten Tag in der Klinik aufgefallen, daß er den Männern vom Roten Kreuz die Tasche mitgegeben hatte. Er selbst war nicht mitgefahren, natürlich nicht. Er hatte auch nicht in der Klinik angerufen. Jedenfalls erwähnte es niemand.
Die Tasche – sie hatte ihr plötzlich die Chance zur Flucht eröffnet, der lange geplanten, immer wieder vereitelten Flucht. Die Tasche und Giannis Anruf. Sie war nicht mehr in das Haus in Spandau zurückgekehrt ... Sie würde sich neue Kleider anschaffen müssen ...
Der Zollbeamte hatte seinen Hymnus auf den großen Flieger Enrico Canossa wieder aufgenommen. Geschwindigkeitsrekorde, Fernflüge, Flugzeugtypen. Er begleitete sie zur Schwingtür. Die Halle lag ausgestorben da. Er streckte ihr die Hand hin. »War mir eine Ehre, die Tochter des comandante Canossa kennenzulernen.«
Die Reisetasche in der linken Hand, über dem rechten Arm den Mantel, stand sie da und blickte sich suchend um. Sie sah niemand. Die Schalter der Lufthansa und der beiden italienischen Linien, der ALI und der LATI, waren geschlossen. Über dem Informationsschalter brannte ein trübes Licht, das jetzt auch erlosch. Ein grauhaariger Mann kam hinter der Theke hervor und strebte dem Ausgang zu.
Sie rief ihm nach. Er blieb stehen, ein Mann, der seinen Dienst beendet hatte und heimwollte. »Was gibt’s?«
»Hat hier niemand gewartet?«
Ein Kopfschütteln. »Ich muß den Bus erreichen.«
»Ich sollte abgeholt werden.«
»Hier war niemand.«
»Kommt noch ein Flug?«
»Sicher nicht!«
»Hat jemand eine Nachricht hinterlassen? Eine Nachricht für ...« sie zögerte »... für Maria Canossa.«
»Ich weiß von keiner Nachricht.« Sein Blick ging zu der Wanduhr. Sie zeigte halb zwölf. »Sie wollen in die Stadt? Das ist der letzte Bus.«
»Aber es muß eine Nachricht dasein.«
»Tut mir leid ...«
»Kann ich telefonieren?«
»Signora, der Bus wartet nicht! Wenn er weg ist, sitze ich hier die ganze Nacht fest. Und Sie auch.«
»Kann ich hier ein Taxi bekommen?« Er schüttelte den Kopf und eilte davon.
Sie zögerte. Dann folgte sie ihm. Die Reisetasche erschien ihr plötzlich sehr schwer. Der Mantel glitt ihr vom Arm, fiel zu Boden. Sie bückte sich danach. Als sie sich aufrichtete, zitterten ihr die Beine. Sie hatte die ganzen neun Stunden nichts gegessen außer etwas Schokolade, nichts getrunken außer einem Schluck Wasser. Ihr Mund war ausgetrocknet; sie fühlte sich fiebrig. Sie öffnete ihre Kostümjacke. Der Geruch ihres eigenen Körpers störte sie plötzlich.
Es wurde noch schlimmer, als sie ins Freie trat. In der milden Luft wurde der Geruch noch unerträglicher. Es war ihr eigenes Eau de Cologne. Im Gürtelband steckte das Taschentuch, das damit getränkt war. Seit Jahren benützte sie dieses Eau de Cologne; es hatte immer zu ihr gepaßt. Jetzt zog sie das Taschentuch aus dem Rockbund und warf es fort. Ich muß mir etwas Neues zulegen, dachte sie, gleich morgen. Es war ein überraschender Gedanke. Morgen. Ein neuer Duft. Der Gedanke tat ihr gut.
3
Der graugrüne Bus hatte die Türen schon geschlossen. Sie begann zu laufen. Sie konnte niemand im Innern erkennen, nur dunkle, glänzende Scheiben. Das klobige Fahrzeug setzte sich in Bewegung – Maria blieb stehen, winkte, gab Zeichen – und stoppte wieder. Weißer Qualm entströmte dem Holzvergaser. Eine Hand streckte sich ihr entgegen, als die vordere Tür aufging. Sie blickte in das lächelnde Gesicht des Copiloten. Er wirkte frisch und ausgeruht. Er mußte Zeit gefunden haben, sich in einem der Waschräume des Flughafens zu rasieren.
»Nett, Sie wiederzusehen!«
»Vielen Dank.«
Sie suchte in ihrer Handtasche nach Kleingeld für das Billett, aber er war schneller. »Stazione aerea Roma?« Sie nickte, und er bezahlte den Fahrer. Erst in diesem Moment dachte sie daran, daß sie überhaupt kein italienisches Kleingeld bei sich hatte, nur die großen Noten, in einem Seitenfach der Handtasche.
Der Bus war so leer wie vorher das Flugzeug. Nur die zwei Lufthansa-Piloten, der eine Passagier aus Berlin in Zivil, der grauhaarige Mann vom Informationsschalter und zwei Frauen. Die Zöllner und Paßbeamten lebten vermutlich draußen am Flughafen.
Sie hatte den Platz hinter dem Fahrer gewählt und mit der Reisetasche und dem Mantel den Sitz neben sich belegt. Der Copilot hatte den Wink verstanden. Er saß in der anderen Reihe, so daß der Gang zwischen ihnen war. Sie fühlte, wie er sie beobachtete, aber sie reagierte nicht.
Es war warm im Bus, eine andere Wärme als im Flugzeug. Vielleicht lag es an der Sonne, in der er tagsüber gestanden hatte. In Berlin war es naßkalt gewesen; auf dem Flugplatz hatte es gestürmt. Sie hatte ihr Hütchen festhalten müssen und war durchfroren in die Maschine gestiegen. Dazu die Angst, daß im letzten Augenblick etwas dazwischenkommen könnte ...
Der Fahrer vor ihr summte eine Melodie. Es war eine einfache, schwermütige Tonfolge, die sich immer wiederholte. Sie weckte eine Erinnerung: ihr Vater – im Frack noch größer als sonst – und sie im weißen Rüscheinkleid in der Loge, über deren Brüstung sie kaum hinwegsehen konnte. Er liebte die Oper, Verdi vor allem ... Was der Fahrer summte, war aus einer Verdi-Oper. »Othello.« Ihr fielen auch die Worte ein: Egli era nato per la sua gloria, io per amar. Er war geboren zu seinem Ruhme, ich, ihn zu lieben ...
Sie beugte sich zum Fenster, schirmte die Augen ab, um besser zu sehen. Sie fuhren, so schien es, durch vollkommenes Dunkel, vollkommene Leere, das einzige Fahrzeug auf der Straße. Dann sah sie Schirmpinien am Straßenrand. Von Kindheit an waren das ihre Lieblingsbäume. Warum eigentlich? War es die bizarre Form, das breite, schützende Dach, das ihre Zweige bildeten?
Allmählich belebte sich die Straße.
Sie entdeckte andere Wagen. Meist waren es Militärfahrzeuge, nur selten Personenautos und dann fast immer schwarze Mercedes-Limousinen. Einmal überholte sie ein kleiner zweisitziger Fiat.
Und dann, endlich, sah sie die Stadt daliegen oder erahnte sie doch im Licht des Mondes. Sie fuhren einen Fluß entlang, überquerten eine Brücke. Die Umrisse des Kolosseums tauchten auf, das Kapitol. Sie erkannte die Gegend! Nicht umsonst hatte sie ein Jahr lang Fremde durch Rom geführt. Im fahlen Licht des Mondes wirkten die Ruinen des Forums seltsam belebt. Wenn sie auch in Norditalien geboren war, so fühlte sie sich doch ganz als Römerin, und der Platz dort unten war für sie der Ort, wo einmal der Lauf der Welt bestimmt worden war.
»Entschuldigen Sie ...«
Der Copilot hatte den Platz gewechselt und sich hinter sie gesetzt. »Sie haben – Ihren Freund verpaßt? Vielleicht kann ich Ihnen behilflich sein.« Sie hatte zwar gesagt, sie sei in Rom zu Hause, aber er bezweifelte das jetzt. »Die Hotels werden überfüllt sein – so kurz vor Ostern.«
Daß Gianni sie nicht am Flughafen abgeholt hatte, beunruhigte sie nicht wirklich. Sein Telegramm war in Tunis aufgegeben. Wer weiß, ob ihre Antwort ihn dort noch erreicht hatte. Es war Krieg, und im Krieg gingen Telegramme verloren, daran war nichts Besonderes. Sie hatte die Adresse seiner neuen Wohnung; er hatte ihr angeboten, dort zu bleiben, solange sie in Rom war. Aber sie hatte keinen Schlüssel. In seinem Telegramm hatte er nichts vom Schlüssel gesagt. Vielleicht würde sie die erste Nacht doch in einem Hotel verbringen müssen.
Der Copilot schien ihre Gedanken zu erraten. »Wir Piloten übernachten im Grandhotel. Treuer, braver Kasten, wie unsere Ju. Hat dem Krieg bisher tapfer getrotzt. Großartige Bar, immer offen für uns. Gute Kapelle. Italiener. Schmalzig, aber schön.« Er ließ sich durch ihr Schweigen nicht beirren. »Wäre das nichts? Wenn Ihnen danach zumute ist, könnten wir etwas miteinander trinken. Etwas tanzen. Nur, wenn es Ihnen Spaß macht ...«
O Maria im Aracoeli! dachte sie. Sehe ich so aus? Eine, die leicht zu haben ist.
Sie wandte sich auf ihrem Sitz um, versuchte zu lächeln, nur damit er nicht merkte, wie ihr wirklich zumute war. »Nein, vielen Dank. Ich komme schon zurecht.« Es bestand immer noch die Möglichkeit, daß Gianni an der Fluggast-Sammelstelle in der Via Giovanni Giolitti auf sie wartete, weil die Zeit zu knapp gewesen war, um zum Flughafen hinauszufahren. Ob er den Topolino noch besaß?
»... nach neun Stunden Flug kann man sowieso nicht gleich schlafen ... Es war nur eine Frage. Sie verstehen mich nicht falsch?«
»Nein, nein. Nicht im geringsten.« Sie fragte sich, ob das in Zukunft ihr Leben sein würde: Zufallsbekanntschaften, für eine Nacht oder für zwei, für einen Urlaub; kurze, flüchtige Kriegsliebschaften. Immerhin – es hatte sie gegeben, diese seltsame, rasch aufflammende und schon vergangene Kriegsliebschaft. Der einzige Fehltritt in ihrer Ehe ... War es das, was sie von nun an erwartete? Immer wieder und immer wieder? War es das, was sie brauchte – ein Abenteuer? Nein, sie wünschte sich nur eines: allein zu sein! Das war alles, was sie brauchte. Allein sein und schlafen. Schlafen ohne das Veronal, das sie in der Handtasche bei sich hatte. Schlafen, ohne Träume, ohne Ängste.
Sie bemerkte, daß sie bereits auf der Piazza dei Cinquecento waren, dem weiten Platz vor der Stazione Termini. Aber war das tatsächlich der Platz, den sie in Erinnerung hatte? Am Tag ein Hexenkessel und am Abend ein funkelndes Autokarussell, das sich ununterbrochen drehte – jetzt aber still, dunkel, ausgestorben. Kein Platz – ein bleicher, erkalteter Planet.
Wo waren die Leute, die um diese Zeit aus der nahen Oper und aus den Restaurants kamen, Paare in eleganten Abendgarderoben? Wo waren die Jugendlichen, die mit ihren Rädern wilde Jagden um den Platz machten? Die vereinzelten Gestalten, die mit schweren Gepäckstücken beladen dem Haupteingang des Bahnhofs zustrebten, verstärkten noch den Eindruck der Verlassenheit. Als sie das erste Mal nach Rom gekommen war, hatte der Bahnhof sie enttäuscht; er hätte ebensogut in einer Provinzstadt stehen können. Jetzt, mit den mächtigen Steinsäulen längs der Seitenfronten, die Mussolini hatte hinsetzen lassen, gefiel er ihr noch weniger.
Der Bus bog in die Straße rechts von der Stazione Termini. An der Sammelstelle wartete niemand auf sie. Eine Reihe von Bussen stand da, abgestellt für die Nacht. Weit und breit kein Taxi; aber in der Nähe hörte sie das Klappern von Hufen; Gianni hatte ihr in seinem letzten Brief aus Rom geschrieben, daß es kaum Taxis, aber immer mehr Pferdedroschken gebe. Sie hatte sich gewundert: War das Futter für Pferde leichter zu beschaffen als Benzin?
»Nun, was ist? Wollen Sie nicht doch mit uns kommen?« Die beiden Piloten standen neben ihr auf dem Gehsteig, die schmalen Reisetaschen in der Hand.
Der Pilot selbst war der ältere der beiden, ein Mann um die Fünfzig mit einem harten, verschlossenen Gesicht. Wenn schon, dann hätte er ihr besser gefallen, aber er schien weit weg mit den Gedanken.
»Im Grand gibt’s immer noch ein Zimmer, wenn wir ein gutes Wort einlegen. Wir sind Stammgäste, lassen eine Menge Lire dort.«
Er war wirklich hartnäckig. Sie wußte nicht, daß sie lächelte. »Sie sind wirklich hartnäckig.« Sie winkte der Droschke, die in die Via Giovanni Giolitti einbog.
»Sie brauchen keine Droschke.« Er deutete in die Richtung der Piazza Esedra. »Es ist nur ein Katzensprung zum Grand.« Die Silhouette des Najadenbrunnens im Mondlicht. Aber wo waren die Bäume? Dann erst fiel ihr ein, daß man fast alle Bäume vor den Diokletiansthermen abgeholzt und verheizt hatte. Auch davon hatte Gianni ihr in seinen Briefen berichtet. Sie war lange nicht mehr in Rom gewesen, zu lange.
Das Klappern der Hufe kam näher. Das Pferd war erbärmlich mager, ebenso der Mann auf dem Bock. Als er die beiden Piloten in ihrer blauen Uniform sah, schüttelte er den Kopf. »Ich hab’ für heute schon Schluß gemacht.« Für ihn gab es zu viele Deutsche in Rom, in allen möglichen Uniformen.
»Nicht für mich, oder?« Maria redete ihn im breiten Dialekt an, den man im Arbeiterviertel San Lorenzo sprach.
»Nein, für Sie nicht. Wohin soll es gehen?«
Der Copilot gab endlich auf. Er wünschte ihr eine gute Nacht und folgte dem Piloten, der schon vorausgegangen war. Der Kutscher sah ihnen nach. »Deutsche.« Mehr sagte er nicht.
Sie stieg in die Droschke. »Piloten. Lufthansa.«
Er schüttelte den Kopf. »Kein Unterschied. Wohin nun, signora?«
Briga fiel ihr ein, Briga, die aus San Lorenzo stammte und sich einen Spaß daraus machte, den Dialekt ihrer Jugend zu sprechen. Aber sie hatte Briga ein bißchen aus den Augen verloren. Wie alle. Die Pension, in der sie zusammen mit Gianni gewohnt hatte, als sie nach Rom gekommen war? Oberhalb Trinità dei Monti, mit einem herrlichen Blick über die Stadt. Aber sie konnte sich weder auf den Namen der Pension noch auf die Straße besinnen. Sie hatte ganz Rom aus den Augen verloren.
Der Fahrer wartete. Sie nahm Giannis Telegramm aus der Tasche und nannte ihm die Adresse: »Via dei Soldati.«
4
Es war eine enge, verwinkelte Gasse in einem der ältesten Stadtviertel Roms. Sie lag nahe am Tiber, dort, wo er die große Schleife macht und sich jenseits die Engelsburg erhebt. Sie war früher nie in diese Straße gekommen; jedenfalls konnte sie sich nicht daran erinnern. Die Piazza Navona war immer die Grenze gewesen. Wie viele Gläser Limonade hatte sie dort getrunken, vom Besitzer ihres Stammcafés selbst zubereitet, mit etwas mehr Zitrone und etwas mehr Zucker als für gewöhnliche Gäste.
Der Kutscher hatte Mühe, sein Gefährt in der Mitte zwischen den alten, hohen Häusern zu halten. Als er schließlich die Zügel anzog, war links und rechts kaum Platz, um den Schlag zu öffnen.
Er sah zuerst das Haus an, dann sie. »Das ist es doch?«
»Neunundzwanzig.« In der Dunkelheit konnte sie kein Nummernschild erkennen.
Der Kutscher griff nach der Taschenlampe, die er neben sich auf dem Bock liegen hatte. Viel Licht gab sie nicht; die Batterie mußte fast ausgebrannt sein, und den Rest schluckte der bläuliche Luftschutzfilter.
An der Mauer des Hauses standen zwei Nummern, neunundzwanzig und dreißig. Der Verputz war fleckig und brökkelte an vielen Stellen ab. Es fiel ihr schwer, sich vorzustellen, daß Gianni in diesem Haus wohnte. Gianni, der auf äußere Dinge so großen Wert legte! Er, der für einen Mann fast übertrieben eitel war. Wie oft hatte sie ihn wegen seiner maßgeschneiderten Fliegeruniformen aufgezogen, wegen der Manschettenknöpfe, die er zur Galauniform trug, graue Perle inmitten von Brillantsplittern.
»Würden Sie bitte warten?« Sie zwängte sich aus dem halboffenen Schlag. Durch die dünnen Schuhsohlen spürte sie das Kopfsteinpflaster. Am Ende der Gasse, nur wenige Häuser weiter, führte eine Treppe zum Lungotevere Marzio hinauf, der Uferstraße längs des Tiber. Sie nahm Reisetasche und Mantel. »Es kann sein, daß wir weiter müssen. Kann ich Sie dann bezahlen?«
»Und wenn Sie einfach verschwinden?«
»Wie sollte ich?«
»Man weiß das nie bei diesen Häusern.«
»Ich lasse meine Tasche da.«
»So ernst war es nicht gemeint.« Er hob die Hand mit der Taschenlampe, um ihr zu leuchten. In dem bläulichen Schein wurde in dem Bogen über der Haustür ein Gitter mit einem Wappen sichtbar. Dieses zeigte eine Sonne. Das alte Goldblech funkelte in dem ungewissen Licht, und auch die menschlichen Züge, die das Metallbild trug, waren deutlich zu erkennen. Keine freundliche Frau Sonne, sondern ein trotziges Männergesicht. Gitter und Wappen waren bestimmt so alt wie das Haus selbst, wenn nicht viel älter.
Die Luft im Hausgang hatte den strengen Geruch alter Kellergewölbe. Eine Steintreppe führte nach oben. Maria fand den Lichtknopf. Eine einzelne Birne gab etwas Licht. Maria entdeckte Briefkästen, eine ganze Reihe. An einem stand der Name G. CANOSSA. Das Innere war leer.
Im Haus herrschte Stille. Es schien unbewohnt, trotz der Briefkästen. Die anderen Häuser der Via dei Soldati, an denen sie vorbeigefahren waren, hatten genauso ausgestorben gewirkt. Heruntergelassene, verrostete Eisenläden; kleine Handwerksbetriebe, Depots für Wein, Mineralwasser, Olivenöl. Ob sie am Tag je geöffnet wurden? Am Anfang der Straße hatte sie ein Kino gesehen, geschlossen jetzt, aber mit Filmplakaten; ein alter deutscher Film.
Es blieb still, als sie die Treppe hinaufstieg. Das einzige Geräusch waren ihre eigenen Tritte. Sie las die Namen an den Türen, denn sie wußte nicht, in welchem Stockwerk Giannis Wohnung lag. Das Treppenlicht erlosch. Sie tastete sich weiter. Plötzlich spürte sie anstelle des Steinbodens etwas Weiches unter den Füßen. Sie suchte den Lichtschalter.
Es war das oberste Stockwerk. Der Vorplatz war mit einem Teppich ausgelegt, und die Wände waren frisch getüncht. Es gab nur eine Tür, neu, dunkelgrün gestrichen, mit einem neuen Messingbeschlag am Schloß. Ein Schild aus poliertem Messing trug Giannis Namen. Anstelle der Klingel gab es einen Klopfer, eine Miniaturhand aus Bronze.
Sie vernahm Stimmen hinter der Tür, Männer. Sie ließ den Klopfer gegen die Tür fallen. Wieder erlosch das Licht. Die Stimmen verstummten.
Sie stand da in der Dunkelheit und wartete. Hinter der Tür regte sich nichts. Sie wollte wieder zum Klopfer greifen, als sie plötzlich ein Geräusch hinter der Tür hörte und dann eine Stimme, die fragte: »Wer ist da?«
Giannis Stimme war es nicht, trotzdem antwortete sie, als stünde er hinter der Tür. »Ich bin es, Maria!«
»Wer?«
»Maria. Maria ...« Sie stockte. Hatte sie wirklich Maria Canossa sagen wollen? Seit neun Jahren trug sie einen anderen Namen; auch nach der Scheidung würde ihr der andere Name bleiben. Ich muß das ändern, dachte sie. Gleich morgen werde ich das in die Wege leiten. Maria Canossa – das war der richtige Name für sie. Das war sie selber. Ich werde ihn nie mehr hergeben, nie mehr ...
Die Tür öffnete sich. Helles Licht, das sie blendete. Ein fremder Mann stand vor ihr. Er war größer als Gianni. In der Hand hatte er eine Zigarette. Er schien genauso überrascht wie sie. »Wo ist Gianni?«
»Entschuldigen Sie.« Er nahm die Zigarette in die andere Hand. »Marco Varelli.« Seine Stimme war dunkler als die von Gianni, fast etwas heiser.
»Ist Gianni nicht da?«
»Kommen Sie herein ... Geben Sie mir die Tasche!«
Sie zögerte, halb in der Tür. »Ich kam mit einer Droschke. Ich muß den Fahrer bezahlen.«
»Kommen Sie erst einmal herein! Ich erledige das für Sie. Haben Sie noch mehr Gepäck?«
Sie schüttelte den Kopf. »Hatte Gianni keine Zeit, mich abzuholen?«
»Ich bin gleich zurück.«
Sie blickte sich in dem Wohnraum um, in den er sie geführt hatte. Überall brannten Lampen. Die meiste Helligkeit aber kam von einer Vitrine am Ende des Zimmers. Sie reichte vom Boden bis zur Decke. Auf gläsernen Zwischenböden, indirekt beleuchtet, waren kleine Objekte ausgestellt. Ein heller Teppich bedeckte den Boden. Die Möbel waren teils modern, teils alt, aber durchweg wertvoll. Nach dem heruntergekommenen Zustand des Hauses überraschte sie der Luxus der Wohnung.
Sie stand noch an derselben Stelle in der Mitte des Wohnraums, als er zurückkam. Erst jetzt sah sie ihn genauer an. Sein Gesicht war gebräunt, sein Haar dunkel und glatt zurückgekämmt, ohne Scheitel. Hatte sie vorher wirklich zwei männliche Stimmen gehört? Sie war zu müde, um sich darüber Gedanken zu machen. Zu müde, diesen Fremden zu fragen, warum er hier war und nicht Gianni.
»Kann ich mir die Hände waschen?« Sie zog die Handschuhe von den Fingern. Sie trug den Ehering nicht mehr, und doch hatte sie das Gefühl, er sei immer noch an seinem Platz, für jeden sichtbar.
»Hier. Ich zeige es Ihnen.« Er nahm ihre Reisetasche und den Mantel.
Sie mußten an der beleuchteten Glasvitrine vorbei. Die kleinen Objekte waren Flugzeugmodelle. Er öffnete eine Tür, die sie vorher nicht gesehen hatte. Er ging voraus und knipste die Lampen zu beiden Seiten des Bettes an. Er öffnete die Tür zu einem Bad und machte auch dort Licht.
»Soll ich Ihnen einen Kaffee machen?«
»Gerne ... und wenn ich vielleicht etwas zu essen haben könnte?«
Allein, überfiel sie plötzlich ein Gefühl der Unwirklichkeit. Die beiden roten Lackschirme auf Chinavasen neben dem breiten Bett; der braune Boden, die braune Stofftapete, die Vorhänge in derselben Farbe. Es waren nur ihre Augen, die alles registrierten, sie selber konnte mit diesen Eindrücken nichts anfangen. Alles war ihr fremd. Sie selber war sich fremd. Die Tasche dort auf dem Stuhl gehörte ihr. Der Mantel gehörte ihr. Aber warum war sie hier?
Sie öffnete den eingebauten Schrank. Zwei helle Anzüge. Ein Smoking mit weißem Jackett. Eine Uniform. Das Graublau der italienischen Luftwaffe. Sie schob die anderen Bügel zur Seite und sah auf dem Uniformrock die breite Ordensspange. Gianni hatte so ungefähr alle Auszeichnungen erhalten, die es für einen Flieger gab. Er stand in den Zeitungen und war in der Öffentlichkeit so bekannt wie früher sein Vater. Manchmal fürchtete sie, er würde auf ähnliche Weise umkommen wie ihr Vater. Eine Furcht, die sie bis in ihre Träume verfolgte, ihre schlimmen Träume: Gianni aus dem Himmel stürzend, Gianni in einer brennenden Maschine ...
Sie zog ihre Kostümjacke aus, öffnete die Reisetasche. Sie ging ins Bad, und dann, vor dem Spiegel, war sie plötzlich am Ende ihrer Kraft. Sie mußte sich mit beiden Händen am Becken festhalten, um auf den Beinen zu bleiben. Sie war seit fünfzehn Stunden unterwegs. Sie hatte zwei Tage in der Klinik gelegen. Ja, vor drei Tagen war sie schon fast tot gewesen. Sie ließ das Wasser laufen, aber sie war nicht fähig, sich die Hände zu waschen oder einen Schluck Wasser zu trinken. In ihren Beinen war eine Schwäche, als sei sie den ganzen Weg nach Rom gelaufen. Dieser Gedanke gab ihr teilweise die Fassung zurück.
Sie wusch sich die Hände, das Gesicht, trank einen Schluck kaltes Wasser. Sie nahm die Puderdose, klappte sie auf – und dachte: hoffnungslos!
Das war wirklich das schlimmste – das Gesicht der Frau, die ihr aus dem Spiegel entgegenblickte. Sie ertrug diese unglücklichen Augen nicht. Diese Augen erinnerten sie an all das, was sie vergessen wollte.
Vergessen. Und schlafen. Die Puderdose glitt ihr aus den Händen, der Spiegel zerbrach auf dem Steinboden. Aber sie hörte das Geräusch des splitternden Glases nicht mehr.
5
Der Kaffee tat ihr gut. Was noch erstaunlicher war, sie aß mit einem wahren Heißhunger. In den letzten Wochen hatte sie nie mehr wirklich Appetit gehabt. Das Erstaunlichste aber war, daß sie hier saß, diesem fremden Menschen gegenüber, und sich trotzdem ganz ungezwungen fühlte.
Ihr war schwindlig geworden, schwarz vor den Augen. So hatte er sie gefunden, in einem Zustand, in dem keine Frau gern von einem Mann gesehen wird. Dennoch fühlte sie sich in seiner Gegenwart entspannt. Als gebe es zwischen ihnen eine geheime Vertrautheit. Oder war es nur dieser Raum? Oder die Tatsache, daß sie wirklich in Rom angekommen war?
»Noch Kaffee?«
»Gern.« Der Arzt hatte gesagt: Nichts Heißes. Kein Kaffee, kein Alkohol, acht Tage lang nicht. Die Verätzungen schmerzten, aber sie trank trotzdem. Sie saß auf der weichen Couch. Die Vitrine mit den Flugzeugmodellen war nicht mehr beleuchtet. Der Raum wirkte kleiner und wärmer.
»Fühlen Sie sich besser?«
»Ja.« Sie trank von dem Kaffee. Sie hatte ihre Jacke nicht wieder angezogen. Sie trug eine violette Seidenbluse. Die beiden obersten Knöpfe waren offen, und die Kette mit dem Medaillon fiel aus der Bluse, wenn sie sich vorbeugte. Sie steckte es jedesmal zurück. Sie war sich nicht bewußt, daß sie es tat, aber er beobachtete es.
»Ihre Hände waren eisig.«
»Sie haben Sie nie in Berlin gehalten!« War sie das, die da antwortete, die lachte? »Ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal so guten Kaffee getrunken habe. Ich meine, italienischen Kaffee.« Nicht einmal in der Italienischen Botschaft in Berlin war er so gut. Und sie waren ohnehin nur zweimal im Jahr dort eingeladen, zu Mussolinis Geburtstag und im Oktober zum Jahrestag des »Marsches auf Rom«. Aber daran wollte sie nicht denken, geschweige davon sprechen.
Sie blickte ihn über den niedrigen Marmortisch hinweg an. »Der Name, den Sie vorhin nannten ...«
»Marco Varelli.«
Eine vage Erinnerung stieg in ihr auf – ein Park, das helle Geräusch von Krocketkugeln, die aneinanderstießen. Aber sie konnte diese Erinnerung und den Fremden nicht in Verbindung bringen.
»Müßte ich Sie kennen?«
»Wahrscheinlich ist es zu lange her.«
»Wie lange?«
»Jahrhunderte.«
»Wirklich so lange?«
»Jedenfalls eine Ewigkeit.« Er zündete sich eine neue Zigarette an. Der Aschenbecher vor ihm war gefüllt. Sie rauchte nicht mehr seit der Schwangerschaft. Seltsam, daß der Rauch sie nicht störte. Er war süßlich.
»Es ist gut, jemanden eine Ewigkeit zu kennen.«
Er antwortete ihr nicht, und sie hatte das Gefühl, daß sein Gesicht sich noch mehr verschloß, wenn das überhaupt möglich war. Sie betrachtete ihn durch den Rauch der Zigarette.