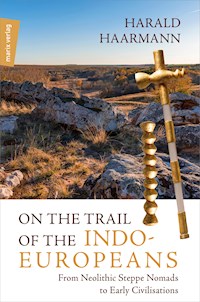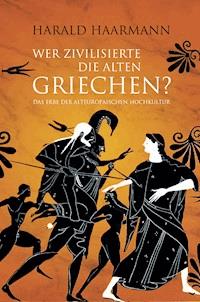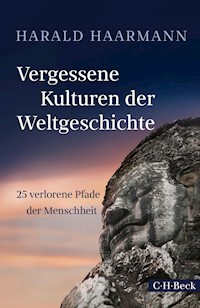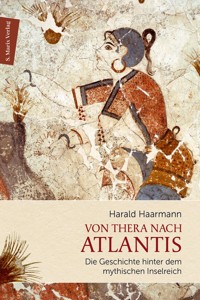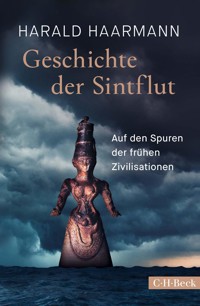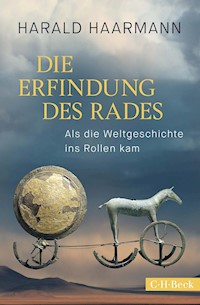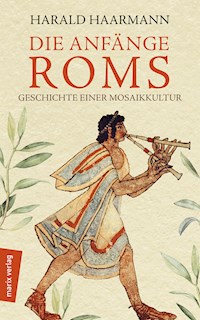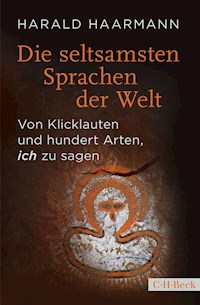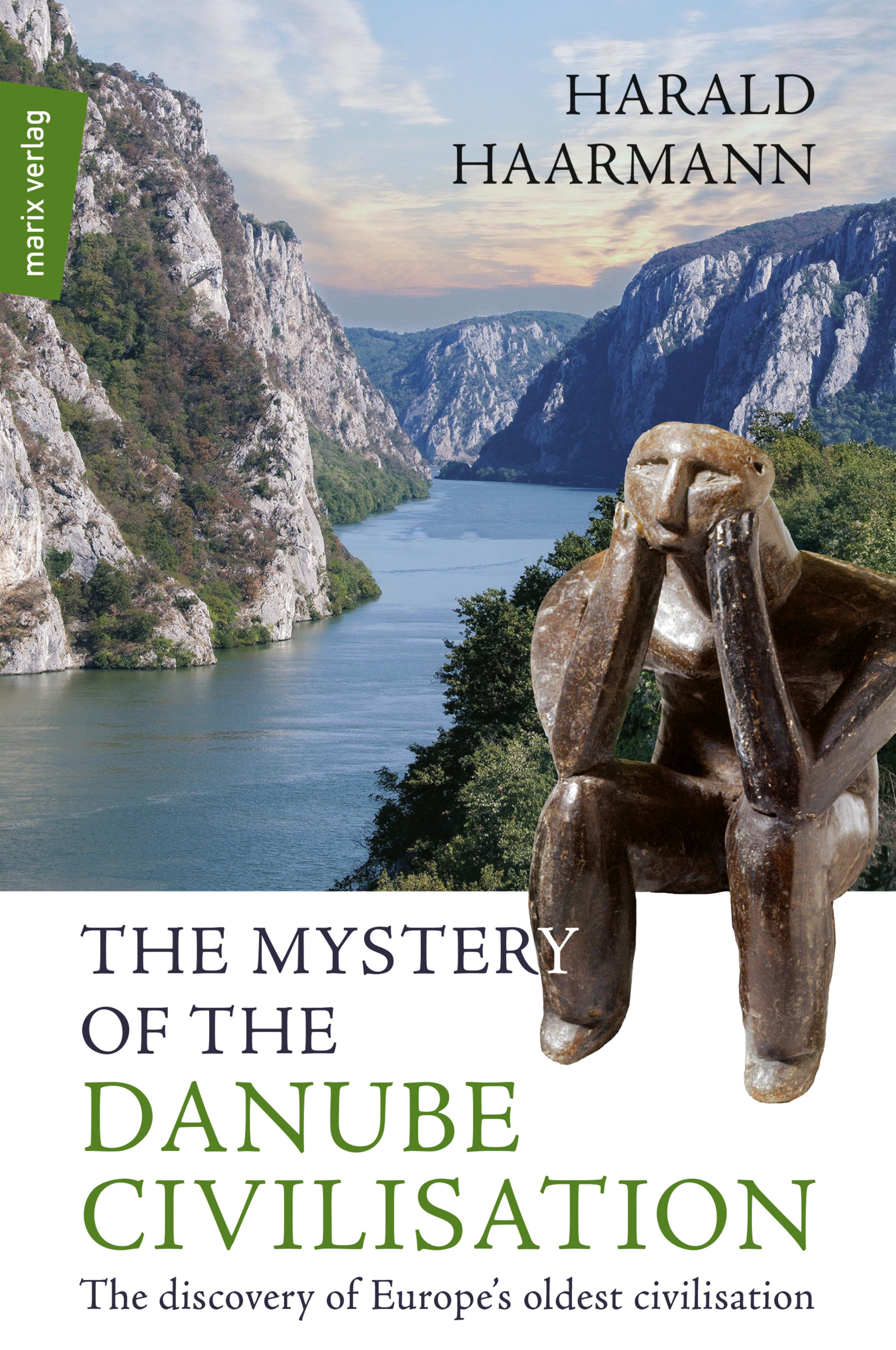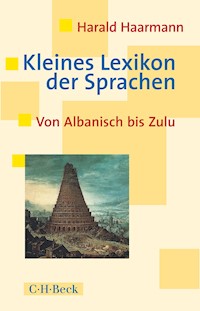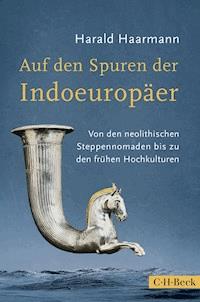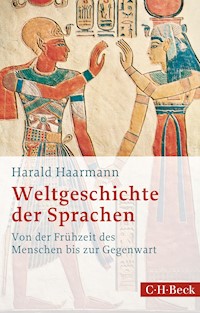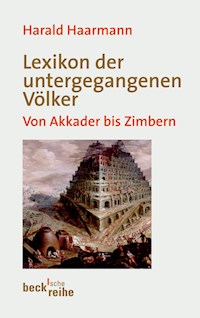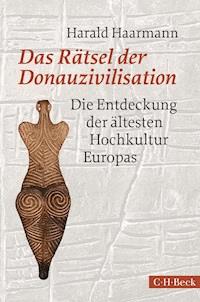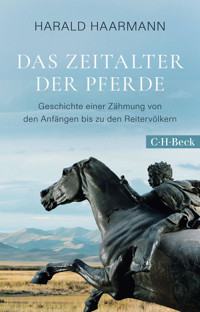
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Domestizierung des Pferdes und seine Rolle als Nahrungslieferant, Reit-, Zug- und Arbeitstier haben eine Schlüsselepoche der Menschheitsgeschichte geprägt. Harald Haarmann rekonstruiert auf der Basis neuer archäologischer, genetischer und linguistischer Forschungen den schrittweisen Prozess der Zähmung und Nutzung von Pferden und zeigt, wie die jahrtausendelange Partnerschaft nicht nur die Pferde, sondern auch die Menschen verändert hat.
In der Steppe nördlich des Schwarzen Meeres begann die Domestizierung der Pferde. Aber warum gerade hier? Und was verband Menschen und Wildpferde von Anfang an? Harald Haarmann beschreibt, wie Menschen zunächst als Jäger den Pferden folgten, dann auch als Viehnomaden auf der Suche nach Weidegründen. Vor 8000 bis 9000 Jahren gewöhnten sich die Steppennomaden über Generationen hinweg im Zuge genetischer Veränderungen an den Konsum von Stutenmilch. Vor über 6000 Jahren dienten Pferde erstmals als Reittiere. Nach der Erfindung von Rad und Wagen machten sie als Zugtiere weite Migrationen möglich. Streitwagen- und Reiterheere brachten großräumige Eroberungen. Domestizierte Pferde verbreiteten sich auf allen Kontinenten und wurden in Religion und Politik zu mächtigen Symbolen. Bis ins 20. Jahrhundert waren Pferde in Stadt und Land omnipräsent. Das Pferdezeitalter ging durch die industrielle Revolution zu Ende, doch dank der jahrtausendealten Prägung werden Pferde auch in Zukunft Partner, Freund und Helfer für die Menschen sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Harald Haarmann
Das Zeitalter der Pferde
Geschichte einer Zähmung von den Anfängen bis zu den Reitervölkern
C.H.BECK
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Motto
Der lange Weg zur Domestizierung
1. Jäger und Pferde in der Steinzeit
Erfahrungen der archaischen Menschen mit Wildpferden
Eiszeitjäger in der arktischen Tundra Europas
Pferdefleisch, ein guter Energiegeber
Die Przewalski-Pferde in der Mongolei
2. Anfänge einer symbiotischen Partnerschaft (ab dem 7. Jahrtausend v.u.Z.)
Wildpferde als Scouts der Hirten
Transhumanz: Voraussetzungen für die Domestizierung
Mensch und Pferd: Sprachhistorische Spuren
Kontakte: Wie kam das ‹Pferd› ins Ostseefinnische?
3. Schrittweise Domestizierung (ab dem 6. Jahrtausend v.u.Z.)
Das Pferd wird zum Reit- und Lasttier der Viehnomaden
Die Überwindung der Laktoseintoleranz: Stutenmilch und Airag
Frühe Ausleseverfahren: Zuchtversuche
Wetteifern der Reiter: Pferderennen
Anfänge der Pferdedressur
Aus Hirten werden Krieger
4. Neue Mobilität: Migrationen und Kriege (ab dem 4. Jahrtausend v.u.Z.)
Die Erfindung von Rad und Wagen: Pferde als Zugtiere
Weiträumige Wanderungen: Zentralasien, Sibirien, China
Südosteuropa: Steppennomaden treffen auf Ackerbauern
Pferde bei der Feld- und Waldarbeit
Kampf und Prunk: Der zweirädrige Streitwagen
Indo-arische Streitwagenleute importieren das Pferd nach Indien
5. Der Weg nach Westasien und Afrika
Wie kamen Pferde nach Anatolien und Mesopotamien?
Pferdezucht und -training bei den Hethitern
Ägyptens Kontakte mit den Hyksos und Mitanni
Ohne Zaumzeug und Sattel: Die numidischen Reiter
Pferde und Zebras in Afrika
6. Symbole, Rituale, Mythen
Pferdeszepter und Pferdeschädel in symbolischen Funktionen
Pferdeopfer bei Kelten, Römern und Indern
Die mächtige Pferdegöttin der Hirtennomaden
Wilde Mischwesen: Die Kentauren
Berittene Amazonen: Mythos und historische Realität
Griechische Schutzpatroninnen: Athene Hippia und Demeter
Rappe und Schimmel in Platons Moralphilosophie
Pegasus und andere berühmte Pferde
7. Höhepunkte des Pferdezeitalters
Reitertrupps und ihre Kampftaktiken
Angriffe aus der Steppe: Hunnen und andere Reitervölker
Die Entstehung des mongolischen Weltreichs
Herrschaft aus dem Sattel und Rittertum
Pferde bei der Eroberung Amerikas durch die Europäer
Cowboys und verwilderte Pferde in Nordamerika
Kulturwandel in Südamerika: Die Lebenswelt der Gauchos
Nachzügler: Die späte Ankunft der Pferde in Australien
Pferde in der technisierten Welt
Bibliographie
Nachweis der Karten und Abbildungen
Register
Zum Buch
Vita
Impressum
Motto
«Wherever man has left his footprints in the long ascent from barbarism to civilization, we find the hoofprint of a horse beside it.»
John Trotwood Moore, 1858–1929
Der lange Weg zur Domestizierung
Die gemeinsame Geschichte von Pferd und Mensch beginnt in den Steppenlandschaften Eurasiens. Zwar gab es auch in Nordamerika seit Langem Wildpferde, aber Menschen gelangten erst nach dem Ende der Eiszeit dorthin. Ihre Erfahrungen mit Wildpferden waren, wenn überhaupt, von kurzer Dauer, denn Pferde sind dort bald danach ausgestorben. Es ist aber bemerkenswert, dass die Evolution der Spezies der Equiden (Equus) vom nördlichen Amerika ihren Ausgang genommen hat. Von dort sind Wildpferde über die Landenge der Beringstraße nach Sibirien hinübergezogen und haben sich bis Europa verbreitet. Pferde gibt es in den Weiten Eurasiens viel länger als Menschen. Die Anfänge ihrer Beziehungen reichen wahrscheinlich bis lange vor die letzte Kaltzeit zurück, nämlich in eine der Warmzeiten des Quartärs vor ca. 300.000 bis 400.000 Jahren.
Seit dem Ende der letzten Kaltzeit vor rund 12.500 Jahren sind Wildpferde für Tausende von Jahren gejagt worden und haben sich zunehmend nach Sibirien zurückgezogen. Es gibt nur ein einziges Rückzugsgebiet, in dem sich heute noch Wildpferde in freier Landschaft bewegen: In der Mongolei leben die Przewalski-Pferde, für die die moderne genetische Forschung ein Genprofil nachgewiesen hat, das von dem der domestizierten Pferdearten signifikant abweicht.
Die Entwicklung des Pferdes von der Jagdbeute zum Partner des Menschen war ein langer, keineswegs geradliniger Prozess, bei dem die räumliche Trennung der gejagten Pferde von den Menschen allmählich aufgehoben wurde und in eine Phase symbiotischer Interaktion überging. Dies ist die Periode der Transhumanz, die das Leben von Viehnomaden in der Steppenlandschaft Osteuropas seit dem 7. Jahrtausend v.u.Z. geprägt hat. Die Nomaden orientierten sich an den Gewohnheiten von Wildpferden, um Wasserstellen und Regionen mit üppigem Grasbestand aufzuspüren.
Die schrittweise Domestizierung erfolgte wahrscheinlich, als sich die Hirten von größeren Herden einen erweiterten Aktionsradius schaffen mussten. Denn es war ihnen nicht möglich, Herden mit vielen Schafen oder Ziegen zu Fuß oder mithilfe von Hunden zu kontrollieren. Die ersten Reiter der Geschichte waren sehr wahrscheinlich Hirten mit einem solchen erweiterten Aktionsbereich. Die Anfänge des Reitens markieren das letzte zentrale Element im Transhumanzprozess, der in die verschiedenen Formen der Domestizierung ausläuft. Frühe Spuren für eine Domestizierung des Pferdes weisen auf die Zeit um 5500v.u.Z. Genetische Untersuchungen von Pferdeknochen haben ergeben, dass sich das Genprofil domestizierter Pferde zuerst in der Steppenlandschaft nördlich des Schwarzen Meeres nachweisen lässt, an der Peripherie der Waldsteppe zwischen Wolga und Dnjepr. Diese Region wird von Archäologen und Sprachwissenschaftlern als die Urheimat der Indoeuropäer identifiziert.
Am Beginn der symbiotischen Beziehung von Mensch und Pferd waren die Tiere auch Lieferanten von Milchprodukten und Fleisch, von Fell und Haar, und sie dienten als Packtiere. Diese zentralen Funktionen erfüllten Pferde lange vor der Erfindung von Rad und Wagen (um 3500v.u.Z.). Über die Kombination von Pferden als Lasttieren und als Zugtieren von Wagen entwickelte sich eine komplexe Partnerschaft von Mensch und Tier.
Von der Steppenlandschaft nördlich des Schwarzen Meeres gelangte das Pferd mit migrierenden Viehnomaden in andere Teile Europas: auf den Balkan, nach Mitteleuropa und in den Westen. In anderer Richtung verbreitete sich das domestizierte Pferd zunächst nach Zentralasien und von dort nach Südsibirien und zu den Mongolen, nach China und weiter nach Ostasien. Ein anderer Weg führte über das iranische Hochland nach Westasien und über Ägypten nach Afrika hinein. Die Einwanderung indoeuropäischer (arischer) Streitwagenleute brachte das Pferd nach Indien.
Auch wenn das «Urpferd», wie eingangs erwähnt, ursprünglich aus Nordamerika stammt: Erst Tausende von Jahren später kamen domestizierte Pferde mit den spanischen Konquistadoren im 16. Jahrhundert nach Südamerika und von dort wieder nach Nordamerika.
Ab dem 4. Jahrtausend v.u.Z. waren Pferde unerlässlicher Bestandteil der bahnbrechenden Erfindung des zweirädrigen Streitwagens. Mit der Umstellung militärischer Strategien auf Reiterverbände verlor diese Kampfmaschine allerdings im Verlauf des 1. Jahrtausends v.u.Z. ihre frühere Bedeutung. Aber Pferde wurden in der Folgezeit sogar noch wichtiger für das Kriegswesen, denn die Kavallerie entwickelte sich zu einem eigenen Teil der Armee. Im Verlauf des Mittelalters entfaltete sich mit dem Pferd als Reittier von Elitekämpfern die Kultur des Rittertums. Mit der industriellen Revolution und der Motorisierung des Transportwesens, der Landwirtschaft und des Militärs verschwanden Pferde zunächst aus den Städten und dann auch vom Land. Doch in manchen Regionen der Welt besteht die friedliche Nutzung des Pferdes bis in die heutige Zeit fort.
Dieses Buch schlägt einen großen Bogen. Es beschreibt die Anfänge der Zähmung und Domestizierung von Wildpferden, die vielfältigen Funktionen des Pferdes in der Weidewirtschaft der Steppennomaden – als Herdentier, Milch- und Fleischlieferant, Reit- und Lasttier –, die Leistungen von Pferden beim Ziehen von Wagen, bei der Feldarbeit, im militärischen Einsatz mit seinen weitreichenden politischen Folgen sowie ihren Platz in uralten mythischen Vorstellungen. Das Buch konzentriert sich auf die ersten, entscheidenden Jahrtausende des Pferdezeitalters und beleuchtet einige seiner Höhepunkte in späterer Zeit. Am Schluss stehen Ausblicke auf das relativ schnelle Ende einer menschheitsgeschichtlichen Schlüsselepoche. Aber auch danach spielen Pferde selbst in den Industriegesellschaften eine wichtige Rolle. Im Reitsport und in der Liebe vieler Menschen zu Pferden lebt die jahrtausendealte Beziehung fort. Und für viele ist es die größte Freude zu sehen, dass aus domestizierten Pferden in Amerika, Australien, Asien und Europa – etwa in der Camargue – wieder Tiere in freier Wildbahn geworden sind.
1.
Jäger und Pferde in der Steinzeit
Menschen und Pferde gingen in ihren Evolutionsgeschichten getrennte Wege. Die Ausgliederung von Equiden einerseits und Hominiden andererseits aus dem Stammbaum der Säugetiere erfolgte nicht nur zu verschiedenen Zeiten und von verschiedenen «Ästen», sondern auch in voneinander getrennten Teilen der Welt. Der Ursprung der Hominiden wird im südlichen Afrika vor rund 7 Millionen Jahren angesetzt. Die Anfänge der Entstehung von Wildpferden werden auf eine Zeit vor 62 Millionen Jahren datiert, die ältesten fossilen Funde stammen aus Amerika (MacFadden 2005).
Der Begriff Wildpferd umfasst ein breit gefächertes Spektrum verschiedener Arten und Unterarten. Die älteste Art von Wildpferd war das Urpferd (Eohippus, aus griech. eos ‹selbst› + griech./latinisiert hippus ‹Pferd›, also eigentlich ‹[erste] selbständige Pferdeart›), das eher wie ein Fuchs aussah und auch ungefähr dessen Größe hatte. Die Schulterhöhe betrug nur 25–30 Zentimeter. Eohippus unterschied sich von späteren Pferdearten auch dadurch, dass es ungleiche Hufe hatte (vier Zehen an den Vorderbeinen und drei Zehen an den Hinterbeinen). Diese ältesten Wildpferde ernährten sich von Laub und Früchten. Das Wildpferd vor rund 40 Millionen Jahren, Mesohippus (aus mesos ‹mittleres› + hippus), war ungefähr doppelt so groß, mit einer Schulterhöhe von ca. 60 Zentimetern.
Das «moderne» Wildpferd (die Spezies des Equus ferus) hat sich vor ca. 3,5 Millionen Jahren in Nordamerika ausgebildet (Orlando et al. 2008). Etwa 2,5 Millionen Jahre vor der Jetztzeit hat sich diese Spezies in andere Teile der Welt verbreitet und sich in regionale Arten ausgegliedert. Vom Equus ferus stammen alle heute existierenden Pferderassen ab. Die Urspezies verbreitete sich über die Bering-Landbrücke, die die längste Zeit eine für Tiere passierbare Tiefebene war, nach Sibirien und von dort nach Europa hinein (Salesa et al. 2004), von Nordamerika nach Südamerika über die Meerenge von Panama, und von Sibirien aus weiter nach Asien und von dort in den Nahen Osten und nach Afrika. Aus der Zeit des mittleren Pleistozän (ca. 0,7–0,1 Millionen Jahren vor der Jetztzeit) gibt es bereits Funde aus allen Weltteilen. Damals entstand eine besondere regionale Variante: das Zebra in Afrika.
Die Evolutionsgeschichte des Wildpferdes begann vor rund 60 Millionen Jahren mit dem nur fuchsgroßen Eohippus (links). Vor rund 3,5 Millionen Jahren entwickelte sich die Spezies Equus ferus, von der alle heutigen Pferderassen abstammen. Das Przewalski-Pferd, Equus ferus przewalskii (rechts), mit einer Schulterhöhe von 120–140 Zentimetern gliederte sich vor etwa 74.000 Jahren aus und ist die einzige noch existierende Wildpferdart.
Wie sich aus der Vorstufe des modernen Wildpferdes die heute bekannten Varianten des domestizierten Pferdes (Hauspferd: Equus ferus caballus) ausgebildet haben, wird schon seit vielen Jahren intensiv erforscht (Librado et al. 2021). Möglicherweise ist die Domestizierung in verschiedenen Regionen, unabhängig voneinander, erfolgt, was die Entstehung individueller regionaler Pferdearten erklären würde. Allerdings weisen die ältesten datierten Funde auf die Steppenregion Eurasiens im östlichen Teil Europas hin.
Als Folge der Domestizierung von Wildpferden bildeten sich die heutigen Hauspferdarten aus, die sich auf einige regionale Grundtypen zurückführen lassen:
Verbreitungsgebiet
Besonderheiten
Typ 1: Nordpony
Nordwesteuropa
Dieser Typ hatte bereits eine Schulterhöhe von ca. 120 Zentimetern und war an ein feuchtkaltes Klima angepasst.
Typ 2: Tundrenpony
südliches Russland, Zentralasien, westliches China, Iran
Typ 3: Ramskopfpferd
Zentralasien
Für diesen Typ soll ein ausgeprägtes Revierverhalten charakteristisch sein.
Typ 4: Steppenpferd
südliches Asien, Mittlerer und Naher Osten, Ägypten
Erfahrungen der archaischen Menschen mit Wildpferden
Schon seit Urzeiten sind Menschen mit den Lebensgewohnheiten von Pferden vertraut. In der Chauvet-Höhle in Südfrankreich, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, findet man die älteste visuelle Dokumentation aus dem Kontaktmilieu von Mensch und Pferd. Diese Sammlung von Höhlenmalereien geht auf die Zeit um 35.000v.u.Z. zurück. Wahrscheinlich gehörten auch Pferde zu den Tieren, die von den Menschen der Altsteinzeit gejagt wurden, denn sie hatten wirkungsvolle Jagdwaffen (Speere). Die damaligen Menschen waren Vertreter unserer Spezies. Der moderne Mensch hat Europa auf seiner Migration aus dem afrikanischen Süden vor rund 45.000 Jahren erreicht. Die Jagd auf Wildpferde ist erst sehr viel später bezeugt.
Aber lange vor dem modernen Menschen haben Menschenspezies in Europa gelebt, wie der Neandertaler und der Homo erectus (Beaver 2019). Die Annahme liegt nahe, dass auch diese Menschenspezies bereits Pferde jagten. Allerdings gibt es keinen archäologischen Nachweis dafür. Doch es gibt eine spektakuläre Ausnahme, die den Schluss zulässt, dass Menschen bereits in weit zurückliegenden Zeitaltern Jagd auf Pferde machten: der Fund uralter Speere. Diese ältesten Jagdwaffen der Welt stammen aus einer Periode vor ca. 320.000 Jahren (Thieme 2007).
Das war das Zeitalter einer Menschenspezies, die noch vor dem modernen Menschen (Homo sapiens sapiens) und noch vor dem archaischen Menschen (Homo sapiens) rangiert: der «Heidelberger Mensch», benannt nach dem Fundort der ältesten Knochenreste. Die damaligen Hominiden machten Jagd auf Wildpferde, und die Speere sind bei einem Jägerlager und auf einer Art Abfallhalde mit Pferdeknochen in der Gegend von Schöningen gefunden worden.
Die klimatischen Bedingungen des damaligen Lebensmilieus waren gemäßigt warm. Das Szenario der durch die Funde dokumentierten Jagderfahrungen damaliger Menschen datiert in eine Wärmeperiode zwischen Kaltzeiten. In der Klimageschichte hat es immer Fluktuationen zwischen Kalt- und Warmzeiten gegeben. In Europa lassen sich in den Bodenschichten Zyklen von fünf Kaltzeiten nachweisen, zwischen denen Wärmeperioden lagen. Das Zeitfenster für die prähistorischen Jäger aus der Region von Schöningen lässt sich grob so darstellen: Ende der Elstereiszeit: vor ca. 350.000 Jahren – Interglaziale Periode der Reinsdorf-Warmzeit – Anfang der Saale-Riß-Kaltzeit: vor ca. 300.000 Jahren.
Die Entdeckung des Jägerlagers aus der Zeit des Homo heidelbergensis war ein Zufallsfund. Als im Tagebaubetrieb bei Schöningen in den 1990er Jahren weiteres Gelände für die Braunkohlegewinnung erschlossen wurde, verfolgten Archäologen die Aktion des riesigen Schaufelradbaggers, der die Erdkruste viele Meter tief aufriss. An einer Stelle ließen sie den Betrieb des Baggers unterbrechen, denn es wurden Knochenreste freigelegt. Das war in einer Tiefe von ungefähr 10 Metern.
Was dann ans Licht kam, war eine Sensation: mehr als tausend Steinwerkzeuge, acht vollständig erhaltene Speere mit einer Länge zwischen 1,80 und 2,50 Metern sowie Gerätschaften aus Holz. Das Material war im Laufe der Zeit nicht verfault oder morsch geworden und zerbröselt. Denn die Fundstelle lag früher am Ufer eines prähistorischen Sees, und die Artefakte waren vom Schlamm überdeckt worden. Auf diese Weise wurde die Fundschicht luftdicht verschlossen, und dieser Zustand hielt sich bis zur Entdeckung unserer Tage. Die Sedimentschicht enthielt auch Pflanzenreste wie Samen und Pollen sowie zahlreiche Tierknochen: von Wildpferden, Auerochsen, Wollnashörnern, Hirschen und Wölfen. Die organischen Reste wurden im Labor datiert und ergaben das sensationelle Alter von ca. 320.000 Jahren – ein einmaliger Fund!
Von den Tausenden von freigelegten Tierknochen waren rund 90 Prozent solche von Wildpferden, und zwar der damals in Mitteleuropa verbreiteten Spezies Equus mosbachensis. Der Bestand an Knochen ließ auf zwanzig bis fünfundzwanzig Tiere schließen. Der Kontext der Funde wies eindeutig auf ein Jägerlager der Frühmenschen hin. Das Nahrungsangebot (mit einem geschätzten Gesamtgewicht von rund 4 Tonnen) für eine Jägergemeinschaft von vermutlich dreißig Personen reichte aus für etwa zwei Monate. Unter den Pferdeknochen waren auch solche von Jungpferden, was darauf hindeutet, dass die Jagdzüge im Herbst erfolgten, als die im Frühjahr geborenen Tiere bereits herangewachsen waren.
Um Pferde, die sich im Galopp bewegen, zu erlegen, bedarf es einer effizienten Jagdwaffe, und die Schöninger Speere zeigen deutlich, dass der Heidelberger Mensch fähig war, physikalische Zusammenhänge zu begreifen. Für die Anfertigung eines funktionsfähigen Speers ist technisches Know-how erforderlich, denn um eine günstige Flugbahn zu garantieren, muss der Speer vorne schwerer sein als hinten, und er muss aus stabilem, nicht zu leichtem Holz hergestellt sein, damit die Jagdwaffe nicht durch Windströmungen von ihrer intendierten Flugbahn abdriftet. Wichtig ist nicht nur die Treffsicherheit, die ein Jäger durch Wurferfahrung erreichen kann, sondern auch die Fähigkeit der Waffe, beim Auftreffen auf das gejagte Tier in dessen Körper einzudringen. Das macht eine harte Spitze erforderlich, und eine solche erreichten die Jäger von Schöningen dadurch, dass sie die Speerspitzen im Feuer härteten.
Dies wiederum beweist, dass die Menschen von damals das Feuer kontrollieren konnten und dass in ihrem Lager bei der Speerherstellung eine Feuerstelle zur Verfügung stand. Was die technische Entwicklung von Frühmenschen betrifft, so ist gesichert, dass bereits die Spezies des aufrecht gehenden Menschen (Homo erectus) das Feuer beherrschte, und zwar vor mindestens einer halben Million Jahren, wenn nicht schon länger.
Die Fundstelle des Jägerlagers aus der Frühgeschichte des Menschen umgibt auch ein Geheimnis. Wenn wir als moderne Beobachter versuchen, die Speerfunde in den Kontext der damaligen Lebenswelt einzuordnen, dann drängen sich vielerlei Fragen auf, für die es keine leichten Antworten gibt:
Warum haben die Jäger so viele intakte Speere, insgesamt acht an der Zahl, zurückgelassen, wo doch diese Jagdwaffen die wichtigsten Utensilien für eine erfolgreiche Nahrungsversorgung der Gemeinschaft waren? So wie ein Schmied nicht seinen Hammer zurücklässt, wenn er seinen Werkplatz verlässt, um woanders weiterzuarbeiten, so lässt ein Jäger nicht einfach seine vertraute Jagdwaffe zurück, wenn er weiterzieht.
Warum liegen die Speere sorgsam platziert an einem Ort, wo auch Pferdeschädel liegen, und zwar abseits vom Hauptplatz des Jägerlagers? Das heißt, dass die Assoziation von Schädeln mit Jagdwaffen nicht zufällig war, sondern von den Jägern beabsichtigt.
Warum waren die Pferdeschädel von den Jägern nicht aufgebrochen worden wie andere Tierknochen, um an das nahrhafte Knochenmark zu kommen? Die Komposition von Jagdwaffe und dem intakten Schädelknochen des gejagten Tieres war offensichtlich für die damaligen Menschen von besonderer Bedeutung.
Die Platzierung intakter Pferdeschädel an ausgewählten Orten ist eine Tradition, die sich bis heute erhalten hat, und zwar in der Mongolei. Dort gibt es Orte, wo Pferdeschädel deponiert werden, und es ist bekannt, dass sich mit dieser Sitte bestimmte Vorstellungen von der innigen Zusammengehörigkeit der beiden Lebensformen verbinden: des Menschen und desjenigen Tieres, das so viele seiner Lebensbereiche prägt, des Pferdes.
Es ist anzunehmen, dass schon die archaischen Menschen Imaginationen von sich selbst in Relation zu anderen Lebewesen ihrer Umwelt entwickelten. Somit besaßen sie die Fähigkeit zu abstraktem Denken – über die konkreten Realitäten hinaus bis in eine höhere, spirituelle Ebene. Die Annahme, dass es solche spirituellen Vorstellungen gegeben hat, ist «eine wichtige Voraussetzung, um die kulturellen Ausdrucksformen, die Religiosität, das damit offenbar im Wechselverhältnis stehende soziale und wirtschaftliche Verhalten prähistorischer Menschen und ihre Auseinandersetzung mit der jeweiligen Umwelt halbwegs zutreffend beurteilen zu können» (Reichstein 2005: 66).