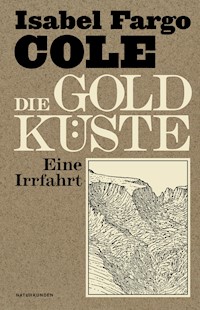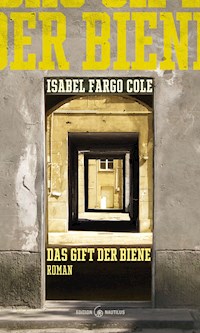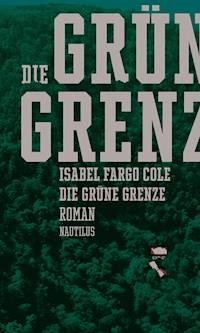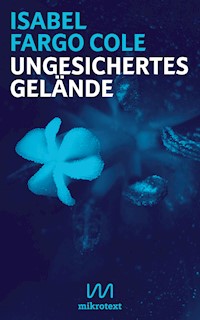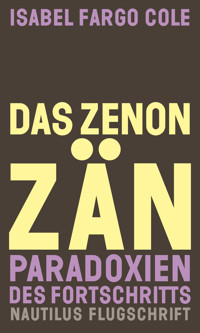
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Nautilus Flugschrift
- Sprache: Deutsch
Eine Läuferin steht in den Startlöchern bereit. Doch um ins Ziel zu kommen, muss sie zunächst die Hälfte der Strecke schaffen, und dafür wiederum die Hälfte der Hälfte … Wenn sie für jede Hälfte eine bestimmte Zeit benötigt und sich die Strecke unendlich oft halbieren lässt, ist dann auch das Rennen ein unendliches? Soll sie überhaupt loslaufen? Heute ist klar, dass dem Paradoxon des Zenon von Elea ein Fehlschluss zugrundeliegt – und doch ist gerade für dieses Heute einiges an Wahrheit darin aufgehoben. Die ständige Teilung der Gesellschaft in immer kleinere Identitäten und Bubbles, das technologische Sprinten ohne echten Fortschritt, ohne Vorwärtskommen. Leben wir vielleicht im Zenonzän? Mit einem aufmerksamen Interesse für die großen Fragen, die über unserer Gegenwart schweben, und einem emphatischen Blick für kleine und randständige Tendenzen schreibt Isabel Fargo Cole über Sprache und Wortmaschinen der Künstlichen Intelligenz, über Postwachstum und Schöpfungsgeschichte, über den Stillstand der Lockdowns, Überwachung, linken (und rechten) Technikoptimismus und die Arbeit des Übersetzens. Sie weist auf manch erschreckende Bruchkante im stabil geglaubten Fundament unseres Weltbilds hin, findet aber auch verblüffend schöne, funkelnde Einschlüsse im Gestein des Zenonzäns. »Leise im Ton und bestimmt in der Sache erschließen die Essays von Isabel Fargo Cole das Gelände einer Gegenwart, in welcher der beschleunigte Takt von Krisen und Katastrophen mit dem Horizont einer aufgezehrten Zukunft verschmilzt und sich im Eindruck eines ›stehenden Sturmlaufs‹ (Franz Kafka) verdichtet. Diese scharfsinnigen Exkursionen in ein Deutschland der letzten dreißig Jahre durchqueren eine thematische Vielfalt, die von vergessenen Utopien über die Zumutungen des digitalen Kapitalismus bis hin zu überraschenden literarischen Begegnungen reicht. Dabei erweisen sich die Texte dieses Bands als Essays oder Versuche im besten Sinn: Sie halten die Spannung zwischen Genauigkeit und Leidenschaft, Theorie und Erfahrung, Analyse und Intuition und formieren mit der Erinnerung an uneingelöste Möglichkeiten der Geschichte einen Widerstand gegen die Versteinerung politischer Einbildungskraft.« Joseph Vogl »Vielleicht beschreibt man diese Schriftstellerin am besten als eine Art Ethnologin, die sich in denkbar größter Intensität dem eigentlich Fremden annähert. Mit einer unbändigen Neugier will sie erkunden, die Fakten, die Sprache, die Geschichte, die Seelen und die Schicksale mit ihrem tauchenden Blick erkennen.« Alexander Cammann, Laudatio zum Literaturpreis der A und A Kulturstiftung
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ISABEL FARGO COLE, (*1973 in Galena, Illinois), Autorin und Übersetzerin, lebt seit 1995 in Berlin. Ihr Debütroman Die grüne Grenze (2017) war für den Preis der Leipziger Buchmesse und den Klaus-Michael Kühne-Preis nominiert. 2018 erhielt sie den Helen & Kurt Wolff Übersetzerpreis für ihre Übersetzung von Wolfgang Hilbigs Alte Abdeckerei ins Englische. 2019 erschien Das Gift der Biene (Edition Nautilus), 2022 Die Goldküste. Eine Irrfahrt (Matthes & Seitz). 2023 wurde ihr der Literaturpreis der A und A Kulturstiftung verliehen.
Edition Nautilus GmbH
Schützenstraße 49 a
22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de
Alle Rechte vorbehalten, ausdrücklich auch die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG
© Edition Nautilus 2025
Deutsche Erstausgabe September 2025
Umschlaggestaltung: Maja Bechert
www.majabechert.de
Satz: Corinna Theis-Hammad
www.cth-buchdesign.de
Porträt der Autorin
auf Seite 2: © Sven Gatter
1. Auflage
ePub ISBN 978-3-96054-491-3
Inhalt
Legenden des Wachstums
Zwischen Gestern und Morgen
Postwachstumsutopien
Die Übersetzbarkeit der Überwachung
Zu Wolfgang Hilbigs Roman »Ich«
Im Spiegelsaal der Aufklärung
Verschüttete Portale
Die 1990er
Das Jubeljahr
Annäherungen im ersten Corona-Sommer
Das Zenonzän
Wachträume
Die falsche Maria
Die Ikonografie der KI
Maschinenwörter, Wortmaschinen
Gedankenarbeit im Keller der KI
Frau C. versteht die Welt nicht mehr
Generationskram
Rube-Goldberg-Variationen
Erstveröffentlichungsnachweise und zitierte Texte
Um den trägen Zustand zu überblenden, erzählen mir alle Apparate ständig Geschichten vom schnellen Leben.
Hans-ChristianDany, Schneller als die Sonne. Aus dem rasenden Stillstand in eine unbekannte Zukunft, 2015
Legenden des Wachstums
Das beunruhigendste Phänomen, mit dem sich die politische Theorie […] konfrontiert sah, war der noch heute anhaltende, aber bis dahin unbekannte Prozeß eines wachsenden Reichtums, wachsenden Besitzes, wachsenden Erwerbs. […] Dabei lag es vom Anfang an nahe, diese Prozesse im Sinne natürlicher Prozesse zu sehen […]. (Hannah Arendt, Vita Activa)
Wachstum, der göttliche Urwille: Es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, das sich besame, und fruchtbare Bäume, da ein jeglicher nach seiner Art Frucht trage und habe seinen eigenen Samen bei sich selbst. Bestimmung der Pflanze als Werkzeug der eigenen Fortpflanzung, Bestimmung der Frucht als Gefäß der eigenen Fruchtbarkeit. Nichts ist – alles wird, es wird mehr. Es werde … es sammle sich … es lasse aufgehen … es errege sich – die Befehle richten sich an ein rätselhaftes Es, das alles und nichts ist. Sie führen sich selbst aus.
Mehrt euch, sagt Gott zu den Tieren. SEIN Befehl gilt nun einem konkreten Gegenüber, denn Tiere haben Ohren, um zu hören – dafür keinen eigenen Samen bei sich selbst wie die fest verwurzelten Bäume. Die Tiere müssen tätig werden, sie müssen zueinanderfinden. Und das tun sie: Es webt und lebt und kreucht und fleucht. Alles ist sich selbst genug und könnte ewig so fortweben. Da aber – als fände ER, dass alles allzu rund läuft, als fehle IHM an diesem autonomen Kreislauf der Reiz, der produktive Störfaktor, das IHM-Gleiche, das Bewusstsein – schafft Gott Mann und Frau hinzu, um zu herrschen über alles Getier, das auf Erden kriecht. Was für widersprüchliche Befehle. Füllt die Erde – als wäre die vorhandene Fülle nichts weiter als zu füllende Leere. Und macht sie euch untertan – als wäre die nichtmenschliche Fülle dann doch nicht zu leugnen, und deshalb zu bezwingen.
Replenish the earth, and subdue it: Der Befehl in der King-James-Bibel ist auf andere Weise schillernd. Replenish heißt wieder füllen – also: Teil eines Kreislaufs sein, ihn erhalten, fortführen, steigern? Subdue wiederum klingt nach Bändigung, nach der Drosselung physischer Kräfte. Als müsste der Mensch all das Wachstum der Erde steuern und erneuern – doch zugleich ihr Wuchern unterdrücken.
Ich habe euch gegeben allerlei Kraut, das sich besamt […] und allerlei fruchtbare Bäume, die sich besamen. In der King-James-Bibel: every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed. Seltsam, wie Gott den hilflosen neuen Menschlein mit diesen Worten vor Augen führt, wie unerschöpflich vital alles bereits Bestehende ist, wie es ganz ohne ihr Zutun sich selbst besamt. Baum zeugt Obst und Obst Samen und Same Baum ad infinitum … Ob es Adam und Eva da schwindelte?
Grund dazu hätten sie. Denn hier geht ein Ruck durch den Text. Ihr Kapitel bricht ab, mitten in der Idylle – es war sehr gut. Als wäre es zu gut, wieder einmal zu rund, Mann und Frau sich allzu gleich, allzu ähnlich den Tierpaaren, deren lange Reihe sie abschließen. Wie zufällig stehen sie am Ende der Schöpfung und sollen über alles herrschen, was doch auch ohne sie vollendet und autark ist. Als wäre der sich selbst aussäende Same Keim eines Zweifels, der Gott in der Nacht befällt: Wo kämen wir hin, bei solcher Harmonie? So dreht sich die Geschichte nur im Kreise!
Gott verwirft das Menschenpaar, die Tiere und die Pflanzen, die Schöpfungsgeschichte setzt neu an. Und allerlei Bäume auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und allerlei Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Die im ersten Anlauf so unbändig sprießenden Pflanzen schweben nun in einem rätselhaften noch nicht. Im paradoxen before: And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew. Noch stecken sie nicht in der Erde, noch steckt nichts in ihnen (der Baum in der Frucht im eigenen Samen); das Wachsen, selbst die Möglichkeit des Wachsens steht diesen nur als Idee vorhandenen Pflanzen noch bevor. Denn Gott der HERR hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und es war kein Mensch, der das Land baute.
Aus der kahlen Erde schafft Gott nun einen Menschen, der allein dasteht, ganz allein das Land bebauen muss, den Stoff, dem er gerade erst entsprungen ist, den Staub, zu dem er zurückkehren wird. Gott gesellt ihm als Erstes die Bäume bei, unter ihnen der Baum der Erkenntnis, von dem er nicht essen darf, sonst muss er des Todes sterben. Jetzt scheint der Mensch Gott doch noch leidzutun – wie auch nicht, so dieser unverdienten Drohung ausgeliefert? ER sieht ein, dass der Mensch eine Gehilfin braucht. Zunächst denkt ER an Tiere, brachte sie zu dem Menschen, daß er sähe, wie er sie nenne, genauso, wie Gott Tag und Nacht und Erde und Meer nannte. Der Mensch darf Gott spielen, Entschädigung für die ihm eingejagte Todesangst. Er gibt den Tieren ihre Namen, aber kein Tier kann ihm helfen, genauso wenig, wie er Gott hätte helfen können. Da erbarmt sich Gott seiner erneut und schafft dem Menschen Seinesgleichen – nicht gleich, aber seins – aus ihm selbst heraus, pflanzt ihn fort wie einen Obstbaum, dem man ein Reis abnimmt. Und er nahm seiner Rippen eine und schloß die Stätte zu mit Fleisch. Und Gott der HERR baute ein Weib aus der Rippe, die er vom Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Und der Mensch nennt sich Mann und Männin.
Mehrt euch!, sagt Gott zu den Menschen. Sie haben nicht nur Ohren, um zu hören, sondern einen Willen, um sich zu weigern. Schließlich sollst du mit Schmerzen Kinder gebären und im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Gott muss die Menschen ermahnen und ermuntern: Ich will deinen Samen machen wie den Staub auf Erden. Doch diese massenhafte, beliebige Besamung kann dem Menschen niemals ganz behagen. Gleicht der Same doch dem Staub, zu dem er zurückkehren muss. So steht der Auftrag der Fortpflanzung für Gottes Geschenk, das Leben, aber auch für Gottes Strafe, den Tod. Die Menschen, die sich auf Erden zu mehren beginnen, wachsen gar zu Riesen, deren Bosheit im nächsten Vers als zwingende Folge des unbändigen Wachstums beklagt wird, welches Gott nun bereut und bestraft. ER schickt die Sintflut. Von jeder Tierart verschont ER ein exemplarisches Paar, von der Menschheit immerhin eine ganze Kleinfamilie.
So geht es doch noch einmal los mit dem exponentiellen Wachstum – mittels Inzucht, wie schon nach Adam und Eva. Wurzelt darin das Unbehagen an der Mehrung des Fleisches? Im Verdacht nämlich, was sich hier mehre, sei das Immergleiche, was heranwachse, sei ein Zuviel der Selbstähnlichkeit, was sich als Fruchtbarkeit ausgebe, sei ins Sterile ausartende Replikation. Bald wuchert auch das Geld, dessen abstrakte Vermehrung die Massen versklavt. Die Menschheit ballt sich in Marktflecken, Handelszentren. Sodom und Gomorrha: Mann erkennt Mann, trotzt dem Fruchtbarkeitsimperativ. Das kann Gott nicht ungestraft lassen. Die Massen, die die Fortpflanzung infrage stellen, werden hinweggerafft. Schwefel und Feuer bricht herein über die zu vielen, die nicht noch mehr werden wollen. Doch Lot, der aus Sodom in die menschenleeren Berge flüchtet, wird dort von den eigenen Töchtern verführt: Da sprach die ältere zu der jüngeren: Unser Vater ist alt, und ist kein Mann mehr auf Erden, der zu uns eingehen möge nach aller Welt Weise; so komm, laß uns unserm Vater Wein zu trinken geben und bei ihm schlafen, daß wir Samen von unserm Vater erhalten.
2500 Jahre nach der Sintflut ist die Erde schon wieder zersiedelt, aufgeteilt zwischen Imperien mit ihren Prachtstädten. Keine generative Notlösung, weder Aufpfropfung noch Inzucht wäre nun nötig. Doch wieder einmal hängt das – nun rein seelische – Heil der Menschenmassen von einer Familie ab, die vom gottgegebenen Fortpflanzungsschema abweicht. Maria – Josef – Jesus: eine Familieneinheit von solch exzessiver Keuschheit, als müsste sie all das unlautere Begehren der Vorfahren wiedergutmachen. Parthenogenese im Himmel, Parthenogenese im Bauch. Die Gottheit spaltet sich auf, die Jungfrau kommt zum Kinde. Ein Junge, der niemals eine Frau erkennen soll – ER, der Allwissende, bedarf schließlich dieser menschlichen Erfahrung nicht. In früheren Epochen nahmen die Götter Menschengestalt an, um der Fleischeslust zu frönen, ihren Samen auf Erden zu säen. Dieser dagegen: um zu lieben, zu leiden, das Wort zu verbreiten. Die alte Praxis der Askese, seit jeher eine Annäherung der Menschen ans Göttliche, bestimmt die Annäherung Gottes ans Menschliche.
Das Geschöpf, das der Welt entsagte, tat es nun seinem Schöpfer gleich. Eremiten zogen in die Wüste, lebten in Höhlen oder auf Säulen, ernährten sich von Brot und Wasser oder jahrelang von gar nichts. Es galt, sich der Wildnis schutzlos auszuliefern, so wie Jesus es getan hatte. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, daß diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben »Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.«
Wer mit knurrendem Magen in die Wüste aufbricht, stellt sich der teuflischen Versuchung, das leere Innen und Außen zu füllen, den Sinnesentzug mit Sinnlichkeit aufzuheben. Der Heilige Antonius muss erotischen Anfechtungen standhalten. Jesus verzichtet selbst auf Brot zugunsten des Wortes, welches allein die Wüste füllen soll. Mit Sinn statt mit Sinnlichkeit. Jeder Stein ein Wort wie das Wort vom Anfang. Die asketische Abkehr von der Welt ist die paradoxe Einkehr in die ursprünglichste Schöpfung, die noch in der Schwebe scheint, als wäre Gut noch nicht von Böse geschieden. Wirrnis, der man sich stumm aussetzt, die man mit keinem Wort für gut und schön befindet. Diese Schöpfung blickt zurück mit der Fratze des Versuchers.
Heute zieht es uns dorthin, wo die Einsiedler in Zellen oder Höhlen kauerten oder sich gar einmauern ließen. Hier suchen und finden wir erhabene Schönheit. Sie kann die Damaligen doch nicht unberührt gelassen haben! In den Pyrenäen schlief ein gewisser St. Savin jede Nacht im eigenen Grab – das allerdings eine spektakuläre Aussicht in die Vallée des Gaves bot. Heute steht dort eine Kapelle als Ausflugsziel. Haben die Eremiten die Schönheit zu tief empfunden? Als teuflische Versuchung, der sie eingemauert widerstehen wollten? Oder waren sie trotz allem schöpfungsverliebt? Mauerten, gruben sie sich in die Schönheit der Welt ein – einem Paradies entgegen, das sie in der unberührten Natur aufschimmern sahen?
So sehr bewundert wurden damals diese göttlichen Hungerkünstler, dass sie Pilger und Nachahmer anzogen; die Menschen, vor denen sie flüchteten, scharten sich aufs Neue um sie. Denkbar, dass die Eremiten sich zuerst erzürnten, erbittert ihre Sachen packten, um noch tiefer in den Wald zu ziehen – dann aber, milder gestimmt durch menschliche Anerkennung, ihre Misanthropie revidierten. Nicht der Mensch an sich ist mir zuwider, mag der Eremit gedacht haben, sondern der Mensch, wie ihn die korrupte Gesellschaft zu sein zwingt. Nicht vor den Menschen bin ich geflohen, sondern vor ihrer Ordnung – nun flüchten sie zu mir, und ich habe die einmalige Gelegenheit, eine neue, eine brüderliche Ordnung aufzubauen. Eine Ordnung der Askese, fortgesetzt nicht durch fleischliche Mehrung, sondern durch reine Überzeugung.
Zur selben Zeit zeugten die Kirchenväter die Kirche, die jungfräuliche Braut Ecclesia, Gefäß des Wortes, welches Johannes an den Anfang der Schöpfungsgeschichte setzte. Das Wort, das Gott war und zum Fleisch wurde. Das Wort, nunmehr Same, galt es auszusäen, um eine endgültige Wahrheit zu verbreiten, die Endgültigkeit schlechthin, das glückliche Ende. Propaganda – so nannte Ecclesia ihre rein geistige Fortpflanzung. Der Reproduktionsprozess fand in den Skriptorien der Klöster statt: Tausende Mönche schrieben abertausendmal das Buch der Bücher ab.
Hier gedieh nicht nur die Schrift. Die klösterliche Ordnung nahm auf, wer in der weltlichen Gesellschaft überflüssig war: politisch Unliebsame, wirtschaftlich nicht Verwertbare, unmannbare Frauen, enttäuschte Liebhaber, den Überschuss an Söhnen und Töchtern. Dort, wo Ressourcenkampf herrschte, wurden sie aus dem Verkehr gezogen und einem geschlossenen Kreislauf zugeführt, dessen geballte Energien in die Umgestaltung der Natur flossen. Um am unwirtlichen Ort zu bestehen, ja immer weiter in die Öde und Leere hineinzuwachsen, muss eine Gemeinschaft nicht nur gerecht und rein im Geiste sein, sondern außerordentlich leistungsfähig. Sie muss Wälder und Wüsten in Gärten verwandeln.
Ein einzelner Asketiker im mystischen Rausch kann Entbehrung und Selbstkasteiung bis zum bitteren Ende treiben – eine ganze asketische Gemeinschaft aber muss für den eigenen Fortbestand sorgen. Schon aus Überlebensgründen mussten die Mönche sumpfige Täler trockenlegen, Bergbäche begradigen, den Wald roden und seinen Boden urbar machen. Zugleich, in einem sekundären Schöpfungsakt, bauten sie Eden nach: der Garten im Kreuzgang, einer Waldlichtung nachempfunden. Ein ideales Quadrat Grün mit einem Brunnen in der Mitte, geschützt durch vier Säulenreihen wie abstrahierte Bäume, deren Kronen vor Fabeltieren wimmeln. Um diesen Garten baute man im Kleinen eine Stadt – einen Staat – als keusche, quasi prälapsarische Ordnung. Männer unter sich, Frauen unter sich, als wären Adam und Eva getrennte Wege gegangen, um sich nach rein pflanzlichen Methoden in Selbstähnlichkeit weiter zu reproduzieren. Friedlicher Separatismus als Lösung. Gerade Frauen bot das Klosterleben Zuflucht, Befreiung von Ehe- und Geburtenzwang, Möglichkeiten der Selbstverwaltung und -entfaltung und eine oft beträchtliche Machtsphäre.
Kein Wunder, wenn in den Wirren des Mittelalters das Kloster immense Strahlkraft besaß. Die Architektur gewordene himmlische Vision war hier auf Erden lebbar. Zwar nicht als freies, schon gar nicht freizügiges Wandeln und Früchtepflücken in paradiesischen Gefilden, sondern als strenge Disziplin, als Reglementierung von Zeit, Raum und Arbeit. Ora et labora. Ora: Feste Gebetszeiten ziehen sich durch Tag und Nacht, richten den menschlichen Sinn auf Gott, binden die Einzelnen zum Kollektiv mit höherem Ziel zusammen. Und mit dem Läuten der Klosterglocke legt sich das Gefüge der Stunden über die Landschaft, die Zeitläufte werden begradigt wie die Flüsse. In vierundzwanzig Stunden erlebt man einen ganzen Gebetszyklus und zugleich einen vollen Arbeitstag, Diesseits und Jenseits genauestens verzahnt. Labora: Auch die Arbeit ist geweiht.
Bruder Thiethmar schritt hinein in den Wald … Auch ich als Atheistin gehe bei den Mönchen gern ein Stück weit mit. Auch als ich über ein atheistisches Land schrieb, über die DDR, in meinem Roman Die grüne Grenze, ließ ich einen im Harzer Grenzgebiet lebenden Schriftsteller anhand einer erdachten Mönchsfigur in die Geschichte tauchen. Mein fiktiver DDR-Kollege will von einem Mönch erzählen, der vom Benediktinerkloster Ilsenburg im Ostharz zum Zisterzienserkloster Walkenried im Westharz aufbricht. Der Mönch – er heißt mal Thietmar, mal Tilo, mal Talimil – muss dabei den Urwald durchqueren, aber auch die Grenze, die im 20. Jahrhundert die kapitalistische Ordnung von der sozialistischen trennte. Doch wie im berühmten Paradoxon des Zenon rückt mit jedem Schritt das Ziel in eine unerreichbare Ferne, die Spur des Bruder T. verliert sich im Wald. In immer neuen Romanentwürfen setzt mein Kollege in verschiedenen Epochen an, in denen immer neue Systemkonflikte entlang dieses Grenzgangs abgehandelt werden. Mönchsorden und Gesellschaftsordnungen im Auf- oder Abstieg stehen in stets wechselnder Beziehung zueinander. Die Frage, was es bedeutet, in eine bessere Ordnung unterwegs zu sein, ist niemals endgültig zu beantworten. Schließlich wohnte schon den Mönchsorden eine paradoxe Dynamik inne. Denn [j]e mehr sich der klösterliche Kommunismus bewährte und befestigte, so Karl Kautsky,
desto mehr mußte der Reichtum des Klosters wachsen. Der klösterliche Großbetrieb lieferte bald die besten Produkte und auch die billigsten, da dank dem gemeinsamen Haushalt seine Produktionskosten gering waren. […] Ihre Arbeitskräfte zeigten sich dabei weit eifriger, als die Sklaven des Großgrundbesitzers gewesen waren, denn es waren ja die Genossen, die den ganzen Ertrag ihrer Arbeit selbst erhielten. Überdies umfaßte jedes Kloster so zahlreiche Arbeitskräfte, daß es […] eine weitgehende Arbeitsteilung durchführen konnte. Endlich besaß das Kloster, dem einzelnen menschlichen Individuum gegenüber, eine ewige Existenz. […] Es konzentrierte nur Eigentum, ohne es durch Vererbung jemals teilen zu müssen.
So hebt sich die Askese selbst auf. Die Wildnis, einmal zum Garten gemacht, leistet keine Läuterung durch Entbehrung, sondern Bereicherung durch Ertrag. Die Mönche Walkenrieds zapften den wilden Bergbach an, pferchten die flinken Bachforellen ein, schufen, so hieß es, 365 Fischteiche. So konnten sie jeden Tag des Jahres die silbrig glänzende Ausbeute eines Teiches verzehren. Die Gärten reichten bis tief in die Erde, ins Gestein, in die Erzader – in Gruben legten die Mönche ihren Reichtum an, und das Silber kullerte ihnen entgegen, bis das Kloster wegen Liederlichkeit und Verschwendung in Verruf kam. Und Kautsky schreibt:
Sobald ein Kloster reich und mächtig geworden war, vollzog sich in ihm derselbe Prozeß, der sich seitdem bei mancher anderen kommunistischen Vereinigung wiederholt hat […]. Die Besitzer der Produktionsmittel finden es jetzt bequemer, statt selbst zu arbeiten, andere für sich arbeiten zu lassen, wenn sie die nötigen Arbeitskräfte finden: besitzlose Lohnarbeiter, Sklaven oder Hörige.
Es passierte immer wieder: Der Verzicht, der am Anfang des ersten Ordens stand, erwies sich als unendlich fruchtbar, der Orden bereicherte sich, wurde sich unversehens untreu. Dann musste ein Reformorden her, der zu den Wurzeln zurückkehrte, von den Wurzeln wieder üppig wuchs und einen weiteren Orden gebar, bis hin zur Reformation, und auch die Protestanten spalteten sich pausenlos, und die protestantische Arbeitsethik gebar den Kapitalismus, der den Kommunismus gebar. Und Kautsky fragt: Wird nicht dieser Kommunismus nun seinerseits dieselbe Dialektik entwickeln, die der christliche durchmachte, und seinerseits ebenfalls zu einem neuen Ausbeutungs- und Herrschaftsorganismus umschlagen?
Der Mönch als Wüstling – das subversive Bild, das im Mittelalter aufkam, bleibt uns als Bierdeckel-Folklore erhalten, Sinnbild der Heuchelei, Volkswissen um das Unheil der unterdrückten Triebe. Lehrreiche Beispiele, über Generationen hinweg überliefert. Die Geschichte etwa eines versumpften Teiches bei Kloster Ilsenburg, die mir ein Mann aus dem Ort erzählte: Bei Ausgrabungen fand man tief im Teichgrund Säuglingsskelette. Der Teich liegt im Wald auf halbem Weg zwischen dem Männerkloster Ilsenburg und dem Frauenkloster Drübeck. Hier sollen sich Mönche und Nonnen heimlich geliebt haben. Die Früchte ihrer Liebe, die nicht sein durfte, sollen die Nonnen im Teich verschwinden lassen haben. Den Wahrheitsgehalt der Geschichte habe ich nicht nachprüfen können. Sie zeugt immerhin vom beharrlichen Glauben an eine schreckliche Notwendigkeit: Die Lust des Fleisches lasse sich nicht leugnen. Aber der Lohn dieser Lust sei die Mehrung zum Tode. Ich will deinen Samen machen wie den Staub auf Erden.
Zwischen Gestern und Morgen
Postwachstumsutopien
Warum immer wieder der Blick in die Vergangenheit? Aus Sehnsucht? Vielleicht. Aber nicht, um einer »besseren« Zeit nachzutrauern, sondern wie um einer Wurzel in die Tiefe zu folgen. Auf Radix, die Wurzel, geht die Radikalität zurück – ein Wort, mit dem ich mich allerdings schwertue. Allzu oft klingt es nach einem Mit-der-Wurzel-Ausreißen. Dabei ist die radix immer unergründlich verschlungen. Wer sie blindwütig rausrupft, kann alles mit ausreißen, was doch nur von Unkraut befreit werden soll. Und letztlich ist Unkraut nur eine Pflanze am falschen Ort, die erst dann überhandnimmt, wenn ein Gleichgewicht gestört ist. Man müsste ganz sachte hinabtasten, mit einer Behutsamkeit, die man für Nostalgie halten könnte. Ganz zärtlich entwirren, um irgendwo neu ansetzen zu können.
»Man« schreibe ich, und denke: Ich. Als läge der Punkt des Neuansatzes immer auch in meinem Leben. Mein Geburtsjahr ist im Nachhinein ein solcher Schicksalsmoment – den ich wahrzunehmen versäumte. 1973 schlug ich allen Warnungen zum Trotz den falschen Weg ein.
Die Spanne meines Lebens ist die Fortdauer einer ungelösten Frage: Ist in einer endlichen Welt unendliches Wachstum möglich? In Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit wurde sie 1972 erstmals so deutlich gestellt und zugleich so vernichtend beantwortet: Exponentielles Wachstum, Grundlage der freien Marktwirtschaft, werde in absehbarer Zeit die natürlichen Grundlagen des Lebens aufzehren. Es war ein Augenblick, in dem die Welt als Ganzes begriffen wurde, in der ganzheitlich gehandelt werden muss. Aber die Welt von damals war politisch zweigeteilt, und Rivalitäten hatten Vorrang.
Bevor ich überhaupt ein Bewusstsein dafür entwickeln konnte, war die ökologische Krise schon wieder verdrängt. In der Reagan-Zeit schleppte sich der Kalte Krieg dahin – bis unversehens unser System siegte. Alle Zweifel waren ausgeräumt, alle Alternativen ausgestochen. Als ich 1995 nach Berlin ging, interessierte ich mich durchaus für den anderen Weg, den der Osten beschritten hatte, aber ich versprach mir keinen Nutzen davon, keine Lösung, gar Erlösung. Überhaupt war ich eher auf der Suche nach Problemen – waren doch mit dem »Ende der Geschichte« alle großen Aufgaben bereits erledigt! Mich beschäftigten die Dilemmata der jungen Ostdeutschen, ihrer Eltern und Großeltern. Aber als diese sich in meinem Kopf zu einem Roman auswuchsen und ich mit der Arbeit an Die grüne Grenze begann, setzte ich als Anfangspunkt mein eigenes Geburtsjahr, um die Ostzeit mit meiner Zeit in ein noch unklares Verhältnis zu setzen. Damit rückte eine Frage in den Fokus, der beide Lager im Kalten Krieg ausgewichen waren. Vielleicht hatte ich das Problem bereits gespürt, gleichsam körperlich, als mir in meinen Dreißigern langsam unheimlich wurde, was in meinen Zwanzigern noch natürlich erschien: die Vorstellung, immer weiter zu wachsen, keine Grenzen zu kennen.
Bei meinen Romanrecherchen stieß ich auf ein Buch, das das für mich noch diffuse Thema ausführlich behandelte. In Bahro – Harich – Havemann. Marxistische Systemkritik und politische Utopie in der DDR (2014) schildert der Politikwissenschaftler Alexander Amberger die Wege dreier ostdeutscher Denker, die die Ideologie des Wachstums zu kritisieren wagten und dafür abgestraft wurden. Sie erkannten nämlich, dass der Bericht des Club of Rome nicht nur die Krise des Kapitalismus, sondern auch die Widersprüche des Sozialismus offenbarte. Denn Marx, der hellsichtig die kapitalistische Wachstumsdynamik erkannte, machte sie zur Bedingung einer neuen Gesellschaftsordnung: Erst der Kapitalismus häuft den Reichtum an, den es zu verteilen gilt, bündelt die Produktivkräfte für den Aufbau des Kommunismus. Aber wann und wie vollzieht sich der Übergang vom »Reich der Notwendigkeit« ins »Reich der Freiheit«? Der reale Sozialismus hatte sich stillschweigend von jener ideellen Verheißung verabschiedet. Angesichts des »Wirtschaftswunders« BRD beschloss die DDR-Führung unter Honecker ab 1973 den Ausbau des Konsumsektors ohne Rücksicht auf Ressourcenverschwendung, erklärte das quantitative Wirtschaftswachstum zum »wichtigste[n] Maß im ökonomischen Wettbewerb«.
Ausgerechnet aus dieser dem Kapitalismus hinterherhechelnden »sozialistischen Konsumgesellschaft« stammte der erste bedeutende Beitrag eines deutschen Intellektuellen (in Ost- und Westdeutschland) zur Wachstumsdebatte: Wolfgang Harichs Kommunismus ohne Wachstum. Babeuf und der Club of Rome (1975). 1923 geboren, SED-Mitglied der ersten Stunde, längst zum Dissidenten wider Willen geworden, hatte Harich nach einem gescheiterten Komplott gegen Walter Ulbricht 1957–1964 in Einzelhaft gesessen. Als politische Öffentlichkeit blieb ihm nur der Westen, wo sein eigenwilliger Marxismus auf Faszination und Befremden zugleich stieß. In Marxismus ohne Wachstum ruft er zum Verzicht auf Wohlstand und auf Freiheiten auf. Die Dringlichkeit der ökologischen Krise lasse keine andere Wahl zu: Der Zeitpunkt für den Übergang zum Kommunismus sei jetzt. »Ich glaube jedoch nicht mehr, daß es jemals eine im Überfluß lebende, eine aus dem Vollen schöpfende kommunistische Gesellschaft geben wird […].« Das Vorhandene müsse jetzt schon durch einen autokratischen Weltstaat gerecht aufgeteilt werden. Dieser Kommunismus »wäre kein Paradies, sondern ›nur‹ eine Heimstatt ökologischer Vernunft bei strenger sozialer Gerechtigkeit. Aber das eben ist das Beste, was sich überhaupt je wird erreichen lassen.«
So verband sich Harichs einmalig realistische Sicht auf das Ausmaß der Umweltkrise mit einer einmaligen realpolitischen Naivität. Rein durch Einsicht in die Notwendigkeit sollte seine Vision verwirklicht werden, und zwar »so schnell wie möglich […], um möglichst viele Freiheiten erhalten zu können.« Aber die westliche Linke lehnte Harichs »autoritären Verteilungsstaat« ab. In der DDR indes galt er als Nestbeschmutzer, der »mit der Propagierung des Kommunismus als eine Gesellschaft der Askese, der Armut« den Antikommunisten in die Hände spiele – und so wurden seine Thesen totgeschwiegen, und seine dringliche Bitte an die Obrigkeit (»Macht von mir Gebrauch!«), eine ökologische Strategie mitentwickeln zu dürfen, stieß auf taube Ohren. 1979 ging er schweren Herzens in die BRD, engagierte sich bei der Gründung der Grünen. Doch schon 1981 kehrte er enttäuscht in die DDR und die politische Isolation zurück.
Rudolf Bahro war zunächst mehr Ruhm beschieden. 1935 geboren, entwickelte er sich zu einem kritischen Marxisten, der nach der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 »endgültig mit dem realsozialistischen System brach«. In diesem Sinne schrieb er neun Jahre lang an einer – so der schlichte Titel – Alternative. Das Manuskript wurde in die Bundesrepublik geschmuggelt und erregte bei seinem Erscheinen 1977 großes Aufsehen – woraufhin Bahro in der DDR wegen »nachrichtendienstlicher Tätigkeit« zu acht Jahren Haft verurteilt wurde. 1979 kam er frei unter der Bedingung, das Land zu verlassen.
Mit seiner Alternative kann Bahro im Gegensatz zu Harich der Wachstumsproblematik eine positive Utopie abgewinnen. Bei dem notwendigen sofortigen Übergang zum