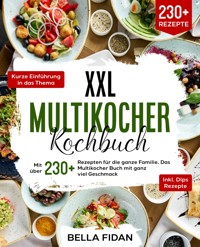9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Beim Streben nach Optimierung, Verbesserung und Erkenntnis lassen wir nichts unversucht, damit uns das "Glück" nicht entwischt. Haben wir tatsächlich die große Liebe gefunden? Die richtige Berufswahl getroffen? Wann ist die optimale Zeit für die Familiengründung? Und was ist der Sinn des Lebens? Gute Frage, nächste Frage. Der Schlüssel zum Glück liegt für die Philosophin Ina Schmidt in der Suche nach der persönlichen Lebenszufriedenheit, die sich im Laufe des Lebens ständig wandelt. Es geht nicht ums "Ankommen". Das "Unterwegssein" zählt. Schließlich reflektieren wir dabei unser gegenwärtiges Leben, können Wünsche formulieren und entwickeln uns immens weiter. Ihr Buch ermuntert uns, Wege zu gehen, ohne immer ein konkretes Ziel vor Augen zu haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber das BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungZitatEine Einführung1. Eine Alltagsphilosophie der Suche: Was können wir überhaupt finden?– Immer auf der Suche – aber wonach eigentlich?– Eine Philosophie der Suche: Der Versuch zu verstehen– Jeden Tag aufs Neue: Die Suche als alltagsphilosophische Praxis2. Vom Suchen zum Aussuchen: Die Kraft der Entscheidung– Was bedeutet es, eine Entscheidung zu treffen?– Wer hat was von einfach gesagt? Der Umgang mit Freiheit und Komplexität– Bauch und Kopf sind keine Gegner: Warum unsere Intuition so wertvoll ist3. Die Kraft der Besonnenheit: Auf der Suche nach dem Glück– Chill dein Leben: Warum gelassen nicht entspannt ist– Das leise Glück der kleinen Dinge: Wieso wir nach dem Guten streben sollten– Machen Sie mal Pause: Vom Hamsterrad zur Besonnenheit4. Die innere Suchmaschine: Geben Sie mindestens ein Wort zur Suche ein– Wie suche ich mein Selbst, und woher weiß ich, dass ich mich gefunden habe?– Das Hohelied der Empathie: Warum wir nur mit anderen wir selbst sein können– Auf der Suche nach der eigenen Stimme – mitten im Lärm5. Ein philosophischer Leitfaden für Suchende– Zehn Fragen für SuchendeDankeEinige Literaturhinweise zum WeitersuchenQuellenverzeichnisÜber das Buch
Beim Streben nach Optimierung, Verbesserung und Erkenntnis lassen wir nichts unversucht, damit uns das »Glück« nicht entwischt. Haben wir tatsächlich die große Liebe gefunden? Die richtige Berufswahl getroffen? Wann ist die optimale Zeit für die Familiengründung? Und was ist der Sinn des Lebens? Gute Frage, nächste Frage. Der Schlüssel zum Glück liegt für die Philosophin Ina Schmidt in der Suche nach der persönlichen Lebenszufriedenheit, die sich im Laufe des Lebens ständig wandelt. Es geht nicht ums »Ankommen«. Das »Unterwegssein« zählt. Schließlich reflektieren wir dabei unser gegenwärtiges Leben, können Wünsche formulieren und entwickeln uns immens weiter. Ihr Buch ermuntert uns, Wege zu gehen, ohne immer ein konkretes Ziel vor Augen zu haben.
Über die Autorin
Ina Schmidt, geboren 1973 in Flensburg, studierte Angewandte Kulturwissenschaften an der Universität Lüneburg und promovierte im Bereich Philosophie über den Begriff des Lebens in der Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts. Im Vordergrund ihrer Forschungen stand der Einfluss der Lebensphilosophie auf das frühe Denken Martin Heideggers. 2005 gründete Ina Schmidt die denkraeume, eine Initiative, in der sie in Vorträgen, Workshops und Seminaren philosophische Themen und Begriffe für die heutige Lebenswelt - sowohl von Unternehmen wie Privatpersonen - verständlich macht. Sie ist Autorin verschiedener Bücher, zuletzt erschien 2014 im Münchner Ludwig Verlag »Auf die Freundschaft. Eine philosophische Begegnung oder wie aus Menschen Freunde werden.« Ina Schmidt ist Mitglied der Internationalen Gesellschaft für philosophische Praxis und arbeitet als Referentin für die modern life school in Hamburg. Außerdem schreibt sie für das Philosophiemagazin »Hohe Luft« und ist als Kolumnistin für Zeitschriften tätig, u.a. für Emotion und Brigitte. Ina Schmidt ist verheiratet, Mutter von drei Kindern und lebt mit ihrer Familie in Reinbek bei Hamburg.
INA SCHMIDT
Das Ziel ist im Weg
Eine philosophische Suche nach dem Glück
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Angela Kuepper
Umschlaggestaltung: © ZERO Werbeagentur, München
Einband-/Umschlagmotiv: © ZERO Werbeagentur, München
Datenkonvertierung E-Book:
hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-3653-5
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
FürGesa und Imke
Und was soll aus mir werden?Ein Neugieriger. Das ist zwar noch keinBeruf, aber es wird bald einer werden.
François Truffaut, »Jules und Jim«
Eine Einführung
Ach, ich bin gelaufen, gelaufen
und hingefallen, wieder aufgestanden,
umgeworfen, wieder aufgesammelt,
bis ich da angekommen bin, wo
mein Ziel anfängt.
Franziska zu Reventlow
Wo stehe ich, und wo will ich eigentlich hin? Was ist es, das mein Leben ausmacht oder irgendwann einmal ausmachen soll?
Bei all den Antworten, die es auf diese scheinbar so einfachen Fragen gibt, lässt sich kaum ein gemeinsames Ziel finden, und doch, eins wollen wir eigentlich irgendwie alle – glücklich sein. Aber ebendieses Ziel scheint eher der Anfang von neuen Fragen zu sein als ihr Ende. Wo steckt das Glück, und warum suchen wir es so sehr, dass wir kaum noch wissen, wo uns der Kopf steht? Bei all der Hektik bieten sich derzeit jede Menge neue Angebote, um sich auf die Suche nach dem Glück zu machen. Ankommen scheint das Gebot der Stunde, dort, wo ich immer schon hinwollte, bei mir selbst. Die innere Mitte finden, wissen und bleiben, wer ich bin, und endlich einmal in Ruhe Zeit genießen, die mir ganz allein gehört – das scheint gegenwärtig die höchste Form eines geglückten Lebens zu versprechen. Wie dieses Ziel so ganz genau aussieht, weiß ich nicht, also arbeite ich entweder umso zielstrebiger die gesellschaftlich relevanten To-dos für ein vermeintlich glückliches Leben ab, oder ich tue einfach mal nichts, bin ganz bei mir, häkle Mützen, baue Bienenkästen für den Balkon mitten in der Stadt oder male ein wenig in meinem neuen Achtsamkeitsmalbuch gegen den Stress der modernen Zeit an. Ein Zustand, in dem ich mit mir und der Welt Frieden geschlossen habe – alles wunderbar. Aber irgendetwas stimmt da nicht. Denn komme ich wirklich irgendwo an, und woher weiß ich, dass ich da ganz bei mir bin und nicht bei jemand anderem?
Trotz aller Begeisterung für das Hier und Jetzt ist alles und jeder bis zur Unkenntlichkeit mobil und flexibel, verändert sich und macht irgendwie »sein Ding«, also müssen wir offenbar ein paar Kompromisse schließen, was das Ankommen im Gegenwärtigen angeht. Da helfen oft ein paar Weisheitszitate oder die eine oder andere Yogaübung: Ein herabschauender Hund in der Mittagspause und ein bisschen »Muße-to-go« zwischen zwei Meetings, alles kein Problem, und es geht nun mal nicht anders. Aber was tun wir da eigentlich? Sind die Ziele, die wir auf diese Weise verfolgen, eigentlich wirkliche Ziele – ist es das, was wir wollen? Nehmen wir uns die Zeit, den Unterschied herauszufinden, und wie suchen wir nach dem, was wir wollen? Aber Moment mal – genau das tun wir doch ständig. Die ewige Sucherei ist es doch, die uns vom Ankommen abhält, wir tun doch kaum etwas anderes, als auf der Suche nach dem zu sein, was das Leben ausmacht: nach dem Sinn, der großen Liebe, den eigenen Möglichkeiten – oder aber auch nur nach dem günstigsten Smartphone-Tarif, dem besten Parkplatz oder der perfekten Dreizimmerwohnung. Und schließlich suchen wir, um am Ende etwas zu finden, um irgendwo ankommen zu können – oder etwa nicht? Und das Glück sollte ebendieses Ende unserer Suche sein, das, was uns ein gutes Leben ermöglicht – Ende gut, alles gut.
Aber ist das, was wir da vor uns hertragen, wirklich ein Ziel oder nicht eher so etwas wie eine Sehnsucht, ein Ideal, etwas, das wir anhimmeln, aber nicht wirklich anstreben können? Gerade in einer Welt, die Innovation und globalen Wandel zum Wesen moderner Gesellschaften erklärt, kann eine Kultur des »Ankommens« nicht gleichzeitig als ultimative Glücksformel hochgehalten werden – der Widerspruch liegt auf der Hand: Wir können nicht gleichzeitig aufs Gas treten und auf der Bremse stehen, die Kraft, die diese eigenartige Gleichzeitigkeit kostet, brauchen wir für das Abwägen eines gelingenden Nacheinanders, eines Gleichgewichts aus Wandel und Beständigkeit. Das, was wir brauchen, sind Menschen, die sich in dem, was sich verändert, bewegen können – wissen, wann sie sich anpassen müssen und wann es Zeit ist, neue Ziele in Angriff zu nehmen, die Nachdenken nicht mit Zeitverschwendung und das Maximum nicht mit dem Optimum verwechseln. Das ist zugegebenermaßen eine ziemlich anspruchsvolle Angelegenheit, die uns derzeit vielfach mit dem Gefühl der Überforderung und Verwirrung belohnt. Aber dieses Empfinden liegt nicht allein an einer schnelllebigen und komplexen Zeit, sondern vielfach eher daran, welche Erwartungen wir an das haben, was wir glauben, erreichen zu können – und auf welche Weise. Jede Frage bedeutet eine Suche; Neugier und Verwunderung sind Antriebskräfte, die uns nicht nur ausbrennen, sondern vielmehr beflügeln können. Etwas zu suchen bedeutet eben kein kopfloses Herumirren in einer entgrenzten Welt voller Optionen, die den Einzelnen in die Überforderung der Freiheit wirft, sondern den ernsthaften Versuch, sich in genau dieser Welt zu orientieren. Damit unterscheidet es sich vom Jammern oder Beleidigtsein, von der Ablenkung oder Zerstreuung. Ein Suchender ist kein Spielball der Unberechenbarkeiten, sondern jemand, der versucht, dieser Unberechenbarkeit etwas entgegenzusetzen, indem er den Rahmen des »Möglichen« für sich absteckt.
Bei aller berechtigten Kritik am Zuviel des Möglichen in dieser Welt, am Zugroß und Zuschnell, bleibt diese Kritik oft einem Dualismus verbunden, der die »Last der Möglichkeiten« als reine Zumutung beschreibt und daraus den Schluss zieht, dass jedes Weniger für den modernen Menschen der westlichen Welt automatisch ein Mehr sein muss. Damit schaffen wir allerdings auch keinen Ausweg aus der eigenen Grübelfalle. Denn aus dieser Annahme folgen zum einen die erneute Überforderung auf der Suche nach dem Weniger und zum anderen das Problem, dass es nicht nur in materiellen, sondern auch in geistigen Belangen ein eindeutiges Zuwenig gibt, mit dem wir uns gerade nicht zufriedengeben dürfen. Da reicht ein kurzer Blick in die Kommentarkultur der sozialen Netzwerke.
Wie aber finden wir die Maßstäbe für das, was wir an Rüstzeug brauchen, um herauszufinden, worauf es ankommt? Die ständige Orientierung an äußeren Zwecken, der Wunsch, beständig Kompetenzen auszuprägen, um dies oder jenes zu erreichen, verstellt uns den Blick für die Dinge, die um ihrer selbst willen eine Bereicherung, ein Baustein für ein geglücktes Leben sein können. Dinge, die nicht darauf angewiesen sind, dass wir sie beeinflussen. Dafür müssen wir aber weniger unser Handeln verändern, sondern vielmehr unseren Blick, unsere Art, hinzuschauen und zuzuhören, um zu lernen, das Wesentliche vom weniger Wesentlichen zu unterscheiden. Moderne Praktiken aus unterschiedlichsten Weisheitslehren, Achtsamkeit und Gelassenheit sind wichtige Methoden und Tugenden, um diesen Blick zu öffnen, aber nur dann, wenn wir sie nicht erneut anderen Interessen und Zweckmäßigkeiten unterordnen. Gerade, wenn es um diese inneren Weichenstellungen geht, reicht es nicht, unsere Buntstifte zu zücken, um sich in das Entspannungsausmalbuch zu flüchten, oder »Corporate Meditation« in Großkonzernen zum Gebot der Stunde zu erklären, um danach munter weiterzuhetzen – denn in der Hetze und Unaufmerksamkeit liegt das Gegenteil jeder gelingenden Suche. Es geht also darum, sich gegen das eine und für das andere entscheiden zu wollen.
Vor diesem Hintergrund will dieses Buch eine vielleicht ungewohnte Frage stellen und beantworten: nicht die, wie wir das vermeintlich leidige Suchen beenden können – um endlich ans Ziel oder auch mal wieder zur Ruhe zu kommen –, sondern die, wie wir lernen können, auf eine andere Weise zu suchen: nämlich in Ruhe, damit wir da ankommen können, wo wir auch wirklich hinwollen, auch wenn wir es vorher noch nicht wussten, um von dort aufs Neue aufzubrechen.
Im ersten Kapitel geht es vor diesem Hintergrund um die Suche als eine ganz eigene Art des Tuns – einer besonderen Form der Praxis, die auf das zurückgeht, was die antiken griechischen Philosophen als »tätiges Leben« beschrieben haben. Ich möchte zeigen, dass die »Suche« kein modernes Phänomen digitaler Netzwerkwelten in einem globalen Kontext darstellt, sondern ein zutiefst menschliches Bedürfnis ist, das uns zumindest philosophisch seit über zweitausend Jahren begleitet – wenn wir in der europäischen Suche bis zur griechischen Antike zurückgehen. Eine Suche, die nach einem »glückseligen« Leben strebt, gerade indem sie in Bewegung bleibt, sich nicht zufriedengibt und trotzdem in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen und verantwortlich mit der eigenen Freiheit umzugehen: Das ist das Anliegen der aristotelischen Ethik, die vor über zweitausend Jahren geschrieben wurde.
Um diesen Anspruch auch in unserer heutigen Lebenswelt umsetzen zu können, brauchen wir die Möglichkeit, uns zu orientieren, Strukturen zu schaffen, um uns selbst in der Suche nicht verloren zu gehen: Wie wählen wir aus, was wir suchen wollen, wie treffen wir Entscheidungen, kommen also vom Suchen zum Aussuchen? Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt, um den es im zweiten Kapitel gehen wird. Denn sofern wir uns als Suchende ernst nehmen, kann es sehr wohl gelingen, im Rahmen dieser Suche auch anzukommen – Etappenziele zu erreichen –, um von dort aus zu überprüfen, ob wir bleiben wollen oder nicht. Hier sollen Hintergründe aus der Komplexitäts- und Entscheidungstheorie helfen, unseren Wunsch nach eindeutigen Ergebnissen und exakt voraussagbaren Zielsetzungen als Illusion zu enttarnen – mit dem Ergebnis, dass sich auch damit der Begriff des Scheiterns beziehungsweise der Fehlentscheidung anders denken lässt.
Das dritte Kapitel widmet sich den momentan weit verbreiteten Gedanken zur Achtsamkeit, Gelassenheit und Entschleunigung sowie der Frage, was die derzeitige Zeitgeistdebatte aus diesen alten Elementen meist östlicher Weisheitslehren macht. Statt sich auf moderne Tools und Praktiken zur Selbstverwirklichung zu stürzen, soll es darum gehen, wie sich den modernen Sorgen auch mit der eher europäisch geprägten philosophischen Tugend der Besonnenheit begegnen lässt – und was den Unterschied ausmacht.
All diese Gedanken münden in die Frage, was vor diesem Hintergrund mit der modernen Idee der »Selbstsuche« beziehungsweise »Selbstfindung« gemeint sein kann. Und so fragen wir uns im vierten Kapitel: Wie kann ich nach mir selbst auf die Suche gehen, wie gehe ich mir verloren, und woher weiß ich, wen ich da gefunden habe? Wenn wir die eigene Identität beziehungsweise das, was ich als »Ich« erfahre, weniger als »Ding« – also eine Art substanzielles Ziel – ansteuern und uns stattdessen auf die Suche nach dem machen, wie wir uns selbst erleben, dann werden wir zwar niemals ankommen, können dabei aber sehr wohl glücklich sein.
Um sich bei der eigenen Suche an ein paar Wegweisern und Geländern entlanghangeln zu können, knüpft sich am Ende aus all den unterschiedlichen Perspektiven ein roter Faden, um Sie im fünften Kapitel mit den wichtigsten Fragen auf Ihrer ganz persönlichen Suche zu begleiten – damit Sie auf Ihrem Weg am Ende nicht nur an-, sondern hoffentlich auch ein Stück weiterkommen, ob mit oder ohne Ausmalbücher, Megayoga oder philosophischen Tugenden – die gelungene Mischung liegt ganz bei Ihnen. Wer weiß, welche Ziele sich auf Ihrem Weg noch ergeben werden!
Ina Schmidt
Reinbek 2016
1. Eine Alltagsphilosophie der Suche: Was können wir überhaupt finden?
Auf welche Weise willst
du denn dasjenige suchen,
Sokrates, wovon du überhaupt
gar nicht weißt, was es ist?
Platon
Ein frühlingshafter Sonntagnachmittag in der Küche einer Dreizimmerwohnung, Altbau, mitten in Hamburg. Draußen kämpfen sich einige mutige Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke und lassen erahnen, dass die Welt irgendwann auch wieder heller wird. Der Nieselregen liegt noch in der Luft, aber es riecht nach Frühling. Ein Moment für die größeren Fragen – die, für die in der Woche, auf dem Weg ins Büro oder mitten im Supermarkt zu wenig Zeit ist, Fragen, mit denen man nicht so gern allein ist, die aber auch nicht zu jedem passen, der gerade zu Besuch in der eigenen Küche ist. Meine Freundin, die mit ihrer Katze in dieser Altbauwohnung lebt, sitzt am Küchentisch und blinzelt in die Sonne: »Wieso ist es eigentlich so schwer, zufrieden zu sein – das gut zu finden, was man im Leben auf die Beine gestellt hat? Vielleicht sogar erreicht hat. Es muss ja nicht das ganz große Glück sein, aber zufrieden sollte doch eigentlich gehen, oder?« Will sie darauf wirklich eine Antwort? Ich warte einen Moment ab, nein, ihre Gedanken wandern weiter.
»Manche Menschen leiden wirkliche Not, verlassen ihre Heimat und müssen sich ein neues Leben aufbauen, und ich sitze hier im Warmen, bin gesund und munter und kämpfe ständig mit dem Wunsch, das zu verbessern, was schon da ist. Warum nur?« Meine Freundin macht eine Pause, eine Falte bildet sich auf ihrer Stirn. »Und dann ärgere ich mich über mich selbst, lese jede Menge gute Ratschläge, bastle dämliche Wimpelketten und weiß eigentlich gar nicht, was das soll«, murmelt sie weiter, während sie vom Tisch aufsteht, ihre geliebte Teekanne mit heißem Wasser füllt und sich wieder auf dem alten Küchenstuhl zurücklehnt. Erneut wandert ihr Blick zum Fenster, als wäre es dann einfacher, den Gedanken zu folgen, die ihren eigenen Kopf zu haben scheinen: »Ständig diese Aufforderungen von allem und jedem, etwas wollen zu sollen, etwas Sinnvolles anzusteuern, irgendwie sein zu müssen – besser oder eben gerade nicht, weil wir bleiben sollen, wie wir sind. Sich treu bleiben und trotzdem endlich mal was wagen. In der U-Bahn, auf Postkarten, im Coffeeshop. Sogar da sollen wir glücklich sein. Und wenn ich es richtig anstelle, bietet mir der Espresso in der kurzen Mittagspause eine Möglichkeit zur inneren Ruhe. Ausgerechnet Espresso. Irgendwie sehe ich vor lauter Zielen gar keinen Weg mehr.« Meine Freundin rührt ihren Tee um und sieht mich an, endlich: »Also, was soll das Ganze eigentlich? Warum will ich dauernd irgendwo ankommen, wenn ich noch nicht mal genau weiß, was ich suche?«
Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob in all ihren Gedanken wirklich eine Frage steckt und worauf sie hinauswill. Möchte sie ernsthaft ihr Leben umkrempeln, tatsächlich etwas verändern, oder ist es nur das alljährliche Grübeln, wenn wieder so etwas wie Aufbruch in der Luft liegt? Ein bisschen Wohlstandsgejammer und melancholische Sozialromantik: alles neu, alles frisch – ab morgen. Also ernsthaft: Gibt es neue Ziele oder gerade keine? Ihre liebgewonnenen Gewohnheiten sind offenbar nicht von den Gedankenspielen betroffen, die alte Teekanne, der Blick aus dem Fenster, der Platz am Küchentisch. Aber sind das wirklich die Dinge, auf die es im Leben ankommt, das, was man gefunden haben will? Auch, aber doch nicht nur.
Irgendwie sollte das »Wesentliche«, das, wonach wir alle suchen, doch ein paar Nummern größer sein – ab wann dürfen wir uns mit uns und unserem Leben zufriedengeben, und was ist es, was ein gutes Leben ausmacht? Soll es im Job wirklich immer so weitergehen, ist das eigene Lebensmodell tatsächlich das richtige – und wie machen das eigentlich die anderen? Es ist ja nicht so, dass meine Freundin die Einzige wäre, die sich so ihre Fragen stellt. Manch anderer findet sogar Antworten: Ein gemeinsamer Freund hat sich gerade nach langjährigem Geläster über die spießigen »Inbetweens« irgendwo zwischen Reeperbahn und Resthof ein Endreihenhaus am Stadtrand eingerichtet und scheint ziemlich begeistert vom Rasenmähen und den Fußballspielen seines Jüngsten am Wochenende – und trotzdem kann man ja abends immer noch mal ins Theater gehen, vielleicht – oder auch nicht. Wenn man sich an einer Stelle seines Lebens festgelegt hat, sind andere Fragen offenbar nicht mehr so wichtig. Oder kommen dann einfach neue?
Also – was genau soll der ewige Monolog über die innere Zerrissenheit zwischen der Notwendigkeit, irgendwo anzukommen, und dem gleichzeitigen Wunsch nach Veränderung, dem ewigen Geschrei nach Unabhängigkeit, wenn es doch eigentlich nur die Angst vor Entscheidungen ist? Das klingt nach einem Plan, in dem das Unglück vorprogrammiert ist.
Was also sucht meine Freundin, während sie gedankenverloren ihre dampfende Teetasse in der Hand hält, und was hat unser Freund am Stadtrand vielleicht schon gefunden? Ich nehme mir ebenfalls einen Becher, setze mich zu ihr an den Tisch, und es wird ein langer und sehr besonderer Nachmittag auf der Suche nach dem, was wir eigentlich suchen können und was nicht. Was sich verändern muss und was sich auf keinen Fall ändern sollte. Ein paar Antworten haben wir gefunden – auf der Suche sind wir immer noch. Zum Glück!
Immer auf der Suche – aber wonach eigentlich?
Die erste Frage, um die es geht, ist recht einfach: Was und warum suchen wir überhaupt etwas und leben nicht so gut es eben geht mit dem, was bereits da ist? Wir könnten auch daraus das Beste machen und es für das Gute halten. Wieso gelingt uns die Idee eines glücklichen Lebens so selten in dem, was »ist«? Aber das, was wir vorfinden, scheint uns irgendwie nicht zu reichen. Denn das, was wir da um uns herum zu erkennen glauben, ergibt einfach zu wenig Sinn: Angefangen bei der menschlichen Erkenntnis, dass das Leben von Anfang an dazu bestimmt ist, zu Ende zu gehen, wozu also das Ganze? Wie ringen wir der eigenen Vergänglichkeit ein wenig Ordnung, Sinnhaftigkeit oder eben auch »Glück« ab? Wir machen uns auf die Suche, ob hinter dem, was wir sehen, nicht noch mehr versteckt ist.
Nicht nur die Philosophie, die ja auch mancher Denker als Rüstzeug nutzen wollte, um das »Sterben zu lernen«, auch die Religion macht diesen menschlichen Wesenszug zu einem zentralen Thema. In der biblischen Geschichte, in der dem Menschen selbst das Paradies nicht reichte und er beziehungsweise sie durch den Griff zum Apfel der Erkenntnis sogar den göttlichen Rauswurf aus einem Leben ohne Sorgen und Gefahren auf sich nahm, wird mehr als deutlich, dass der Mensch ein strebendes Wesen ist. Der Wunsch nach Erkenntnis, nach Wissen, nach mehr oder besser treibt uns offenbar an, ohne dass wir viel dafür oder dagegen tun könnten. Aber muss darin ein Problem liegen? Verzweifeln wir zwangsläufig an der Sinnlosigkeit der Welt, egal in welchen paradiesischen Zuständen wir scheinbar leben? Lange vor der christlichen Verknüpfung von Erkenntnisstreben und Sündenfall finden sich durchaus andere Möglichkeiten, um den menschlichen Wunsch nach Wissen und Verstehenwollen zu beschreiben.
Die griechische Philosophie hat Momente, in denen existenzielle Fragen in uns aufsteigen, in denen wir weiterfragen und über die Wirklichkeit stolpern, als Momente des »Staunens« (thaumazein) bezeichnet und sie nicht als zwingende Abweichung vom rechten Weg oder als störende Verwirrung, sondern als Anlass entzückter Entdeckungsfreude beschrieben. Aristoteles ist sicher, dass die Menschen »dank ihres Staunens […] heute wie vormals zu philosophieren beginnen«1. Diesen Beginn schreibt er der einfachen Frage zu: »Was ist das?« (ti estin) – dem schlichten Beginn des menschlichen Bedürfnisses nach Wissen und dem Glauben, dass es mehr zu entdecken gibt als das, was wir sehen. Das muss uns zwar bei Weitem nicht immer begeistern, aber es kann auch eine Form der Neugier sein, ein Glaube daran, dass das andere sogar das Bessere sein könnte, das unsere Fragen antreibt. Vor diesem Hintergrund erscheint unsere Suche, unser Wunsch nach Wissen und Verstehen – und damit der Beginn der Philosophie –, in einem positiven Licht. Es ist das Streben nach einer Weisheit, die uns das Leben ein bisschen besser verstehen lässt – ganz im Sinne Platons, dem Lehrer des Aristoteles, der »die Einstellung eines Mannes, der die Weisheit wahrhaft liebt«, als den einzig möglichen Anfang der Philosophie beschrieb.2
Im Augenblick des Staunens machen wir also (im Idealfall) einen neuen, einen eigenen Anfang und blicken ganz unverstellt auf die Dinge, die uns begegnen – uns gelingt eine Perspektive, wie sie vielleicht nur der kindlichen Art und Weise vergleichbar ist, die die Dinge zum ersten Mal erblickt und in einen Kontext zu bringen versucht. Wir drehen und wenden sie, versuchen sie ins Licht zu halten und etwas zu erkennen, das uns bekannt vorkommt – nur so lassen sich Verbindungen herstellen, und wir können dieses Neue in etwas einordnen, das wir kennen. Und das mag in der Tat erstaunlich sein, hin und wieder auch befremdlich, bedrohlich oder erschreckend, aber eben auch reizvoll und vielversprechend: Versuchen Sie sich daran zu erinnern, wie Sie das erste Mal die Welt aus einem Flugzeug von oben gesehen haben. Oder das erste Mal am Meer waren, oder vielleicht gelingt es Ihnen, das Gefühl zurückzuholen, als Sie zum ersten Mal ein zusammenhängendes Wort gelesen haben – aus den vielleicht schon länger bekannten einzelnen Buchstaben entsteht ein neuer Sinnzusammenhang, und es tut sich eine neue Welt auf und bereichert das, was Sie kennen, um eine neue Perspektive beziehungsweise Lesart. Durch diese Neuigkeiten verändert sich das, was wir kennen, die Welt des Alten: Wir finden neue Verbindungen und Zugänge zu den Dingen, sehen vielleicht kleinere Probleme in einem größeren Zusammenhang oder haben schlicht den Mut, eine neue Aufgabe anzunehmen, und stellen zu unserer Überraschung fest, dass es leichter ist, als wir dachten. Vielleicht aber auch nicht. Das, was wir zu wissen glaubten, steht infrage und muss einer Überprüfung standhalten. Das verlangt uns einiges ab, und aus der Neurowissenschaft wissen wir, dass unser Gehirn bei aller Großartigkeit ein recht bequemes Organ ist, das sich nur ungern mit allzu viel Veränderung und Neuartigkeit auseinandersetzt, wenn wir uns denn erst einmal in unserer Komfortzone eingerichtet haben. Aber anders als andere Lebewesen haben wir die erstaunliche Fähigkeit, genau das von uns zu wissen und dieser Bequemlichkeit zu begegnen. Erstaunt sein zu können und neugierig zu bleiben ist kein Hexenwerk, sondern eine Möglichkeit, sich zu der Welt zu verhalten – wir fügen uns nicht in scheinbar Selbstverständliches, sondern lassen uns von dem überraschen, was wir dachten zu kennen.
Das Staunen beschreibt also eine Art Überraschung darüber, die Dinge so vorzufinden, wie sie sind, vielleicht gegen die eigene Erwartung, aber anders als Platon oder Aristoteles haben wir heute eher den Wunsch, »Überraschungen« und »Verwunderungen« aus dem Weg zu gehen – der Philosoph Peter Sloterdijk nennt diese Haltung, die insbesondere in zu Institutionen erstarrten wissenschaftlichen Apparaten anzutreffen ist, »Verblüffungsresistenz«3, also das exakte Gegenteil einer Haltung, die das Staunen als Beginn des Wissens und der Erkenntnis wertschätzt. Wir schätzen eben das, was wir kennen, was wir wissen und worauf wir uns verlassen können – das ist auch grundsätzlich gar kein Problem, aber das, was wir kennen, ist meist eben nicht das, was wir gesucht hatten.
Doch bleiben wir noch für einen Moment in der Tradition der griechischen Denker und versuchen uns an dieser antiken Sicht auf die Dinge – denn auch hier geht es nicht um das Neue als Selbstzweck, sondern den Wunsch, es sich zu eigen zu machen, daraus etwas werden zu lassen, mit dem ich umgehen kann: Ich lerne dazu – und zwar im besten Sinne, nicht weil mich die Umstände dazu zwingen, sondern weil mich das, was mich überrascht oder erstaunt, gleichzeitig interessiert: mit Schokolade überzogene Heuschrecken zum Dessert in Mexiko, eine japanische Teezeremonie am anderen Ende der Welt oder die Tatsache, dass unsere Nachbarin fließend Sanskrit spricht oder sich in der Flüchtlingshilfe engagiert. Die Begegnung mit dem, was uns erstaunt, kann die unterschiedlichsten Auswirkungen haben, es kann uns zeigen, dass die Dinge – und Menschen – deutlich mehr Facetten haben, als wir dachten, es kann uns Angst machen und verwirren, oder aber es kann uns zeigen, dass das eigene Leben nur eine Möglichkeit ist, die wir gestalten können, die so sein kann, aber auch ganz anders.
Diese unterschiedlichen Perspektiven fordern uns jede auf ihre Weise und geben dem Ziel, »ankommen« zu wollen beziehungsweise »zielstrebig« sein zu müssen, eine andere Bedeutung. Einerseits wollen wir uns nicht vorwerfen lassen, wir wüssten nicht, was wir wollen, und stecken uns hochfliegende Ziele, die zwingend erreicht werden müssen, andererseits führt die Vorstellung unsere Agenda an, dass es das »Neue«, das »Nächste« sein muss, das unser Leben gelingen lässt: Das Glück als Idealziel liegt vielleicht nicht immer in der Ferne, aber doch da, wo wir noch nicht sind. An einem Ziel, das wir nicht kennen. Also machen wir uns schleunigst auf den Weg – aber wohin? Sobald wir das Glück, das gute oder bessere Leben nur dort vermuten, wo wir gerade nicht sind, aber glauben sein zu müssen, werden wir von Suchenden zu Getriebenen – wir achten nicht auf unsere Schritte, schauen kaum links und rechts des Weges, sondern eilen brav nach den Anweisungen eines gesellschaftlichen Navigationsgerätes auf dem effizientesten Weg von Ziel zu Ziel, das uns mit nichts als dem Schein eines möglichen Versprechens ködert.
Dieses Tun hat mit Suchen nichts mehr zu tun, sondern mit Effizienz und Schnelligkeit: Wenn wir in der kürzest möglichen Zeit das meiste rausholen, kann es nicht falsch sein, und irgendwo werden wir es schon finden, das verdammte Glück. Es geht nicht mehr darum, was wir da eigentlich tun, sondern wie schnell wir es erledigen können, damit Zeit für das Nächste bleibt. Kein Anhalten mehr möglich, keine Ruhe und kein Moment des Innehaltens – und selbst wenn uns das Glück in diesem Hamsterrad doch einmal über den Weg laufen sollte, würden wir es wahrscheinlich nicht erkennen. Zu schnell, zu flüchtig – aber darin liegen nicht zwingend Eigenheiten des Glücks, es hat ganz schlicht und einfach kein großes Interesse an Effizienz. Es scheint nicht mal ein Verhältnis zwischen beiden zu geben, eine Art Kriterium oder Maßstab, mit dem wir das eine mit dem anderen verbinden könnten.
Selbst das liebe Geld als möglicher Maßstab für die Bedingung eines glücklichen Lebens ist kein hinreichendes Kriterium. Zumindest nicht dann, wenn ein Grundmaß an finanzieller Sicherheit gewährleistet ist. Die US-Glücksforscher Ed Diener und sein Sohn Robert Biswas-Diener haben in einer Studie gezeigt, dass das Glücksniveau nicht mit dem eigenen Wohlstand steigt.4 Auch Untersuchungen des griechischen Volkswirts Stavros Drakopoulos bestätigen diese Erkenntnis, der in seinen Forschungen den Zusammenhang von Werten und Wirtschaftstheorie herausarbeitet.5
Diese Forschungen zeigen, dass wir, um glücklich sein zu können, zwar keine finanzielle Not leiden oder ständig finanzielle Sorgen mit uns herumtragen dürfen, sich das Glück aber dennoch einfach nicht an die Prinzipien ökonomischer Maximierung halten will. Faktoren wie Freiheit, Freundschaft, Vertrauen et cetera beeinflussen unser Empfinden von Glück deutlich mehr als unser materieller Status. Keine revolutionäre Erkenntnis, aber eine, die uns ab und an bei zu treffenden Entscheidungen helfen könnte, wenn wir es wieder nicht schaffen, mit unseren Freunden ins Theater zu gehen, oder das Schulfest verpasst haben, wenn wir glauben, dass die nächste Beförderung endlich Ruhe bringt und wir dafür kaum noch wissen, wie es unseren Kindern geht. Wenn wir also immer noch davon ausgehen, dass reiche auch die glücklicheren Menschen sind, dann liegen wir offenbar falsch – und wir sollten unsere Ziele schleunigst überdenken.
Eine wichtige Einsicht heißt demnach: Das Paradigma der gehetzten Unzufriedenheit auf der Suche nach Status und materiellem Glanz hat mit tatsächlicher Suche nichts zu tun, es verhindert sogar gerade das, was notwendig ist, um uns auf die eigentliche Suche zu machen. Denn das Erreichen dieser Ziele erlöst uns leider nicht von dem Streben nach mehr. Was uns zu Gehetzten macht, ist in diesem Kreislauf aber weniger die Flut an Möglichkeiten, die wir im Gegensatz zu unseren Vorfahren zu bewältigen haben, sondern das Missverständnis, dass wir glauben, das Streben bei der nächsten Ankunft beenden zu können, wenn wir uns selbst nur die richtigen Ziele gesetzt haben: Wunschlos glücklich zu sein ist ein Paradox, wenn wir das innere Streben als menschlichen Wesenszug ernst nehmen, denn es gehört zu einem glücklichen Leben dazu, Fragen, Sehnsüchte, Wünsche zu haben – Wünsche, die wir aber nicht zwingend erfüllen können und die nicht immer etwas damit zu tun haben, was wir alles leisten, schaffen und herstellen können. Moderne Freiheit und individualistische Sinnsuche hin oder her.
Das, was wir unserer modernen freiheitlichen Lebenswelt verdanken, ist genau diese Möglichkeit: nach dem Glück streben zu können – the Pursuit of Happiness, wie es in der amerikanischen Verfassung sogar festgeschrieben wurde. Das bedeutet aber weder die Garantie, es auch tatsächlich zu finden, noch das Gefühl eines automatischen Scheiterns, weil wir aus dem Streben nicht herausfinden – denn oftmals liegt das wesentliche Glücksgefühl darin, etwas tun zu können, es aber nicht zwingend zu müssen.
Sind es also viel weniger das Geld, der Reichtum oder der Status, sondern die Rolle der Freiheit, die wir für ein glückliches Leben stärker in den Blick nehmen müssen? Es scheint nicht so zu sein, dass mehr Freiheit auch mehr Glück bedeutet, aber so ganz ohne das Gefühl, frei sein zu können, ist ein glückliches Leben für uns fast unvorstellbar. Wie also gelingt ein gutes Verhältnis von Glück und Freiheit? Über viele Jahrhunderte haben Menschen unter ebenden Umständen gelebt, in die sie hineingeboren waren, sie nannten es Schicksal, Religion oder Ordnung, gehörten bestimmten Familien und gesellschaftlichen Schichten an, die ihren Weg vorzeichneten, und in den meisten Fällen gab es wenig Spielraum dafür, sich ständig neu zu erfinden und die eigene Lebensführung auf den Prüfstand zu stellen. Ihr Streben galt anderen Dingen – einer anständigen, tugendhaften Lebensführung, religiöser oder sozialer Pflichterfüllung, der Meisterschaft in einer bestimmten Fähigkeit oder Ähnlichem. Das heißt nicht, dass zu diesen Zeiten die Menschen glücklicher gewesen wären, aber es bedeutet, dass das persönliche Glücksstreben viel weniger Teil ihrer inneren Suche war. Darum ging es schlicht nicht – oder zumindest nicht so sehr.
Diese Zielsetzung im eigenen Leben beginnt sich erst mit der sogenannten Moderne als individuelles Streben auszuprägen, also in der Epoche, die das Mittelalter ablöst und damit einen Weg aus einer stark religiösen Weltordnung in eine säkularisierte Welt eröffnet. Das neuzeitliche Denken entdeckt das, was wir heute als persönliche Freiheit selbstverständlich finden, und knüpft damit vielfach an die antiken Denker an, die trotz einer lebendigen Götterwelt die Entfaltung der eigenen Fähigkeiten im Sinne des Gemeinwohls für bedeutend hielten (auch wenn dahinter kein demokratischer Gedanke, sondern ein sehr elitäres Lebensmodell privilegierter »freier« Aristokraten stand). Aristoteles entfaltete in seiner »Nikomachischen Ethik« die Grundlagen für ein Leben, das nach »Glückseligkeit« strebt, gemeint aber war keine individuelle Glückssuche, sondern ein soziales Gefüge, in dem das tugendhafte Verhalten jedes Einzelnen zum Gelingen einer gemeinschaftlichen Glückseligkeit beitragen sollte.
Erst zu Beginn der Neuzeit ist ein wahrhaft neues Denken in der abendländischen Welt auf dem Vormarsch, das den Einzelnen auf die Suche schickt und unserem suchenden »Ich« eine zentrale Rolle bei der Erkenntnis und Gestaltung der Welt einräumt. Jedem von uns wird nun die Fähigkeit zugeschrieben, mithilfe des menschlichen Verstandes die Welt aus verschiedensten Blickwinkeln zu sehen und sie zu erklären: »Ich denke, also bin ich«, beziehungsweise in der exakten Übersetzung des lateinisches Satzes auch: »Ich zweifle, also bin ich« – diesen Satz kennen wir alle, und er hat mehr verändert, als wir auf den ersten Blick annehmen mögen. Der französische Denker René Descartes formulierte ihn 1641 in seinen »Meditationes de Prima Philosophia« bei dem Versuch, den Dingen auf einen letzten feststellbaren Grund zu gehen, um immer wieder herauszufinden, dass unsere Erkenntnisse von Bedingungen abhängig sind.6