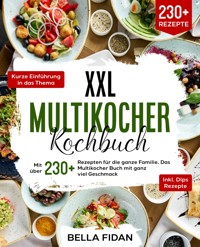14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Hoffnung in Krisenzeiten: durch neues Denken zu mehr Zuversicht. In einer Ära, die geprägt ist von Krisen und Unsicherheit, führt uns die Philosophin Ina Schmidt vor Augen, wie essenziell ein neuer Denkansatz für unsere innere Stabilität und unser Glück ist. Anstelle von Resignation und Verzweiflung plädiert sie für eine andere Sichtweise auf die Welt – eine, die die Welt als lebendigen Zusammenhang begreift, voller Anfänge und Möglichkeiten. Die Philosophie, so Schmidt, stellt für diesen Perspektivwechsel mehr als nur theoretisches Wissen zur Verfügung; sie dient vielmehr als konkreter Wegweiser durch das Labyrinth des Lebens, hilft uns, unsere eigenen Standpunkte zu festigen, und fördert die Verbundenheit mit unserer Umwelt und unseren Mitmenschen. Anhand alltagsnaher Beispiele demonstriert Ina Schmidt, dass Konzepte wie Krisenbewältigung, konstruktives Denken und eine philosophisch geprägte Lebensführung weit mehr sind als bloße Ideen: Sie sind zentrale Elemente für ein gelingendes Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ina Schmidt
Wofür es sich zu denken lohnt
Ein philosophischer Wegweiser für unsichere Zeiten
Über dieses Buch
Hoffnung in Krisenzeiten: durch neues Denken zu mehr Zuversicht
In einer Ära, die geprägt ist von Krisen und Unsicherheit, führt uns die Philosophin Ina Schmidt vor Augen, wie essenziell ein neuer Denkansatz für unsere innere Stabilität und unser Glück ist. Anstelle von Resignation und Verzweiflung plädiert sie für eine andere Sichtweise auf die Welt – eine, die die Welt als lebendigen Zusammenhang begreift, voller Anfänge und Möglichkeiten. Die Philosophie, so Schmidt, stellt für diesen Perspektivwechsel mehr als nur theoretisches Wissen zur Verfügung; sie dient vielmehr als konkreter Wegweiser durch das Labyrinth des Lebens, hilft uns, unsere eigenen Standpunkte zu festigen, und fördert die Verbundenheit mit unserer Umwelt und unseren Mitmenschen. Anhand alltagsnaher Beispiele demonstriert Ina Schmidt, dass Konzepte wie Krisenbewältigung, konstruktives Denken und eine philosophisch geprägte Lebensführung weit mehr sind als bloße Ideen: Sie sind zentrale Elemente für ein gelingendes Leben.
Vita
Ina Schmidt (Jahrgang 1973) studierte Angewandte Kulturwissenschaften an der Universität Lüneburg und promovierte am dortigen Institut für Philosophie. 2005 gründete sie denkraeume, eine Initiative zur Vermittlung philosophischer Praxis. Seit 2010 publiziert sie philosophische Sachbücher für Erwachsene und Kinder. Außerdem arbeitet sie als Referentin für verschiedene Bildungseinrichtungen. Sie ist verheiratet, Mutter von drei Kindern und lebt mit ihrer Familie in Reinbek bei Hamburg.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Coverabbildung Shutterstock
ISBN 978-3-644-02234-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
«Philosophers ask questions.
The best ones challenge us to think again.
If there ever was a time in my lifetime
when we need to think again, it is now.»
Siri Hustvedt, Instagram
16.03.2022
Anmerkung der Autorin: In allen behandelten Fragen und Gedanken dieses Buches sind alle Geschlechter gleichermaßen mitgedacht. Zur besseren Lesbarkeit steht an einigen Stellen die maskuline oder die feminine Form im Vordergrund, in den meisten Fällen habe ich mich bemüht, eine dualistisch-binäre Schreibweise zu vermeiden.
Gedanken können Wege weisen
Stell Dich mitten in den Regen
glaub an seinen Tropfensegen
spinn Dich in sein Rauschen ein
und versuche gut zu sein![1]
Wolfgang Borchert
Vor einiger Zeit war ich zu Gast in einem ehemaligen Schweizer Kartäuserkloster, der Kartause Ittingen in der Nähe des Bodensees. Ein besonderer Ort, der alte Traditionen mit modernem Design und Einkehr und Stille mit der Lebendigkeit einer Holzwerkstatt, Kultur- und Kunstprojekten zu verbinden versteht. Beim Spaziergang durch den Klostergarten stieß ich auf ein Labyrinth, das aus Feldsteinen in die Erde eingearbeitet war. Ich zögerte, den verschlungenen Weg zu betreten, und entschied mich zunächst für eine Bank zwischen den Lavendel- und Rosenbüschen am Rande des Steinornaments. Neben meiner Bank war eine Steinplatte angebracht. Darauf war zu lesen, dass das Labyrinth einen Durchmesser von 16 Metern hatte, sieben Umgänge fasste und die gesamte Gehlänge 205 Meter betrug. Seine Struktur ging auf eine Niederschrift aus dem 9. Jahrhundert zurück, die im Kloster St. Gallen zu finden ist.[2] Über diese sachlichen Informationen hinaus machte die Inschrift aber auch auf etwas anderes, sehr Wesentliches aufmerksam. Es sei wichtig zu verstehen, dass ein Labyrinth nicht immer ein Irrgarten sei: «Es hat zwar einen verschlungenen, mitunter verwirrenden Weg. Doch dieser führt sicher in die Mitte und wieder zurück zur Außenwelt.» Und so schlussfolgerte der Text: «Das Labyrinth kann als Sinnbild für den Lebensweg eines Menschen verstanden werden. Es lädt dazu ein, sich auf einen Weg einzulassen und auf die Mitte zuzugehen.» Die Mitte ist aber nicht das Ziel, wir dürfen uns an diesem Ort der Ruhe nicht einrichten oder im Labyrinth selbst nach Antworten suchen, sondern unser Weg geht weiter. Die in der Mitte gewonnenen Einsichten gilt es auf erneut verschlungenen Wegen in die Außenwelt zu tragen. Nur im Zwischenspiel von innen und außen lassen sich unsere Erkenntnisse überprüfen, vielleicht verändern und immer wieder neu ausrichten.
Dieser Gedanke erschien mir deutlich interessanter als die reinen Sachinformationen. Ganz anders als das antike Ur-Labyrinth, das, in der Antike von Daedalus erbaut, das Monster Minotaurus gefangen halten sollte und durch Irrwege und Sackgassen dazu führte, dass der Weg hinaus nur mithilfe des Ariadnefadens möglich war, bot dieses Labyrinth einen Weg an, der nicht das Herumirren zum Ziel hatte, sondern Orientierung versprach. Anstatt also einfach auf meiner Bank sitzen zu bleiben, machte ich einen Versuch und ging die 205 Meter auf die Mitte zu. Dort blieb ich einen Moment stehen und ging wieder hinaus in die Außenwelt. Gab es bahnbrechende Einsichten? Nein, eher nicht – es hatte sich kaum etwas verändert. Die Sonne schien weiter, die eine oder andere Biene summte durch die Lavendelbüsche, alles wie bisher. Und doch hatte sich ein neuer Gedanke auf den Weg gemacht, eine Frage nach der Unterscheidung von Labyrinthen und Irrgärten. Beim Gehen des Weges waren sich eine jahrhundertealte Tradition und meine sehr gegenwärtige Suche nach Orientierung begegnet, in die Frage mündend, wie sich neue Wege in unsicheren Zeiten finden lassen. Und dieses Zusammentreffen veränderte dann doch etwas: die Möglichkeit, dass Umwege auch auf dem eigenen Lebensweg keine Irrwege sein müssen, sondern ein neuer Zugang zu einer Mitte, die wir noch nicht kennen, und von der aus wir möglicherweise anders in die Welt da draußen zurückkehren können. Auch wenn mich nach den 205 Metern Gehlänge kein Blitz der Erkenntnis getroffen hat und ich keine unmittelbare Veränderung feststellen konnte, hilft mir seitdem der Gedanke an dieses Labyrinth, wenn ich nicht so recht weiß, wohin ich meinen Fuß setzen soll.
Worauf also kommt es an, wenn wir nicht sicher sind, wie wir den nächsten Schritt gehen sollen oder wollen? Was hindert uns, neue Wege zu finden, und wie könnte unser Denken darin wegweisend sein? Darauf gibt es selbstverständlich keine eindeutige Antwort, die Antworten bestehen in Möglichkeiten, die wir suchen und finden müssen. Es gilt zu experimentieren, Wagnisse einzugehen und von anderen zu lernen, die Grenzen der eigenen Möglichkeiten mitdenkend. Denn so schön all diese Gedanken klingen mögen: Die bedenkenswerten Themen sind derzeit ebenso dringlich wie vielfältig, und anders als bei meinem Weg durch das Steinornament ist es von beträchtlicher Bedeutung, dass sich an manchen Stellen etwas ändert. Aber was haben wir damit zu tun? Überall fühlen wir uns aufgefordert, eine Perspektive einzunehmen, eine Meinung zu haben, zu wissen, was richtig ist und wie wir uns engagieren sollten: als Klima- oder Friedensaktivistin, als Parteimitglied, Veganerin oder doch lieber als ehrenamtlicher Hausaufgabenbetreuer an der Grundschule? Aber welchen Beitrag können und sollten wir wo leisten, und aus welcher Haltung entstehen welche Konsequenzen im Handeln? Und wie kann aus diesen Fragen und Antworten ein erster Schritt werden: Welchen Weg wollen wir nicht nur allein, sondern als Gemeinschaft, als Gesellschaft gehen? Jede Entscheidung bedeutet die Verwirklichung einer Möglichkeit, die andere Möglichkeiten unverwirklicht lässt. Die Art und Weise, wie wir über diese Fragen nachdenken, ist also im wahrsten Sinne des Wortes wegweisend: Einzelne Gedanken werden zu Argumenten, zu Gründen, zu Erklärungen oder Theorien, zu Narrativen und Weltanschauungen. Nicht immer und zu jeder Zeit, aber doch häufiger, als wir denken.
Unsere Gedanken sind wesentlich für die Wahl, die wir treffen, welche Wege wir einschlagen und welche nicht – das Labyrinth betreten oder lieber auf der Bank sitzen bleiben? Es macht einen Unterschied, wie ich über die Bedeutung eines solchen Schrittes denke: Wenn ich überzeugt bin, dass mein Handeln eine Wirkung hat, vorbildlich sein und etwas bewegen kann, verhalte ich mich anders, als wenn ich denke, dass dem nicht so ist und ich ohnehin nichts ausrichten kann: Im ersten Fall mache ich wahrscheinlich einen ersten Schritt, im zweiten bleibe ich wohl eher sitzen.
Also scheint es überaus sinnvoll, sich mit dieser rätselhaften Tätigkeit des menschlichen Denkens gerade in Zeiten der Unsicherheit etwas genauer zu beschäftigen. Dabei wollen wir das Denken als den inneren Prozess verstehen, in dem wir Informationen, Erinnerungen, Fragestellungen und Wahrnehmungen so zu verarbeiten versuchen, dass daraus eine sinnvolle Einsicht entsteht, nicht immer eine Erkenntnis – aber auf diesen Unterschied werden wir noch kommen. Allerdings: Tun wir das nicht sowieso? Denken? Schließlich können wir gar nicht nicht denken – oder doch? Was also genau machen wir da eigentlich? Gedanken machen wir uns dauernd, egal, ob wir durch einen Garten schlendern oder in der S-Bahn sitzen, ob wir gerade schwierige Probleme lösen, trauern, die Welt nicht mehr verstehen; ob wir verliebt sind, aufgeregt neue Entdeckungen machen oder gespannt fremdes Terrain betreten. Und doch kommt es offenbar sehr darauf an, nicht nur, dass wir denken, sondern auch, welche Gedanken wir uns warum machen und welche nicht.
Denn über das Denken selbst machen wir uns eher selten Gedanken – es gibt zwar angesehene «Thinktanks» und «Denkfabriken», aber darin wird das Denken eher vorausgesetzt. Und obwohl das kreative Denken mittlerweile als Zukunftskompetenz gilt[3], gibt es in Schulen keinen «Denkunterricht» oder später Kurse für die berufliche Weiterbildung, die wir belegen könnten, auch keine Jobprofile, die sich an ausgebildete Denkerinnen richten würden, sondern es ist etwas, das wir tun, ohne groß darüber nachzudenken.
Das zentrale Anliegen dieses Buches ist jedoch genau das: über das Denken nachzudenken – ohne dabei die verwegene Vorstellung zu vertreten, wirklich abschließend herausfinden zu können, was genau wir tun, wenn wir denken. Es ist selbst das Ergebnis eines denkenden Versuchs, Wege ins und aus dem Labyrinth zu finden, mit oder ohne Ariadnefaden, aber immer in der Überzeugung, dass es einen eigenen Wert hat, dem Denken selbst nach-zu-denken. Es ist die wesentliche Fähigkeit des Menschen, um sich in der Welt zu orientieren, um Entscheidungen zu treffen, Urteile zu fällen und Schlussfolgerungen zu ziehen und damit auch das Gute vom Schlechten zu unterscheiden, dem, wonach wir streben, und dem, wogegen wir aufstehen wollen. Nicht nur ganz grundsätzlich, sondern jeden Tag, immer wieder, an der Bushaltestelle, in der Schlange im Supermarkt oder beim Abendessen mit Freunden. Es macht die Welt weiter, größer und eröffnet Methoden, Begriffe und neue Denkmuster, die uns Orientierung und Anknüpfungspunkte bieten – etwas, das wir zu brauchen scheinen, egal ob in Krisenzeiten oder Momenten der Zufriedenheit. Besondere Aufmerksamkeit bekommt das Denken aber meist erst dann, wenn wir uns Sorgen machen, nicht mehr sicher sind, was wir gerade denken sollen oder wollen. In Zeiten der Unsicherheit, wenn wir in dem, was wir tun, innehalten, Gewohnheiten verändern oder unserem Leben eine neue Richtung geben müssen – wenn wir auf etwas treffen, das uns stört, ärgert, verwirrt, neugierig macht oder erstaunt. Zeiten wie diesen.
Fangen wir also mit dem Nachdenken an. Jetzt, einfach so, und beginnen mit einer schlichten Frage: Was zeichnet unsichere Zeiten eigentlich aus? Fragen, in denen das Wort «eigentlich» vorkommt, eignen sich meist sehr gut, um mit dem Nachdenken zu beginnen. Also: Gibt es überhaupt so etwas wie sichere Zeiten oder unterscheiden sie sich nur in dem, was sie verunsichert? Sind diese Zeiten für alle unsicher oder nur für einige Menschen, und was entscheidet am Ende darüber, wann wir uns warum verunsichern lassen?
Unsicherheiten treten auf, wenn sich das, was wir kennen, zu sehr verändert, wenn wir uns Sorgen um die Zukunft machen, nicht wissen, was wir als Nächstes tun sollen, oder ob das, was wir vorhaben, wirklich eine gute Idee ist. Ein Zustand, der offenbar zunimmt. Studien zufolge fühlen sich immer mehr Menschen hierzulande nicht mehr nur erschöpft, sondern ohnmächtig, haben Zukunftsängste und sind überfordert.[4] Jeder Dritte meidet ganz bewusst die Nachrichten und klagt über ein Leben, in dem alles irgendwie zu viel und das Tempo nicht mehr zu halten ist. Unsicherheit ist in diesem Zuviel die Folge eines Mangels: entweder an Gewissheit, Information, an Kompetenz oder an Vertrauen in das, was kommt.
Sicher fühlen wir uns im Umkehrschluss, wenn wir etwas zu wissen glauben, wenn wir genügend Informationen gesammelt oder ausreichend Erfahrungen gemacht haben. Wenn wir uns auf etwas verlassen können, das uns vertraut und in einem überschaubaren Rahmen berechen- oder prognostizierbar ist. All dies sind Rahmenbedingungen, die Stabilität und damit eine Form von Sicherheit versprechen. Aber auch diese Bedingungen unterliegen in scheinbar «sicheren» Zeiten beständiger Veränderung – also geht es eher um eine Kompetenz im Umgang mit Veränderung und weniger die Rückkehr in statische Zustände vermeintlicher Stabilität. Die Frage ist also, inwieweit uns welche Veränderungen betreffen bzw. wir uns von ihnen betreffen lassen. Denn entkommen tun wir ihnen ohnehin nicht. Auch wissenschaftliche Erkenntnis beruht auf veränderbaren Annahmen, sie birgt Unsicherheiten in der Messung von Daten oder der Entwicklung getroffener Annahmen, jedes organische Gleichgewicht lebt mit Schwankungen und Wandel und ist damit sogar auf ein gewisses Maß an Instabilität angewiesen, um anpassungsfähig zu bleiben. Veränderung ist das Ergebnis von Unsicherheiten und bringt selbst wieder neue Verunsicherung mit sich. Entscheidend ist demnach offenbar weniger die Abwesenheit von Veränderung, die einen Zustand der Erstarrung oder des Stillstands bedeuten würde, sondern vielmehr die Frage, wie wir mit Veränderung umgehen wollen – und welches Maß an Unsicherheit sich in unserem Handeln, Denken und Fühlen unterbringen lässt. Es geht also nicht nur darum, Unsicherheiten auszuhalten, sondern darüber nachzudenken, wie es uns warum mit ihnen geht.
Wenn wir verunsichert sind, mischen sich Gedanken und Gefühle auf eine Weise, die wir nur schwer entwirren können: Wann ist ein Lage unsicher und wann empfinden wir sie als unsicher? Warum fällt das Urteil von Menschen dazu so unterschiedlich aus? Und was können wir in Zeiten der Unsicherheit tun, um uns sicherer zu fühlen – auch wenn wir es nicht sind?
Das Gefühl der Unsicherheit (bleiben wir einmal beim Gefühl) und die Gedanken, die daraus folgen, beschreiben also, egal unter welchen Bedingungen, etwas Abwesendes, das irgendeine Form von Verlust bedeutet. Wir haben etwas in unserem Leben verloren: den Überblick, die Kontrolle, die Orientierung.[5] Nicht jeder Moment der Verunsicherung oder die Erfahrung, nicht genau zu wissen, was als Nächstes zu tun ist, muss aber zwingend zu Angst, Sorgen oder Verzweiflung führen. Ein solcher Moment kann auch dazu einladen, innezuhalten, zur Besinnung zu kommen und genauer zu betrachten, welche Option tatsächlich eine ist und welche nicht: Auch Konzentration, Fokussierung und Klarheit können aus Unsicherheit entstehen, wenn wir uns darauf einlassen, eine Pause einzulegen und uns nach dem Warum unserer Unsicherheit zu fragen. Das heißt nicht, dass wir jede Verunsicherung begeistert umarmen und daraus eine Chance oder ein positives «Reframing» zaubern müssen – es geht vielmehr um die Möglichkeit einer anderen Form der gedanklichen Bestandsaufnahme, die uns anders über das nachdenken lässt, was uns verunsichert. Meist aber weichen wir dieser unfreiwilligen Bestandsaufnahme oder gar einer emotionalen Angemessenheitsprüfung, wie es die Philosophin Heidemarie Bennent-Vahle[6] nennt, aus, eben gerade weil wir unsicher sind. Dabei ist Unsicherheit ein grundlegendes Phänomen, mit dem wir eigentlich ganz gut klarzukommen scheinen. Jeder Tag bringt Ungewissheiten, Unerwartetes und stellt uns vor die Aufgabe, unsere Pläne zu ändern – daran ist nichts Ungewöhnliches. Wir machen Termine, die wir ändern oder absagen, planen große Reisen und nehmen dann doch eine andere Route, schließen Versicherungen ab, wohl wissend, dass jederzeit etwas «dazwischen» kommen kann. Zwischen uns und die gemachten Pläne. Das ist das Leben und wir gehen damit um.
Wenn wir uns jedoch gegenwärtig in der Welt umschauen, geht es nicht nur um individuelle Unsicherheiten und das Suchen und Finden persönlicher Balancen. Verschiedenste Formen von Krisenerfahrungen, von der drohenden Klimakatastrophe, dem Verlust der Artenvielfalt über die Erschütterung demokratischer Ordnungen bis hin zur Sorge um sich wiederholende Pandemien, stellen das, was uns gewohnt und vertraut, vielleicht sogar selbstverständlich und richtig vorkommt, ganz existenziell in Frage. Es sind die ganz großen Fragen, die uns beschäftigen: Wie begegnen wir der Klimakatastrophe? Haben wir eine Verantwortung für nachfolgende Generationen? Kann man mit Waffen Frieden schaffen? Welche ethischen Standards sollte es in der KI-Entwicklung geben?
Es geht also um Unsicherheiten, die die Grundlagen dessen betreffen, worüber wir nachdenken können und wollen, es geht um die grundsätzliche Frage, wie wir als Gesellschaft, als Menschen zusammenleben wollen und können. Aber kann ich dazu überhaupt Antworten finden, Stellung beziehen, so ganz allein, mitten in meinen persönlichen Unsicherheiten? Welchen Informationen kann, soll oder will ich trauen? Weiß ich noch, was wahr und falsch, möglich oder unmöglich ist und wofür es sich zu kämpfen lohnt? Ja und Nein. Ja, aber. Nein, aber dann doch. Oft genug wird uns in den rasanten Entwicklungen, den Multi- bzw. Omnikrisen und katastrophalen Prognosen die Suche nach einem eigenen Standpunkt schon zu viel. Und: Welchen Kampf will, welchen kann ich überhaupt kämpfen, und was ändert das schon? Im Großen wie im Kleinen? Welche politische Debatte kann ich führen, welchen Streit vermeiden und welchen Konflikt endlich mal austragen? Wie erziehe ich meine Kinder in diesen Zeiten richtig? In was für einem Unternehmen möchte ich arbeiten und in welchem nicht? Und warum ist es so schwer, eine bezahlbare Wohnung zu finden? Leise Resignation macht sich breit, Erschöpfung, Rückzug in die Innerlichkeit, Verdrängung, Chips und Netflix.
Aber selbst wenn wir uns in die Zerstreuung retten, die Nachrichtenapp löschen, das Radio ausschalten und das Handy aus der Hand legen, um uns in unsere persönliche Welt zurückzuziehen, bleibt eine Frage, die uns meist weiter beschäftigt: Was ist in solch unsicheren Zeiten noch ein gutes, ein gelingendes Leben? Wo will ich hin, wer will ich sein, und warum ist das so? Rückzug mag eine Möglichkeit sein, eine Antwort ist er sicher nicht. Denn egal welche Antwort wir finden, der Lauf der Dinge weigert sich, eindeutig zu sein, und damit sprudelt die Quelle der Unsicherheiten munter weiter.
Denn nicht einmal in der Resignation und der Klage, in unsicheren Zeiten zu leben, finden wir Eindeutigkeit. Denn dann gibt es diese Augenblicke, die das dunkle Bild stören. Wir müssen einräumen, dass trotz allem noch jede Menge Dinge gelingen, Menschen das Gute wollen und es sogar erreichen. Es gibt diese Momente, in denen wir uns auch in unsicheren Zeiten, mitten in Krisen und Notlagen, wohlfühlen, in denen gute Nachrichten Hoffnung stiften. Augenblicke, die zeigen, dass es Menschen gibt, die sich auf den Weg machen, um Plastik aus dem Meer zu fischen und in Krisengebieten für das Wohl anderer ihr Leben zu riskieren, in denen medizinische Fortschritte sichtbar oder neue Lebensmodelle denkbar werden. Kleine Momente, in denen uns die ältere Dame in der Supermarktschlange vorlässt, weil wir morgens nur schnell die Milch besorgen wollten, oder der Kellner dem jungen Mann am Tresen einen Kaffee schenkt, weil der leider nicht genug Kleingeld für seinen Cappuccino dabeihat. Ein anderer Blickwinkel, andere Gedanken, doch unter denselben Bedingungen. Romantisierender Unsinn, unbedeutende Kleinigkeiten – oder aber fundamentaler Perspektivwechsel? Lässt sich hier nicht anknüpfen? Und wenn wir uns nun dem kopfschüttelnden Vorwurf idealisierender Naivität aussetzen müssen und belehrt werden, dies seien Einzelfälle und wir sollten uns den Zustand der Welt einfach mal ansehen – dann versuchen wir doch genau das und fangen bei unserem kleinen, oft privilegierten Alltag an: Wir haben gut geschlafen, gehen unserer Arbeit nach, leben in einem Land, in dem wir unsere Meinung frei äußern, unsere Kinder zur Schule schicken und unsere Katze zum Tierarzt bringen können, und wenn wir morgens eilig aus dem Haus hasten, kommt trotz allem die Sonne hinter den Wolken hervor – zumindest manchmal. Mitten in all den düsteren Gedanken. Was für ein Klischee. Die Bilder passen nicht zusammen. Das Schöne nimmt weiterhin Platz ein inmitten von Leid, Not und Sorgen, Momente der Resonanz mitten im Missklang. Dinge gelingen, Menschen lächeln sich zu.
Sicherheit sieht ganz bestimmt anders aus, aber was bedeutet uns dieses Licht, diese kleinen Momente, in denen das Gefühl sich regt, dass Dinge machbar, Fragen beantwortbar sein könnten? Selbst wenn wir noch nicht genau wissen, wie? Dürfen wir in unserer Morgenroutine den Moment genießen, auch wenn sich die Gesellschaft spaltet? Dürfen wir hoffnungsvoll bleiben, wenn die Polkappen schmelzen? Dürfen wir zuversichtlich sein, wenn so viel dagegen spricht, dass es gut enden wird? Ja, wir dürfen. Gerade jetzt und gerade wir, die überhaupt in der Lage sind, irgendeine Morgenroutine zu pflegen. Vielleicht müssen wir das sogar, und denken mit dem Philosophen Immanuel Kant über eine «Pflicht»[7] zur Hoffnung nach. Auch darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Privilegien haben vielleicht nicht zwingend etwas mit Pflichten, aber sicher etwas mit Verantwortung zu tun: Für all die, die diese eben nicht oder nicht mehr genießen können. Aber dazu wie gesagt später.
Fangen wir also an, gerade in unsicheren Zeiten im Denken das Hoffen zu lernen, genau so, wie es der Philosoph Ernst Bloch in seinem Werk «Das Prinzip Hoffnung»[8] mitten in den Unsicherheiten und Nöten des Zweiten Weltkriegs schrieb. Wenn wir darauf hoffen können, dass sich etwas zum Guten ändern kann, werden wir uns aufmachen, nach neuen Wegen zu suchen, uns anders zurechtzufinden. Es braucht nicht nur andere Blick- sondern auch Denkwinkel, um unsere Gedanken neu zu sortieren, sie abzustauben, auszulüften, vielleicht einmal auf den Kopf zu stellen und herauszufinden, ob manche Dinge nicht auch anders zusammenpassen, als wir immer gedacht haben. Nur so gelingt es, in ein Denken aufzubrechen, das die ambivalente Gleichzeitigkeit von Unterschiedlichkeit in der Welt nicht als Angriff auf eine dualistisch durchorganisierte Erwartungshaltung missversteht, sondern als Aufforderung, sich auch mal zwischen die Stühle zu setzen. Es darf beides geben. Sowohl-als-auch statt Entweder-oder: Die Not und das Schöne, die Angst und die Zuversicht, den Verlust und den Neuanfang. Und manchmal geht es nicht darum, komplexe Zusammenhänge zu entwirren, sondern sich zu trauen, überhaupt einen ersten Schritt zu gehen: Und das ist dann hin und wieder doch die ganz schlichte Entscheidung zwischen einem Ja und einem Nein, Aufstehen oder Sitzenbleiben, auch wenn es anstrengend ist. Und genau darüber gilt es nachzudenken, gut nachzudenken.
Dies ist das Thema dieses Buches. Ein persönlicher Versuch, der im Denken tastend, suchend, experimentierend unterwegs sein und bleiben will. Ein Denkversuch, der nicht so sehr darauf aus ist, das Denken als wissenschaftlichen Gegenstand zu erörtern, neurowissenschaftlich zu erklären oder biologisch zu verorten. Das können andere sehr viel besser. Es geht um das, was Denken bedeutet, wie es sich anfühlt, welche Methoden sich anbieten, wenn wir das Wagnis eingehen, uns mit unserem eigenen Denken zu beschäftigen und uns gedanklich auf den Weg zu machen. Dafür brauchen wir einiges an Rüstzeug, aber vor allem Mut – ganz so, wie es das althochdeutsche Wort «muot» nahelegt, das unter anderem auch «die Kraft des Denkens» meint. Nicht, weil das Denken eine Gefahr birgt (manchmal allerdings auch das), sondern weil es uns fordert, schmerzhaft sein kann und nicht immer zum Ziel führt, wenn wir es als eine kreative und schöpferische Fähigkeit ernst nehmen. Aber es hilft, die Welt anders sehen zu lernen, zuzuhören und sich von Möglichkeit zu Möglichkeit zu hangeln, um sich in verwirrenden Zeiten der eigenen Richtung zu versichern. «Sapere aude!» – «Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen» war einer der Wahlsprüche der Aufklärung, den Immanuel Kant 1784 in seiner Schrift «Was ist Aufklärung?»[9] formulierte – und diesen Mut gilt es auch heute wieder aufzubringen.
Aber denken wir noch etwas weiter zurück. Nicht nur, um zu überlegen, was das Denken eigentlich ist oder sein sollte, sondern wer da eigentlich zu denken in der Lage ist. «Cogito ergo sum» – «Ich denke, also bin ich». Mit diesem Satz hat der französische Denker René Descartes in seinen «Meditationen» im ausgehenden Mittelalter einen markanten Aufschlag gemacht, der dem modernen Menschen die Fähigkeit zuschreibt, dass wir uns die Welt denkend erklären können. Wir stehen als frei denkende Individuen einer Welt gegenüber, die wir mithilfe unseres Verstandes zu ergründen versuchen. Darin liegt der Schlüssel zu so manch fortschrittlicher Entwicklung, aber gleichzeitig der Ursprung einer Spaltung. Wir sind im Denken nicht mehr Teil der Welt, über die wir nachdenken, sondern machen sie uns zur Aufgabe oder als Ressource zunutze. Eben darin liegt offenbar ein Problem, dem wir uns nun mühsam wieder anzunähern versuchen.
Ein Denkbegriff, der uns bis ins 21. Jahrhundert begleiten kann, muss sich also darauf verstehen, Verbindungen zu schaffen, wo Trennungen üblich waren, um neue Denkwege einschlagen zu können. Anknüpfungspunkte zu suchen und Brücken zu bauen, die die Unterschiede nicht zu nivellieren versuchen, sondern sie selbst zum Thema machen. Ein solches Denken kann sich nicht allein auf analytisch-erklärende Kriterien beschränken, nicht allein den eigenen Verstand bemühen, sondern muss in der Lage sein, das sinnliche Erleben und Erfahren einzubeziehen, emotionale Gewissheiten und damit verbundene Praktiken erörtern zu lernen: Ein Denken, das sich im wahrsten Sinne entfalten und Vielfalt auf unterschiedlichen Ebenen sichtbar, hörbar und spürbar machen kann.
Aus einer solchen Denkpraxis – und genau um diese Form einer denkenden Praxis wird es in den folgenden Kapiteln gehen – entsteht eine andere Form der Sicherheit, die Verunsicherung nicht mit bedrohlicher Ungewissheit gleichsetzt, sondern sie als gegeben voraussetzt. An diesem Punkt kommt die Philosophie ins Spiel. Die philosophische Tradition eröffnet in diesem weiten Feld der Fragen und des unvollständigen Wissens andere Perspektiven und Denkmöglichkeiten als beispielsweise die naturwissenschaftlichen Disziplinen. Mit der Philosophin Eva Weber-Guskar setzt das philosophische Denken dort an, wo andere Disziplinen enden.[10]
Die Philosophie wird in diesem Buch allerdings weniger als historischer Fundus für Denkmodelle und Theorien behandelt, sondern als Methode, als fragende Haltung, die das eigene Denken auf den Prüfstand stellt. Es geht darum, sich dem eigenen Denken zu nähern, es auszuprobieren und Gedankenanstöße zu liefern. Anlass dafür waren Gespräche, die mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen sind, Geschichten und Menschen, denen ich begegnen durfte, Künstlerinnen und Denker, die ihr Denken in Projekten umgesetzt und zum Denken eingeladen haben, aber auch wissenschaftliche Forschungen und Untersuchungen, die andere Perspektiven denkbar werden lassen. All das sind Formen, in denen das Denken zum Ausdruck kommt, so selbstverständlich, dass es uns bis in die alltäglichsten Winkel unseres Lebens begleitet – und dann wieder so geheimnisvoll und rätselhaft, dass wir nicht mehr wissen, was wir darüber denken sollen.
Schwerpunkt des ersten Teils ist eine Art Bestandsaufnahme, in der die Tätigkeit des Denkens selbst erörtert werden soll. Außerdem geht es um die Notwendigkeit, sich auf diese rätselhafte und doch so kostbare Fähigkeit einzulassen, zu der wir als Menschen offenbar auf besondere Weise begabt sind. Diese Fähigkeit beschreibt mehr als ein analytisches Aneinanderreihen von Zahlen, Daten und Fakten, die in Theorien, Bilanzen und Tabellen zum Ausdruck kommen. Das reflexive Denken, das eng mit unseren geschärften Sinnen zusammenarbeitet, kann weitaus mehr: Mit offenen Augen und Ohren lehrt es uns, all das, was in der Welt zu sehen und zu hören, zu erleben und zu erfahren ist, für sich zu deuten. Die Instrumente dafür haben wir meist zur Hand, schöpfen ihr Potential aber nicht aus: Das Stellen von Fragen, das Überprüfen von Behauptungen, das Klären von Begrifflichkeiten, mit denen wir umgehen, und das Bitten um Unterstützung, wenn es im eigenen Denken gerade nicht so recht weitergeht. Mit diesen Instrumentarien und Fähigkeiten beschäftigt sich der zweite Teil des Buches. In den einzelnen Kapiteln geht es um die menschliche Wahrnehmung, die ähnlich rätselhaft wie das Denken doch die erste Quelle für das ist, worüber wir auf eine uns besondere Weise nachdenken wollen. Darüber hinaus wird das Sehen und Hören als besonderer Zugang zu dem untersucht, was wir in der Welt wahrnehmen und in einen eigenen Deutungszusammenhang bringen. Daran anknüpfend geht es in drei weiteren Kapiteln um Fähigkeiten, die sich der Verarbeitung all dieser Eindrücke widmen: das Hinterfragen, das Begreifen und das Prüfen.
Im dritten Teil steht dann die Frage im Zentrum, was ein solches Denken in Aussicht stellt – eine Denkwelt, in der wir uns in einer mobil und flüchtig gewordenen Welt einrichten und vielleicht sogar heimisch werden können, wenn wir vertraute Denkgewohnheiten aufgeben oder verändern müssen. Wie machen wir das Ungewohnte bewohnbar? Wie verwurzeln wir uns auf schwankenden Untergründen, von denen wir nicht so recht wissen, ob und wie lange sie uns tragen und Halt geben? Und wohin soll all das führen?
Am Ende stellen wir die Ausgangsfrage noch einmal: Wofür das alles? Und wagen die These, dass das Denken zwar eine ziemlich aufreibende Angelegenheit sein kann, es aber am Ende Inspiration und Hoffnung lebendig hält, Beziehungen stiftet und Verbundenheit zum Ausdruck bringt – und damit sogar mitten in diesen unsicheren Zeiten eine Quelle des Glücks sein kann.
Eine Quelle, die uns zur Verfügung steht, egal, ob wir gedankenverloren durch ein Labyrinth im Klostergarten gehen oder am Schreibtisch nach neuen Lösungen suchen, ob wir über die Zukunft unserer Kinder nachdenken oder einfach gerade nicht wissen, was unser nächster Schritt sein soll, weil wir unsicher sind, ob der Untergrund trägt.
Der Umgang mit Unsicherheiten, welcher Art auch immer, braucht Übung – und je geübter wir darin sind, desto eher können wir erkennen, ob die verschlungenen Wege, auf denen wir unterwegs sind, wirklich zu einem Irrgarten gehören oder Teil eines Labyrinthes sind und wir den Weg zur Mitte nur noch nicht gegangen sind.
Ina Schmidt
Reinbek, April 2025
Teil 1Warum Denken wirklich hilft: Das gelingende Leben in unsicheren Zeiten
Unser schlauer Verstand hat sich offenbar
von unserem empathischen Herzen entkoppelt.
Wahre Weisheit erfordert aber beides:
Denken mit dem Hirn, Verstehen mit dem Herzen.[11]
Jane Goodall
Jeden Tag ein Projekt.» Das war einer der Sätze, den meine Großmutter hin und wieder mit einem leichten Lächeln um die Mundwinkel als Antwort gab, wenn es um ihre Tagesplanung ging. Eine Mischung aus New Work und Seneca, offensichtlich bereits in den 1980er Jahren relevant, aus denen meine Erinnerungen an diesen Satz stammen. Meine Großmutter war fast immer mit irgendetwas beschäftigt: Sie schälte Äpfel, erntete Johannisbeeren, backte Weihnachtsplätzchen oder schichtete den Komposthaufen um. Sie häkelte Mützen, strickte Socken oder saß in Hut und Mantel im Flur und wartete darauf, zu einem Seniorennachmittag abgeholt zu werden – immer etwa eine Viertelstunde zu früh, damit ja niemand auf sie warten musste. Sie hat zwei Weltkriege erlebt, sieben Kinder großgezogen und einen Lebensmittelladen geführt. Meine Großmutter wusste, was Unsicherheit und Krise bedeuteten, wie ungewiss der Ausgang einer Lungenentzündung und so mancher Ehe sein konnte und dass es manchmal einfach nur darum ging, tief durchzuatmen und die Projekte des Tages so gut es eben ging anzugehen. Dabei kann ich mich nicht erinnern, sie klagen gehört zu haben, selbst wenn sie berichtete, dass es nicht immer leicht war – was auch immer dieses «es» gewesen sein mag. Ganz sicher hätte es einiges gegeben, was ans Licht gehört und nicht in dieser Diffusität unverfügbar geblieben wäre. Meine Großmutter war keine überzeugte Denkerin und hielt nicht allzu viel vom Grübeln. Sie hatte ihren Glauben, und vielleicht hat ihr gerade diese Sicherheit das Denken an manchen Stellen erspart, selbst wenn es sinnvoll gewesen wäre.
Und doch war das Festhalten an einem Projekt des Tages eine sehr bedachte Überzeugung, die wohlgewählt an die Jahreszeit und die Notwendigkeiten des Alltags angepasst war. Doch was ist überhaupt ein Projekt? Etwas, das zielgerichtet ist, das einen Anfang und ein Ende hat und der lateinischen Wortbedeutung nach (Vorauswerfen) zukünftiges Handeln in einer bestimmten Zeitspanne bestimmt. Wir haben also meist einen Projektplan oder wissen einigermaßen, was zu tun ist, wenn wir uns vornehmen, auf diese Weise durch den Tag zu kommen. Manchmal sind es auch viele kleinere Projekte, die diese Abläufe bestimmen, aber – so meine Großmutter – eines sollte es schon sein. Der Gedanke, dass das Leben nur auf diese Weise gelingen kann, man nur so den Widrigkeiten und so manchem Verlust begegnen kann, hat sie begleitet und mich schon als Kind auf unbestimmte Weise verwundert und beeindruckt. Etwas Stabiles lag darin, eine selbstgewählte Ordnung, die weit mehr bedeutete, als den eigenen Alltag am Laufen zu halten. Auf diese Weise hat sie der Unsicherheit, dem Wandel, etwas entgegengesetzt, das auch anders hätte sein können. Sie hat Orientierung und Halt ermöglicht, die aus der Erfahrung entstanden ist, dass das Leben selbst diesen Halt nicht zur Verfügung stellt. Dabei hatte diese Struktur aus selbstgewählten Stabilitäten auch ihre Schattenseiten: Ihr stures Festhalten an Abläufen, die durchaus an veränderte Gegebenheiten oder Bedürfnisse hätten angepasst werden können, ihre manchmal verfälschende Rückführung von für sie unverständlichen Informationen auf das, was sie kannte, damit das Neue das Alte nicht zu sehr durcheinanderbrachte (während ich auf einer Rucksackreise durch Guatemala unterwegs war, hat sie ihren Freundinnen erzählt, ich sei in Mexiko, weil sie mit Guatemala nicht viel anfangen konnte), oder die feste Überzeugung, dass jeder Mensch mittags um 12 Uhr hungrig zu sein habe. Diese Überzeugungen waren nicht immer einfach, und viele habe ich nicht geteilt, aber sie haben etwas hinterlassen, worüber es sich für mich nachzudenken lohnt – auch in der Abgrenzung und bei der Suche nach eigenen Projekten und dem Umgang mit Unsicherheiten, die darin unvermeidbar waren und es bis heute sind.
Das, was hinter dieser Suche steht, ist der Wunsch, dass das eigene Leben egal unter welchen Umständen gelingen möge – was auch immer das heißen mag. Denn: Wann genau gelingt eigentlich ein Leben? Was können wir dafür tun und was nicht, was müssen wir ändern und für wen? Diese Fragen sind kein Phänomen des 21. Jahrhunderts oder das Ergebnis von Poly- und Omnikrisen, Krisenphänomenen, die uns in ihrer Vielzahl verunsichern oder so groß sind, dass sie eigentlich irgendwie alles betreffen: unsere Umwelt und unser Klima, unsere Sicherheit und unseren Frieden, unseren Wohlstand und unsere Demokratie.
Die Frage nach den Kriterien für ein gelingendes Leben wurde von Menschen zu allen Zeiten in allen Kulturen gestellt. In der europäischen Geistesgeschichte reicht sie bis in die griechische Antike zurück, in der Platon das «gute Leben» zum Dreh- und Angelpunkt seiner Dialoge machte und sein Schüler Aristoteles mit der Vorstellung einer ethischen Lebensführung dann durchaus pragmatisch wurde: Ein gutes Leben ist demnach ein tugendhaftes Leben, also eines, das bestimmten Werten und Prinzipien folgt. Das Wort Tugenden klingt heute ziemlich verstaubt, und doch ist die Überlegung, wie sich solche «Kardinaltugenden» – die Besonnenheit, die Tapferkeit, die Weisheit und die Gerechtigkeit waren es bei Platon – wohl aus der Welt der griechischen Antike in die moderne Gegenwart übersetzen ließen. Alle anderen Tugenden seien Ableitungen dieser großen vier, und auch im Laufe der folgenden Abschnitte werden wir immer wieder auf sie zurückkommen. Das Ziel eines solchen «tugendhaften» Lebens sei, so war Aristoteles in seiner Nikomachischen Ethik überzeugt, die Eudaimonia, die «Glückseligkeit». Sie ist dabei aber weniger so etwas wie das Ende eines Weges, an dem wir ankommen wollen, sondern gleichermaßen eine Kraftquelle, eine Ressource, mit der wir uns immer wieder in Bewegung setzen, um das Leben gelingen zu lassen.[12] Ein solches Glück sei ein «sich selbst genügendes Gut», wie es der Philosoph formuliert, das aber immer nur im gemeinsamen Tun mit anderen zu finden ist.[13] Es finde sich «in der Verflochtenheit mit Eltern, Kindern, der Frau, überhaupt den Freunden und Mitbürgern», die ebenso nach dem Glück suchen – denn: «der Mensch ist von Natur bestimmt für die Gemeinschaft»[14], nur als soziale Wesen könnten wir überhaupt nach so etwas wie einem gelingenden Leben streben.
Das Leben des Einzelnen kann eben nur so gut sein wie die Gemeinschaft, in der es stattfindet, auch wenn die Güte einer Gemeinschaft heute anderen Maßstäben gehorchen muss als denen der antiken Polis. Dort blieb das Nachdenken über die Fragen des gelingenden Lebens nur wenigen männlichen Auserwählten vorbehalten. Der aristotelischen Orientierung an einer tugendhaften Ausrichtung dieses Nachdenkens können wir folgen, auch wenn diese Ausrichtung eine Übersetzung in gegenwärtige Kriterien braucht. Die Grundidee bleibt: Ein gelingendes Leben bedeutet, dass ich mir im Austausch mit anderen Gedanken darüber mache, was wesentlich ist, welche Fähigkeiten und Kompetenzen dafür gebraucht werden und wie diese gemeinschaftlich zum Einsatz kommen. Das ist eine lebenslange Aufgabe, in der das Gelingen eben immer wieder aufs Neue möglich wird, mit jedem kleinen und großen Projekt.
Eine sehr viel aktuellere Bestätigung für diese antiken Gedanken (und die Projektorientierung meiner Großmutter) finden sich in der berühmt gewordenen Langzeitstudie der Harvard University zur Frage, was Menschen in ihrem Leben zufrieden sein und bleiben lässt. Seit 1938 arbeitet diese Studie kontinuierlich an Antworten. Der derzeitige Leiter der Forschungen, Robert Waldinger[15], kommt zu dem eindeutigen Schluss, dass unsere Zufriedenheit davon abhängt, wie verbunden wir in und mit der Welt sind, in der wir leben. In den sozialen Beziehungen, die wir eingegangen sind, gestalten und pflegen. Daraus entsteht die wichtigste Kraft, die wir brauchen, um mit Unsicherheiten und Wandel umzugehen. Diese Form der Verbundenheit beschreibt einen Zustand, der nicht darauf angewiesen ist, im Dauerglück zu schwelgen, sondern in Bezugnahme zu anderen Menschen, Denkweisen, Gepflogenheiten oder Umgangsformen genügend Stabilität aufweist, um das lebendige Prinzip der Gegensätze auszuhalten. Dieses Gelingen bedeutet weit mehr als das Streben nach und die Erfüllung individueller Wünsche und Träume, es ist vielmehr eine bestimmte Lebensqualität, die uns in die Lage versetzt, unser Leben gut zu leben, unabhängig davon, ob wir wissen, was uns darin begegnet.
Erinnern wir uns an meine Großmutter und denken kurz nach: Welche Projekte wollen wir angehen, was ist nur eine fixe Idee, welche Bedingungen und sozialen Beziehungen brauchen wir, wenn wir mit Veränderungen leben wollen, die wir uns nicht ausgesucht haben? Wie gelingt das, was wir uns nicht ausgesucht haben?
Die Suche nach Antworten beginnt im Denken. Mit Gedanken zu dem, was sich verändert, verändern muss und was bleiben soll. Es geht um ein Denken unter veränderten Bedingungen, ein verändertes Denken über das, was Veränderung ausmacht. Das ist keine leichte Übung, aber eine, der wir uns auf der Suche nach dem gelingenden Leben durchaus annehmen sollten.
Den Dingen nachdenken: Entwicklung oder Veränderung?
Denken heißt, Bestimmtes erkennen und beurteilen, es heißt, unausgesprochene Worte über etwas zu formen, Worte für sich herzusagen, ohne sie ins Lauthafte zu bringen.[16]
Hannah Arendt
Wie aber genau widmen wir uns all diesen großen und zum Teil doch recht sperrigen Gedanken? Und wofür? Wäre es nicht leichter, das eigene Leben gelingen zu lassen, indem wir genau das gerade nicht tun und aufhören, uns ständig Gedanken darüber zu machen, was zu tun und zu lassen ist und einfach erledigen, was im Alltag so anliegt? Das ist eine Möglichkeit. Sofern wir aber nur irgendwelchen Listen oder Projektplänen folgen, hat diese Möglichkeit wenig mit Denken zu tun, und damit mit dem, was wir uns hier vorgenommen haben: das Leben denkend besser zu verstehen. Und vielleicht reicht diese Möglichkeit, um den Versuch zu wagen und Gedankenlosigkeit als Option auszuschließen.
Dieses Vorhaben scheint recht ambitioniert, vielleicht eine Nummer zu groß, um auch noch wegweisend sein zu können. Schon die politische Denkerin Hannah Arendt merkte zu Beginn ihres Werkes «Vom Leben des Geistes» an: «Über das Denken zu sprechen, scheint mir so vermessen, dass ich das Gefühl habe, ich sollte eher mit einer Rechtfertigung als mit einer Entschuldigung beginnen.»[17] Allerdings stand für Arendt fest, dass uns das Denken als das auszeichnet, was wir sind, und diese Einsicht den Versuch rechtfertigt, sich dieser Fähigkeit so gut zu widmen, wie wir es eben vermögen. Für Hannah Arendt blieb es zeit ihres Lebens, besonders als Jüdin auf der Flucht vor dem Nationalsozialismus und im amerikanischen Exil wichtig, sich als denkende Person zu verstehen und das Leben nicht gedankenlos geschehen zu lassen. «Das Denken», so schrieb sie, «sagt nicht ein für alle Mal, was das Gute sei». Und dennoch habe es eine enorme Bedeutung, ob wir die Dinge um uns herum gedankenlos hinnehmen, oder nicht, das Denken also selbst zum Thema machen: «Wenn jeder gedankenlos mitschwimmt in dem, was alle anderen tun oder glauben, dann stehen die Denkenden nicht mehr im Hintergrund, denn ihre Weigerung ist nicht zu übersehen und wird damit zu einer Art zu handeln.»[18]
Das Denken ist also gerade in verunsicherten Zeiten ein Akt, für den ich mich entscheiden kann, eine Art zu handeln bzw. die notwendige Voraussetzung für das, was wir gutes Handeln nennen wollen. So gehört der nachdenkliche Moment im Businessmeeting ebenso zur beruflichen Praxis wie das Anpacken, Erledigen und Produzieren.[19] Der oft fest installierte Gegensatz zwischen Theorie und Praxis, Grüblern und Machern, Pragmatismus und Kontemplation schafft Gräben, wo keine sein müssen, auch wenn sich in diesen Begriffspaaren beständig die Frage nach Übergängen, Balancen und unterschiedlichen Gewichtungen von Denken und Handeln stellt: Nicht jeder Gedanke führt zu einer Handlung und es gibt sicher Verhaltensweisen, die gedankenloser sind als andere. Halten wir dennoch fest: Ein «tätiges» Denken entsteht in der Bezugnahme auf das, worüber es nachdenkt. Es ist immer ein «reflexives» Denken, das den Kontext mitdenkt, verschiedene Gründe abwägt und auch mal die Gegenposition einnimmt. Es zeigt konstruktive Möglichkeiten auf und spielt Konsequenzen durch – ein Prozess, der für Hannah Arendt als Erkenntnisprozess «weltbildend» ist und daher erheblich mehr bedeutet als eine kognitive Fähigkeit, die für Analysen, Prognosen oder Produktkalkulationen zuständig ist. Gemeint ist im wahrsten Sinne des Wortes ein über die Analyse von Zusammenhängen hinausgehendes begründetes, abgewogenes Suchen und Finden von Deutungen und Urteilen, die aus einem sorgfältigen und zielgerichteten Überlegen hervorgehen.[20] Oft sprechen wir hier auch von kritischem oder logischem Denken, was bedeutet, dass es stichhaltigen Argumenten folgt und in der Begründung klar und nachvollziehbar ist. Kritisch bedeutet ursprünglich unterscheiden zu können, also differenziert zu denken und Dinge in Beziehung zu setzen. Die Logik[21] begegnet uns hier sowohl als wissenschaftlicher Teilbereich der Philosophie seit der Antike, aber ebenso im Zusammenhang mit Alltagslogiken oder gesellschaftlichen Teilbereichen wie z.B. einer politischen Logik. Gemeint ist dabei eine Form der Transparenz in der Art und Weise, wie gedacht und wie im Denken zu Schlussfolgerungen gelangt wird.
Wir wollen uns hier also auf ein Denken stützen, das in seinem Streben nach Klarheit und Eindeutigkeit dennoch einen Bezug zu der Unvollkommenheit seines Gegenstands herstellt. Wenn wir uns in diesem denkenden Verhältnis auf die Welt richten, gehen wir eine Beziehung zu ihr ein und betrachten sie nicht nur als zu erklärendes Material – wir lernen, uns als Teil der Welt verstehen zu lernen. Daraus entsteht keine logisch eindeutige Theorie, aber auch kein verbohrtes Grübeln, sondern eine wissensbasierte Haltung, die sich kontextbezogen ausrichten kann und darin trotz aller Beweglichkeit urteilsfähig bleibt. Damit ist das gemeint, was sich nach Hannah Arendt von einer funktionierenden Gedankenlosigkeit abhebt, ein Unterlassen des Denkens, das uns den großen Fragen gegenüber wie gleichgültig[22] durch unser Leben gehen lässt.
Das Denken und Handeln, das Hannah Arendt meint, folgt also gerade keinen selbstgewählten Narrativen, die als Behauptung oder persönliche Befindlichkeit ein empörtes «Dagegen» ins Feld führen. Es ist ein Denken, das nicht in