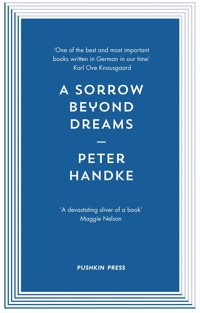10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zurückgekehrt nach jahrelangem Unterwegssein in die Gegend südwestlich von Paris, drängt es den Helden drei Tage später bereits zu einem erneuten Aufbruch. Er will Rache nehmen an einer Journalistin, die seine Mutter in einem Zeitungsartikel denunziert hatte, dem Anschluß ihres Landes an Deutschland zugejubelt zu haben. Eine wahrheitswidrige Behauptung. »›Das also ist das Gesicht eines Rächers!‹ sagte ich zu mir selber, als ich mich an dem bewußten Morgen, bevor ich mich auf den Weg machte, im Spiegel ansah.«
»Ich hatte mir keinerlei Plan ausgedacht oder festgesetzt. Weder mit einem bestimmten Bewegungs- und Ortsplan war ich aufgebrochen noch mit einem sonstigen. Es hatte zu geschehen: So war es in mich eingeschrieben, und das hatte mich auf die Beine gebracht.« Und so mündet der Rachefeldzug in ein Fest, eine bewusste Entscheidung des Erzählers Peter Handke: In die geschriebene Geschichte erhält nur Zutritt, was in der Realgeschichte Bestand hat. Und umgekehrt: Sich vollziehende Geschichte erlangt nur Wirklichkeit, wenn sie des Erzählens wert ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Übersicht
Inhalt
Cover
Titel
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Motto
1. Späte Rache
2. Das zweite Schwert
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Peter Handke
Das zweite Schwert
Eine Maigeschichte
Suhrkamp
Und Er sagte zu ihnen: Wer jetzt einen Geldbeutel hat, nehme den, ebenso einen Reiseranzen, und wer keins davon hat, verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert! … Sie aber sagten: Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter! Und Er sagte zu ihnen: Das genügt
(Lukas, 22, 36-38)
1. Späte Rache
»Das also ist das Gesicht eines Rächers!« sagte ich zu mir, als ich mich an dem bewußten Morgen, bevor ich mich auf den Weg machte, im Spiegel ansah. Jener Satz kam vollkommen lautlos aus mir, und zugleich artikulierte ich ihn; bewegte, indem ich ihn still aussprach, überdeutlich die Lippen, wie um ihn mir von meinem Spiegelbild abzulesen und auswendig zu lernen, ein für alle Male.
Eine solche Art Selbstgespräch, womit ich mich doch sonst, so oder so, und das nicht erst seit den letzten Jahren, oft tagelang allein unterhielt, erfuhr ich in diesem Augenblick als etwas für meine Person Einmaliges, und dazu über mich hinaus Unerhörtes, in jedem Sinn.
So sprach und erschien ein menschliches Wesen, welches dabei war, nach vielen Jahren des Zögerns, des Aufschiebens, in den Zwischenzeiten auch des Vergessens, aus dem Haus zu gehen und die längst fällige Rache zu exekutieren, zwar – vielleicht – auf eigene Faust, doch jenseits dessen im Interesse der Welt und im Namen eines Weltgesetzes, oder auch bloß – warum »bloß«? – zum Aufschrecken und in der Folge Aufwecken einer Öffentlichkeit. Welcher? Derjenigen welcher.
Seltsam dabei: mir wurde, während ich so mich, den »Rächer«, in Gestalt der Ruhe in Person und der Instanz über sämtlichen sonstigen Instanzen im Spiegel betrachtete und wohl eine Stunde lang förmlich einstudierte, insbesondere das Augenpaar, von dem kaum einmal ein Wimpernzucken kam, zugleich zunehmend das Herz schwer und tat mir dann, weg vom Spiegel, weg von Haus und Gartentor, sogar weh.
Mein übliches Reden mit mir selbst war, jeweils gar wortreich, entweder ein nicht allein lautloses, sondern völlig ausdrucksloses und von niemandem – so bildete ich es mir wenigstens ein – bemerktes. Oder ich schrie es, allein im Haus und zugleich – wieder in der Einbildung – allein auf weiter Flur, aus mir heraus, in der Freude, in der Wut, in der Regel wortlos, bloße Schreie, ein jähes Aufschreien. Als Rächer nun aber öffnete, rundete, schürzte, spannte, verzerrte ich den Mund, riß ihn auf, stumm bleibend, in einem deutlichen, wie schon seit jeher, und eben nicht von mir persönlich vorgesehenen Ritual, welches mit der Zeit vor dem Spiegel übergegangen war in eine regelrechte Rhythmik. Und aus solchem Rhythmus waren zuletzt Töne geworden. Aus mir, dem Rächer, war ein Singen gekommen, ein Singsang, ohne Worte, ein bedrohlicher. Und der hatte das Herzweh hervorgerufen. »Schluß mit dem Singen!« schrie ich mein Spiegelbild an. Und es hatte auf der Stelle gehorcht und sein Gesumme abgebrochen, das Herz freilich so doppelt beschwerend. Denn jetzt gab es kein Zurück mehr. »Endlich!« (Wieder geschrien.)
Auf zum Rachefeldzug, zu führen von mir als Einzelperson. Erstmals seit einem Jahrzehnt nahm ich, der ich mich all die Zeit höchstens geduscht hatte, ein Morgenbad, stieg alsdann, ein Bein und ein Arm schön nach dem andern, in den grauschwarzen, im voraus auf dem Bett mitsamt dem von eigener Hand frischgebügelten weißen Hemd säuberlich ausgebreiteten Dior-Anzug; dem Hemd an der rechten Hüftseite eingestickt ein dickschwarzer Schmetterling, den ich einen Fingerbreit oberhalb des Gürtels in das Blickfeld rückte. Die Reisetasche, welche für sich allein mehr wog als das, was drin war, geschultert und aus dem Haus, ohne dieses abzusperren, nach meiner Gewohnheit selbst bei längeren Abwesenheiten.
Dabei war ich doch erst vor drei Tagen nach mehreren Wochen Stromerns durch das nördliche Landesinnere in meinen Stammwohnsitz-Vorort südwestlich von Paris zurückgekehrt. Und zum ersten Mal hatte es mich heimgezogen, mich, der seit dem gar vorzeitigen Ende, wenn nicht jähen Abbruch seiner Kindheit sich vor jeder Art Heimkehr, von jener zu der Geburtsstätte zu schweigen, gescheut, ja den es vor gleichwelchem Heimkommen gegraust hatte – ein Einschnüren im Körper bis in die untersten und letzten Darmausläufer – besonders dort.
Und diese zwei, drei Tage nach meiner, spät, aber doch, erstmals im Leben nicht »glücklichen« (bleib weg von mir, Glück!), vielmehr harmonischen Heimkehr hatten mein Bewußtsein, an Ort und Stelle zu sein, und das ein für alle Male, bekräftigt. Nichts mehr würde meine Ortsansässigkeit wie auch -verbundenheit in Frage stellen. Es war eine Freude am Ort, eine stetige, und solche Ortsfreude nahm die Tage (und Nächte) lang noch zu, und war auch, anders als in den fast drei Jahrzehnten zuvor, nicht mehr beschränkt auf Haus und Garten, hing in keiner Weise ab von den beiden, galt allein und rein dem Ort. »Dem Ort inwiefern? Dem Ort im allgemeinen? Dem Ort im speziellen?« – »Dem Ort.«
Zu meiner ungeahnten Ortsfreude, wenn nicht darüber hinaus Ortsgläubigkeit (oder, wenn ihr wollt, meinem späten Lokalpatriotismus, wie der sonst eher gewissen Kindern zu eigen sein kann) trug auch bei, daß in der Gegend gerade eine der im Lauf der Jahre, nicht bloß in Frankreich, zahlreich gewordenen Ferien deklariert waren, nicht die langen des Sommers, sondern die um Ostern herum, gar nicht so kurz auch sie, verlängert jetzt im fraglichen Jahr meiner Rachegeschichte noch um die Zeitbrücke hin zum Ersten Mai.
So sorgten die Abwesenheiten, solche wie solche, für einen weiten und von Tag zu Tag weiteren, und in Momenten, die für den ganzen Tag standen, gar grenzenlosen Ort. Taglang nicht mehr das jähe Hundedoppel-Gebrüll hinter der Hecke, bei dem mir die Hand, ob sie nun gerade Worte oder Zahlen (auf einem Scheck, einer Steuererklärung) schrieb, wegschnellte und einen Strich, und einen wie dicken!, machte quer über das ganze Papier, Scheckpapier oder sonstwelches. Wenn doch noch ein Hund bellte, dann einer in weiter Ferne, wie am Abend einst auf dem Land, was jetzt auch zu Bewußtheit und Raumgefühl von Heimkehr, oder wenigstens bald bevorstehender, beitrug.
In dieser Zeit waren weniger Leute unterwegs; viel weniger. Es kam vor, daß ich auf den Straßen und dem sonst oft überbevölkerten Bahnhofsplatz vom Morgen bis zum Abend nur zwei, drei Menschen begegnete, und diese waren meist Unbekannte. Aber auch der eine oder andere mir vom Sehen Vertraute ging, stand, saß (vor allem saß er) als Fremder? Als jemand Anderer. Und ob Bekannte oder Unbekannte: regelmäßig grüßten wir einander, und das war einmal ein Grüßen. Oft wurde ich auch nach dem Weg gefragt und wußte immer, wo was war. Oder fast immer. Aber gerade, indem mir einer der Ortswinkel nicht gewärtig war, brachte es mich, und den Andern, auf die Sprünge.
Alle die drei Tage nach meiner Heimkehr keinmal das Rattern der Hubschrauber, welche sonst die Staatsbesuche vom Militärflugplatz auf dem Plateau der Ile-de-France hinab zum Elysée-Palast im Tal der Seine oder zurück transportierten. Keinmal von der Landestelle dort, vom Frühlingswind zu »uns«, so dachte ich unwillkürlich jetzt von mir und meinen Mitansässigen – herübergeweht die Bruchstücke der Trauermusik, mit welcher in der Normalzeit die Särge der in Afrika, Afghanistan oder sonstwo ums Leben gekommenen Soldaten, ausgeladen aus den Staatsflugzeugen auf das Ehrenpodest namens »Tarmac«, im französischen Vaterlande begrüßt zu werden pflegten. Der Himmel, allein in mittlerer Höhe durchkreuzt, durchkurvt, durchflattert, durchflittert (die ersten Schwalben) und durchschossen (ein so anderes Schießen, und überdies nicht das Spätkommen im Jahr der Falken und sonstigen Greifkrallen) von beinah allen möglichen Vögeln, und dazu, wieder eine Abwesenheit, kein sonst Sommer für Sommer allein im leeren Himmel zuhöchst im Zenit kurvenziehender Adler, angesichts dessen ich einmal, an einem lautlosen Hochsommermittag, in der Vorstellung, unten auf dem Erdboden ebenso allein zu sein, über die Gegend hier hinaus, sage und schreibe die Vision hatte, eine eher apokalyptische, und so oder so eine des Grauens: Ich sei, im Visier des Riesenadlers, im letzten noch übrigen Himmelsloch hier auf Erden der letzte Mensch.
Und – um nach solcher Sphärenschau wieder die hiesigen Teerstraßen und Steinpflaster unter den Sohlen zu gewinnen: dazu noch alle die Tage kein vormorgendlicher Mülltonnenkrach, oder kein übliches pausenloses Gerumms-und-Getöse, sondern, wenn Krach, ein sporadischer, jetzt hinter sieben Seitenstraßen, jetzt drei Steinwürfe weg nach dem zweiten Rondell, und jetzt, ein, zwei Halbschlafträume danach, die Tonne vor der Tür des nächsten Nachbarn, desjenigen, welcher in seinem inzwischen recht langen Erwachsenenleben, soviel ich weiß, noch keinmal über Haus und Ort hinausgekommen ist: Auch hier, wie dort hintendraußen von den spärlichen andern, von den Nachbarmülltonnen weder Knall noch Fall – beim Leeren, als sei da kaum was zu leeren, jeweils kaum ein kurzes Aufrauschen, dann Rascheln, fast ein Gezirp, nah an einem wie geheimen Klingeln; zuletzt einem sachten Zurück-auf-den-Platz-Stellen, wohl auch dank der besonderen, mir von der Bahnhofsbar von Zeit zu Zeit zutrinkenden örtlichen Müllmänner. Und in der Folge die Fortsetzung der auf den Tag einstimmenden Halbschlafbilder.
Immer wieder im Leben war mir in den Sinn gekommen die alte mehr oder weniger biblische Geschichte von dem Mann, der von Gott oder sonst einer höheren Gewalt von seinem Stammort am Haarschopf weggelupft wurde ganz woandershin – in ein anderes Land. Und ich für meine Person hätte mir, im Gegensatz zu dem Helden der Geschichte, der, scheint mir, lieber an Ort und Stelle geblieben wäre, auch so ein Weggetragenwerden von meiner Bleibe gewünscht, zuhinterst am Schopf gepackt, dank einer gnädigen Macht querluftein ferntransportiert zu einer anderen Bleibe? Nur keine Bleibe! Nichts wie wegexpediert von jetzt und hier!
Während der drei Tage vor meinem Mich-auf-den-Weg-Machen für die Rache-Aktion zog ich mich fast stündlich eigenhändig am Schopf, aber nicht, um mich vom Boden abzuheben und fort, hinter die Horizonte, zu schrauben, sondern um mich zu verankern, oder bodenständig zu machen, da mit beiden Beinen zu stehen, wo ich jetzt und hier war, und, o Wunder oder auch nicht, für einmal heimisch war. Wie rupfte ich jeden Morgen gleich nach dem Aufstehen mir den Schopf, mit der linken Faust, dann der rechten, riß und rüttelte, stark und stärker, nah an einem Gewaltakt gegen mich selber – von außen gesehen vielleicht einer, der dabei war, sich selber den Schädel abzureißen –, und spürte das doch als eine Wohltat, die von oben nach unten allmählich bis in die Schenkel, die Knie, die kleinste Zehe den ganzen Körper, und nicht allein den, erfüllte, still durchpaukte, tonlos durchtrommelte mit von Stunde zu Stunde neu bedrohter Ortsfestigkeit.
Zu dieser Merkwürdigkeit – alle paar Jahre eine andere, die mir aber die Augen aufgehen ließ – paßte, daß mir von einem Tag zum andern, da und dort eins der sonst während der zwei Wochen der Osterferien verwaisten Häuser bewohnt erschien. Als sei das eine örtliche Regel oder sogar ein Ortsgesetz, fand ich mich jeweils nach dem Vorbeigehen an einem Dutzend verschlossener Rolläden und dergleichen vor einem Haus, wo zumindest eins, wo nicht alle der Fenster, insbesondere die im Parterre, den Einblick ins Innere, in die Wohn- und Eßzimmer ließen. Indem zusätzlich die Vorhänge weggezogen waren, wie vorsätzlich, hatte das, auch ohne gedeckte Tische, etwas Gastliches, ja Einladendes: »Bitte, einzutreten, wer auch immer!« Dabei zeigten sich diese Räume ein jedesmal menschenleer. Und ebendiese Menschenleere verlockte, näherzutreten, und machte Appetit, einen umfassenden. Undenkbar, daß irgendwo in der lichten Weite solch eines Hauses da jemand, Herr oder Frau Eigentümer, oder das ganze Paar, die vollzählige Sippe aus einem versteckten Winkel drinnen einen ausspähte, ob als Lebendgestalt oder auf einem Bildschirm. Ich fühlte mich ein jedesmal zwar gesehen, aber mit Blicken des Wohlwollens und des Entgegenkommens. Diese Häuser waren nur im Moment menschenleer; ein Augenblick, und ich würde willkommen geheißen, aus einer ganz unvermuteten Richtung, ob französisch, deutsch, arabisch (alles, nur kein »welcome!«). Und dazu die Stimmen von Kindern wie von hoch aus Baumkronen.
Und einmal, am zweiten oder dritten – und vorläufig letzten – Morgen meiner Rück- und Heimkehr, rauchte dann vor einem solchen unbevölkerten Gast-Haus in dem winzigen Vorgarten, wo die Gräser als Gräser wuchsen, statt einen Rasen, oder sonstwas, darzustellen, ein wie gerade aus Eisenstangen improvisierter und so gleichsam altertümlicher Barbecue-Rost, zweierlei Rauch aus zwei eng benachbarten Feuerstellen, wobei die Rauchfahne zur einen Hand klassisch senkrecht und gleichmäßig hell himmelwärts strebte, indes die zur andern Hand ebenso klassisch weg zur Erde gedrückt wurde, ein dunkler rußiger Qualm, wenn auch nur anfangs, im Wegstieben von der Feuerstelle: denn danach, auf quirligen bodennahen Umwegen, fand ebenso dieser zweite Rauch, im Widerspruch zur vorsintflutlichen Brudermordstory, himmelauf in die Senkrechte, das schwärzlich hin und her puffende Gequalme ging über in hellweiße Federwölkchen, zu verwechseln (fast) mit jenen halb durchsichtigen aus dem Zwillingsrost, erstaunlicher noch, eine wahre Weltneuigkeit: die zweierlei Rauchsäulen trafen oben, kurz vor dem beiderseitigen Ganzdurchsichtigwerden und im Luftraum Verschwinden, sogar noch, für Augenblick um Augenblick, zusammen; verknüpften sich miteinander; verflochten sich ineinander, und das in einem fort, und immer wieder neu, in dem Maße, wie unten vom Rost die eine und die andere Rauchrakete aufstieg.
Und siehe da: Wer jetzt aus dem scheinbar leeren Haus trat und mich in den Garten zum Schmaus lud, das war, gefolgt wie eh und je ein paar Schritte dahinter von ihrem Mann, die ehemalige Briefträgerin, la factrice, welche seit einigen Monaten, gleich ihrem Mann, auch er ein Briefträger, facteur, der, schon seit Jahren, pensioniert (worden) war. Immer noch bewahre ich den Zettel auf, wo sie, »votre factrice Agnès«, uns, der Bevölkerung der Gegend, mitteilt, daß sie, immer mit dem Rad unterwegs, »am 10. Juli 20.. ihre letzte Runde, tournée, drehen wird«, und als ich das Papierstück einmal verloren glaubte, war das mir, der doch so vieles im Leben ohne Bedauern verloren hat, fast ein Jammer – ein Lichtblick, dann unter all dem Zettelwerk, ohne Suche, gerade auf den einen Zettel da, wie er nun vor mir auf dem Tisch liegt, zu stoßen. Wir haben wieder bis lang in den Nachmittag zu dritt im Garten gesessen, und die beiden einstigen Briefträger erzählten, wie sie, der Mann aus den Ardennen im französischen Nordosten, die Frau aus dem gebirgigen Teil Südwestfrankreichs, von der Zentralpostbehörde in die Gegend von Paris und die Ile-de-France geheuert worden waren, als die ungelernten Leute vom Land, welche aber, robuster als die Metropolitaner, gerade die richtigen für das Postausfahren mit Rädern – damals, versteht sich, noch ohne Motoren – wären für die ungezählten Steigungen im großen Umkreis Paris, die geeigneten Pedaltreter für die regionspezifischen Ile-de-France-Passagen, in der Radfahrersprache, auch bei der Tour de France, faux plats geheißen, »falsche Ebenen«, kaum sichtbare, dafür auf dem Rad umso spürbarere, nicht endenwollende Steilstellen.
Obwohl es noch eine Zeit hin bis zum Sommer war, ist mir dieser eine Tag, sind mir überhaupt alle die drei Tage im Gedächtnis als die längsten des ganzen Jahres: als werde die Nacht jeweils hinausgezögert über die natürliche Tag-Nacht-Grenze; als gehe die Sonne, »wie durch ein Wunder«, eigens nicht unter, jedenfalls bis zu meinem Mitdabeisein in der folgenden Ortsepisode, und noch so einer, und noch einer. Und selbst die Nächte kamen ohne die Empfindung eines Dunkelwerdens.
Wieder siehe!: Zwar waren die Rolläden an dem Eigenbauhaus des nun bald vor einem Jahrzehnt rasch hintereinander weggestorbenen Nachbarnpaares weiter, wie seit damals, heruntergelassen – die Farbe, gute Malerarbeit, noch nirgends abgeblättert –, aber durch den verstruppten Garten, wo da und dort, prächtiger als vordem, eine Rose am Aufblühen war, spannte sich eine Wäscheleine steckvoll ausschließlich mit Kindersachen, mehr oder weniger dunklen, früher hätte man gesagt, »ärmlichen«.
Und hör: An den Wegen der Hügelwälder das Knarren und Quietschen der Äste, sich aneinander reibend im Wind als Wiederholen der sich gastlich öffnenden Garten-, Haus- und Weinkellertüren der Gegend (die eine Feuerstelle war nicht die einzige geblieben).
Und da schau her: Die Lichtung, wo üblicherweise schon von weitem das Klicken der Hundertschaften von Boulekugeln herschallte, leer bis auf ein Auto am Rand, hinterm Lenkrad ein Mann mit still offenen Augen, unbeirrbar nichts als die Lichtung im Blick, die weite Schotterfläche mit den Spuren der Spielkreise, eigens dazu an dieser Stelle gehalten, gleich wie, so sagt man, manche Portugiesen aus dem Landesinnern an die Küste fahren, mit nichts im Sinn, als eine Zeitlang, ohne Aussteigen immer schön im Auto geblieben, den Ozean vor sich zu haben. Aber ist der Mensch da nicht in der Tat ein Portugiese, ein Maurer, anders als heute oft mit zementbestaubten Haaren, einer der Nebenmänner abends an der Bahnhofsbar?
Und so hör doch: das Rauschen jetzt tief unter der Seitenstraße: Das kann nicht die Kanalisation sein! – Aber was ist es? Woher kommt es? – Es kommt von dem Bach oder kleinen Fluß, der im Lauf der Jahrtausende unser ganzes, wenn auch nicht gar langes Hochtal gegraben hat, von seiner Quelle oben unweit vom jetzigen Schloß, von Versailles bis unten zu seiner Mündung in die Seine, in den Untergrund verlegt vor mehr als einem Jahrhundert. – So rauscht da in der Tiefe versteckt unser Marivel? – Ja, das ist er, das ist sein Name, und schau, die Biegung der Straße: wie sie den Lauf und die Biegung des Marivel genau nachzieht. Was für ein Rauschen. So rauscht keine Klosettspülung, keine Waschmaschinenschleuder, kein Feuerwehrschlauch – so rauscht allein ein Bach. Und du wirst sein Wasser gleich sehen, es vor dir haben, bei Tageslicht, dich damit waschen, es trinken (na, trinken wohl besser nicht). – Wie das? – Schau dort, die Pumpe, die gußeiserne im verwachsenen Garten. Geh hin und pumpe! – Aber die Pumpe ist doch verrostet. – Weg der Rost und weitergepumpt. – Jetzt kommt was, eher Schlamm und Dreck, kackbraun. – Pump weiter, kleiner Pumper, pump weiter. – Ja, da schau her!