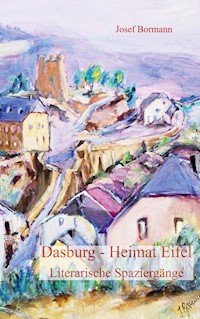
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
In den literarischen Spaziergängen dieses Buches geht es nicht nur um schöne und ausgewählte Wanderrouten in einem noch weitgehend unentdeckten, einsamen Landstrich der Eifel an der Grenze zu Luxemburgs Norden, sondern auf einer tieferen Ebene um das Thema Heimat. In vier persönlichen Wanderungen durch Landschaft, Dorf und Kirche werden Gegenwart und Vergangenheit, persönliche Erinnerungen und Reflexionen zum sozialen Wandel miteinander verknüpft. Mit Gemälden des Autors werden die Texte ergänzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
Vom literarischen Spazierengehen
Spaziergang
Durchs Ourtal entlang der Mühlen und Grenze
Durch einsame Loh- und Fichtenwälder
An Our und Rellesmühle
Brücke und Grenze zugleich
Von der Frankmühle zurück in die Gegenwart
Spaziergang
Von der Burg durchs Dorf
Durchs Burggelände
Im Dorf unterwegs
Spaziergang
Über die „Hohe Kuppe“ ins Mühlbachtal
Hinauf zur „Hohen Kuppe“
Im Mühlbachtal
Über die Höhen von Dahnen
Spaziergang
Gemeinsamer Gang an Allerheiligen
Von der Kirche im Mittelpunkt
Auf dem Weg zum Friedhof
Zur familiären Einkehr
ÜBER DEN AUTOR
Dr. Josef Bormann,
1946 in Dasburg geboren, aufgewachsen in der ländlichen Idylle eines typisch katholischen und geschlossenen Dorfmilieus der Eifel in den Fünfzigerjahren. Mit vierzehn aufgewacht im Konvikt zu Trier mit der schmerzlichen Erfahrung, dass es noch eine andere Welt da draußen gibt. Ende der Sechzigerjahre, Studium der Theologie in Trier und München und im Miterleben der studentischen Revolte dieser Zeit, insbesondere in München, die Entdeckung der Freiheit und allmähliche Loslösung von allerlei tief eingeprägten sozialen und kirchlichen Zwängen.
Beruflicher Einsatz als einer der ersten Laientheologen im Bistum Trier im Rahmen der Hochschulseelsorge, dabei gleichzeitige Aus- und Weiterbildung für die praktische Arbeit mit Einzelnen, Gruppen und in Organisationen. Verschiedene berufliche Tätigkeiten in Lehre und Beratung in den verschiedensten Feldern des kirchlichen Bereichs. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.
Mit Eintritt in den Ruhestand Kurse in Malerei an der Europäischen Kunstakademie Trier. Eigene Mal- und Ausstellungstätigkeiten.
Mit zunehmendem Alter, geläutert und gereift, ist die alte Liebe zur Heimat Dasburg geblieben. Er lebt mit seiner Frau in Trier und Dasburg.
VORWORT
Vom literarischen Spazierengehen
Aus welcher Richtung auch immer man sich Dasburg nähert, ob aus Richtung der Morgensonne über die Ortseingangsstraße, oder von drüben aus Richtung Süden, von Rodershausen und Hosingen, oder gar aus dem Norden, von Dahnen herkommend durch den Neuenweg, immer hat man die Burg vor sich. Die Ansichten und Perspektiven sind zwar verschieden, aber unverkennbar immer wieder die Dasburger Burg. Mal zeigt sie sich mächtig in ihrer ganzen Größe und Schönheit mit ihren Ringmauern und Pfeilern, mit Brücke und Turm, mit Schule und Forsthaus, mal bescheiden und zurückhaltend nur mit ihrem gezackten Turm. Mal im hellen Licht und mit Bäumen grün umrahmt, mal nebelumhüllt, grau und kalt. Der eigene Standort, Jahreszeit und Perspektive, Nähe und Ferne zu ihr machen den Unterschied, während die Burg immer dieselbe bleibt.
Für mich ein passender Vergleich für meine niedergeschriebenen Spaziergänge durch Dorf und Landschaft, durch das Gestern und Heute, durch persönliche Erinnerungen an Daheim, vorbei an Schönem und Bemerkenswertem, vorbei an scheinbar banalen Details und vielleicht auch an übersehen Wichtigem. Trotz all der verschiedenen Beobachtungen, Eindrücke und Gedanken auf meinen Wegen, geht es letztendlich immer um ein und dasselbe, um das uralte Thema, von Herkunft und Heimat. Sie ist der Turm in meinen Spaziergängen.
Und dennoch, die Blicke auf diesen Heimat-Turm sind für jeden sehr verschieden und persönlich. So auch meine Spaziergänge, wenn ich auf den Turm meiner Heimat schaue. Sie sind geprägt von persönlichen Erinnerungen und Erfahrungen, bestimmt und gefärbt von meiner Nähe und Ferne zu den Dingen und aus dem geschrieben, was ich gesehen, dabei empfunden, dazugelernt und bearbeitet habe.
Trotz dieser subjektiven Komponente bemühe ich mich dennoch, auch Wissenswertes hinzuzufügen und auch dieses zu reflektieren, um für mich selbst und der Leserin oder dem Leser auch die Gegenwart meiner und seiner Heimat besser zu begreifen und begreifbar zu machen.
Die Feierlichkeiten zur urkundlichen Erwähnung Dasburgs vor achthundert Jahren im Prümer Urbar, einem Besitzverzeichnis der Abtei Prüm, sollen den Blick nicht nur in die Vergangenheit lenken, sondern auch und vor allem in die Zukunft. Beides gehört zusammen. So möchte ich mit meinen literarischen Spaziergängen ein wenig zur Aufhellung dieses Verhältnisses und zur Weiterentwicklung in die Zukunft hier an diesem konkreten Ort der Geschichte beitragen.
Vom Vorbereiten eigener Reisen in fremde Städte und Landschaften kenne ich den Begriff des literarischen Reisens, eine andere Art des Reiseführers, der sich im Schwerpunkt nicht mit Fakten und Zahlen beschäftigt, sondern mit den persönlichen und subjektiven Erlebnissen und Eindrücken des reisenden Schreibers, natürlich immer in Bezug zu dem, was er an Historie und an Gegenwart vorfindet. Diese Schilderungen haben mir manche Stadt und Landschaft nähergebracht als jeder Baedeker. Unsere Landschaft ist eine Wanderlandschaft. Damit wirbt die Tourismusbranche. Und so möchte ich nicht nur den heimischen, sondern auch den auswärtigen Wanderinnen und Wanderern meine Heimat Eifel schmackhaft machen und deren Spaziergängen bereichern.
Bis vor Kurzem wäre ich nie auf die Idee gekommen, durchs Dorf spazieren zu gehen, oder durch die „Gaas“, wie meine Mutter früher leicht abwertend das Zentrum des Dorfes nannte. Es ist jene Zone, wo etwas los war, wo Menschen draußen auf der Straße, in den Gassen waren, wo man mit anderen Jungs Fußballspielen konnte, Schlittenfahren, frische Wurst und Persil kaufen konnte, abends nach dem Rosenkranzgebet in der Dunkelheit so allerlei anstellen konnte, kurzum, sich das soziale dörfliche Leben abspielte, ob für die Kinder oder die Erwachsenen, für die Frommen wie für die Wirtschaftsgänger. In die „Gaas“ ging man nur, zumindest aus meiner Perspektive von damals, um Dinge zu erledigen, zur Kirche, zur Schule, zum Schuster, zum Metzger und zu vielen anderen Zwecken mehr.
Doch genau das ist nach heutigem Verständnis der Spaziergangswissenschaften, für die es tatsächlich einen Lehrstuhl an der Universität Kassel gibt, kein Spazieren mehr, sondern zweckgeleitetes Gehen. Im Gegensatz dazu ist Spazierengehen ein zweckfreies sich Ergehen, eine Körper und Geist entspannende Bewegung. Dabei wird Landschaft nicht nur bezogen auf Natur, Wald, Wiese, Blumen, sondern auf alles, was sich dem Auge darbietet. Das kann Schönes und Hässliches sein, Auffälliges und Banales, Häuser, Straßen, zufällige Begegnungen.
Zunächst waren es die Städte, die neben der Naturlandschaft spazierend erkundet und betrachtet wurden. Warum nicht auch das Dorf? Spazierend wird auch dieses so zur Landschaft, zur persönlichen Dorflandschaft, die weit über das äußerlich Sichtbare hinausreicht, weil das Wahrgenommene sich auch emotional mit eigenen Erlebnissen verbindet. Auch die Wissensebene kommt ins Spiel. Die Spuren der Geschichte, die verdeckten und die unübersehbaren, fließen mit ein ins Bild. Wie hat sich das Dorf zu dem entwickelt, was es heute ist? Was nehme ich heute wahr? Vergangenheit und Gegenwart kommen zusammen. Historische Fakten und Legenden, vielfach Wiederholtes und Erzähltes, ob es stimmt oder nicht, mischen sich durcheinander zu einem Bild, einem flüchtigen, intensiven Augenblick der Gegenwart.
All diese Aspekte zusammengenommen, machen die Freuden und den Reiz des flanierenden und schauenden Spaziergängers, ja, auch des Reisenden aus. In der Gattung des literarischen Reiseführers und der literarischen Spaziergänge kommen die Liebhaber dieser Art des Reisens und des Spazierengehens voll auf ihre Kosten.
Fügt man diesen Komponenten dann noch die sportliche Note des rhythmischen, schnellen Gehens hinzu, dann kann Spazierengehen zum Rausch werden, fast so, wie wir es von den trainierten Joggern nach etlichen Kilometern kennen.
Im Gehen lockern sich die mentalen Verkrampfungen und die blockierten Erinnerungen und Gedanken. Das gehende Schauen befeuert unsere Gehirnzellen und schärft die Wahrnehmung, spült längst Vergessenes an die Oberfläche unseres Bewusstseins, setzt altes Wissen und Erlebtes frei. Plötzliche Einfälle und Geschichten beleben, stimulieren und belohnen den Spaziergänger, entschädigen für Muskelkater und Gliederschmerzen.
Von den vier folgenden Spaziergängen führen zwei durch die Naturlandschaft und zwei durch die Dorflandschaft. Wer nicht gerade blinden Auges durch das Dorf geht, entdeckt dieses und jenes. Ich habe es liebevoll, vielleicht mitunter auch ironisch aufgeschrieben und mir meine Gedanken gemacht. Es versteht sich von selbst, dass ich dabei vielleicht bei dem ein und anderen anecke. Man möge gelassen damit und auch gnädig mit mir umgehen, denn wie schon mehrfach betont, es sind flüchtige, subjektive, freie, literarische Eindrücke.
Im gemeinsamen Allerheiligen-Gang befasse ich mich mit den tiefen Spuren, die Religion und Kirche in mir und im Dorf hinterlassen haben. Hier gilt das Gleiche. Es sind Versuche der Aufarbeitung und Wertschätzung dessen, was wir einst hatten und nicht leichtfertig aufgeben sollten.
1. SPAZIERGANG
Durchs Ourtal entlang der Mühlen und Grenze
Heute habe ich mir die Tour runter ins Ourtal vorgenommen. Kein Wanderer in und um Dasburg kommt ohne die, in der Tourismuswerbung offiziell bezeichnete Nat´Our Route 2, aus. Neulich wurde dieser Wanderweg sogar über eine ganze Seite in der Wochenendausgabe des Trierischen Volksfreundes ausführlich in Text und Bild vorgestellt. Lang hingestreckt liegt auf einem dieser Bilder die Burganlage auf ihrem, aus dem Tal sich erhebenden Felssporn, geschmückt und umstanden von herbstfarbenen Linden, Eichen, Kastanien, umweht von dunstigen, blau-weißen Rauchschwaden, die Innerlichkeit und ländliche Idylle verheißend aus den Kaminen des Dorfes aufsteigen. Hellgrün leuchtend heben sich einzelne Wiesenflächen, wie von Zauberhand der Sonne gemalt, aus den warm-violetten, hellblau verschwimmenden Wäldern in der Ferne ab. Welch ein Glück muss es sein, an solchem Orte zu leben. „Das historische Dasburg, die Perle inmitten reinster Natur mit Mühlen und Lohwäldern“, möchte man titeln, angesichts dessen, was den Spaziergänger erwartet.
Diese Seite des TV weckt Aufmerksamkeit und Interesse und klingt für jeden unvoreingenommenen, fremden oder heimischen Wanderer wie eine vielversprechende Ouvertüre. Das Eigentliche des Genusses würde sich jedoch erst später entfalten, in diesem Falle, im Akt des Wanderns selbst durch eben dieses Tal.
Heute nun ist nach diesem Flut- und Regensommer die Gelegenheit zu diesem Wandergenuss gekommen. Endlich steigt aus dem Nebel des Morgens einer dieser lang ersehnten Augusttage auf, wie ich sie besonders liebe. Bei meinem Hinaustritt am Morgen sehe ich noch die ganze Welt vor mir in Nebel gehüllt. Gegen Osten hin jedoch und weiter hoch zu den Engeln, lichtet sich bereits der neblige Vorhang und das Helle der Sonne schimmert hindurch. Noch kämpft sie mit dem Dunst und dünnt seine Schleier. Wie feuchtes Scheinwerferlicht bricht das Licht in langen, weißen Streifen durch die schon lichter gewordenen Baumkronen von Kastanie und Linde und wirft helle Sonnenflecken durch die Linde auf den Boden. Weiter oben, zum Wald hin, legen sich noch dunkle Schatten auf die taunasse Wiese, während es jenseits der silhouettenartigen Schattenkante im frischen Morgentau schon glitzert und funkelt. Und bald schon hat die Sonne den Durchbruch geschafft und die Wiese dampft in der Morgenwärme. Das Schauspiel währt nur kurz und man muss auf der Hut sein, es nicht zu verpassen.
Zwischen Ästen und Zweigen treten im Gegenlicht die Gespinste der Nacht ans Tageslicht und lassen erste Vorahnungen auf das bevorstehende Ende des Sommers entstehen. Auch im Ourtal verzieht sich der Nebel. Talabwärts, nach Vianden hin löst er sich auf und dann weiß ich es endgültig, heute wird ein Sonnentag, ein Wandertag. „Zieht der Nebel nach Vianden, gibt es gutes Wetter in allen Landen, zieht er nach St. Vith, ist das gute Wetter quitt“, so eine geläufige luxemburgische Wetterregel hier an der Grenze.
Der Tag erscheint vielversprechend zu werden. Zu der Freude auf unverfälschtes Naturerleben und überraschende Eindrücke auf dem Weg, kommt die pure Lust am Draußensein hinzu.
„Einen Sommer lang gehen durch Heide und über Gebirg sich vom Wegrand ernähren segeln durch wogendes Getreide immer den Vögeln nach und den Sonnen bevor sie ausgerottet sind. Man muss erfahren haben welche Welt vergeht.“
Wunderbare Lyrik von Ludwig Fels, die meine Wanderlust an diesem Sommermorgen zusätzlich befeuert. Einfach mal nichts tun, zwar nicht einen ganzen Sommer lang, doch wenigstens mal für einen Tag, für diesen Tag, vielleicht auch noch für den nächsten und nächsten und noch einen Tag.
Heute also der Ourtal-Spaziergang. Dieses Tal und seine Wege sind das Nonplusultra eines jeden Gehers in diesem Landstrich der Stille und Einsamkeit an der immer noch natürlich dahinfließenden Grenze zwischen Deutschland und Luxemburg. Es gibt viele Möglichkeiten des Einstiegs, Varianten der Länge, des Schwierigkeitsgrades und der Richtung. Man kann sie so oder so rum gehen, diesseits und jenseits der Our oder nur diesseits. Man kann nur ganz unten im Tal gehen oder auch auf halber Höhe und beides miteinander verbinden.
Gegenüber der Pestkapelle möchte ich in den Wanderweg einsteigen, der in halber Höhe nördlich durch das Ourtal führt.1
1 Man kann auch an der L 410 auf halbem Weg zwischen dem Ortsausgang und der Grenzbrücke Dasburg, in diesen Wanderweg einsteigen.
Durch einsame Loh- und Fichtenwälder
Und dann geht es gegenüber der Kapelle hinab ins taufeuchte Tal, tief eingeschnitten und zugewachsen von allerlei Gestrüpp und Hecken, gezäunte und rindsverlassene, überwucherte Weiden. Dafür hat sich jetzt das Drüsige Springkraut in seiner ganzen Höhe mit seinen violett blühenden, orchideenähnlichen Dolden in der nassen Talsenke breitgemacht. Was im 19. Jahrhundert als Zierpflanze nach Europa eingeführt wurde, verdrängt heute die einheimische Flora der Feuchtgebiete. Umgefallene Fichten, fein säuberlich gestapelte, abgedeckte Holzstöße säumen meinen Weg. Mein Blick zurück, hoch zur Kapelle, dringt nicht durch und bleibt am üppigen Grün hängen.
Mit nassen Füßen komme ich an dem auf mittlerer Höhe des Ourtals gelegenen Wanderweg an.
Hier, wo der Weg vom jetzt leise dahin murmelnde Jeybach untertunnelt wird, sehe ich dann die ersten Spuren seiner vor einigen Wochen angeschwollenen Kraft. An der Stelle des stillen, leise gluckernden, leicht gestauten Tümpels vor dem betongegossenen Rohr, jetzt eine weit klaffende Wunde aufgerissenen Gesteins. Auf dem Weg angeschwemmtes Geröll, beiseite gebaggert und aufgetürmt. Aus dem von der Kraft des Wassers abgerissenen Rohrausgang auf der unteren Seite des Weges fällt jetzt nur noch ein schwaches Rinnsal tief hinab in ein, mit rot-weißem Plastik notdürftig abgesperrtes tiefes Loch, überkreuzt mit Wurzelwerk und bleich-blass gescheuertem Schwemmgut.
An dieser ersten Querung meines Wanderweges durch das schmale Jeybachtal mit seiner Quelle nur gut tausend Meter weiter oben, bekomme ich eine Ahnung, was stille Wässerchen alles anrichten können, wenn sie genährt werden. Ich wage mir nicht auszudenken, zu was erst die großen Wasser imstande sind. Inzwischen wissen wir es.
Ich biege nach rechts und beschleunige auf dem jetzt ohne Steigungen dahin führenden Weg meine Schritte. Ich komme in meinen Wandertritt mit dem Gleichklang von Atem und Schritt, und mit zunehmender Strecke auch in den Modus, wo sich meine Gedanken dem Umherschweifen öffnen und meine Sinne all dem, was an der Strecke sich ihnen darbietet.
Schieferformationen zur Rechten begleiten meinen Weg, der im 19. Jahrhundert, vielleicht auch schon früher, mit Pickel und Schaufel mühsam von Hand in den steilen Hang getrieben wurde. Warum wohl? Der herben Bitterkeit der Lohe wegen oder des sauren Weines wegen, der schon lange vor dieser Zeit hier gewachsen sein soll. Die Weingärten sind verschwunden, nur noch der Name ist geblieben, Wingertsberg und hält die Frage vom Weinbau an der Our weiterhin offen.
Es gibt keine Zeugen mehr, auch keine Berichte und auch keine archäologischen Befunde, die dies bestätigen. Nur der Flurname legt es nahe, dass es so war. Denkbar ist es, denn auch die römischen Legionäre sind zur Sicherung ihrer Territorien unweit von hier über Luxemburgs Höhen gen Norden gezogen. Davon zeugt gegenüber auf einem Felsplateau jenseits der Our eine weitere römische Namensanleihe. Nach hiesiger Aussprache: Kascheltslay, was so viel heißt, wie: das Castell auf der Laye, ein möglicher Beleg dafür, dass die Römer hier waren. Und damit könnten nicht nur die Bläck Föös „Ich bin ene Römer“, sondern auch der Dasburger Musikverein, das Lied vom Römer singen oder wenigstens blasen. So finden sich wohl auch bei den Dasburgern, die über viele Generationen abgenutzten römischen Feiergene immer noch in ihren Stammzellen, glimmen weiter und kommen ab und zu bei Fest- und Saufgelagen mit aller Macht zum Vorschein.
Während die Spuren des Weinbaus verschwunden sind, zeugen die mittlerweile in die Jahre gekommenen Eichenpflanzungen an der Talseite des Weges immer noch von der mühsamen Lohschälerei bis in die Mitte des vergangenen Jahrhunderts.
Unterhalb des ins Schiefergestein getriebenen Weges haben es, nach den verschwundenen und gemutmaßten Rebstöcken, ihre bittersaftigen Nachfahren, die widerständigen Eichenpflanzungen, bis ins Heute geschafft, wenngleich sich auch niemand mehr um ihre Rinde und Schale schert. Wie nicht weitergewachsene, dünn-beinige Krüppel stehen sie vergessen und herrenlos am steilen Hang, zu nichts mehr nütze, tauglich nur noch zur Erinnerung an noch gar nicht so lang vergangene Zeiten. Genauso wie der begonnene und bald schon wieder verlassene, heute mit Brombeergerank überwucherte Steinbruch. Offensichtlich auch er, nach anfänglicher Begeisterung und Kraftanstrengung, bald schmählich verlassen, ob des hohen Einsatzes und des mangelnden Ertrages wegen.
An diesem geheimnisvollen und gefährlichen Ort haben wir uns als Volksschuljungs in kleinen verschworenen Freundesgruppen herumgetrieben, um dem Abenteuer zu frönen. Schießen mit Karbid war die prickelnde Lieblingsbeschäftigung. Ich war stellvertretend für meinen Vater öfter mit dem Traktor in der Werkstatt, damals war das die Schmiede in Dahnen und hatte als guter Kunde vertrauliche Beziehungen zum Schmied aufgebaut. So kam ich an den begehrten Stoff, mit dem er seine Esse befeuerte. Bei sachgemäßer Handhabung konnte man das Karbid allerdings auch als Sprengmittel mit Knalleffekt benutzen. Hierzu brauchte man Dosen mit einem verschließbaren Deckel. Bevorzugt waren die größeren Nestlédosen mit 2,5 Liter Fassungsvermögen oder noch größere Dosen mit Deckel bis zu 5 Litern. Je größer und besser die Dose, d. h. je fester der Deckel auf der Dose saß, desto lauter war der Knall. Hierzu wurde am Dosenboden mit einem Nagel ein Loch reingehauen, ein Klümpchen Karbid in die Dose gelegt, darauf gespuckt, sodass sich der Klumpen in Gas auflöste, der Deckel fest verschlossen und gewartet bis das Gas in der Dose den richtigen Druck aufgebaut hatte, sodass es aus dem Loch strömte. Mit dem Fuß hielt man die Dose fest am Boden und entzündete dann das ausströmende Gas mit einem Streichholz. Wenn alle Komponenten richtig zusammenpassten, flog der Deckel mit einem ohrenbetäubenden Knall von der Dose, sodass es ringsum im Tal nur so donnerte und hallte. Besonders an den Fastnachtstagen, wenn sich die ersten Boten des Frühlings zeigten, streiften wir auf diesem sonnigen Weg umher, weit genug vom Dorf entfernt und ließen es krachen und knallen.
Hinter dem versuchten Steinbruch, oberhalb des Weges, wo die Lagen nicht mehr ganz so steil sind, ist das neueste Kapitel der Steillagenbewirtschaftung und ihre Folgen zu beobachten. Der Anbau schnell wachsender Fichtenkulturen. Große Flächen sind nach dem Kriege damit bepflanzt worden und sind heute zur Erntereife gelangt, bzw. dazu verurteilt, weil Trockenheit, Borkenkäfer und neuere Pilzkrankheiten ihnen derart zugesetzt haben, dass nur noch der Kahlschlag bleibt. Bereits nach einer Generation eines erhofften und sicheren Ertrages scheint auch dieser wirtschaftliche Ansatz zum Scheitern verurteilt. Ihn scheint an dieser Stelle das gleiche Schicksal des Niedergangs und des Verschwindens zu ereilen, wie das ihrer vorausgegangenen hölzernen Brüder, ob Rebstock oder Lohstock.





























