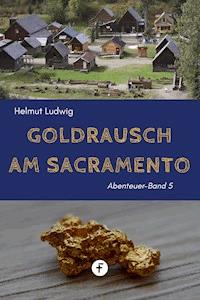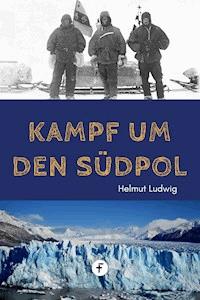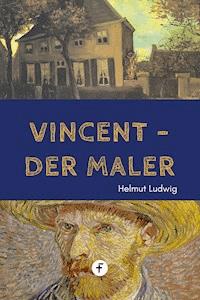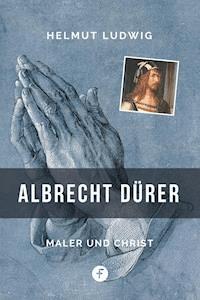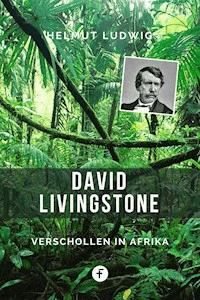
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Biografien bei ceBooks.de
- Sprache: Deutsch
Mit seiner spannenden Biografie schildert der Autor Leben und Wirken des großen Missionars, Forschers und Arztes David Livingstone. Seine Tagebuchaufzeichnungen dienten als Vorlage für dieses Buch über einen Menschen, dessen Leben nie ohne Dramatik war. Mit viel Sachverstand und schriftstellerischem Geschick zeichnet Helmut Ludwig große Ereignisse und kleine Episoden nach: wie der junge David im Alter von 10 Jahren 14 Stunden an der Webmaschine steht, wie er Missionskandidat wird und fast durchfällt, wie er dann nicht nach China, sondern nach Afrika ausreist und dort die Kalahari-Wüste erforscht, die Victoriafälle des Sambesi entdeckt und schließlich als verschollen gilt. Der Journalist H. M. Stanley sucht ihn und findet einen entkräfteten, kranken Mann, der sich von einer weiteren Expedition nicht abbringen lässt, um Gottes Auftrag vollends zu erfüllen. Auf diesem Gewaltmarsch stirbt er. Seine Getreuen bringen den Leichnam durch Urwald, Steppe und Busch bis zur Küste. In der Westminster-Abtei wird er beigesetzt. Ein großer Missionar, dessen bis zum Äußersten gehende Hingabe zeigt, was Glaube und Hoffnung um Christi willen für die Mitmenschen und die Wissenschaft zu vollbringen vermögen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 113
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
David Livingstone
Verschollen in Afrika
Helmut Ludwig
Impressum
© 2014 Folgen Verlag, Wensin
Autor: Helmut Ludwig
Cover: Eduard Rempel, Düren
Lektorat: Mark Rehfuss, Schwäbisch Gmünd
ISBN: 978-3-944187-38-9
Verlags-Seite: www.folgenverlag.de
Kontakt: [email protected]
Shop: www.ceBooks.de
David Livingstone – Verschollen in Afrika ist früher als Buch im Christlichen Verlagshaus, Stuttgart, unter dem Titel david livingstone stop verschollen in afrika stop erschienen.
Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Inhalt
Nach Afrika
Kampf mit Löwen
Expedition ins Unbekannte
Am Großen Strom
Gegen den Sklavenhandel
Vorstoß zum Atlantik
Der »Donnernde Rauch«
Dem Indischen Ozean entgegen
»Afrikafieber«
Entdeckung des Njassasees
Der Tod greift ein
Rückschläge
Wo liegen die Nilquellen?
Ein Sklavenhändler erbarmt sich
Weltweites Zwischenspiel
Ich bin Mr. Livingstones Diener
Die Welt horcht auf
Ein heldenmütiger Entschluss
Nach Afrika
David Livingstone war erst zehn Jahre alt, da begann für ihn der Ernst des Lebens. Am 1. April 1823 hatte er in aller Frühe sein Elternhaus verlassen, um seine Arbeit in der Spinnerei von Mister Dale zu beginnen.
David war stolz, in einer richtigen Fabrik beschäftigt zu werden. Zahlreiche neumodische Maschinen waren in der Fabrik aufgestellt und sicherten den Bewohnern des kleinen schottischen Ortes Blantyre bei Glasgow Verdienst und Auskommen.
Für den kleinen, schmächtigen David war es schwer, von 6 Uhr morgens bis abends 8 Uhr die Maschine zu bedienen und nur kurze Zeit zum Frühstück und Mittagessen zu haben. Die tägliche Arbeitszeit von fast vierzehn Stunden zehrte an den jugendlichen Kräften. Morgens vor fünf schlief David den tiefen Schlaf der Erschöpfung, wenn seine Mutter ihn wach rütteln wollte, damit er pünktlich in der Spinnerei Dale erschien. Herr Dale, der Chef, war nicht ungerecht zu seinen Leuten. Aber an den Maschinen konnte man es sich nicht leisten einzuschlafen, weil sie weiterliefen.
Man musste froh sein, diese Stelle ausfindig gemacht zu haben. Zu Hause ging es ärmlich zu, denn Davids Vater war Hausierer. Nun sollte Davids Wochenlohn von vier Schillingen seinen Eltern ein wenig helfen, ihre fünf Kinder zu versorgen. Familie Livingstone bewohnte ein einziges Dachzimmer in einem dreistöckigen Haus für Fabrikarbeiter. So war David von klein auf an Entbehrungen gewöhnt.
David hatte nur eine Abendschule besucht, die von freundlichen Leuten für Kinder der Armen eingerichtet worden war. Dort unterrichtete ein alter abgedankter Soldat die Kinder in Lesen, Schreiben und Rechnen. Im Erdkundeunterricht war David ganz bei der Sache und auch Naturkunde interessierte ihn brennend. So lernte er Pflanzen bestimmen und hörte von Tieren, die in seiner schottischen Heimat nicht vorkamen. Er erfuhr, dass es Menschen mit anderer Hautfarbe gab.
Nun wollte sich David weiterbilden. Er kaufte sich daher von einem Teil seines ersten Wochenlohns ein lateinisches Lehrbuch. Die kurze Abendzeit nach Fabrikschluss war ihm aber zu wenig zum Lernen. So kam er auf den Gedanken, sein Buch an der »Fleißigen Jenny«, seiner Spinnmaschine, zu befestigen. Die Maschine spulte von Baumwollballen Garn ab. Der Hebel musste von Zeit zu Zeit umgelegt werden, damit das Garn nicht über die Spule hinauslief. Dazwischen konnte David in seinem Buch lesen, ein lateinisches Wort oder gar einen ganzen Satz auswendig lernen, bis er nach einer knappen Minute wieder seine Maschine zu bedienen hatte.
Die Kameraden lachten anfangs über den »versponnenen Baumwollspinner«. Es geschah auch, dass die im gleichen Fabriksaal beschäftigten Mädchen ihn neckten und sein Buch mit Webspulen bewarfen, so dass es herunterfiel. Aber dadurch ließ sich David weiter nicht stören. Er blieb dabei, so viel wie möglich zu lernen. So galt er in der Fabrik als eigenwilliger Sonderling, von dem niemand glaubte, dass er es im Leben noch einmal weit bringen würde.
Vom dreizehnten Lebensjahr an besuchte David von 8 bis 10 Uhr eine kostenlose Abendschule für Latein. Über den Hausaufgaben saß er dann oft bis Mitternacht oder noch später, »falls meine Mutter nicht schon vorher dazwischenfuhr, aufsprang und mir die Bücher aus den Händen riss«.
Sein Vater hatte für die wissenschaftlichen Bücher seines Sohnes wenig übrig. Dass sich David damit beschäftigte, hielt er für bloße Zeitverschwendung. Der Junge sollte abends lieber früher zu Bett gehen, anstatt sich beim trüben Schein der blakenden Petroleumlampe die Augen zu verderben.
Davids Vater war ein gläubiger Mann. In den letzten zwanzig Jahren seines Lebens betätigte er sich noch neben seinem Beruf als Diakon. Von ihm lernte der Sohn beten. Die Mutter rackerte sich im Haushalt ab und wusch Wäsche für die Nachbarn. Sie fand wenig Zeit, sich um die Kinder zu kümmern.
Sonntags ging Familie Livingstone gemeinsam zum Gottesdienst. Danach wanderte David gern in seinem schottischen Heimatland. Er beobachtete Tiere und Pflanzen. Fand er Blumen oder Gräser, die er noch nicht kannte, nahm er sie mit nach Hause, um anhand von Büchern ihre Namen festzustellen.
Einmal wollte David mit seinem Bruder am Fluss Forellen angeln. Da biss ein großer Lachs an. Eigentlich war es verboten, Lachse zu fangen. Aber es tat ihnen leid, den schönen Fisch einfach wieder ins Wasser zu werfen. So steckten sie ihn in das lange Hosenbein seines Bruders Karl und gingen mühsam heimwärts. Dabei erregte der Junge nicht wenig Mitleid, der mit einem scheinbar schrecklich geschwollenen Bein durchs Dorf humpelte.
Mit achtzehn Jahren hatte David ausgelernt und rückte zum Spinnereigehilfen auf. »Die Arbeit war außerordentlich schwer für einen schmalen, leichthändigen Burschen«, schrieb er einmal, »doch sie wurde gut bezahlt.« Dadurch konnte er sich endlich die so lang ersehnten Bücher anschaffen, die er zu seiner Fortbildung haben wollte. Besonders Reisebeschreibungen hatten es ihm angetan. Damals war das Reisen noch ziemlich beschwerlich und langwierig, so dass wegen der Anstrengungen und Kosten nur wenige auf Reisen gehen konnten. Außerdem waren manche Länder der Erde noch gar nicht erforscht. So las David die Reiseerlebnisse mit Spannung wie Berichte aus einer anderen Welt.
In dieser Zeit begann er auch die Bibel zu lesen. Er erkannte, dass der Gott, der die Erde schuf und erhält, derselbe Gott ist, der sich in der Bibel als Retter der Menschen offenbart. David fühlte die Notwendigkeit, den Sohn Gottes im Glauben anzunehmen und übergab Ihm sein Leben. Darüber schrieb er: »Der Wandel in meinem Wesen war so, als ob ein Farbenblinder plötzlich geheilt worden wäre. Die völlige Freiheit durch die Vergebung aller Sündenschuld erweckte in mir eine unbändige Liebe zu dem, der uns mit Seinem Blut erkauft hat, und eine tiefe Verpflichtung, Ihm zu dienen. In dem Licht der Liebe, das Christus uns schenkt, beschloss ich bald, mein Leben der Linderung des menschlichen Elends zu widmen.« Er wollte Missionsarzt werden. Diese innere Berufung erlebte David Livingstone als Zwanzigjähriger.
Da las er in einem Aufruf des deutschen Chinamissionars Gützlaff, dass China dringend Missionsärzte braucht. Diesem Ruf wollte David folgen und sein Leben als Missionar und Arzt unter den Chinesen einsetzen. Aber dazu fehlte ihm noch etwas: die medizinische Ausbildung.
Vater Livingstone war für den Plan seines Sohnes, Medizin zu studieren, nicht zu gewinnen. Er dachte: »Reiche Leute können es sich leisten, ihre Jungen studieren zu lassen. Aber für David kommt das nicht in Frage.« David hatte auch nicht die Absicht, die Dinge zu überstürzen. Zunächst wollte er sich die notwendigen Grundkenntnisse in der Abendschule verschaffen. Gleichzeitig sparte er für sein geplantes Studium, was er nur von seinem Verdienst erübrigen konnte. Da gab der Vater nach.
An einem kalten Herbstmorgen 1836 gingen Vater und Sohn durch den Schnee in das 13 Kilometer entfernte Glasgow. Dort mussten sie den ganzen Tag lang suchen, bis sie eine möglichst billige Unterkunft für David fanden. Und gleich am nächsten Morgen begann er mit dem Studium an der Universität. Seine Fächer waren Griechisch, Theologie, Chemie und Medizin. Bald wurden seine Professoren auf den begabten und vielseitig interessierten jungen Mann aufmerksam.
Nach dem Wintersemester arbeitete David wieder in der Spinnerei, um sich das Geld für das Sommersemester zu verdienen. Trotz aller Sparsamkeit brachte er den nötigen Betrag nicht zusammen. Da half ihm sein älterer Bruder und lieh ihm, was er noch brauchte.
Im August 1837 meldete sich David Livingstone bei der Londoner Missionsgesellschaft. Darauf wurde ihm ein Vordruck mit siebzehn Fragen gesandt. Lange musste er auf Antwort warten. Endlich wurde ihm mitgeteilt, er möchte im August 1838 zur Aufnahmeprüfung nach London kommen. Diese bestand er. Die Mission nahm ihn an und schickte ihn in den Probedienst zu einem Pfarrer nach Ongar, nicht weit von London.
Dort bewies David einmal seine Zähigkeit und Ausdauer, durch die er sich später als Afrikaforscher bewährte. Sein Bruder bat ihn, einiges Geschäftliche für ihn in London zu erledigen. So brach David an einem nebligen Novembermorgen um drei Uhr in Ongar auf.
Es dauerte nicht lange, da fiel er in der Dunkelheit in einen Graben. Von oben bis unten beschmutzt machte er sich wieder auf den Weg. Nach einem Marsch von über 40 km ging er in London von Geschäft zu Geschäft. Seine Müdigkeit wurde immer größer. Dennoch trat er am Spätnachmittag zu Fuß den Heimweg an.
Als er London hinter sich hatte, fand er eine Frau bewusstlos am Wege liegen. Sie war aus einem Wagen gefallen. Livingstone trug sie ins nächste Haus und untersuchte sie. Als er feststellte, dass nichts gebrochen war, ließ er zur weiteren Behandlung einen Arzt rufen und setzte den Heimweg fort.
Plötzlich entdeckte er, dass er in der Dunkelheit auf den falschen Weg geraten war. Vor Übermüdung hätte er sich auf der Stelle hinlegen und schlafen mögen. Aber er nahm seine ganze Kraft zusammen und tappte mit wunden Füßen weiter, bis er einen Wegweiser fand. Daran kletterte er hinauf und entzifferte im Sternenlicht, in welche Richtung er nun zu gehen hatte.
Um Mitternacht kam er blass und todmüde in Ongar an. Fast 100 Kilometer hatte er an diesem Tag zurückgelegt. Sein Stubenkamerad brachte ihm Milch und Brot und half ihm dann ins Bett, wo er im selben Augenblick einschlief.
Als Missionskandidat hatte Livingstone seine Predigten schriftlich abzufassen und auswendig zu lernen. Da erkrankte ein Pfarrer von einer Nachbargemeinde und Livingstone sollte ihn im Morgengottesdienst vertreten. Seine Predigt hatte er gewissenhaft vorbereitet und ging am Sonntagmorgen in den Nachbarort. Der Gottesdienst begann. David stieg auf die Kanzel und verlas den Bibeltext. Dann wollte er anfangen zu predigen, aber sein Gedächtnis hatte ihn verlassen. Er brachte nur einen Satz heraus: »Freunde, ich habe alles vergessen, was ich sagen wollte«, und verließ die Kanzel.
Vor der Missionsleitung konnte sein Pfarrer deshalb nicht nur günstig über ihn urteilen. In einer Sitzung entschied sie sich dann beinahe gegen Livingstone, wenn nicht ein einziges Mitglied für ihn eingetreten wäre. So wurde er nach London gerufen, um dort sein Medizinstudium zu beenden.
In dieser Zeit lernte Livingstone Robert Moffat kennen. Der war als Pioniermissionar Hunderte von Kilometern in das Innere Afrikas vorgedrungen und weilte gerade auf Heimaturlaub. Vor vielen Jahren hatte er als Gärtnergehilfe seine Laufbahn mit einem Missionskurs begonnen und wurde von der Londoner Mission nach Südafrika ausgesandt. Dort wirkte er unter den Hottentotten und gründete später in Kuruman unter den Betschuanen eine Missionsstation. Moffat erzählte: »Nördlich von meiner Missionsstation ist eine weite Ebene. Dort habe ich manchmal in der Morgensonne den Rauch von tausend Dörfern aufsteigen sehen, in die noch kein Missionar gekommen ist.«
Da erkannte David Livingstone: Nicht nach China, nach Afrika wird mein Weg führen.
Mit Feuereifer betrieb er nun seine medizinischen Studien, so sehr war er von seinem neuen Ziel erfasst. Es drängte ihn hinaus nach Afrika.
Da brach er durch Überarbeitung gesundheitlich zusammen. Man trug ihn auf ein Schiff Richtung Heimat. Sein Ende schien gekommen. Aber wie durch ein Wunder erholte er sich während der Seereise und dann zu Hause rasch und befand sich schon nach einem Monat wieder in London, angestrengt bei der Arbeit.
Einige Monate später, im November 1840, legte er in Glasgow die Doktorprüfung mit Erfolg ab und machte sich noch spät abends auf den Weg in seine Heimatstadt, um von den Seinen Abschied zu nehmen. Nur diese eine Nacht konnte er noch bei ihnen sein.
Am nächsten Morgen um 5 Uhr war die ganze Familie zum Frühstück beisammen. David las den 121. Psalm und betete. Nach dem Lebewohl begleitete der Vater ihn zu Fuß bis nach Glasgow an den Dampfer. Seinen Vater hat David in diesem Leben nicht wiedergesehen.
Wenige Tage danach wurde David Livingstone am 20. November 1840 in London als Missionar eingesegnet und zur Ausreise verabschiedet. Am 8. Dezember bestieg er das Segelschiff »Georg« mit dem Reiseziel: Kap der Guten Hoffnung.
Kampf mit dem Löwen
Am 14. März 1841 landete der junge Missionar bei Port Elisabeth an der Südküste Afrikas. Während der langen Seereise ließ er sich vom Kapitän des Schiffes in Sternkunde und Standortbestimmung auf hoher See unterrichten. Diese Kenntnisse wurden ihm bei seinen späteren Forschungsreisen unentbehrlich.
Kuruman, Moffats südafrikanische Missionsstation, lag nördlich des Oranjeflusses. Mit einem plumpen, schweren Karren und vier Paar Ochsen als Vorspann machte sich Livingstone auf die Reise dorthin. »Während ich den Oranjefluss überquerte, wurde mein Wagen umgeworfen«, berichtet er. »Meine Ochsen gerieten in Unordnung, wobei die Köpfe der einen dahin gerieten, wo ihre Schwänze hätten sein sollen. Die anderen wurden unter ihrem Joch so ungebärdig, als ob sie Selbstmord verüben oder den Wagen umwerfen wollten. Dennoch gefällt mir das Reisen wirklich sehr gut.« Dabei hatte Livingstone bis Kuruman rund 900 Kilometer in oft unwegsamem Gelände zu bewältigen und musste bis in Höhen von 1000 Metern hinauf. Aber der junge Missionar ließ sich dadurch in der Freude am neuen Dienst nicht hindern.
So traf er nach zehn Wochen Fahrt einsatzbereit und mit innerer Spannkraft geladen in Kuruman ein, wo er von Missionar Moffat und dessen Familie herzlich begrüßt wurde. Moffat war nicht mehr der Jüngste und freute sich, einem jungen Freund und Bruder manche Neuerungen anzuvertrauen und alte Aufgaben zu übergeben.
Als Arzt gab es für Livingstone hier viel zu tun. Kurz nach seiner Ankunft sah er nach den Kranken der Station. Er verband Wunden, schiente Knochenbrüche, führte Operationen unter primitiven Umständen durch.
In Kuruman hatte der junge Missionar bald erkannt, dass christliche Verkündigung ein volles Ja zur Gleichberechtigung aller Menschen sagen muss, ganz gleich, welche Hautfarbe sie haben; denn vor Gott sind alle Menschen ohne Ansehen der Person gleich. Auch kulturelle Unterschiede können die Liebe Gottes nicht beeinflussen.
Trotz vieler Arbeit hielt es Livingstone nicht lange in Kuruman. Es drängte ihn nach Norden zu den tausend Dörfern, die noch nichts von Jesus gehört hatten. Mit einem jungen Missionar zusammen brach Livingstone schon nach wenigen Wochen auf. Unterwegs konnte er sich viel als Arzt betätigen. Seiner Schwester schrieb er: »Als wir etwa 240 Kilometer gereist waren, kamen wir in ein großes Dorf. Der Häuptling litt an kranken Augen. Ich behandelte ihn, und er speiste uns ziemlich gut mit Milch und Bohnen und schenkte mir einen stattlichen Bock.«
Als Livingstone schon über 15 Kilometer weitergereist war, holte ihn bei einer Rast ein etwa elfjähriges Negermädchen ein und wollte hinter seinem Wagen her mit nach Kuruman gehen. Eine andere Familie hatte sich dieses Waisenkindes bemächtigt, um es später als Frau zu verkaufen. Da war die Kleine davongelaufen.
Nicht lange darauf begann das Mädchenherz brechend zu schluchzen. Ein Mann mit einer Flinte war ihr nachgeschickt worden, um sie zurückzuholen.
Da sprang ein bekehrter Eingeborener, der Livingstone begleitete, dazwischen. Das Mädchen war mit Perlschnüren überladen, um es anziehender und preiswürdiger zu machen. Die nahm er ab, gab sie dem Mann und bat ihn wegzugehen. Danach ließ Livingstone die Kleine im Wagen verbergen, damit er sie sicher mit nach Kuruman bringen konnte. »Wenn auch fünfzig Mann gekommen wären, sie würden das Mädchen nicht bekommen haben.«
In kurzer Zeit lernte Livingstone die Eingeborenensprache. Er wollte aber die afrikanischen Verhältnisse so gut wie möglich kennenlernen. Daher ging er nach drei Monaten wieder auf die Reise nach Norden, diesmal nur mit zwei schwarzen Christen. Sie erreichten Lepelole, ein Dorf der Bakwena oder »Volk des Krokodils«. Dort lebte er ein halbes Jahr nur unter Eingeborenen. Dadurch wurde Livingstone mit den Gewohnheiten der Afrikaner vertraut und verschaffte sich eine gute Kenntnis ihrer Sprache und Denkart. Das war für seine Tätigkeit als Missionar und für seine späteren Afrikareisen von unschätzbarem Wert.
Gerade damals litten die Bakwena unter großem Wassermangel. Dem Medizinmann war es nicht gelungen, Regen herbeizuzaubern. Da sagte Livingstone, er könne Wasser herbringen, wenn auch nicht vom Himmel, so doch durch Bau eines Kanals vom nahe gelegenen Fluss her. Daran hatte niemand gedacht und mit Eifer ging das ganze »Volk des Krokodils« an den Kanalbau, Livingstone, der Häuptling und der Medizinmann voran. Als Werkzeug hatten sie nur einen Spaten ohne Stiel und viele spitze Stöcke. Aber der Kanal wurde nach einiger Zeit fertig und das begehrte Wasser floss zum Dorf. Der Medizinmann war über das Kunststück seines weißen »Kollegen« nicht böse, sondern lachte von Herzen darüber. So gewann Livingstone Achtung und Zutrauen unter den Afrikanern.
Von hier aus machte Livingstone einen zwölftägigen Streifzug in die Kalahariwüste und kam zum Häuptling Sekomi. Dort waren die Löwen eine gefährliche Landplage. Der Missionar musste mit eigenen Augen sehen, wie eine Frau in ihrem Garten von einem Löwen aufgefressen wurde. Das herzzerreißende Geschrei der Kinder dieser Frau ging ihm durch Mark und Bein.
Bevor Livingstone weiterzog, gab Häuptling Sekomi dem Missionsarzt noch eine schwere Aufgabe. Der Häuptling saß in tiefen Gedanken ihm gegenüber und sagte dann: »Du musst mein Herz umändern. Gib mir Medizin, es zu verwandeln; denn es ist stolz, stolz und immer zornig.«
Da nahm Livingstone sein Neues Testament und wollte wie Jesus zu Nikodemus von dem einzigen Weg reden, auf dem das Herz umgewandelt werden kann.
Aber Sekomi rief: »Nein, ich will es durch Medizin umgewandelt haben; denn es ist immer sehr stolz und beständig auf jemand böse.« Da er keine Arznei hiergegen bekommen konnte, stand er auf und ging.
Auf seiner Weiterreise wurde Livingstone vor dem Stamm der Bakaa gewarnt. Diese hatten kurz zuvor einen durchreisenden europäischen Händler und seine drei eingeborenen Begleiter ermordet. Sie vergifteten drei von ihnen und erdrosselten den vierten. Aber Livingstone ging furchtlos unter diese Leute, setzte sich in ihren Kreis, aß mit ihnen und legte sich danach schlafen, als hätte er nichts zu befürchten.
»Ich empfand mehr als gewöhnliche Freude«, berichtet der Missionar, »zu diesen Mördern von dem kostbaren Blut zu reden, das von aller Sünde reinigt. Ich danke Gott, dass ich der erste Gnadenbote sein darf, der diese Gegenden betritt.«
Livingstone wurde im Umgang mit den Schwarzen immer vertrauter und sicherer. Am Rand der Kalahari mussten sie lange Strecken zu Fuß bewältigen. Einige neue Träger marschierten mit, die nicht wussten, dass Livingstone ihre Sprache verstand. Da hörte er, wie einer zu einem anderen sagte: »Er ist nicht stark, er ist ganz schmächtig und scheint nur stark, weil er sich in diese Säcke (Hosen) gesteckt hat. Er wird bald ermüdet sein.« Da ließ es Livingstone auf die Probe ankommen und bewies den schwarzen Gefährten seine Ausdauer.
Als sie das Gebiet eines anderen Stammes betraten, kamen plötzlich Schwarze mit Gewehren auf sie zu anstatt mit Speer, Pfeil und Bogen. Wie erstaunte Livingstone! »Diese erhalten sie von den Portugiesen«, schrieb er, »und ich vermute, dass sie sie im Austausch für Sklaven bekommen.« Damit war der Missionar zum ersten Mal auf Spuren des grauenhaften Sklavenhandels gestoßen.
Schließlich traf Livingstone im Juni 1842 wieder in Kuruman ein. Mehr als 1600 Kilometer hatte er im Ochsenkarren und zu Fuß geschafft. Über allen Erlebnissen und gesammelten Erfahrungen aber war ihm eines groß geworden: »Das Evangelium hat noch nichts von seiner wunderbaren Kraft verloren.«
Daneben konnte er als Arzt auf der Reise vielen dienen. »Meine Praxis hier ist außerordentlich groß«, teilte er einmal mit. »Gegenwärtig habe ich Patienten, die mehr als 200 Kilometer weit hergekommen sind, um sich von mir behandeln zu lassen. Viele sehr schlimme Fälle wurden vor mich gebracht, und manchmal war mein Wagen von Blinden, Hinkenden und Lahmen förmlich belagert. Welch ein gewaltiger Erfolg würde erzielt, wenn einer der siebzig Jünger hier wäre, um sie alle mit einem Wort zu heilen! – Übrigens sind sie ausgezeichnete Patienten. Da gibt es kein Gejammer. Bei einer Operation sitzen selbst die Frauen unbeweglich.«
Aber auch als Forscher betätigte sich Livingstone. Er beobachtete die Tiere und bewunderte besonders die vielgestaltigen Arten der Vögel vom kleinen Kolibri bis zum übermannshohen schnelllaufenden Strauß. »Einige der schönen Vögel des Innern versuchte ich zu präparieren. Allein die Hitze war so überaus groß, dass sie in einigen Stunden verfaulten.«
In Kuruman wartete Livingstone auf Entscheid seiner Missionsleitung, denn er wollte weiter im Innern des Landes eine Missionsstation aufbauen. Inzwischen setzte er sich mit seinen vielseitigen Fähigkeiten in Kuruman ein. »Trotz all unserer Schwächen beweist das Wort Gottes seine Kraft. Beständig werden Seelen gewonnen und oft solche, von denen man nie erwartet hätte, dass sie sich zum Herrn kehren würden.«
Doch bald trieb es ihn wieder auf die Reise, um da und dort im Lande als Missionar und Arzt zu helfen. Er schaffte sich einen Reitochsen an, weil er mit dem Ochsenwagen nicht überall weiterkam. Die Haut des Ochsen war beweglich. Außerdem konnte der Reiter von den langen Hörnern in den Leib gestoßen werden, wenn der Ochse seinen Kopf umwendete. So musste Livingstone schnurgerade sitzen wie ein Dragoner. Trotzdem legte er auf diese Weise über 600 Kilometer zurück. Dabei erlebte er allerhand Abenteuer.
Einmal stürzte er unversehens. Er geriet mit seiner Hand in einen Felsspalt und zog sich einen doppelten Fingerbruch zu. Wenig später überfiel eines Nachts ein Löwe das Lager. Livingstone griff nach seinem Revolver und feuerte im Finstern auf die Bestie. Das Raubtier floh. Aber durch den Rückstoß der Waffe brach der Finger, der bereits am Heilen war, aufs Neue und blutete stark. Als die Afrikaner das Blut sahen, trösteten sie Livingstone: »Du hast dir weh getan, aber uns hast du gerettet.«
Im Juni 1843 kam endlich der ersehnte Brief der Londoner Mission an. Wie freute sich der Pioniermissionar, tiefer in das heidnische Afrika Vordringen und eine Missionsstation errichten zu dürfen! Schon Anfang August brach er mit einem anderen Missionar und drei weißen Großwildjägern auf nach Mabotsa, etwa 350 Kilometer nordöstlich Kuruman. Dort erwarb Livingstone von dem Häuptling der Bakhatla, »Volk des Affen«, ein Stück Land für die Mission und baute sogleich eine große Hütte darauf. Bald konnten darin Kranke behandelt und operiert werden. Er rief auch die Kinder des Dorfes zusammen und gab ihnen Schulunterricht.
In den Nächten ertönte schreckliches Löwengebrüll, das in den umliegenden Bergen fast wie Donner widerhallte. Die Löwen hatten in dieser Gegend so überhand genommen, dass sie sogar am Tag in die Krale der Eingeborenen eindrangen und Kühe und Schafe raubten. Die Schwarzen hatten Angst, die
Löwen zu jagen, weil sie dachten, durch einen bösen Zauber wären diese Raubtiere so wild gegen sie.
Eines Tages fiel ein Löwenrudel über eine Schafherde her, die auf einem Hügel bei der Missionsstation weidete. Neun Schafe wurden zerrissen. Da ging Livingstone seinen Leuten voran gegen die Löwen vor. Durch sein Beispiel wollte er den verzagten Eingeborenen Mut machen.
Nach kurzer Pirsch entdeckten sie die Raubtiere auf einem kleinen Hügel. Dort hatten sie sich nach dem Raub gelagert. Die wenigen Schwarzen, die die Löwenjagd gewagt hatten, umzingelten die Anhöhe und näherten sich vorsichtig den Raubkatzen. Ein Löwe saß zuvorderst auf einem Felsblock. Mebalwe, der schwarze Schullehrer, ein treuer Helfer des Missionars, war auch mit einer Flinte bewaffnet. Er gab den ersten Schuss ab. Das gewaltige Tier sprang auf, durchbrach die Kette der schwarzen Jäger und entkam. Vor Angst hatten die Eingeborenen nicht einmal ihre Speere gegen den Räuber geworfen, wie sie es sonst taten.
Nun bemerkte Livingstone einen zweiten Löwen hinter einem Busch. Er nahte sich dem Tier unerschrocken auf etwa 25 Meter und schoss beide Läufe seiner Flinte auf die Raubkatze ab. Als er eine neue Kugel in seinen Vorderlader schob, stürzte der verwundete Löwe mit Gebrüll auf ihn, packte Livingstone an der Schulter und schüttelte ihn wie ein Hund eine Ratte. Dadurch wurde der Missionar fast betäubt. Trotzdem war er noch geistesgegenwärtig und drehte sich, um von der schweren Pranke loszukommen, die auf seinem Hinterkopf lastete. Da sah er, wie sich die funkelnden Augen des Löwen auf Mebalwe richteten.
Livingstone wird von einem verwundeten Löwen angefallen (Nach einer Skizze von Livingstone)
Der Lehrer war bis auf zehn Meter herangekommen und wollte schießen, aber die Flinte versagte. Nun stürzte sich der Löwe auf Mebalwe und biss ihn ins Bein. Da ging ein Eingeborener mit dem Speer auf die rasende Bestie los. Er hatte Mut gefasst, denn Livingstone rettete ihm früher einmal das Leben, als ein wütender Büffel ihn auf die Hörner nahm.
Auch diesen Mann packte der Löwe an der Schulter. Doch inzwischen hatten Livingstones Kugeln ihre Wirkung getan und das gewaltige Raubtier brach tot zusammen. Die Schwarzen bezeugten, noch nie einen so großen Löwen gesehen zu haben. Sie zündeten ein mächtiges Feuer an und führten um das erlegte Tier bis in die Nacht hinein Freudentänze auf.
Doch Livingstones linker Arm war gebrochen und durch das scharfe Gebiss der Raubkatze an elf Stellen schwer verletzt. Hier musste sich der Arzt selber helfen. Da ihm die nötige Ruhe fehlte, verheilte der Bruch nur unvollkommen. Zeit seines Lebens behielt der Missionar in diesem Arm eine Schwäche zurück und konnte ihn nur unter Schmerzen gebrauchen.
An seinen Vater schrieb Livingstone über diese folgenschwere Löwenjagd: »Dankbarkeit gegen Gott ist das einzige Gefühl, das wir in der Erinnerung an dieses Ereignis haben sollten.«
In England wurde der Missionar später gefragt, was er gedacht habe, als er unter dem Löwen lag. Da antwortete er: »Ich überlegte, welchen Teil von mir der Löwe wohl zuerst fressen würde.«
Im Sommer 1844 verlobte sich Livingstone mit Mary Moffat, der Tochter des bewährten Missionars, der ihm in London die Not Afrikas so brennend ans Herz legte. Zielbewusst ging er nun in Mabotsa an den Bau eines Hauses. Dabei musste er das meiste selbst tun. An seine Braut schrieb er einmal: »Du musst das schmutzige Papier entschuldigen. Meine Hände wollen sich nicht sauberwaschen lassen, nachdem ich den ganzen Tag im Mörtel herumgeschmiert habe.«
Durch Livingstones erstaunliche Tatkraft und seine Geschicklichkeit in vielen Handwerken wurde das Haus noch im selben Jahr fertig. So heiratete er am 2. Januar 1845 und brachte seine junge Frau nach Mabotsa. Sie war in Afrika aufgewachsen und kannte das Leben auf vorgeschobener Missionsstation fern von Europa. Mit vereinten Kräften ging nun das junge Ehepaar an die Missionsarbeit. Neben der Verkündigung des Gotteswortes, dem Dienst an den Kranken und dem Schulunterricht hatten sie noch vielerlei Arbeiten in Haus und Garten. Livingstone meinte, er komme sich vor wie Robinson Crusoe. »Meine Frau ist Mädchen für alles, und ich pfusche in allen Handwerken herum.« Ihre Butter machten sie selbst und Kerzen und Seife stellten sie aus Fett und Pflanzenasche her.
Nach kurzer Zeit kam eine Einladung vom Bakwena-Häuptling Setscheie nach Tschonuane, etwa 70 Kilometer nördlich von Mabotsa. Diesem Ruf folgte Livingstone und gründete in Tschonuane eine neue Missionsstation. Bald merkte er, dass der Umzug und der Bau des neuen Hauses mit allen Mühen nicht vergeblich war; denn Häuptling Setscheie zeigte sich sehr aufgeschlossen für die Heilsbotschaft, wenn auch vorläufig nur als einziger seines Stammes.
Nun wollte der Häuptling, dass alle seine Bakwena Christen würden. Deshalb erbot er sich, seine Untergebenen mit Nashornpeitschen so lange auspeitschen zu lassen, bis sie einwilligten, Jesus Christus anzubeten. Es kostete dem Missionar viel Mühe, dem Häuptling klarzumachen, dass Christus nur freiwillige Gefolgsleute gebrauchen kann.
Als eine verheerende Trockenheit eintrat, riet Livingstone, nach Kolobeng zu ziehen, das an einem Fluss lag. So brachen die Bakwena mit ihrem Missionar auf und ließen sich an dem neuen Siedlungsplatz nieder. Dort baute Livingstone seine dritte Missionsstation.
Er hatte inzwischen zwei Kinder, Robert und Agnes. Und hier in Kolobeng kam im April 1849 der kleine Thomas dazu. Noch eine weitere Freude erlebte er. Drei Jahre lang hatte er Häuptling Setscheie in der christlichen Glaubenslehre unterrichtet und nun konnte er ihn taufen.
Livingstone war ganz von seiner Aufgabe erfüllt. Als Pioniermissionar wollte er immer weiter in die noch unerforschten Gebiete Innerafrikas Vordringen und damit der Mission zur Verkündigung der Rettungsbotschaft neues Arbeitsfeld erschließen. Wie viele Menschen verschmachteten in der grauenhaften Finsternis des Heidentums! So klingt seine Frage wie ein Aufruf:
»Wer wird Afrika durchdringen?«
Livingstones Reisen
Expedition ins Unbekannte
Der Missionar saß oft an den abendlichen Lagerfeuern seiner schwarzen Freunde, erzählte ihnen von Jesus von Nazareth, der frei macht von Götzenglauben und Zauberbann und der größer ist als alle Jujus (magische Geister) und Tiergottheiten. Und die Männer am Lagerfeuer lauschten willig und freundlich den Worten des hilfsbereiten weißen Mannes, der sie nicht zu untergeordneten Arbeiten ankaufen, sondern ihr Freund sein wollte.
Unterdessen hatte David Livingstone erfahren, dass die große Wüste Kalahari gar nicht unbegrenzt wäre, dass man sie in großen Tagesritten durchqueren könne, dass dort Menschen lebten, Stämme auf der Kulturstufe der Steinzeitmenschen, die sich als Jäger und Sammler ernährten.
Zwar erklärte Häuptling Setscheie, dass es für einen weißen Mann unmöglich wäre, durch die Kalahari nach Norden zu kommen. Aber Livingstone wollte selbst feststellen, ob er nicht doch durch die Kalahari gelangen konnte. Er hatte über die Missionsreisen des Apostels Paulus viel gelesen und dessen Arbeitsweise als Missionar genau verfolgt. Auch Paulus hielt sich nie sehr lange an einem Ort und in einer neu gegründeten Gemeinde auf.
Schon lange war Livingstone das Gerücht bekannt, im Norden der Kalahari gäbe es einen riesigen See. Da kamen eines Tages Boten aus dem Norden von dem großen Makololo-Häuptling Sebituane. Er hatte schon von dem weißen Arzt und Missionar gehört und lud ihn zu sich. Die Makololo-Boten berichteten von großen Seen und gewaltigen Strömen. Ihr Häuptling sei als »Herr im Reich der Wasser und Wälder« weithin bekannt. Das war eine fesselnde Nachricht zu einer Zeit, wo Fachleute sich noch stritten, ob das Innere Afrikas eine große Wüste oder ein See wäre. Die Makololos erzählten viele Geschichten von ihrem Stamm, denen die Bakwena in den zauberhaften Nächten am Lagerfeuer bis in die frühen Morgenstunden lauschten.
Livingstone ließ sich von Setscheie sagen, was er über Sebituane und seinen Stamm der Makololo wusste. Er wollte den »Herrn im Reich der Wasser und Wälder« sehen, mit ihm reden.
Als eines Tages in Kolobeng zwei englische Großwildjäger eintrafen, die in der Kalahari jagen und dann weiter nach Norden vorstoßen wollten, war der Plan des Missionars schnell fertig. Er schloss sich der hervorragend ausgerüsteten Expedition der beiden Engländer an, um den Häuptling Sebituane zu besuchen. Vielleicht würde er die Errichtung einer Missionsstation in seinem Wohnsitz Linjanti oder in der Umgebung gestatten. Jedenfalls sollte er die Freudenbotschaft der Erlösung erfahren.
Am 1. Juni 1849 brach die Expedition auf ins unbekannte Land. Jeder wusste, dass es eine gefahrvolle Wüstenstrecke zu durchqueren galt.
David Livingstone hielt vor dem Aufbruch einen Gottesdienst unter freiem Himmel und befahl die Expedition in Gottes Schutz und Hand.
Die Expedition stellte eine umfangreiche Gruppe dar. Achtzig Ochsen zogen vier hochbepackte Planwagen durch den Sand der Wüste. Zwanzig Pferde wurden von den beiden Engländern und ihren Dienern als Reittiere benutzt. Dazu begleiteten eine Anzahl Eingeborene den Zug. Die zwei Großwildjäger sorgten für das nötige Fleisch zur Verpflegung.
Nach Wochen trafen sie eingeborene Händler. Diese versuchten den Weitermarsch auf alle mögliche Weise zu behindern: sie gaben falsche Auskünfte, machten die Wasserstellen unbenutzbar. Offensichtlich betrachteten sie die Karawane der Weißen als Konkurrenz.
Eines Abends kam die Expedition an den ersehnten Brunnen, von dem die Schwarzen wussten, wo er lag. Er war aber vollständig mit Sand zugeschüttet. Nun musste erst lange gegraben werden, um an das frische Wasser zu gelangen. Einmal geschah es, dass die Ochsen 96 Stunden lang ohne Wasser aushalten mussten, bis die Karawane das nächste Wasserloch fand.
Die zwerghaften Buschmänner, die Livingstone nach wochenlangem Treck erreichte, gebärdeten sich feindlich. Es war Abend. Durstig betrat der Missionar mit einigen Gefährten einen ganz primitiven Wohnplatz dieses Wüstenvolks. Nirgends war hier ein Brunnen zu sehen. Livingstone hatte einmal gehört, dass Karawanenleute Wasser gefordert hätten und die Antwort erhielten: »Wir haben keins.« Als die vom Durst Gequälten zornig wurden und mit der Waffe drohten, antworteten die Buschmänner mit ihren kleinen Giftpfeilen, die wie Spielzeug aussehen, und die Karawanenleute kamen ums Leben.
Aber Livingstone setzte sich ganz ruhig zu den Leuten und zeigte ihnen, dass er als Freund gekommen sei. Nach einer Weile ließ er merken, dass er Durst habe. Darauf gingen ein paar Frauen und brachten nach kurzer Zeit große Straußeneier mit Wasser, das sie an verborgenen Wasserstellen holten.
So konnte Livingstone durch sein friedfertiges Auftreten immer wieder misstrauische Menschen und Feinde umstimmen, ja sogar zu Freunden gewinnen.
Eines Abends erblickte die Expedition in der Ferne einen sehr großen See. Das konnte der Ngamisee sein, von dem Livingstone schon gerüchtweise gehört hatte! Alle waren gespannt. Livingstone notierte in seinem Tagebuch: »Die Wellen tanzten auf dem breiten Wasser. Die Schatten der Bäume spiegelten sich deutlich auf der Oberfläche, dass unser Vieh machtvoll ausholte und die Pferde, Hunde und sogar die Eingeborenen dem See entgegeneilten. Da war es plötzlich, als ob der Dunst mit dem Tiefersinken der untergehenden Sonne zerriss. Das Trugbild verschwand, und wieder starrte uns nur die nackte Wüste entgegen.«
Dies war für Livingstone eine Enttäuschung. Er wusste, dass bereits fünfzehn Jahre vorher ein englischer Forscher den Ngami gesucht und nicht gefunden hatte. Sollte es ihm ebenso gehen?
Die Enttäuschung war nach mehreren Tagen vergessen, als Livingstone zu seinem großen Erstaunen an einen Fluss kam, an dessen Rand hohe Bäume standen. Der neuentdeckte Fluss mit Namen Suga kam aus dem Ngami, dem sagenumwobenen See.
Nach den Reisestrapazen genoss Livingstone hier eine Zeit der stillen Freude an Naturschönheiten, die nur wenige vor ihm und nach ihm jemals erlebten. In einem ausgehöhlten Baumstamm fuhr er auf dem Fluss und beobachtete die Tiere, wie sie zum Trinken kamen. Er schildert ganz hingenommen: »Es ist ein herrlicher Fluss. So etwas Großartiges hast Du noch nicht gesehen. Die Ufer sind außerordentlich schön ... Löwen und Elefanten, Antilopen und Flusspferde schauen neugierig auf mein Fahrzeug.«
Am 1. August 1849 erreichte Livingstone als erster Weißer den Ngamisee
Livingstone durchquert mit eingeborenen Trägern einen Fluss. (Nach einer Skizze von Livingstone)
Nur wenige Tage später, am 1. August 1849, erblickte Livingstone als erster Weißer die glänzende weite Wasserfläche des Ngamisees. Das war für ihn und seine Begleiter eine unbeschreibliche Freude. Durch diese Entdeckung wurde er mit einem Schlag als Forscher weithin bekannt.
Nun wollte Livingstone den in südöstlicher Richtung aus dem See fließenden Suga überschreiten und gleich nach Norden in das Reich Sebituanes weiterreisen. Aber der am Fluss herrschende Häuptling Letschulatebe fürchtete, dass die Weißen seinem Widersacher Gewehre bringen und Sebituane dadurch noch mächtiger würde. So verbot er seinen Leuten, die Expedition überzusetzen. Zwar versuchte Livingstone, ein Floß zu bauen; er stand bis zu den Armen im Wasser und mühte sich ab. Aber der Versuch misslang. Jetzt blieb nichts weiter übrig als umzukehren, zumal der dürre Südsommer bevorstand. Auf einem anderen Weg mehr am Rand der Kalahari ging der Zug zurück nach Kolobeng.
Die Missionsstation hatte die Abwesenheit des Missionars gut überstanden. Häuptling Setscheie lauschte gespannt, als Livingstone und seine schwarzen Begleiter von den Entdeckungen und Abenteuern der Reise erzählten.
Am Großen Strom
Zum Weiterlesen HIER klicken!
Gegen den Sklavenhandel
Zum Weiterlesen HIER klicken!
Vorstoß zum Atlantik
Zum Weiterlesen HIER klicken!
Der »Donnernde Rauch«
Zum Weiterlesen HIER klicken!
Dem Indischen Ozean entgegen
Zum Weiterlesen HIER klicken!
»Afrikafieber«
Zum Weiterlesen HIER klicken!
Entdeckung des Njassasees
Zum Weiterlesen HIER klicken!
Der Tod greift ein
Zum Weiterlesen HIER klicken!
Rückschläge
Zum Weiterlesen HIER klicken!
Wo liegen die Nilquellen?
Zum Weiterlesen HIER klicken!
Ein Sklavenhändler erbarmt sich
Zum Weiterlesen HIER klicken!
Weltweites Zwischenspiel
Zum Weiterlesen HIER klicken!
Ich bin Mr. Livingstones Diener
Zum Weiterlesen HIER klicken!
Die Welt horcht auf
Zum Weiterlesen HIER klicken!
Ein heldenmütiger Entschluss
Zum Weiterlesen HIER klicken!
Unsere Empfehlungen
Paul Olbricht: Der Bibelübersetzer Hermann Menge
Folgen Verlag, 978-3-944187-11-2
Die Biografie über Hermann Menge (1841–1939) ist eine einfache Darstellung seines Lebens, das seinen Verlauf vor allem in seinem Studierzimmer nahm. Ein Leben, das dennoch und vielleicht gerade wegen seiner Bescheidenheit groß und im wahrsten Sinne des Wortes gottgesegnet genannt werden darf.
Paul Olbricht zeichnet den Weg nach, wie aus einem weltlichen Sprachwissenschaftler ein biblischer Theologe wird. Denn die letzten 40 Jahre seines Lebens hat er bis zu seinem Tod an seiner Bibelübersetzung gearbeitet. “Es ist kein übertriebenes Lob, wenn man der Menge-Bibel das Zeugnis der besten Bibelübersetzung nächst der Lutherbibel ausstellt.” E. Dicht
Die Menge-Bibel gilt bis heute als eine ausgezeichnete Übersetzung. Wer nähere Bekanntschaft mit diesem schlichten Gottesmann schließe möchte, bekommt hier von seinem Kollegen und Schwager einen Einblick in sein Leben und seine Werke. Menge strebte nicht nach Ruhm und Ehre. Wer ihn kennenlernen wolle, sollte sich seiner Meinung nach lieber mit seiner Bibelübersetzung beschäftigen und sich durch die auf diesem Wege gewonnene Kenntnis zu Gott und zum Heiland führen zu lassen — dann besitze man ein Wissen, das wirklichen Wert hat!
Jost Müller-Bohn: Spurgeon – ein Mensch von Gott gesandt
Folgen Verlag, 978-3-944187-06-8
Mehr als 100 Jahre nach seinem Tod, gehört Charles Haddon Spurgeon auch heute noch zu den gachtetsten Predigern in der Geschichte der Gemeinde Jesu. Dreißig Jahre lang predigte Spurgeon ununterbrochen von derselben Kanzel, ohne dass seine kraftvolle Verkündigung je abgenommen oder er sich in irgendeiner Weise leergepredigt hätte. In dieser gut recherchierten Biografie wird etwas von dem herrlichen Geist spürbar, der in diesem Mann wohnte.
Gottfried Mai: Lenin - Die pervertierte Moral
Folgen Verlag, 978-3-944187-25-9
Im Ostblock nimmt die Abneigung gegen Lenin zu und obwohl sich sogar die chinesischen Kommunisten als Realpolitiker von der unbrauchbaren Doktrin des Leninismus abwenden, erfreut sich im freien Westen die Lehre Lenins einer vorhandenen Beliebtheit und Verharmlosung. Im Vergleich zu Stalin mag Lenin harmloser erscheinen, doch er ist als Urheber für eine in der Geschichte nie zuvor dagewesene Häufung von schlimmsten Verbrechen hauptverantwortlich. Wenn linke Träumer uns, die wir unter der Diktatur des Kommunismus in Ostdeutschland aufgewachsen sind, mit einer positiven Wertung des Leninismus überzeugen wollen, so ist das genauso absurd, wie wenn ein Spätgeborener einem Überlebenden von Ausschwitz erklären würde, es habe niemals Konzentrations- oder Massenvernichtungslager gegeben.
Wer Lenin kritisch liest, wird erschrecken, wie offen dieser den Terror und die Diktatur nicht nur bejaht, sonder auch praktiziert hat. Der frühe Gollwitzer stellte fest: Wer die Menschen hindert, sich mit dem Marxismus—Leninismus rechtzeitig auseinanderzusetzen, trägt dazu bei, dass sie ihm wehrlos verfallen, sobald er über sie herrscht.