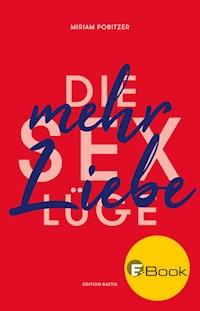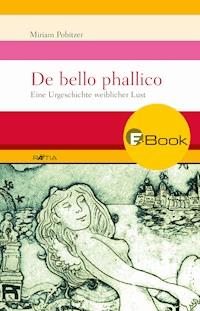
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Raetia
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Was uns trotz aller Aufklärung heute noch fehlt, ist ein Lebenskult, der den Körper mit seinen Empfindungen verehrt, der partnerschaftlichen, ekstatischen Austausch zwischen den Menschen befürwortet und zu individueller Lebenslust geleitet, eine Kunst, die vor 4.000 Jahren noch gelehrt wurde und auch heute noch in manchen Völkern praktiziert wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die weibliche Lust ist zum Teil noch heute ein Tabuthema. Die Sexualtherapeutin Miriam Pobitzer hat bereits mit ihrer Diplomarbeit eine kulturanthropologische Studie zur Entwicklung genitaler Massagegeräte für die weibliche Sexualbefriedigung vorgelegt und dafür einen Preis erhalten. Im vorliegenden Buch setzt sie ihren Streifzug durch die kulturelle Entwicklung der weiblichen Lust fort. Der Startpunkt liegt in einer urgeschichtlich lustvollen Zeit, in der die Sexualität der Frau gefeiert wurde. Doch bald wurde die intime Freiheit der Frau eingeschränkt und verhindert. Die dafür verantwortlichen Moralvorstellungen, die Entstehung der Scham sowie das Vorschützen bestimmter psychosomatischer Leiden entlarvt Pobitzer als Konstrukte der Gesellschaft. Heute tritt durch Emanzipation und Gleichberechtigung die persönliche Entscheidung und Verantwortung in den Vordergrund: Die Frau lebt selbstbestimmt ihre Sexualität.
Miriam Pobitzer:
Geboren 1976 in Meran, engagiert sie sich in jungen Jahren vielseitig in sozialen Bereichen, studiert Psychologie in Innsbruck und absolviert weitere akademische Ausbildungen in Belgien und München. Ihre Diplomarbeit wurde 2003 vom Landesbeirat für Chancengleichheit ausgezeichnet. Pobitzer veröffentlicht Artikel im In- und Ausland und spricht auf internationalen Kongressen zu sexualwissenschaftlichen Themen - unter anderem anlässlich des World Congress of Men’s Health in Wien. In ihrer psychologischen Praxis „Zentrum Lebenslust“ setzt sie ihren Schwerpunkt auf die Sexualität. Darüber hinaus macht sie Musik in einem weiblichen Bläser-Quintett und arbeitet aktiv als Clown bei Medicus Comicus. Bei Edition Raetia: „De Bello Phallico – Eine Urgeschichte weiblicher Lust“ (2006).
© EDITION RÆTIA, BOZEN 2006
Umschlagbild: Alexandra von Hellberg | Grafisches Konzept: Dall’O & Freunde | Druckvorstufe und Druck: Medus, Meran
ISBN E-Book: 978-88-7283-437-4
www.raetia.com
Miriam Pobitzer
De bello phallico
Eine Urgeschichte weiblicher Lust
Gewidmetmeinem VaterWalter Pobitzer
Miriam Pobitzer
De bello phallico
Eine Urgeschichte weiblicher Lust
Vorwort
Wer sich mit dem Thema Sexualität beschäftigt, betritt ein Gebiet mit vielen Tabus. Medizin, Psychologie, Soziologie, Kriminologie, Pädagogik, Psychotherapie sind nur einige wissenschaftliche Teilgebiete, die sich damit auseinandersetzen. Seit einigen Jahrzehnten findet ein internationales Umdenken statt, das sexuelle Verhaltensweisen nicht mehr streng kategorisch als krank oder gesund klassifiziert, sondern in einem Zusammenhang zu begreifen versucht. Biologische, psychische und soziale Aspekte werden kombiniert und in die jeweilige Lebenssituation und kulturelle Umgebung integriert. Dabei ist ein differenziertes Wissen und die Bereitschaft sich Fächer übergreifend zu bilden notwendig. Individuelle Sexualstörungen sind nur dann behandelbar, wenn Arzt und Therapeut das notwendige Hintergrundwissen haben und sich vorbehaltlos für die Belange der Betroffenen öffnen.
Dieses Buch ist im Begriff seinen Teil dazu beizutragen. Aus einem ungewohnten Blickwinkel bringt es Licht in eine dunkle und verschwiegene Vergangenheit. Es beleuchtet gesellschaftliche Mythen, die vielen Menschen Probleme in ihrem Sexualleben bereiten. Es erklärt, wie diese entstanden sind, wie sie sich im Laufe der Zeit entwickelt und wie sie manipulierend auf die menschliche Sexualität gewirkt haben. Dieses Buch ist deshalb ein Anstoß, sich von auferlegten Beschränkungen zu befreien.
Als junge Frau und Wissenschaftlerin betont die Autorin die weibliche Intimität stärker als die des Mannes, was dem gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Denken allerdings nur gut tun kann. Miriam Pobitzer ist eine Frau, die sich traut, einen lustvollen Blick über Grenzen zu wagen, und zur Freude für die Leserin und den Leser mit viel Gespür davon berichtet.
Dr. Elia Bragagna
Leiterin der Sexualambulanz Wilhelminenspital in Wien
und Vizepräsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Sexualmedizin
Einladung
Sexualität eröffnet ein breites Spektrum von Frust bis Lust, von Schwierig bis Leicht, von Abneigung bis Zuwendung, von Tod bis Leben. Die Konstante, die sich dabei wie ein roter Faden durchzieht, ist Kommunikation. Im Kontakt nähern wir uns an, wir wenden uns einander zu, berühren uns, sind neugierig, gehen aufeinander ein, gehen ineinander, erleben Gemeinsames, nehmen etwas auf und geben etwas von uns, tun uns auf und lassen uns ein, sind verbunden. Dann lassen wir voneinander, wir verabschieden uns, wenden uns ab, sind wieder mit uns selbst. Was bleibt, ist etwas Neues, das alle Beteiligten befruchtet. Lebendigkeit ist die Verbindung zwischen Kommen und Gehen, ist das Ergebnis von Geben, Nehmen und Empfangen, Befruchten und Nähren. Leben ist kreieren.
Für alle Männer möchte ich Weiblichkeit ein kleines Stück weit öffnen, damit sie Lust bekommen, Frauen als Frauen zu erkennen, ihren Raum zu erkunden und, falls eingeladen, zu befruchten. Alle Frauen möchte ich ermutigen, auf die Reise zu sich selbst zu gehen. Um mit Lust bei sich anzukommen, in der Liebe, im Raum und in der urweiblichen Möglichkeit, Lebendigkeit aus einem Austausch zu gebären.
Durch einen Streifzug in die Vergangenheit können wir ein Verständnis für unsere oft komplizierte Kommunikation zwischen den Geschlechtern und rund um die Sexualität bekommen. Die Geschichte kennt lustreiche und unbeschwerte Zeiten, an die im ersten Teil „Lust“ erinnert werden soll. Beschränkende Normen sind im Wandel der Zeit entstanden und in den Teilen „Last“ und „Frust“ wiedergegeben. In „Leben“ schließlich wird deutlich, wie wichtig und oft auch widersprüchlich die sexuelle Wirklichkeit war. Und der letzte Bereich „Lebenslust“ beendet schließlich die Reise mit der Sicht der aktuellen Sexualwissenschaft. In den Kapiteln, die diese Hauptteile abschließen, versuche ich einen Bogen in die Gegenwart zu spannen und Schlussfolgerungen aus dem vorher Geschriebenen für die heutige Zeit zu ziehen. Denn erst durch die Freiheit von gesellschaftlichen Zwängen und durch das Besinnen sowohl auf sich selbst als auch auf die beteiligten Personen kann Erotik einen neuen Stellenwert gewinnen. Die Werke von Alexandra von Hellberg zu jedem Teilbeginn feiern die Lust in ihrer besonderen Weise und laden dazu ein.
Liebe, Lust und Sex können Offenheit, Neugierde und Genuss sein. Das und das Vergnügen mit sich selbst wünsche ich allen Leserinnen und Lesern.
Miriam Pobitzer
LUST
Lustreiche Vorzeit
Bis zu den Anfängen der patriarchalen Gesellschaftsstrukturen sind keine Werkzeuge zu finden, die das gewaltsame Verletzen und Töten beweisen würden. Nirgends sind Spuren zu finden, die darauf schließen lassen, dass die Menschen gegeneinander gekämpft hätten. Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit haben Menschen in Gruppen und Gemeinschaften einmal anders gelebt, als es die zivilisierten Kulturen heute gewohnt sind. Um sich heute früheres Zusammenleben vorstellen zu können, sind alternative Ideen für hierarchische Organisation, für Recht und Schuld notwendig.
Wäre Gottvater eine Frau, mit langem, silbern gewelltem Haar und großen runden Brüsten, einem weichen Gesäß und gänzlich nackt, wäre die Präsidentin von den geeinten europäischen Völkern eine geduldige Familienoma, wäre die technologische Forschung nicht von der Wirtschaft beherrscht, wie verschieden wären unsere Einstellungen dann? Unsere Vorstellungen, Überzeugungen und Wünsche sind konstruiert – durch die Wirklichkeit, in der wir leben. Bisher haben sich viele, auch gegensätzliche Überzeugungen abgelöst, nachdem scheinbar stichhaltige Beweise die alten Vorstellungen als falsch beschrieben haben. Spinat zum Beispiel war eine unter vielen Gemüsesorten, bis sein erhöhter Eisengehalt festgestellt wurde, was zum allgemeinen Wissen wurde. Von da an war Spinat der Inbegriff gesunden Essens. Vor nicht allzu langer Zeit stellte sich nun heraus, dass es sich bei der Rechnung, die das Umdenken hervorrief, um eine fälschliche Verschiebung der Kommastelle handelte, um einen simplen Tippfehler. Der Eisengehalt von Spinat sei recht durchschnittlich im Vergleich zu anderen Gemüsesorten, heißt es nun, und auch dann nur von der menschlichen Verdauung zu verwerten, falls mit Zitrone angerichtet – schmackhaft oder nicht. Es war also völlig unnütz, ganze Generationen von Kindern mit Spinatgerichten zu jagen.
Viele Frauen und Männer schämen sich heute für ihren nackten Körper. Das bedeutet, dass wir uns für das, was und wie wir sind, schämen, uns schmutzig und unwohl empfinden. Unsere steinzeitlichen Vorfahren haben sexuelle Praktiken mit Sicherheit anders genutzt, als es unseren heutigen Vorstellungen entspricht. Und doch geht gleichzeitig unsere Gegenwart aus der Vergangenheit hervor. Alles, was jetzt ist, hat einen Entstehungsgrund in der Geschichte.
Nachdem die Sonne untergegangen und die Vögel ihren Kopf in die Federn gesteckt hatten, blieb noch Zeit für Lagerfeuer, Hautpflege, das gemeinsame Zusammenhocken. Vielleicht haben die Menschen damals die Zeit genutzt, sich zu lieben – allein, als Paar und als Gruppe. Vielleicht gab es keine Regeln und Normen, vielleicht weder Eifersucht noch Treue noch Scham, vielleicht war vieles normal. Wie es wirklich war, werden wir durch rationale Forschung allein nie erfahren.
Wissenschaftliches
Um unsere Gegenwart zu verstehen, ist ein Blick in die Vergangenheit notwendig. Woher kommen wir? Was hat uns geprägt? Wieso sind wir heute so, wie wir sind? Diese und ähnliche Fragen geben Aufschluss über uns und unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, ob in privaten oder globalen Zusammenhängen. Doch die Interpretation der Vergangenheit hat ihre Fallstricke: Immer werden vergangene Zeiten durch die Brille aktueller Vorstellungen interpretiert. Deshalb sagt die Geschichtsschreibung vielfach mehr über die Gegenwart ihres Schreibers aus als über die Vergangenheit. Jeder Historiker – egal, ob sein Interesse der Frühgeschichte gilt oder den jüngeren Entwicklungen – muss sich bewusst sein, dass alle Rekonstruktionen wie in Nebel gehüllt bleiben, weil die aktuellen Grenzen der Wahrnehmung auf alles Vergangene übertragen werden. Die Wahrheit bleibt unbekannt.
Jede Generation von Experten und Forschern ist von den jeweils gültigen Ansichten beeinflusst. Die Haltung der machthabenden Autorität, welche die Forschung antreibt und die finanziellen Mittel liefert, beeinflusst die Entdeckungen und gibt der Wissenschaft Inhalt und Richtung vor. Anhand dieser Denkmuster werden die Kunst- und Gebrauchsgegenstände der früheren Epochen gedeutet. Missverständnisse rühren allzu oft daher, dass die Interpretationen von Vergangenem als Wirklichkeit anerkannt werden. Viele Irrtümer mussten durch diesen unpräzisen Forschungsansatz schon beseitigt werden – vielleicht nur, um durch eine neue Fehleinschätzung ersetzt zu werden.
Die Wissenschaft konstruiert ein Bild von unserer Vergangenheit: Aus Scherben werden Töpfe, aus Kriegen Eckdaten der Menschheit, aus Maschinen Fortschritt. Nur Einzelne haben Zugang zu den Orten, wo Geschichte gemacht wird, wo Zeitungsartikel diktiert und ausgewählt, Bilder vor öffentlichen Blicken versteckt werden. Unsere Vorstellung von der Vergangenheit ist eine Interpretation von Quellen und Zeugnissen. Die Lehrherren der Geschichte haben den Blick auf diese Vergangenheit nicht immer nur gefördert. Viele Quellen und Zeugnisse wurden bewusst zerstört oder verfälscht. Denn früh schon erkannten die jeweils Regierenden, dass die Interpretation der Vergangenheit eines ihrer hervorragendsten Instrumente des Herrschens ist. Besonders in den Darstellungen der Urgeschichte sind unterschiedliche Interpretationen von Vergangenem gang und gäbe, weil Funde viele Möglichkeiten der Deutung offen lassen. Es kann gut möglich sein, dass größere Irrtümer passieren als das flüchtige Verschieben einer Kommastelle. Die Folgen von irrigen Zusammenhängen innerhalb der Geschichtsschreibung können im Vergleich mit den Wirkungen des kleinen Spinat-Fehlers nur erahnt werden.
Die ersten Menschen, die wie wir heute zur Art des Homo sapiens sapiens zählen, wurden gegen Ende der Altsteinzeit geboren. Die Steinzeit gilt als erste Phase der Menschheitsgeschichte. Diese lang andauernde Periode begann vor etwa 2,5 Millionen Jahren und endete, als die Menschen die Verarbeitung von Metallen entdeckten. Sie wird in drei Abschnitte gegliedert: Altsteinzeit (Paläolithikum), Mittelsteinzeit (Mesolithikum) und Jungsteinzeit (Neolithikum). Die Menschen dieser frühen Epoche hatten ähnliche intellektuelle Fähigkeiten wie wir heute – aber nicht unsere technischen Möglichkeiten. Ihre Lebensweise war anders. Das Verhalten der damaligen Menschen scheint unserem fremd zu sein, genauso wie ihre Lebenseinstellungen, Wissenschaften und Religionen.
Der Lebensraum der frühen Kulturen war die Natur in ihrer ursprünglichsten und direktesten Form. Mit großer Wahrscheinlichkeit haben diese Kulturen versucht, sich natürliche Vorgänge zu erklären, damit das Überleben einfacher und sicherer werden konnte. Vor allem in Höhlen und auf Plätzen finden sich außergewöhnliche Merkmale, die auf frühe wissenschaftliche Versuche schließen lassen. Überbleibsel wie Malereien, abstrakte Figuren, Feuerstellen ohne offensichtlichen lebensnotwendigen Sinn bekamen den Namen „Religion“ oder „Kult“. Die Menschen von einst wandten keine sogenannten „empirischen“ Methoden an. Die Ziele ihrer und unserer Wissenschaft und Forschung scheinen jedoch dieselben zu sein: Gesundheit, Leben und Tod begreifen und für das Wohl der Menschen sorgen.
Die ursprünglichsten symbolischen Darstellungen von einer Kraft, die über Leben und Tod entscheidet, sind früheste Statuetten, die in naturalistischer oder abstrakter Weise menschliche Figuren darstellen. Wir würden sie heute als Götterfiguren bezeichnen. Unserem Denken entsprechend, sehen wir die Figuren als personifizierte Idealisierungen einer allmächtigen Kraft, als einen Gott, der über allem steht, eine männliche Person, die über Glück und Elend richtet. Diese Interpretation klingt sehr abstrakt und sieht auch die Steinfigur als abstrakte Abbildung. Vielleicht ist schon in dieser Interpretation eine Täuschung verborgen.
Phalluskult
Die erste religiöse Form von Wissenschaft wird als „Phalluskult“ bezeichnet. Dieser Begriff stammt aus der Archäologie, einer Wissenschaft, die genau wie alle anderen das zu Untersuchende aus einem bestimmten Blickpunkt betrachtet – meist ist dieser männlich gefärbt. Die Kulte, in denen ein Phallus im Zentrum stand, sollten angeblich dazu dienen, mit der göttlich schöpferischen Kraft Kontakt aufzunehmen und natürliche Vorgänge positiv zu beeinflussen. Das erigierte männliche Glied schien laut diesen wissenschaftlichen Interpretationen der Allmacht am nächsten zu kommen. Überall, wo Zeugnisse des Phalluskultes gefunden wurden, wird seine Anwesenheit durch stehende Steinsäulen, sogenannte Megalithen, gekennzeichnet. Gefunden wurden sie von Indien über das gesamte europäische Festland bis nach Großbritannien. Durch ihre Form und ihre Platzierung an wichtigen Wegstrecken gelten sie als ein Abbild der wohlwollenden, allmächtigen Gottheit und ihr Sinn soll sein, diese zu würdigen.
Zwischen dem 7. und 5. Jahrtausend und darüber hinaus wurden in Europa Säulentempel und Höhlen, die Stalagmiten und Stalaktiten enthielten, zu zeremoniellen Zwecken genutzt. Fruchtbarkeitskulte sollten eine Verbindung zur göttlichen Lebenskraft herstellen. Die Anfänge der in Höhlen verwendeten sogenannten Lebenssäulen reichen allerdings noch viel weiter zurück. In jungpaläolithischen Höhlen wurden Tonfiguren in Phallusform gefunden. Diese Funde belegen, dass Symbole der Lebenskraft in religiösen Zeremonien eine zentrale Rolle spielten. Bis einige hundert Jahre v. Chr. tauchen plastische Darstellungen des erigierten männlichen Gliedes auf. Diese anthropomorph phallischen Skulpturen lassen eine Verbindung zu den Ritualen erkennen, in denen die damalige Bevölkerung den Tod und das Leben feierte. Das Symbol des Phallus steht also für die Lebenskraft.
Lebenssäule mit phallischem Aussehen Verona, einige Jahrhunderte v. Chr.
Viele Plastiken, die gefunden wurden, werden diesem Phalluskult zugeschrieben und werden dahingehend interpretiert, dass das männliche Glied – und ausschließlich dieses – verehrt wurde. Wir könnten meinen, dass das Geschlechtsteil Penis verehrt wurde. Die Kraft, die von der göttlichen Figur repräsentiert wird, wäre somit die männliche Potenz.
Symbolische Einheit
Weibliche Wissenschaftlerinnen der neueren Zeit weiten unser Verständnis. Sie öffnen den Blick von einer männlichen zu einer menschlichen Sichtweise. Der Lebenskult soll in den ersten großen Zivilisationen entstanden sein, die sich zu Beginn des Neolithikums bis zum Ende der Eiszeit um 8.000 v. Chr. über den fernen Osten bis in die heutigen westlichen Grenzen Europas hinein ausgeweitet haben. Spuren und Symbole dieser Kulturen führen über Mesopotamien nach Ägypten, zu den Griechinnen und Griechen, zu den Römerinnen und Römern bis zu den Überresten des etruskischen und keltischen Volkes und – versteckt – bis in die Gegenwart.
Phalluskulte und deren Überreste wurden meist innerhalb eines Steinkreises, in einer Höhle oder in ähnlichen besonders gekennzeichneten Räumen gefunden. Es ist also naheliegend, die dort aufgefundenen Phallussymbole als Teil eines größeren Ganzen zu verstehen. Die heiligen Orte könnten dabei das Weibliche darstellen, ein Innenraum also, in dem Leben und Fruchtbarkeit möglich sind. Die frühesten Formen einer Weltanschauung feierten demnach das Leben in der Verbindung des männlichen mit dem weiblichen Prinzip.
Im Mittelblock des Kosbacher „Altars“ ist ein Phallus eingelassen, Bayern, 5. bis 6. Jahrhundert v. Chr.
Die frühe Urgeschichte zeigt, dass das Zentrum des Lebens die Einheit von Frau und Mann war – in den Köpfen, in den Herzen, im Leben der Menschen. Einen Hinweis für diese Interpretation finden wir in vielen Statuetten, die das männliche Glied in Einheit mit dem weiblichen Körper zeigen. Das männliche Glied ist erigiert und drängt danach, seinen Samen in die fruchtbare Frau zu geben. Diese öffnet ihren Schoß in Form von Höhlen und ist für die Verwirklichung der Lebendigkeit bereit. Solche Funde belegen, dass die Leben spendende Säule in religiösen Zeremonien eine zentrale Rolle spielte. In der neolithischen Grab- und Tempelarchitektur Sardiniens, Korsikas und Maltas sowie der etruskischen Kulturen der ersten Hälfte des ersten Jahrtausends v. Chr. tauchen immer wieder phallische Säulen auf. Immer stehen sie an sicheren Orten, umgeben von Steinen und Mauern, die die Frau verkörpern. Erst wenn der Penis von der Weiblichkeit aufgenommen ist, ist das Zentrum des heiligen Ortes erreicht. Nur innerhalb des weiblichen Körpers wird die Männlichkeit lebendig – ein Mann ohne Frau hätte keine kreative Potenz.
Einen weiteren Hinweis für diese Interpretation finden wir in vielen Statuetten, die das männliche Glied in Einheit mit dem weiblichen Köper zeigen. In naturalistischer Formgebung ist der weibliche Körper gestaltet, der zusammen mit dem männlichen Geschlecht eine einzige Figur bildet. Die frühesten Statuen vereinen so das Weibliche mit dem Männlichen zu einem einzigen Wesen. Die symbolische Aussagekraft dieser doppelgeschlechtlichen Statuetten scheint eine natürliche zu sein: Männlicher Phallus und Frauenkörper ergeben zusammen eine gesteigerte Energie, die Potenz neuen Lebens.
Das Bild unten zeigt eine jungpaläolithische Figur aus Steatit (Speckstein), deren Kopf ein gesichtsloser Phallus ist. In den Darstellungen wird der Phallus zum weiblichen Körper nahtlos hinzugefügt, sie bilden eine Einheit.
Zweigeschlechtliche Statuette der Gravettischen Kultur, Savignano, Norditalien, um 20.000 v. Chr.
Der Körper der Frau nahm seit den Anfängen der Menschheit einen zentralen Stellenwert im Leben ein: neun Monate der Schwangerschaft, intensive Vorbereitungen für ein sich veränderndes physisches, emotionales und soziales Leben, Nächte und Tage der Geburt. Menschliches Leben wird von der Frau geboren. Egal, ob wir in einer hoch technisierten Welt oder im Einklang mit der Natur leben – diese Initiierung des menschlichen Lebens verändert sich nicht. Sie muss auch damals großen Eindruck auf die Menschen gemacht haben.
Ohne Mann wären diese großen, beinahe übernatürlichen Erfahrungen nie möglich. Er ist aktiv, sucht nach Zielen und findet. Er besamt die weibliche Fruchtbarkeit – gibt ihren Möglichkeiten dadurch Form. Aus der Sexualkraft und der ekstatischen Verbindung von Frau und Mann wird neues Leben geboren. Das Zusammenspiel von Frau und Mann ist die Basis allen Lebens, nicht nur bei der Gattung Mensch, sondern auch bei den allermeisten Pflanzen und Tierarten. Die früheste Wissenschaft – wir können sie auch Religion oder Weltanschauung nennen – versinnlicht genau diesen Aspekt des Lebens: seinen Ursprung. Nicht umsonst leitet sich „Religion“ von dem lateinischen Ursprungswort religere ab, was bedenken, verbinden, verehren heißt.
Verbindung und Verehrung finden auch zwischen zwei Menschen während wohltuender körperlicher Liebe statt. Durch langsame Annäherung, Streicheln, Sich-Halten, Voneinander-Geben-und-Nehmen, Sich-Darbringen und Sich-Öffnen, entsteht aus Kontakt Austausch. Vertrauen und Sicherheit verwandeln die Begegnung zu lustvollem Genuss. Körper, Denken und Gefühle verdichten sich zur Explosion, schaffen die Möglichkeit für Neues. Der sexuelle Höhepunkt von beiden Partnern weckt die biologische Kraft der Sexualorgane, aktiviert die männliche Fruchtbarkeit und die weibliche Empfängnis, Hormone stärken die emotionale Bindung der Partner, ein paar Augenblicke lang verlieren die Menschen die Kontrolle über sich selbst und dadurch den rationalen Aspekt des Bewusstseins. Genau in diesem Augenblick geschieht das Unverständliche.
Lebenskult
Leben und Tod sind Ereignisse des Lebens, die existentiell sind. Gesundheit ist förderlich und Krankheit ist zerstörerisch. Die Lebendigkeit liegt in der aktiven Kraft des Mannes, die sich nach außen richtet, und in der empfangenden Kraft der Frau, die ihre Stärke an das Neugeborene weitergibt und alles Nötige für die Entwicklung eines neuen Menschen bereitstellt. Heute ist unser Leben angefüllt mit materiellen Dingen und Aufgaben. Erst wenn ein plötzlicher Todesfall oder eine schwere Krankheit in unseren Alltag hereinbricht, wird uns unversehens klar, wie wesentlich Gesundheit und Lebenskraft sind.
Lange war es Aufgabe der Religionen, die Bevölkerung an die Vergänglichkeit zu erinnern. Mehr und mehr haben die großen Religionen der Welt diese Aufgabe vernachlässigt sowie durch die stetige Beschäftigung mit dem Materiellen ihre verbindende Bedeutung eingebüßt. Rationale Erklärungen haben heute größeres Gewicht und gelten vielen als die einzig gültige Interpretation der Welt um uns herum. Religion und Wissenschaft stehen im Wettstreit miteinander in ihrer welterklärenden Funktion und erschaffen dabei abstrakte, mit den menschlichen Sinnen nicht unmittelbar zu begreifende Gesetze. Die Grundkonstanten des Lebens werden von den Menschen meist wesentlich unmittelbar empfunden: Fruchtbarkeit, Lebenskraft und Wohlergehen, Gesundheit und Krankheit, Entscheidungen zwischen Glück und Unglück halten das Gleichgewicht der Welt aufrecht. In den Ursprüngen von Kult und Wissenschaft bleibt diese Potenz in den Menschen und wird nicht in eine übergeordnete, göttliche Instanz verlegt. Der einstige Lebenskult betonte die Kraft des Lebendigseins in jeder einzelnen Person. Frühe heilige Statuen verraten uns noch mehr über die damalige Weltanschauung: Die Potenz, die Lebendigkeit, der Austausch von Geben und Empfangen sind eingebettet in der sexuellen Lust. Sie bieten kreative Möglichkeiten im sich wandelnden Leben.
Die Einheit der weiblichen Fruchtbarkeit mit dem Samen spendenden Organ des Mannes lassen auf ein natürliches Verständnis der Genitalien und deren Leben bringender Funktion schließen. Besonders im weiblichen Körper scheint sich diese Vorstellung zu verwirklichen. In den frühesten jungpaläolithischen Phallusdarstellungen Europas bilden der Phallus und der Körper der Göttin eine Einheit. Einige der sogenannten Venusstatuetten aus dieser Zeit weisen einen phallischen, gesichtslosen Kopf auf. Männliches Glied und weiblicher Körper gehen ineinander über.
Neolithische Statuetten der Sesklokultur, welche sowohl einen weiblichen Körper mit betonten Geschlechtsmerkmalen als auch die männlichen Geschlechtsorgane darstellen. Starčevo, Südungarn, 5. Jahrtausend v. Chr.
Die Sesklokultur im heutigen Griechenland zählt neben der Starčevokultur und einigen anderen zu den wichtigsten Kulturgruppen, die am Anfang des Weges der Menschheit durch die Jahrtausende standen. Sie waren als älteste Jungsteinzeitkulturen Südosteuropas von Anfang an bäuerlich geprägt und erschlossen nahezu die gesamte Balkanhalbinsel dieser Epoche. Deutlich hervorgehoben wird in den Figuren und Statuetten dieser Kulturen das naturalistische weibliche Geschlechtsteil zwischen den Oberschenkelansätzen. Die Figur stellt eine stilisierte Frau dar, wobei ihre Lebensorgane betont werden. Deutlich ist die Öffnung zu erkennen, die in den weiblichen Körper leitet. Im sexuellen Akt, der neues Leben entstehen lässt, ist das männliche Glied eingeladen, sich mit der Frau zu vereinen. Der erigierte Penis ist ein Symbol für den Mann, zu dessen Wesen es gehört, ein Ziel zu verfolgen und aktiv mit der Umwelt in Kontakt zu treten. Die Hoden, die den männlichen Samen tragen, sind die biologische Entsprechung, die die Funktion nach außen bringt. Im selben Maße, wie die zum Geschlechtsverkehr bereite Frau dargestellt wird, gibt diese Figur die Fruchtbarkeit des Mannes im Phallus wieder.
Solche Figuren wurden in Savignano (Norditalien) und am Trasimenosee (Mittelitalien), in der Weinberghöhle bei Mauern in Bayern und in Charente in Frankreich gefunden. Dem Zeitalter der Steinzeit werden vergleichbare Darstellungen in ganz Europa zugeschrieben.
Von den Archäologen als „Werkzeuge“ bezeichnet, Le Placard, Frankreich, 12. Jahrtausend v. Chr.
Wie naturgetreu die männlichen und weiblichen Genitalien in dieser vorchristlichen Zeit dargestellt wurden, zeigen auch die folgenden Statuetten. Die unten abgebildete kleine Kalksteinfigur aus Zypern ist von hinten betrachtet eine anatomisch korrekte Wiedergabe der männlichen Genitalien: des erigierten Penis mit dem in der Mitte gefurchten Hodensack. Von oben und unten gesehen ähnelt die Skulptur den weiblichen Sexualorganen und von vorne einer hockenden Frau.
Zweigeschlechtlich deutbare Kalksteinfigur, Zypern, ca. 3.500 v. Chr.
Die „Rote von Mauern“ scheint das männliche Motiv naturalistisch und das weibliche symbolisch darzustellen. So ergeben sich in getrennten Sichtweisen einmal der fruchtbare Frauenkörper und einmal das erigierte Geschlechtsteil des Mannes. Müller-Beck und Albrecht beschreiben in ihrem Buch über die Anfänge der Kunst die „Rote von Mauern“, eine der ersten Frauenfiguren, als „doppel-geschlechtlich deutbare Frauenstatuette“: Aufrecht ist sie eine sehr vereinfachte weibliche Darstellung mit betontem Gesäß; liegend jedoch ist „sie“ Penis und Hoden mit einer Lochung, die den Ausgang der Harn-Samen-Röhre andeutet.
Die „Rote von Mauern“, Bayern, etwa 25.000 bis 18.000 v. Chr.
Gemeinsam ist diesen Statuen das Verschmelzen von Männlichem und Weiblichem: Das männliche Fortpflanzungsorgan ist ein Teil der Fruchtbarkeit und bildet zusammen mit dem weiblichen Körper eine Einheit. Die Mythologie dieser Kulturen und die uns erhalten gebliebenen Darstellungen und Figuren sind typische Beispiele für die Verquickung von Symbolen der das Leben erneuernden Kraft. Sie eröffnen neue Blickwinkel und verweisen uns auf andere Werte, die einstmals gegolten haben mögen. Die Sexualität ist eine Feier, der weibliche und der männliche Körper sind heilig. In ihrer Einheit kann Fruchtbarkeit wahr werden. Urgeschichtlich wurde die weibliche Lust gefeiert und als heilig verehrt, weil die Frau menschliches Leben gebärt und nährt. Das Heiligste aber war die orgiastische Vereinigung von Frau und Mann – die Kreation. Neues Leben braucht den vollen Einsatz von beiden, weder gut noch schlecht, weder oben noch unten, einfach lustvoll.
Auf eine natürliche Einstellung zur Sexualität weist auch die Architektur eines Dorfes der vorchristlichen Zeit hin. Skara Brae ist eine schottische Steinzeitsiedlung, deren Häuser in Wärme spendende Kompostwälle eingebettet sind. Sie wurden etwa von 3.100 bis 2.500 vor Christi Geburt bewohnt. Die Häuser sind rundlich und bieten in ihrem einzigen Raum eine Wohnfläche von etwa 36 Quadratmetern. Im Zentrum befindet sich die Feuerstelle, und jedes Haus hat eine riesige Anrichte aus Steinplatten. Zu beiden Seiten des Feuers steht ein Doppelbett aus Stein. Dies sind die ältesten bekannten Betten der Welt. Die Bauweise lässt auf eine gleichberechtigte Gesellschaftsordnung schließen. Weil mit größter Wahrscheinlichkeit ein ganzer Familienverband in dem einen Raum gewohnt und geschlafen hat, wird die Sexualität zumindest zwischen Vater und Mutter kein Tabu gewesen sein. Skara Brae war bis vor Beginn des Patriarchats bewohnt. Danach änderte sich die Einstellung zur körperlichen Freiheit und zur Gleichwertigkeit von Frau und Mann schnell.
Göttliche Liebe
Die positiven Wirkungen des Geschlechtsverkehrs, besonders die des ekstatischen Austausches der Liebespartner und -partnerinnen, fördern das organische, emotionale und soziale Wohlergehen. Durch die Beobachtung von anderen Säugern wird deutlich, dass die sexuell genussvolle Ekstase eine besondere Fähigkeit ist, eine Qualität, die einer komplexen Entwicklung körperlicher, sozialer und emotionaler Bereiche bedarf. Die intensive Begegnung zeichnet sich durch Genuss und Vergnügen aus. In den hochzivilisierten Kulturen des westlichen Kulturkreises wurde dieses zentrale Wissen lange verleugnet und ist auch heute noch nicht für alle begreifbar. In den alten Kulturen, die vom asiatischen Raum beeinflusst waren, scheint diese Orientierung jedoch wesentlich zu sein. Die lustvolle Vereinigung von Menschen galt in den Jahrtausenden vor der antiken und der aktuellen Gesellschaftsordnung als heilig und hat dem Leben Beginn und Sinn gegeben.