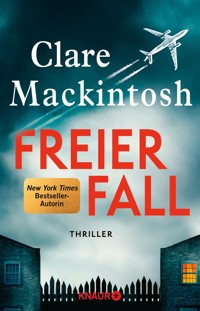9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Zwei Jahre ist es her, seitdem Tom und Caroline Johnson Selbstmord begangen haben sollen. Ihre Tochter Anna weigert sich zu glauben, dass die Eltern ihrem Leben wissentlich ein Ende gesetzt haben. Und seit sie selbst Mutter geworden ist, quält die Ungewissheit sie mehr denn je. Sie beginnt nachzuforschen, stößt schnell auf Lügen und Ungereimtheiten. Dann aber spürt Anna, dass jemand sie beobachtet, ihr nachstellt. Schon bald muss sie lernen: Manche Dinge sollte man besser ruhen lassen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Zitat
Teil eins
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Teil zwei
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreißig
Einunddreißig
Zweiunddreißig
Dreiunddreißig
Vierunddreißig
Fünfunddreißig
Sechsunddreißig
Siebenunddreißig
Achtunddreißig
Neununddreißig
Vierzig
Einundvierzig
Zweiundvierzig
Dreiundvierzig
Vierundvierzig
Fünfundvierzig
Sechsundvierzig
Siebenundvierzig
Achtundvierzig
Neunundvierzig
Fünfzig
Einundfünfzig
Zweiundfünfzig
Dreiundfünfzig
Vierundfünfzig
Teil drei
Fünfundfünfzig
Sechsundfünfzig
Siebenundfünfzig
Achtundfünfzig
Neunundfünfzig
Sechzig
Einundsechzig
Zweiundsechzig
Dreiundsechzig
Vierundsechzig
Fünfundsechzig
Sechsundsechzig
Siebenundsechzig
Achtundsechzig
Neunundsechzig
Siebzig
Einundsiebzig
Zweiundsiebzig
Anmerkung der Autorin
Über das Buch
Zwei Jahre ist es her, seitdem Tom und Caroline Johnson Selbstmord begangen haben sollen. Ihre Tochter Anna weigert sich zu glauben, dass die Eltern ihrem Leben wissentlich ein Ende gesetzt haben. Und seit sie selbst Mutter geworden ist, quält die Ungewissheit sie mehr denn je. Sie beginnt nachzuforschen, stößt schnell auf Lügen und Ungereimtheiten. Dann aber spürt Anna, dass jemand sie beobachtet, ihr nachstellt. Schon bald muss sie lernen: Manche Dinge sollte man besser ruhen lassen …
Über die Autorin
Clare Mackintosh arbeitete zwölf Jahre bei der britischen Polizei und brachte es bis zum CID. Doch dann musste sie feststellen, dass sie ihre eigenen Kinder kaum sah und sie sich außerdem nach neuen beruflichen Herausforderungen sehnte. Also begann sie für diverse Zeitungen zu schreiben und arbeitete an ihrem ersten Roman, der 2015 erschien. MEINE SEELE SO KALT wurde sensationell erfolgreich und verkaufte sich bis heute weltweit über eine Million Mal. Zusammen mit ihrem Mann und ihren drei Kindern lebt sie in Wales.
Clare Mackintosh
DEINELETZTELÜGE
Thriller
Aus dem Englischenvon Sabine Schilasky
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe: Copyright © 2018 by Clare Mackintosh
Titel der britischen Originalausgabe: »Let Me Lie« Originalverlag: Sphere, an imprint of Little, Brown Book Group
Für die deutschsprachige Ausgabe: Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln Textredaktion: Bettina Steinhage
Titelillustration: © RIRF Stock / shutterstock; pashabo / shutterstock; Honored_member / shutterstock
Umschlaggestaltung: Sandra Taufer, München
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-6123-0
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
»Drei Menschen können ein Geheimnis wahren,wenn zwei von ihnen tot sind.«
Teil eins
Eins
Tot zu sein steht mir nicht. Ich trage den Tod wie eine geliehene, schlechtsitzende Jacke, die mir von den Schultern in den Dreck rutscht. Kurz, er passt nicht. Und ist unbequem.
Ich möchte dieses Kostüm abstreifen, es in den Schrank werfen und in meine maßgeschneiderten Sachen schlüpfen. Ich wollte mein altes Leben nicht verlassen, hoffe jedoch auf das nächste – hoffe, dass ich jemand sein kann, der schön und strahlend ist. Denn jetzt bin ich gefangen.
Zwischen zwei Leben. In der Schwebe.
Es heißt, plötzliche Abschiede sind leichter. Weniger schmerzlich. Was nicht stimmt. Jeder Schmerz, der beim verlängerten Abschied einer langen, schweren Krankheit entsteht, wird übertrumpft von dem schieren Horror eines unerwarteten, unangekündigt geraubten Lebens. Eines gewaltsam genommenen Lebens. Am Tag meines Todes balancierte ich zwischen zwei Welten, und das Auffangnetz unter mir war in Fetzen. In eine Richtung ging es in die Sicherheit; in die andere in die Gefahr.
Ich ging. Ich starb.
Früher machten wir Witze über das Sterben – als wir jung genug, vital genug waren, der Tod etwas war, das anderen widerfuhr.
»Was meinst du, wer als Erster geht?«, fragtest du eines Nachts, als der Wein alle war und wir in meiner Mietwohnung in Balham vor dem elektrischen Kaminfeuer lagen. Deine träge Hand, die meinen Oberschenkel streichelte, milderte die Worte ab. Ich antwortete prompt.
»Du natürlich.«
Und du warfst mir ein Kissen an den Kopf.
Wir waren seit einem Monat zusammen, genossen den Körper des anderen und sprachen über die Zukunft, als gehörte sie jemand anderem. Keine Verpflichtungen, keine Versprechungen – nur Möglichkeiten.
»Frauen leben länger.« Ich grinste. »Das ist eine allgemein bekannte Tatsache. Genetisch bedingt. Das Überleben des Stärkeren. Männer kommen alleine nicht klar.«
Du wurdest ernst, umfingst mein Gesicht mit den Händen, damit ich dich ansah. Im Dämmerlicht waren deine Augen schwarz, und das künstliche Feuer spiegelte sich in deinen Pupillen. »Das stimmt.«
Ich wollte dich küssen, aber du hieltst meinen Kopf fest. Deine Daumen drückten gegen mein Kinn.
»Ich weiß nicht, was ich tun würde, sollte dir irgendwas passieren.«
Ein winziges Frösteln, trotz der Hitze des Feuers, kaum mehr als eine Gänsehaut.
»Hör auf!«
»Ich würde auch sterben.«
Da hatte ich deinen jugendlichen Hang zum Drama gebremst, indem ich deine Hand von meinem Kinn zog. Allerdings hielt ich sie weiter fest, weil ich dich ja nicht kränken wollte. Ich küsste dich, erst sanft, dann fester, bis du dich auf den Rücken gleiten ließest, so dass ich auf dir lag und mein Haar einen Vorhang um unsere Gesichter bildete.
Du wärst für mich gestorben.
Unsere Beziehung war frisch, ein Funke, der ebenso leicht gelöscht wie zu einer Flamme entfacht werden konnte. Ich konnte nicht ahnen, dass du aufhören würdest, mich zu lieben; dass ich aufhören würde, dich zu lieben. Aber ich konnte auch nicht umhin, mich von der Tiefe deines Gefühls und der Intensität deines Blicks geschmeichelt zu fühlen.
Du wärst für mich gestorben, und in dem Moment dachte ich, ich würde vielleicht auch für dich sterben.
Ich hätte nur nie gedacht, dass es einer von uns müsste.
Zwei
Anna
Ella ist acht Wochen alt. Ihre Augen sind geschlossen, und ihre langen dunkeln Wimpern fächern sich auf den Pausbacken, die sich beim Trinken auf und ab bewegen. Eine winzige Hand spreizt sich einem Seestern gleich auf meiner Brust. Ich sitze auf dem Sofa und denke an all die Dinge, die ich tun könnte, solange sie trinkt. Lesen. Fernsehen. In einem Online-Supermarkt stöbern.
Heute nicht.
Heute ist kein gewöhnlicher Tag.
Ich beobachte meine Tochter, und nach einer Weile heben sich ihre Augenlider, und sie fixiert mich mit ihrem Blick, ernst und vertrauensvoll. Ihre Pupillen sind tiefe Seen bedingungsloser Liebe. Mein Spiegelbild darin ist klein, aber klar.
Ellas Saugen wird langsamer. Wir sehen einander an, und mir kommt in den Sinn, dass Muttersein das bestgehütete Geheimnis von allen ist. All die Bücher, die Filme, die Ratschläge in der Welt bereiten einen nicht annähernd auf dieses überwältigende Gefühl vor, alles für ein winziges Wesen zu sein. Oder dass dieses Wesen alles für einen ist. Ich wahre das Geheimnis, verrate es keinem, denn wem soll ich es schon erzählen? Keine zehn Jahre nach der Schule teilen meine Freundinnen das Bett mit Liebhabern, nicht mit Babys.
Ella sieht mich immer noch an, doch allmählich verschwimmt der Fokus ihres Blicks, ähnlich Morgennebel, der sich über eine Landschaft schiebt. Ihre Lider sinken ein wenig, ein bisschen mehr, fallen zu. Ihr Saugen – anfangs immer so ungeduldig, dann rhythmisch, entspannt, wird träger, bis mehrere Sekunden zwischen zwei Schlucken vergehen. Schließlich hört es ganz auf. Sie schläft.
Ich hebe eine Hand und drücke behutsam mit dem Zeigefinger auf meine Brust, um den Kontakt zwischen meiner Brustwarze und Ellas Lippen zu lösen. Dann hake ich meinen Still-BH zu. Ellas Mund setzt die Saugbewegungen noch ein wenig fort, bis sie richtig eingeschlafen ist. Ihre Lippen erstarren in einem vollkommenen »O«.
Ich sollte sie hinlegen und die Zeit nutzen, solange sie schläft. Zehn Minuten? Eine Stunde? Wir sind noch weit von jedweder Routine entfernt. Routine. Das war das Losungswort für die neue Mutter, das einzige Gesprächsthema bei den Kaffeetreffen, zu denen mich die Gemeindeschwester verdonnert. Schläft sie schon durch? Du musst versuchen, ihr Schreien zu kontrollieren. Hast du Gina Ford gelesen?
Ich nicke, lächle und sage, ja, ich versuch’s, ehe ich mich einer der anderen jungen Mütter zuwende. Jemand anderem. Weniger herrischem. Denn Routine ist mir egal. Ich will Ella nicht schreien lassen, während ich unten sitze und auf Facebook Beiträge zu »Albtraum Elternschaft« poste!
Es tut weh, nach einer Mutter zu schreien, die nicht kommt.
Das muss Ella noch nicht erleben.
Sie regt sich im Schlaf, und der permanente Kloß in meinem Hals schwillt an. Wach ist Ella meine Tochter. Wenn Freunde behaupten, Ähnlichkeiten mit mir zu sehen, oder sagen, wie sehr sie Mark ähnelt, erkenne ich es nie. Ich sehe Ella an und erkenne schlicht Ella. Schläft sie jedoch … dann sehe ich meine Mutter. Unter diesen Babybäckchen verbirgt sich ein herzförmiges Gesicht, und der Haaransatz ist so ähnlich, dass ich schon vorhersehen kann, wie meine Tochter in Jahren stundenlang vor dem Spiegel stehen und versuchen wird, diesen einen kleinen Wirbel zu korrigieren.
Träumen Babys? Wovon können sie träumen, wenn sie so wenig von der Welt wissen? Ich beneide Ella um ihren Schlaf, und das nicht bloß, weil ich so müde bin, wie ich es vor meinem Baby nie erlebt habe, sondern weil mit dem Schlaf meine Albträume kommen. Sie zeigen mir, was ich unmöglich wissen kann. Mutmaßungen aus Polizeiberichten und den Akten des Untersuchungsgerichts. Ich sehe meine Eltern, ihre Gesichter vom Wasser aufgedunsen und entstellt. Ich sehe Angst in ihren Zügen, als sie von der Klippe stürzen. Ich höre ihre Schreie.
Manchmal ist mein Unterbewusstsein nett zu mir. Ich sehe meine Eltern nicht immer fallen; manchmal sehe ich sie auch fliegen. Ich sehe, wie sie ins Nichts treten, ihre Arme ausbreiten und über das blaue Meer segeln, wo die Gischt in ihre lachenden Gesichter aufsprüht. Dann wache ich sanft auf, mit einem Lächeln auf den Lippen, bis ich meine Augen öffne und mir klar wird, dass alles noch genauso ist, wie es war, als ich sie schloss.
Neunzehn Monate ist es her, dass mein Vater einen Wagen vom Hof seines eigenen Geschäfts nahm – den neuesten und teuersten. Er fuhr die zehn Minuten von Eastbourne nach Beachy Head, wo er das Auto auf dem Parkplatz abstellte, die Türen unverriegelt, und hinauf zur Klippe ging. Auf dem Weg sammelte er Steine, um sich zu beschweren. Dann, als die Flut ihren Höchststand erreicht hatte, warf er sich von der Klippe.
Sieben Monate später, von Sinnen vor Trauer, tat es meine Mutter ihm mit solcher Präzision gleich, dass die Lokalzeitungen von einem »Nachahmungssuizid« sprachen.
Das alles weiß ich so genau, weil ich bei zwei unterschiedlichen Gelegenheiten mitanhören musste, wie uns der Coroner diese Abläufe Schritt für Schritt schilderte. Ich saß mit Onkel Billy da und lauschte dem ruhigen, aber schmerzlich gründlichen Bericht von zwei gescheiterten Rettungseinsätzen der Küstenwache. Ich starrte auf meinen Schoß, während Experten ihre Angaben zum Tidenwechsel, zu Überlebensraten und Sterbestatistiken machten. Und ich schloss meine Augen, als der Coroner Suizid als Todesursache festlegte.
Meine Eltern starben im Abstand von sieben Monaten, doch weil die Taten miteinander in Verbindung standen, fanden die Anhörungen vorm Untersuchungsgericht in derselben Woche statt. In jenen zwei Tagen erfuhr ich eine Menge, nur nicht das, worauf es wirklich ankam.
Warum sie es taten. Vorausgesetzt, sie hatten es getan.
Die Fakten sind unanfechtbar. Abgesehen von der Tatsache, dass meine Eltern nicht suizidgefährdet gewesen waren. Sie waren nicht depressiv, litten nicht unter Angststörungen. Sie waren die letzten Menschen, von denen ich jemals erwartet hätte, dass sie ihr Leben aufgeben würden.
»Psychische Probleme sind nicht immer offensichtlich«, sagt Mark, wenn ich es anspreche, wobei keine Spur von Ungeduld durchklingt, weil das Gespräch – mal wieder – darauf kommt. »Die fähigsten, heitersten Leute können Depressionen haben.«
Im Laufe des letzten Jahres habe ich gelernt, meine Theorien für mich zu behalten; nichts vom Zynismus durchblicken zu lassen, der unter meiner Trauer schlummert. Niemand sonst hat irgendwelche Zweifel. Niemand sonst ist beunruhigt.
Andererseits kannte wohl auch keiner meine Eltern so wie ich.
Das Telefon läutet. Ich lasse den Anrufbeantworter anspringen, aber der Anrufer spricht nicht aufs Band. Stattdessen vibriert das Handy in meiner Tasche, und ich weiß schon, bevor ich hinsehe, dass es Mark ist.
»Zufällig unter einem schlafenden Baby?«
»Wie hast du das bloß erraten?«
»Wie geht es ihr?«
»Sie trinkt quasi alle halbe Stunde. Ich versuche dauernd, mit dem Kochen anzufangen, und komme keinen Schritt weiter.«
»Lass ruhig, das kann ich übernehmen, wenn ich zu Hause bin. Wie fühlst du dich?« Sein Ton verändert sich so minimal, dass es keinem außer mir auffallen würde. Da schwingt noch etwas anderes mit. Wie fühlst du dich heute, an diesem Tag?
»Ganz okay.«
»Ich kann nach Hause kommen …«
»Nein, mir geht es gut, ehrlich.«
Mark würde nur sehr ungern seinen Kurs nach der ersten Hälfte abbrechen. Er sammelt Fortbildungen wie andere Leute Bierdeckel oder ausländische Münzen; inzwischen hat er so viele Abkürzungen zusammen, dass sie nicht mehr hinter seinen Namen passen. Alle paar Monate druckt er neue Visitenkarten, und die unwichtigsten Buchstabenkombinationen fallen hinten raus, geraten in Vergessenheit. Der heutige Kurs heißt »Der Wert der Empathie in der Klient-Therapeut-Beziehung«. Mark braucht ihn nicht; seine Empathiefähigkeit war in dem Moment offensichtlich, in dem ich durch seine Tür trat.
Er ließ mich weinen. Schob mir eine Schachtel Papiertaschentücher hin und sagte, ich solle mir Zeit lassen. Anfangen, wenn ich so weit bin, keine Sekunde früher. Und als ich aufhörte zu weinen, aber immer noch keine Worte fand, erzählte er mir von den Stadien der Trauer – Leugnen, Wut, Verhandeln, Depression, Akzeptanz –, und mir wurde bewusst, dass ich noch im ersten Stadium festhing.
Wir hatten vier Sitzungen hinter uns, da holte Mark tief Luft und sagte mir, dass er mich nicht mehr behandeln könne. Ich fragte ihn, ob es an mir läge, und er antwortete, es gäbe einen Interessenkonflikt und dies hier wäre schrecklich unprofessionell, aber ob ich eventuell mal mit ihm essen gehen würde.
Er war älter als ich – altersmäßig näher an meiner Mutter als mir – und mir immer dementsprechend selbstbewusst erschienen. Doch nun konnte ich auch die sorgfältig beherrschte Nervosität wahrnehmen.
Ich zögerte nicht. »Ja, sehr gerne.«
Hinterher sagte er, ihn würde der Abbruch meiner Therapie stärker belasten als das ethische Dilemma, etwas mit einer Klientin anzufangen. Früheren Klientin, hatte ich erwidert.
Ihm ist bis heute nicht ganz wohl dabei. Ich erinnere ihn jedes Mal, dass Menschen sich an allen erdenklichen Orten begegnen. Meine Eltern lernten sich in einem Londoner Nachtclub kennen; seine sich in der Tiefkühlabteilung von Marks & Spencer. Und er und ich begegneten uns in einer Wohnung im siebten Stock eines Hochhauses in Putney, in einem Sprechzimmer mit Ledersesseln, weichen Wolldecken und mit einem Schild an der Tür: MARK HEMMINGS. PSYCHOTHERAPEUT. TERMINE NUR NACH VEREINBARUNG.
»Wenn du meinst. Gib Ella-Bella einen Kuss von mir.«
»Bye.« Ich lege zuerst auf, und ich weiß, dass er sich das Telefon an die Lippen presst, wie er es immer tut, wenn er tief in Gedanken versunken ist. Er wird nach draußen gegangen sein, um mich anzurufen, verzichtet dafür auf Kaffee, Netzwerken oder was dreißig Therapeuten eben so tun, wenn sie aus einem Seminarraum kommen. Gleich wird er zu den anderen zurückkehren und die nächsten Stunden nicht verfügbar sein, weil er an seiner Empathie im Zusammenhang mit einem erfundenen Problem arbeitet. Vorgetäuschte Sorge. Fiktive Trauer.
Er würde gerne an meiner arbeiten, aber ich lasse ihn nicht. Ich habe die Therapie abgebrochen, als mir klar wurde, dass kein Reden der Welt meine Eltern zurückbringen konnte. Man erreicht einen Punkt, an dem der Schmerz im Innern zur schlichten Traurigkeit wird. Und die lässt sich nicht heilen.
Trauer ist kompliziert. Sie schwappt auf und ab und hat so viele Facetten, dass ich Kopfweh bekomme, wenn ich versuche, sie zu zerpflücken. Ich halte Tage durch, ohne zu weinen, und dann wieder kann ich vor lauter heftigem Schluchzen kaum atmen. Mal lache ich mit Onkel Billy über irgendwas Blödes, das mein Vater früher gemacht hat; im nächsten Augenblick bin ich voller Wut auf seinen Egoismus. Hätte mein Vater sich nicht umgebracht, hätte es meine Mutter auch nicht getan.
Die Wut ist das Schlimmste. Diese glühende Rage, der unweigerlich Schuldgefühle folgen.
Warum haben sie es getan?
Millionen Male bin ich in Gedanken die Tage vor dem Tod meines Vaters durchgegangen, habe mich gefragt, ob wir irgendwas hätten tun können, es zu verhindern.
Dein Dad wird vermisst.
Stirnrunzelnd hatte ich auf die Textnachricht gesehen und nach einem versteckten Witz gesucht. Ich wohnte noch bei meinen Eltern, war jedoch über Nacht bei einer Tagung in Oxford und saß gerade mit einer Kollegin aus London morgens beim Kaffee. Ich entschuldigte mich, um meine Mutter anzurufen.
»Was soll das heißen, er wird vermisst?«
Meine Mutter redete wirr. Sie sprach langsam, als müsse sie die Worte aus Untiefen hervorwühlen. Sie hatten sich den Abend zuvor gestritten; mein Vater war in den Pub geflohen. So weit war alles normal. Ich hatte mich längst damit abgefunden, dass die Beziehung meiner Eltern recht stürmisch war. Wobei die Böen sich genauso schnell beruhigten, wie sie herbeigefegt waren. Nur dass mein Vater diesmal nicht nach Hause gekommen war.
»Ich dachte, dass er vielleicht bei Bill geschlafen hat«, sagte sie, »aber jetzt bin ich bei der Arbeit, und Bill hat ihn nicht gesehen. Ich bin ganz krank vor Sorge, Anna!«
Ich verließ die Tagung sofort. Nicht, weil ich mich um meinen Vater sorgte, sondern weil ich mir Gedanken um meine Mutter machte. Sie achteten beide sehr darauf, den Anlass ihrer Streitereien vor mir zu verbergen, doch die Nachwehen hatte ich zu oft miterlebt. Mein Vater verschwand – zur Arbeit, auf den Golfplatz oder in den Pub. Und meine Mutter versteckte sich im Haus und tat mir gegenüber, als hätte sie nicht geweint.
Bis ich zu Hause eintraf, war alles vorbei. In der Küche standen Polizisten, die ihre Mützen in den Händen hielten. Meine Mutter zitterte so sehr, dass sie einen Sanitäter gerufen hatten, um ihr etwas gegen den Schock zu geben. Onkel Billy war dort, kreidebleich vor Kummer. Laura, das Patenkind meiner Mutter, machte Tee und vergaß, Milch hineinzutun. Keiner von uns nahm es richtig wahr.
Ich las die Textnachricht, die mein Vater geschickt hatte.
Ich schaffe das nicht mehr. Die Welt wird ohne mich ein besserer Ort sein.
»Ihr Vater hat einen Wagen von der Arbeit genommen.« Der Polizist war ungefähr im Alter meines Vaters, und ich fragte mich, ob er Kinder hatte. Ob sie ihn für selbstverständlich nahmen. »Die Kameras zeigen, wie der Wagen gestern spätabends in Richtung Beach Head fuhr.« Meine Mutter stieß einen erstickten Schrei aus. Ich sah Laura, die zu ihr ging, um sie zu trösten; ich konnte das nicht. Ich war wie erstarrt, wollte nichts hören und hörte doch genau hin.
»Officers reagierten auf einen Notruf gegen halb zehn heute Morgen.« PC Pickett blickte in seine Notizen. Ich vermutete, es war leichter, als uns anzusehen. »Eine Frau berichtete, dass sie einen Mann gesehen hatte, der einen Rucksack mit Steinen füllte, seine Brieftasche und sein Handy auf die Erde legte und über den Klippenrand trat.«
»Und sie hat nicht versucht, ihn zurückzuhalten?« Ich wollte eigentlich nicht schreien, und Onkel Billy legte mir eine Hand auf die Schulter. Ich schüttelte ihn ab, wandte mich den anderen zu. »Sie hat einfach zugeguckt, wie er sprang?«
»Es ging alles sehr schnell. Die Anruferin war aufgelöst, wie Sie sich vorstellen können.« Zu spät erkannte PC Pickett, wie ungeschickt dieser letzte Halbsatz war.
»Sie war aufgelöst, ja? Was dachte sie denn, wie mein Dad sich fühlte?« Ich wirbelte herum, suchte in den Gesichtern der anderen nach Unterstützung, bevor ich mich wieder den Polizisten zuwandte. »Haben Sie sie befragt?«
»Anna«, sagte Laura leise.
»Woher wissen Sie, dass sie ihn nicht gestoßen hat?«
»Anna, das hilft jetzt keinem.«
Ich wollte widersprechen, doch dann sah ich, wie sich meine Mutter leise schluchzend an Laura lehnte. Bei dem Anblick verließ mich jeder Kampfgeist. Ich trauerte, aber Mum trauerte mehr. Also ging ich zu ihr, kniete mich neben sie, nahm ihre Hand und fühlte, wie Tränen meine Wangen nässten, noch ehe mir bewusst wurde, dass ich weinte. Meine Eltern waren sechsundzwanzig Jahre zusammen gewesen. Sie hatten zusammen gelebt – und gearbeitet – und sich trotz aller Höhen und Tiefen geliebt.
PC Pickett räusperte sich. »Die Beschreibung passt auf Mr Johnson. Wir waren innerhalb von Minuten vor Ort. Sein Wagen wurde auf dem Parkplatz vom Beachy Head gefunden, und am Klippenrand fanden wir …« Er brach ab und zeigte zu einer Beweismitteltüte auf dem Küchentisch. Darin konnte ich das Handy meines Vaters und seine braune Brieftasche sehen. Aus dem Nichts fiel mir ein Witz ein, den Onkel Billy dauernd riss, über die Motten in den Jackentaschen meines Vaters, und für eine Sekunde dachte ich, ich würde gleich losprusten vor Lachen. Stattdessen weinte ich und hörte drei Tage nicht mehr auf.
Mein rechter Arm unter Ella ist eingeschlafen. Ich ziehe ihn hervor und wackle mit den Fingern. Ein Kribbeln setzt ein, als das Blut zurück in die Extremitäten strömt. Plötzlich werde ich unruhig. Mit jener neuen Wendigkeit, wie sie junge Mütter erwerben und die eines Royal Marines würdig wäre, winde ich mich unter der schlafenden Ella hervor und sichere die Kleine mit Kissen auf dem Sofa. Dann stehe ich auf und strecke meine vom zu vielen Sitzen steifen Glieder.
Mein Vater hatte nie unter Depressionen oder Angststörungen gelitten.
»Hätte er es im Fall des Falles denn erzählt?«, fragte Laura. Wir sitzen in der Küche – Laura, meine Mutter und ich. Die Polizei und die Nachbarn waren gegangen, und wir saßen benommen bei einer Flasche Wein, der zu sauer schmeckte. Lauras Frage war nicht unberechtigt, selbst wenn ich sie nicht gelten lassen wollte. Mein Vater entstammte einer langen Linie von Männern, nach deren Überzeugung nur »Schwuchteln« über »Gefühle« redeten.
Was auch der Grund gewesen sein mochte, sein Selbstmord kam aus dem Nichts und stürzte uns alle in tiefe Trauer.
Mark – und sein Nachfolger, nachdem er gefunden war – wollten, dass ich mich durch die Wut arbeitete, die ich in Bezug auf den Tod meines Vaters empfand. Ich biss mich an sechs Worten des Coroners fest.
Nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte.
Sie halfen mir, den Mann von der Tat zu trennen, zu begreifen, dass es bei Suizid nicht darum ging, die zu verletzen, die er zurückließ. Vielmehr legte seine letzte Nachricht nahe, dass er wirklich glaubte, wir könnten ohne ihn glücklicher sein. Nichts läge ferner als das.
Noch schwerer, als mit dem Suizid meines Vaters fertigzuwerden, war das, was als Nächstes geschah. Zu ergründen, warum meine Mutter – nachdem sie am eigenen Leib erfahren hatte, was ein Selbstmord an Schmerz auslöst, und mich um meinen Vater weinen sah –, warum sie mich zwang, das noch einmal durchzumachen.
Mein Puls surrt in meinen Ohren wie eine Wespe an einer Glasscheibe. Ich gehe in die Küche und trinke schnell ein Glas Wasser, bevor ich die Hände auf die Granitarbeitsplatte stemme und mich über das Spülbecken beuge. Im Geiste höre ich meine Mutter, wie sie beim Abwaschen singt oder an meinem Vater herumnörgelt, ob er denn nicht alle Jubeljahre mal selbst seinen Dreck wegräumen könne. Ich sehe Mehlwolken aufstieben, als ich meine ersten, schrecklich süßen Kuchenteige in der Steingutschüssel meiner Mutter rühre. Ihre Hände an meinen – die Kekse oder kleine Pasteten formten. Und später, als ich wieder nach Hause zog, wie wir uns abwechselten, am Aga-Herd zu lehnen, während die andere Abendessen kochte. Mein Vater in seinem Arbeitszimmer oder vorm Fernseher im Wohnzimmer. Wir Frauen in der Küche – aus eigenem Antrieb, nicht weil sich es so gehörte –, die sich beim Kochen unterhalten.
In diesem Raum fühle ich mich meiner Mutter am nächsten.
Und hier tut es am meisten weh.
Ein Jahr ist es heute auf den Tag genau her.
Trauernde Witwe stürzt sich in den Tod, hieß es in der Gazette. Seelsorger fordert Schwärzung von Suizid-Hotspot, lautete eine unfreiwillig komische Guardian-Überschrift.
»Du hast es gewusst«, flüstere ich. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass Selbstgespräche kein Indiz für einen gesunden Geist sind, kann ich mich keine Sekunde länger beherrschen. »Du hast gewusst, wie weh es tut, und es trotzdem gemacht.«
Ich hätte auf Mark hören sollen und mir für heute etwas vornehmen. Eine Ablenkung. Ich hätte Laura anrufen können. Mich zum Essen verabreden. Einkaufen gehen. Irgendwas anderes, nur nicht im Haus hocken, immer wieder über dasselbe nachgrübeln und mich damit quälen, dass sich heute der Todestag meiner Mutter jährt. Es gibt keinen logischen Grund, warum der heutige Tag schwerer sein sollte als jeder andere. Meine Mutter ist heute nicht toter, als sie gestern war; nicht lebendiger, als sie es morgen sein wird.
Und dennoch …
Ich hole tief Luft und versuche, mich aus dieser Schleife zu reißen. Einen Tick zu laut stelle ich mein Glas in die Spüle, als würde eine hörbare Zurechtweisung meiner selbst etwas ändern. Ich werde mit Ella in den Park gehen. Wir können eine große Runde drehen, um Zeit totzuschlagen, und auf dem Rückweg kaufen wir fürs Abendessen ein. Dann kommt Mark bald nach Hause, und dieser Tag wird beinahe vorbei sein. Abrupte Entschlossenheit ist ein alter Trick, aber er funktioniert. Der Schmerz in meiner Brust wird weniger, und der Druck hinter meinen Augen schwindet.
Man tut als ob, bis man es kann, sagt Laura immer. Zieh dich für den Job an, den du willst, nicht für den, den du hast, ist noch so ein Lieblingsspruch. Sie meint damit zwar die Arbeitswelt (man muss sehr genau hinhören, um zu erkennen, dass ihr Eton-Akzent antrainiert, nicht vor Ort erworben wurde), aber das Prinzip ist dasselbe. Gib vor, dass es dir gut geht, dann hast du bald wirklich das Gefühl, dir ginge es gut. Und über kurz oder lang stimmt es dann auch, dir geht es gut.
Am letzten Teil arbeite ich noch.
Ich höre ein Quieken, das bedeutet, dass Ella wach ist. Als ich halb durch die Diele bin, sehe ich etwas aus dem Briefschlitz vorlugen. Entweder wurde es direkt gebracht, oder es hat sich dort verfangen, als der Postbote seine Runde machte. Jedenfalls habe ich es am Morgen, beim Einsammeln der Post von der Fußmatte, nicht gesehen.
Es ist eine Karte. Heute Morgen waren schon zwei gekommen – beide von Schulfreundinnen, die mit Trauer besser umgehen können, solange sie die auf Armeslänge halten – und ich bin gerührt, wie viele Menschen auf diese Weise an ein bestimmtes Datum denken. Am Jahrestag vom Selbstmord meines Vaters hatte jemand einen Auflauf mit einer sehr kurzen Nachricht vor meine Tür gestellt.
Einfrieren oder aufwärmen. Ich denke an dich.
Bis heute weiß ich nicht, wer dafür verantwortlich war. Viele der Beileidskarten, die nach dem Tod meiner Eltern kamen, spielten auf die Autos an, die sie über die Jahre verkauft hatten. So viele Geschichten. Von Schlüsseln, die allzu selbstbewussten Jugendlichen und überängstlichen Eltern ausgehändigt wurden. Von Sportwagen, die gegen Familienkutschen eingetauscht wurden. Von Autos zur Feier von Beförderungen, runden Geburtstagen, Ruhestandsbeginn. Meine Eltern hatten in zahlreichen Leben eine Rolle gespielt.
Die Adresse ist auf einen Aufkleber getippt, der Poststempel in der oberen rechten Ecke verschmiert. Die Karte ist aus dickem, teurem Papier und nur mühsam aus dem Umschlag zu ziehen.
Ich starre das Bild an.
Grelle Farben tanzen über die Seite: eine Umrandung aus rosa Rosen, deren Stämme und grünen Blätter ineinander verschlungen sind. In der Mitte zwei Sektgläser, die zusammenstoßen. Der Gruß ist geprägt und mit Glitzer verziert.
Glückwunsch zum Jahrestag!
Ich zucke zurück, als sei ich geschlagen worden. Ist das ein kranker Scherz? Ein Irrtum? Irgendeine wohlmeinende, kurzsichtige Bekanntschaft, die sich am Kartenständer vergriffen hat? Ich öffne die Karte.
Die Nachricht drinnen ist ebenfalls getippt. Aus billigem Papier ausgeschnitten und eingeklebt.
Das hier ist kein Versehen.
Meine Hände zittern, so dass die Worte vor meinen Augen verschwimmen. Die Wespe in meinem Ohr surrt lauter. Ich lese die Botschaft noch einmal.
Selbstmord? Von wegen.
Drei
So hatte ich nicht gehen wollen. Nein, nicht so.
Wenn ich mir meinen Tod vorstellte, dann malte ich mir einen verdunkelten Raum aus. Unser Schlafzimmer. Aufgeklopfte Kissen hinter meinem Rücken, ein Glas Wasser, das meine Lippen berührt, weil meine eigenen Hände schon zu schwach sind, es zu halten. Morphium, um die Schmerzen zu lindern. Besucher, die einer nach dem anderen auf Zehenspitzen hereinkommen, um sich zu verabschieden; du mit geröteten Augen, aber stoisch, als du ihre freundlichen Worte anhörst.
Und ich; schrittweise mehr schlafend als wach, bis ich eines Morgens gar nicht aufwache.
Früher behauptete ich gern, dass ich im nächsten Leben als Hund zur Welt kommen wolle.
Wie sich herausstellt, hat man keine große Wahl.
Man nimmt, was kommt, ob es einem passt oder nicht. Eine Frau genau wie du. Älter, hässlicher. Das oder nichts.
Es fühlt sich seltsam an, ohne dich zu sein.
Sechsundzwanzig Jahre waren wir zusammen. Beinahe genauso lange verheiratet. In guten wie in schlechten Zeiten. Du in einem Anzug, ich in einem Empire-Kleid, das meinen Fünf-Monats-Bauch verbergen sollte. Ein neues gemeinsames Leben.
Und jetzt nur ich. Einsam. Verängstigt. Fremd, im bloßen Schatten eines Lebens, das ich einst in vollen Zügen genossen hatte.
Nichts ist so gekommen, wie ich geglaubt hatte. Und jetzt dies.
Selbstmord? Von wegen.
Die Worte sind nicht unterzeichnet. Anna wird nicht wissen, von wem sie kommen.
Aber ich weiß es. Ich habe das ganze letzte Jahr nur darauf gewartet, während ich mir einredete, dass Stille Sicherheit bedeutete.
Tut sie nicht.
Ich erkenne Hoffnung in Annas Gesicht; sie erhofft sich Antworten auf die Fragen, die sie nachts wachhalten. Ich kenne unsere Tochter. Sie wollte nie glauben, dass du und ich freiwillig von jener Klippe gesprungen sind.
Sie hat recht.
Ich sehe auch mit schmerzlicher Klarheit, was nun geschehen wird. Anna wird zur Polizei gehen. Eine Ermittlung verlangen. Sie wird um die Wahrheit kämpfen, nicht ahnend, dass die Wahrheit nichts als noch mehr Lügen bereithält. Noch mehr Gefahr.
Von wegen.
Was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Ich muss verhindern, dass Anna zur Polizei geht. Ich muss sie davon abhalten, die Wahrheit herauszufinden, bevor ihr etwas zustößt.
An dem Tag, an dem ich zum Beachy Head fuhr, glaubte ich, nichts mehr von meinem alten Leben wiederzusehen. Anscheinend lag ich falsch.
Ich muss das hier verhindern. Ich muss wieder nach unten.
Vier
Anna
Ich rufe Mark zurück, spreche ihm eine Nachricht wegen der Karte auf die Mailbox. Ich merke selbst, wie wenig Sinn meine Worte ergeben, atme tief durch und erkläre es noch mal.
»Ruf mich an, sobald du das hier abhörst«, ende ich.
Selbstmord? Von wegen.
Die Bedeutung ist klar.
Meine Mutter wurde ermordet.
Meine Nackenhaare sträuben sich immer noch, und ich drehe mich langsam um, blicke zu der breiten Treppe hinter mir, den offenen Türen zu beiden Seiten und den bodentiefen Fenstern zum Garten. Dort ist niemand. Natürlich nicht. Doch die Karte hat mir eine solche Angst eingejagt, als wäre jemand ins Haus eingebrochen und hätte sie mir direkt in die Hand gedrückt. Es fühlt sich nicht mehr an, als seien Ella und ich allein im Haus.
Hastig stopfe ich die Karte zurück in den Umschlag. Ich muss hier raus.
»Rita!«
Es ist Rascheln aus der Küche zu hören, gefolgt vom schlitternden Tapsen kleiner Krallen auf den Fliesen. Rita ist teils Zypernpudel, teils diverse andere Rassen. Sie hat rotbraune Brauen, die ihr über die Augen und um die Schnauze herumfallen, und wenn sie im Sommer getrimmt wird, leuchten die weißen Flecken in ihrem Fell wie Schnee. Begeistert schleckt sie mich ab.
»Wir gehen spazieren.«
Das muss man ihr nie zweimal sagen, und auch jetzt flitzt sie zur Haustür, wo sie den Kopf zur Seite neigt und mich ungeduldig betrachtet. Der Kinderwagen steht in der Diele unter der Treppenbiegung, und ich stecke die anonyme Karte in den Einkaufskorb unten, schiebe sie tief unter eine Decke. Als würde sie sich in Luft auflösen, sobald ich sie nicht mehr sehe. Ich nehme Ella hoch, als sie gerade von gurrender Zufriedenheit zu Nörgelei wechselt.
Selbstmord? Von wegen.
Ich wusste es. Ich habe es immer gewusst. Meine Mutter besaß eine Stärke, von der ich mir nur ein Zehntel wünschte – ein Selbstvertrauen, um das ich sie bis heute beneide. Sie gab nicht auf. Und sie hätte ganz sicher nicht ihr Leben aufgegeben.
»Gehen wir mal an die frische Luft, ja?«
Ella sucht wieder nach meiner Brust, doch dafür haben wir keine Zeit. Ich will nicht eine Minute länger im Haus bleiben. Eilig hole ich die Wickeltasche aus der Küche und überprüfe, ob alles drin ist – Windeln, feuchte Reinigungstücher, Spucktücher – und werfe mein Portemonnaie und die Hausschlüssel hinein. Dies ist gewöhnlich der Moment, in dem Ella ihre Windel füllt oder sich so vollspuckt, dass sie komplett umgezogen werden muss. Vorsichtig schnuppere ich an ihrem Po und stelle fest, dass alles sauber ist.
»Gut, gehen wir!«
Vor dem Haus führen drei Stufen hinunter zur Kiesfläche vorn und dem Gehweg. Jede der Stufen ist in der Mitte eingesunken von unzähligen Füßen, die sie über die Jahre abgenutzt haben. Als Kind hüpfte ich zuerst von der untersten Stufe, bis ich mit den Jahren sicherer wurde und – begleitet vom »Sei vorsichtig!« – von der obersten springen und sicher auf der Auffahrt landen konnte, die Arme im Triumph gereckt.
Mit Ella auf dem Arm rolle ich den Kinderwagen die Stufen hinunter, bevor ich sie hineinlege und die Decken rund um meine Tochter feststecke. Ein Ende der Frostperiode zeichnet sich nicht ab, und Reif glitzert auf dem Gehweg. Der Kies knirscht dumpf, als gefrorene Steinklumpen unter meinen Schritten brechen.
»Anna!«
Unser Nachbar, Robert Drake, steht auf der anderen Seite des schwarzen Zauns, der unser Haus von seinem trennt. Die Häuser hier sind identisch: dreigeschossig im georgianischen Stil mit lang gestreckten Gärten nach hinten raus und schmalen Pfaden, die zwischen den Häusern verlaufen. Meine Eltern zogen 1992 nach Eastbourne, als mein unerwartetes Erscheinen ihrem Londoner Leben ein Ende setzte und sie in die Ehe katapultierte. Mein verstorbener Großvater hatte dieses Haus gekauft, zwei Straßen entfernt von dem, in dem mein Vater aufwuchs, und es bar bezahlt (»Ist die einzige Währung, auf die die Leute hören, Annie«). Ich nehme an, dass er erheblich weniger bezahlte als Robert, der fünfzehn Jahre später das Haus nebenan kaufte.
»Ich habe an dich gedacht«, sagt Robert. »Es ist heute, nicht wahr?« Er lächelt mir mitfühlend zu und neigt den Kopf zur Seite. Es erinnert mich an Rita, nur dass Ritas Blick warm und vertrauensvoll ist, während Roberts …
»Deine Mutter«, ergänzt er für den Fall, dass ich ihm nicht folgen kann. Dabei hat er einen gereizten Unterton, als sollte ich mich dankbarer für sein Mitgefühl zeigen.
Robert ist Chirurg, und obwohl er ausnahmslos freundlich zu uns ist, hat er diesen eindringlichen, fast klinischen Blick, bei dem ich mir immer vorkomme, als läge ich auf seinem OP-Tisch. Er lebt allein und spricht mit jener Distanz von den Nichten und Neffen, die ihn gelegentlich besuchen, wie sie ein Mann wahrt, der nie eigene Kinder hatte und auch nie wollte.
Ich schlinge Ritas Leine um den Kinderwagengriff. »Ja, es ist heute. Nett von dir, dass du daran denkst.«
»Jahrestage sind immer bitter.«
Mehr Plattitüden halte ich nicht aus. »Ich will gerade mit Ella spazieren fahren.«
Robert scheint froh über den Themenwechsel. Er späht durch den Zaun. »Ist die aber gewachsen!« Es sind so viele Decken um Ella gewickelt, dass er es unmöglich erkennen kann, trotzdem stimme ich zu und erzähle ihm, wo sie in der Perzentilenkurve steht, was wahrscheinlich schon mehr ist, als er wissen will.
»Hervorragend! Sehr gut. Tja, dann lasse ich euch mal losziehen.«
Die Einfahrt ist so breit wie das Haus, jedoch nur gerade eben lang genug für Autos. Die Flügel des Eisentors lehnen am Zaun, und solange ich denken kann, war das Tor noch nie geschlossen. Ich verabschiede mich und schiebe den Kinderwagen aus der Einfahrt auf den Gehweg. Auf der anderen Straßenseite ist ein Park, der mit seiner aufwendigen Bepflanzung und den vielen Schildern, was man alles nicht betreten darf, eher für Erwachsene angelegt ist. Meine Eltern haben Rita hier abwechselnd abends spät ausgeführt, und nun zerrt sie an der Leine, aber ich ziehe sie zurück und gehe in Richtung Innenstadt. Am Ende der Reihe freistehender Häuser biege ich nach rechts. Ich schaue mich noch einmal zu Oak View um und sehe, dass Robert nach wie vor in seiner Einfahrt steht. Er wendet den Blick ab und geht zurück in sein Haus.
Wir spazieren die Chestnut Avenue entlang, wo blitzblanke Zäune noch mehr Stadthäuser einrahmen. Lorbeerbäume stehen Wachposten gleich in den Vorgärten, von blinkenden Lichterketten behängt. Eines oder zwei der riesigen Häuser in der Avenue wurden in Wohnungen aufgeteilt, doch die meisten sind nach wie vor Einfamilienhäuser, bei denen die großzügigen Eingänge nicht von Klingelbrettern und Briefkästen verunstaltet werden. Weihnachtsbäume stehen in Erkern, und hier und da sehe ich durch die Fenster Leben in den Zimmern dahinter. In dem ersten lümmelt sich ein Teenager auf einem Sofa; in dem zweiten rennen kleine Kinder durchs Zimmer, aufgedreht von der Feiertagsstimmung. In Nummer sechs sitzt ein altes Ehepaar und liest Zeitung.
Die Tür zu Nummer acht ist weit offen. Eine Frau – Ende vierzig, schätze ich – steht dort, hinter ihr eine in einem schicken Grauton gestrichene Diele. Sie hat eine Hand an der Tür. Ich nicke ihr zu, doch obwohl sie die Hand hebt, richtet sich ihr Lächeln auf ein harmlos kabbelndes Trio, das einen Tannenbaum vom Auto ins Haus schafft.
»Vorsicht, ihr lasst ihn noch fallen!«
»Weiter nach links. Passt auf die Tür auf!«
Das junge Mädchen lacht lauthals, und ihr ungeschickter Bruder grinst schief.
»Ihr müsst ihn über den Zaun heben.«
Der Vater, der alles dirigiert, im Weg steht und sichtlich stolz auf seine Kinder ist.
Für eine Sekunde schmerzt es so sehr, dass ich keine Luft bekomme. Ich kneife die Augen zu. Mir fehlen meine Eltern schrecklich, und das zu unterschiedlichen Zeiten und Gelegenheiten, die ich nie vorausgesehen hätte. Zwei Weihnachten zuvor wären das mein Vater und ich mit dem Baum gewesen und meine Mutter, die uns scherzhaft von der Tür aus zurechtweist. Es hätte Schachteln mit Roses-Schokolade gegeben, zu viel Alkohol und genug Essen für die Speisung der Fünftausend. Laura, die mit einem Berg von Geschenken ankam, falls sie gerade einen neuen Job gefunden hatte; Gutscheine und Entschuldigungen, falls sie gerade einen verloren hatte. Mein Vater und Onkel Billy, die sich wegen Quatsch streiten und eine Münze werfen, um eine Wette zu entscheiden. Meine Mutter, die gefühlsduselig wird und »Driving Home for Christmas« auf dem CD-Player anstellt.
Mark würde sagen, dass ich alles durch eine rosarote Brille sehe, aber ich kann unmöglich die Einzige sein, die sich nur an die schönen Zeiten erinnern will. Und ob weichgezeichnet oder nicht, mein Leben hat sich für immer verändert, als meine Eltern starben.
Selbstmord? Von wegen. Kein Selbstmord. Mord.
Jemand raubte mir mein altes Leben. Jemand brachte meine Mutter um. Und wenn sie meine Mutter töteten, ist der logische Schluss, dass auch mein Vater sich nicht selbst das Leben nahm. Meine beiden Eltern wurden ermordet.
Ich umfasse den Griff von Ellas Kinderwagen fester, denn mir wird leicht schwindlig bei dem Gedanken, dass ich monatelang wütend auf meine Eltern war – weil sie sich über die erhoben, die sie zurückließen. Vielleicht ist es falsch gewesen, ihnen die Schuld zu geben. Vielleicht war es nicht ihre Entscheidung, mich zu verlassen.
Das Autohaus Johnson’s Cars ist an der Ecke Victoria Road und Main Street, ein hell erleuchteter Glasbau an der Stelle, wo Läden und Friseursalons den Wohnanlagen und Häusern am Stadtrand weichen. Die flatternden Wimpelgirlanden, an die ich mich aus der Kindheit erinnere, sind längst verschwunden, und es ist nicht auszudenken, was mein Großvater zu den iPads gesagt hätte, die unter den Armen der Verkäufer klemmen, oder zu dem riesigen Bildschirm, auf dem das Angebot der Woche beworben wird.
Ich überquere den Vorplatz, lenke Ellas Kinderwagen zwischen einem eleganten Mercedes und einem gebrauchten Volvo hindurch. Die Glastüren gleiten lautlos auf, als wir uns ihnen nähern, und warme Luft lockt uns nach drinnen. Weihnachtsmusik dudelt aus teuren Lautsprechern. Hinter dem Tresen, wo früher meine Mutter saß, tippt eine auffallend hübsche Frau mit karamellfarbenem Teint und passenden Strähnen auf ein Keyboard ein. Ihre künstlichen Fingernägel klackern auf den Tasten. Sie lächelt mir zu, und ich sehe einen kleinen Diamanten an einem ihrer Zähne aufblitzen. Ihr Stil könnte nicht weiter von dem meiner Mutter entfernt sein. Vielleicht hatte Onkel Billy sie deshalb eingestellt; es kann nicht leicht sein, tagtäglich zur Arbeit zu kommen, wo alles wie immer scheint, es aber nicht ist. Wie mein Zuhause. Wie mein Leben.
»Annie!«
Immer Annie. Nie Anna.
Onkel Billy ist der Bruder meines Vaters und der Inbegriff des überzeugten Junggesellen. Er hat einige Freundinnen, die sich mit gelegentlichen Wochenend-Dates zufriedengeben, und einen festen Pokerabend jeden ersten Mittwochabend im Monat.
Hin und wieder schlage ich vor, dass Bev, Diane oder Shirley mal auf einen Drink mitkommen könnten, und jedes Mal ist Billys Antwort dieselbe.
»Eher nicht, Annie.«
Mit seinen Freundinnen bahnt sich nie etwas Ernstes an. Ein Essen ist immer ein Essen, ein Drink ist immer ein Drink und mehr nicht. Und obwohl er die besten Hotels bucht, wenn er nach London reist, und seine jeweilige Begleitung mit den tollsten Geschenken überschüttet, vergehen immer Monate, bis er sie wiedersieht.
»Warum lässt du sie alle am ausgestreckten Arm zappeln?«, habe ich ihn mal gefragt, nachdem wir zu viel von dem gekippt hatten, was in unserer Familie »Johnson Gin Tonics« heißt.
Billy zwinkerte mir zu, antwortete aber sehr ernst: »Weil auf die Art niemand verletzt wird.«
Ich umarme ihn und atme die vertraute Mischung aus Aftershave und Tabak ein, zusammen mit etwas Undefinierbarem, das mich mein Gesicht in seiner Schulter vergraben lässt. Er riecht wie mein Großvater früher. Wie mein Vater früher. Wie alle Johnson-Männer. Von denen jetzt nur noch Billy übrig ist.
Ich weiche zurück und beschließe, es einfach auszusprechen.
»Mum und Dad haben keinen Selbstmord begangen.«
Onkel Billy wirkt eindeutig resigniert. Wir hatten das alles schon.
»Ach, Annie …«
Aber diesmal ist es anders.
»Sie wurden ermordet.«
Er sieht mich stumm an – mustert mich besorgt –, bevor er mich in sein Büro mitnimmt, weg von den Kunden. Dort bugsiert er mich in den teuren Ledersessel, der schon ewig hier steht.
Billig kaufen heißt doppelt kaufen, sagte mein Vater immer.
Rita legt sich auf den Boden, und ich blicke zu meinen Füßen. Ich erinnere mich noch, wie sie weit über die Sesselkante baumelten, bevor sie mit den Jahren weiter nach unten und schließlich bis zum Boden reichten.
Einmal habe ich hier ein Praktikum gemacht.
Da war ich fünfzehn und wurde ermuntert, in das Familienunternehmen einzusteigen, bis klar wurde, dass ich schon Mühe hätte, in der Sahara Wasser zu verkaufen. Mein Vater war ein Naturtalent. Wie heißt es noch? Er hätte den Eskimos Eis andrehen können. Früher beobachtete ich ihn, wie er die Kunden – die Chancen, wie er sie nannte – einschätzte. Er sah sich den Wagen an, den sie fuhren, ihre Kleidung, und dann entschied er sich unbeirrbar für die richtige Herangehensweise. Er war stets er selbst – immer Tom Johnson –, doch sein Akzent war mal ein wenig stärker, mal ein wenig schwächer ausgeprägt, oder er erklärte sich zum waschechten Fan von Watford FC, The Cure, chocolatfarbenen Labradoren … Man erkannte den Moment genau, in dem es klickte; die Sekunde, in der ein Kunde beschloss, dass er und mein Vater auf einer Wellenlänge waren. Dass Tom Johnson ein Mann war, dem man vertrauen konnte.
Ich konnte das nicht. Ich versuchte, meinen Vater nachzuahmen, mit meiner Mutter am Tresen zu arbeiten und ihre Art zu kopieren, die Kunden anzulächeln und nach ihren Kindern zu fragen, doch ich klang selbst in meinen eigenen Ohren gekünstelt.
»Ich glaube nicht, dass Annie zur Verkäuferin geboren ist«, sagte Billy – nicht unfreundlich –, als mein Praktikum zu Ende ging. Keiner widersprach.
Das Komische ist, dass ich trotzdem im Verkauf gelandet bin. Denn letztlich läuft es bei Wohltätigkeitsarbeit darauf hinaus. Monatliche Spenden verkaufen, Förderung für Kinder, Nachlässe und Erbschaften. Schuldgefühle an Leute zu verkaufen, die genug Geld haben, um helfen zu können. Seit dem Uni-Abschluss bin ich bei Save the Children, und es hat sich nie gekünstelt angefühlt. Wie sich herausstellte, konnte ich mich bloß nie für das Verkaufen von Autos begeistern.
Billy trägt einen dunkelblauen Nadelstreifenanzug, und seine roten Socken und Hosenträger verleihen ihm ein Wall-Street-Flair, was auch volle Absicht ist. Billy tut nichts zufällig. Bei jedem anderen hätte ich diesen Aufzug protzig gefunden, doch Billy steht er – auch wenn sich die Hosenträger ein bisschen über seinem Bauch spannen. Er trägt ihn mit einem Hauch von Ironie, was ihn eher liebenswert macht, nicht angeberisch. Nur zwei Jahre jünger als mein Dad, trotzdem ist sein Haar noch voll, und das wenige Grau, das sich an seinen Schläfen gebildet haben mag, ist sorgfältig gefärbt. Seine Erscheinung nimmt Billy genauso ernst wie das Autohaus.
»Worum geht es, Annie?«, fragt er sanft. Er war immer schon sanft, schon wenn ich als Kind hinfiel oder mich auf dem Spielplatz mit anderen zankte. »Ein harter Tag? Ich bin heute selbst neben der Spur und werde froh sein, wenn er vorbei ist. Jahrestage, was? Lauter Erinnerungen.« Unter der brüsken Art schwingt Verwundbarkeit mit, und ich nehme mir vor, mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Früher war ich dauernd hier, doch seit meine Eltern tot sind, flüchte ich mich in nichtige Ausreden, sogar vor mir selbst. Ich habe zu viel zu tun, Ella ist zu klein, das Wetter ist zu schlecht … In Wahrheit schmerzt es zu sehr, hier zu sein.
Aber das ist nicht fair. »Kommst du morgen Abend zum Essen?«
Billy zögert.
»Bitte?«
»Klar, das wäre nett.«
Die Glasscheibe zwischen Billys Büro und dem Verkaufsraum ist einseitig getönt, und durch sie sehe ich einen der Verkäufer beim Händedruck mit einem Kunden. Er blickt zum Büro, offensichtlich in der Hoffnung, dass der Chef zuschaut. Billy nickt zustimmend, speichert es gewiss für die nächste Bewertung ab. Ich beobachte ihn, suche nach einem verräterischen Zeichen, um zu erahnen, was er denkt.
Die Geschäfte gehen schleppend. Mein Vater war die treibende Kraft hier, und sein Tod traf Onkel Billy hart. Als auch noch meine Mutter starb, dachte ich für einen Moment, er würde es nicht überstehen.
Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem mir das klar wurde: Ich wusste erst seit kurzem, dass Ella unterwegs war, und war zum Autohaus gekommen, um Onkel Billy zu besuchen. Ich fand ein unglaubliches Chaos war. Das Büro war leer, und auf den niedrigen Tischen im Wartebereich flogen leere Plastikbecher herum. Die Kunden wanderten allein zwischen den Wagen auf dem Vorplatz umher. Am Empfang hockte Kevin – ein neuerer Verkäufer mit dichtem rotem Haarschopf – auf dem Tresen und flirtete mit der Empfangssekretärin. Sie war von einer Zeitarbeitsvermittlung und hatte die Woche nach Weihnachten angefangen.
»Aber wo ist er?«
Kevin zuckte mit den Schultern. »Er war heute noch nicht hier.«
»Und ihr seid nicht auf die Idee gekommen, ihn anzurufen?«
Auf der Fahrt zu Billy ignorierte ich die aufsteigende Panik in meiner Brust. Er hatte sich den Tag freigenommen, sonst nichts. Er wurde nicht vermisst. Das würde er mir nicht antun.
Ich klingelte bei ihm. Hämmerte an seine Tür. Und als ich bereits in meiner Tasche nach dem Handy wühlte und meine Lippen schon die Worte formten, die mir aus der Anhörung zu meinen Eltern vertraut waren – es besteht Sorge um das Wohl –, öffnete Billy die Tür.
Feine rote Linien durchzogen das Weiße in seinen Augen. Sein Hemd stand offen, und an seinem zerknitterten Anzugjackett erkannte ich, dass er darin geschlafen hatte. Eine Alkoholwolke wehte mir entgegen, und ich hoffte, dass sie vom Vorabend war, nicht von heute Morgen.
»Wer führt das Geschäft, Onkel Billy?«
Er starrte an mir vorbei zur Straße, wo ein altes Ehepaar langsam vorbeischlurfte, einen Einkaufswagen hinter sich herziehend.
»Ich kann das nicht. Ich halte es dort nicht aus.«
Mich überkam Wut. Dachte er etwa, ich wollte nicht aufgeben? Glaubte er, er wäre der Einzige, den das hier hart traf?
Im Haus sah es furchtbar aus. Ein Fettfilm bedeckte den Glascouchtisch im Wohnzimmer. Überall in der Küche stand schmutziges Geschirr, und im Kühlschrank stand nur eine halb volle Flasche Weißwein. Nichts Richtiges zu essen im Haus zu finden ist nicht ungewöhnlich, denn Onkel Billy betrachtet aushäusiges Essen als einen der besonderen Vorzüge des Single-Lebens; doch hier war nicht mal Milch oder Brot. Nichts.
Ich verbarg mein Entsetzen, stapelte das Geschirr in die Spüle, wischte die Arbeitsflächen ab und sammelte die Post vom Dielenboden auf.
Er lächelte mich müde an. »Du bist ein gutes Kind, Annie.«
»Bei der Wäsche bist du auf dich gestellt – ich werde nicht deine Unterhosen waschen.« Meine Wut war verflogen. Dies war nicht Billys Schuld. Es war niemandes Schuld.
»Tut mir leid.«
»Weiß ich.« Ich umarmte ihn. »Aber du musst wieder zur Arbeit, Billy. Das sind nur Jugendliche.«
»Wozu denn noch? Gestern hatten wir gerade mal sechs Kunden da, und das waren alles Reifentreter.«
»Reifentreter sind bloß Käufer, die es noch nicht wissen.« Der Lieblingsspruch meines Vaters bescherte mir einen Kloß im Hals. Billy drückte meinen Arm.
»Er war so stolz auf dich.«
»Auf dich war er auch stolz. Und auf das, was ihr beide mit der Firma erreicht habt.« Ich wartete kurz, ehe ich hinzusetzte:
»Enttäusch ihn nicht.«
Mittags war Billy bei der Arbeit, blies Kevin den Marsch und versprach dem Ersten, der einen Wagen verkaufte, eine Flasche Champagner. Ich wusste, dass es mehr als Champagner bräuchte, um Johnson’s Cars zurück auf Kurs zu bringen, doch wenigstens übernahm Billy wieder das Steuer.
Mein Vater hatte das getönte Glas einbauen lassen, wenige Wochen nachdem mein Großvater sich aus dem Geschäft zurückgezogen hatte, und Billy und mein Vater waren in das Büro gezogen, wo sie jeder einen Schreibtisch hatten.
»Hält die Leute auf Trab.«
»Verhindert wohl eher, dass sie euch beim Nickerchen erwischen.« Meine Mutter durchschaute die Johnson-Männer. Das tat sie immer.
Billy wendet sich wieder mir zu. »Ich hätte gedacht, dieser Bursche von dir hätte heute freigenommen.«
»Er heißt Mark, nicht dieser Bursche. Es wäre schön, wenn du ihm eine Chance gibst.«
»Sobald er eine anständige Frau aus dir gemacht hat.«
»Wir sind nicht in den 1950ern, Billy.«
»Aber dich heute allein zu lassen!«
»Er hatte angeboten, zu Hause zu bleiben. Ich habe gesagt, dass es mir gut geht.«
»Klar.«
»Tat es auch. Bevor das hier ankam.« Ich angle die Karte unten aus dem Korb von Ellas Kinderwagen und gebe sie Billy. Dann beobachte ich, wie er die Karte ansieht und die Nachricht drinnen liest. Es folgt eine lange Stille, ehe er die Karte in den Umschlag zurücksteckt. Seine Züge verhärten sich.
»Kranke Schweine.« Bevor ich ihn aufhalten kann, zerreißt er die Karte, erst in zwei, dann in vier Teile.
»Was machst du denn?« Ich springe aus dem Sessel auf und reiße ihm die Kartenteile aus der Hand. »Wir müssen die zur Polizei bringen.«
»Zur Polizei?«
»Von wegen. Das ist eine Botschaft. Sie deuten an, dass Mum von der Klippe gestoßen wurde. Und Dad vielleicht auch.«
»Annie, Liebes, das hatten wir doch schon hundertmal.
Glaubst du im Ernst, dass deine Eltern ermordet wurden?«
»Ja.« Meine Unterlippe bebt, und ich kneife den Mund zu, um mich zu fangen. »Ja, tue ich. Ich habe immer gedacht, dass etwas nicht stimmt. Die beiden hätten sich doch nie das Leben genommen, am allerwenigsten Mum, denn sie wusste, wie sehr uns Dads Tod getroffen hat. Und jetzt …«
»Da wühlt jemand Dreck auf, Annie! Irgendein durchgeknallter Mistkerl, der es witzig findet, die Todesanzeigen zu lesen und trauernde Familien zu schikanieren. Wie die Drecksäcke, die Beerdigungslisten durchgehen und bei den Leuten einbrechen. Wahrscheinlich hat der hier gleichzeitig noch ein Dutzend ähnliche Karten verschickt.« Obwohl ich weiß, dass er sich über den Absender der Karte aufregt, fühlt es sich an, als würde sich seine Wut gegen mich richten. Ich stehe wieder auf.
»Noch ein Grund mehr, damit zur Polizei zu gehen. Damit sie rausfinden können, wer die Karte geschickt hat.« Ich klinge trotzig, aber entweder das, oder ich breche in Tränen aus.
»Diese Familie ist nie zur Polizei gelaufen. Wir haben von jeher unsere Probleme allein gelöst.«
»Probleme?« Ich verstehe nicht, warum Billy so begriffsstutzig ist. Sieht er denn nicht, dass dies hier alles ändert? »Das ist kein Problem, Billy. Es ist nicht irgendein Streit, den man hinterm Pub regelt. Es könnte Mord sein. Und mich interessiert, was mit meiner Mum passiert ist, selbst wenn es dich nicht kümmert.« Zu spät beiße ich mir auf die Zunge. Billy dreht sich weg, aber vorher kann ich noch erkennen, wie gekränkt er ist. Eine Weile lang stehe ich hilflos da, sehe seinen Hinterkopf an und versuche, mich zu entschuldigen, doch die Worte wollen mir nicht über die Lippen kommen.
Ich schiebe Ellas Kinderwagen aus dem Büro und lasse die Tür weit offen. Wenn Billy mir nicht helfen will, gehe ich allein zur Polizei.
Jemand hatte meine Eltern umgebracht, und ich werde herausfinden, wer das war.
Fünf
Murray
Murray Mackenzie schwenkte einen Teebeutel in einem Styroporbecher.
»Milch?« Er öffnete den Kühlschrank und schnupperte hintereinander an drei Milchtüten, bis er eine fand, die er guten Gewissens einer Zivilistin in Not anbieten konnte. Und Anna Johnson war zweifelsfrei in Not. Sie weinte nicht, doch Murray war sich unangenehm sicher, dass sie das jederzeit könnte. Mit Tränen konnte er gar nicht gut umgehen. Er wusste nie, ob er sie ignorieren sollte oder etwas sagen – oder ob es heutzutage politisch inkorrekt war, ein frisch gebügeltes Taschentuch anzubieten.
Murray hörte ein leises Murmeln, das die Ankündigung eines Schluchzens gewesen sein könnte. Politische Korrektheit hin oder her, falls Mrs Johnson kein Taschentuch hatte, würde er ihr zu Hilfe kommen. Er selbst benutzte keine Stofftaschentücher, hatte aber für solche Gelegenheiten stets eines bei sich, genau wie sein Vater früher. Murray klopfte an seine Tasche, doch als er sich umdrehte – mit dem etwas zu vollen Styroporbecher in einer Hand –, wurde ihm klar, dass das leise Quieken von dem Baby gekommen war, nicht von Mrs Johnson.
Seine Erleichterung war indes nur von kurzer Dauer, denn Anna Johnson hob das Baby schwungvoll aus dem Wagen und legte es sich quer über den Schoß, ehe sie ihr Top hochzog und zu stillen begann. Murray spürte, wie er rot wurde, was ihn umso mehr erröten ließ. Nicht dass er etwas dagegen hatte, dass Frauen ihren Säuglingen die Brust gaben; er wusste bloß nie, wohin er schauen sollte, wenn sie es taten. Einmal hatte er einer Mutter in dem Café über Marks & Spencer verständnisvoll zugelächelt – zumindest hielt er es für verständnisvoll, worauf die Frau ihn empört anfunkelte und sich bedeckte, als wäre er irgendein Perverser.
Nun fixierte er einen Punkt irgendwo oberhalb von Mrs Johnsons linker Augenbraue, während er ihr so formvollendet den Tee hinstellte, als reichte er ihn in edlem Porzellan. »Ich konnte leider keine Kekse finden.«
»Tee ist wunderbar, danke.«
Je älter Murray wurde, desto schlechter wurde er darin, das Alter anderer Leute einzuschätzen. Mittlerweile kam ihm jeder unter vierzig jung vor, doch Anna Johnson war eindeutig noch keine dreißig.
Sie war eine attraktive junge Frau mit leicht gewelltem, mittelblondem Haar, das auf ihren Schultern wippte, wenn sie den Kopf bewegte. Allerdings war sie blass und ihr anzusehen, was es bedeutete, eine junge Mutter zu sein. Dieselben Auswirkungen hatte Murray bei seiner Schwester beobachtet, als seine Neffen klein waren.
Sie saßen in dem kleinen Bereich hinter dem Empfangstresen der Polizeiwache Lower Meads, wo man für Murray und dessen Kollegen eine Kitchenette eingebaut hatte, damit sie hier ihre Mittagspause machen und gleichzeitig im Auge behalten konnten, wer durch die Tür kam. Eigentlich sollten keine Zivilisten auf dieser Seite des Tresens sein, aber auf der Wache war es ruhig; ganze Stunden waren vergangen, ohne dass jemand einen entlaufenen Hund gemeldet oder ein Kautionsformular unterschrieben hatte. Murray hatte zu Hause schon genug Zeit allein mit seinen Gedanken; bei der Arbeit brauchte er nicht auch noch Stille im Überfluss.
Es kam selten vor, dass sich so weit von der Zentrale jemand blicken ließ, dessen Rang höher als der eines Sergeants war, weshalb Murray alle Vorsicht in den Wind geschlagen und Mrs Johnson in den nichtöffentlichen Bereich gebeten hatte. Man musste kein Detective sein, um zu begreifen, dass ein knapper Meter Tresen mit Resopalplatte wenig geeignet war, einer Zeugin ein Gefühl von Entspanntheit zu vermitteln. Nicht dass Mrs Johnson aussah, als würde sie sich jemals entspannt fühlen, wenn man den Grund für ihren Besuch bedachte.
»Ich glaube, dass meine Mutter ermordet wurde«, hatte sie bei ihrer Ankunft verkündet. Beinahe trotzig hatte sie Murray angesehen, als rechnete sie damit, dass er ihr widersprach. Dabei war Murrays Adrenalinspiegel sofort erwartungsvoll angestiegen. Ein Mord. Welcher DI hatte heute Dienst? Oh nein … Detective Inspector Robinson. Es würde kein Spaß, den Jungschnösel mit dem Flaum auf der Oberlippe und circa fünf Minuten Berufserfahrung herbeizurufen. Dann jedoch hatte Anna Johnson erklärt, dass ihre Mutter seit einem Jahr tot war und der Coroner bereits Suizid als Todesursache festgestellt hatte. In dem Moment hatte Murray die Tür seitlich vom Tresen geöffnet und Mrs Johnson hereingebeten. Er vermutete, dass sie eine Weile bräuchten. Ein Hund folgte ihr brav und schien nicht im Mindesten verunsichert von der Umgebung.
Nun griff Anna Johnson umständlich hinter sich und nahm einen kleinen Stapel Papier aus dem Kinderwagen. Bei der Verrenkung rutschte ihr T-Shirt nach oben und enthüllte einige Zentimeter weichen Bauch. Murray hüstelte recht deutlich und starrte gebannt auf den Fußboden, während er sich fragte, wie lange es dauerte, ein Kind zu stillen.
»Heute ist der Todestag meiner Mutter.« Sie sprach laut und mit einer Strenge, die vermutlich dem Versuch geschuldet war, nicht die Fassung zu verlieren. Es ließ ihre Stimme befremdlich kühl klingen und passte nicht zu ihrem ängstlichen Blick. »Dies hier kam mit der Post.« Sie warf Murray das Papierbündel zu.
»Ich hole mir ein paar Handschuhe.«
»Fingerabdrücke! Daran hatte ich nicht gedacht … Habe ich jetzt alle Beweise zerstört?«
»Sehen wir uns erst mal an, was wir hier haben, Mrs Johnson.«
»Genau genommen ist es Miss, aber Anna reicht vollkommen.«
»Anna. Lassen Sie uns sehen, was wir hier haben.« Murray kehrte an seinen Platz zurück und zog sich die Latexhandschuhe mit solcher Routiniertheit über, dass es guttat. Dann legte er eine große Beweismitteltüte zwischen ihnen auf den Tisch und breitete die Papierstücke aus. Es handelte sich um eine Karte, die grob in vier Stücke gerissen worden war.
»So kam sie nicht an. Mein Onkel …« Anna zögerte. »Ich glaube, er war wütend.«
»Der Bruder Ihrer Mutter?«
»Meines Vaters. Billy Johnson. Johnson’s Cars an der Ecke Main Street?«
»Das Autohaus gehört Ihrem Onkel?« Murray hatte seinen Volvo dort gekauft. Er versuchte, sich an den Mann zu erinnern, der ihm den Wagen verkauft hatte, und ihm fiel ein elegant gekleideter Mann ein, der sich das Haar sorgsam über eine kahle Stelle oben gekämmt hatte.
»Es gehörte meinem Großvater. Mein Vater und mein Onkel Billy haben bei ihm ihre Ausbildung gemacht, danach aber in London gearbeitet. Dort haben sich meine Eltern kennengelernt. Als mein Großvater krank wurde, kamen mein Vater und Billy zurück, um ihm zu helfen. Er ging in den Ruhestand, und sie übernahmen das Geschäft.«
»Und jetzt gehört es Ihrem Onkel?«
»Ja. Na ja, und mir, schätze ich. Auch wenn das nicht unbedingt ein Segen ist.«
Murray wartete.
»Das Geschäft läuft momentan nicht so gut.« Sie zuckte mit den Schultern, achtete aber darauf, das Baby in ihren Armen nicht aufzuschrecken. Murray nahm sich vor, später genauer zu überprüfen, wer was von Annas Eltern geerbt hatte. Zunächst wollte er sich die Karte ansehen.
Er trennte die Umschlagteile von der Karte und fügte Letztere zusammen. Dann betrachtete er den festlichen Aufdruck, der in einem grausamen Widerspruch zur anonymen Botschaft im Innern stand.
Selbstmord? Von wegen.
»Haben Sie eine Ahnung, wer Ihnen das geschickt haben könnte?«
Anna schüttelte den Kopf.
»Wie bekannt ist Ihre Adresse?«