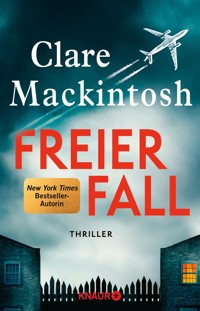9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Zoe Walker führt ein komplett durchschnittliches Leben in einem Londoner Vorort: Sie ist geschieden, hat zwei Kinder und einen langweiligen Job. Eines Tages entdeckt sie auf dem sonst so ereignislosen Heimweg ein Foto von sich in der U-Bahn, daneben eine ihr unbekannte Telefonnummer. Bloß eine harmlose Verwechslung? Zoe ahnt, dass es hier um mehr gehen muss. Doch noch weiß sie nicht, in welcher Gefahr sie schwebt - und wie bald sie alles zu verlieren droht, was sie liebt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Zitat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Epilog
Danksagung
Über die Autorin
Clare Mackintosh arbeitete zwölf Jahre bei der britischen Polizei und brachte es bis zum CID. Während ihrer Elternzeit sehnte sie sich nach neuen beruflichen Herausforderungen und begann eine erfolgreiche Karriere als freie Journalistin, u.a. für den Guardian. Außerdem gründete sie 2012 das Chipping Norton Literaturfestival, das nur wenige Jahre nach seiner Gründung Besuchermassen anzieht. Zusammen mit ihrem Mann und ihren drei Kindern lebt sie in den Cotswolds. Ihr erster Roman MEINE SEELESOKALT war 2015 das erfolgreichste Thrillerdebüt in Großbritannien.
Clare Mackintosh
ALLEINE BISTDU NIE
Psychothriller
Aus dem britischen Englisch vonSabine Schilasky
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:Copyright © 2016 by Clare MackintoshTitel der Originalausgabe: »I See You«First published in Great Britain in 2016 by Sphere,an imprint of Little, Brown Book Grou
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Stefanie Kruschandl, HamburgTitelillustration: © getty-images/PiccellUmschlaggestaltung: Mediabureau di Stefano, Berlin
eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-2966-7
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für meine Eltern,
Du tust jeden Tag das Gleiche.Du weißt genau, wohin du willst.Ich auch.
1
Der Mann hinter mir steht nahe genug, dass sein Atem mich feucht im Nacken trifft. Ich bewege mich wenige Zentimeter nach vorn, sodass ich gegen einen grauen Regenmantel stoße, der nach nassem Hund riecht. Es kommt einem vor, als hätte es den ganzen November noch nicht aufgehört zu regnen. Dünne Dampfschwaden steigen von den warmen, zusammengedrängten Körpern um mich herum auf. Die Kante einer Aktentasche schneidet mir in den Oberschenkel. Als die Bahn durch eine Kurve rumpelt, werde ich einzig von den Menschen um mich herum aufrecht gehalten und muss mich kurz an dem grauen Mantelrücken abstützen. In Tower Hill speit der Wagen ein Dutzend Pendler aus und schluckt weitere zwei Dutzend, die allesamt dringend nach Hause ins Wochenende wollen.
»Nutzen Sie bitte den gesamten Wagen!«, fordert eine Lautsprecheransage.
Keiner rührt sich.
Der graue Mantel vor mir ist weg, und ich rücke auf seinen Platz, wo ich endlich die Haltestange erreiche und mir nicht mehr die DNA eines Fremden in den Nacken geblasen wird. Meine Handtasche ist nach hinten gerutscht, und ich ziehe sie wieder nach vorn. Zwei japanische Touristen tragen gewaltige Rucksäcke vor ihren Bäuchen, die so viel Raum wie zwei weitere Leute einnehmen. Eine Frau auf der anderen Seite des Wagens bemerkt, dass ich zu den beiden blicke. Sie sieht mich an und zieht eine Grimasse, um ihre Solidarität zu bekunden. Ich halte den Augenkontakt nur flüchtig, bevor ich zu Boden blicke. Die Schuhe um mich herum variieren: große, blanke Herrenschuhe unter Nadelstreifenaufschlägen; bunte Damenpumps mit zehenquetschenden Spitzen. Und mittendrin eine blickdichte schwarze Feinstrumpfhose, die in grellweiße Turnschuhe mündet. Die Trägerin kann ich nicht sehen. Ich stelle sie mir aber in den Zwanzigern vor, mit einem Paar hochhackiger Ersatzschuhe in einer geräumigen Handtasche oder in einer Schublade im Büro.
Ich habe noch nie tagsüber hohe Schuhe angezogen. Schließlich war ich kaum aus meinen Clark’s-Schnürschuhen raus, als ich mit Justin schwanger wurde, und in der Kassenschlange bei Tesco oder mit einem Kleinkind auf der Straße bieten sich hohe Absätze weniger an. Mittlerweile bin ich zu alt, um mich in solche Dinger zu quälen. Eine Stunde Bahnfahrt zur Arbeit, eine Stunde zurück nach Hause, dazwischen defekte Rolltreppen, die es zu erklimmen gilt, und Buggys und Räder, die einem über die Füße rollen. Und wofür? Für acht Stunden hinter einem Schreibtisch. Da spare ich mir meine schicken Schuhe für Feiertage und Urlaub auf. Ich kleide mich freiwillig uniform: schwarze Hosen und eine Auswahl an Stretch-Tops, die nicht gebügelt werden müssen und gerade schick genug sind, um als Bürokleidung durchzugehen. In der untersten Schublade meines Schreibtisches ist eine Strickjacke für besonders geschäftige Tage, wenn dauernd die Tür aufgeht und die Wärme drinnen mit jedem potenziellen Klienten schwindet.
Die Bahn hält, und ich drängle mich hinaus. Von hier aus nehme ich die S-Bahn. Die ist zwar auch oft voll, aber ich mag sie lieber. Unter der Erde fühle ich mich einfach nicht wohl, kann nicht richtig atmen. Mein Traum wäre eine Arbeitsstelle, die ich zu Fuß erreichen kann, aber das wird ein Traum bleiben. Die einzigen lohnenden Jobs befinden sich in Zone eins, die einzigen bezahlbaren Hypotheken in Zone vier.
Ich muss auf meine Bahn warten und nehme mir eine Ausgabe der London Gazette aus dem Gestell neben dem Fahrkartenautomaten. Die Schlagzeilen sind dem Datum – Freitag, der 13. November – entsprechend düster. Die Polizei hat wieder mal einen Terroranschlag verhindert, und auf den ersten drei Seiten häufen sich Bilder von Sprengstoff, den sie in einer Wohnung in Nordlondon beschlagnahmt haben. Ich blättere durch die Fotos von bärtigen Männern, während ich zu dem Riss im Belag des Bahnsteigs gehe, wo sich die Wagentür öffnen wird. Von dieser Position aus kann ich direkt zu meinem bevorzugten Platz gelangen, bevor sich der Wagen füllt: am Ende der Reihe, wo ich mich an die Glasabtrennung lehnen kann. Der Rest des Wagens füllt sich schnell, und ich sehe zu den Leuten, die noch stehen, wobei mich eine beschämende Erleichterung überkommt, weil keiner von ihnen alt oder offensichtlich schwanger ist. Trotz der flachen Schuhe tun mir die Füße weh, da ich fast den ganzen Tag an den Aktenschränken gestanden habe. Eigentlich ist die Ablage nicht meine Aufgabe. Dafür ist ein junges Mädchen eingestellt, das die Immobilien-Exposés kopiert und die Dokumente in die Ordner sortiert; aber sie ist für zwei Wochen auf Mallorca, und wie ich heute festgestellt habe, kann sie seit Wochen keine Ablage mehr gemacht haben. Ich fand Wohn- zwischen Gewerbeimmobilien, Mietverträge zwischen Verkäufen. Und ich war so blöd, es zu erwähnen.
»Dann sortieren Sie das mal lieber, Zoe«, sagte Graham. So kam es, dass ich, statt Besichtigungstermine abzusprechen, im zugigen Korridor vor Grahams Büro stand und wünschte, ich hätte den Mund gehalten. Der Job bei Hallow & Reed ist nicht schlecht. Früher war ich einen Tag pro Woche dort, um die Buchhaltung zu machen. Dann ging die Büroleiterin in den Mutterschutz, und Graham bat mich einzuspringen. Ich bin Buchhalterin, keine Sekretärin, aber die Bezahlung war anständig, und da ich gerade einige Mandanten verloren hatte, ergriff ich die Chance. Mittlerweile sind drei Jahre vergangen, und ich bin immer noch dort.
Bis Canada Water hat sich die Bahn merklich geleert, und die einzigen Leute, die noch stehen, tun es freiwillig. Der Mann neben mir sitzt so breitbeinig da, dass ich meine Beine zur Seite lehnen muss, und als ich zur gegenüberliegenden Reihe sehe, bemerke ich, dass zwei andere Männer genauso sitzen. Machen die das mit Absicht? Oder ist es eine Art angeborener Drang, sich größer als andere zu machen? Die Frau direkt vor mir bewegt ihre Einkaufstasche, und ich höre das unverkennbare Klimpern von Flaschen. Wein vermutlich. Ich hoffe, Simon hat nicht vergessen, Wein in den Kühlschrank zu stellen. Es war eine lange Woche, und ich möchte mich nur noch aufs Sofa legen und fernsehen.
In der London Gazette bin ich auf einer Seite angekommen, auf der sich ein früherer X-Factor-Finalist über den »Stress des Berühmtseins«, beklagt, gefolgt von einer Diskussion über den gesetzlichen Schutz der Privatsphäre, die einen Großteil der Seite einnimmt. Ich lese, ohne den Text richtig aufzunehmen. Vielmehr sehe ich die Bilder an und überfliege die Schlagzeilen, um zumindest halbwegs auf dem Laufenden zu sein. Ich erinnere mich nicht, wann ich das letzte Mal eine Zeitung von vorn bis hinten gelesen oder die Nachrichten von Anfang bis Ende gesehen habe. Meistens sehe ich morgens Bruchstücke von Sky News beim Frühstück oder lese die Schlagzeilen bei anderen mit.
Der Zug hält zwischen Sydenham und Crystal Palace. Von weiter vorn im Wagen höre ich ein frustriertes Stöhnen, aber ich sehe nicht nach, von wem es kommt. Es ist schon dunkel, und als ich zum Fenster blicke, ist da nur mein Spiegelbild, blass und verzerrt vom Regen. Ich nehme meine Brille ab und reibe die Druckstellen an meiner Nase. Aus den Lautsprechern erklingt eine solch verknackste und verrauschte Ansage, die überdies mit einem derart starken Akzent durchgegeben wird, dass unklar ist, was gesagt wurde. Es könnte alles sein – von einem Signalausfall bis hin zu einer Leiche auf den Gleisen.
Ich hoffe, dass es keine Leiche ist, und denke an mein Glas Wein und Simon, der mir die Füße massiert. Prompt bekomme ich ein schlechtes Gewissen, weil mein erster Gedanke meinem eigenen Wohl gilt und nicht irgendeinem verzweifelten Selbstmörder. Nein, sicher ist es keine Leiche. Leichen fallen montags morgens an, nicht freitags abends, wenn die Arbeit glorreiche drei Tage entfernt ist.
Es gibt ein lautes Knirschen, dann Stille. Was immer der Verspätungsgrund ist, es wird eine Weile dauern.
»Das ist kein gutes Zeichen«, sagt der Mann neben mir.
Ich gebe ein neutrales »Hmm« von mir und blättere weiter in meiner Zeitung. Sport interessiert mich nicht, und danach kommen hauptsächlich Anzeigen und Theaterkritiken. Wenn das so weitergeht, werde ich nicht vor sieben zu Hause sein. Das heißt, dass wir eher etwas Einfaches essen werden, nicht das Brathähnchen, das ich geplant hatte. Unter der Woche kocht Simon, und ich übernehme es freitags und an den Wochenenden. Da würde er es auch machen, wenn ich ihn bitte, aber das kann ich unmöglich annehmen. Es käme mir falsch vor, wenn er uns – meine Kinder – jeden Abend bekocht. Vielleicht hole ich auf dem Weg auch ein Takeaway.
Ich überfliege den Wirtschaftsteil und sehe mir das Kreuzworträtsel an, habe jedoch keinen Stift bei mir. Also lese ich die Anzeigen, ob ich vielleicht einen Job für Katie entdecke – oder für mich, obwohl mir klar ist, dass ich Hallow&Reed niemals verlassen werde. Sie zahlen gut, und ich weiß, was ich tue, inzwischen jedenfalls. Abgesehen von meinem Boss ist der Job perfekt. Die Kunden sind größtenteils nett, normalerweise Start-ups, die Büroräume suchen, oder bereits etablierte Firmen, die sich vergrößern wollen. Viele Wohnimmobilien vermakeln wir nicht, ausgenommen die Wohnungen über den Läden für Erstkäufer und Leute, die sich verkleinern wollen oder müssen. Mir begegnen relativ viele frisch Getrennte, und manchmal, wenn mir danach ist, sage ich ihnen, dass ich weiß, was sie durchmachen.
»Wie sind Sie damit klargekommen?«, fragen die Frauen dann immer.
»Es war das Beste, was ich je getan habe«, antworte ich, denn das wollen sie hören.
Ich finde keine Jobs für eine neunzehnjährige Möchtegernschauspielerin, aber ich knicke die Ecke einer Seite ein, auf der eine Büroleiterin gesucht wird. Es schadet ja nicht zu wissen, was sich sonst noch bietet. Für einen Moment male ich mir aus, wie ich in Graham Hallows Büro spaziere, ihm meine Kündigung reiche und ihm sage, dass ich es mir eben nicht gefallen lasse, wie ein Fußabtreter behandelt zu werden. Dann sehe ich das Gehaltsangebot in der Anzeige und erinnere mich, wie mühsam ich mich in eine Position hochgearbeitet habe, von der ich tatsächlich leben kann. Und wie heißt es noch so schön? Hat man die Wahl, entscheidet man sich lieber für das Übel, das man kennt.
Auf den letzten Seiten der Gazette sind nur noch amtliche Forderungsanzeigen und Finanzwerbung. Die Kreditanzeigen meide ich absichtlich – bei diesen Zinssätzen müsste man entweder irre oder verzweifelt sein. Also sehe ich mir die Kontaktanzeigen ganz unten an.
Verheiratete Frau sucht diskrete Abwechslung.Für Bilder SMS an ANGEL 69998 schicken.
Ich rümpfe die Nase – eher über die astronomischen Preise pro SMS als über die angebotenen Dienste. Wer bin ich, dass ich verurteilen könnte, was andere Leute tun? Ich will schon weiterblättern und doch die Ergebnisse des gestrigen Fußballspiels studieren, als mir eine Anzeige direkt unter »Angel« auffällt.
Für einen Moment denke ich, dass meine Augen übermüdet sein müssen. Ich blinzle, doch das ändert nichts.
Mich beschäftigt das, was ich sehe, so sehr, dass ich gar nicht merke, wie die Bahn wieder anfährt. Weshalb ich bei dem Ruck prompt zur Seite kippe und unwillkürlich eine Hand ausstrecke, die auf dem Schenkel meines Nachbarn landet.
»Entschuldigung!«
»Schon gut, kein Problem.« Er lächelt mich an, und ich zwinge mich, das Lächeln zu erwidern. Pochenden Herzens starre ich auf die Anzeige. Sie enthält dieselben Hinweise auf die SMS-Kosten wie die anderen, und oben steht eine 0255-Nummer. Es ist auch eine Webadresse angegeben: www.findtheone.com. Finde die Eine? Aber was mich am meisten erschüttert, ist das Foto. Es ist eine Nahaufnahme vom Gesicht, aber man kann noch blondes Haar und den Ausschnitt eines schwarzen Trägertops sehen. Die Frau ist älter als die anderen, die hier ihre Waren anbieten, auch wenn das Bild viel zu körnig ist, um das Alter genau zu schätzen.
Muss ich sowieso nicht, weil ich weiß, wie alt sie ist. Vierzig.
Denn die Frau in der Anzeige bin ich.
2
Kelly Swift stand in der Mitte des Central-Line-Wagens und lehnte sich zur Seite, um die Kurvenbewegung des Zugs auszugleichen. Zwei Jugendliche – nicht älter als vierzehn oder fünfzehn – stiegen an der Bond Street zu und fluchten um die Wette. Für die außerschulischen Club-Veranstaltungen waren sie zu spät dran, und draußen war es bereits dunkel. Kelly hoffte, dass sie auf dem Heimweg waren, nicht für den Abend loszogen, denn dafür waren sie definitiv zu jung.
»Scheißpsycho!« Der Junge blickte auf und wurde verlegen, als er Kelly sah. Vermutlich hatte sie die gleiche Miene aufgesetzt wie ihre Mutter früher so oft. Die Teenager verstummten, wurden sehr rot und drehten sich weg, in Richtung der zugleitenden Türen. Tja, dachte Kelly. Wahrscheinlich war sie sogar alt genug, um die Mutter der beiden zu sein. Sie zählte von dreißig rückwärts und stellte sich vor, wie es sein musste, einen vierzehnjährigen Sohn zu haben. Mehrere ihrer alten Schuldfreundinnen hatten Kinder, die fast genauso alt waren. Auf Kellys Facebook-Seite tauchten immer wieder Fotos von stolzen Familien auf, und sie hatte sogar schon Freundschaftsanfragen von einigen der Kinder bekommen – eine todsichere Methode, um sich richtig alt zu fühlen.
Kelly bemerkte den Blick einer Frau gegenüber, die einen roten Mantel trug. Die Frau nickte ihr zu, als wolle sie ihr gratulieren, diese Wirkung auf die Jugendlichen zu haben.
Kelly erwiderte den Blick lächelnd. »Einen guten Tag gehabt?«
»Jetzt ist er besser, weil er vorbei ist«, antwortete die Frau. »Auf ins Wochenende, was?«
»Ich arbeite und habe erst am Dienstag frei.« Und selbst da nur einen Tag, dachte sie und stöhnte innerlich. Die Frau wirkte entsetzt, doch Kelly zuckte mit den Schultern. »Einer muss es ja machen, nicht?«
»Ja, ist wohl so.« Als der Zug zum Oxford Circus hin verlangsamte, schritt die Frau auf die Türen zu. »Hoffentlich wird es ruhig für Sie.«
Ein frommer Wunsch, der sich jetzt bestimmt nicht erfüllen würde. Kelly sah auf ihre Uhr. Noch neun Stationen bis Stratford: ihren Kram abliefern, dann zurück. Zu Hause gegen acht, vielleicht halb neun, und um sieben Uhr morgen früh wieder im Dienst. Sie gähnte, wobei sie sich nicht mal die Hand vor den Mund hielt, und fragte sich, ob sie etwas zu essen im Haus hatte. Kelly teilte sich ein Haus in der Nähe von Elephant and Castle mit drei Mitbewohnerinnen, deren volle Namen sie nur von den Mietschecks kannte, die monatlich zur Abholung an der Pinnwand vorne steckten. Das Wohnzimmer hatte der Vermieter ebenfalls zu einem Schlafzimmer umgebaut, um seine Einnahmen zu maximieren, sodass einzig die kleine Küche als Gemeinschaftsraum blieb. Darin fanden nur zwei Stühle Platz, aber die Arbeitszeiten ihrer Mitbewohnerinnen hatten zur Folge, dass sie manchmal tagelang keine von ihnen sah. Die Frau mit dem größten Schlafzimmer, Dawn, war Krankenschwester. Sie war jünger als Kelly, jedoch sehr viel häuslicher, und stellte ihr hin und wieder etwas Gekochtes neben die Mikrowelle, mit einem leuchtend pinken Post-it versehen: Bedien dich! Bei dem Gedanken an Essen grummelte Kellys Magen, und wieder sah sie auf die Uhr. Nachmittags war mehr los gewesen, als sie erwartet hatte; nächste Woche müsste sie einige Überstunden einlegen, sonst würde sie den Berg niemals abgearbeitet bekommen.
Eine Handvoll Geschäftsleute stieg ein. Auf den ersten Blick sahen sie mit ihren kurzen Haaren, den dunklen Anzügen und den Aktentaschen fast identisch aus. Aber der Teufel steckt im Detail, schoss es ihr durch den Kopf. Sie registrierte das ausgeblichene Nadelstreifenmuster, den Titel des Buches, das achtlos in eine Tasche gestopft war, die Brille mit dem Metallgestell, bei dem ein Bügel verbogen war, und das braune Lederarmband der Uhr, das unter einer weißen Baumwollmanschette hervorlugte. All die Eigenheiten, die sie aus einer Reihe nahezu identischer Männer heraushoben. Kelly beobachtete sie unverhohlen. Sie übte bloß, sagte sie sich, und ihr war egal, dass einer von ihnen aufsah und ihren kühlen Blick bemerkte. Eigentlich rechnete sie damit, dass er wieder wegsehen würde, doch stattdessen zwinkerte er ihr zu und lächelte selbstbewusst. Ihr Blick wanderte zu seiner linken Hand. Verheiratet. Weiß, gut gebaut, circa einen Meter neunzig groß mit dunklen Bartstoppeln an Kinn und Wangen, die vor einigen Stunden noch nicht dort gewesen sein dürften. Ein vergessenes gelbes Reinigungsetikett blitzte innen an seinem Mantel hervor. So gerade, wie er dastand, war er vermutlich früher beim Militär gewesen. Alles in allem hatte er nichts Auffälliges, dennoch würde sie ihn wiedererkennen, sollten sie sich noch einmal über den Weg laufen.
Zufrieden richtete sie ihre Aufmerksamkeit auf die nächsten Fahrgäste, die in Holborn zustiegen und zu den letzten freien Sitzplätzen strebten. Fast jeder hatte ein Smartphone in der Hand, war in ein Spiel vertieft, hörte Musik oder umklammerte das kleine Gerät, als sei es mit seiner Hand verwachsen. Am Ende des Wagens hielt jemand sein Telefon in die Höhe, und instinktiv wandte Kelly das Gesicht ab. Sicher ein Tourist, der Eindrücke aus der Londoner U-Bahn festhalten wollte. Die Vorstellung, als Hintergrund für die Urlaubsfotos anderer Leute zu fungieren, war allerdings schlicht zu schräg.
Bei der nächsten Bewegung spürte Kelly, wie ihre Schulter schmerzte – an der Stelle, an der sie gegen die Mauer geprallt war, als sie in Marble Arch eine Kurve zur Rolltreppe zu eng genommen hatte. Sie war Sekunden zu spät dran gewesen, und es nervte, dass sie sich ganz umsonst einen Bluterguss am Oberarm zugezogen hatte. Nächstes Mal würde sie schneller sein.
Der Zug fuhr in die Station Liverpool Street ein, wo eine Menschentraube ungeduldig auf dem Bahnsteig darauf wartete, dass die Türen aufgingen.
Kellys Puls beschleunigte sich.
Da, mitten in der Menge und halb versteckt in seiner zu großen Jeans, der Kapuzenjacke und der Baseballkappe, war Carl. Sofort zu erkennen und – so dringend sie auch nach Hause wollte – unmöglich zu ignorieren. So, wie er sich in die Menge duckte, war offensichtlich, dass er sie einen Moment früher gesehen haben musste und ebenso wenig begeistert von dieser Begegnung war. Jetzt musste sie schnell sein.
Kelly sprang aus dem Wagen, als die Türen schon zischend hinter ihr zuglitten. Zuerst dachte sie, sie hätte ihn verloren, aber dann entdeckte sie seine Baseballkappe ungefähr zehn Meter weiter vorn. Er lief nicht, bewegte sich aber zügig durch die Masse der Leute, die vom Bahnsteig nach oben gingen.
Wenn Kelly eines in den letzten zehn Jahren bei der U-Bahn gelernt hatte, dann war es, dass einen Höflichkeit keinen Schritt weiterbrachte.
»Vorsicht!«, rief sie, lief los und drängte sich zwischen zwei japanischen Touristen mit Rollkoffern durch. »Aus dem Weg!« Sie mochte ihn heute Morgen verloren und sich dabei einen blauen Fleck an der Schulter eingefangen haben, aber nochmal würde sie ihn nicht davonkommen lassen. Flüchtig dachte sie an das Abendessen, auf das sie gehofft hatte, und überschlug, dass dies hier ihren Tag um mindestens zwei Stunden verlängern dürfte. Aber es nützte ja nichts. Und sie könnte sich auf dem Heimweg noch einen Kebab besorgen.
Carl lief die Rolltreppe hinauf. Anfängerfehler, wie Kelly wusste, die stattdessen die Treppe nahm. Dort waren weniger Touristen, denen man ausweichen musste, und man war schneller, weil das ungleichmäßige Geruckel des Rolltreppenmechanismus wegfiel. Allerdings brannten ihre Muskeln, als sie auf einer Höhe mit Carl war. Er warf ihr einen Blick über die linke Schulter zu, als sie oben waren, und schwenkte nach rechts. Oh verflucht nochmal, Carl, dachte sie. Ich hätte längst Dienstschluss!
Mit einem letzten Sprint holte sie ihn ein, als er gerade über die Ticketsperre setzen wollte, packte mit der linken Hand seine Jacke und zog mit der rechten seinen Arm auf den Rücken. Carl unternahm einen halbherzigen Versuch sich loszureißen, was sie vorübergehend aus dem Gleichgewicht brachte, sodass ihre Mütze zu Boden fiel. Während sie mit Carl beschäftigt war, nahm sie aus dem Augenwinkel wahr, wie jemand die Mütze aufhob. Hoffentlich würde er nicht damit wegrennen. Sie hatte sowieso schon Stress mit der Materialstelle, weil sie neulich bei einem Gerangel ihren Schlagstock eingebüßt hatte – und sie brauchte wirklich nicht noch einen Anpfiff.
»Nicht eingehaltene Termine mit dem Bewährungshelfer«, sagte sie, wobei ihre Worte von schnappenden Atemzügen akzentuiert wurden, denn in der dicken Schutzweste fiel ihr das Luftholen schwer. Sie griff an ihren Gürtel, löste die Handschellen, legte sie Carl an und testete, ob sie richtig fest saßen. »Das war’s, Freundchen.«
3
Ich sehe dich. Aber du siehst mich nicht. Du bist in dein Buch vertieft; ein Taschenbuch mit einer jungen Frau in einem roten Kleid auf dem Cover. Ich kann den Titel nicht lesen, aber das macht nichts; die sind alle gleich. Wenn es kein Junge-trifft-Mädchen ist, ist es Junge-stalkt-Mädchen. Junge-tötet-Mädchen.
Welche Ironie!
Beim nächsten Halt nutze ich den Schwall neu Zusteigender als Vorwand, näher zu dir zu rücken. Du hältst dich an einer Schlaufe in der Mitte des Wagens fest und liest einhändig, blätterst geübt mit dem Daumen um. Wir sind uns so nahe, dass sich unsere Mäntel berühren, und ich kann die Vanille-Basis deines Parfums riechen; dieser Duft wird längst verflogen sein, wenn du von der Arbeit kommst. Manche Frauen verschwinden in der Mittagspause auf dem Klo, wo sie ihr Make-up auffrischen und sich neu Parfum aufsprühen. Du nicht. Wenn ich dich nach der Arbeit sehe, ist die dunkelgraue Schminke auf deinen Lidern zu müden Schatten unter den Augen geronnen; die Farbe auf deinen Lippen hat sich auf unzählige Tassen Kaffee übertragen.
Aber hübsch bist du, sogar nach einem langen Tag. Das will eine Menge heißen. Nicht dass es immer um Schönheit geht; manchmal sind es exotische Züge oder große Brüste oder lange Beine. Manchmal sind es Klasse und Eleganz – maßgeschneiderte dunkelblaue Hosen und hohe hellbraune Schuhe – und manchmal ist es ordinär. Nuttig sogar. Vielfalt ist wichtig. Selbst das beste Essen wird langweilig, wenn man es dauernd isst.
Deine Handtasche ist überdurchschnittlich groß. Normalerweise trägst du sie über der Schulter, aber wenn die Bahn voll ist – wie immer, wenn du unterwegs bist –, stellst du sie auf den Boden zwischen deine Beine. Sie ist ein wenig aufgeklafft, sodass ich hineinsehen kann. Ein Portemonnaie aus weichem braunen Kalbsleder mit einer vergoldeten Schließe. Eine Bürste, in deren Borsten blonde Haare verfangen sind. Eine sorgsam zusammengerollte Einkaufstasche. Ein Paar Lederhandschuhe. Zwei oder drei braune Umschläge, alle aufgerissen und mitsamt Inhalt in die Tasche gestopft: Die Post, die du nach dem Frühstück von der Fußmatte aufgesammelt und auf dem Bahnsteig durchgesehen hast, während du auf deinen ersten Zug wartetest. Ich recke den Kopf ein wenig, damit ich sehen kann, was auf dem obersten Umschlag steht.
Jetzt kenne ich also deinen Namen.
Nicht dass es eine Rolle spielt. Du und ich werden nicht die Art Beziehung haben, bei der Namen nötig sind.
Ich ziehe mein Telefon hervor und wische nach oben, um die Kamera einzuschalten. Dann drehe ich mich zu dir und zoome mit Daumen und Zeigefinger, bis nur noch dein Gesicht im Bild ist. Sollte mich irgendwer bemerken, würde derjenige bloß denken, dass ich eine Aufzeichnung von meiner Fahrt bei Instagram oder Twitter hochlade. Hashtag Selfie.
Ein leises Klicken, und du bist mein.
Als der Zug in eine Kurve geht, lässt du die Halteschlaufe los und bückst dich zu deiner Tasche, immer noch auf dein Buch konzentriert. Wüsste ich es nicht besser, würde ich denken, dass du meinen Blick gesehen hast und deine Sachen außer Sichtweite bringst. Aber das ist es nicht. Die Kurve bedeutet schlicht, dass wir uns deiner Station nähern.
Du genießt dieses Buch. Sonst hörst du schon viel früher auf zu lesen; wenn du ein Kapitelende erreichst, schiebst du die Postkarte zwischen die Seiten, die du als Lesezeichen benutzt. Heute liest du sogar noch, als der Zug in den Bahnhof einfährt. Sogar als du dich zu den Türen durchdrängelst, wobei du ein Dutzend Mal »Verzeihung« und »Entschuldigung«, murmelst. Du liest immer noch, als du zum Ausgang gehst, und blickst nur sehr flüchtig auf, damit du niemanden anrempelst.
Immer noch liest du.
Und immer noch beobachte ich.
4
Crystal Palace ist die Endstation. Andernfalls wäre ich vielleicht auf meinem Platz geblieben und hätte weiter die Anzeige angestarrt in der Hoffnung, ihr einen Sinn abringen zu können. So bin ich die Letzte, die aussteigt.
Der Regen ist zu einem Nieseln abgeflaut, trotzdem bin ich kaum aus dem Bahnhof, da ist die Zeitung durchgeweicht und hinterlässt Spuren von Druckerschwärze an meinen Fingern. Es ist schon dunkel, aber die Straßenlaternen sind eingeschaltet, und die Neonschilder über zig Takeaways und Handy-Läden in der Anerley Road lassen mich alles klar und deutlich sehen. Grellbunte Lichterketten baumeln zwischen den Laternenpfählen, in Vorbereitung für das große Anschalten durch einen Z-Promi am Wochenende. Für mich ist es zu mild – und zu früh –, um schon an Weihnachten zu denken.
Ich starre weiter auf die Anzeige, als ich nach Hause gehe, und nehme den Regen kaum wahr, der mir die Ponyfransen an die Stirn klebt. Vielleicht bin ich das gar nicht. Vielleicht habe ich eine Doppelgängerin. Ich bin wohl kaum die erste Wahl für eine Sex-Hotline: Man sollte meinen, dass sie sich eine Jüngere, Attraktivere aussuchen, keine Frau in mittleren Jahren mit zwei erwachsenen Kindern und einem kleinen Ersatzreifen um die Hüften. Fast muss ich laut lachen. Ich weiß, dass in diesem Markt alles vertreten ist, auch wenn mein Typ Frau eher in einer der Nischen gefragt sein dürfte.
Zwischen dem polnischen Supermarkt und dem Schlüsseldienst ist Melissas Café. Eines von Melissas Cafés, korrigiere ich mich. Das andere ist in einer Seitenstraße von Covent Garden, wo die Stammkunden schlauerweise vorher telefonisch ihre Mittags-Sandwiches bestellen, um nicht anstehen zu müssen, und die Touristen an der Tür zögern und überlegen, ob ein Panini die Wartezeit lohnt. Man sollte meinen, dass ein Café in Covent Garden eine Gelddruckmaschine ist, aber die hohen Mieten dort bedeuten, dass Melissa seit fünf Jahren kämpft, um in die schwarzen Zahlen zu kommen. Dieses Café hier hingegen, mit den schäbigen Wänden und den eher schlichten Leuten in der Gegend, ist eine Goldgrube. Und das seit Jahren, lange bevor Melissa übernahm und ihren Namen über der Tür anbrachte. Es ist einer dieser Geheimtipps, die man manchmal in Stadtführern sieht. Das beste Frühstück in Südlondon, steht in dem fotokopierten Artikel, der an die Tür geklebt ist.
Ich bleibe eine Weile auf der gegenüberliegenden Straßenseite, damit ich hinübersehen kann, ohne bemerkt zu werden. Die Fensterränder sind von innen beschlagen, wie auf einem dieser weichgezeichneten Fotos aus den 1980ern. In der Mitte, hinterm Tresen, wischt ein Mann eine Acrylglasvitrine von innen aus. Er trägt eine halbgefaltete Schürze um die Hüfte gebunden – Pariser Kellnerstil – und mit dem schwarzen T-Shirt und dem dunklen, Gerade-aufgestanden-Look seiner Frisur wirkt er viel zu cool, um in einem Café zu arbeiten. Sieht er gut aus? Ich bin natürlich voreingenommen, aber ich denke, schon.
Nun überquere ich die Straße und achte auf Radfahrer, als mich ein Busfahrer hinüberwinkt. Eine Glocke über der Café-Tür bimmelt, und Justin sieht auf.
»Alles klar, Mum?«
»Hi, Schatz.« Ich blicke mich nach Melissa um. »Bist du allein hier?«
»Sie ist in Covent Garden. Der Manager da ist krank, also musste sie hin, und ich habe hier übernommen.« Sein Tonfall ist lässig, daher versuche ich, genauso zu reagieren, obwohl ich mächtig stolz bin. Ich habe immer gewusst, dass Justin ein guter Junge ist. Er brauchte bloß jemanden, der ihm eine Chance gab. »Wenn du fünf Minuten wartest«, sagt er und spült seinen Lappen in dem Edelstahlwaschbecken aus, »komme ich mit dir nach Hause.«
»Ich wollte unterwegs irgendwas zum Abendessen kaufen. Die Fritteuse ist vermutlich schon aus, oder?«
»Ich habe sie eben erst ausgeschaltet. Es würde nicht lange dauern, ein paar Pommes frites zu machen. Und es sind noch Würste da, die morgen wegmüssten. Melissa macht es nichts aus, wenn wir die mitnehmen.«
»Ich bezahle sie aber«, sage ich, weil ich nicht möchte, dass Justin sich von seiner vorübergehenden Position als Manager allzu sehr hinreißen lässt.
»Ihr macht das wirklich nichts.«
»Ich bezahle«, wiederhole ich entschieden und nehme mein Portemonnaie aus der Tasche. Dann sehe ich auf die Tafel und rechne den Preis für viermal Würstchen und Pommes frites aus. Justin hat recht – Melissa hätte uns das Essen bestimmt gerne gegeben, wenn sie hier gewesen wäre. Aber das ist sie nicht, und in unserer Familie bezahlen wir für das, was wir uns nehmen.
Die Läden und Büros werden weniger, je weiter wir uns vom Bahnhof entfernen. Stattdessen nehmen die Reihenhäuser zu, die jeweils in Zwölfergruppen zusammenstehen. Viele sind mit grauen Metall-Fensterläden verrammelt, was bedeutet, dass sie gepfändet wurden. Rote und orangene Flammen-Graffiti prangen an den Haustüren. Unsere Häuserreihe sieht nicht anders aus. Bei dem Haus drei Türen weiter fehlen Dachziegel, und dicke Sperrholzplatten sind vor die Fenster genagelt. Die vermieteten Häuser erkennt man an den verstopften Regenrinnen und den fleckigen Fassaden. Nur die beiden Häuser am Ende der Reihe sind im Privatbesitz: Melissa und Neil haben das begehrte Endhaus, meines ist gleich daneben.
Justin kramt in seinem Rucksack nach den Schlüsseln, und ich stehe für einen Moment auf dem Gehweg vor dem Zaun. Er begrenzt, was man sehr großzügig unseren Vorgarten nennen könnte. Unkraut linst durch den nassen Kies, und der einzige Schmuck ist eine solarbetriebene Lampe in Form einer altmodischen Laterne, die dumpfes gelbes Licht verströmt. Melissas Garten ist auch mit Kies ausgeschüttet, aber bei ihr ist nirgends Unkraut zu sehen, und zu beiden Seiten ihrer Haustür stehen Buchsbäume in Töpfen, die zu perfekten Spiralen gestutzt sind. Unter dem Erkerfenster sind die Backsteine ein bisschen heller als an der übrigen Fassade. Dort hatte Neil eine Graffiti-Schmiererei von jemandem abgeschrubbt, der immer noch verbohrt genug war, gegen gemischtrassige Ehen zu sein.
In unserem Wohnzimmer hat keiner die Vorhänge zugezogen, sodass ich Katie sehe, die sich am Esstisch die Fingernägel lackiert. Früher habe ich darauf bestanden, dass wir uns zum Essen alle gemeinsam an den Tisch setzen; ich habe es geliebt, mir von den Kindern erzählen zu lassen, wie es in der Schule war. Anfangs, als wir hier neu eingezogen waren, war es die eine Zeit am Tag, in der ich das Gefühl hatte, wir kämen prima ohne Matt zurecht – die kleine, dreiköpfige Familieneinheit, zu einem Mahl um sechs Uhr abends am Tisch versammelt.
Trotz der Schmierschicht am Fenster, die sich in der Nähe einer vielbefahrenen Straße automatisch einstellt, erkenne ich, dass Katie sich Platz für ihr Maniküre-Set freigeräumt hat zwischen den Zeitschriften, dem Stapel Rechnungen und dem Wäschekorb. Letzterer hat sich irgendwie den Esstisch als natürlichen Lebensraum erwählt. Hin und wieder räume ich alles weg, damit wir sonntags mittags zusammen essen können, doch es dauert nie lange, bis uns eine schleichende Flut von Papieren, Wäsche und leeren Einkaufstüten zurück vor den Fernseher mit dem Essen auf dem Schoß verbannt.
Justin öffnet die Tür, und mir fällt ein, wie es war, als die Kinder noch klein waren und angeflitzt kamen, um mich zu begrüßen, als wäre ich Monate fort gewesen statt acht Stunden zum Regalauffüllen bei Tesco. Als sie ein bisschen größer waren, holte ich sie nach der Arbeit im Nachbarhaus ab und bedankte mich bei Melissa, dass sie auf die zwei aufgepasst hatte. Zwar beteuerten die Kinder damals, sie bräuchten niemanden mehr, der sie nach der Schule betreut, aber insgeheim fanden sie es klasse.
»Hallo?«, rufe ich. Simon kommt mit einem Glas Wein aus der Küche. Er reicht es mir, küsst mich auf den Mund und legt einen Arm um meine Taille, um mich dann dicht an sich zu ziehen. Ich gebe ihm die Plastiktüte mit dem Essen aus Melissas Café.
»Nehmt euch ein Zimmer, ihr zwei.« Katie kommt aus dem Wohnzimmer, die Finger gespreizt in die Luft gestreckt. »Was gibt’s heute Abend?« Simon lässt mich los und trägt die Tüte in die Küche.
»Würstchen und Pommes.«
Sie rümpft die Nase, und ich komme ihr zuvor, ehe sie anfangen kann, über Kalorien zu jammern. »Es ist noch Salat im Kühlschrank. Den kannst du dazu essen.«
»Damit wirst du deine fetten Knöchel auch nicht los«, sagt Justin. Katie versetzt ihm einen leichten Schlag, als er an ihr vorbeiläuft und die Treppe hinaufsprintet, zwei Stufen auf einmal nehmend.
»Werdet endlich erwachsen, ihr zwei.« Katie ist neunzehn und winzig. Sie passt locker in Größe 34, und es ist nichts mehr von dem Babyspeck übrig, den sie noch bis vor wenigen Jahren hatte. Mit ihren Knöcheln ist erst recht nichts verkehrt. Ich will sie in die Arme nehmen, doch mir fällt ihr Nagellack ein, also küsse ich sie stattdessen auf die Wange. »Tut mir leid, Schatz, aber ich bin erledigt. Und ab und zu ein bisschen Fast Food wird dir nicht schaden.«
»Wie war dein Tag?«, fragt Simon. Er folgt mir ins Wohnzimmer, wo ich auf das Sofa sinke, einen kurzen Moment die Augen schließe und seufze, als ich mich entspanne.
»Ganz okay, abgesehen davon, dass Graham mich verdonnert hat, die Ablage zu machen.«
»Das ist nicht dein Job«, sagt Katie.
»Genauso wenig wie das Klo putzen, und rate mal, was ich gestern machen musste.«
»Uärgs. Der Typ ist so ein Arschloch.«
»Du darfst dir das nicht gefallen lassen.« Simon setzt sich neben mich. »Du musst dich beschweren.«
»Bei wem? Ihm gehört der Laden.« Graham Hallow gehört zu jener Sorte Männer, die ihr Ego aufblähen, indem sie die Leute um sich herum kleinmachen. Ich weiß das, und deshalb stört es mich nicht. Meistens jedenfalls nicht.
Um das Thema zu wechseln, nehme ich die London Gazette vom Couchtisch, wo ich sie vorhin fallen gelassen habe. Sie ist noch feucht, aber ich falte sie so, dass die Anzeigen und die Werbung für Escortservices oben sind.
»Mum! Wieso siehst du dir denn die Escort-Anzeigen an?«, fragt Katie lachend. Sie hat die zweite Nagellackschicht aufgetragen und schraubt vorsichtig das Fläschchen zu, ehe sie an den Tisch zurückgeht, um die Hände unter eine Ultraviolett-Lampe zu halten, damit der Lack fest wird.
»Vielleicht überlegt sie, Simon gegen ein jüngeres Modell auszutauschen«, sagt Justin, der ins Wohnzimmer kommt. Er hat das schwarze T-Shirt und die Jeans ausgezogen, die er zur Arbeit trägt, und stattdessen eine graue Jogginghose und ein Sweatshirt an. In einer Hand hat er sein Telefon, in der anderen einen gehäuft vollen Teller mit Wurst und Pommes frites.
»Das ist nicht witzig«, sagt Simon und nimmt mir die Zeitung ab. »Aber im Ernst, warum siehst du dir die Anzeigen an?« Er runzelt die Stirn, und ich sehe, wie ein Schatten über sein Gesicht huscht. Ich werfe Justin einen verärgerten Blick zu. Simon ist vierzehn Jahre älter als ich, auch wenn ich manchmal vor dem Spiegel denke, dass ich ihn allmählich einhole. Da sind Falten um meine Augen, die ich in den Dreißigern noch nicht hatte, und die Haut an meinem Hals wird faltig. Ich habe kein Problem mit dem Altersunterschied zwischen uns, doch Simon erwähnt ihn häufiger, daher weiß ich, dass er ihm sehr wohl zu schaffen macht. Justin weiß es ebenfalls und nutzt jede Gelegenheit, Salz in die Wunde zu streuen. Ob diese Angriffe allerdings auf Simon oder mich abzielen, kann ich nicht genau sagen.
»Findet ihr nicht, dass die aussieht wie ich?« Ich zeige auf die Anzeige unten, direkt unter Angels »reifem« Service. Justin beugt sich über Simons Schulter, und Katie zieht die Hände unter der Lampe vor, um einen besseren Blickwinkel zu bekommen. Eine Sekunde lang starren wir alle stumm auf die Anzeige.
»Nein«, sagte Justin im selben Moment, in dem Katie sagt: »Ein bisschen.«
»Du hast eine Brille, Mum.«
»Die trage ich nicht immer«, entgegne ich. »Manchmal habe ich Kontaktlinsen drin.« Obwohl ich mich nicht erinnere, wann ich die zum letzten Mal benutzt habe. Mich stört es nicht, eine Brille zu brauchen, und die jetzige mag ich. Das dicke schwarze Gestell lässt mich sehr viel intellektueller aussehen, als ich bin.
»Vielleicht erlaubt sich jemand einen Scherz«, sagt Simon. »›www.findtheone.com‹ – könnte dich jemand aus Spaß bei einer Dating-Agentur angemeldet haben?«
»Wer würde das machen?« Ich sehe zu den Kindern, ob sie eventuell einen Blick wechseln, aber Katie wirkt so verwirrt wie ich, und Justin isst seine Pommes.
»Hast du die Nummer angerufen?«, fragt Simon.
»Für ein Pfund fünfzig die Minute? Du machst wohl Witze.«
»Oder bist du es doch?«, fragt Katie. Ihre Augen blitzen. »Du weißt schon, ein bisschen Taschengeld nebenbei verdienen? Na los, Mum, uns kannst du es doch verraten.«
Das mulmige Gefühl, das ich seit der Entdeckung der Anzeige habe, ebbt langsam ab, und ich lache. »Ich wüsste nicht, wer ein Pfund fünfzig die Minute für mich bezahlen würde, Schatz. Aber die sieht wie ich aus, oder? Ich habe mich ganz schön erschrocken.«
Simon zieht sein Handy aus der Tasche und zuckt mit den Schultern. »Es wird jemand sein, der sich eine Geburtstagsüberraschung für dich ausgedacht hat, jede Wette.« Er stellt das Telefon auf Lautsprecher und tippt die Nummer ein. Es kommt mir lächerlich vor, wie wir alle um die London Gazette versammelt sind und eine Sex-Hotline anrufen.
»Die Nummer, die Sie gewählt haben, ist nicht bekannt.«
Mir wird bewusst, dass ich den Atem angehalten habe.
»Na, das war es dann«, sagt Simon und gibt mir die Zeitung.«
»Aber was macht mein Foto da?«, frage ich. Mein Geburtstag ist noch lange hin, und mir fällt niemand ein, der es witzig fände, mich bei so einem Dating-Dienst anzumelden. Ich überlege, ob es jemand ist, der Simon nicht mag und für Probleme zwischen uns sorgen will? Matt? Den Gedanken verwerfe ich sofort wieder.
Unwillkürlich drücke ich Simons Schulter, obgleich ihn die Anzeige gar nicht zu verstören scheint.
»Mum, die sieht überhaupt nicht wie du aus. Das ist irgendeine alte Kuh mit ausgewachsener Blondierung«, sagt Justin.
In diesem Satz ist ein Kompliment versteckt, denke ich.
»Jus hat recht, Mum.« Katie sieht wieder zur Anzeige. »Sie sieht dir ähnlich, aber viele Leute ähneln anderen. Bei der Arbeit ist ein Mädchen, das haargenau aussieht wie Adele.«
»Ja, kann sein.« Ich sehe ein letztes Mal die Anzeige an. Die Frau auf dem Foto blickt nicht direkt in die Kamera, und die Auflösung ist so schlecht, dass mich wundert, wie sie für eine Anzeige ausgesucht werden konnte. Dann gebe ich Katie die Zeitung. »Pack die bitte zum Altpapier, Schatz, und hol uns was zu essen.«
»Meine Nägel!«, ruft sie.
»Meine Füße«, erwidere ich.
»Ich mach schon«, sagt Justin. Er stellt seinen Teller auf den Couchtisch und steht auf. Simon und ich wechseln einen verwunderten Blick, und Justin verdreht die Augen. »Was? Ihr tut ja so, als würde ich hier nie helfen.«
Simon stößt ein kurzes Lachen aus. »Und was willst du uns damit sagen?«
»Ach, leck mich, Simon. Dann hol dir doch selbst dein Essen.«
»Hört auf, alle beide«, gehe ich dazwischen. »Gott, manchmal weiß man nicht, wer hier das Kind ist.«
»Das meine ich ja. Er ist nicht …«, beginnt Justin, verstummt jedoch, als er meinen Gesichtsausdruck sieht. Wir essen vor dem Fernseher, zanken uns um die Fernbedienung, und ich blicke zu Simon. Er zwinkert mir zu: ein privater Moment inmitten des chaotischen Lebens mit zwei erwachsenen Kindern.
Als die Teller bis auf einen Fettfilm leer sind, zieht Katie ihre Jacke an.
»Willst du jetzt noch weg?«, frage ich. »Es ist schon nach neun.«
Sie wirft mir einen vernichtenden Blick zu. »Es ist Freitagabend, Mum.«
»Wo willst du hin?«
»In die Stadt.« Sie bemerkt meine Miene. »Ich teile mir mit Sophia ein Taxi. Das ist nicht anders, als würde ich von einer Spätschicht nach Hause kommen.«
Ich will erwidern, dass es sehr wohl anders ist. Dass der schwarze Rock und das weiße Top, die Katie zum Kellnern trägt, weit weniger gewagt sind als das hautenge Kleid, das sie jetzt anhat. Dass sie mit ihrem Pferdeschwanz frisch und unschuldig wirkt, mit diesem Look jetzt hingegen zerzaust und sexy. Ich möchte ihr sagen, dass sie zu sehr geschminkt ist, dass ihre Absätze zu hoch und ihre Fingernägel zu rot sind.
Natürlich sage ich das alles nicht. Schließlich war ich auch mal neunzehn, und ich bin schon lange genug Mutter, um zu wissen, wann ich meine Gedanken für mich behalte.
»Viel Spaß.« Aber so ganz kann ich es doch nicht lassen. »Sei vorsichtig. Bleibt zusammen, und halte immer die Hand über deinen Drink.«
Katie küsst mich auf die Stirn und dreht sich zu Simon. »Rede mal mit ihr, ja?«, sagt sie und nickt in meine Richtung. Aber sie grinst und zwinkert mir zu, ehe sie zur Tür hinaus, tänzelt. »Seid ja artig, ihr zwei«, ruft sie. »Und falls ihr nicht artig sein könnt, seid vorsichtig!«
»Ich kann nicht anders«, sage ich, als sie weg ist. »Ich mache mir Sorgen um sie.«
»Weiß ich, aber sie ist vernünftig.« Simon drückt mein Knie. »Sie kommt nach der Mutter.« Er sieht zu Justin, der ausgestreckt auf dem Sofa liegt und sein Telefon dicht vors Gesicht hält. »Willst du nicht mehr weg?«
»Pleite«, antwortet Justin, ohne den Blick von dem winzigen Bildschirm zu nehmen. Ich erkenne die blauen und weißen Kästchen eines Chats, doch die Schrift ist viel zu klein, als dass ich sie auf die Entfernung entziffern könnte. Ein Streifen rote Boxershorts trennt Justins Jogginghose von dem Sweatshirt, dessen Kapuze er aufgesetzt hat, obwohl er drinnen ist.
»Bezahlt Melissa dich nicht immer freitags?«
»Sie hat gesagt, dass sie mir das Geld am Wochenende vorbeibringt.«
Als Justin im Frühsommer im Café anfing, hatte ich schon fast die Hoffnung aufgegeben, dass er jemals einen neuen Job finden würde. Er hatte ein paar Vorstellungsgespräche – eines in einem Plattenladen, das andere bei Boots – aber in dem Moment, in dem sie von dem aktenkundigen Ladendiebstahl erfuhren, war es das.
»Kann man verstehen«, war damals Simons Kommentar. »Kein Arbeitgeber will riskieren, jemanden einzustellen, der in die Kasse langen könnte.«
»Da war er vierzehn!«, verteidigte ich ihn sofort. »Außerdem musste er eine Menge durchmachen: Erst die Scheidung, dann der Schulwechsel. Er ist ja wohl kaum ein Krimineller!«
»Trotzdem.«
Ich ließ es gut sein, denn ich wollte mich nicht mit Simon streiten. Auf dem Papier war Justin nicht einstellbar, aber wenn man ihn kannte … Also ging ich zu Melissa. »Lieferungen«, schlug ich vor. »Prospekte verteilen. Irgendwas.«
Justin war nie der lernbegierige Typ. Er las nicht so gerne wie die anderen Kinder in der Grundschule. Bis er acht war, beherrschte er nicht mal das Abc. Mit den Jahren wurde es zunehmend schwieriger, ihn überhaupt in die Schule zu bekommen; die Unterführung und das Einkaufszentrum reizten ihn mehr als das Klassenzimmer. Er schloss die Schule mit einem GCSE in Informatik und einer Verwarnung wegen Ladendiebstahls ab. Bis dahin hatten die Lehrer begriffen, dass er Legastheniker war, aber da war es natürlich zu spät, noch etwas zu tun.
Bei dem Gespräch damals sah Melissa mich nachdenklich an, und ich fragte mich, ob ich unsere Freundschaft vielleicht gerade überstrapazierte.
»Er kann im Café arbeiten.«
Mir fehlten die Worte. »Danke« kam mir völlig unangemessen vor.
»Mindestlohn«, sagte Melissa sachlich, »und erst mal eine Probezeit. Montags bis freitags, abwechselnd Früh- und Spätschicht. Ab und zu auch an den Wochenenden.«
»Du hast einiges gut bei mir.«
Sie winkte ab. »Wozu sind Freunde da?«
»Vielleicht könntest du anfangen, deiner Mutter Miete zu zahlen, wo du jetzt einen Job hast«, sagt Simon. Ich sehe ihn streng an. Eigentlich mischt Simon sich nie in die Erziehung ein. Das war von Anfang an klar, und wir mussten gar nicht darüber reden. Die Kinder waren achtzehn und vierzehn, als ich Simon kennenlernte, also fast erwachsen, auch wenn sie sich nicht so benahmen. Sie brauchten keinen neuen Dad, und zum Glück versuchte Simon auch nie, einer zu sein.
»Katie fragst du nicht nach Miete.«
»Sie ist jünger als du. Du bist zweiundzwanzig, Justin, alt genug, um auf eigenen Beinen zu stehen.«
Justin schwingt die Beine zur Seite und steht auf, was sehr geschmeidig aussieht. »Du hast vielleicht mal Nerven! Wie wäre es, wenn du anfängst, Miete zu bezahlen, bevor du mir erzählst, was ich machen soll?«
Ich hasse das. Zwei Menschen, die ich liebe, gehen sich gegenseitig an die Gurgel.
»Justin, rede nicht so mit Simon.« Dass ich Partei ergreife, geschieht nicht bewusst, doch sobald ich es ausspreche, sehe ich Justins Blick. Als hätte ich ihn verraten. »Er schlägt es nur vor. Und ich will keine Miete von dir.« Würde ich nie, und mir ist egal, ob mich andere deshalb für zu weich halten. Ich bleibe dabei. Sicher könnte ich Justin einen winzigen Betrag für Kost und Logis abknöpfen, und er hätte immer noch so gut wie nichts. Wie soll er denn da leben, geschweige denn etwas für später zurücklegen? Ich war jünger als Katie, als ich nur mit einem Koffer voller Kleidung und einem wachsenden Bauch von zu Hause wegging, während mir die Vorwürfe meiner Eltern noch in den Ohren klingelten. Für meine Kinder wünsche ich mir etwas anderes.
Simon gibt keine Ruhe. »Suchst du eigentlich nach Arbeit? Das Café ist ja gut und schön, aber wenn du dir ein Auto kaufen willst, eine eigene Wohnung mieten, brauchst du mehr als das, was Melissa dir bezahlen kann.«
Ich verstehe nicht, was in ihn gefahren ist. Wir sind nicht reich, klar, aber es geht uns doch ganz gut. Wir müssen den Kindern kein Geld abnehmen.
»Dad hat gesagt, dass er mir Geld für einen Wagen leiht, wenn ich die Führerscheinprüfung bestanden habe.«
Ich fühle, wie sich Simon neben mir verkrampft. Das tut er jedes Mal, wenn Matt erwähnt wird. In manchen Momenten ist diese Reaktion ärgerlich, aber meistens wird mir davon wohlig warm. Ich glaube nicht, dass Matt jemals der Gedanke kam, jemand anders könnte mich attraktiv finden. Und mir gefällt, dass Simon mich genug mag, um eifersüchtig zu sein.
»Das ist nett von deinem Dad«, sage ich hastig. Meine Loyalität gegenüber Justin bewegt mich, etwas zu sagen – irgendwas –, um ihm beizustehen. »Vielleicht solltest du dir mal überlegen, später noch einen Taxischein zu machen.«
»Ich fahre doch nicht den Rest meines Lebens in einem Taxi rum, Mum.«
Justin und ich waren uns so nahe, als er noch jünger war; aber er hat mir nie richtig vergeben, dass ich Matt verließ. Ich denke, das wäre anders, wenn er die ganze Geschichte kennen würde, doch ich will nicht, dass die Kinder schlecht von ihrem Dad denken. Sie sollen nicht so verletzt werden wie ich.
Die Frau, mit der Matt geschlafen hatte, lag altersmäßig exakt zwischen Katie und mir. Komisch, auf was für Details ich fixiert bin. Ich habe sie nie gesehen, was mich früher aber nicht von quälenden Gedanken abhielt, wie sie wohl aussah. Ich stellte mir die Hände meines Mannes auf ihrem dreiundzwanzigjährigen, dehnungsstreifenfreien Körper vor.
»Tja, man kann sich eben nicht alles immer aussuchen«, sagt Simon. »Und das ist ein guter Job.«
Ich sehe ihn verwundert an. Sonst ist er immer schnell bei der Hand, wenn es darum geht, Matts mangelnden Ehrgeiz zu kritisieren. Teils bin ich genervt, weil ich mich genau erinnere, dass er Taxifahren mal als »Sackgasse« bezeichnet hat. Matt war am College und hat Bautechnik studiert. Das änderte sich schlagartig, als meine Regel so lange ausblieb, dass es nur eines bedeuten konnte. Noch am selben Tag gab Matt das Studium auf und suchte sich einen Job. Es war reine Knochenarbeit auf dem Bau, aber sie wurde nicht schlecht bezahlt. Nach der Heirat machte er seinen Taxischein, und seine Eltern gaben uns als verspätetes Hochzeitsgeschenk Geld für sein erstes Taxi.
»Das Café ist doch erst mal gut«, sage ich. »Und das Richtige wird sich schon noch finden. Da bin ich sicher.«
Justin gibt ein undefinierbares Schnauben von sich und verlässt das Zimmer. Er geht nach oben, und ich höre sein Bett knarzen, also nimmt er seine übliche Position ein: bäuchlings und den Kopf aufgestützt, damit er den Monitor seines Laptops sehen kann.
»Wenn das so weitergeht, wohnt er mit dreißig noch hier.«
»Ich will doch nur, dass er glücklich ist.«
»Er ist glücklich«, sagt Simon. »Und das auf deine Kosten.«
Ich verkneife mir die Erwiderung, die mir auf der Zunge liegt, denn sie wäre unfair. Immerhin habe ich gesagt, dass ich keine Miete von Simon will. Wir haben uns deshalb sogar gestritten, aber ich weigere mich, Miete von ihm anzunehmen. Wir teilen uns die Kosten fürs Essen sowie die Nebenkosten, und er lädt mich dauernd zum Essen oder auf Reisen ein – die Kinder auch. Er ist total großzügig. Wir haben ein gemeinsames Konto und uns noch nie Gedanken darüber gemacht, wer was bezahlt.
Aber das Haus gehört mir.
Als ich Matt heiratete, war das Geld richtig knapp. Er arbeitete nachts, ich saß von acht bis vier an der Kasse bei Tesco. So schafften wir es, bis Justin eingeschult wurde. Als Katie kam, war es leichter. Matt hatte mehr Arbeit, als er bewältigen konnte, und nach und nach konnten wir uns einige Extras leisten – mal essen gehen; sogar einen Sommerurlaub.
Dann trennten wir uns, und ich musste wieder von vorne beginnen. Keiner von uns konnte sich leisten, das Haus allein zu halten, und es dauerte Jahre, bis ich genug für die Anzahlung auf dieses Haus zusammenhatte. Deshalb schwor ich mir, mich nie wieder von einem Mann abhängig zu machen.
Wohlgemerkt: Ich schwor mir auch, mich nie wieder zu verlieben, und das ist jetzt das Ergebnis.
Simon küsst mich, eine Hand an meinem Kinn, dann in meinem Nacken. Selbst jetzt, nach einem sehr langen Tag, riecht er sauber, nach Rasierschaum und Aftershave. Ich fühle, wie mich die vertraute Hitze durchfährt, als er mein Haar um seine Hand wickelt und sanft daran zieht, sodass ich den Kopf hebe und er meinen Hals küssen kann. »Wollen wir früher schlafen gehen?«, flüstert er.
»Ich bin gleich oben.«
Ich staple die Teller zusammen, bringe sie in die Küche und lade sie in den Geschirrspüler. Aus dem Altpapierbehälter starrt mich die Frau in der Anzeige an. Ich schalte das Licht in der Küche aus und schüttle den Kopf, um den blöden Gedanken loszuwerden. Natürlich bin ich das nicht. Was hätte denn ein Foto von mir in einer Zeitung zu suchen?
5
Kelly zog das Gummiband vom Handgelenk und versuchte, ihr dunkles Haar zu einem Pferdeschwanz zu binden. Inzwischen bereute sie den spontanen Friseurbesuch im August, als sie nach zwei Wochen Hitze entschieden hatte, dass hüftlanges Haar einfach zu umständlich war. Jetzt ließen sich die gekürzten Strähnen kaum noch zusammenbinden. Prompt fielen zwei davon wieder nach vorne. Letztlich hatte es zwei Stunden gedauert, Carl Bayliss einzuliefern, nachdem festgestellt wurde, dass er im Zusammenhang mit ein paar Diebstählen sowie Verstoß gegen die Bewährungsauflagen gesucht wurde. Kelly gähnte. Ihren Hungerpunkt hatte sie so gut wie überwunden, trotzdem ging sie in die Küche und blickte sich hoffnungsvoll um – für alle Fälle. Nichts. Sie hätte doch unterwegs einen Kebab kaufen sollen. Nun machte sie sich etwas Toast und nahm ihn mit in ihr Zimmer im Erdgeschoss. Es war ein großer quadratischer Raum mit einer hohen Decke. Von der Bildleiste aufwärts waren die Wände weiß gestrichen, darunter hatte sich Kelly für einen hellen Grauton entschieden. Außerdem hatte sie den Teppichboden, der seine besten Zeiten hinter sich hatte, mit zwei großen Läufern bedeckt, die sie bei einer Auktion erstanden hatte. Der Rest des Zimmers – das Bett, der Schreibtisch sowie der rote Sessel, in dem sie nun saß – war ausnahmslos von Ikea. Die modernen Konturen standen im Kontrast zu dem geschwungenen Erkerfenster, unter dem sich das Bett befand.
Sie blätterte durch die Metro, die sie auf dem Rückweg mitgenommen hatte. Viele ihrer Kollegen sahen nie in die Lokalzeitungen – schlimm genug, dass wir den Abschaum bei der Arbeit sehen müssen; da will ich den nicht noch mit mir nach Hause tragen –, aber sie war in puncto Nachrichten unersättlich. Auf ihrem iPhone gingen immerzu die neuesten Meldungen ein, und wenn sie ihre Eltern besuchte, die nach der Pensionierung von London nach Kent gezogen waren, stürzte sie sich auf das Dorfblatt, um über Komitees zu lesen, die noch Mitglieder suchten, oder die Beschwerden über Müll und Hundekot auf den Straßen zu studieren.
Nun fand sie auf Seite fünf, wonach sie suchte. Gleich eine Doppelseite war fett mit »U-Bahn-Kriminalität nimmt zu« überschrieben: Stadtverwaltung beauftragt eine Untersuchung zu Straftaten im öffentlichen Personennahverkehr, nachdem vermehrt sexuelle Belästigungen, brutale Angriffe und Diebstähle angezeigt wurden.
Der Artikel eröffnete mit einem Absatz, der entsetzliche Kriminalstatistiken zitierte – die allein können einen schon davon abhalten, je wieder U-Bahn zu fahren, dachte Kelly –, bevor es mit einer Reihe von Fallschilderungen weiterging, um die häufigsten Straftaten in Londons Verkehrsnetz zu illustrieren. Kelly sah zu dem Abschnitt über brutale Angriffe, wo das Foto eines jungen Mannes abgedruckt war, der ein unmissverständliches Muster seitlich ins Haar rasiert trug. Das rechte Auge des Teenagers war so heftig zugeschwollen, dass er entstellt aussah.
Der Angriff auf Kyle Matthews war brutal und geschah vollkommen grundlos, lautete die Bildunterschrift. Das sollte man lieber nicht blind glauben, fand Kelly. Sicher, sie kannte Kyle nicht, sehr wohl aber das Symbol an seinem Kopf, und »vollkommen grundlos« war gemeinhin nicht die Formulierung, die einem bei Trägern solch eines Zeichens in den Sinn kam. Dennoch sollte sie ihn nicht vorverurteilen.
Das Foto in dem Abschnitt zum Thema »sexuelle Übergriffe« war schattig, sodass man gerade noch das Profil einer Frau ausmachen konnte. »Archivbild« stand unter dem Foto. »Name geändert.«
Unwillkürlich erschien ein anderer Zeitungsartikel vor Kellys geistigem Auge: eine andere Stadt, eine andere Frau, die gleiche Schlagzeile.
Sie schluckte, wandte sich der letzten Fallstudie zu und grinste über die Grimasse der Frau auf dem Foto.
»Sie verlangen doch wohl nicht, dass ich ein Daily-Mail-Gesicht mache, oder?«, hatte Cathy Tanning den Fotografen gefragt.
»Selbstverständlich nicht«, hatte er munter geantwortet. »Ich will, dass Sie ein trauriges Metro-Gesicht ziehen, mit einem Anflug von Wut. Nehmen Sie die Handtasche auf den Schoß und versuchen Sie sich vorzustellen, dass Sie nach Hause kommen und Ihren Mann im Bett mit der Fensterputzerin erwischen.«
Der Pressesprecher der British Transport Police war verhindert gewesen, weshalb Kelly sich bereit erklärte, bei Cathys Interview dabei zu sein, was Cathy sofort annahm.
»Sie waren super«, sagte sie zu Kelly, »und das ist das Mindeste, was ich tun kann.«
»Sparen Sie sich das Lob auf, bis wir den Kerl gefunden haben, der Ihre Schlüssel geklaut hat«, hatte Kelly erwidert, auch wenn sie wusste, dass die Chancen sehr schlecht standen. Sie war am Ende einer einmonatigen Versetzung zur Diebstahlseinheit, der Dip Squad, als der Auftrag kam, und sie hatte Cathy Tanning auf Anhieb gemocht.
»Es ist meine Schuld«, hatte die Frau gesagt, sobald Kelly sich vorgestellt hatte. »Ich arbeite so lange, und die Fahrt nach Hause dauert so ewig, da nicke ich schon mal ein. Aber ich hätte nie gedacht, dass jemand das so fies ausnutzt.«
Kelly fand, dass Cathy Tanning noch Glück gehabt hatte. Der Dieb hatte ihre Handtasche durchwühlt, während Cathy tief und fest schlafend an der Wand lehnte, konnte ihr Portemonnaie in der seitlichen Reißverschlusstasche jedoch nicht finden, ebenso wenig wie ihr Handy, das in einer anderen Seitentasche steckte. Stattdessen hatte er ihre Schlüssel geklaut.
»Es ist nicht Ihre Schuld«, hatte Kelly ihr versichert. »Es ist Ihr gutes Recht, auf der Fahrt nach Hause kurz einzunicken.« Kelly hatte die Anzeige ausgefüllt und sich die Aufzeichnungen der Sicherheitskameras vorgenommen. Als sie später den Anruf von der Pressestelle bekam, schien Cathy die offensichtliche Wahl für einen Beitrag über U-Bahn-Kriminalität. Kelly sah nach, ob sie in dem Artikel erwähnt wurde, und tatsächlich hatte man sie zitiert, sie allerdings als DC statt als PC angegeben – was einigen Leuten bei der Arbeit vermutlich sauer aufstieß.
»Cathy ist nur eine von Hunderten Pendlern und Touristen, die jedes Jahr Opfer von Taschendieben werden. Wir möchten die Fahrgäste bitten, besonders aufmerksam zu sein und Verdächtiges unverzüglich bei einem Beamten der British Transport Police zu melden.«
Sorgfältig schnitt Kelly den Artikel für Cathy aus und schickte ihr eine SMS, um sich nochmals für ihre Hilfe zu bedanken. Ihr Arbeitstelefon war in ihrem Schließfach auf dem Revier, doch sie hatte Cathy ihre Privatnummer für eventuelle Notfälle gegeben.
Kelly war noch halb in Berufskleidung – dunkelblauer Fleecepulli über einer weißen Bluse, aber ohne Krawatte und Schulterklappen. Nun bückte sie sich, um ihre Stiefel aufzuschnüren. Einige ihrer alten Schulfreunde trafen sich heute Abend und hatten gefragt, ob sie auch kommen wollte. Aber sie musste morgen um fünf raus, und an einem Freitagabend nüchtern durch die Pubs zu ziehen machte keinen Spaß. Toast, Netflix, Tee und Bett, dachte sie. Wenn das nicht fetzte.
Ihr Telefon klingelte, und ihre Stimmung hellte sich auf, als sie den Namen ihrer Schwester auf dem Display las.
»Hey, wie geht es dir? Wir haben ja ewig nichts voneinander gehört!«
»Tut mir leid. Du weißt ja, wie es ist. Hör mal, ich habe das ideale Weihnachtsgeschenk für Mum gefunden, aber das kostet ein bisschen mehr, als wir sonst ausgeben. Willst du dich beteiligen?«
»Sicher. Was ist es?« Kelly streifte erst einen, dann den anderen Stiefel ab und hörte nur halb hin, als ihre Zwillingsschwester ihr die Vase beschrieb, die sie auf einem Kunsthandwerkmarkt entdeckt hatte. Es war erst Mitte November, also noch Wochen hin bis Weihnachten. Kelly vermutete, dass sie das Shopping-Gen nicht geerbt hatte, denn sie schob die Weihnachtseinkäufe immer bis zur letzten Minute auf und genoss insgeheim die fiebrige Hektik, die an Heiligabend im Einkaufszentrum herrschte, wenn abgehetzte Männer in Panik überteuerte Düfte und Dessous kauften.
»Wie geht es den Jungs?«, unterbrach sie, als offensichtlich wurde, dass Lexi im Begriff stand, auch gleich Geschenke für den Rest der Familie vorzuschlagen.
»Denen geht es prima. Na ja, sie sind schon mal anstrengend, klar, aber super. Alfie kommt bestens in der Schule zurecht, und Fergus scheint sich in der Kindertagesstätte sauwohl zu fühlen, so wie seine Klamotten nachmittags immer aussehen.«
Kelly lachte. »Sie fehlen mir.« Lexi und ihr Mann Stuart lebten in St. Albans, und doch sah Kelly sie nicht annähernd so oft, wie sie gerne würde.
»Dann komm vorbei!«
»Mach ich, versprochen, sobald ich freihabe. Ich sehe auf dem Dienstplan nach und schicke dir die Daten. Vielleicht irgendwann an einem Sonntagmittag?« Lexis Zeitmanagement war legendär. »Ich glaube, ich habe Anfang Dezember einige Tage hintereinander frei, falls es euch nichts ausmacht, dass ich auf eurem Sofa schlafe.«
»Klasse! Die Jungs freuen sich riesig, wenn du über Nacht bleibst. Allerdings geht es am dritten nicht – da muss ich zu einem Jahrgangstreffen.«
Das kaum merkliche Zögern und Lexis betont lässiger Tonfall verrieten Kelly, um was für ein Treffen es sich genau handelte und wo es stattfinden würde.
»Ein Jahrgangstreffen in Durham?«
Am anderen Ende war es still, und Kelly stellte sich vor, wie ihre Schwester nickte und ein wenig das Kinn vorschob, wie sie es immer tat, wenn sie mit einer Diskussion rechnete.
»Erstsemester 2005«, sagte Lexi heiter. »Ich bezweifle zwar, dass ich auch nur die Hälfte wiedererkenne, aber ich habe immer noch Kontakt zu Abbie und Dan, und ich treffe mich ab und zu mit Moshy. Man fasst es nicht, dass das schon zehn Jahre her ist! Mir kommt es vor wie zehn Minuten. Obwohl …«
»Lexi!«
Ihre Schwester verstummte, und Kelly versuchte, die richtigen Worte zu finden.