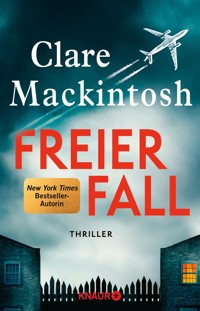12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: mvg Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Mit Verlust geht ein Mensch auf ganz eigene Weise um. Denn Trauer ist für jeden von uns so einzigartig wie die Person, die wir verloren haben. Sie kann überwältigend, anstrengend, einsam, unvernünftig, scheinbar endlos sein und uns treffen, wenn wir es am wenigsten erwarten. Bestsellerautorin Clare Mackintosh musste den Tod ihres kleinen Sohns verkraften und kann uns durch ihre Erfahrungen mit Trauer versichern: "Es wird nicht immer so wehtun!". In 18 kurzen, mitfühlenden Ratschlägen, die aus Clares ganz persönlichen Erlebnissen stammen, begleitet sie Trauernde. Auf jeder Seite des Buches entfalten sich neue Geschichten von Hoffnung, Resilienz und Kraft, die von Dunkelheit erzählen und Licht schenken. Ein Buch, das Clare damals gebraucht hätte – und vielen von uns in der Zukunft helfen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buchvorderseite
Für alle, die jemals geliebt und verloren haben.
Und für Alex.
Titelseite
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Für Fragen und [email protected]
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
1. Auflage 2025
© 2025 by mvg Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Die englische Originalausgabe erschien 2024 bei Sphere, ein Imprint von Little, Brown Book Group Limited, eine Hachette UK Company, unter dem Titel I Promise It Won't Always Hurt Like This: 18 Assurances on Grief. Copyright © Clare Mackintosh 2024. All rights reserved. The right of Clare Mackintosh to be identified as the Author of the Work has been asserted by her in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Übersetzung: Simone Fischer
Redaktion: Susanne von Ahn
Umschlaggestaltung: Maria Verdorfer
Umschlagabbildung: AdobeStock/TWINS DESIGN STUDIO/VPcreativeshop/Enso
Satz: feschart print- und webdesign, Michaela Röhler, Leopoldshöhe
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-7474-0703-5
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-98922-122-2
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.mvg-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Einleitung
Ich bin Ende vierzig. Ich habe Großeltern, Freunde, einen Vater und ein Kind verloren. Trauer durchzieht mein Leben wie ein roter Faden – manchmal ist sie hauchdünn und kaum wahrnehmbar, manchmal stopft sie die Risse mit dicken, unförmigen Flicken. In meiner Trauer bin ich Mutter, Kind, Schwester, Ehefrau, Frau und Freundin.
Ich bin auch eine Schriftstellerin. In allem, was ich geschrieben habe, habe ich Trauer berührt, weil Trauer jeden Teil von mir berührt hat. Ich schreibe, um der Welt und meinem Platz darin einen Sinn zu geben, und ich schreibe, um Menschen zu finden, denen es genauso geht wie mir. Ich schreibe in der Hoffnung, dass meine Worte bei anderen Anklang finden; dass sie eine Zeile immer und immer wieder lesen und sagen: Genau. Genau so fühle ich mich.
Meine Romane kreisen um das Thema Verlust, aber ich habe nie explizit über Trauer geschrieben. Darüber, wie sie sich anfühlt, wie sie sich äußert, wie schrecklich sie ist. Über ihre sich verändernde Natur, ihre Abläufe und ihr Abklingen.
Ich habe nie über meine Trauer geschrieben.
Es fühlte sich immer zu groß an, um es ohne den schützenden Filter der Fiktion anzugehen, und zu gefährlich – wie direkt in die Sonne zu sehen. Was, wenn sie mich blendet? Was, wenn ich, sobald ich sie einmal im Blick habe, nicht mehr wegsehen kann? Lange Zeit habe ich meine Trauer bewältigt, indem ich sie abgespalten habe. Diese Technik habe ich mir in meinen Jahren als Polizistin angeeignet, als es für alle Beteiligten schädlich gewesen wäre, das emotionale Gepäck von einem Job zum nächsten mitzunehmen. Ich packte meine Gefühle fein säuberlich in kleine Bündel und sperrte sie weg, bis ich den Raum und die Kraft hatte, sie auszupacken.
Ich habe sie jedoch nie vollständig ausgepackt.
Manche Momente – manche Gefühle – sind so belastend und so schwer, dass sie in ihren Kisten bleiben, wie die Nostalgie, die wir bei einem Umzug von einem Zuhause ins nächste mitnehmen und die unsere Dachböden, Garagen und Abstellräume füllt. Relikte einer anderen Zeit. Ballast, den wir nicht mehr brauchen. Wir haben diese Dinge seit Jahren nicht mehr angerührt, können uns aber nicht ganz davon trennen. Denn sie sind ein Teil von uns.
Wenn ich über meine Trauer schreiben würde, dachte ich, müsste ich die Kisten auspacken. Ich müsste meine Gefühle herausnehmen und sie eins nach dem anderen untersuchen. Es könnte mich kaputtmachen. Es würde mich kaputtmachen. Und so habe ich das Thema weiterhin nur hauchzart gestreift, nämlich durch meine Romanfiguren. Wie ein Kind, das jemanden, der größer und mutiger ist, vor sich schiebt.
Und nun stehen wir hier: am Anfang eines Buches, in dem es überwiegend um Trauer geht. Du und ich, wir sehen in die Sonne.
Letztendlich war der Auslöser für das Schreiben nicht die Trauer selbst, sondern genau das Gegenteil: die Abwesenheit der Trauer. Vor vier Jahren, am Nachmittag des vierzehnten Todestages meines Sohnes, wurde mir plötzlich bewusst, welcher Tag es war. Natürlich hatte ich das Datum im Kopf, aber seine Bedeutung war in die hintersten Winkel meines Gedächtnisses gerutscht, so wie es einem manchmal passiert, wenn man versprochen hat, irgendwo hinzukommen oder irgendetwas zu tun, sich aber nicht mehr daran erinnern kann, wohin man muss oder was man tun wollte.
Der Groschen fiel im Gartencenter, mitten in der anstrengenden Aufgabe, den perfekten Weihnachtsbaum zu finden. Der Duft der Tannennadeln war berauschend und beruhigend, und ich stand einen Moment lang in diesem temporären Indoor-Wald und ordnete meine Gefühle, als wäre ich eine Ersthelferin am Unfallort, die mit den Fingern sanft von einer Seite des Patienten zur anderen fährt und nach Brüchen sucht. Wie fühlte ich mich? Wie schwer waren meine Verletzungen? Atmete ich noch?
Ich atmete.
Mein Sohn Alex war fünf Wochen alt, als er starb.
Ich weiß nicht einmal mit Sicherheit, was die genaue Todesursache war. Bei einem älteren Mann mit Krebs im Endstadium kann ein Organversagen oder Unterernährung der ausschlaggebende Faktor sein, und dennoch würden wir den Krebs für seinen Tod verantwortlich machen. Eine junge Frau, die bei einem Autounfall ums Leben kommt, hat vielleicht eine tödliche Kopfverletzung, aber die Ursache ihres Todes ist sicherlich der Unfall. Mein Sohn wurde in der 28. Schwangerschaftswoche geboren, und natürlich war er nicht gerade gesund und munter, aber seine Prognose war gut. Besser sogar als die seines Zwillingsbruders, der direkt an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurde. Maschinen hielten ihn am Leben, wo ich versagt hatte. Beide Jungen entwickelten sich besser als erwartet, nahmen an Gewicht zu und tranken gut, und sie blieben von den unzähligen Gesundheitsproblemen verschont, die bei Frühgeburten häufig auftreten.
Daher kam die rasante Verschlechterung von Alex’ Zustand im Alter von drei Wochen unerwartet und war schrecklich beängstigend. Tests ergaben, dass Pseudomonas vorlag – ein Bakterium, das unter der harmlos klingenden Bezeichnung »Krankenhauskeim« bekannt ist, als wäre es etwas, das man einfach so abschütteln kann. Und vielleicht hätte er das gekonnt, wäre er nicht zu früh geboren worden, hätte er nicht nur knapp drei Pfund gewogen, hätte er keine Meningitis bekommen.
Starb er an der Meningitis?
An der darauffolgenden Hirnblutung?
Oder an der Entscheidung, die mein Mann und ich letztendlich trafen, um seinem Leiden ein Ende zu setzen?
Der Tod ist, wie das Leben, selten geradlinig.
In den Tagen nach Alex’ Tod war ich ununterbrochen überrascht, dass ich noch am Leben war. Es schien mir unmöglich, dass mein Körper weiter funktionieren konnte, wo ich doch das Gefühl hatte, meine Organe versagten. Meine Arme und Beine waren taub und kribbelten, als hätte mein Blut einen flüchtigen Blick auf die Entfernung geworfen, die es zurücklegen musste, und sich dann dagegen entschieden. Irgendetwas drückte auf meine Brust, bestimmt waren meine Rippen gebrochen, und meine Lunge hatte nur noch einen Bruchteil ihrer normalen Größe. Mein Atem kam flach und stoßweise, jedes Einatmen kürzer als das vorherige, jedes Ausatmen schwerer als das letzte. Eine dunkle Wolke sickerte in mein Gehirn, wie Tinte durch ein Löschblatt, vernebelte meine Gedanken und lastete auf meinen Gliedern.
Kurz gesagt, ich starb.
Und doch starb ich nicht, und es gab Zeiten, in denen sich das wie eine doppelte Grausamkeit anfühlte.
Im Laufe der Jahre hat meine Trauer ihre Form verändert, ihre scharfen Kanten sind weicher geworden, sodass sie leichter zu ertragen ist. Sie hat ihr Verhalten geändert, sie ist weniger fordernd und weniger bedürftig geworden. Diese Veränderungen sind ausnahmslos passiert, während ich weggeschaut habe, so wie bei einer Zugfahrt die Kilometer im Nu vorbeiziehen, wenn man in ein Buch vertieft ist. An diesem vierzehnten Jahrestag, umgeben von Weihnachtsbäumen, blickte ich auf und stellte fest, dass ich weiter gekommen war, als ich für möglich gehalten hatte. Ich war an diesem Morgen nicht mit einem so überwältigenden Herzschmerz aufgewacht, dass ich nicht sprechen konnte, wie in jedem Jahr zuvor. Es lastete nichts mehr auf meiner Brust, sodass sich jeder Atemzug wie mein letzter anfühlte. Meine Trauer war immer noch da, aber sie verzehrte mich nicht mehr.
Es war einfacher geworden.
Es wird auch für dich einfacher werden.
Das verspreche ich. Über so etwas, über so einen kleinen Satz, schreibt man doch kein ganzes Buch, oder? Doch, denn mir ist mittlerweile klar geworden, dass es nicht ausreicht, etwas einmal zu hören, um es zu glauben, vor allem, wenn einem der Kopf etwas ganz anderes einreden will.
Es war deine Schuld.
Du hättest mehr tun sollen.
Wenn nur dies
Wenn nur das
Wenn nur jenes ...
Dazu später mehr – viel mehr.
Vierzehn Jahre sind nicht die magische Zahl. Wenn du gerade unter einem Verlust leiden musst, ist dieses Gefühl echt und unverfälscht. Es kann drei Jahre, sieben oder zwanzig Jahre dauern, bis du aufwachst, ohne dass die Trauer in deiner Kehle steckt. Ich weiß, wie sehr es schmerzt. Aber ich weiß auch, weil ich die Trauer selbst so unheimlich gut kenne, dass du dich nicht immer so fühlen wirst.
Wir können versuchen, die Trauer zu analysieren. Wir können unsere Emotionen in klar gekennzeichnete Phasen einteilen. Wir können die Wissenschaft hinter dem körperlichen Schmerz, den wir fühlen, diskutieren. Aber Trauer ist größer als all diese Dinge, sie ist eigensinniger. Sie folgt ihrem eigenen Weg. Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, meine Trauer nicht zu bekämpfen, sondern bewusst mit ihr umzugehen. Sie als Teil von mir zu akzeptieren, genauso wie ich das Knacken meiner Gelenke und meine Narben, meine grauen Haare und meine Falten akzeptiere.
Dieses Buch ist um eine Reihe von Versprechen herum aufgebaut: mein Versprechen an dich, dass die Sonne wieder aufgehen wird. Es ist ein Gespräch, kein Vortrag, eine Geschichte der Hoffnung, nicht des Verlustes. Es ist ein Buch, nach dem man greifen kann, wenn man leidet, das man einem Freund schenken kann, wenn man nicht weiß, was man sagen soll. Ein Buch, das man zur Hand nehmen kann, wenn man eine tröstende Stimme braucht, die einem Gesellschaft leistet. Es enthält achtzehn Versprechen, eines für jedes Jahr, das ich nun ohne meinen Sohn gelebt habe, und jedes Jahr bin ich mehr an meiner Trauer gewachsen.
Nur wenige Menschen sprechen offen über den Tod, und ich erinnere mich, dass ich mich in meiner frühen Trauer schrecklich einsam gefühlt habe. Ich wusste nicht, ob ich »es richtig machte« – ob das, was ich fühlte, normal war –, und ich wusste nicht, wo ich Antworten finden konnte.
Die kurze Antwort lautet: Was auch immer du fühlst, ist normal.
Die längere Antwort ist dieses Buch.
Am 10. Dezember 2020 – dem vierzehnten Todestag von Alex –, nachdem wir einen Weihnachtsbaum ausgesucht hatten und damit nach Hause gefahren waren, postete ich meine Gedanken online. Ich wollte allen, die noch am Anfang ihrer Reise durch die Trauer stehen, Hoffnung geben und ihnen versichern, dass es nicht immer so wehtun wird. Ich wollte diesen Moment auch für mich selbst festhalten. Es fühlte sich wie ein Meilenstein an. Sogar wie eine Errungenschaft – denn Trauer ist ein aktiver, kein passiver Prozess.
Selbst Jahre später erhalte ich noch immer täglich Nachrichten als Reaktion auf diesen Beitrag. Ich habe Zehntausende von Geschichten von Menschen aus aller Welt gelesen, die sich in unterschiedlichen Phasen der Trauer befanden. Ich habe um diejenigen geweint, die keinen Ausweg gesehen haben, und mich über diejenigen gefreut, die nicht nur überlebt, sondern auch wieder neuen Lebensmut geschöpft haben. Ich habe so viele Nachrichten wie möglich beantwortet, und als ich nicht mehr hinterherkam, habe ich dieses Buch geschrieben. Eine Zeit lang reichten die Worte, die ich auf Twitter gepostet hatte, aus. Sie hatten fast zwanzig Millionen Menschen erreicht, und ich wusste aus den Reaktionen, dass sie Trost spendeten.
Aber es gab noch so viel mehr, was ich sagen wollte.
Ich wollte meine Versprechen vervollständigen und sie mit praktischen Vorschlägen ergänzen. Mir wurde klar, dass ich endlich bereit war, meine eigene Trauer auszupacken und zu überlegen, welche Elemente allgemeingültig sind. Mein Sohn wäre dieses Jahr achtzehn geworden, und es fühlt sich richtig an, in seinem Namen an etwas zu arbeiten – ein Erwachsenwerden für meine Trauer statt für meinen Jungen.
Ich erinnere mich noch gut daran, wie schwierig es für mich war, im Internet unterwegs zu sein, als meine Trauer ihren Höhepunkt erreichte. Ein schlecht formulierter Kommentar oder eine unpassende Anzeige konnte mich tagelang aus der Bahn werfen.
Aber ein Buch ...
Ein Buch enthält nur das, was auf dem Cover versprochen wird. Hier gibt es nichts, was in deine privaten Nachrichten rutscht oder in deine Chronik springt. Ein Buch gibt den Lesenden die Macht zurück.
Dies ist also meine Reise durch die Trauer, aber es ist auch deine. In jedem Winkel der Welt trauern Menschen jeden Tag, jede Minute um ihre Liebsten. Trauer ist universell. Aber so wie unsere Erfahrungen mit dem Tod unterschiedlich sind, so sind es auch die Emotionen, die darauf folgen. Deine Trauer ist so einzigartig wie du selbst – so einzigartig, wie deine Beziehung zu der Person war, die du verloren hast. Und was auch immer du fühlst, ist berechtigt und wahr. Ich habe mich auf die Elemente der Trauer konzentriert, die so vielen von uns gemeinsam zu sein scheinen, basierend auf den Nachrichten, die ich erhalten habe. Es wird Seiten geben, die du immer wieder lesen möchtest, in die du Lesezeichen oder Papierschnipsel stecken oder handschriftliche Notizen am Rand einfügen wirst. Genau. Genau so fühle ich. Aber es wird auch Kapitel geben, in denen die Worte dich nicht auf die gleiche Weise ansprechen – in denen du das Gefühl hast, dass sie zu jemand ganz anderem sprechen –, und das ist auch in Ordnung. Überspringe diese Seiten und mach dir keine Sekunde lang Sorgen, dass du etwas falsch machst, weil du nicht so empfindest wie ich. Wir alle trauern auf unsere eigene Weise.
Ich bin keine ausgebildete Trauerbegleiterin. Ich bin nicht anders als du, außer dass ich – vielleicht – ein Stück weiter auf dieser Reise gekommen bin, die keiner von uns jemals antreten wollte. Ich hätte dieses Buch nicht direkt nach dem Tod meines Sohnes schreiben können, aber ich wünschte, ich hätte es lesen können. Ich wünschte, ich hätte etwas gehabt, nach dem ich in dem Moment hätte greifen können, als ich es gebraucht hätte.
Im Laufe der Jahre habe ich viele Bücher über Trauer gelesen – und noch viel mehr zu lesen versucht. Kurz nachdem ich einen geliebten Menschen verloren hatte, als ich am dringendsten Trost in einem Buch gebraucht hätte, fand ich stattdessen lange, überfordernde Listen mit Dingen, die ich tun sollte. Ich fand unverständliche psychologische Analysen in winzig klein gedruckten Absätzen, die zu erklären versuchten, warum ich mich so fühlte, wie ich mich fühlte, obwohl der Grund dafür eigentlich ganz einfach war. Mein Sohn war gestorben. Es half mir nicht – nicht damals –, zu verstehen, dass mein Gehirn von Cortisol überflutet wurde oder dass mein präfrontaler Cortex (der Teil, der für die Entscheidungsfindung zuständig ist) vorübergehend abgeschaltet hatte. Was ich wissen wollte, war, dass es besser werden würde. Dass ich nicht allein war.
Deine Freunde und deine Familie werden sich an besonderen Tagen – Weihnachten, Jahrestage, Geburtstage – bei dir melden, aber selbst die engsten Freunde können nicht immer vorhersehen, dass es Auslöser gibt, die selbst dich überraschen. Ein Refrain aus einem Lied, das ihr im letzten gemeinsamen Urlaub gehört habt. Der Duft eines Parfüms, das du früher täglich auf deinem Kissen gerochen hast. Das Rascheln von Haaren. Ein Schal in einem Schaufenster. Ein Paar Schuhe, ein Foto, ein Weinetikett. Narzissen.
Dieses Buch ist für genau diese Momente da.
Vielleicht stellst du fest, dass du dich, so wie es bei mir war, nicht über einen längeren Zeitraum konzentrieren kannst. Aus diesem Grund gibt es in diesem Buch keine Rahmenerzählung – keine Verpflichtung, sich durch hundert Seiten dunkler Zeiten zu kämpfen, bevor die Hoffnung auftaucht. Du kannst das Buch auf herkömmliche Weise lesen, von Anfang bis Ende, oder du kannst Mut aus einem einzelnen Kapitel schöpfen. Wenn selbst das für dich zu viel ist, könnte dir die Liste der Versprechen allein schon Trost spenden.
Wie auch immer du es liest, ich hoffe, es hilft. Ich verspreche dir – und ich werde es so lange versprechen, bis du mir glaubst –, dass es nicht immer so wehtun wird.
Versprechen
1.Ich verspreche dir, dass es nicht immer so wehtun wird,
2.dass du nicht für immer nachts wach liegen und schluchzen wirst, bis du keine Luft mehr bekommst.
3.Ich verspreche dir, dass die Wellen der Trauer, die dich von den Füßen reißen, dich nicht ertränken werden.
4.Ich verspreche dir, dass du einen Weg finden wirst, um Lebewohl zu sagen,
5.und einen Grund, um weiterzumachen.
6.Ich verspreche dir, dass dies nicht immer dein erster Gedanke am Morgen sein wird,
7.dass du nicht immer das Schlimmste befürchten wirst.
8.Ich verspreche dir, dass du dich nicht immer so wütend
9.und so schuldig fühlen wirst
10.und so müde sein wirst.
11.Ich verspreche dir, dass du jemanden finden wirst, der dich versteht.
12.Ich verspreche dir, dass das Glück anderer Menschen dich nicht immer aus der Bahn werfen wird,
13.dass du an Jahrestagen irgendwann nicht mehr zusammenbrichst
14.oder von Fragen erschüttert wirst, die du nicht beantworten kannst.
15.Ich verspreche dir, dass du wieder glücklich sein wirst,
16.dass du eines Tages in der Lage sein wirst, etwas zurückzugeben.
17.Ich verspreche dir, dass du nicht vergessen wirst.
18.Ich verspreche dir, dass es nicht immer so wehtun wird.
1. Ich verspreche dir, dass es nicht immer so wehtun wird
Ich hätte nicht sagen können, welcher Monat gerade war, aber die Narzissen blühten, also musste es Frühling sein. Ich schätze, es war ein paar Wochen nach Alex’ Tod. Höchstens zwei Monate. Die Köpfe der Narzissen waren schwer vom Regen, ihre Stängel in feuchte Küchenrolle und Alufolie gewickelt. An den Blumen hing eine Frau.
»Wie geht es Ihnen?«, fragte sie.
Wie es mir ging?
Ich starb. Mein Herzschlag war unregelmäßig, mein Puls dröhnte in meinen Ohren wie ein Düsenjet. Meine Haut schmerzte, als hätte ich die Grippe. Sie war so berührungsempfindlich, dass ich nur die weichste Kleidung tragen konnte – Kleidung, die seit einer Woche oder länger nicht mehr gewaschen worden war. Mein Mann war bei der Arbeit und unser überlebender Zwilling noch auf der Intensivstation, sodass die Frau mich wohl in einem der seltenen Momente zu Hause erwischt hatte. Ich fragte mich, ob sie schon öfter vorbeigekommen war und ob die Narzissen schon zum zweiten oder dritten Mal im Einsatz waren.
»Es geht mir gut«, sagte ich. Denn das ist doch die Standardantwort, oder? Ich kann mir gut vorstellen, dass du das auch schon gesagt hast, mit gerade aufgerichtetem Rücken, den Schultern nach hinten und dem Kinn angehoben, um zu verbergen, dass du innerlich langsam verschwindest. Oder es gerne tun würdest. Du nickst mit dem Kopf, um dich ihnen anzupassen.
»Das bezweifle ich«, sagte die Frau mit den Narzissen. »Darf ich reinkommen?«
Ich trat zur Seite. Die Frau war eine Fremde, aber das allein war nicht mehr seltsam. Die Wochen waren voller ungebetener Gäste gewesen: Ärzte, Bestattungsunternehmer, Trauerbegleiter. Einmal ein Pfarrer, der auf Wunsch eines Freundes der Familie aus einer anderen Stadt geschickt worden war. Ich hatte um keinen von ihnen gebeten. Ich wollte keinen von ihnen. Keiner von uns will das, und doch bringt die Trauer sie alle an unsere Tür.
Das Haus, in dem wir damals wohnten, war lang und schmal. Vor dem Haus war ein winziger, ummauerter Garten, in dem die Katze in einem Blumenbeet schlief und das Tor im Wind klapperte, wenn der Postbote es offen gelassen hatte. Ich war die Bezirkspolizistin, und mein Arbeitsweg war von einem Ende der Hauptstraße zum anderen, wobei ich mir die Krawatte umband, während ich meinen Frühstückstoast aß. Ich war schon lange nicht mehr bei der Arbeit gewesen und konnte mir nicht vorstellen, wann ich wieder dorthin zurückkehren würde.
»Es tut mir so leid, dass Ihr Sohn gestorben ist«, sagte die Frau, als wir uns setzten. Ich hätte ihr vielleicht eine Tasse Tee anbieten sollen, sie hätte vielleicht angenommen. Ich starrte auf die Narzissen, auf die winzigen Fruchtfliegen, die aus ihnen krabbelten, aber beim Klang ihrer Worte schaute ich auf.
Wer auch immer diese Frau war, sie hatte auch jemanden verloren.
Das merkt man, stimmt’s? Manchmal sieht man es an der Art, wie sich die Menschen verhalten, an dem aufrichtigen Lächeln, das nicht gleich wieder verschwindet, wie es bei so vielen wohlmeinenden Blicken der Fall ist, als würde es wehtun, unseren Schmerz zu sehen. Aber meistens ist es die Art, wie sie sprechen. Tatsachenbehauptungen statt Euphemismen. Direkt. Fast schon unverblümt. Das ist passiert. Es ist schrecklich, aber so ist es nun mal. Unvermeidlich. Jemand ist gestorben.
»Wie hieß er?«, fragte sie.
Ich glaube, dass dies die wichtigste Frage ist, die man jemandem stellen kann, der trauert, aber ich kann die Anzahl der Menschen, die sie gestellt haben, an einer Hand abzählen. Sie fragen stattdessen: »Wie ist er gestorben?«, als ob die Ursache wichtiger wäre als das Leben, das sie genommen hat.
Mein Sohn hieß Alex. Wir wählten den Namen Alexander, obwohl wir wussten, dass er für einen so kleinen Jungen zu lang war. Als er geboren wurde, legte ich meinen kleinen Finger in sein Händchen und stellte mir vor, was für ein Mann er einmal werden würde.
Ein Großteil der Trauer dreht sich um Abwesenheit. Nicht nur um die Abwesenheit desjenigen, den wir lieben, sondern auch um den Verlust von Erinnerungen, die noch nicht geschaffen wurden. Die verpassten Gelegenheiten. Der Vater, der seine Tochter nicht zum Traualtar führen kann, die Großmutter, die ihr erstes Enkelkind nicht im Arm halten kann. Alex, der nie in seinen Namen hineingewachsen ist.
Ich wünschte, ich könnte mich an den Namen der Frau mit den Narzissen erinnern. Ich wünschte, ich könnte mich an den Namen des Kindes erinnern, das sie verloren hatte. Sie blieb etwa eine Stunde lang, und die ganze Zeit hielt ich die Blumen fest, die sie mitgebracht hatte, und starrte auf diese winzigen Fliegen.
Ich nehme an, sie hatte die Narzissen in ihrem Garten gepflückt. Sie hatte sich die Zeit genommen, sie abzuschneiden, sie in feuchtes Papier zu wickeln und sie an die Tür einer Fremden zu bringen, die nicht einmal Augenkontakt herstellen konnte. Das ist eines der nettesten Dinge, die je jemand für mich getan hat.
»Ich verspreche Ihnen, dass es nicht immer so wehtun wird«, sagte die Frau. Ihre eigene Trauer sei am Anfang unerträglich gewesen, sagte sie. Sie dachte, sie würde vor Schmerz sterben. Sie konnte nicht sprechen, sich nicht bewegen, nicht funktionieren. Sie erzählte mir von ihrem Sohn und wie er vor all den Jahren gestorben war. Ich lauschte ihrer Stimme, sachlich und ruhig, und nicht für eine Million Pfund hätte ich den Gedanken laut ausgesprochen, der mir durch den Kopf ging, während sie redete.
Ich gestehe ihn nun aber dir.
Ich dachte: Du kannst ihn nicht wirklich geliebt haben.
Ich bin nicht stolz darauf, aber Trauer beschränkt sich nicht auf Friedhofsbesuche mit Tränen in den Augen und leises Schluchzen am Küchentisch. Trauer ist nicht romantisch, sie ist schmerzhaft und hässlich, ebenso oft voller Wut und Bitterkeit wie voller Liebe. Wenn dir niemand von den schrecklichen Gedanken erzählt, die sie oder er hatte, wirst du glauben, dass du als Einziger so denkst, und Trauer ist auch ohne das schon einsam genug. Hinter jedem Versprechen in diesem Buch steht ein Grundprinzip: Ich verspreche, ehrlich zu dir zu sein.
Wenn die Frau mit den Narzissen ihren Sohn wirklich geliebt hätte, so meine logische Schlussfolgerung, wäre es ihr nicht so leichtgefallen, über ihn zu sprechen. Sieh dich doch mal an, dachte ich, gut gekleidet, mit einem Job, einer Familie, einem Leben. So werde ich nie wieder sein. Mein Sohn ist tot, und ich werde nie, niemals darüber hinwegkommen.
»Es ist noch sehr früh für Sie«, sagte die Frau. »Aber ich verspreche Ihnen, dass es einfacher wird.«
Danach stand ich in der Küche und weinte, bis ich keine Luft mehr bekam. Ich hatte vorgehabt, die Narzissen ins Wasser zu stellen, aber eine Vase zu finden, überstieg meine Fähigkeiten, und so welkten sie auf dem Abtropfbrett vor sich hin. Es war mir egal. Ich wollte keine Narzissen. Ich würde, so beschloss ich, nie wieder Narzissen mögen.
Es würde nicht einfacher werden.
Was auch immer meine unangekündigte Besucherin durchgemacht hatte, es war nichts im Vergleich zu meiner Trauer. Meine Trauer war echt. Sie war schmerzhaft und quälend und sie würde mich zerstören. Ich würde nicht in ein paar Jahren ruhig über meinen Sohn sprechen können, ich würde nicht mit Narzissen und tröstenden Worten an der Tür einer Fremden klingeln. Weil ich selbst immer noch gebrochen wäre.
Meine Trauer war anders.
~
Während ich dies schreibe, ist es Februar. Technisch gesehen ist es immer noch Winter, aber überall, wo ich hinschaue, gibt es Anzeichen für den Frühling, und der morgendliche Frost weicht an manchen Tagen einem blauen Himmel, der auf bessere Zeiten hoffen lässt. Unser neues Haus hat einen Garten – einen großen, weitläufigen Rasen, der sich bis zu den Feldern erstreckt – und unter den Bäumen stecken Dutzende von Narzissen ihre Köpfe aus dem Gras und warten darauf, zu blühen. Jeden Herbst stecke ich Dutzende weitere Narzissen und vergrabe sie wie einen Schatz unter der abgetragenen Grasnarbe. Der Gedanke an sie trägt mich durch den Winter. Ich kann sie nicht sehen, aber ich weiß, dass sie da sind: Verheißungen des Frühlings, die die dunklen Tage überdauern, bis es so weit ist.
Im Supermarkt stehen Eimer voller Narzissen an den Kassen, mit Gummibändern befestigt und mit noch geschlossenen Knospen. Sie kosten ein Pfund pro Stück. Ein Pfund! Wo sonst kann man Hoffnung für ein Pfund kaufen? Ich kaufe jede Woche einen Strauß und träufle Wasser über ihre Köpfe. Die Blüten öffnen sich zwei Tage später, sonnig und lächelnd, und jedes Mal, wenn ich sie sehe, denke ich an meinen Jungen.
Meine Gartennarzissen lasse ich lieber in der Erde – es scheint mir unfair, sie herauszureißen, wo sie doch so hart dafür gearbeitet haben, an ihrem Standort zu blühen –, aber manchmal schneide ich ein paar lange Stängel für eine Vase ab.
»Was ist das für ein komischer Geruch?«, fragt ein Teenager, der in mein Arbeitszimmer schlendert. Derselbe Teenager, der vor all den Jahren noch auf der Intensivstation lag. Derselbe Teenager, der an dem Tag, an dem ich ein Kind verlor, seinen Zwillingsbruder verlor.
»Das ist der Frühling«, sage ich, aber er ist schon weg, auf der Suche nach etwas Interessanterem als seiner Mutter und einer Vase mit herunterhängenden Blumen. Meine Finger schweben über der Tastatur. Ich habe den Faden verloren. Ein winziges Insekt krabbelt aus dem Kelch einer Narzisse, bevor es sich seinen Weg um die gekräuselten Ränder bahnt, jede Windung ein Miniaturberg, den es zu erklimmen gilt.
Es wird einfacher werden, sagte die Frau. Nicht besser, aber einfacher.
Und genauso ist es gekommen.
2. Ich verspreche dir, dass du nicht immer nachts wach liegen und schluchzen wirst, bis du keine Luft mehr bekommst
Als Alex’ Zustand äußerst kritisch wurde, wurden wir aus dem Krankenzimmer in einen Raum geführt, der als Raum der Stille bekannt war. Er lag am Ende eines Ganges, und als wir dem Facharzt folgten, fühlte ich mich wie Alice, die in eine Welt fiel, in die sie nicht gehörte. Der Gang war lang und ich wünschte, er wäre noch länger, damit ich nie am Ende ankommen würde. Aber da waren wir nun. Die Behinderungen unseres Sohnes, so der Arzt, würden umfassend sein. Es sei möglich, dass er nie selbstständig atmen würde, und selbst wenn er es täte, würde er nie gehen, sprechen oder schlucken können. Es sei zweifelhaft, ob er überhaupt die Welt um sich herum bewusst wahrnehmen würde.
Wie sehr ich diesen Raum hasste, der so erfüllt war vom Echo schlechter Nachrichten, von den Tränen unzähliger Eltern, die sich vor der Zukunft fürchteten und um die Vergangenheit weinten. Ich fing an zu weinen, sobald der Arzt zu sprechen begann, und ich dachte, ich würde nie wieder aufhören.