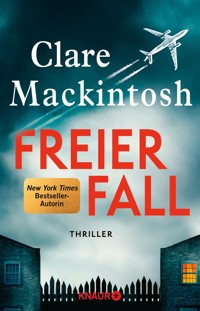Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein regnerischer Abend in Bristol. Der 5-jährige Jacob ist mit seiner Mutter auf dem Weg nach Hause, plötzlich reißt er sich los und stürmt auf die Straße. Das Auto, das wie aus dem Nichts erscheint und ihn erfasst, ist ebenso schnell wieder verschwunden. Für den kleinen Jungen kommt jede Hilfe zu spät.
Jenna Gray flieht vor den Ereignissen in die Einsamkeit eines walisischen Dorfes. Aber die Trauer um ihr Kind und die Erinnerungen lassen sie selbst dort nicht los. Schon bald ist sie sich sicher, dass nicht nur die Vergangenheit sie erbarmungslos verfolgt ...
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:7 Std. 45 min
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
Teil eins
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Teil zwei
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Epilog
Anmerkung der Autorin
Über die Autorin
Clare Mackintosh arbeitete zwölf Jahre bei der britischen Polizei und brachte es bis zum CID. Während ihrer Elternzeit sehnte sie sich nach neuen beruflichen Herausforderungen und begann eine erfolgreiche Karriere als freie Journalistin, u. a. für den GUARDIAN. Außerdem gründete sie 2012 das Chipping Norton Literaturfestival, das nur wenige Jahre nach seiner Gründung Besuchermassen anzieht. Zusammen mit ihrem Mann und ihren drei Kindern lebt sie in den Cotswolds. MEINE SEELESOKALTist ihr erster Roman.
Clare Mackintosh
MEINE SEELESO KALT
Psychothriller
Aus dem britischen Englisch von Rainer Schumacher
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2014 by Clare Mackintosh
Titel der englischen Originalausgabe: »I Let You Go«
First published in Great Britain in 2014 by Sphere,
an imprint of Little, Brown Book Group
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Bettina Steinhage und Anja Lademacher
Titelgestaltung: Sandra Taufer, München unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock: chuyuss | Heidi Brand | Honored_member
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-1477-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Alex
Prolog
Der Wind weht ihr das nasse Haar ins Gesicht, und zum Schutz vor dem Regen kneift sie die Augen zusammen. Wetter wie das hier treibt jeden zur Eile. Die Menschen, die über den rutschigen Bürgersteig huschen, vergraben das Kinn im Kragen, und vorbeifahrende Autos spritzen ihnen Wasser auf die Schuhe. Der Verkehrslärm macht es ihr unmöglich, mehr als nur ein paar Worte des geplapperten Updates zu verstehen, das sofort einsetzte, als die Schultüren sich öffneten. So groß ist die Aufregung angesichts dieser neuen Welt, in die er gerade hineinwächst, dass die Worte nur so aus ihm heraussprudeln. Sie hört irgendetwas von einem besten Freund, einem Projekt über den Weltraum und einem neuen Lehrer. Lächelnd schaut sie zu dem Jungen hinunter und ignoriert die Kälte, die sich einen Weg durch ihren Schal sucht. Er grinst zurück und legt den Kopf in den Nacken, um den Regen zu schmecken. Die nassen Wimpern bilden dunkle Flecken um seine Augen.
»Und ich kann schon meinen Namen schreiben, Mami!«
»Du bist ja auch ein kluger Junge«, sagt sie und beugt sich vor, um ihn leidenschaftlich auf die nasse Stirn zu küssen. »Wenn wir wieder zuhause sind, musst du mir das unbedingt zeigen.«
So schnell die Beine eines Fünfjährigen es zulassen, marschieren sie los. In der freien Hand hält sie seinen Ranzen, der immer wieder gegen ihre Knie schlägt.
Fast daheim.
Scheinwerferlicht funkelt auf dem nassen Asphalt und blendet sie alle paar Sekunden. Sie warten auf eine Lücke im Verkehr, überqueren geduckt die belebte Straße, und sie verstärkt ihren Griff um die winzige Hand in dem weichen Wollhandschuh, sodass der Junge laufen muss, um mit ihr Schritt zu halten. Nasse Blätter kleben an den Zäunen und verlieren allmählich ihre Farbe.
Dann erreichen sie die ruhige Straße, in der sie ihr Zuhause mit seiner warmen Gemütlichkeit erwartet. In der Sicherheit ihrer eigenen Nachbarschaft lässt sie seine Hand los, um ihm das nasse Haar aus den Augen zu wischen. Tropfen spritzen von den Strähnen, und sie lacht.
»Da«, sagt sie, als sie um die letzte Ecke biegen. »Ich habe das Licht für uns angelassen.«
Auf der anderen Straßenseite steht ein rotes Ziegelhaus. Es hat zwei Schlafzimmer, die winzigste aller Küchen und einen Garten voller Blumentöpfe, die sie schon ewig hat bepflanzen wollen. Es gibt nur sie beide.
»Lass uns um die Wette rennen, Mami …«
Er ist immer in Bewegung. Von der Sekunde an, in der er aufsteht, strotzt er nur so vor Energie, bis sein Kopf abends wieder auf dem Kissen liegt.
»Komm schon!«
Es dauert nur einen Augenblick. Der Platz neben ihr ist plötzlich leer, als er in Richtung Haus rennt, hin zu der Wärme des Flurs und dem sanften Licht auf der Veranda. Milch, Kekse, zwanzig Minuten Fernsehen und Fischstäbchen zum Tee. Das ist so schnell zu ihrem Ritual geworden, und dabei ist er noch nicht einmal ein halbes Jahr lang in der Schule.
*
Das Auto kommt aus dem Nichts. Das Quietschen nasser Bremsen, ein Junge, fünf Jahre alt, der auf der Windschutzscheibe aufprallt und sein Körper, der herumwirbelt, bevor er auf dem Asphalt aufschlägt. Sie rennt ihm hinterher, rennt vor den sich noch immer bewegenden Wagen. Und sie rutscht aus, fällt auf die ausgestreckten Hände, der Aufprall treibt ihr die Luft aus der Lunge.
Einen Augenblick später ist es vorbei.
Sie kauert neben ihm und sucht verzweifelt nach einem Puls. Ihr Atem bildet eine einsame weiße Wolke in der Luft. Sie sieht einen dunklen, rasch wachsenden Schatten unter seinem Kopf, und sie hört ihr eigenes Heulen wie aus weiter Ferne. Dann schaut sie zu der verschwommenen Windschutzscheibe hinauf. Die Scheibenwischer schaufeln Wasser in die immer dunkler werdende Nacht, und sie schreit den unsichtbaren Fahrer an, ihr zu helfen.
Sie beugt sich vor, um ihn mit ihrem Körper zu wärmen, breitet ihren Mantel über sie beide, und der Saum saugt das Wasser der Straße auf. Und als sie ihn küsst und ihn anfleht, doch wieder aufzuwachen, schrumpft das gelbe Licht, das sie umgibt, zu einem schmalen Strahl. Der Wagen setzt zurück. Vorwurfsvoll heult der Motor auf. Das Auto wendet in zwei, drei, vier Zügen, und schabt in seiner Eile an einem der riesigen Ahornbäume entlang, die über die Straße wachen.
Und dann ist es dunkel.
Teil eins
1
Detective Inspector Ray Stevens stand am Fenster und schaute nachdenklich auf seinen Bürostuhl, an dem schon seit mindestens einem Jahr die Lehne gebrochen war. Bis jetzt hatte er das Ganze eher pragmatisch gesehen und sich einfach nicht nach links gelehnt, doch während er in der Mittagspause gewesen war, hatte irgendjemand mit einem dicken schwarzen Filzstift »defective« auf die Rückenlehne gekritzelt, »defekt«. Ray fragte sich, ob der neu gefundene Enthusiasmus der Verwaltung wohl so weit gehen würde, dass man ihm auch ein Ersatzmöbel zuteilte, oder ob er das CID, die Kriminalpolizei von Bristol, bis ans Ende seiner Tage von einem Stuhl aus würde leiten müssen, der ernste Zweifel an seiner Professionalität weckte.
Ray beugte sich vor, um im Chaos seiner Schreibtischschublade nach einem Marker zu suchen. Dann hockte er sich hinter die Lehne und änderte die Aufschrift in »detective«. Im selben Augenblick öffnete sich die Tür zu seinem Büro. Rasch stand er auf und steckte die Kappe auf den Stift.
»Ah … Kate … Ich habe nur …« Ray hielt inne. Er wusste sofort, was Kates Blick bedeutete, noch bevor er den Ausdruck der Notrufzentrale in ihrer Hand sah. »Was gibt’s?«
»Ein Unfall mit Fahrerflucht in Fishponds. Einen fünfjährigen Junge hat’s erwischt.«
Ray streckte die Hand nach dem Blatt Papier aus und überflog es, während Kate verlegen in der Tür stand. Sie war erst vor ein paar Monaten vom Streifendienst zur Kriminalpolizei versetzt worden und hatte sich noch nicht so recht eingelebt. Aber sie war gut, besser sogar, als sie glaubte.
»Kein Kennzeichen?«
»Nicht, soweit wir wissen. Der Tatort ist abgesperrt, und der Skipper nimmt gerade die Aussage der Mutter auf. Wie du dir denken kannst, steht sie unter Schock.«
»Ist es okay für dich, wenn wir ein paar Überstunden machen?«, fragte Ray, doch Kate nickte bereits, bevor er die Frage beendet hatte. In freudiger Erwartung lächelten sie einander an, während das Adrenalin durch ihre Körper strömte. Das war immer so, wenn etwas Schreckliches geschah, auch wenn es sich falsch anfühlte.
»Nun denn … Auf geht’s.«
*
Sie nickte den Rauchern zu, die sich unter dem kleinen Vordach am Hintereingang versammelt hatten.
»Alles klar, Stumpy?«, sagte Ray. »Ich fahre mit Kate zu der Fahrerflucht in Fishponds. Kannst du mal bei der Verkehrsüberwachung nachfragen, ob schon was reingekommen ist?«
»Klar.« Der ältere Mann nahm einen letzten Zug von seiner selbstgedrehten Kippe. Detective Sergeant Jake Owen wurde schon so lange Stumpy genannt, dass es jedes Mal komisch wirkte, wenn bei Gericht seinen richtiger Name verlesen wurde. Stumpy war ein Mann weniger Worte, auch wenn er mehr Kriegsgeschichten zu erzählen hatte, als er teilen wollte; ohne Zweifel war er einer von Rays besten Sergeants. Die beiden Männer waren mehrere Jahre lang zusammen Streife gefahren, und da Stumpy über eine Kraft verfügte, die seine kleine Statur Lügen strafte, war Ray mehr als einmal froh gewesen, ihn an seiner Seite zu haben.
Neben Kate bestand Stumpys Team noch aus dem zuverlässigen Malcolm Johnson und dem jungen Dave Hillsdon, einem zwar engagierten, aber bisweilen unberechenbaren Detective Constable. Dessen kaum zu bremsendes Verlangen, Täter hinter Gitter zu bringen, ging Ray häufig ein wenig zu weit. Zusammen jedoch bildeten sie ein gutes Team, und Kate lernte rasch von ihnen. Sie war mit einem leidenschaftlichen Eifer bei der Sache, der Ray wehmütig an seine Zeit als DC zurückdenken ließ, bevor siebzehn Jahre Bürokratie ihn auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hatten.
*
Kate lenkte den unauffälligen Corsa durch den zunehmenden Rushhour-Verkehr in Richtung Fishponds. Sie war eine ungeduldige Fahrerin. Vor jeder roten Ampel schüttelte sie missbilligend den Kopf und reckte den Hals, um an den wartenden Autos vorbeischauen zu können. Ständig war sie in Bewegung: Sie trommelte mit den Fingern auf dem Lenkrad, rümpfte die Nase und rutschte auf ihrem Sitz herum. Und wenn der Verkehr sich dann wieder in Bewegung setzte, beugte sie sich vor, als könne sie den Wagen auf diese Weise beschleunigen.
»Du vermisst wohl Blaulicht und Sirene«, bemerkte Ray.
Kate grinste. »Manchmal vielleicht.« Abgesehen von ein wenig Kajal hatte sie auf Make-up verzichtet, und dunkelbraune Locken fielen unfrisiert auf ihre Schultern, obwohl sie versucht hatte, sie mit einer Haarklammer zu bändigen.
Ray kramte nach seinem Handy, um die notwendigen Anrufe zu tätigen. Er wollte sich vergewissern, dass die Spurensicherung auf dem Weg war, dass man den diensthabenden Superintendent informiert hatte und dass irgendjemand den Unfalldienst gerufen hatte, einen riesigen Wagen voller Zelte, Notfallscheinwerfer und heißer Getränke. Alles war erledigt. Das war eigentlich immer so, dachte Ray. Dennoch musste er sichergehen, denn als DI trug am Ende er allein die Verantwortung für den Einsatz. Zwar machten die Streifenbeamten jedes Mal einen kleinen Aufstand, wenn die Kriminalpolizei eintraf, um einen ihrer Fälle zu übernehmen, aber so war das nun einmal. Alle hatten sie das so gemacht, selbst Ray, der auf dem Weg nach oben nur so wenig Zeit wie möglich in Uniform verbracht hatte.
Ray telefonierte mit der Leitstelle, um sie zu informieren, dass sie in fünf Minuten da sein würden. Bei sich zu Hause rief er dagegen nicht an. Er hatte sich angewöhnt, Mags nur dann anzurufen, wenn er ausnahmsweise mal pünktlich sein würde. Bei den vielen Überstunden war das praktischer.
Als sie um die Ecke bogen, bremste Kate den Wagen auf Schritttempo ab. Ein halbes Dutzend Streifenwagen stand willkürlich verteilt auf der Straße. Sie hatten die Signallichter eingeschaltet, und alle paar Sekunden fiel blaues Licht auf die Szenerie. Scheinwerfer auf Dreibeinen machten den Regen sichtbar, der in den letzten Stunden Gott sei Dank zu einem Nieseln abgeebbt war.
Kate hatte sich beim Verlassen des Reviers einen Mantel geschnappt und ihre High Heels gegen Gummistiefel getauscht. »Praktisch geht vor elegant«, hatte sie gelacht, ihre Schuhe in den Spind geworfen und die Stiefel angezogen. Ray dachte über so etwas nur selten nach, doch jetzt wünschte er, er hätte sich zumindest einen Mantel mitgenommen.
Sie stellten den Wagen gut hundert Meter von einem großen weißen Zelt entfernt ab, das errichtet worden war, um mögliche Beweise vor dem Regen zu schützen. Eine Seite des Zeltes stand offen, und im Inneren konnten Neuankömmlinge eine Kriminaltechnikerin sehen, die auf allen vieren irgendetwas vom Boden abtupfte. Weiter die Straße hinunter untersuchte eine Gestalt im Papieranzug einen der großen Ahornbäume.
Noch während Ray und Kate sich dem Tatort näherten, wurden sie von einem jungen Beamten aufgehalten, der seine Leuchtweste so hoch geschlossen hatte, dass Ray das Gesicht zwischen Kragen und Mütze kaum erkennen konnte.
»Guten Abend, Sir«, sagte der Mann. »Wollen Sie ins Zelt? Dann muss ich Sie erst eintragen.«
»Nein, danke«, erwiderte Ray. »Aber Sie könnten mir sagen, wo Ihr Sergeant ist.«
»Er ist im Haus der Mutter«, antwortete der Beamte und deutete zu ein paar kleinen Reihenhäusern hinüber. »Nummer vier«, fügte er hinzu.
»Gott, was für ein mieser Job«, sagte Ray, als er und Kate sich von dem Mann entfernten. »Ich erinnere mich noch daran, wie ich als blutiger Anfänger einmal zwölf Stunden lang einen Tatort bewachen musste. Im strömenden Regen. Und dann hat mich der DCI angemacht, weil ich ihn nicht angelächelt habe, als er um acht Uhr am nächsten Morgen endlich aufgekreuzt ist.«
Kate lachte. »Bist du deshalb zur Kriminalpolizei gegangen?«
»Nicht nur deswegen«, antwortete Ray, »aber das war sicher ein Grund. Der Hauptgrund war jedoch ein anderer: Ich war es schlicht leid, alle großen Fälle an die Spezialisten abgeben zu müssen. Ich konnte nie einen Fall zu Ende bringen. Was ist mit dir?«
»Ähnlich.«
Sie erreichten die Häuser, auf die der Beamte gedeutet hatte. Kate sprach weiter, während sie nach Nummer vier suchten.
»Es gefällt mir einfach, mich um die härteren Fälle zu kümmern. Ich langweile mich leicht. Ich mag komplizierte Ermittlungen, die mir wirklich Kopfzerbrechen bereiten. Kryptische Kreuzworträtsel statt der ganz einfachen. Ergibt das Sinn?«
»Vollkommen«, antwortete Ray. »Kreuzworträtsel waren allerdings nie mein Ding.«
»Es gibt da einen Trick«, sagte Kate. »Bei Gelegenheit bringe ich ihn dir bei. So … Da wären wir … Nummer vier.«
Die Eingangstür war sauber lackiert und stand einen Spaltbreit offen. Ray schob sie auf und rief hinein: »CID! Dürfen wir reinkommen?«
»Im Wohnzimmer«, kam die Antwort.
Ray und Kate traten sich die Füße ab und gingen durch den schmalen Flur, vorbei an einer überladenen Garderobe, unter der die roten Gummistiefel eines Kindes neben denen einer Erwachsenen standen.
Die Mutter des Kindes saß auf einem kleinen Sofa und starrte auf den blauen Schulranzen in ihrem Schoß.
»Ich bin Detective Inspector Ray Stevens. Das mit Ihrem Sohn tut mir sehr leid.«
Die Frau hob den Kopf, schaute ihn an und wickelte sich den Riemen des Schulranzens so fest um die Hand, dass sich das Blut staute. »Jacob«, sagte sie. »Sein Name war Jacob.«
Auf einem Küchenstuhl neben dem Sofa balancierte ein uniformierter Sergeant den Papierkram auf seinem Schoß. Ray hatte ihn schon einmal auf dem Revier gesehen, wusste aber nicht, wie er hieß. Er schaute auf das Namensschild.
»Brian, würde es Ihnen etwas ausmachen, Kate in die Küche zu begleiten und sie darüber zu informieren, was Sie bis jetzt herausgefunden haben? Ich würde der Zeugin gerne ein paar Fragen stellen. Es dauert auch nicht lange. Vielleicht könnten Sie ihr ja eine Tasse Tee machen.«
Brians Gesichtsausdruck nach zu urteilen, war das das Letzte, was er tun wollte, aber er stand auf und verließ mit Kate den Raum. Zweifellos würde er sich gleich erst einmal bei ihr beschweren, dass das CID sich einfach so in seine Ermittlungen drängte, doch das kümmerte Ray nicht.
»Bitte, entschuldigen Sie, dass ich Ihnen noch weitere Fragen stellen muss«, wandte er sich an die Frau, »aber wir brauchen so viele Informationen wie möglich – und das schnell.«
Jacobs Mutter nickte, hob aber nicht den Blick.
»Wenn ich richtig informiert bin, haben Sie das Kennzeichen nicht erkennen können, oder?«
»Es ging alles so schnell«, schluchzte die Frau. »Er hat von der Schule erzählt, und dann … Ich habe ihn nur kurz losgelassen.« Sie zog den Riemen noch fester um die Hand, und Ray sah, wie die Farbe aus ihren Fingern wich. »Es ging so schnell. Der Wagen war so schnell.«
Dann fasste sie sich wieder und beantwortete seine Fragen mit einer bemerkenswerten Geduld. Ray hasste es, sie so bedrängen zu müssen, doch ihm blieb keine andere Wahl.
»Wie sah der Fahrer aus?«
»Ich konnte nicht in den Wagen sehen«, antwortete die Frau.
»Gab es Beifahrer?«
»Ich konnte nicht in den Wagen sehen«, wiederholte sie. Ihre Stimme klang dumpf und hölzern.
»Okay«, sagte Ray. Wo zum Teufel sollten sie anfangen?
Die Frau schaute ihn an. »Werden Sie ihn finden? Den Mann, der Jacob getötet hat, meine ich. Werden Sie ihn finden?« Ihre Stimme brach, und die Worte endeten in einem leisen Stöhnen. Sie beugte sich vor, drückte sich den Ranzen an die Brust, und Ray schnürte es die Kehle zu. Er atmete tief durch und schob das Gefühl beiseite.
»Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun«, erklärte er und verachtete sich selbst dafür, dass er mit solchen Klischees um sich warf.
Kate kehrte aus der Küche zurück, gefolgt von Brian, der einen Becher Tee in der Hand hielt. »Dürfte ich jetzt wohl weiter meine Aussage aufnehmen … Sir?«, fragte er.
Regen Sie meine Zeugin nicht so auf, meinst du, dachte Ray. »Natürlich. Danke. Entschuldigen Sie die Störung. Haben wir alles, was wir brauchen, Kate?«
Kate nickte. Sie sah blass aus, und Ray fragte sich, was ihr Brian wohl gesagt haben mochte, das sie so aufgeregt hatte. In einem Jahr würde er sie genauso gut kennen wie den Rest des Teams, doch im Augenblick durchschaute er sie noch nicht. Sie war recht forsch, das wusste er bereits. Sie hatte keinerlei Problem damit, bei Teammeetings ihre Meinung zu sagen, und sie lernte schnell.
Sie verließen das Haus und kehrten schweigend zum Wagen zurück.
»Alles okay?«, fragte Ray, obwohl er Kate deutlich ansah, dass dem nicht so war. Ihr Kiefer war angespannt und ihr Gesicht kreidebleich.
»Klar«, antwortete Kate, doch ihre Stimme klang belegt, und Ray wusste, dass sie kurz davorstand, in Tränen auszubrechen.
»Hey«, sagte er, streckte die Hand aus und legte ihr unbeholfen den Arm um die Schultern. »Geht’s um den Fall?« Im Laufe der Jahre hatte Ray einen Abwehrmechanismus gegen Fälle wie diesen entwickelt. Das traf auf die meisten Polizisten zu – deshalb musste man auch ein Auge zudrücken, wenn in der Kantine mal ein grober Scherz die Runde machte –, doch vielleicht war Kate ja anders.
Sie nickte und nahm einen tiefen, zitternden Atemzug. »Tut mir leid. Normalerweise bin ich nicht so, das kann ich versprechen. Ich habe schon Dutzende Todesnachrichten überbracht, aber … Gott, er war erst fünf! Offenbar wollte Jacobs Vater nie etwas mit ihm zu tun haben, und deshalb waren sie immer nur zu zweit. Völlig unvorstellbar, was die arme Frau gerade durchmacht.« Ihr versagte die Stimme, und erneut spürte Ray, wie es ihm die Kehle zuschnürte. Sein Abwehrmechanismus beruhte darauf, sich voll und ganz auf die Ermittlungen zu konzentrieren, auf die Beweislage. Gefühle den Betroffenen gegenüber versuchte er tunlichst zu vermeiden. Wenn er zu viel darüber nachdachte, wie es sich wohl anfühlte, dem eigenen Kind beim Sterben zuschauen zu müssen, dann nutzte es niemandem was – nicht Jacob und auch nicht seiner Mutter. Unwillkürlich wanderten Rays Gedanken zu seinen eigenen Kindern, und er verspürte das irrationale Verlangen, sofort zuhause anzurufen und sich zu vergewissern, dass es den beiden gut ging.
»Tut mir leid.« Kate schluckte und lächelte verlegen. »Ich verspreche, dass das nicht immer so sein wird.«
»Hey, schon in Ordnung«, sagte Ray. »Das haben wir alle durchgemacht.«
Kate hob die Augenbrauen. »Du auch? Hatte dich gar nicht so sensibel eingeschätzt, Boss.«
»Doch, doch. Auch bei mir gibt es diese Momente.« Ray drückte ihre Schulter, bevor er den Arm wieder wegnahm. Er hätte nie gedacht, dass er eines Tages im Job weinen würde, doch jetzt stand er kurz davor. »Geht’s wieder?«
»Jaja. Danke.«
Als sie wegfuhren, schaute Kate zum Tatort zurück, wo die Kriminaltechniker noch immer an der Arbeit waren. »Was muss das für ein Bastard sein, der einen Fünfjährigen umbringt und dann einfach weiterfährt?«
Ray zögerte nicht. »Genau das werden wir herausfinden.«
2
Ich will keine Tasse Tee, nehme sie aber trotzdem und halte mein Gesicht in den Dampf, bis er mich verbrüht. Schmerz sticht mir in die Haut, betäubt meine Wangen und brennt in meinen Augen. Ich kämpfe dagegen an, instinktiv zurückzuzucken. Ich brauche die Taubheit, damit die Szenen verschwimmen, die in meinem Kopf herumspuken.
»Vielleicht auch was zu essen?«
Er ragt über mir auf, und ich weiß, dass ich den Blick heben sollte, doch das kann ich nicht ertragen. Wie kann er mir Essen und Trinken anbieten, als wäre nichts geschehen? Eine Welle der Übelkeit steigt in mir auf, und ich schlucke Galle herunter. Er gibt mir die Schuld dafür. Zwar hat er das nicht so gesagt, doch das ist nicht nötig. Ich sehe es in seinen Augen. Und er hat recht: Es war meine Schuld. Wir hätten einen anderen Weg nach Hause nehmen sollen. Ich hätte ihn nicht ablenken sollen. Ich hätte ihn aufhalten sollen …
»Nein, danke«, sage ich leise. »Ich habe keinen Hunger.«
Der Unfall läuft in meinem Kopf in Dauerschleife. Ich will auf Pause drücken, doch der Film ist gnadenlos: Immer wieder und wieder prallt der kleine Körper auf die Windschutzscheibe. Ich hebe den Becher erneut ans Gesicht, doch der Tee ist abgekühlt, und die Wärme reicht nicht mehr aus, um mir auf der Haut zu schmerzen. Ich spüre keine Tränen in meinen Augen, doch fette Tropfen zerplatzen auf meinen Knien. Ich schaue zu, wie sie in meine Jeans sickern, und ich kratze mit dem Nagel an einem Schmutzfleck auf meinem Schenkel.
Ich lasse meinen Blick durch das Zimmer in dem Heim schweifen, das ich über so viele Jahre hinweg perfekt eingerichtet habe. Die Vorhänge passen zu den Kissen. Einige der Kunstwerke stammen von mir, andere habe ich in Galerien gekauft, weil ich mich in sie verliebt hatte. Ja, ich dachte, ich würde hier ein Heim schaffen, dabei habe ich in Wahrheit nur ein Haus gebaut.
Meine Hand schmerzt. Im Gelenk spüre ich meinen Puls schnell und schwach. Ich bin froh über den Schmerz. Ich wünschte nur, er wäre stärker. Ich wünschte nur, ich wäre diejenige gewesen, die überfahren worden ist.
Er spricht wieder. Die Polizei sucht überall nach dem Auto … Die Zeitungen werden Zeugen bitten, sich zu melden … Es wird in den Nachrichten gesendet …
Der Raum dreht sich, und ich versuche mich auf den Beistelltisch zu konzentrieren und nicke, wenn es angebracht erscheint. Er geht zwei Schritte zum Fenster und dann wieder zurück. Ich wünschte, er würde sich setzen. Er macht mich nervös. Meine Hände zittern, und ich stelle den unberührten Tee ab, bevor ich ihn noch fallen lasse, aber das Porzellan macht ein lautes klapperndes Geräusch auf der Glasplatte, als ich die Tasse abstelle. Sein ungeduldiger Blick trifft mich.
»Tut mir leid«, sage ich. Ich habe einen metallischen Geschmack im Mund, und ich bemerke, dass ich mir auf die Lippe gebissen habe. Ich schlucke das Blut herunter, denn ich will keine Aufmerksamkeit auf mich lenken, weil ich um ein Taschentuch bitte.
Alles hat sich verändert. In dem Augenblick, als das Auto über den Asphalt gerutscht ist, hat sich mein ganzes Leben verändert. Jetzt sehe ich alles klar und deutlich, als würde ich es von außen betrachten. So kann das nicht weitergehen.
*
Als ich aufwache, bin ich mir eine Sekunde lang nicht sicher, was das für ein Gefühl ist. Alles ist gleich, und doch hat sich alles verändert. Dann, noch bevor ich meine Augen öffne, breitet sich Lärm in meinem Kopf aus, als würde eine U-Bahn durch meinen Schädel rasen. Und da ist es … Es ist, als würden Szenen in Technicolor ablaufen, die ich weder anhalten noch stummschalten kann. Ich presse die Handballen an meine Schläfen, als könnte ich die Bilder mit Gewalt aus meinem Kopf vertreiben, doch sie kommen immer wieder.
Auf meinem Nachttisch steht der Messingwecker, den Eve mir geschenkt hat, als ich auf die Universität gegangen bin – »Sonst schaffst du es nie in eine Vorlesung« –, und entsetzt sehe ich, dass wir schon halb elf haben. Der Schmerz in meiner Hand ist von dem Schmerz in meinem Kopf verdrängt worden, der mich blendet, wann immer ich den Kopf zu schnell bewege, und als ich mich aus dem Bett wuchte, tut mir jeder Knochen weh.
Ich ziehe dieselben Sachen an wie gestern und gehe in den Garten, ohne mir vorher einen Kaffee zu kochen, auch wenn mein Mund so trocken ist, dass mir das Schlucken Schmerzen bereitet. Ich kann meine Schuhe nicht finden, und der Frost brennt an meinen Füßen, als ich über das Gras gehe. Der Garten ist nicht groß, doch der Winter steht vor der Tür, und als ich die andere Seite erreiche, spüre ich meine Zehen nicht mehr.
Mein Gartenatelier hat mir die letzten fünf Jahre als Zuflucht gedient. Von außen betrachtet ist es kaum mehr als ein Schuppen, doch ich komme hierher, um zu arbeiten, nachzudenken und vor der Welt zu fliehen. Der Holzboden ist immer fleckig von den Tonklumpen, die von meiner Töpferscheibe fallen. Sie steht mitten im Raum, sodass ich um sie herumgehen und meine Arbeit von allen Seiten kritisch begutachten kann. An drei Wänden befinden sich Regale, auf die ich meine Skulpturen stelle, ein geordnetes Chaos, das nur ich durchschaue: auf der einen Seite die Werke, an denen ich gerade arbeite. Auf der anderen die gebrannten, aber noch unbemalten Stücke und dort die, die nur noch darauf warten, an den Kunden verschickt zu werden. Es sind Hunderte, doch wenn ich die Augen schließe, kann ich die Form jeder einzelnen unter meinen Fingern fühlen und die Feuchtigkeit des Tons auf meiner Haut.
Ich hole den Schlüssel aus seinem Versteck unter der Fensterbank und öffne die Tür. Es ist schlimmer, als ich gedacht habe. Auf dem Boden liegt ein Teppich aus zerbrochenem Ton, gerundete Topfhälften enden abrupt in wütenden, scharfen Spitzen. Die Holzregale sind leer wie auch meine Werkbank, und die winzigen Figuren auf der Fensterbank sind nur noch ein Haufen Splitter, die im Sonnenlicht funkeln.
Neben der Tür liegt die kleine Statue einer Frau. Ich habe sie letztes Jahr gemacht als Teil einer Figurenreihe für einen Laden in Clifton. Ich wollte der Realität nahekommen, nicht perfekt sollten sie sein, aber trotzdem schön. Insgesamt habe ich zehn Frauen gemacht, jede mit individuellen Rundungen und Unzulänglichkeiten. Orientiert habe ich mich dabei an meiner Mutter, meiner Schwester, den Mädchen aus meinen Töpferkursen und den Frauen, die mir immer im Park begegnen. Die hier bin ich … in groben Zügen zumindest und so, dass mich niemand erkennen würde, aber trotzdem. Der Busen ist ein wenig zu flach, die Hüfte ein wenig zu schmal und die Füße ein wenig zu groß, die Haare am Halsansatz zu einem Knoten zusammengebunden. Ich bücke mich und hebe die Figur auf. Bis jetzt habe ich geglaubt, sie sei intakt geblieben, doch als ich sie nun berühre, bewegt sich der Ton in meinen Fingern, und plötzlich halte ich zwei Hälften in den Händen. Kurz schaue ich sie mir an. Dann schleudere ich sie mit aller Kraft gegen die Wand, wo sie in winzige Splitter zerbersten, die auf meinen Werktisch regnen.
Ich atme tief ein und sehr langsam wieder aus.
*
Ich bin nicht sicher, wie viele Tage seit dem Unfall vergangen sind, oder wie es mir gelungen ist, eine Woche zu überstehen, in der ich ständig das Gefühl hatte, durch Sirup zu waten. Ich weiß nicht, warum ich der Meinung bin, dass heute der Tag gekommen ist, ich weiß nur, dass es so ist. Wenn ich jetzt nicht gehe, werde ich vermutlich nie mehr gehen, so viel steht fest. Ich nehme nur mit, was in meine Reisetasche passt. Planlos wandere ich durchs Haus und versuche, mir vorzustellen, dass ich nie mehr hier sein werde. Der Gedanke ist beängstigend und befreiend zugleich. Kann ich das? Ist es wirklich möglich, sein altes Leben einfach so zurückzulassen und ein neues zu beginnen? Ich muss es zumindest versuchen. Es ist meine einzige Chance, das Ganze heil zu überstehen.
Mein Laptop ist in der Küche. Darauf sind Fotos, Adressen und wichtige Informationen, die ich vielleicht eines Tages brauchen werde. Sie auch irgendwo anders zu speichern, daran habe ich gar nicht gedacht, und jetzt habe ich keine Zeit mehr dafür. Also packe ich das schwere, unhandliche Ding ein. Die Tasche ist schon fast voll, aber ein letztes Stück meiner Vergangenheit kann ich unmöglich zurücklassen. Ich nehme einen Pullover und eine Hand voll T-Shirts heraus und schaffe so Platz für die kleine Zedernholzkiste, in der meine Erinnerungen versteckt sind. Ich schaue nicht hinein. Das muss ich auch nicht. Da ist die Sammlung Tagebücher eines Teenagers, aus denen die ein oder andere Seite in jugendlichem Frust herausgerissen worden ist, ein von einem Gummi zusammengehaltenes Bündel Konzertkarten, mein Abschlusszeugnis und Zeitungsartikel zu meiner ersten Ausstellung. Und dann sind da die Fotos des Sohnes, den ich mit schier unglaublicher Intensität geliebt habe. Es sind wertvolle Fotos, aber zu wenige für jemanden, der so geliebt worden ist. Er hat so wenig Spuren in dieser Welt hinterlassen, und doch war er der Mittelpunkt meines Lebens.
Ich kann der Versuchung nicht widerstehen. Ich öffne die Kiste und hole das oberste Foto heraus. Es ist ein Polaroid, das die Hebamme am Tag seiner Geburt aufgenommen hat. Darauf ist er nur als winziges rosa Etwas zu erkennen, kaum sichtbar unter dem weißen Krankenhauslaken. Auf dem Foto halte ich ihn auf die typisch unbeholfene Art einer frischgebackenen Mutter, die in Liebe und Erschöpfung zu ertrinken droht. Es war alles so schnell gegangen, so Furcht erregend, so ganz anders als in den Büchern, die ich während meiner Schwangerschaft verschlungen habe, doch die Liebe, die ich hatte, ist nie versiegt. Plötzlich kann ich nicht mehr atmen. Ich lege das Foto wieder zurück und stopfe die Kiste in meine Reisetasche.
*
Jacobs Tod macht Schlagzeilen. Sie schreien mich vom Zeitungsautomaten am Parkhaus an, aus dem Schaufenster an der Ecke und in der Schlange an der Bushaltestelle, in der ich stehe, als wäre ich genau wie alle anderen … als wäre ich nicht auf der Flucht.
Immer geht es um den Unfall. Wie konnte das nur passieren? Wer hat das nur getan? An jeder Bushaltestelle kommen neue Nachrichten hinzu, und Gerüchtefetzen, denen ich nicht ausweichen kann, ziehen über die Köpfe der Wartenden hinweg.
Es war ein schwarzer Wagen.
Es war ein roter Wagen.
Die Polizei steht kurz vor einer Festnahme.
Die Polizei hat keine Spur.
Eine Frau sitzt neben mir. Sie schlägt die Zeitung auf, und plötzlich habe ich das Gefühl, als würde mir jemand auf die Brust drücken. Jacobs Gesicht starrt mich an. Seine geschwollenen Augen klagen mich an, dass ich ihn nicht beschützt habe, dass ich ihn habe sterben lassen. Ich zwinge mich, ihn anzusehen, und mir schnürt es die Kehle zu. Mein Blick verschwimmt, und ich kann die Worte nicht mehr lesen, aber das muss ich auch gar nicht. Ich habe eine Version dieses Artikels in jeder Zeitung gesehen, an der ich heute vorbeigekommen bin. Zitate von am Boden zerstörten Lehrern, Beileidsbekundungen an den Blumensträußen neben der Straße, die Ermittlungen … eröffnet und erst einmal wieder eingestellt. Ein zweites Foto zeigt einen Kranz aus gelben Chrysanthemen auf einem unmöglich kleinen Sarg. Die Frau seufzt, schüttelt den Kopf und beginnt zu reden – halb mit sich selbst, glaube ich, aber vielleicht spürt sie ja, dass ich etwas dazu sagen könnte.
»Schrecklich, nicht wahr?«, sagt sie. »Und das so kurz vor Weihnachten.«
Ich bleibe stumm.
»Einfach so wegzufahren, ohne anzuhalten.« Wieder schüttelt sie den Kopf. »Und er war erst fünf! Was für eine Mutter lässt ein so kleines Kind auch alleine über die Straße laufen?«
Ich kann nicht anders. Ich schluchze. Ohne dass ich es merke, laufen mir heiße Tränen über die Wangen und in das Taschentuch, das sie mir sanft in die Hand drückt.
»Armes Lämmchen«, sagt die Frau, als tröste sie ein kleines Kind. Meint sie mich oder Jacob? »Das ist einfach unvorstellbar.«
Nein, das ist es nicht, und ich möchte ihr sagen, dass es noch tausend Mal schlimmer ist, als sie glaubt. Sie gibt mir noch ein Taschentuch – zerknüllt, aber sauber –, und blättert eine Seite weiter, um den Artikel über die feierliche Inbetriebnahme der Weihnachtsbeleuchtung von Clifton zu lesen.
Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal weglaufen würde. Ich hätte nie gedacht, dass das nötig sein könnte.
3
Ray ging in den dritten Stock hinauf, wo das unbändige Tempo der Bereitschaftsräume den stillen, mit Teppichböden ausgelegten Büros jener Beamten wich, die entweder im Innendienst arbeiteten oder beim CID tätig waren. Besonders abends war Ray gerne hier, denn dann konnte er endlich den liegengebliebenen Papierkram auf seinem Schreibtisch abarbeiten, ohne gestört zu werden. Er ging durch den offenen Raum zum Büro des DIs, das man in einer Ecke vom Raum abgetrennt hatte.
»Wie ist das Briefing gelaufen?«
Ray zuckte unwillkürlich zusammen. Er drehte sich um und sah Kate an ihrem Schreibtisch sitzen. »Die Vier ist meine alte Schicht, weißt du? Ich hoffe, sie haben wenigstens so getan, als würde sie das interessieren.« Sie gähnte.
»Es war ganz gut«, sagte Ray. »Die sind schon okay, und wenigstens vergessen sie es so nicht.« Ray hatte dafür gesorgt, dass der tödliche Unfall und die Fahrerflucht für eine ganze Woche auf der Tagesordnung geblieben waren, doch irgendwann war etwas anderes wichtiger geworden und der Fall drohte bereits in Vergessenheit zu geraten. Ray tat sein Bestes, um jede Schicht daran zu erinnern, dass die Kriminalpolizei noch immer ihre Hilfe brauchte. Er tippte auf seine Uhr. »Was machst du eigentlich um die Zeit noch hier?«
»Ich wollte nur die Meldungen durchgehen, die nach den Aufrufen in den Medien reingekommen sind«, antwortete Kate und klopfte auf einen Stapel Computerausdrucke. »Nicht, dass uns das etwas nützen würde, aber …«
»Gibt es wirklich nichts, was wir uns mal näher ansehen sollten?«
»Null«, antwortete Kate. »Ein paar Leute haben irgendwelche Raser gesehen. Andere faseln selbstgerecht was von Verletzung elterlicher Aufsichtspflicht, und dann sind da noch die üblichen Deppen und Irren, einschließlich eines Typs, der was vom Jüngsten Gericht erzählt hat.« Sie seufzte. »Wir brauchen einen Durchbruch, irgendetwas, das uns weiterbringt.«
»Ich weiß, das ist frustrierend«, sagte Ray, »aber halt durch. Es wird sich schon was ergeben. Das ist immer so.«
Kate stöhnte und schob den Stuhl zurück. »Offenbar bin ich nicht mit Geduld gesegnet.«
»Das kenne ich.« Ray setzte sich auf die Tischkante. »Das ist der langweilige Teil der Ermittlungsarbeit. Den bekommt man im Fernsehen nie zu sehen.« Er grinste Kate reumütig an. »Aber das Ergebnis ist die Sache wert. Überleg mal: Inmitten dieses Stapels Papier könnte sich der Schlüssel zu dem Fall verbergen.«
Zweifelnd ließ Kate ihren Blick über den Schreibtisch wandern, und Ray lachte.
»Komm«, sagte er. »Ich mache uns jetzt erst einmal eine Tasse Tee. Dann helfe ich dir.«
*
Sie schauten sich jeden einzelnen Ausdruck an, fanden aber nicht die entscheidende Information, auf die Ray gehofft hatte.
»Na ja«, seufzte er. »Wenigstens können wir das schon mal abhaken. Danke, dass du so lange geblieben bist.«
»Glaubst du, wir werden den Fahrer finden?«
Ray nickte. »Wenn wir selbst nicht daran glauben, wie sollen die Leute dann Vertrauen in uns haben? Ich habe schon Hunderte Fälle bearbeitet, und natürlich blieben einige auch ungelöst. Aber ich habe immer fest daran geglaubt, dass die Lösung hinter der nächsten Ecke lauerte.«
»Stumpy hat gesagt, du hättest Crimewatch um Hilfe gebeten.«
»Ja«, bestätigte Ray. »Bei Fahrerflucht ist das nicht ungewöhnlich – besonders nicht, wenn es sich bei dem Opfer um ein Kind handelt. So eine Fernsehshow kann echte Emotionen wecken. Und die nachgestellten Szenen bei Crimewatch bringen erstaunlicherweise einiges an Erinnerungen bei Zeugen zutage. Ich fürchte nur, dass bedeutet noch viel mehr davon.« Er deutete auf den riesigen Stapel Ausdrucke, der jetzt nur noch Futter für den Schredder war.
»Ist schon okay«, sagte Kate. »Ich kann die Überstunden gut gebrauchen. Letztes Jahr habe ich mir meine erste Wohnung geleistet, und um ehrlich zu sein, habe ich an den Raten arg zu knabbern.«
»Lebst du allein?« Ray fragte sich, ob er heutzutage so etwas noch fragen durfte. Inzwischen trieb man es mit der »Political Correctness« so weit, dass man besser allem Privatem aus dem Wege ging. Wenn das so weiterging, durften die Leute in ein paar Jahren überhaupt nicht mehr miteinander reden.
»Meistens«, antwortete Kate. »Die Wohnung gehört mir, aber mein Freund ist häufig da. Eine optimale Kombi.«
Ray nahm sich die leeren Becher. »Nun denn«, sagte er. »Dann solltest du jetzt wohl besser nach Hause gehen. Dein Freund fragt sich sicher schon, wo du steckst.«
»Ach, das ist schon okay. Er ist Koch«, erwiderte Kate, stand aber trotzdem auf. »Er hat schlimmere Schichten als ich. Was ist mit dir? Verzweifelt deine Frau nicht an deinen Arbeitszeiten?«
»Sie ist daran gewöhnt«, antwortete Ray und sprach lauter, um das Gespräch fortführen zu können, während er sich sein Jackett aus dem Büro holte. »Sie war auch bei der Polizei. Wir haben zusammen angefangen.«
Im Ausbildungszentrum der Polizei in Ryton-on-Dunsmore hatte es nur wenige Lichtblicke gegeben, doch die billige Bar war definitiv einer davon gewesen. Bei einem besonders schmerzhaften Karaoke-Abend hatte Ray Mags bei ihren Klassenkameradinnen sitzen sehen. Sie hatte den Kopf zurückgeworfen und über irgendetwas gelacht, das eine Freundin gesagt hatte. Als Ray sah, wie sie aufstand, um zur Theke zu gehen, kippte er rasch sein noch fast volles Pint herunter, damit er sich zu ihr gesellen konnte. Doch als er neben ihr stand, hatte er einen Kloß im Hals. Glücklicherweise hatte es Mags nicht auch die Sprache verschlagen, und den Rest ihres sechszehnwöchigen Kurses waren sie unzertrennlich gewesen. Ray unterdrückte ein Grinsen, als er sich daran erinnerte, wie er sich damals um sechs Uhr morgens aus der Frauenkaserne geschlichen hatte.
»Wie lange bist du schon verheiratet?«, fragte Kate.
»Fünfzehn Jahre. Nach der Probezeit haben wir direkt Nägel mit Köpfen gemacht.«
»Aber sie ist nicht mehr dabei?«
»Nach Toms Geburt hat Mags eine Pause eingelegt, und als dann auch noch unsere Jüngste kam, ist sie einfach zu Hause geblieben«, erzählte Ray. »Doch Lucy ist jetzt neun und Tom gerade in die weiterführende Schule gewechselt. Deshalb denkt Mags darüber nach, wieder arbeiten zu gehen. Sie will sich zur Lehrerin umschulen lassen.«
»Warum hat sie denn so lange nicht mehr gearbeitet?« In Kates Augen funkelte echte Neugier, und Ray erinnerte sich daran, dass Mags sich das kurz nach der Ausbildung auch nicht hatte vorstellen können. Mags’ Sergeant hatte den Dienst quittiert, um Kinder zu bekommen, und Mags hatte Ray erklärt, sie verstehe einfach nicht, warum jemand Karriere machte, nur um dann alles wieder aufzugeben.
»Sie wollte für die Kids da sein«, sagte er. Irgendwie fühlte er sich schuldig. Hatte Mags das wirklich gewollt? Oder hatte sie schlicht das Gefühl gehabt, das müsse so sein? Externe Kinderbetreuung war so teuer, dass ihnen diese Entscheidung damals ganz selbstverständlich erschienen war. Außerdem wusste Ray, dass Mags an all den wichtigen Tagen dabei sein wollte, bei der Einschulung und zum Erntedank. Doch Mags war genauso klug und fähig wie er … sie hatte sogar mehr auf dem Kasten, wenn er ehrlich war.
»Ich nehme an, wenn man jemanden mit so einem Job heiratet, dann muss man auch die beschissenen Umstände akzeptieren.« Kate schaltete die Schreibtischlampe aus, und kurz standen sie im Dunkeln, bis Ray den Flur betrat und das Licht dort automatisch ansprang.
»Das nennt man wohl Berufsrisiko«, stimmte Ray ihr zu. »Wie lange bist du schon mit deinem Freund zusammen?« Sie gingen zum Hof, wo sie ihre Autos geparkt hatten.
»Erst knapp sechs Monate«, antwortete Kate. »Allerdings ist das schon ziemlich gut für mich. Für gewöhnlich mache ich schon nach ein paar Wochen wieder Schluss. Meine Mutter sagt immer, ich sei zu wählerisch.«
»Was stimmt denn mit den Männern nicht?«
»Ach, alles Mögliche«, erklärte Kate fröhlich. »Der eine klammert zu viel, der andere zu wenig. Der eine hat keinen Sinn für Humor, der andere ist einfach nur albern …«
»Du scheinst mir in der Tat ziemlich kritisch zu sein«, warf Ray ein.
»Vielleicht.« Kate rümpfte die Nase. »Aber das ist doch wichtig, oder? Den Richtigen zu finden, meine ich. Letzten Monat bin ich dreißig geworden. Meine Uhr tickt.« Sie sah nicht wie dreißig aus, allerdings war Ray noch nie gut darin gewesen, das Alter von jemandem einzuschätzen. Wenn er in den Spiegel schaute, dann sah er noch immer den Mann, der er in seinen Zwanzigern gewesen war, auch wenn die Falten in seinem Gesicht eine andere Geschichte erzählten.
Ray griff in die Tasche und suchte nach seinen Schlüsseln. »Wie auch immer«, sagte er. »Überstürz es nicht mit dem Sesshaftwerden. Es ist nicht alles eitel Sonnenschein, weißt du?«
»Danke für den Rat … Dad.«
»Hey! So alt bin ich nun auch wieder nicht.«
Kate lachte. »Danke für deine Hilfe heute Abend. Bis morgen.«
Ray musste schmunzeln, als er seinen Wagen aus der Parkbucht lenkte. Dad! Also wirklich … Was für ein freches Gör.
*
Als er zuhause ankam, saß Mags im Wohnzimmer, und der Fernseher lief. Sie trug eine Pyjamahose und dazu eines von Rays alten Sweatshirts. Die Beine hatte sie untergeschlagen wie ein Kind. Ein Nachrichtensprecher fasste gerade den Fall des überfahrenen Jungen für jene Bürger zusammen, die die ausführliche Berichterstattung letzte Woche aus irgendeinem Grund versäumt hatten. Mags schaute zu Ray hinauf und schüttelte den Kopf. »Ich kann einfach nicht wegschauen. Der arme Junge.«
Ray setzte sich neben sie und griff nach der Fernbedienung, um den Ton auszustellen. Auf dem Bildschirm erschien eine alte Aufnahme vom Tatort, und Ray sah seinen eigenen Hinterkopf, als er und Kate aus dem Wagen stiegen. »Ich weiß«, sagte er und legte den Arm um seine Frau. »Aber wir schnappen den Täter schon.«
Wieder wechselte das Bild, und Rays Gesicht erschien, als er eine Erklärung vor der Kamera abgab.
»Glaubst du wirklich? Habt ihr denn schon irgendwelche Spuren?«
»Nicht wirklich.« Ray seufzte. »Niemand hat den Unfall beobachtet … oder zumindest meldet es niemand. Also müssen wir uns auf die Kriminaltechnik und die Pathologie verlassen.«
»Ist es vielleicht möglich, dass der Fahrer gar nicht bemerkt hat, was er angerichtet hat?« Mags setzte sich auf und drehte sich zu Ray um. Ungeduldig schob sie sich das Haar hinters Ohr. Seit Ray sie kannte, trug Mags die gleiche Frisur: lang und glatt, kein Pony. Ihr Haar war genauso dunkel wie Rays, im Gegensatz zu ihm hatte sie jedoch keine grauen Strähnen. Kurz nach Lucys Geburt hatte Ray versucht, sich einen Bart stehenzulassen, doch nach drei Tagen hatte er wieder aufgehört, als sich herausstellte, dass es mehr Salz als Pfeffer sein würde. Jetzt war er stets glattrasiert und versuchte, die weißen Sprenkel an den Schläfen zu ignorieren, die Mags als »distinguiert« bezeichnete.
»Unmöglich«, antwortete Ray. »Der Junge ist direkt auf der Motorhaube aufgeschlagen.«
Mags zuckte noch nicht einmal. Ihr eben noch mitfühlender Blick war einem konzentrierten Gesichtsausdruck gewichen, den er von ihrer gemeinsamen Zeit auf Streife nur allzu gut kannte.
»Außerdem«, fuhr Ray fort, »hat der Wagen angehalten, zurückgesetzt und gewendet. Der Fahrer hat vielleicht nicht gewusst, dass Jacob tot war, aber er hat unmöglich übersehen können, dass er ihn erwischt hatte.«
»Habt ihr euch schon in den Krankenhäusern umgehört?«, fragte Mags. »Vielleicht hat der Fahrer sich ja auch verletzt, und …«
Ray lächelte. »Wir kümmern uns darum. Versprochen.« Er stand auf. »Bitte, versteh mich nicht falsch, aber es war ein langer Tag, und ich will jetzt einfach nur ein Bier, mich ein wenig vor die Kiste hocken und dann ins Bett.«
»Klar«, erwiderte Mags kurz angebunden. »Du weißt ja … Alte Gewohnheiten und so …«
»Ich weiß, und ich verspreche dir, dass wir den Fahrer schnappen werden.« Ray küsste sie auf die Stirn. »Das tun wir immer.« Ray erkannte, dass er Mags genau das Versprechen gegeben hatte, das er Jacobs Mutter nicht hatte geben wollen, denn er konnte so etwas beim besten Willen nicht garantieren. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, hatte er ihr stattdessen gesagt. Er hoffte nur, dass das reichen würde.
Ray ging in die Küche, um sich etwas zu trinken zu holen. Es war die Tatsache, dass es sich bei dem Opfer um ein Kind handelte, was Mags so aufregte. Vielleicht war es ja doch keine so gute Idee gewesen, ihr die Details des Unfalls zu schildern. Immerhin fand Ray es selbst schon schwer genug, seine Gefühle unter Kontrolle zu behalten. Also war es nur verständlich, dass Mags genauso empfand. Er beschloss, seine Zunge fortan besser im Zaum zu halten.
Ray kehrte mit seinem Bier ins Wohnzimmer zurück und setzte sich neben Mags, um Fernsehen zu schauen. Sofort schaltete er um, von den Nachrichten zu einer der Doku-Soaps, von der er wusste, dass Mags sie mochte.
*
Als er mit einem Stapel Akten, die er sich im Postraum geschnappt hatte, in seinem Büro eintraf, ließ Ray den Papierkram einfach auf seinen ohnehin schon überladenen Schreibtisch fallen, wo der ganze Stapel wegrutschte und auf den Boden fiel.
»Scheiße«, knurrte er und starrte leidenschaftslos auf seinen Schreibtisch. Die Putzfrau war da gewesen, hatte den Mülleimer geleert und halbherzig versucht, um das ganze Chaos herum Staub zu wischen, sodass jetzt Staubflocken an Rays Ablage klebten. Zwei Becher mit kaltem Kaffee flankierten seine Tastatur, und mehrere Post-it-Zettel, die von unterschiedlich dringenden Anrufen kündeten, hingen am Monitor. Ray nahm sie ab und klebte sie auf den Deckel seines Terminkalenders, wo ihn bereits ein pinkfarbener Zettel daran erinnerte, dass er noch die Beurteilungen für sein Team schreiben musste. Als hätten sie nicht schon genug zu tun. Ray hatte schon immer mit der alltäglichen Bürokratie zu kämpfen gehabt, die sein Job mit sich brachte. Allerdings schaffte er es auch nicht, sich dagegen zu wehren – nicht wenn die nächste Beförderung so verführerisch nahe war –, aber er würde auch nie lernen, es einfach zu akzeptieren. Für ihn war jede Stunde, die er damit verbrachte, sich um seine Karriere zu kümmern, verschwendete Zeit – besonders, wenn es darum ging, den Tod eines Kindes aufzuklären.
Während Ray darauf wartete, dass sein Computer hochfuhr, kippte er den Stuhl nach hinten und betrachtete Jacobs Foto, das an die gegenüberliegende Wand gepinnt war. Ray hatte immer ein Bild der Person in Sichtweite, die im Mittelpunkt einer Ermittlung stand. Das hatte er von Anfang an so gemacht, seit er bei der Kriminalpolizei angefangen und sein Sergeant ihn daran erinnert hatte, dass es ja ganz toll sei, wenn er jetzt in Schlips und Kragen herumliefe, aber dabei dürfe er nie vergessen, »wofür wir diesen Scheiß hier machen«. Früher hatten die Fotos auf seinem Schreibtisch gelegen, bis Mags vor ein paar Jahren in sein Büro gekommen war. Sie hatte ihm etwas vorbeigebracht – Ray wusste nicht mehr, was es gewesen war, vielleicht eine vergessene Akte oder etwas zu essen. Aber er erinnerte sich noch genau daran, dass er über die Störung verärgert gewesen war, als sie von der Rezeption aus bei ihm angerufen hatte, um ihn zu überraschen. Doch dann hatte sich sein Ärger in Schuldgefühle verwandelt, denn ihm war bewusst geworden, welche Mühe Mags auf sich genommen hatte, um ihn zu sehen. Auf dem Weg zu Rays Büro hatten sie einen kurzen Zwischenstopp eingelegt, damit Mags ihren alten Schichtleiter begrüßen konnte, der inzwischen zum Superintendent aufgestiegen war.
»Ich wette, es fühlt sich seltsam an, wieder hier zu sein«, hatte Ray bemerkt, als sie in seinem Büro angekommen waren.
Mags lachte. »Es ist, als wäre ich nie weg gewesen. Einmal Polizist, immer Polizist, du weißt schon.« Ihre Augen strahlten, als sie durch Rays Büro ging, und sanft strich sie mit den Fingern über seinen Tisch.
»Wer ist die andere Frau?«, neckte sie ihn und griff nach dem Foto, das an dem gerahmten Bild von ihr und den Kindern lehnte.
»Ein Opfer«, antwortete Ray, nahm Mags das Foto wieder ab und stellte es auf seinen Schreibtisch zurück. »Ihr Freund hat siebzehn Mal auf sie eingestochen, weil sie den Tee zu spät aufgesetzt hat.«
Wenn Mags das schockierte, so zeigte sie es zumindest nicht. »Du lässt das nicht in der Akte?«
»Ich habe es gern da, wo ich es sehen kann«, sagte Ray. »So vergesse ich nicht, warum ich all die Überstunden mache.« Mags nickte. Manchmal war ihm gar nicht klar, wie gut sie ihn verstand.
»Aber nicht direkt neben unserem Bild. Bitte, Ray.« Mags streckte die Hand wieder nach dem Foto aus und schaute sich nach einem passenderen Ort dafür um. Schließlich fiel ihr Blick auf die ungenutzte Korktafel im hinteren Teil des Büros. Sie nahm sich eine Stecknadel aus dem Glas auf Rays Schreibtisch und befestigte das Bild der lächelnden toten Frau mitten auf der Tafel.
Und da war es dann geblieben.
Der Freund der lächelnden Frau war schon lange wegen Mordes verurteilt worden, und andere Opfer hatten ihren Platz eingenommen: der alte Mann, der von Teenagern ausgeraubt und grün und blau geprügelt worden war; die vier Frauen, die von einem Taxifahrer vergewaltigt worden waren … Und jetzt hing da ein Bild von Jacob in seiner Schuluniform, wie er über das ganze Gesicht strahlte. Für all diese Menschen war nun Ray verantwortlich. Er überflog die Notizen, die er sich am Abend zuvor gemacht hatte, und bereitete sich auf das morgendliche Briefing vor. Sie hatten nicht viel, womit sie etwas hätten anfangen können. Als sein Rechner piepte, um ihm mitzuteilen, dass er hochgefahren war, schüttelte sich Ray. Er brauchte einen klaren Kopf. Ja, sie hatten nicht gerade viele Spuren, aber es gab dennoch einiges zu tun.
*
Kurz nach zehn kamen Stumpy und sein Team in Rays Büro. Stumpy und Dave Hillsdon setzten sich auf die beiden Sessel am Kaffeetisch, während die anderen sich an die Wand stellten. Den dritten Sessel überließen die Männer der anwesenden Dame, doch Ray registrierte amüsiert, dass Kate das Angebot ignorierte und sich neben Malcolm Johnson an die Wand lehnte. Ihre Gruppe war kurzfristig um zwei Mann von der Bereitschaftspolizei aufgestockt worden. Allerdings schienen sich die beiden Männer in ihren geliehenen Anzügen ziemlich unwohl zu fühlen.
»Morgen, zusammen«, begann Ray. »Ich will euch nicht lange aufhalten. Zunächst einmal will ich euch Brian Walton und Pat Bryce von der Bereitschaftspolizei vorstellen. Es ist schön, euch dabeizuhaben, Jungs, und es gibt viel zu tun. Haltet euch also einfach ran.« Brian und Pat nickten zur Bestätigung. »Okay«, fuhr Ray fort. »Der Zweck dieses Briefings ist es, noch einmal durchzugehen, was wir über den Unfall in Fishponds wissen, und uns zu überlegen, wie wir weiter vorgehen wollen. Wie ihr euch vorstellen könnt, sitzt der Chief uns ganz schön im Nacken.« Er schaute auf seine Notizen, obwohl er sie auswendig kannte. »Um 16:28 Uhr am Montag, den 26. November, ging ein Notruf von einer Frau in der Enfield Avenue ein. Sie hatte einen lauten Knall gehört und dann einen Schrei. Als sie schließlich draußen war, war schon alles vorbei, und die Mutter kauerte mitten auf der Straße neben ihrem Sohn. Nach sechs Minuten traf der Krankenwagen ein, und Jacob wurde noch vor Ort für tot erklärt.«
Ray hielt kurz inne, um seinen Kollegen Zeit zu geben, den Ernst der Ermittlungen zu verstehen. Er schaute zu Kate, doch ihr Gesichtsausdruck verriet keine Emotionen, und er wusste nicht, ob er traurig oder erleichtert sein sollte, dass sie so schnell einen Schutzmechanismus entwickelt hatte. Und sie war nicht die Einzige, die ungerührt zu sein schien. Für einen Unbeteiligten konnte es so wirken, als würde der Tod des kleinen Jungen die Polizei nicht kümmern. Dabei wusste Ray ganz genau, wie tief sie alle das traf. Er fuhr mit dem Briefing fort.
»Jacob ist letzten Monat fünf geworden, kurz nachdem er in St Marys in der Beckett Street eingeschult worden ist. Am Tag des Unfalls hat Jacob nach der Schule noch eine AG besucht, während seine Mutter gearbeitet hat. Ihrer Aussage zufolge befanden sie sich auf dem Heimweg und haben sich über den Tag unterhalten, als sie kurz Jacobs Hand losließ und er über die Straße zu ihrem Haus rannte. Laut ihrer Aussage hat er das schon öfter getan. Da er jedoch den Verkehr noch nicht richtig einschätzen konnte, hat seine Mutter ihn immer festgehalten, wenn sie an einer Straße waren.« Außer dieses eine Mal, fügte Ray in Gedanken hinzu. Sie hat nur einen Augenblick lang nicht aufgepasst, und das wird sie ihr ganzes Leben lang bereuen. Ray schauderte unwillkürlich.
»Was hat sie von dem Wagen gesehen?«, fragte Brian Walton.
»Nicht viel. Sie behauptet, anstatt zu bremsen, habe der Wagen sogar noch beschleunigt, bevor er Jacob getroffen habe, und sie selbst sei ihm nur knapp entkommen. Sie ist tatsächlich gestürzt und hat sich dabei verletzt. Die Beamten vor Ort haben ihre Verletzungen bemerkt, doch sie hat jede ärztliche Hilfe abgelehnt. Phil, kannst du uns noch mal den Tatort beschreiben?«
Phil Crocker, der einzige Uniformierte im Raum, war ein Unfallspezialist, und dank seiner jahrelangen Erfahrung auf der Straße war er Rays bester Mann, wenn es um Verkehrstote ging.
»Da gibt es nicht viel zu sagen.« Phil zuckte mit den Schultern. »Aufgrund des nassen Wetters haben wir keine Reifenspuren, und deshalb kann ich weder die Fahrzeuggeschwindigkeit einschätzen noch sagen, ob der Wagen vor dem Aufprall abgebremst hat. Gut zwanzig Meter von der Unfallstelle entfernt haben wir ein Stück Plastik sicherstellen können, und die Kriminaltechnik hat bestätigt, dass es vermutlich vom Nebelscheinwerfer eines Volvos stammt.«
»Das klingt ermutigend«, sagte Ray.
»Ich habe Stumpy die Details gegeben«, sagte Phil. »Aber ich fürchte, abgesehen davon habe ich nicht viel.«
»Danke, Phil.« Ray griff wieder nach seinen Notizen. »Bei der Autopsie wurde festgestellt, dass Jacob an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma gestorben ist. Außerdem hatte er mehrere Knochenbrüche einschließlich einer gebrochenen Wirbelsäule.« Ray hatte der Autopsie selbst beigewohnt, doch weniger, um die Beweiskette sicherzustellen, als vielmehr, weil er die Vorstellung nicht ertragen konnte, dass Jacob allein in der kalten Leichenhalle lag. Er hatte zugeschaut, ohne etwas zu sehen, und dabei Jacobs Gesicht gemieden. Stattdessen hatte er sich auf die Fakten konzentriert, mit denen der Chefpathologe sein Diktiergerät im Stakkato gefüttert hatte. Sie hatten beide aufgeatmet, als es endlich vorbei gewesen war.
»Den Aufprallspuren nach zu urteilen, suchen wir nach einem kleinen Fahrzeug. Also können wir Vans und SUVs ausschließen. Der Pathologe hat Glassplitter in Jacobs Körper gefunden, aber wenn ich richtig verstanden habe, kann man die nicht mit einem bestimmten Fahrzeug in Verbindung bringen … Stimmt doch, Phil, oder?« Ray schaute zu dem Unfallspezialisten. Phil nickte.
»Das Glas an sich ist nicht fahrzeugspezifisch«, erklärte Phil. »Hätten wir einen Verdächtigen, könnten wir vermutlich ähnliche Partikel auf seiner Kleidung finden. Die kann man so gut wie gar nicht loswerden. Aber wir haben kein Glas am Tatort gefunden, was nahelegt, dass die Windschutzscheibe durch den Aufprall gerissen, aber nicht zerbrochen ist. Wenn ihr das Auto für mich findet, können wir das Glas mit den Splittern im Opfer abgleichen, aber ohne …«
»Aber so können wir doch wenigstens bestätigen, was für Schäden das Fahrzeug davongetragen hat«, warf Ray in dem Versuch ein, dem Wenigen, was sie hatten, etwas Positives abzugewinnen. »Stumpy, was haben wir bis jetzt alles gemacht?«
Der DS schaute an die Wand von Rays Büro, wo eine Reihe von Karten, Tabellen und Flipcharts die Ermittlungen illustrierten. »Noch am selben Abend sind wir von Haus zu Haus gegangen und haben die Anwohner befragt. Am folgenden Tag haben wir dann die vernommen, die am Abend zuvor nicht da waren. Mehrere Leute haben etwas gehört, was sie als ›lauten Knall‹ bezeichnet haben, gefolgt von einem Schrei, doch niemand hat den Wagen gesehen. Die Beamten, die die Schulwege sichern, haben mit den Eltern gesprochen, und wir haben in den angrenzenden Straßen der Enfield Avenue Briefe eingeworfen, die Zeugen auffordern, sich zu melden. An den Laternen hängen immer noch die Plakate, und Kate geht ein paar Anrufen nach, die wir daraufhin bekommen haben.«
»Und? Ist dabei was Nützliches herumgekommen?«
Stumpy schüttelte den Kopf. »Es sieht nicht gut aus, Boss.«
Ray ignorierte den Pessimismus. »Wann läuft der Fall bei Crimewatch?«
»Morgen Abend. Wir haben den Unfall rekonstruiert, und sie haben ein paar Bilder hinzugefügt, die zeigen, wie das Fahrzeug ausgesehen haben könnte. Anschließend bringen sie noch ein Studiointerview mit dem DCI zu dem Thema.«
»Ich brauche einen Freiwilligen, der Überstunden macht, um den besten Hinweisen nachzugehen, die nach der Sendung reinkommen«, sagte Ray zu seinem Team. »Den Rest können wir dann später in aller Ruhe abarbeiten.« Es folgte eine lange Pause, und Ray ließ erwartungsvoll den Blick über sein Team schweifen. »Irgendjemand muss …«
»Mir macht das nichts aus.« Kate hob die Hand, und Ray lächelte sie anerkennend an.
»Was ist mit dem Nebelscheinwerfer, den Phil erwähnt hat?«, fragte Ray.
»Volvo hat uns die Teilenummer übermittelt, und wir haben eine Liste aller Werkstätten, an die das Ersatzteil in den letzten zehn Tagen geschickt worden ist«, erklärte Phil. »Ich habe Malcolm angewiesen, sie zu kontaktieren, angefangen mit denen in der unmittelbaren Umgebung. Er soll sich die Nummern aller Fahrzeuge geben lassen, bei denen der Nebelscheinwerfer seit dem Unfall erneuert worden ist.«
»Okay«, sagte Ray. »Lasst uns das im Hinterkopf behalten, wenn wir weiter nachfragen, aber vergesst nicht, dass das nur ein einzelnes Beweisstück ist. Selbst wenn wir ein entsprechendes Fahrzeug finden, können wir nicht sicher sein, dass es auch das richtige ist. Wer kümmert sich um die Überwachungskameras?«
»Wir, Boss.« Brian Walton hob die Hand. »Wir haben uns alles besorgt, was wir bekommen konnten: nicht nur das Material der städtischen Kameras, sondern auch das von Läden, Tankstellen, Banken und so weiter. Wir beschränken die Suche auf eine halbe Stunde vor und nach dem Unfall. Trotzdem sind es noch Hunderte Stunden Material.«
Ray zuckte unwillkürlich zusammen bei dem Gedanken, was die bevorstehenden Überstunden für das Abteilungsbudget bedeuteten. »Zeigt mir die Liste der Kameras«, sagte er. »Wir können unmöglich alles durchgehen. Also müssen wir Prioritäten setzen.«
Brian nickte.
»So. Dann haben wir ja genug zu tun«, sagte Ray und lächelte trotz aller Bedenken. Inzwischen lag die »goldene Stunde« – also die Zeitspanne unmittelbar nach einem Verbrechen, in der die Aussichten auf Erfolg am größten waren – schon vierzehn Tage zurück, und obwohl das Team schon unzählige Überstunden angehäuft hatte, waren sie noch keinen Schritt weitergekommen. Ray hielt kurz inne, bevor er seinen Leuten die schlechte Nachricht übermittelte. »Es wird euch sicher nicht überraschen zu hören, dass bis auf Weiteres aller Urlaub gestrichen ist. Tut mir leid. Ich will versuchen, es so zu drehen, dass ihr wenigstens über Weihnachten ein wenig Zeit mit euren Familien verbringen könnt.«
Ein verärgertes Raunen ging durch den Raum, als sie Rays Büro verließen, doch niemand beschwerte sich, und Ray wusste, dass sie das auch später nicht tun würden. Auch wenn es keiner von ihnen aussprach, sie dachten alle daran, wie Weihnachten dieses Jahr wohl für Jacobs Mutter sein würde.
4
Kaum habe ich Bristol hinter mir gelassen, gerät mein Entschluss ins Wanken. Bis jetzt habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht, wohin es eigentlich geht. Ich fahre blind in Richtung Westen, vielleicht nach Devon oder Cornwall. Wehmütig erinnere ich mich an die Ferien in meiner Kindheit, als ich mit Eve Sandburgen am Strand gebaut habe, das Gesicht verklebt von Eis am Stiel und Sonnencreme. Und die Erinnerung zieht mich zum Meer, weg von den großzügigen Alleen Bristols und weg vom Verkehr. Ich empfinde eine fast körperliche Angst vor diesen Autos, die es gar nicht erwarten können, uns zu überholen, als der Bus die Haltestelle anfährt. Eine Weile wandere ich ziellos umher. Dann gebe ich einem Mann am Fahrkartenschalter der Überlandbusse zehn Pfund. Ihn kümmert es genauso wenig wie mich, wohin ich fahre.
Wir überqueren die Severn Bridge, und ich schaue auf das trübe, wirbelnde Wasser des Bristol Channel hinunter. In dem großen Bus ist alles ruhig und anonym, und hier liest niemand die Bristol Post, und niemand redet von Jacob. Ich lehne mich zurück. Ich bin erschöpft, doch ich wage es nicht, die Augen zu schließen. Wenn ich schlafe, höre und sehe ich wieder den Unfall, und mich quält das Wissen, dass all das nicht passiert wäre, wenn ich nur ein paar Minuten früher da gewesen wäre.