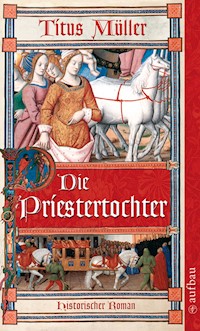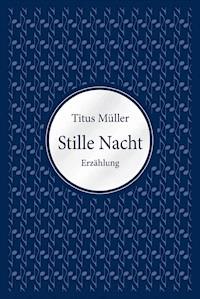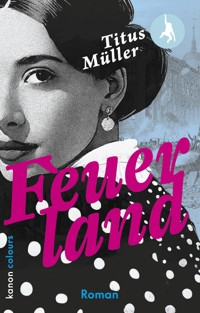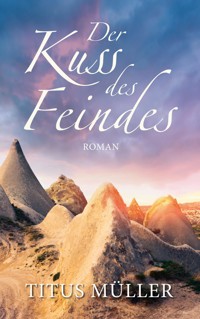Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der Stille der Bibliothek arbeitet Stefan an seiner Mappe fürs Kunststudium. Als ihm dort Lenja begegnet, wagt er es nicht, sie anzusprechen. Stattdessen zeichnet er sie. Die beiden lernen sich kennen, und Lenja nimmt ihn - den Atheisten - mit in ihre Kirchengemeinde. Aber sie warnt ihn: "Erwarte nicht, dass du Gott vorgeführt bekommst." Das Umfeld von Lenja glaubt nicht daran, dass diese Beziehung eine Zukunft hat - zu verschieden sind die beiden. Doch dann stürzt Lenja in eine tiefe Glaubens- und Lebenskrise. Stefan beschließt kurzerhand, für sie die Schönheit des Glaubens wiederzufinden ... Eine warmherzige Erzählung über große Fragen, die Liebe und die Kraft des Glaubens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über den Autor
Titus Müller studierte in Berlin Literatur, Mittelalterliche Geschichte, Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Mit 21 Jahren gründete er die Literaturzeitschrift „Federwelt“. Titus Müller ist Mitglied des PEN-Clubs und wurde u. a. mit dem „C. S. Lewis-Preis“ und dem „Sir Walter Scott-Preis“ ausgezeichnet. Seine Bücher werden regelmäßig zu Bestsellern.
ERSTER TEIL
Die Reise
Vor acht Monaten
Die Gehwege und Straßen waren weiß, und die Autos auf der vierspurigen Otto-Suhr-Allee fuhren langsam, wie verträumt. Berlin flüsterte. Immer noch fiel Schnee, die Flocken verharrten in der Luft, schwebten, wurden hierhin und dorthin getragen, bis sie sich behutsam auf einem Briefkasten oder einem Fensterbrett niedersetzten.
Ich nahm diese Behutsamkeit in mich auf wie eine Medizin. Wenn die Woche vorbei ist, habe ich viele unfreundliche Kunden erlebt. Leute, die zu mir an die Kasse kommen und mich anblaffen: „Handschuhe?“
Wenn ich antworte: „Sie wollen wissen, ob wir Handschuhe haben? Leider nicht“, dann drehen sie sich wortlos um, als wäre ich ein Ding, eine gefühllose Maschine, die keine Höflichkeit verdient hat.
Bin ich am Ende der Woche hundertmal grundlos beleidigt, angeschnauzt oder verachtet worden, brauche ich ein paar Stunden Ruhe. Ich zeichne, und bald geht es mir besser. Ich kann mich wieder spüren, bin wieder ich selbst.
Auch an diesem Freitag war meine Seele wund. Ich betrat die Bibliothek. Nicht, um mir Bücher auszuleihen, sondern um zu zeichnen.
Früher hatte ich mir noch ein Buch aus dem Regal geholt und es vor mich hingelegt, um ein Alibi zu haben, bevor ich mit dem Zeichnen begann. Inzwischen brauchte ich das nicht mehr. Die Bibliothekarinnen kannten mich. Ich war still. Ich störte niemanden.
An diesem Tag war die Stimmung in der Bibliothek besonders. Alle hatten ein Leuchten im Gesicht, wie Kinder bei der Bescherung an Heiligabend. Sie hatten den Winter flüstern gehört. Ich klopfte mir den Schnee vom Mantel, hängte ihn an die Garderobe und ging leise zu meinem Lieblingsplatz. Ich rieb meine kalten Hände aneinander, dann schlug ich den Zeichenblock auf. Die Bleistifte bewahrte ich in einer alten, abgeschrammten Metalldose auf, zusätzlich in einen Lappen gewickelt, damit die Spitzen nicht abbrachen. Für die ersten Linien nahm ich einen harten Bleistift und zeichnete den Umriss einer Tannenmeise. In Berlin sah man im Winter eher Rotkehlchen, Gimpel und Sperlinge. Aber selten, am Stadtrand, bekam man auch eine Tannenmeise zu Gesicht. Wenn der Schnee alles bedeckte, brauchten die Vögel Futter von freundlichen Menschen. Das machte sie auch sichtbar.
Ich war zu einem weichen Bleistift gewechselt und gab den Schwanzfedern mit dicken Strichen die charakteristische Färbung, als ich aufblickte und du an mir vorübergingst. Du hattest die helle Latzhose an, und deine schmalen Hände hielten einen Bücherstapel, den du zur Ausleihe brachtest – Romane, und zwar gewichtige. Als du bei der Ausleihe ankamst, legtest du die Bücher ab und strichst dir das Haar hinter das Ohr. Ich habe nie etwas Schöneres gesehen als dich an diesem Tag.
Du packtest die Bücher in deinen Stoffbeutel und gingst zur Tür, und als du gerade im Begriff warst, hindurchzutreten, drehtest du dich zu mir um.
Es war uns beiden unangenehm. Erst schlugst du die Augen nieder, dann ich. Kurz darauf warst du weg. Da war nur noch die hohe Schwingtür mit den Messingknäufen, die leise nachwippte.
Eine Stunde lang habe ich dich gezeichnet.
Das flaue Gefühl im Magen hörte nicht auf. Ich stand auf und ging zur Bibliothekarin. Ich war schon rot, bevor ich überhaupt den Mund aufgemacht hatte. „Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wie die junge Frau heißt, die vor einer Stunde Romane ausgeliehen hat? Die mit der Latzhose?“
Sie sah mich fragend an.
Ich wäre am liebsten gestorben. Nach einigem Zögern schlug ich meinen Zeichenblock auf und zeigte ihr die Zeichnung.
Sie nahm den Block und strich sanft über das Papier. „Meine Güte. Du musst an die Uni. Du musst Kunst studieren.“
„Hab ich versucht. Ich wurde nicht genommen.“
„Versuch’s noch mal.“
„Können Sie mir sagen, wie sie heißt?“
„Jede Frau sollte jemanden haben, der sie so zeichnet.“
Ich schwieg.
Sie sah mich mitleidig an. „Ich darf dir den Namen nicht sagen.“
„Verstehe.“ Mir war heiß vor Scham. Ich ging zurück zu meinem Platz und packte meine Sachen zusammen.
Als ich an ihr vorbei zum Ausgang ging, sagte die Bibliothekarin: „Sie kommt immer donnerstags.“
Ich stoppte. „Aber heute ist Freitag.“
„Das wundert mich auch. Sie ist zum ersten Mal an einem Freitag da gewesen.“
Ich bedankte mich und trat durch die großen Türen des Rathauses nach draußen. Die kalte, klare Luft schlug mir auf die Wangen. Ich atmete tief ein und war froh, am Leben zu sein.
Das Charlottenburger Rathaus mit seinem Turm und den großen alten Fenstern wirkte, als wäre es aus einer anderen Zeit. Du warst hier langgegangen, unter den vielen Spuren im Schnee waren auch deine.
Dass es dich gab, dass ich dich gesehen hatte, änderte alles. Du warst Berlinerin. Du warst Teil dieser Stadt gewesen, ohne dass ich es gewusst hatte.
Ich tauschte meinen Dienst bei der Arbeit, um am Donnerstag freizubekommen. Dann zitterte ich auf diesen Tag hin. Mit weichen Knien ging ich in die Bibliothek. Ich konnte mich nicht auf meine Zeichnungen konzentrieren. Die Stunden verstrichen, ich blieb bis um sieben, bis die Bibliothek geschlossen wurde. Du kamst nicht.
Alles erschien mir eigenartig in diesen Tagen. Die Zahnpasta schmeckte anders. Die Lieder im Radio klangen, als wären sie extra für mich ausgewählt worden. Und ich hatte den Eindruck, dass die Kunden im Supermarkt freundlicher geworden waren.
Als es wieder Donnerstag war und ich an der Ausleihe vorbeikam, winkte mich die Bibliothekarin zu sich und sagte leise: „Sie war am Freitag da.“ Sie lächelte und hob die Augenbrauen.
Am Freitag hatte ich Schicht bis um acht, ich konnte nicht in die Bibliothek, aber für die Folgewoche tauschte ich die Dienste, sodass ich am Freitag dort sein konnte.
Ich setzte mich an meinen gewohnten Platz, zeichnete die schönste Blaumeise, die mir unter diesen Umständen gelingen konnte, und sah jedes Mal hoch, wenn jemand durch die Eingangstür kam. Dann warst du da. Deine anziehende Fremdheit war beinahe zu viel für mich. Ich wagte kaum, dich anzusehen.
Du gingst zwischen die Regale, bliebst dort eine Weile. Als du ein Buch in einem Regal in meiner Nähe suchtest, drehtest du dich unvermittelt zu mir um und sagtest leise: „Du zeichnest?“
Mein Mund war so trocken, dass ich nur nicken konnte.
„Darf ich es sehen?“
Ich hielt dir den Block hin.
Dieses Lächeln!
Ich sagte: „Der Schnabel ist zu kurz. Und die Flügel müssten –“
„Was zeichnest du noch?“
Hatte die Bibliothekarin dir etwa von mir erzählt? Hatte sie verraten, dass ich dich gezeichnet hatte? Ich klappte den Block zu. „Tannenmeisen“, brachte ich heraus. „Und Rotkehlchen.“
Als ich nach Hause kam, brannte ich innerlich. Ich ging auf und ab. Später wälzte ich mich schlaflos und unruhig im Bett.
Ich aß kaum etwas an jenem Wochenende. Zeichnete dich viermal, immer mit ernstem Gesicht, ich konnte dich nicht mit einem Lächeln zeichnen.
Am Montag bei der Arbeit fragten sie mich, ob ich krank sei. „Geh nach Hause“, sagte der Chef, „du steckst sonst alle an.“
Ich schlich nach Hause und legte mich aufs Bett. Am Dienstag riss ich mich zusammen und ging arbeiten, genauso am Mittwoch, am Donnerstag. Freitags saß ich wieder in der Bibliothek.
Aber auch du warst erschrocken über unsere Begegnung. An diesem Freitag hast du mir nur einmal kurz zugenickt, wir sprachen kein Wort miteinander.
Hatte die Bibliothekarin vielleicht doch nicht geplaudert? Sie besaß ein gutes Herz. Sie würde mich doch nicht so bloßstellen. Ich ärgerte mich. Du hattest mich angesprochen, und ich hatte das Gespräch vermasselt. Wie sollte ich jetzt ein neues beginnen?
In der nächsten Woche traute ich mich zu fragen: „Wie heißt du eigentlich?“
Du hobst den Blick. Deine braunen Augen musterten mich. „Lenja. Und du?“
In diesem Moment hätte ich gern einen außergewöhnlichen Namen gehabt, so wie Lenja der beste, der schönste Name auf der Welt war. Gern hätte ich geantwortet: Amadeus. Milo. Janosch. Aber mir blieb nur die Wahrheit. „Stefan.“
„Wartest du auf jemanden?“, fragtest du.
„Nein, wieso?“ Mir schlug das Herz bis zum Hals.
„Weil du hier in der Bibliothek zeichnest. Warum machst du das nicht zu Hause?“
„Hier ist es still. Und aufgeräumt.“
Du lachtest leise.
Ich fragte: „Und du studierst Deutsch?“ Ich hatte erspäht, was dein Leseprogramm war: Lion Feuchtwanger, Alfred Döblin, Hans Fallada. Zu Hause hatte ich die Namen gegoogelt.
„Hey!“ Du gabst mir einen Knuff in die Seite. „Da passt aber jemand genau auf, was ich lese.“
Ich wurde rot, aber du hast mich angestrahlt.
Immer war ich unsichtbar gewesen, hatte mich als Außenseiter gefühlt. Jetzt bekam ich dieses Lächeln geschenkt. Es verwirrte mich. Hob mich empor und wirbelte mich herum.
Später spazierten wir gemeinsam aus der Bibliothek. Du erzähltest mir, dass du Mathe studierst und dass dir die klassischen Autoren einfach gefallen. Jeder, der uns hörte, hätte unser Plaudern für ein Allerweltsgespräch gehalten. Für uns war es das nicht. Vorsichtig tasteten wir uns mit Worten voran und versuchten zu ergründen, wer wir waren.
Heute
Eine Durchsage scheppert aus den Lautsprechern. Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Damen und Herren. Das Geschnatter der Passagiere am Gate verebbt, jetzt horchen alle auf. Auch ich. Die Stimme verkündet: Ihr Flug nach Thessaloniki ist heute ausgebucht. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und zu Ihrem Komfort bitten wir alle Fluggäste der Economy Class, nur ein Stück Handgepäck mit an Bord zu nehmen.
Ein griechisches Mädchen spricht begeistert auf sein Telefon ein. Es hält sich das Smartphone vor den Mund, als wollte es davon abbeißen wie von einer schwarzen Waffel, und diskutiert mit strahlenden Augen mit seinem unsichtbaren Gegenüber.
Mein Handy schweigt. Du schreibst nicht. Es wäre Wahnwitz, dich anzurufen. Trotzdem schwebt mein Finger über der Kurzwahltaste, die deine Nummer wählt.
Wir dürfen uns anstellen, um ins Flugzeug zu steigen, und die Leute drängeln zum Durchlass. Jeder hat bereits den Zettel mit der Nummer seines Sitzplatzes in der Hand. Schneller im Flugzeug zu sein, bringt nichts. Doch die Meute drängt trotzdem voran.
Ich werde durch den schmalen Korridor zum Flugzeug geschoben. Hier stehen der Co-Pilot und ein Steward. Wahrscheinlich beneiden sie die Kollegen, die anstelle von Menschen nur Fracht transportieren, Post oder Medikamente oder Schnittblumen. Ihr Begrüßungslächeln kann mich nicht täuschen. Es stammt noch aus einer Zeit, in der das Fliegen Luxus war.
Im Flugzeuginneren dudelt Musik, sie klingt nach einer Fernsehserie aus den Sechzigern. Dazu pfeifen die Turbinen, der Pilot testet die Triebwerke. Die Leute stopfen ihr Gepäck in die Fächer. Die seichte Musik soll darüber hinwegtäuschen, dass es ungemütlich ist, in einer Blechbüchse mit hundert fremden Leuten und pfeifenden Turbinen festzustecken.
Ich habe einen Fensterplatz. Draußen werden Koffer auf das Laufband geworfen, ziemlich grob, jedem Gepäckstück gucke ich hinterher. Da ist ein roter Koffer, er sieht aus wie deiner. Ich stelle mir vor, wie es wäre, wenn du neben mir im Flugzeug sitzen würdest.
Ich öffne die Mappe mit den Tickets und ziehe das Foto hervor. Ein kleines Steingebäude im Gebirge des Olymps. Davor du, blond, im strahlenden Sonnenschein. Damals waren wir gerade zusammengekommen. Eure Reise war schon gebucht gewesen. Vielleicht saßt du mit Sophie im gleichen Flieger wie ich jetzt. Ich habe mir immer eingebildet, du hättest für mich verliebt in die Kamera gesehen. Ein Blick aus Griechenland nach Berlin. Vielleicht warst du damals wirklich in Gedanken bei mir.
Die Gepäckschlepper fahren weg, das Flugzeug ist bereit. Wir rollen an die Startbahn heran. Als wir sie erreichen, verstummt die Dudelmusik. Auch die Leute werden still. Sie müssen einsehen, dass das Fliegen keine Nebensächlichkeit ist. Ich schnalle mich an. Ohne die Musik ist es besser. Jetzt fühle ich mich als Passagier wieder ernst genommen.
Nach einem kurzen Moment der Ruhe dröhnen die Turbinen los. Das Flugzeug brettert über die Startbahn. Ich gebe das ganze Leben auf, wie man das beim Fliegen tun muss, jeder muss die Kontrolle abgeben, bis auf die Piloten. Das Rütteln endet und wir heben ab. Erstaunlich schnell gewinnen wir an Höhe. Ich sehe die Flughafengebäude kleiner werden.
Wie viel Land die Stadt umgibt, verblüfft mich. Das, was mir wie die Welt erscheint, ist nur ein Fleckchen aus Stahl und Beton, umgeben von endlosen Wäldern, Wiesen und Äckern. Dazwischen spannen sich Straßen über das Land.
Ein Gewicht setzt sich auf meine Brust. Müsste ich nicht eher eine Leere fühlen? Aber ich kriege keine Luft, ich vermisse dich und die ganze Welt mit dir.
Ich hole meinen Block aus dem Handgepäck und zeichne.
Vor siebeneinhalb Monaten
Du wolltest mich deinen Freunden vorstellen. Ich war noch nicht so weit, wir kannten uns ja kaum.
Als wir reinkamen, erschrak ich. So viele Jungs. Jeder von denen war heimlich in dich verschossen, da war ich sicher. Sie umarmten dich zur Begrüßung, sie durften das. Ich hätte nicht mal gewagt, deinen Arm zu streifen.
Es schien ihnen selbstverständlich, dass die schönste Frau der Welt mich mitbrachte. Aber du ließt auch nicht erkennen, dass wir etwas Besonderes füreinander waren. Ich hätte genauso gut eine lockere Bekanntschaft von der Straße sein können.
Wir spielten Tabu. Es gab lautes Gelächter. Nur einmal wurde es still, als ich einen Begriff durch eine Zeichnung erklären sollte. Sie sahen verblüfft auf das Blatt, während ich strichelte, und dann sahen sie nicht mehr mich an, sondern dich, als würden sie plötzlich begreifen, dass ich nicht bloß als Kumpel hier war.
„Hast du gewusst, dass er das kann?“, fragte dich Alex, in dessen Wohnung wir waren.
Ich habe kurz hochgesehen, in dein Gesicht. Da war ein Anflug von Röte auf deinen Wangen. Unsere Blicke trafen sich. Ich las ein wenig Stolz darin, es gefiel dir, dass deine Freunde mich bewunderten. Und Zuneigung fand ich in deinem Blick.
Das Spiel ging weiter, andere kamen an die Reihe, und dann wieder ich, und diesmal sollte ich etwas vorführen. Mein Begriff hieß: Skispringen. Meine Körperbewegungen waren steif. Ich kam mir dumm und ungeschickt vor.
Den anderen schien es nichts auszumachen, sich zu blamieren. Wieso wart ihr so vertraut miteinander? Es ging über eine lockere Freundschaft hinaus, auf mich wirkte es, als wärt ihr schon gemeinsam in den Kindergarten gegangen. Ich nahm meinen Mut zusammen und fragte, woher ihr euch kennt.
Ihr saht euch an. Offensichtlich war euch die Frage unangenehm – als gäbe es da ein Geheimnis, eine Peinlichkeit. Schließlich sagte Alex: „Aus der Kirchengemeinde.“ Es klang gewollt locker, und gerade dieser Versuch, dem Umstand das Besondere zu nehmen, machte mich aufmerksam.
Ihr habt weiter gemeinsam gelacht, habt auf dem Sofa gelümmelt, die Jungs haben Chips gefuttert. Ein paarmal hast du mir merkwürdige Blicke zugeworfen. Was ging hinter deiner Stirn vor? Wie gern hätte ich deine Gedanken gelesen und gewusst, was du fühlst und denkst.
Als du in die Küche gingst, um den Wasserkrug nachzufüllen, folgte ich dir. „Du glaubst an Gott?“, fragte ich.
Du schwiegst und ließt das Wasser aus der Leitung in den Krug rauschen. Dann war der Krug voll. Sacht stelltest du ihn ab und drehtest dich zu mir um.